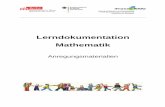Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur: Entstehen und Verdrängen...
Transcript of Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur: Entstehen und Verdrängen...

BerWissGesch 5,53-74 (1982)
Fritz Krafft
Berichte zur WISSENSCHAFTSGESCHICHTE © Akademische Verlagsgesellschaft 19R2
Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur*
Entstehen und Verdrängen teleologischer Denkweisen in den exakten Naturwissenschaften
Summary: Considering teleology you have to distinguish between an ,internal' objective ("interne Finalität"), which determines single processes, and an ,external' objective ("externe Finalität"), which governs the whole of nature, so that everything has a purpose. Furthermore a difference exists between (natural) expediency and (subjective) ftxing of aims. In science (which is a course of spoken action) only the fixing of aims by man is possible, because science has no internal aim, towards which it can develop (and it is not to be understood from a definite state at a given time, for instance the present, as an aim).
Aristotle unlike Christian Aristotelism still doesn't know an ,external' expediency of nature (externe Finalität), but he does know an ,internal' objective of single processes in nature. Only after Aristotelian physics were transformed into a form of Christian science, did the idea of an external expediency arise, which originated in the fixing of a general aim by God. In this way Philoponos came up with his theory of impetus concerning natural movements, a theory which had already been discussed for several centuries regarding ,violent' movements.
The conception of an external objective suppressed the real Aristotelian conception of an internal objective of single processes, because it would contradict God's omnipotence, if the course of a single process was strictly determined. This suppression is exemplified in detail by the theory of horror vacui and by the development from the theory of impetus to the idea of ,universal gravitation'. The subsequently prevailing conception of a (transcendental) external objective ( that is to say the conception, that the aims of the creation were fixed through God's providence) on its part disappeared in the course of the eighteenth century, because by degrees natural ( causal-mechanical) explanations were found
* Ergänzender Beitrag zum XIX. Symposium der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, "Die Idee der Zweckmäßigkeit in der Geschichte der Wissenschaften, 28.-30. Mai 1981 in Bamberg, überarbeitete Fassung eines Vortrages im Rahmen des Forschungskolloquiums "Teleologisches Denken" des Instituts ftir Philosophie, Wissenschaftstheorie, Wissenschafts- und Technikgeschichte der Technischen Universität Berlin (WS 1980/81) am 10. Februar 1981, der inzwischen abgedruckt ist bei H. Poser (wie Anm. 1), S. 31-59. Vgl. auch den Bericht über dieses Kolloquium von H.-J. Engfer: Teleologisches Denken, seine Bedeutung ftir die empirischen Wissenschaften und seine Rolle in der Philosophie. Ein Bericht und eine These.Berichte zu Wissenschaftsgeschichte 5 (1982), 143-152.

54 Fritz Krafft
for single phenomena, which formerly could not be explained as having arisen naturally and therefore were attributed to God's wise decree. - What remains is nature (and natural science) whithout any aim, that is to say without any sense.
Zusammenfassung: Neben dem Unterschied zwischen einer ,internen' Finalität, die den Einzelprozeß deterministisch bestimmt, und einer ,externen' Finalität, die als allgemeine Zweckmäßigkeit die gesamte Natur durchwaltet, besteht auch ein Unterschied zwischen Zielgerichtetheit/Zweclcmäßigkeit (in der Natur) und (subjektiver) Zielsetzung. Eine Wissenschaft als sprachliche Handlungsform kann demnach nur eine Zielsetzung durch den Menschen erfahren, sie entwickelt sich nicht auf ein inneres Ziel hin (ist also auch nicht von einem bestimmten Stand wie dem der Gegenwart her als Ziel zu verstehen).
Eine allgemeine Zweckmäßigkeit (externe Finalität) kennt Aristoteles im Gegensatz zum christlichen Aristotelismus noch nicht, wohl aber eine ,interne' Finalität des natürlichen Einzelprozesses. Erst der Versuch einer christlich orientierten Umformung der aristotelischen Physik läßt die Idee einer von Gott gesetzten ,externen' Zweckmäßigkeit auflcommen. Auf diese Weise entsteht bei Philoponos die Impetustheorie für ,natürliche' Bewegungen (die für ,gewaltsame' Bewegungen schon seit mehreren Jahrhunderten diskutiert worden war).
Die Vorstellung von der externen Finalität unterdrückte die genuin aristotelische von der ,internen' Finalität des Einzelprozesses, dessen streng determinierter Ablauf der Allmacht Gottes widerspreche. Dieser Verdrängungsprozeß wird am Beispiel der Theorie vom ,horror vacui' und des Weges von der Impetus-Theorie zur Idee der Allgemeinen Gravitation dargestellt. Die danach dominierende Vorstellung von der ,externen' Finalität (als der durch Gottes Vorsehung zweckmäßig gemachten Schöpfung) geht im Laufe des 18. Jahrhunderts dann wegen der Transzendierung auf etwas Außernatürliches (Gott) deshalb verloren, weil einzelne Phänomene, die noch nicht als natürlich entstanden erklärt werden konnten und daraufhin auf Gottes weisen Ratschluß zurückgeführt wurden, nach und nach eine natürliche (kausal-mechanische) Erklärung fanden. -Zurück bleibt eine Natur (und Naturwissenschaft) ohne Zweck, und das heißt: ohne Sinn.
Schlüsselwörter: Aristotelismus, Bewegungslehre (aristotelische), Christlicher Aristotelismus, Finalität (interne/externe), horror vacui, Impetustheorie, Teleologie, Teleonomie, Wissenschaftstheorie und Teleologie, Zielsetzung (in der Wissenschaft), Zweclcmäßigkeit, Zwecksetzung; Aristoteles, Johannes Philoponos, Immanuel Kant, Johannes Kepler; Antike, Mittelalter, XVII Jh., XVIII Jh.
I. Einleitung
I 1. Teleologie und Wissenschaftstheorie
Die analytische Wissenschaftsmethodologie, die sich Wissenschaftstheorie nennt, kann natürlich dadurch, daß sie gegenwärtig in jeweils ausgewählten Forschungsbereichen angewandte Methodik in abstrahierter und idealisierter Form als normatives Kriterium auch der Geschichte der Wissenschaften wie ein speziell strukturiertes Netz überstülpt, das nur für solche Fakten durchlässig ist, die den vorgegebenen Strukturen entsprechen, einerseits nicht deren Richtigkeit durch ,historische Fallstudien' beweisen; andererseits unterstellt sie damit aber dem Wissenschaftsfortgang als ,fortschrittlicher Entwicklung' insgesamt offensichtlich auch gerade das teleologische Element, das sie wegen des metaphysischen Charalcters als Denkansatz ihrem Objekt ,Wissenschaft' verweigert. Entstehen und Fortschritt von ,Wissenschaft' sollen nämlich aus der schrittweisen Eliminierung von Meta-

Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur 55
physik resultieren. Analytische ,Wissenschaftstheorie' enthält damit eine teleologische Prämisse -wäre also im Sinne der von ihr für eine Wissenschaftlichkeit angelegten Maßstäbe selber keine Wissenschaft; denn teleologisch orientierte Denkweisen gelten als ,vorwissenschaftlich'.
Die Wissenschaften haben sich nach Auffassung moderner Wissenschaftstheorie- ohne daß dieses in der Regel direkt ausgesprochen wird - auf ein Ziel hin entwickelt. Als ,Ziel' gilt den analytischen ,Wissenschaftstheorien' eine idealisierte Form des gegenwärtig erreichten Stadiums einer formalistisch strukturierten Erfahrungswissenschaft, also einer exakten Naturwissenschaft wie der Physik, während die konstruktivistischen Wissenschaftstheorien dieses Ziel als apriorivorgegeben setzen und dadurch scheinbar diejenigen Normen für eine Wissenschaftlichkeit gewinnen, die es erlauben sollen, über den Aufweis von Widersprüchlichkeiten hinaus korrigierend in die Methodik der Einzelwissenschaften eingreifen zu können. Ob dieses ,Ziel' der Wissenschaft beziehungsweise der Wissenschaftlichkeit (als ,Zweck' der Wissenschaft) aber als a priori gegeben oder als historisch erreicht und damit als a posteriori (empirisch) zu gewinnen aufgefaßt wird, in beiden Fällen wird es als ein die Wissenschaft(en) auch in ihrem historischen Fortgang bestimmendes Faktum deklariert. Wissenschaft hat danach nicht nur dieses ,Ziel' als Zweck, sie sei auch eh und je ,zweckmäßig' gewesen in dem Sinne, daß dieses Ziel das einzige und damit auch das beste sei und stets gewesen sei und sein werde. Die idealisierte gegenwärtige ,Wissenschaft' beziehungsweise die aus apriorischen Prinzipien abgeleitete "Wissenschaft" gilt somit jeweils als "vollkommen" im Sinne der aristotelischen €zm:"AEXEW'. (€v TEAH EXEL). Beider ,Wissenschaften' Ziele unterscheiden sich also gemäß den von Wolfgang Kulimann 1 für den Bereich der ,Natur' differenzierten Typen des aristotelischen TEAO<:-Begriffs nur insofern, als das ,Ziel' der Wissenschaft für die analytische ,Wissenschaftstheorie' zum Typ der "angestrebten und erreichten Ziele" gehört - im Sinne einer determinierenden natürlichen ,internen' Finalität insbesondere der Organismen/ aber auch anderer ,natürlicher' Körper des sublunaren Bereiches -, während das Ziel für die konstruktivistische Wissenschaftstheorie vom Typ der "angestrebten, aber letztlich unerreichbaren Ziele" ist - im Sinne der ,metaphysischen' Begründung des Ursprungs letztlich aller ,Bewegung' durch den Unbewegten Beweger (Gott) als telos.
Mit diesem Rekurs auf Aristoteles läßt sich meines Erachtens deutlicher als in langen Ausführungen darlegen, was ich sagen will - mit nur geringer Gefahr, mißverstanden zu werden. Die ,Wissenschaft' der Wissenschaftstheorien unterschiedlichster Ausrichtung (bis hin zur Struktur wissenschaftlicher Revolutionen Thomas S. Kuhns3
) stellt sich im Rahmen dieser Begrifflichkeit nämlich als natürlicher, gesetzlich determinierter und gerichteter Prozeß ,interner' Finalität dar. 4
Die strikte Orientierung an den exakten Erfahrungswissenschaften hat in meinen Augen dazu verführt, den aufgrund besserer Einsichten in die Komplexität und den Kontext (wieder) gewonnenen funktional-teleonomischen Aspekt natürlicher Prozesse und Strukturen auch auf die Entwicklung und das ,Ziel' der Wissenschaft von solchen natürlichen Prozessen selber zu übertragen: ,Wissenschaft' gilt in diesem Rahmen häufig als ein solcher natürlicher, ,zielgerichteter' dynamischer Prozeß; ihre ,interne' Finalität ftihre notwendig zur "Entelechie". Aufgabe des Naturforschers wäre danach nur noch die des aristotelischen artifex' 5 dessen der die Natur nachahmt", indem er in Kenntnis der ,Entelechie', d~s ,Ziel~s' seines Objektes, dessen natürlichen Prozeßverlauf in seinem Sinne fördernd nutzt und beschleunigt - aber natürlich nur in der von der ,internen Finalität' des Objektes deterministisch vorgegebenen (,naturgemäßen') Richtung. Um ein Beispiel im Sinne des Aristoteles zu geben: Die natürliche Eigenschaft des Eisens, seine Schwere, kann im Artefakt ,Hammer' nur in der naturgemäßen Richtung der ,Schwere' eingesetzt werden, sie kann nicht zur Veranlassung eines entgegengesetzt gerichteten SchwP-bens oder Steigens vervvendet werden.

56 Fritz Krafft
Meines Erachtens ist allerdings der gesamte, den meisten gegenwärtigen wissenschaftstheoretischen Überlegungen zugrundeliegende Ansatz falsch.6 ,Wissenschaft' ist nämlich nicht etwas natürlich Vorgegebenes -weder in platonisch-konstruktivistischem noch in aristotelisch-analytischem Sinne. Wissenschaft, auch exakte Erfahrungswissenschaft, ist nicht etwas, das der Mensch vorfindet, sie wird erst vom Menschen durch sein denkerisches und sprachliches Handeln hergestellt; sie ist ebenso wie die Technik ein Produkt des menschlichen Geistes- oder, wie es Matthias Gatzemeier jüngst thesenhaft formulierte 7 : "Wissenschaft ist zu verstehen als wissenschaftliches Tun, näherhin als Sprachhandlung bestimmter Art". Wissenschaftstheorie ist damit "die Theorie dieser Sprachhandlungen" oder "die Lehre von den Zielen ( = Teleologie) und von den Mitteln ( = Methodologie) bestimmter Sprachhandlungen", wobei die ,Teleologie' vor der ,Methodologie' untersucht werden müsse, weil das Ziel die Methoden bestimme. Gatzemeier tut dann gut daran, den Zweck, das Ziel der ,Wissenschaft', nicht, wie üblicherweise angesetzt wird, in der angestrebten ,gesicherten Erkenntnis' zu sehen, sondern vorzuschlagen, das die Methoden bestimmende Ziel mit "(möglichst) ,verläßliche Orientierung'" zu umschreiben.
Was er hier aus vorwiegend formalen Gründen vornimmt - denn: zur weiteren Be· stimmung dessen, was als ,gesichert' gelten solle, müsse man auf Methoden vorgreifen, die an dieser Stelle der wissenschaftstheoretischen Analyse noch gar nicht zur Verfügung stünden, sondern erst gewonnen werden müßten-, erweist sich auch aus anderen Gründen als recht sinnvoll. Der Begriff ,Orientierung' enthält nämlich bereits das Handeln im Hinblick auf ein Ziel. Ein solches Ziel ist aber nicht vorgegeben, sondern wird vom handelnden Wissenschaftler subjektiv - oder im Geltungsbereich einer ,scientific community' intersubjektiv- gesetzt. Die zum Erreichen dieses jeweils gesetzten Zieles anzuwendende Methodik muß deshalb, abgesehen von der allgemein geltenden Forderung nach Widerspruchsfreiheit, notwendig variieren.
Es ist deshalb nicht statthaft, von der durch ein gegenwärtig intersubjektiv anerkanntes Ziel einer einzelnen exakten Erfahrungswissenschaft bestimmten Methodik her normativ auf die Wissenschaftlichkeit anderer Wissenschaften oder älterer Formen der denselben Objektbereich betreffenden Wissenschaft zu schließen; denn die Methode ist zielbedingt, und das die Methode bedingende Ziel ist nicht nur objektbedingt, sondern auch von dem jeweiligen ,Historischen Erfahrungsraum' der zielsetzenden Menschen her. Dieser ,Erfahrungsraum', der die Erfahrungsweisen ermöglicht, ist seinerseits wiederum Änderungen unterworfen, die durch die unterschiedlichsten außer- und innerwissenschaftlichen Komponenten, die ihn konstituieren, bedingt sind.8 Aufgaben und Ziele einer Wissenschaft sind deshalb ebenfalls Änderungen unterworfen; sie sind nicht immer dieselben gewesen und müssen (werden) deshalb auch nicht die gegebenenfalls gegenwärtig anerkannten bleiben.
Die ,Orientierung' der Wissenschaft( en) kann auf reine Erkenntnis um ihrer selbst willen ausgerichtet sein; sie kann aber auch auf technische und/oder wirtschaftliche Nutzung aus sein; sie kann auch theologische, soziale, humane, pädagogische, ästhetische und andere Zielsetzungen enthalten. Alle diese Zielnuancen hat auch die Wissenschaft von der Natur einmal gehabt;9 sie brauchen sich nicht alle auszuschließen und haben deshalb zum Teil auch nebeneinander oder gemeinsam bestanden. Zu hoffen ist, daß gegenwärtige Tendenzen sich verstärkt durchsetzen und auch die Naturwissenschaften mit ihren technischen Anwendungen ökologische, aber auch wieder humane Zielsetzungen erfahren - was sich natürlich entsprechend auf die Methodik und die Art der Erkenntnisse auswirken würde.
Halten wir fest: Wissenschaft als solche ist stets eine Handlungsform. Eine Handlung setzt ein bewußt oderunbewußt vom Handelnden selbst gesetztes Ziel voraus. Ein solches

Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur 57
subjektiv gesetztes Ziel kann aber keine ,interne Finalität' zur Folge haben. Zufall und Glück, Mißgeschick und Unglück begleiten vielmehr die Suche nach dem ,Ziel'; mit anderen Worten: weder in ihrer Wirkung noch in der Notwendigkeit ihrer Zusammensetzung vorhersehbare inner- und außerwissenschaftliche Bedingungen und Voraussetzungen bestimmen den Weg zum selbstgesetzten Ziel; und ob durch die einzelnen Schritte eine Annäherung an dieses Ziel oder eine Entfernung von ihm erfolgt, läßt sich jeweils erst nachträglich feststellen. 10 Das besagt allerdings nicht, daß die einzelnen Schritte beim Fortgang von Wissenschaft unter einer bestimmten Zielsetzung und in ihrem Rahmen nicht jeweils auch kausal bedingt wären; nur ist diese kausale Bedingtheit nicht eine deterministisch im Sinne einer ,internen Finalität' bestimmte.
I. 2. Der ,moderne Aristoteles'
Man mag die Legitimität der Anwendung aristotelischer Begrifflichkeit anzweifeln; sollte dann aber bedenken, daß die ihr zugrundeliegende Erkenn- und Verstehbarkeit aristotelischer Teleologie erst durch modernste naturwissenschaftliche Denkweisen ermöglicht wurde. 11 Es ist nicht die Teleologie des Aristoteles der christlichen Spätantike und der Scholastik mit ihrer das gesamte Naturgeschehen durchwaltenden ,externen' Zweckmäßigkeit; es ist nicht die Teleologie des Aristoteles der Physikotheologie des Zeitalters der Aufklärung; und es ist nicht die Teleologie des Aristoteles des Vitalismus des 19. und des Neovitalismus des 20. Jahrhunderts, die ihm den Vorwurf eintrug, die ,Physik' als Biologie zu betreiben; sondern es ist die Teleologie des Aristoteles der Naturwissenschaft unserer Zeit mit ihren Struktur- und Funktionssystemen, mit Feld, Fließgleichgewicht und geschlossenen thermodynamischen Systemen, mit ,Teleonomie' und ,Selbstorganisation' -welch letzteres in meinen Augen von der Idee und dem Erkenntnis,zweck' her nichts anderes ist als das aristotelische ,telos', nur das die dahin führenden Kausalzusammenhänge anders und differenzierter gesehen werden.
Immerhin vermochte bereits 1960 ein guter Kenner des Aristoteles und moderner physikalischer Denkweisen, John H. Randall, 12 festzustellen, daß die Vorstellungen der aristotelischen Physik der heutigen physikalischen Theorie weit näher stehen als die des 19. Jahrhunderts.
Vor 30 Jahren [also ca. 1930] war es noch möglich, die Physik des Aristoteles als den am wenigsten wertvollen Teil seines Denkens zu betrachten, der lediglich von historischem Interesse sei. Heute gilt uns seine Analyse der Faktoren und Begriffe, die beim ,Prozeß' eine Rolle spielen, als einer der wertvollsten Teile seiner gesamten Philosophie, einer seiner erhellendsten und an fruchtbaren Anstößen reichsten Untersuchungen. Weit davon entfernt, offensichtlich ,falsch' zu sein, erscheint sie heute weitaus wahrer und besser begründet als die Grundbegriffe Newtons. Und es ist faszinierend, dem Gedanken nachzugehen, wie uns -wäre es dem 17. Jahrhundert möglich gewesen, Aristoteles zu rekonstruieren, statt sich von ihm abzuwenden- mehrere Jahrhunderte arger Verwirrungen und Irrsale hätten erspart bleiben können. [ ... ] Die funktionalen Begriffe des Aristoteles waren für die einfache Massenmechanik des 17. und 18. Jahrhundert nicht notwendig; sie wurden [ftir diesen Bereich] weitgehend aufgegeben, weil sie mit den verftigbaren mathematischen Techniken nicht zu bewältigen waren. Mit der Fortentwicklung der mathematischen Methodik und mit dem Vordringen der naturwissenschaftlichen Methoden in viel konkretere, reichere, weniger abstrakte Bereiche - wie den der Strahlungsenergie - sind wir gezwungen, zu den aristotelischen Begriffen von Funktion und Kontext zurückzukehren, diesmal freilich in exakter, analytischer und mathematischer Formulierung
- und eben hierin liegt natürlich der Grund für den ,Umweg' seit Galileo Galilei, Rene Descartes und Isaac Newton; diese Denk- und Erkenntnismethoden hätten auf der Basis aristotelischer ,Physik' gar nicht entstehen können. 13 Die Folge der Denkweisen moderner Physik ist aber dann, daß die daraufhin neu verstandene aristotelische Teleologie in begrifflichen Vorstellungen vom Fließgleichgewicht, von angestrebten Energieniveaus, von ,Teleonomie' und ,Selbstorganisation' wieder aufleben kann.

58 Fritz Krafft
Die ,Verdrängung' teleologischer Denkweisen in den exakten Naturwissenschaften selbst wird somit irgendwie mit dem natürlich verständlichen und notwendigen Unvermögen des 17. und 18. Jahrhunderts zusammenhängen, Aristoteles im Sinne der physikalischen Denkweisen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ,rekonstruieren' zu können. Das hängt nun aber andererseits größtenteils damit zusammen, daß die damals vorgefundene Teleologie des ,Aristoteles' die des Aristotelismus der mittelalterlichen und der Barock-Scholastik war, die überwunden werden mußte, um den Weg beschreiten zu können, der nach mehreren Jahrhunderten die Rückkehr zum ,Aristoteles' der Zeit vor dem Stoizismus und Neuplationismus, zum ,echteren' Aristoteles -jedenfalls aus heutiger Sicht - ermöglichte, der lediglich die einzelnen natürlichen Prozesse durch eine ,interne Finalität' im Sinne der Funktionalität bestimmt sein läßt, die ihrerseits allein deterministisch durch ,Kausalursachen' (causa efficiens) -teilweise sogar kausal-mechanischerreicht wird.
Das, was im 17. und wieder im 19. Jahrhundert als verdrängungswürdig erschien, war demgegenüber die Vorstellung von einer die ganze Natur durchwaltenden, gottgegebenen ,externen' Zweckmäßigkeit, wie sie Aristoteles selbst gar nicht ins Auge gefaßt hatte. Die ,interne' Finalität oder Zweckmäßigkeit eines Prozeßverlaufs war für den anorganischen Bereich noch nicht wieder entdeckt worden; und das ausgehende 19. Jahrhundert schien sie durch die Anpassung an physikalisch-mechanistische Denkweisen auch für den organischen Bereich eieminiert zu haben.
I 3. ,Interne' und ,externe' Finalität als ,subjektive' Zwecksetzung oder ,objektive' Zweckmäßigkeit
Es ist also für die ,Teleologie' zu unterscheiden zwischen einer Lehre von der ,internen' Finalität oder Zweckmäßigkeit (heute im organischen Bereich etwa als ,Teleonomie' bezeichnet) und einer Lehre von der den Einzelprozeß und -zustand darüberhinaus oder anstelle dessen bestimmenden ,externen' Zweckmäßigkeit (,Teleologie' im eigentlichen, das heißt: im allgemeinen, kritisierten Sinne). Wir haben aber neben der ,internen' und ,externen' Finalität auch noch zwischen einer Teleologie für subjektiv gesetzte und einer solchen ftir objektiv gegebene Ziele zu unterscheiden, zwischen ,Zwecksetzung' und ,Zweckmäßigkeit'. Erstere, die Zwecksetzung, beträfe in unserem Falle die ,Wissenschaft' als Handlungsform, letztere die Zweckmäßigkeit, wenn überhaupt, ihr Objekt; und diese ,Zweckmäßigkeit' könnte eine ,interne' oder eine ,externe' sein.
Wir werden uns im folgenden hauptsächlich nur noch mit den Vorstellungen von der Zweckmäßigkeit oder Zielgerichtetheit natürlicher Prozesse beziehungsweise der ,Natur' beschäftigen -und gehen dazu wiederum von Aristoteles aus, auch deshalb, weil sich aus der Umformung und Neuorientierung seiner Lehren diejenigen Vorstellungen ergaben, deren Verdrängungsprozeß wir verfolgen wollen.
H. Die Impetustheorie, eine christliche Erweiterung der ,internen' Finalität um eine von Gott gesetzte ,externe' Finalität
Auch für die Betrachtung der ,Physik' des Aristoteles ist in diesem Zusammenhang eine Beschränkung auf den unbeseelten, im späteren Sinne anorganischen Bereich erforderlich und hier sogar auf einen einzelnen der in der Neuzeit von den ,exakten' Naturwissenschaften erfaßten Anteile. Das erfolgt allerdings in dem Bewußtsein, daß eine solche trennende Isolierung für Aristoteles und damit eigentlich auch für einen Aristoteles-Interpreten nicht zulässig ist.

Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur 59
Die Schwierigkeit wird auch schon deutlich, wenn man bedenkt, daß die Äthersphären, aus deren ,natürlicher' Bewegung die Erscheinungen am Himmel resultieren, sich zwar ,selbst' bewegen, daß diese gleichfönnig kreisende Bewegung aber jeweils durch eine dem Ätherkörper zugehörige (einteilige) Seele (intelligentia) bewirkt wird -jedenfalls nach dem vermutlich von Aristoteles später eingefügten Kapitel MetaphysikA 8. 14 Daß es sich dabei um ein Grenzproblem aristotelischer Physik handelt, geht aber schon daraus hervor, daß hier der einzige Fall vorliegt, bei dem eine ,natürliche Bewegung' kein erreichbares Ziel hat und (deshalb) nicht zur ,Ruhe' im Ziel kommen kann, das ,Ziel' also stets außerhalb des bewegten Körpers bleibt. Die Äthersphären erreichen deshalb eigentlich nie ihre ,Vollkommenheit', sie sind nie "am Ziel" (ev TEAEL EXELV: Entelechie) -und sie verbleiben deshalb im Zustand der ,Bewegung', allerdings allein der ,Ortsbewegung'. Die ,Ruhe am Ziel' ist aber generell das Ehrwürdigere denn die ,Bewegung zum Ziel' als Prozeß der ,internen' Finalität. Gott, die ,finale' causa, die von den Sphärenseelen mittels der gleichförmigen Rotationsbewegung ihrer Sphärenkörper ,erstrebt' wird, ist selber unbewegt, ständige und deshalb höchste ,Entelechie', der ,Unbewegte Beweger'. Die in sich geschlossene gleichförmige Bewegung am Orte, welche die Sphären ausführen, ist nur eine Quasi-Ruhe. Da eine durchgängige externe Zweckmäßigkeit der ,Natur' bei Aristoteles selbst fehlt/ 5 ist ein strenger Dualismus zwischen irdischem, sublunaren und ätherischhimmlischem, supralunaren Bereich die Folge.
Ein ,Unbewegter Beweger' ist im Rahmen eines ,geschlossenen' Systems, wie es der aristotelische Kosmos darstellt, schon deshalb erforderlich, weil eine ,regressio ad infinitum' nur so vermieden werden kann. Gemeinsam mit den ,Bewegungen' im irdischen, sublunaren Bereich kommt den Äthersphärenbewegungen nämlich zu, daß "alles Bewegte notwendigerweise von etwas bewegt wird"16 -wobei das Bewegende (der Beweger) bei natürlichen, ,naturgemäßen' Bewegungen im Bewegten selbst ist, bei erzwungenen, ,naturwidrigen' Bewegungen außerhalb des Bewegten. Die intelligentia, welche die letzte, die Fixsternsphäre (kausal) bewegt, bedarf auch ihrerseits eines ,Bewegers'; dieser besitzt, damit er nicht seinerseits wieder eines Bewegers bedarf, keinen materiellen Körper und ist deshalb beziehungsweise daraufhin unbewegt.
Eine Folge dieser physikalischen Bewegungslehre ist, daß eine erzwungene (vom Menschen ,künstlich' erzeugte und verursachte) Bewegung in dem Augenblick erlöscht und in die ,naturgemäße' Bewegung umschlägt, in dem der äußere Bewegungsantrieb aufhört einzuwirken. Die Schwierigkeiten, die Aristoteles daraufhin mit der Erklärung einer Wurfbewegung hatte, und seine Lösung des Problems sind allgemein bekannt. An die Stelle dieser Lösung mittels einer sukzessiven übertragung der ,Bewegungskraft' von der Hand des Werfers auf das vom Geschoß durchflogene Medium trat später die Impetustheorie:
Allerdings ist diese Impetustheorie nicht, wie allgemein angenommen wird, zur Lösung dieses Problems von Johannes Philoponos und den Nominalisten des 14. Jahrhunderts, Johannes Buridanus und Nicole von Oresme, entwickelt worden. Sie ist aber wohl auch nicht veranlaßt worden durch die spezielle sozio-ökonomische Diskussion im Alexandria des 6. Jahrhunderts, wie Michael Wolff jüngst von marxistisch orientiertem Standpunkt her zu zeigen suchte. 17 Es ist sicherlich nicht unrichtig, daß die auf christlich-theologischer Ebene ausgetragene Diskussion zwischen den Dyophysiten und Monophysiten auch den von Wolff herausgestrichenen sozio-ökonomischen Charakter hatte; aber es ist kaum zutreffend anzunehmen, daß der Monophysit Philoponos die naturphilosophische Impetustheorie nur deshalb erfand, um ein Feld für eine gefahrlose Begründung seines politischen und theologischen Standpunktes zu erhalten. Das würde zum einen eine argumentative Trennung von Philosophie, Ökonomie und ,Physika' von einander und von der Theologie voraussetzen, die erst im 17. Jahrhundert einsetzt; kein Christ vermoc.hte bis ins 19. Jahrhundert (sieht man von den deshalb in Nord- und Zentraleuropa ver-

60 Fritz Krafft
botenen Averroisten ab) eine Physik zu vertreten, die zumindest nach eigener Einschätzung anerkannten christlichen Glaubenssätzen widersprach, und umgekehrt mußten zumindest bis ins ausgehende 16. Jahrhundert auch diese Glaubenssätze ein philosophischnaturwissenschaftliches Fundament haben -und zwar weniger aus Furcht vor Verfolgung denn aus Überzeugung. Allein hieraus erldärt sich auch die erstmals radikale Umorientierung, die der Christ Philoponos nach einer langen und intensiven Tradition der Aristoteleskommentierung in Alexandria bezüglich der Erklärung der ,naturgemäßen' Bewegungen durch die Impetustheorie vornimmt.
Die Impetustheorie selber ist allerdings sehr viel älter; für den ,Wurf' und den ,Fall' aus erzwungener Ruhelage war sie seit langem als überzeugende Alternative bekannt. Sie findet sich in Ansätzen bereits in den Quaestiones mechanicae von Aristoteles selbst; weiter entwickelt wurde sie im 2. vorchristlichen Jahrhundert von Hipparchos von Nikäa, dessen Ausflihrungen in der Schrift Über das sich aufgrund seiner Schwere nach unten Bewegende spätestens seit Beginn der intensiven Aristoteleskommentierung bei Alexandros von Aphrodisias (3. Jahrhundert n. Chr.) mehr oder weniger zustimmend zur Erklärung von Wurf und Fall auch im Rahmen der aristotelischen ,Physik' herangezogen wurden 18
- also zu Zeiten ( 4. oder 2. vor- und 3. nachchristliches Jahrhundert), als natürlich ganz andere sozio-ökonomische Situationen und Diskussionen herrschten als im 6. nachchristlichen Jahrhundert zur Zeit des Philoponos. Die Theorie des Hipparchos besagt, daß die ,Kraft' des Werfers dem Geschoß "eingeprägt" wird, daß dieser Impetus aber allmählich versiegt, bis die natürliche Tendenz des Fallens überwiegt. Was bei Philaponos neu ist, ist die Übertragung der Vorstellung von einer vom Werfer dem gewaltsam und widernatürlich bewegten schweren Gegenstand übertragenen (,eingeprägten') ,Kraft<~9
auf Bewegungsprozesse, die im Sinne des Aristoteles und der orthodoxen Aristoteliker ,von Natur aus', das heißt aufgrunddes eigenen inneren Antriebs zum ,Ziel' hin ablaufen. Neu ist also die übertragung der Impetustheorie von den ,gewaltsamen' auf die ,natürlichen' Ortsbewegungen. Grund dafür ist nicht eine spezielle sozio-ökonomische Situation, sondern der Umstand, daß Philoponos Christ ist:
Nach christlichem Glauben ist die Welt von Gott erschaffen worden- wie der Mensch als Gottes Ebenbild. Philoponos führt deshalb Platons OY/J.lWVPJ'OC: wieder ein, der jetzt aber wie ein JJ.Y/X(l'.VLKOC: und rexviTY/C: nicht nur plant, sondern auch ausführt. Die Ebenbildlichkeit des Menschen, für Platon nicht gegeben, läßt jetzt die Analogie zwischen der göttlichen Schöpfungstätigkeit und der menschlichen Tätigkeit des ,künstlichen' Erschaffens zu. Den im aristotelischen Sinne ,künstlichen' Prozessen der vom Menschen gegen das spontane natürliche Geschehen mechanisch bewirkten Bewegungen, wie zum Beispiel dem Wurf, können deshalb bezüglich der Verursachung die nach Aristoteles ,natürlichen' Bewegungen gleichgesetzt werden. Nur ist jetzt Gott der Verursacher; er prägt den ,natürlich' bewegten Körpern die ,Kraft' ein, dem fallenden Stein, dem steigenden Feuer, aber auch der rotierenden Äthersphäre - gerrau wie bei ,gewaltsamen' Bewegungen nach Hipparcl1os der Werfer dem Geschoß; denn da Gott (wie ftir Platon und die Stoiker) die Welt als beste erschaffen hat, ist ein physischer Dualismus in dieser Welt nicht mehr möglich. Aber ebenso wie der Mensch mit einer ,künstlich' verursachten Bewegung eine bestimmte Absicht verfolgt, ihr einen ,Zweck' setzt/0 so tut es Gott mit allen durch seinen Impetus verursachten Bewegungen. Alle diese göttlich verursachten, im alten Sinne ,natürlichen' Bewegungen haben damit einen Zweck, der von dem einen Gott gesetzt ist; die Einzelzwecke sind deshalb notwendig (weil allein sinnvoll) aufeinander abgestimmt. Gottes Zwecksetzung in der Schöpfung macht die Natur durch die von illm ,eingeprägten Kräfte' insgesamt zweckmäßig. Die göttliche Zweck.setzung wird ftir die ,Natur' zur ,externen' Zweckmäßigkeit- über die von ihm im Einzelprozeß gesetzte und damit ,natürlich' vorhandene ,interne' Zweckmäßigkeit hinaus.

Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur 61
Philoponos erreicht also durch die christliche Umorientierung der aristotelischen Bewegungslehre seiner Zeit, die schon die Impetustheorie für ,gewaltsame' Bewegungen beinhaltete, für den darüberhinaus weitgehend unverändert bleibenden Kosmos des Aristoteles eine allumfassende, ,externe' Zweckmäßigkeit, wie sie nur gemeinsam mit der Vorstellung von einem Schöpfergott auftreten kann21 -und, wenn dieses ein guter Gott ist, auch notwendig muß. Wir kennen eine solche göttliche Zwecksetzung und damit Zweckmäßigkeit der Schöpfung Natur deshalb etwa auch von Platon her und besonders ausgeprägt von den Stoikern mit ihrer Vorstellung von der alles natürliche Geschehen bestimmenden göttlichen Vorsehung (npovou:x)22
- und seit dem christlichen Aristoteliker Philoponos auch für den aristotelischen Kosmos.
Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, wenn die christlich orientierte ,physica' des lateinischen Mittelalters göttliche Vorsehung und allumfassende Zweckmäßigkeit in der belebten und unbelebten Natur walten läßt -sowohl in der mehr am platonischen Timaios orientierten Phase bis ins 12. Jahrhundert als auch in der von Neuplatonismus und Stoizismus geprägten und bis ins 17. Jahrhundert hineinragenden Phase des RenaissanceHumanismus aber auch - und zwar ohne den erst etwa seit 1500 wieder bekannt gewordenen Physik-Kommentar des Philoponos kennen zu müssen - im sogenannten Christlichen Aristotelismus seit dem 13. Jahrhundert, der die Basis für die ,physica' auch noch im 16. und teilweise noch im 17. Jaluhundert bildete.
Die ,externe' Zweckmäßigkeit brauchte dabei nicht jeweils expressis verbis programmatisch deklariert zu werden, zumal naturwissenschaftliche Fragestellungen seit dem 13. Jahrhundert vorwiegend im Zusammenhang mit der Kommentierung von aristotelischen Schriften sowie bezeichnenderweise im Rahmen der Kommentierung der Sentenzen des Petrus Lombardus abgehandelt wurden - im Gegensatz zu mathematischen Problemen, die aufgrund ihrer vorgegebenen Methodik auch dann, wenn sie einen Erfaluungsbereich betreffen, wie in der Astronomie und Optik, bald wie schon bei den Griechen und Arabern in eigenständigen, monographischen Schriften behandelt wurden. Aber hier geht es ja bei Erfahrungsbereichen lediglich um eine mathematische hypothetische Beschreibung der Phänomene, nicht um ihre Erklärung und physikalische Begründung, die unter Berufung auf Aristoteles ausgespart und dem ,philosophus' und ,physicus' überlassen wird. 23 Das hat Auswirkungen auf die ,Physik' des 17. Jahrhundert insofern, als der anfangs strikte quantitative Reduktionismus, die Beschränkung auf die Frage nach dem ,Wie' statt nach dem ,Warum', im älteren und eigentlichen Sinne ,physikalische' Fragestellungen weitgehend aus der Diskussion ausschloß. Gerade um diese geht es aber in unserem Zusammenhang, für den ich mich auf zwei Beispiele beschränken muß.
m. ,Interne' und ,externe' Zweckmäßigkeit der ,Natur'
!I/. 1. Vom Horror vacui zum atmosphärischen Luftdruck
Daß auch für das christliche Mittelalter nicht unbedingt Gott selber stets für die Einhaltung der Zweckmäßigkeit sorgen muß, da die ,Natur' so von ihm eingerichtet worden ist, zeigt das erste von zwei Beispielen, die Einführung des Begriffs ,horror vacui'. 24 Es geht hierbei um die Erklärung der Wirkweise von Klepshydren, Stech· und Saughebern, die Flüssigkeiten ,gegen die Natur' des Wassers, das sich als ,schwer' nach unten bewegt, heben.
Die aristotelische Erklärungsgrundlage daftir, daß nämlich Luft- und Wassersphäre naturgemäß an einander ,hängen', so daß bei ,gewaltsam' entfernter Luft in einem Saugheber das Wasser nachfolgt, ohne daß ein Vakuum entstehen könnte, bleibt bis ins 13.

62 Fritz Krafft
Jahrhundert bestehen -gelegentlich wie bei Aristoteles selber durch eine AntiperistasisLehre (ftir die causa efficiens) gestützt- wobei jedoch stets betont wird, daß weder das vermiedene Vakuum selbst, noch diese Antiperistasis (ixvmrepiamat~, iv.vm7Toooat~, 7Tcüuvopof.1U'~ Kivf/at~ und ähnliches) als bloße Beschreibung des Vorganges die Ursache ftir die Aufwärtsbewegung des Wassers sei. Eine neue und neuartige Erklärung erhält das Phänomen erst in der zweiten Hälfte dieses 13. Jahrhunderts durch den Franziskaner Roger Bacon, der sich besonders in seinen Werken Opus rnaius, Opus minus, Opus tertium und Compendium philosophiae nicht nur um die Einheit der Wissenschaften, sondern auch -als Grundlage dafür- um die ,Einheit der Natur' bemüht. Basis bleibt dabei die aristotelische ,Physika' mit ihren ,natürlichen' und ,gewaltsamen' Bewegungen und deren Prinzipien. Auch Bacon wendet sich gegen die unpräzise Sprechweise, die Leere ziehe das Wasser an: "Vacuum nihil est et nulla natura; quod est aliqua, natura est; ergo vacuum non est causa", und fUhrt die in der Aristoteles-Tradition bekannten causae efficientes an: die umgebende und nach Ausgleich strebende Luft, den ,Zusammenhalt' der natürlichen Körper (communia naturalium: ,Kohäsion'). Nur kann in seinen Augen jetzt die ,interne' Finalität des Wassers, seine Abwärtsbewegung, nicht ,gewaltsam' aufgehoben werden -das wäre eine Umgehung seiner ,natürlichen' (gottgegebenen) Zweckmäßigkeit. Roger Bacon unterscheidet deshalb zwischen einer "natura particularis" (als ,interner' Finalität der einzelnen Körper) und einer "natura universalis" (aus der eine ,externe' Finalität der Natur folgt). Die "Ordnung" dieser ,natura universalis' bildet für ihn die positive (finale) ,Kraft', die ein Vakuum als ,Unordnung' und ,Diskontinuum' verhindert. Die ,natura universalis' ist der jeweiligen ,natura particularis' übergeordnet, sie kann diese zum Zwecke der Erhaltung der Weltordnung aufheben. Bezüglich der Heberwirkung heißt es zu dieser zusätzlichen ,causa finalis':
Die dritte ist die Zweckursache, welche die gleichförmige Ordnung der Weltkörper und des Weltbaues Zusammenhalt ist, nämlich damit nicht Leere sei (scilicet ne sit vacuum), welche die Ursache der Unordnung und des Untergangs der Dinge ist. [ ... ] Daraus wird klar, daß alle diese drei Ursachen in eine zusammenfallen und eine Ursache ,konstituieren' (unam constituunt), nämlich damit nicht Leere sei (scilicet ne sit vacuum).
Oder an anderer Stelle: Die Ursache daftir, daß Wasser in der Klepshydra angezogen und zurückgehalten wird, [ ... ] ist
nicht die Leere, sondern die Natur selbst und die Ordnung der Körper (ipsa natura et ordinatio corporum), nämlich Wasser und Luft, damit keine Leere zufällig entsteht (accidat), welche die Ursache der Unordnung und des Untergangs wäre, wenn sie entstünde.
Aus der Folge bei Aristoteles ist bei Roger Bacon also der Zweck geworden. Diese Erklärung der Saugwirkung durch die ,natura universalis' als Zweckursache setzte sich dann sehr schnell durch: Schon Johannes Canonicus spricht davon, daß die ,natura universalis' "Auflösungen und Unterbrechungen vermeidet (abhorret)": "et in tantum natura vacuum abhorret". Der terminus technicus ,horror vacui' (der Natur) scheint dann von Petrus Abanus 1310 eingeführt worden zu sein. Von da ab blieb die Erldärung der Saugwirkung bei Hebern oder Saugpumpen durch den finalen ,horror vacui' der Natur (der natura universalis) bis ins 17. Jahrhundert kanonisch.
Die humanistischen Bestrebungen eines Rückgriffs auf den ,echten' Aristoteles hatten jedoch seit Geranimo Cardano (De subtilitate rerum, 1550) und Julius Caesar Scaliger - und dann selbst bei den jesuitischen Aristoteleskommentatoren von Coimbra und daraufhin innerhalb der Barockscholastik25
- zur Folge, daß die ,externe' Finalität der ,natura universalis' im Anschluß an Roger Bacon wieder durch die ,interne' Finalität der ,conservatio' beziehungsweise ,connectio' (Kohäsion) der Sphären und Körper ersetzt wird, entsprechend der ,communia naturalium' Roger Bacons.
Das ist sicherlich zu sehen im Rahmen des Wiedereindringens platonischer, neuplatorüscher, aber auch stoischer Denkweisen, die sich gerade für die Kohäsionstheorie auch im

Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur 63
Zusammenhang der Schweretheorie zeigen läßt. ,Ziel' der Schwerebewegung war nach Aristoteles das Weltzentrum, ein Punkt (der ,natürliche' Ort), körperlich ein Nichts. Die frühneuzeitliche Kritik- in dem Sinne des Aristoteles, daß ein ,Nichts' keine Ursache sein könne - findet sich nämlich unter Rückgriff auf die platonische Schweretheorie bereits in der Stoa.26 Schon Chrysippos hatte die aristotelische Theorie entsprechend modifiziert: Nicht der körperlose ,natürliche Ort', sondern der dort befindliche gleichartige Körper sei das Ziel des finalen Strebens der gleichartigen Teile, wobei der Weltenbauer in seiner der ,Natur' übergeordneten ,Vorsehung' (rrpovou:t) den Teilen (dem Stoff) dieses Streben eingegeben habe, damit es in der sich gleichgewichtig selbsterhaltenden Kugelform zur Dauer und zum Verharren in der vollkommensten Form komme.
Genau diese Kohäsionstheorie findet sich wieder bei Nikolaus von Kues, aber auch -mit nachweisbarem Rückgriff auf Plutarchos- bei Nicolaus Copernicus. Die Theorie enthält nämlich die Möglichkeit, sie auch für eine Erde außerhalb des Weltzentrums anzuwenden -so bei Plutarchos für den Mond, beim Cuser für alle Gestirne, die alle wie die Erde aus vier Elementarsphären bestünden. Notwendig ist allerdings -und das bleibt bis zur Einführung des Trägheitsprinzips durch Isaac Newton so (der Übergang findet sich gedanklich bei Otto von Guericke) -, daß jedes Gestirn aus einer ihm spezifischen Materie besteht, da anderenfalls eine Zusammenballung aller ( erdartigen) Himmelskörper zu einem Körper die Folge wäre.
Was Nikolaus von Kues, insbesondere aber was Nicolaus Copernicus sagen wollte, wird aus des letzteren Quelle deutlicher, weil konzentrierter. Bei Plutarchos heißt es im Zusammenhang der stoischen Kohäsionstheorie: 27
Es scheint, daß kein Teil eines Ganzen ftir sich alleine eine ihm eigen(tümlich)e Anordnung, Lage oder Bewegung hat, die man schlechthin als ,natürlich' (1wra <{!Vaw) bezeichnen könnte; sondern nur dann, wenn jeder Teil ftir das, um dessentwillen er entstanden ist - sei er natürlich geworden, oder sei er erschaffen-, seine Dienste leistet durch zweckmäßige und passende Bewegung (xprwi!Lw~ KGct
oiKeiw~ KtVOV/J.Evov eGcvrb) [ ... ] , so, wie es für jenes zu seiner Erhaltung, Schönheit oder Wirksamkeit dienlich ist, scheint es, hat er den naturgemäßgen Ort (rrw 1<Gcra <{!vaw xwpGcv ), die naturgemäße Bewegung und den naturgemäßen Zustand ...
Hier ist also in der Kritilc an Aristoteles dessen Begriff der ,Natürlichkeit', der die ,interne' Finalität als eine Art den natürlichen Prozeß auf ,natürliche' (das heißt blindnotwendige) Weise determinierende Gesetzlichkeit enthält, umgedeutet. So heißt es auch weiter28
:
So wenig steckt das Streben aufgrund von Schwere und Leichtigkeit den Bereich der Körper ab. Es muß ein anderer, ein Vernunftgrund sein, der der Gestirne Anordnung im Kosmos bestimmt.
(Copernicus sucht später nach diesem Vernunftgrund;29 er findet ihn in der ,Harmonie', die allerdings bei weitem nicht die dann von Johannes Kepler gesuchte und gefundene ,Weltharmonie' als vernünftiger Schöpfungsplan der göttlichen Vorsehung ist). Schon im 13. Kapitel hatte Plutarchos deshalb den aristotelischen Begriff IW:rix. <{!Vatv durch KarG: Mrov ersetzt: Nicht ,natürlich', sondern ,vernünftig' sei die Welt aufgebaut. Die aristotelische Vorstellung mache die Welt zu einem Automaten und damit den ,Demiourgos' überflüssig. - Ähnliches hatte schon einmal Platon dem Anaxagoras vorgeworfen. - Diese Welt, ihr Aufbau und die Bewegungen in ihr seien vielmehr das Werk der vernünftigen Vorsehung (rrpovoux) Gottes.
Es ist sicherlich nicht zufällig, daß der Humanist Copernicus (ebenso wie Kepler) seine Argumente für die Heliozentrilc und die dazu nötigen Modifizierungen der Physik30 gerade dieser Argumentationsebene entnimmt. Aristoteles ist nur zu überwinden, indem die naturgemäße, blindnotwendige ,interne Finalität' der Prozesse, die nur den aristotelischen Kosmos ergeben kann, aufgehoben wird durch eine oder in einer höheren göttlichen Zwecksetzung beziehungsweise darauf beruhenden Zweckmäßigkeit der Natur - ohne daß damit die Details der aristotelischen ,Physik' ihre Gültigkeit verlieren müßten. In

64 Fritz Krafft
dieser Form war ja auch die christliche Umorientierung der aristotelischen ,Physik' schon mehrfach motiviert gewesen: Philoponos hatte die ,natürlichen' Bewegungen durch göttlichen ,Impetus' verursachen lassen; ähnliches finden wir, wie das zweite Beispiel zeigen wird, bei den Nominalisten des 13. Jahrhunderts; und ähnlich wurde die Argumentation gegen die dem Eim:elprozeß noch final-deterministisch übergeordnete, Aristoteles also gleichsam noch potenzierende ,natura universalis' Roger Bacons geführt, nachdem die platonisch-neuplatonischen und stoischen Lösungen mittels der durch göttliche Vorsehung gegebenen Zweckmäßigkeit wieder bekannt geworden waren, die eine christlichen Vorstellungen adäquatere Naturerklärung ermöglichten. So schloß sich selbst der Aristoteles-Verteidiger Scaliger der Ersetzung der ,natura universalis' durch die ,conservatio' und ,connectio' (,Erhaltung' und ,Zusammenhalt') der Sphären bei Cardano, also einer Art partikularen ,internen' Finalität für die Erklärung des ,horror vacui' an.
Zur endgültigen Loslösung von der aristotelischen final-deterministischen Vorstellung mußte der ,Kraft' des ,horror vacui' nur noch der finale Charakter genommen werden. Aegidius Romanus hatte bereits einmal einen entsprechenden Versuch unternommen, bevor Roger Bacons Theorie sich dann allgemein durchgesetzt hatte, er sprachtrotz aller genannter Einwände vom "tractus vacui" oder "tractus a vacuo" und sah diese ,Kraft' als eine der ,internen' Finalität übergeordnete universale ,causa efficiens'Y Ähnlich spricht dann auch Galilei vom ,horror vacui' als "forza del vacuo",32 die er als ,Saugkraft' nicht mehr final auffaßt. Sie dient ihm jetzt umgekehrt auch der Erklärung der Kohäsion der Körper, die alle von feinverteilten, diskontinuierlichen ,Vacua' durchsetzt seien, so daß der Zusammenhalt eines Körpers, etwa als Reißfestigkeit experimentell geprüft, aus der Summe der ,Kräfte' der einzelnen enthaltenen ,Vacua' resultiere. Von hier war es dann nur noch ein relativ geringer Schritt, das Vakuum auch als Kausal-Ursache ganz zu ersetzen -im Hinblick auf den Einwand, daß das Vakuum als ein Nichts nicht Ursache sein könne.
Das geschah auch etwa gleichzeitig und offenbar unabhängig davon durch Isaac Beeckman, der 1618 Versuche mit riesigen Hebern machte und das Steigen des Wassers und überhaupt alle Kohäsion der Körper als Wirkung des äußeren Luftdrucks in Art einer Antiperistasisbewegung erklärte. 1618 vertrat er in seinen ,Theses' folgende Sätze33
:
Das Vakuum ist den Dingen untergemischt.[ 34)
Der Saugwirkung ausgesetztes Wasser wird nicht von einer Kraft des Vakuums angezogen, sondern von der in den leeren Raum eindringenden Luft angetrieben [das heißt in den Heber oder die Saugpumpe hochgedrückt].
Rene Descartes kannte diese damals nicht veröffentlichten Versuche und Deutungen und übte daraufhin an Galileis Ansichten Kritik, die ihrerseits 1639 eine Gruppe von Naturforschern in Rom zu Versuchen mit Hebern anregte, für die sie dann statt Wasser das schwerere Quecksilber verwendeten, worüber Evangelista Torricelli berichtete. Diese Versuche sowie die von Blaise Pascal und besonders die Luftpumpenversuche Otto von Guerickes seit der Mitte des 17. Jahrhunderts setzten dann endgültig den Luftdruck an die Stelle des )10rror vacui'.
Der Streit um die ,finale' oder ,kausale' eigentümliche Ursache einer Saugwirkung hatte sich von selber gelöst; er war reduziert worden auf die Frage nach der Art der Ursache für den Luftdruck, das heißt nach der Ursache der ,Schwere' der Luft. -Das Beispiel zeigt also, wie durch geeignete Reduktion die Frage nach der ,Finalität' bestimmter Prozesse aufgeltoben wird, indem diese Prozesse als Folgen anderer Prozesse erldärt werden.

Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur 65
I/1. 2. Vom ,Impetus' zur Allgemeinen Gravitation
Das zweite Beispiel geht von einer ähnlich rasch kanonisch gewordenen christlichen Umformung aristotelischer ,Physik' im Mittelalter aus, die deshalb offenbar wie die ,horror vacui'-Theorie Roger Bacons die erforderliche Umorientierung im Rahmen des christlichen Aristotelismus ebenfalls befriedigend leistete. Es handelt sich um die Impetustheorie, die oben schon als von Philoponos unter ähnlichen Motiven und Absichten (,Zielen') entwickelt erwähnt worden ist. Johannes Buridanus und Nicole von Oresme haben diese Theorie allerdings im 14. Jahrhundert nicht von Philoponos übernommen, sie haben sie auch nicht neu erfunden, sondern in ähnlicher Weise selbständig von der ,widernatürlichen' Wurfbewegung(für die sie aus dem seit dem 13. Jahrhundert in lateinischer Übersetzung vorliegenden Physik-Kommentar des Simplikios bekannt war) auf die ,natürliche' Fall- und Sphärenbewegung übertragen. Da das ,Ziel' dieser übertragungdas gleiche war und auch die Gründe ftir diese übertragung die gleichen waren, war das Ergebnis ein vergleichbares. Geringe Unterschiede, auf die ich hier nicht näher eingehen kann,35 erldären sich aus dem unterschiedlichen Stand der Technik (Oresme konnte bereits mechanische Gewichtsuhren als Erldärungsmuster für die Art der Einprägung der ,vis impressa' in die Sphärenkörper durch Gott heranziehen).
,Natürliche' Fall- (und Steig-)Bewegungen und die ,natürlichen' Rotationsbewegungen der Sphären wurden wie bei Philoponos als von Gott durch den von ihm eingeprägten Impetus ,künstlich' verursachte den ,gewaltsamen' Bewegungen, die der Mensch beim Wurf erzeugt, prinzipiell gleichgesetzt. Alle diese Bewegungen galten damit als ,unmittelbar' durch Kraftübertragung verursacht. Der Dualismus zwischen himmlischen und irdischen Bewegungen war damit überwunden, der zwischen ,künstlichen' und ,natürlichen' wenigstens prinzipiell insofern, als beide als unmittelbar durch eine ,vis impressa' verursacht galten, einmal durch den Menschen, einmal durch Gott. Nur hat die ,Zielsetzung' unterschiedliche Konsequenzen. Mit dem geworfenen Geschoß erreicht der Mensch ein partikuläres Ziel (mehr oder weniger gut), während Gott mit allen Bewegungen aufeinander abgestimmte Ziele erreicht; seine Zielsetzung wird zur allgemeinen ,externen' Zweckmäßigkeit der Schöpfung.
In den Details bleibt die aristotelische Bewegungslehre jedoch wieder erhalten: Gott prägt demselben Stoff in unterschiedlichen Körpern denselben Impetus ein. Die ,natürlichen', das heißt von Gott verursachten Bewegungen unterscheiden sich weiterhin von den ,künstlichen', vom Menschen verursachten. Nur kann Gott prinzipiell kraft seiner Allmacht auch einen Impetus verweigern, das heißt: Er vermag Wunder zu vollbringen, etwa die Sonne im Tal Gibeon still stehen zu lassen. Die aristotelische streng deterministische (blindnotwendige) ,interne' Finalität der Naturprozesse, die keine ,Wunder' zuläßt, ist damit aufgehoben durch eine ,externe' Zweckmäßigkeit, in die Gott durch ,Wunder' (also willentliche Entziehung des üblichen ,Impetus') jederzeit eingreifen kann.
Genau das war auch das ,Ziel' von Buridanus und Oresme;36 denn die streng deterministischen Teile der aristotelischen Lehren waren 1277 von Paris aus verboten worden. Das Verbot hatte auch Sätze betroffen wie die, "daß Gott die Himmelssphären nicht in geradliniger Bewegung bewegen könne" (Artikel49), und "daß Gott nicht mehr als eine Welt schaffen könne" (Artikel 34).37 Die Impetustheorie ist deshalb auch nur ein Teil der Umformungen, die beide Nominalisten vornehmen; allerdings werden die anderen Teile durch die Anerkennung der Faktizität des aristotelischen Kosmos als Gottes Wille wieder aufgehoben, neutralisiert -wie etwa die, daß Gott mehrere Welten erschaffen kann und erschaffen haben könnte, daß Gott ebensogut mittels einer ,vis impressa' die Erde statt des Himmels gleichförmig rotieren lassen könne (wobei es sogar keine empirischen Kriterien gäbe, zwischen beiden Bewegungen zu entscheiden)usw., nur habe er das eben nicht

66 Fritz Krafft
getan. Wichtig für unseren Zusammenhang ist jedoch, daß sowohl die Verbote als auch die daraufhin erfolgenden Modifikationen aristotelischer ,Physik' insbesondere die Lehren von den deterministischen ,internen' Finalitäten physischer Prozesse (göttlicher Schöpfungen) betrafen. Die Vorstellung von der Allmacht Gottes erforderte, Gott die Möglichkeit zu lassen, von diesem Determinismus, der damit streng genommen keiner mehr war, abzulassen und abzuweichen. Durch die Impetustheorie drang dann die an deren Stelle zu setzende gottgebene ,externe' Zweckmäßigkeit in der Natur in die aristotelische Physik ein.
Auch die buridan-oresmesche Impetustheorie blieb (ähnlich wie die ,horror vacui'Theorie) bis ins beginnende 17. Jahrhundert kanonisch - ohne daß allerdings in diesem Zusammenhang auf ihre Rolle bei der Wegbereitung der neuen, galileischen Kinematilc aufgrund des quantitativen Reduktionismus eingegangen werden kann oder zu werden braucht. Für die neue dynamische Bewegungslehre war nämlich die Aufhebung noch eines anderen als der angesprochenen Dualismen nötig, nämlich des Dualismus zwischen ,unmittelbaren' Bewegungen einerseits und ,mittelbaren' Bewegungen andererseits, das heißt von Bewegungen (gegen die Natur), die künstlich mittels mechanischer Maschinen wie Hebel, Flaschenzug usw. bewerkstelligt werden.38 Letztere fielen seit der Antike in den Bereich der ,Mechanik' als der Lehre und Kunst von den durch maschinelle ,Überlistung' der Natur durch äußere Gewaltanwendung künstlich verursachten Bewegungen. Als eine Beschreibung und Begründung der Wirkweise dieser Maschinen durch in mit ,natürlichen' Mitteln nicht erzielbare Bewegungen umgesetzte ,äußere' Kräfte konnte die ,Mechanik' diese kausalen Kräfte (Gewichte) quantitativ aus ihren Wirkungen bestimmen - so geschehen bereits in den Quaestiones mechanicae des Aristoteles. Demgegenüber läßt sich auch der Impetus als ,innere' Kraft (vis impressa) mit letztlich finaler Wirkung nicht quantitativ bestimmen. Erst von dem Augenblick an, als die ,mechanischen' (von außen verursachten) Bewegungen nicht mehr als ,künstlich-gewaltsame', sondern als ,naturgemäße' (wenn auch künstlich verursachte) aufgefaßt wurden, war es möglich, auch die ,natürlichen' Bewegungen als durch äußere Kausalkräfte verursacht aufzufassen und die Größe dieser ,Kräfte' aus den Wirkungen zu bestimmen.
Den ersten Schritt tat nach Vorarbeiten italienischer Ingenieure des 16. Jahrhunderts Galileo Galilei- ohne allerdings die Konsequenz für den zweiten Schritt zu sehen; den tat erst J ohannes Kepler, während Galilei Zeit seines Lebens bei der letztlich aristotelischen Auffassung blieb, daß dem fallenden Körper ein finales (eingeprägtes) Streben zum Schwerezentrum hin innewohne, während er die Kreisbewegung der Gestirne (und der Erde) als eine kräftefreie Trägheitsbewegung auffaßte. Letzteres war natürlich ermöglicht durch die Impetustheorie des 14. Jahrhunderts, weil- wegen der fehlenden Reibungder von Gott eingeprägte Impetus sich auch nach Galilei nicht abschwächt. Daß hierbei letztlich doch noch eine finale ,vis impressa' zumindest Pate gestanden hat, zeigt Galileis Beschreibung der Entstehung des Sonnensystems: Nach der Erschaffung der Sonne als Schwerezentrum(-ziel) habe Gott von einer Stelle aus die als Körper erschaffenen Planeten auf die Sonne fallen lassen. Die gemäß dem galileischen Fallgesetz beschleunigte Bewegung habe Gott nach und nach in eine dann (weil nicht weiter ,fallende') gleichbleibende kreisförmige Bewegung umgelenkt, zuerst die des Saturn, dann die des Jupiter usw., und nach der längsten Fallstrecke die ··des sich deshalb am schnellsten auf seiner Kreisbahn bewegenden Merkur. Die Bewegungen bleiben konzentrisch-kreisförmig und notwenig gleichförmig - was zeigt, daß Galilei kein Astonom war; denn dann hätte er die seit der Antike bekannten Ungleichförmigkeiten kaum ignorieren können.
Es waren deshalb auch Astronomen, die von den neuen Möglichkeiten Gebrauch machten. Zum ersten Nicolaus Copernicus, der die aufgrund der Impetustheorie möglichen Modifizierungen der aristotelischen Himmelsphysik, wie sie Oresme teilweise schon angedeutet, dann aber wieder zurückgenommen hatte, auf sein heliostatisches System über-

Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur 67
trug. In diesem wird die Rotation und Kreisbewegung der Erdwasserkugel (aufgrund von Sphären) als ebenso ,natürlich' wie bis dahin die Rotation der Planetensphären und des Fixsternhimmels aufgefaßt 38 -ohne daß Copernicus sich allerdings (anders als bei der Schwerebewegung) noch Gedanken um eine Verursachung dieser ,naturgemäßen', ,von selbst' ausgeführten Bewegungen zu machen braucht. So selbstverständlich und unumstritten war die Impetustheorie im 16. Jahrhundert.
Diesbezügliche Überlegungen stellt erst Johannes Kepler an, nachdem Tycho Brahe aufgezeigt hatte, daß der Äther (die Äthersphären) wegen seiner Subtilität als Träger der Planeten und Gestirne nicht in Frage kommt, so daß die Gestirnsbewegungen nicht aus der konzentrischen Rotation von Äthersphären resultieren können. Kepler schließt aus der Berechnung der Bahngeschwindigkeiten der heliozentrischen Planetenbewegungen auf eine in dem Sonnenkörper befindliche zentrale, die Planeten bewegende ,Kraft'. Er nimmt eine Anregung von William Gilbert auf, der im Rahmen der Lehre vom Magnetismus Vorstellungen von magnetischen, unmittelbar über Distanz wirkenden Zentralkräften entwickelt hatte, und deutet diese bewegende Kraft ebenfalls als magnetische, dem Sonnenkö1per zukommende Kraft, aus der einerseits die Schwere als magnetische Attraktion und andererseits die translatorische Mitftihrung der Planeten als magnetische ,Ausrichtung' resultiere.40 Um die Planeten auf Kreisen herumfUhren zu können, muß der Sonnenkörper sich mit seiner magnetischen ,Kraftsphäre' (sphaera activitatis, orbis virtutis) rotierend drehen, aufgrund einer zur Ruhe strebenden ,Trägheit' der Planetenkörper werden diese von der sich mit Abstand vom Zentrum (linear) abschwächenden Kraftwirkung entsprechend weniger schnell bewegt. Auf nähere Einzelheiten, wie die zur Geschwindigkeitsänderung nötige Abstandsänderung, die auch durch die zentrale Magnetkraft der Sonne erklärt wird, kann hier nicht eingegangen werden41
- ebensowenig wie auf den hier begonnenen, aber wegen des mathematischen Redukionismus und der radikal neuen Astronomie Keplers langen Weg zur Allgemeinen Gravitation Isaac Newtons.42
Erwähnt werden muß aber für unseren Zusammenhang, daß nach der Aufgabe des Elementarcharakters des Feuers im Rahmen der finalen Kohäsionstheorie für bewegte Himmelskörper auch der ,Luft' das finale Streben zum Schwerezentmm hin übertragen werden mußte. Sie galt nicht mehr wie bei Aristoteles wegen ihrer zu der Abwärtsbewegung der ,schweren' Körper entgegengesetzten ,natürlichen' Bewegungsrichtung für ,leicht', sondern wie jeder Stoff für ,schwer'. Nur deshalb konnte Isaac Beeckman den aus der Bewegung der Luft zum Schwerezentrum hin resultierenden Luftdruck als Ursache für das Nichtentstehen eines Vakuums ansehen; und nur deshalb konnte schon Nicolaus Copernicus der Luftsphäre dieselbe rotierende ,natürliche' Bewegung wie der Erdwasserkugel zuschreiben. Der Umschlag vom finalen Streben zur kausalen ,Anziehung' der Luftteilchen, die dazu als ,Ausdünstung' der Erdwasserkugel (,atmosphaera' = ,Dunstkugel') aufgefaßt werden, und zwar durch eine Zentralkraft der Erde, wird dann nach Ansätzen bei William Gilbert und Johannes Kepler besonders deutlich bei Otto von Guericke, der mit seiner selektiven ,vis conservativa' (,Erhaltungskraft,) physikalisch das leistet, was bis dallin nur mehr oder weniger gefordert worden war, nämlich das Schwerezentrum statt als causa finalis (Ziel) der Schwerebewegung als causa efficiens, als die Schwerebewegung verursachende Kausalursache aufzufassen. 43
liV. Gottes Schöpfungsplan
Wie schon gesagt, die Bekämpfung und Aufgabe der aristotelischen ,internen' Finalität des einzelnen Prozesses geschah in der Absicht und mit dem Ziel, sie in christlichem Sinne durch die von Gott gesetzte und seiner Schöpfung eingegebene ,externe' Zweckmäßigkeit

68 Fritz Krafft
nicht nur regulierend und neutralisierend übertrumpfen zu lassen, sondern im Sinne der vom Humanismus ,wiederentdeckten' platonisch-neuplatonischen und stoischen Denkweisen durch diese zu ersetzen. Diese ,externe', auch die anorganische Natur durchwaltende Zweckmäßigkeit darf deshalb keine blind-notwendige deterministische, ,natürliche' sein; sie muß vielmehr eine geistig-rationale, weil von Gott beabsichtigte sein. Ziel der Naturforschung ist deshalb nicht mehr wie im Mittelalter Gotteserkenntnis schlechthin, sondern Erkenntnis der Absichten, die Gott mit seiner Schöpfung erreichte, seine rational-vorsorgliche Zwecksetzung, also Erkenntnis Gottes durch Erkenntnis seines Schöpfungsplans, sichtbar in der ,Harmonie' der Welt.
Diese humanistische Idee wird bei keinem Naturforscher so deutlich ausgesprochen und verfolgt wie bei Johannes Kepler.44 Für ihn ist das Auffinden der ,Weltharmonik' erstes und eigentliches Ziel seines Suchens und Forschens und seiner Wissenschaft, für die es deshalb auch keine isolierten Disziplinen, sondern nur die in ihren Teilen aufeinander bezogene Einheit der Wissenschaft gibt. Astronomie - oder vielmehr ,harmonikale Astrophysik' - als gottesdienstliche Welterkenntnis ist seine Absicht, das sich selbst gesetzte HandlungszieL Dazu mußten Empirie, Physik und Mathematik (Geometrie und Harmonik) eine Einheit bilden -eine Einheit, die (dann unter Ausschluß der Harmonik) für die neu definierte ,Physik' im Anschluß an I. Kant erst wieder das 19. Jahrhundert zu erreichen strebte.45
Die aus den physikalischen und kinematischen ,Gesetzen', die Gott mit den Weltkörpern erschaffen habe, kausal folgenden möglichen Zustände und Prozesse würden durch Gottes Schöpfungsplan auf das Beste eingerichtet. Das Erkennen der ,Physik' und ,Kinematik' der Welt ist für Kepler deshalb auch nicht Selbstzweck, sondern Voraussetzung für das Erkennen des Schöpfungsplanes, Mittel zum Zweck, aber Mittel zum höchsten Zweck menschlicher Erkenntnis und Tätigkeit. Nur so erklärt sich auch die Weite seines Schaffens.
Die von Neuplatonismus und Stoizismus her motivierte Neuorientierung der Vorstellungen von der göttlichen Zweckmäßigkeit der Natur im Humanismus bildet den Hintergrund dafür, daß Kepler diesen zweckmäßigen Schöpfungsplan in bewußter Anknüpfung an neuplatonische Ideen im Rational-Quantitativen sieht, in den von den Platonischen regulären Polyedern bestimmend eingeschlossenen Planetenbahnen und in den deren Größen und damit den Weltbau bestimmenden rational-harmonikalen Proportionen der Extremgeschwindigkeiten, die sich aus den physikalischen und kinematischen Gesetzen nur als realtive Proportionen ergäben.46
In dieser großartigen Form und Synthese ist die Idee von der gottgegebenen ,externen' Zweckmäßigkeit allerdings (zumindest von exakt-naturwissenschaftlicher Seite) nicht wieder gedacht und ausgeführt worden. Der insbesondere von Galilei eingeleitete quantitative Reduktionismus erlaubte eine isolierte kinematische Betrachtung einzelner Prozesse, ohne sich um den Gesamtzusammenhang kümmern zu müssen, der seitdem deshalb weitgehend verlorgen gegangen ist. Die ,Wissenschaft', auch die Wissenschaft von der Natur, zerfiel in Einzeldisziplinen, die sich immer weiter von einander trennten. Die Zweckmäßigkeit der göttlichen Schöpfung und ihres Planes war aber im 17. Jahrhundert noch unbestritten; sie wird von Naturforschern allerdings nicht immer expressis verbis (wie deutlich betont bei Otto von Guericke, überhaupt vorwiegend bei Protestanten) vorgebracht und aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen erwiesen.
Die Zweckmäßigkeit der Schöpfung wird zu einem Problem erst wieder am Ende des 17. Jahrhunderts in der Auseinandersetzung um den extrem quantitativ-mechanistischen Reduktionismus der Philosophiae naturaUs principia mathematica Isaac Newtons, die wieder (wie bei Rene Descartes und Otto von Guericke) einen dynamischen Begründungszusammenhang der gesamten anorganischen Natur liefern sollten. In Auseinandersetzung

Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur 69
damit entstand einerseits die Teleologie einer ,prästabilierten Harmonie' bei Gottfried Wilhelm Leibniz47
- die berühmte Korrespondenz zwischen Samuel Clarke und Leibniz dreht sich um dieses Problem und entzündet sich daran. - Gegen den strikt mechanistischen Reduktionismus Newtons, der Gott überflüssig mache, ist andererseits auch das nicht minder berühmte Werk des englischen Naturforschers John Ray: The Wisdom o[God Manifested in the Works of the Creation von 1691, gerichtet, das den breiten Strom der Physico-Theologie einleitet. Es waren ja die brieflichen Anfragen des englischen Geistlichen Richard Bentley, ob jener Vorwurf denn berechtigt sei, die Newton veranlaßten, selber Stellung zu nehmen in den vier ebenfalls berühmten Briefen an Richard Bentley.48
Deren Rechtfertigungen fanden dann in Form von ,Scholien' (insbesondere dem ,Scholium generale' zum 3. Buch) auch in die zweite (1713) und dritte Auflage (1726) der Principia und in Form von ,Queries' in die Opticks Aufnahme. Im Rahmen der exakten Naturwissenschaften hat dann allerdings mehr der in diesem Zusammenhang von Newton methodisch gerechtfertigte Reduktionismus als Prinzip der ,philosophia experimentalis' Eingang gefunden als die Ableitung der Existenz und Allmacht Gottes aus den ,mechanisch' (noch) nicht erklärbaren Eigenarten des Sonnensystems.
V. Die Welt ohne Schöpfungsplan
Newton macht gegen die Vorwürfe, daß seine Mechanik Gott als Schöpfer und Welterhalter überflüssig mache, geltend, daß seine Mechanik nur zu erklären vermöge, daß der Kosmos so, wie er ist, funktioniert, daß es aber auf den Ratschluß des allmächtigen Gottes zurückzuführen sei, daß der Kosmos so eingerichtet sei, daß der funktioniere. Physikalisch unerklärt geblieben waren noch etwa der gleiche Richtungssinn der Umläufe und Umdrehungen der Planeten und Monde und die gemeinsame Bahnebene aller (damals bekannten) Himmelskörper des Sonnensystems. Daneben benötigte Newton Gottes Eingriffe noch, um die aus seinen mechanischen Bewegungsgesetzen folgenden Bahnstörungen wieder zu beseitigen.
Aber diese von Newton nachträglich vorgenommene Ableitung der Existenz und Allmacht Gottes aus den (noch) nicht erldärbaren Eigenarten des Kosmos birgt auch die Gefahr in sich, für das Nicht-Erklärliche nach und nach natürliche Erldärungen zu finden -und damit Gott und seine Vorsehung mehr und mehr aus der Welt verdrängen zu können. Und im Sinne des methodisch gerechtfertigten Reduktionismus der exakten Erfahrungswissenschaft Newtons sahen sich die Naturforscher des 18. Jahrhunderts auch eben dazu aufgerufen.
In dieser Kontroverse gegen Newton hatte auch die andere große von der Aufldärung aufgenommene geistige Bewegung des 18. Jahrhunderts ihren Ursprung, die PhysikoTheologie, die ältere Ideen der ,Natürlichen Theologie' aufnehmend sich bemüht, im Sinne dieser erfal1rungswissenschaftlichen Methode die Existenz und Allmacht Gottes nicht a priori zu setzen, sondern a posteriori aus der Vielfalt und zweckmäßigen Ordnung des Kosmos abzuleiten.49 Die Physiko-Theologie erhält ihren eigentümlichen Schwerpunkt allerdings in den naturhistorischen Bereichen -etwa in einer Insecto-Theologie und ähnlichem; auch wenn William Derharns Astra-Theologie von 1713 eines der ersten Werke dieser Gattung darstellt, und die Frühschrift Immanuel Kants von 1755, die Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, letztlich auch noch dieser Gattung zugehört. 5° Kant führt hier sogar aus der göttlichen ZwecksetZung heraus noch teleologische Beweise (etwa für die Existenz von intelligenten Bewohnern auf von Monden umkreisten Planeten) - die läßt er allerdings in dem authorisierten, 1691 von Gensieheu publizierten Auszug schon fort 51
-, aber er kann durch die kosmische Ausdehnung der

70 Fritz Krafft
ftir das Sonnensystem geltenden newtonseilen Gesetzte auf kosmogonischer Grundlage aus ihnen auch schon die ftir Newton noch unerklärlichen kosmischen Phänomene auf ,natürliche' Weise erklären. Das ist sogar regelrecht eines der erklärten Anliegen der Schrift. -In der Vorrede heißt es hierzu- 52 :
Mich dünkt, man klinne hier in gewissem Verstande ohne Vermessenheit sagen: Gebet mir Mater i e, i c h w i II e i n e W e I t d a rau s b a u e n ! das ist, gebet mir Materie, ich will euch zeigen, wie eine Welt daraus entstehen soll. Denn wenn Materie vorhanden ist, welche mit einer wesentlichen Attraktionsieraft begabt ist, so ist es nicht schwer, diejenigen Ursachen zu bestimmen, die zu der Eimichtung des Weltsystems, im Großen betrachtet, haben beitragen können. Man weiß was dazu gehört, daß ein Körper eine kugelrunde Figur erlange, man begreift was erfordert wird, daß frei schwebende Kugeln eine laeisförmige Bewegung um den Mittelpunkt anstellen, gegen den sie gezogen werden. Die Stellung der Kreise gegeneinander, die Übereinstimmung der Richtung, die Exzentrizität, alles kann auf die einfachsten mechanischen Ursachen gebracht werden, und man darf mit Zuversicht hoffen, sie zu entdecken, weil sie auf die leichtesten und deutlichsten Gründe gesetzt werden können.
Zu einer ähnlichen Tat auch ftir den organischen Bereich fühlte sich dann das 19. Jahrhundert aufgerufen, das daraufhin schrittweise auch diesen Bereich auf Chemie und Physik zu reduzieren bestrebt war. Daß die zitierte Aussage demgegenüber aus (der Mitte) des 18. Jahrhunderts stammt, geht aus ihrer Fortsetzung hervor:
Kann man wohl von den geringsten Pflanzen oder Insekt sich solcher Vorteile rühmen? Ist man in Stande zu sagen: G e b t mir M a t e r i e, i c h w i II e u c h z e i g e n, w i e e i n e R a u p e erzeuget werden könne? Bleibt man hier nicht bei dem ersten Schritte, aus Unwissenheit der wahren inneren Beschaffenheit des Objekts und der Verwickelung der in demselben vorhandenen Mannigfaltigkeit, stecken? Man darf es sich also nicht befremden lassen, wenn ich mich unterstehe zu sagen: daß eher die Bildung aller Himmelskörper, die Ursach ihrer Bewegung, kurz, der Ursprung der ganzen gegenwärtigen Verfassung des Weltbaues, werde können eingesehen werden, ehe die Erzeugung eines einzigen Krauts oder einer Raupe, aus mechanischen Gründen, deutlich und vollständig kund werden wird.
Von dem Gegensatz her, dem hiermit Ausdruck verliehen wird, ist verständlich, daß die Physiko-Theologie des 18. Jahrhunderts zwar teilweise vom astronomischen Bereich seinen Ausgang nahm (W. Derham), sich dann aber weitgehend auf die noch naturhistorisch untersuchten Naturreiche der Pflanzen und Tiere konzentrierte, in denen Gottes ,Vorsehung' noch vielfach eine natürliche Erklärung ersetzen mußte.
Für den Kant der Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels ist Gott zwar noch der Schöpfer, dessen weiser Ratschluß und Vorsehung der von ihm geschaffenen Materie gerade die Naturgesetze eingeprägt hat, die den deshalb zweckmäßigen Kosmos entstehen ließen und immer wieder entstehen lassen; aber diese durch die neue, weiterreichende Erldärbarkeit bedingte Reduktion legt natürlich nahe, Materie und Naturgesetze als aktualistisch wirkend und ,natürlich' gegeben aufzufassen, gleichsam als Axiome der Naturforschung, die mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht mehr hinterfragt werden können - insbesondere seitdem die Existenz Gottes für den Naturforscher nicht mehr a priori als Glaubenssatz gegeben ist, weil sie sich aus den schon ,natürlich' erklärbaren Prozessen nicht mehr ableiten ließ. So soll denn auch Pierre Sirnon de Laplace auf die Frage Napoleon Bonapartes, wo denn in seiner Kosmogonie, die zu denselben Ergebnissen wie die Kantsche kommt, der Platz Gottes sei, geantwortet haben: "Sir, diese Hypothese brauche ich nicht!" Dieser Ausspruch trifft zumindest den Kern der Sache genau: Die Frage nach dem Urheber der Materie/Energie und der Naturgesetze wird als jenseits naturwissenschaftlicher Erkenntnismöglichkeiten liegend ausgeschlossen - und der Theologie und Philosophie überlassen.

Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur 71
VL Schlußbetrachtung
Die ,externe' Zweckmäßigkeit der Natur, aufgrund christlicher Vorstellungen von der Schöpfung Gottes und seiner Allmacht eingefillut, um die streng deterministische ,interne' Finalität natürlicher Prozesse bei Aristoteles zu ersetzen, so daß sie diese auch aus den Vorstellungen der exakten Naturwissenschaften verdrängte, verschwand nach und nach ebenfalls aus der Vorstellungswelt vom Geschehen in der anorganischen Welt. Hatte Kepler noch geglaubt, den göttlichen Schöpfungsplan für den Kosmos mit mathematischphysikalischen Erkenntnissen nachvollziehen zu können, so hatte der mathematischmechanische Reduktionismus des 17. und 18. Jahrhunderts zur Folge, daß Gottes Existenz und teleologische Vorsehung allein noch aus solchen als ,zweckmäßig' vorausgesetzten Geschehnissen, Prozessen und Strukturen abgeleitet wurde, die (noch) nicht natürlich (kausalmechanistisch) erklärbar waren. Aus der Transzendierung der ,externen Finalität' in Gott resultierte dann allerdings aufgrund der zunehmenden Möglichkeiten, das Defizit an ,natürlichen Erklärungen' auszufilllen (Gott für eine Erklärung immer weniger zu benötigen), die Aufgabe dieser nicht mehr als wissenschaftlich geltenden Prämisse -zuerst in den exakten Naturwissenschaften, dann auch in den biologischen. Der anorganischen und in deren Gefolge (nach einer entsprechenden Anpassung in den Fragestellungen) nach und nach auch der organischen Natur wurde daraufhin eine umfassende ,externe' Finalität generell abgesprochen- während die ehemals von dieser Idee verdrängte Vorstellung von einer ,internen' Finalität allmählich auch in die Wissenschaften von anorganischen Objekten wieder Eingang zu finden scheint.
Die Idee einer ,externen' ursächlichen Finalität in der Natur wird im Rahmen der Natmwissenschaften kaum wieder belebt werden können; man sollte aber an deren Stelle wenigstens der Naturwissenschaft als menschlicher Handlungsform wieder ein auf das Ganze und des Menschen Stellung darin gerichtetes ,Ziel', einen ,humanen Sinn' geben!
1 Als dritter Typ werden von W. KuHmann die "nicht angestrebten, aber erreichten Ziele" unterschieden; sie gelten für Artefakten, Produkte menschlicher Kunst, die die ,interne Finalität' der natürlichen Körper für besondere, menschliche Zwecke ,zielgerichtet' lenkt. - Siehe W. KuHmann (a): Die Teleologie in der aristotelischen Biologie. Aristoteles als Zoologe, Embryologe und Genetiker. (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse 1979/2) Heidelberg 1979; siehe besonders S. 36. Hierzu vgl. jetzt auch seinen oben abgedruckten Beitrag (b): Wesen und Bedeutung der ,Zweckursache' bei Aristoteles. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 5 (1982), 25-39; weiterhin Ingrid Craemer-Ruegenberg (a): Die Naturphilosophie des Aristoteles. Freiburg i. Br. 1980 (besonders S. 134-143); dieselbe (b): Der Begriff des Naturzwecks bei Aristoteles, in: H. Poser (Hrsg.): Formen teleologischen Denkens. Philosophische und wissenschaftshistorische Analysen. KoHoquium an der Technischen Universität Berlin, WS 1980/81. (TUB-Dokumentation Kongresse und Tagungen, Heft 11) Berlin 1981, S. 17-29; sowie zu W. KuHmann auch C. Hünemörder: Teleologie in der Biologie, historisch betrachtet, in: Ebendort, S. 79-97 [ Korrekturzusatz: und (von anderer Position aus) Eve-Marie Engels: Teleologie ohne Telos? Überlegungen zum XIX. Symposium der GeseHschaft für Wissenschaftsgeschichte . . . über "Die Idee der Zweckmäßigkeit in der Geschichte der Wissenschaften". Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie 13 (1982), 122-165.]
2 Wasübrigens dann auch nahe legt, die ,Entwicklung' der Wissenschaft als einen biologischenProzeß im Sinne der darwinschen Deszendenztheorie aufzufassen (so St. Toulmin und andere).
3 Siehe hierzu F. Krafft: Progressus retrogradis. Die ,Copernicanische Wende' als Ergebnis absoluter Paradigmatreue, in: A. Diemer (Hrsg.): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen und die Geschichte der Wissenschaften. XIII. Symposium der GeseHschaft flir Wissenschaftsgeschichte anläßlich ihres zehnjährigen Bestehens, 8.-10. Mai 1975 in Münster. Meisenheim am Glan 1977, S. 20-48. - In diesem Sammelband, der eigenartigerweise (oder bezeichnenderweise?) innerhalb der wissenschaftstheoretischen Diskussion kaum Beachtung gefunden hat, wird in mehreren Beiträgen von wissenschaftshistorischer Seite her die Legitimität der Übertragung einer (der Kuhnschen) ,Struktur' oder Gesetzlichkeit auf den Wissenschaftsprozeß widerlegt.

72
4 Extrem deutlich in den Auffassungen der Starnberger ,Finalisten'-Gruppe. 5 Siehe Anm 1.
Fritz Krafft
6 Im Sinne einer }J.er&ßOlatc; elc; &11./\o '"(evoc;, die seit Aristoteles (Analytica posteriora A 7, 75a33 ff.) ftir ein Beweisverfahren verboten ist.
7 M. Gatzemeier (a): Die Abhängigkeit der Methoden von den Zielen der Wissenschaft. Überlegungen zum Problem der ,Letztbegründung'. Perspektiven der Philosophie. Neues Jahrbuch 6 (1980), S. 92-118, hier S. 109 f; siehe jetzt auch seinen oben abgedruckten Beitrag (b): Zweck und Zweckmäßigkeit der Wissenschaft. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 5 (1982), 17-23.
8 Zu Begriff und Inhalt des ,Historischen Erfahrungsraumes' siehe jetzt F. Krafft: Das Selbstverständnis der Physik im Wandel der Zeit. Vorlesungen zum Historischen Erfahrungsraum physikalischen Erkennens. (taschentext) Weinheim/New York 1982.
9 Zur dadurch bedingten unterschiedlichen Auffassung von Wissenschaft(lichkeit) siehe jetzt besonders Laetitia Boehm: Wissensc:;haft - Wissenschaften - Universitätsreform. Historische und theoretische Aspekte zur Verwissenschaftlichung von Wissen und zur Wissenschaftsorganisation in der frühen Neuzeit. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 1 (1978), S. 7-36.
10 Generell zur Prognosefähigkeit von Wissenschaften siehe den Bericht von F. Krafft: Prognose und Wissenschaft. XVI. Symposium der Gesellschaft ftir Wissenschaftsgeschichte, 4.-6. 5. 1978 in Hannover. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 1 (1978), S. 221-229, wiederabgedruckt im AHF-Jahrbuch der historischen Forschung 1978. Stuttgart 1979, S. 89-97; die Beiträge des Symposiums selber sind abgedruckt in Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 2/ (1979), S. 1-134.
11 Vgl. F. Krafft: Der Wandel der Auffassung von der antiken Naturwissenschaft und ihres Bezuges zur modernen Naturforschung, in 0. Reverdin (Hrsg.): Les etudes classiques aux XIXe et xxe siecles: Leur place dans l'histoire des ictees. (Entretiens sur l'antiquite classique, 26) VandoevresGeneve 1980, S. 241-304.
12 J. H. Randall: Aristotle. New York 1960; besonders S. 165-172: "The significance of Aristotle's natural philosophy"; dieser Abschnitt in deutscher Übersetzung bei G. A. Seeck (Hrsg.): Die Naturphilosophie des Aristoteles. (Wege der Forschung, Bd. 225) Darmstadt 1975, S. 235-242; hier s. 236 f.
13 Siehe F. Krafft (wie Anm. 8), besonders Vorlesung IU und IV. 14 Nach De caelo B 12 ist nur jeder der sieben Planeten ein handelndes (beseeltes) Wesen, das ftir seine
Handlungen (Bewegungen zur Erreichung möglicher Vollkommenheit) mehrere Körperteile (Sphären) benötigt, während nach MetaphysikA 8 jede der angeblich 55 Sphären eine eigene intelligente Seele hat (die - wie jede Seele - mittelbar durch die zugehörige Sphäre als Körper bewegt wird, also kein ,unbewegter Beweger' ist - so W. Kulimann oben [wie Anm 1/b], S. 34 ).
15 Der Deutung von Aristoteles: Politik A 8 durch I. Craemer-Ruegenberg (wie Anm. 1/b, dort S. 26 f.) kann ich nicht zustimmen. ,Politik' und ,Ökonomik' - und um diese handelt es sich dort -sind keine Wissenschaften von der (,internen' oder ,externen' Zweckmäßigkeit der) Natur, sondern praktische (Handlungs)Wissenschaften, in deren Rahmen der handelnde Mensch die ,Ziele' selber setzt. Von dem (anthropozentrisch, egoistisch, das heißt:) ,ökonomisch' handelnden Menschen muß die von ihm nutzbare Natur (und damit indirekt auch die von der durch ihn nutzbaren Natur genutzte, ihm selbst aber direkt nicht nutzbare Natur [nur ftir diesen Zusammenhang kann die Deutungvon I. Craemer-Ruegenberg zutreffen]) als ftir die menschlichen Zwecke der Ökonomie geeignet gesetzt werden (vgl. W. Kullmann[wie Anm. 1/a], besonders S. 25 ff.). Ein Hund, eine Rose etwa würden die ökonomische Zwecksetzung ganz anders vornehmen; sie würden ebenfalls sich selbst als ,Endzweck' se~en.
16 Aristoteles: Physik H 1, 241 24 (34). 17 M. Wolff: Geschichte der Impetustheorie. Untersuchungen zum Ursprung der klassischen Mecha
nik. Frankfurt am Main 1978. 18 Siehe Simplikios: In Aristotelis de caelo commentaria, edidit I. L. Heiberg. (Commentaria in Ari
stotelem Graeca, VII) Berlin 1894, S. 264, 25-265,9. Dazu vgl. F. Krafft: Dynamische und statische Betrachtungsweise in der antiken Mechanik. (Boethius, Bd 10) Wiesbaden 1970, S. 74-78. - Galileo Galilei sagt (Le Opere. Edizione Nazionale. Bd 1, Florenz 1964, S. 319, 23 ff.), daß er diese Theorie des Hipparchos erst zwei Monate nach Aufstellen seiner eigenen entsprechenden Theorie in De motu kennengelernt habe.
19 iaxvc; bei Hipparchos und Aristoteles, während terminus technicus ftir die dem Körper innewohnende ,Kraft', welche die ,naturgemäßen' Bewegungen verursacht, P,o1rf, oder ovVOl!.f.Lc; genannt wird.
20 Vgl. Aristoteles: Quaestiones mechanicae, praefatio, 847al3-16: Da die Natur in ihrer ,internen' Finalität immer gleichgerichtet sei, das Nutzungsziel des Menschen aber Wandlungen unterworfen sei, müsse zum Erreichen dieser Ziele die Natur durch ,Mechanik' überlistet werden; siehe F. Krafft (wie Anm. 18).
21 Auch seine Abwandlungen der Raum-, Zeit- und Körpertheorie des Aristoteles (siehe M. Wolff [wie Anm. 17], S. 147-152) sind hierdurch bedingt.

Zielgerichtetheit und Zielsetzung in Wissenschaft und Natur 73
22 VgL etwa Cicero: De natura deorum II, 115 ff. (auch: Stoicorum veterum fragmenta II, 1140 und öfters).
23 Vgl. F. Krafft: Der Weg von den Physiken zur Physik an den deutschen Universitäten. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 1 (1978), S. 123-162.
24 Siehe im Einzelnen und zu den Belegen F. Krafft: Horror vacui, in: J. Ritter (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd 3 (G-H), Basel/Stuttgart 1974, Sp. 1206-1212. -Siehe besonders Roger Bacon: Liber primus communium naturalium, hrsg. von Steele, in: Opera hactenus inedita. Bd. 3, Oxford 1909, S. 219 ff., sowie: Quaestiones supra libros quatuor physicorum Aristotelis IV, hrsg. von Delormc. Ebendort S. 200-208.
25 Vgl. etwa B. Keckermann: Systema physicum. Danzig 1610, S. 1060. 26 Zum folgenden siehe F. Krafft: Copernicus retroversus, II: Gravitation und Kohäsionstheorie, in:
Colloquia Copernicana IV. Conferences de Symposia ... Torui1 1973. (Studia Copernicana, XIV) Wrodaw usw. 1975, S. 65-78.
27 Plutarchos: De facie in orbe lunae, 14, p. 927 D-F. 28 Plutarchos (wie Anm. 27), p. 928 D. 29 Vgl. die Einleitung zum Cammentarialus des N. Copernicus (um 1510): "saepe cogitabam, si forte
ratianabiliar modus circulorum inveniri possit". 30 N. Copernicus: De revolutionibus orbium caelestium libri VI (Nürnberg 1543), I, 9: "Equidem
existimo gravitatem non aliud esse quam appetentiam quandam naturalem partium inditam illis a divina pravidentia opificis universorum, ut in unitatem integritatemque suam sese conferat in formam globi coeuntes."
31 Aegidius Romanus: In libros de physicae auditu Aristotelis commentaria, IV, lectio 10, 12. 32 G. Galilei: Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze ... , in: Le Opere.
Edizione Nazionale. Bd 8, S. 39 ff. (1638; vgl. schon den Brief von 1613, ebendort Bd 4, S. 298). 33 Vgl. C. de Waard: L'experience barmmitrique. Ses antecedents et ses explications. Thouars 1936,
S. 79. 34 Die Theorie der fein verteilten ,Vakua' geht auf Heron von Alexandria (1. Jahrhundert n. Chr.)
zurück; sie ist wieder bekannt geworden seit der 1575 erschienenen lateinischen Übersetzung der Pneumatica durch Commandino.
35 Siehe hierzu jetzt M. Wolff (wie Anm. 17). 36 Vgl. F. Krafft:Wissenschaft und Weltbild (I): Die Wende von der Einheit zur Vielfalt, in: N. A.
Luyten OP (Hrsg.): Naturwissenschaft und Theologie. (Schriften der Katholischen Akademie in Bayern, Nr. 100) Düsseldorf 1981, S. 53-78.
37 Der Wortlaut des Dekrets von 1277 bei H. Denifle/E. Chatelain: Chartularium universitatis Parisiensis. 4 Bde, Paris 1889-1897; hier Bd 1, S. 543-555.
38 Vgl. F. Krafft (wie Anm. 8), Vorlesung II, zurückgehend auf denselben: Die Stellung der Technik zur Naturwissenschaft in Antike und Neuzeit. Technikgeschichte 37 (1970), S. 189-209, und in Humanismus und Technik 15 (1971), S. 33-50.
39 Siehe zur Entstehung der Heliozentrik aus dem Bemühen, ,Himmelsphysik' und mathematische Astronomie wieder zusammenzuführen, F. Krafft (a): Physikalische Realität oder mathematische Hypothese? Andreas Osiander und die physikalische Erneuerung der antiken Astronomie durch Nicolaus Copernicus. Philasaphia naturalis 14 (1973), S. 243-275, sowie denselben (b): Die sogenannte Copernicanische Revolution. Das Entstehen einer neuen physikalischen Astronomie aus alter Astronomie und alter Physik. Physik und Didaktik 2 (1974), S. 276-290.
40 Siehe F. Krafft: Sphaera activitatis- orbisvirtutis. Das Entstehen der Vorstellung von Zentralkräften. Sudhaffs Archiv 54 (1970), S. 113-140.
41 Bezüglich näherer Einzelheiten siehe F. Krafft: Johannes Keplers Beitrag zur Himmelsphysik, in: F. Krafft/K. Meyer/B. Sticker (Hrsgg.): Internationales Kepler-Symposiilm Weil der Stadt 1971. Referate und Diskussionen. (arbor scientiarum, Reihe A, Bd 1) Hildesheim 1973, S. 55-139.
42 Hierzu siehe F. Krafft: Die Keplerschen Gesetze im Urteil des 17. Jahrhunderts, in: R. Haase (Hrsg.): Kepler Symposium. Zu Johannes Keplers 350. Todestag, 25.-28. September 1980, im Rahmen des Internationalen Bruclmerfestes '80 Linz. Bericht. Linz 1982, S. 75-98.
43 Vgl. F. Krafft (a): Otto von Guericke. (Erträge der Forschung, Bd 87) Darmstadt 1978, S. 67 ff., sowie desselben Exkurs (b): Zur Vorgeschichte des Begriffs der Allgemeinen Schwere, in: F. Krafft (wie Anm. 42), S. 87 ff.
44 Siehe F. Krafft: Keplers Wissenschaftspraxis und -verständnis. Sudhaffs Archiv 59 (1975), S. 54-68.
45 Sieh F. Krafft (wie Anm. 23 ). 46 Übrigens gilt diese ,Harmonik' auch für die nach Kepler neu entdeckten Planeten! Vgl. R. Haase
(a): Fortsetzungen der Keplerschen Weltharmonik, in: Johannes Kepler -Werk und Leistung. (Katalog des Oö. Landesmuseums, Nr. 74) Linz 1971, S. 61-72; sowie denselben (b): Teleologische Ergebnisse der harmonikalen Forschung. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 5 (1982), 97-105.

74 Fritz Krafft
4 7 Siehe jetzt H. Poser: Die Einheit von Teleologie und Erfahrung in der Leibniz-Wolffschen Philosophie, in: H. Poser (wie Anm. 1), S. 99-117.
48 Abgedruckt etwa in I. Newton: Opera quae exstant omnia, hrsg. von S. Horsley. Bd 4, London 1782 (Neudruck: Stuttgart 1964), S. 427-442; deutsche Teilübersetzung in B. Sticker/F. Krafft: Bau und Bildung des Weltalls. Kosmologische Vorstellungen in Dokumenten aus zwei Jahrtausenden. Freiburg/Basel/Wien 1967, S. 198-203. Vgl. auch die Textzusammenstellung von H. S. Thayer/ J. H. Randall, Jr. (Eds.): Newton's Philosophy of Nature: Selections form His Writings. New York 1953 (und öfters).
49 Siehe jetzt Sara Stebbins: Maxima in minimis. Zum Empirie- und Autoritätsverständis in der physikotheologischen Literatur der Frühaufldärung. (Mikrokosmos, Bd 8) Frankfurt am Main usw. 1980; sowie R. Toellner: Die Bedeutung des physico-theologischen Gottesbeweises für die nachcartesianische Physiologie im 18. Jahrhundert. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 5 (1982), 75-82.
50 I. Kant: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Mit einem wissenschaftshistorischen Nachwort hrsg. von F. Krafft.(Naturwissenschaftliche Texte bei Kindler) München 1971. - Vgl. S. A. XXVII-XXIX: "Die angeführten Lehren der mechanischen Erzeugung des Weltbaues leiteten alle Ordnung [ ... ] aus dem ungefähren Zufalle her, der die Atome so glücklich zusammentreffen ließ, daß sie ein wohlgeordnetes Ganze ausmachten. [ ... ] Alle insgesamt trieben diese Ungereimtheit so weit, daß sie den Ursprung aller belebten Geschöpfe eben diesem blinden Zufall beimaßen und die Vernunft wirklich aus der Unvernunft herleiteten. In meiner Lehrverfassung hingegen finde ich die Materie an gewisse notwendige Gesetze gebunden. Ich sehe in ihrer gänzlichen Auflösung und Zerstreuung ein schönes und ordentliches Ganze sich ganz natürlich daraus entwickeln. Es geschiehet dieses nicht durch einen Zufall und von ungefähr, sondern man bemerket, daß natürliche Eigenschaften es notwendig also mit sich bringen. Wird man hierdurch nicht bewogen zu fragen: warum mußte denn die Materie gerade solche Gesetze haben, die auf Ordnung und Wohlanständigkeit abzwecken? war es wohl möglich, daf~ viele Dinge, deren jedes seine von dem andern unabhängige Natur hat, einander von selber gerade so bestimmen sollten, daß ein wohlgeordnetes Ganze daraus entspringe, und wenn sie dieses tun, gibt es nicht einen unleugbaren Beweis von der Gemeinschaft ihres ersten Ursprungs ab, der ein allgenugsamer höchster Verstand sein muß, in welchem die Naturen der Dinge zu vereinbarten Absichten entworfen worden? [ ... Die Materie] hat keine Freiheit, von diesem Plane der Vollkommenheit abzuweichen. Da sie also sich einer höchst weisen Absicht unterworfen befindet, so muß sie notwendig in solche übereinstimmende Verhältnisse durch eine über sie herrschende erste Ursache versetzt worden sein, und es ist ein Gott eben deswegen, weil die Natur auch selbst im Chaos nichts anders als regelmäßig und ordentlich verfahren kann. "
51 William Hersehe! über den Bau des Himmels. Drey Abhandlungen aus dem Englischen übersetzt. Nebst einem authentischen Auszug aus Kants allgemeiner Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Königsberg 1791. - Zur Teleologie-Diskussion bei I. Kant siehe H.-J. Engfer: Über die Unabdingbarkeit teleologischen Denkens. Zum Stellenwert der reflektierenden Urteils!aaft in Kants kritischer Philosophie, in: H. Poser (wie Anm. 1), S. 119-160.
52 I. Kant: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels [1755], S. A. XXXIV f.
Prof. Dr. Fritz Krafft Johannes Gutenberg-Universität Fachbereich Mathematik Arbeitsgruppe ftir Geschichte der Naturwissenschaft Saarstraße 21 D-6500 Mainz