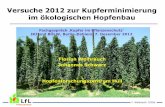12er versuche
description
Transcript of 12er versuche

12.1
Kaliumnitrat KNO3
Gefahrenhinweise - H-Sätze:
H272: Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweise - P-Sätze:
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.P221: Mischen mit brennbaren Stoffen/... unbedingt verhindern.
Sammlung von Kleinmengen:In Sammelbehälter für anorganische Feststoffe geben.Neutrale Lösungen (pH-Wert Kontrolle):In Sammelbehälter für Salzlösungen geben, ein pH-Wert von 6-8 ist einzustellen.
H2so4
Gefahrenhinweise - H-Sätze:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweise - P-Sätze:
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.P309: BEI Exposition oder Unwohlsein:P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Anorganische Säuren und deren Anhydride werden ggf. zunächst verdünnt bzw. hydrolysiert, indem man sie vorsichtig in Eiswasser einrührt. Anschließend wird mit Natronlauge neutralisiert; pH-Wert kontrollieren.In Sammelbehälter für Salzlösungen geben, ein pH-Wert von 6-8 ist einzustellen.
Eisensulfat feso4
Gefahrenhinweise - H-Sätze:
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.H319: Verursacht schwere Augenreizung.H315: Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweise - P-Sätze:
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P302+P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Sammlung von Kleinmengen:In Sammelbehälter für giftige anorganische Rückstände sowie Schwermetall-Salze und ihre Lösungen geben.Sammelgefäße sind deutlich mit der systematischen Bezeichnung ihres Inhaltes zu beschriften. Gefäße an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Der zuständigen Stelle zur Abfallbeseitigung übergeben.
KNO3 + H2SO4 -> HNO3 + KHSO4
3Fe2+ + NO3- + 4 H+ → NO + 3Fe3++ 2 H2O
3Fe2+SO4 + NO3- + 4H+ -> NO + 3Fe3+SO4 + 2H2O
[Fe(H2O)6]2+SO4 + NO -> [Fe(H2O)5NO]SO4 + H2O
2HNO3 + 6FeSO4 + 3H2SO4 -> 3Fe2(SO4)3 + 2NO (sehr reaktiv)+ 4H2ONO + [Fe(H2O)6]2+ -> [Fe(H2O)5NO]2+ + H2O
12.2
Salpetersäure hno3
Gefahrenhinweise - H-Sätze:
H272: Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweise - P-Sätze:
P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P309+P310: BEI Exposition oder Unwohlsein: Sofort GIFTINFORMATIONS-ZENTRUM oder Arzt anrufen.
Anorganische Säuren und deren Anhydride werden ggf. zunächst verdünnt bzw. hydrolysiert, indem man sie vorsichtig in Eiswasser einrührt. Anschließend wird mit Natronlauge neutralisiert; pH-Wert kontrollieren.In Sammelbehälter für Salzlösungen geben, ein pH-Wert von 6-8 ist einzustellen.

Stickstoffdioxidentsorgung :entweichen lassen
H270: Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.H330: Lebensgefahr bei Einatmen.H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Ergänzende Gefahrenhinweise - EUH-Sätze:
EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.
N2O4
H270: Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.H330: Lebensgefahr bei Einatmen.H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Ergänzende Gefahrenhinweise - EUH-Sätze:
EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweise - P-Sätze:
P260: Staub nicht einatmen.P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.P284: Atemschutz tragen.P303+P361+P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.P304+P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P309+P311: BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONS-ZENTRUM oder Arzt anrufen.P404: In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.P405: Unter Verschluss aufbewahren.
stickstoffmonoxid
H270: Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.H330: Lebensgefahr bei Einatmen.H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Ergänzende Gefahrenhinweise - EUH-Sätze:
EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.
12.3
ammoniumchlorid
In Sammelbehälter für anorganische Feststoffe geben.Neutrale Lösungen (pH-Wert Kontrolle):In Sammelbehälter für Salzlösungen geben, ein pH-Wert von 6-8 ist einzustellen.

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise - P-Sätze:
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Naoh
Basen und Alkoholate werden falls erforderlich verdünnt, indem man sie vorsichtig in Wasser einrührt. Anschließend wird mit Salzsäure neutralisiert; pH-Wert kontrollieren.In Sammelbehälter für Salzlösungen geben, ein pH-Wert von 6-8 ist einzustellen,.bzw.in Sammelbehälter für giftige anorganische Rückstände sowie Schwermetallsalze und ihre Lösungen geben.
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweise - P-Sätze:
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P308+P310: BEI Exposition oder falls betroffen: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Nh3
Für ausreichend Lüftung sorgen.Gefährdeten Bereich räumen, betroffene Umgebung warnen.Zur Beseitigung des gefährlichen Zustandes darf der Gefahrenbereich nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen betreten werden.Atem-, Augen-, Hand- und Körperschutz tragen (s. Kapitel Persönliche Schutzmaßnahmen).Versuchen, das Ausströmen des Gases zu unterbinden. Ansonsten undichte Flaschen unter Absaugung stellen oder ins Freie bringen.Austretende Gase/Dämpfe mit Wasser niederschlagen.Funkenfreie Werkzeuge verwenden.Anschließend Raum lüften.Von dem Gas berührte Ausrüstung oder die Umgebung des Leckes mit reichlich Wasser abspülen.
Gefahrenhinweise - H-Sätze:
H221: Entzündbares Gas.H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.H331: Giftig bei Einatmen.H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.
Ergänzende Gefahrenhinweise - EUH-Sätze:

EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweise - P-Sätze:
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.P260: Gas/Dampf nicht einatmen.P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.P304+P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.P303+P361+P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P315: Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.P377: Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.P381: Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.P405: Unter Verschluss aufbewahren.P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Das Haber-Bosch-Verfahren wurde zwischen 1905 und 1913 von dem deutschen Chemiker Fritz Haber und dem Ingenieur Carl Bosch entwickelt. Die Erfindung geht aber eigentlich auf Wilhelm Ostwald zurück, der 1900 ein Patent dazu anmeldete und das Patent an die BASF verkaufte. Das Ammoniak wird bei diesem Verfahren aus Stickstoff und Wasserstoff hergestellt.
Bild vergrößern

Haber und Bosch fanden durch langjährige Versuche heraus, dass für die Gleichgewichts-Reaktion zwischen Stickstoff und Wasserstoff unter folgenden Bedingungen am meisten Ammoniak gebildet wird:
1. Bei einer Temperatur von 550°C 2. Unter sehr hohem Druck von 150 bis 250 bar 3. Bei einem Überschuss von Stickstoff (Hinweis: Das stöchiometrische Verhältnis bei der Reaktion zwischen Stickstoff und Wasserstoff wäre nach der Theorie 1:3, allerdings wird in der Praxis mehr Stickstoff zugegeben) 4. Beim Vorliegen eines Katalysators
Bei sehr hohem Druck verschiebt sich das Gleichgewicht nach rechts und die Ausbeute erhöht sich. Hohe Temperaturen verringern nach dem Prinzip von Le Chatelier jedoch wieder die Ausbeute. Daher wählt man einen Mittelweg und setzt Katalysatoren ein. Erst wenn alle vier Reaktionsbedingungen gleichzeitig vorliegen, ist die Ausbeute an Ammoniak optimal.
1. In einer Pumpe, einem Kompressor, wird das Gasgemisch aus Stickstoff und Wasserstoff auf den notwendigen Druck komprimiert. 2. In einem Gasreiniger wird das Gasgemisch von unerwünschten Verunreinigungen wie Schwefelverbindungen oder Kohlenmonoxid gereinigt. 3. Im Kontaktofen läuft die eigentliche Reaktion nach der oben beschriebenen Reaktionsgleichung ab. In einem zylinderförmigen, druckfesten Reaktionsrohr wird das Gasgemisch unter hohem Druck auf bis zu 500°C erhitzt. Dabei strömt das Gasgemisch an einer mit dem Katalysator beschichteten Fläche vorbei und reagiert zu Ammoniakgas. Der Katalysator besteht aus einem Gemisch von Eisenoxid und Aluminiumoxid. Außen ist das Reaktionsrohr mit druckbeständigem, dicken Stahl verstärkt. Innen darf kein Stahl verwendet werden, weil der Wasserstoff mit dem im Stahl enthaltenen Kohlenstoff reagieren würde. Deshalb besteht das Innenrohr aus kohlenstoffarmem, reinen Eisen. 4. Im Kühler wird das noch heiße Ammoniakgas abgekühlt.
5. Im Abscheider wird das Ammoniakgas von nicht umgesetzten Ausgangsprodukten (Wasserstoff und Stickstoff) getrennt. Im Kontaktofen setzen sich trotz optimaler Reaktionsbedingungen nur etwa 15% der Ausgangsstoffe in Ammoniak um. Die nicht umgesetzten Restgase werden an der Stelle (6) wieder eingeführt.
Das Gas Ammoniak mit der Formel NH3 ist in der Chemie ein wichtiges
Zwischenprodukt. 90% allerDüngemittel werden heute aus Ammoniak gewonnen. Außerdem kann man aus Ammoniak Salpetersäureherstellen. Wasserstoff und Stickstoff lassen sich aus Erdgas nach der Synthesegas-Erzeugung gewinnen.

Fritz Habers erste Versuchsanlage zur Ammoniaksynthese,
ausgestellt im Deutschen Museum in München Die Ammoniaksynthese im Modellversuch In einigen Experimentierbüchern wird eine Synthese von Ammoniak aus den Elementen beschrieben. Mit Hilfe der Entnahmeventile an den Gasflaschen wird der Gasstrom so eingestellt, dass etwa dreimal soviel Wasserstoff wie Stickstoff zusammengemischt werden. Die Kontrolle erfolgt über die Blasenzählung in den beiden Gaswaschflaschen, in denen sich Paraffinöl befindet.
Wasserstoff und Stickstoff werden im Verhältnis 1:3 übereinen Cereisenkatalysator im Verbrennungsrohr geleitet.
Nach dem Erhitzen des Katalysators färbt sich die Phenolphthaleinlösung pink.
Die Nachahmung des Versuchs ist nur mit einer ausführlichen Anleitung aus einem Experimentierbuch zu empfehlen.

Eine Schutzscheibe ist notwendig, eine Durchführung im Abzug empfehlenswert. Film erhältlich auf >DVD Nach einer Weile wird an der Entnahmedüse ganz rechts an der Apparatur die Knallgasprobe durchgeführt. Erst wenn diese negativ verläuft, wenn also kein Sauerstoff mehr in der Apparatur vorhanden ist, kann der austretende Wasserstoff gezündet werden. In der nach dem Reaktionsrohr nachgeschalteten Gaswaschflasche befindet sich eine wässrig-alkoholische Phenolphthaleinlösung. Nun wird der Brenner gezündet und der Katalysator im Reaktionsrohr erhitzt. Er beginnt zu glühen und allmählich färbt sich die Phenolphthaleinlösung pink. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Reaktionsrohr der Stickstoff mit dem Wasserstoff zu Ammoniak reagiert, das sich im Wasser der nachgeschalteten Waschflasche zu Ammoniaklösung löst. Das Phenolphthalein zeigt die entstehende, alkalische Lösung an.
AMMONIAKAmmoniak, NH3, farbloses Gas von charakteristischem, stechendem, zu Tränen reizendem,
erstickendem Geruch und beißendem, laugigem Geschmack; F. -77,4 °C, Kp. -33,35 °C, krit. Temp. 132,5 °C, krit. Druck 11,25 MPa, krit. D. 0,235 g cm-3, D. des flüssigen A. bei -34,4 °C 0,683 g cm-
3, bei 0 °C 0,639 g cm-3, Dampfdruck bei 0 °C 0,438 MPa, bei 30,0 °C 1,19 MPa, Verdampfungswärme des flüssigen A. bei -33,35 °C 1372,0 kJ/kg, bei 0 °C 1264,3 kJ/kg und bei 32,2 °C 1137,3 kJ/kg. In festem Zustand bildet A. farblose, kubische Kristalle.
Eigenschaften. Das Ammoniakmolekül hat pyramidale Struktur, der H-N-H-Winkel beträgt 107,3°. Daraus kann man auf weitgehende sp3-Hybridisierung am N-Atom schließen. Die NH3-Pyramide
ist nicht stabil, sondern unterliegt auch bei tiefer Temperatur rascher Inversion. Die Höhe der Inversionsbarriere beträgt 24,8 kJ/mol. Die hohe Polarität der NH3-Moleküle und die Ausbildung
starker Wasserstoffbrückenbindungen bewirken, daß flüssiges A. beträchtlich assoziiert ist (Dielektrizitätskonstante bei -50 °C 22,7).
Ammoniak. Abb. 1: NH3-Pyramide.
Dies ist die Ursache des unerwartet hohen Siedepunktes und der hohen Verdampfungsenthalpie des A.
A. vermag als Folge seiner Molekülstruktur sowohl mit Donor- als auch Akzeptormolekülen in Wechselwirkung zu treten, d. h., es ist z. B. in der Lage, sowohl Anionen als auch Kationen eines Salzes zu solvatisieren. Dies verschafft dem flüssigen A. ähnliche Lösungsmitteleigenschaften wie dem Wasser. So sind zahlreiche anorganische und organische Verbindungen in flüssigem A. gut

löslich. Flüssiges A. unterliegt ähnlich dem Wasser der Autoprotolyse : 2 NH3
NH2- + NH4
+. Alkalimetalle sowie Calcium, Strontium und Barium lösen sich in flüssigem A. unter
Bildung tiefdunkelblauer Lösungen, deren elektrische Leitfähigkeit und deren Paramagnetismus auf das Vorliegen solvatisierter Elektronen zurückgeführt wird:
A. löst sich begierig in Wasser. 100 ml Wasser lösen bei 0 °C 90,7 g, d. s. 117,6 l gasförmiges A., bei 100 °C 7,4 g A.; Lösungsenthalpie des gasförmigen A. bei 25 °C 30,64 kJ/mol.
Die Hauptmenge des A. ist in Wasser molekular gelöst. Infolge der Fähigkeit des A., als Protonenakzeptor zu fungieren, erfolgt in geringem Umfang Protolyse: NH3+ H2O
NH4+ + OH- (pKB = 4,75). Die wäßrige Lösung reagiert deshalb basisch. Durch Einwirkung starker
Basen auf Ammoniumsalze wird A. wieder freigesetzt, z. B. NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl +
H2O. Gegenüber sehr starken Basen, wie Metallorganica oder ionischen Hydriden, vermag A. als
Säure zu fungieren und geht in seine korrespondierende Base, das Amid-Ion NH2-, über. Amide
werden auch bei Einwirkung elektropositiver Metalle auf A. bei erhöhter Temperatur gebildet, z. B. Na + NH3 → NaNH2 + 1/2 H2.
Das bei gewöhnlicher Temperatur beständige A. zerfällt beim Erwärmen in Gegenwart bestimmter Katalysatoren bis zur Gleichgewichtskonzentration in die Elemente: 2 NH3
N2 + 3 H2, ΔH = 92,5 kJ/mol. In reinem Sauerstoff verbrennt A. im wesentlichen zu Stickstoff und
Wasser: 2 NH3 + 3/2 O2 → N2 + 3 H2O. A.-Sauerstoff-Gemische sind in den Grenzen von 13,5 bis
82 Vol.-% A. und A.-Luft-Gemische von 15,5 bis 28 Vol.-% A. explosibel. Nimmt man die Verbrennung in Gegenwart von Platin- oder Platin-Rhodium-Katalysatoren vor, so erfolgt Umsetzung zu Stickstoffmonoxid: 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O, ΔH ≈ -900 kJ/mol. Diese
Reaktion ist die Basis des Ostwald-Verfahrens zur Herstellung von Salpetersäure. Vermöge seines freien Elektronenpaares ist A. ein guter Komplexligand und ein starkes Nucleophil.
Analytisches. Der qualitative Nachweis des A. erfolgt durch Bildung des blauen [Cu(NH3)4]2+-
Komplexes oder durch Neßlers Reagens.
Sowohl flüssiges Ammoniak als auch dessen wäßrige Lösung wirken ätzend auf Haut und Schleimhäute. Besonders gefährdet sind die Augen. Bei Augenschädigungen ist sofort mit viel Wasser zu spülen.
1,5 bis 2,5 g A./m3 Atemluft wirken nach 30 bis 60 min tödlich. Durch kurzzeitige Inhalation kann es zu Verätzungen und nachfolgend zu Entzündungen der Atemwege und Lungenödem kommen. Hier wird völlige Ruhigstellung und das Einatmen von Wasser- und Essigsäuredämpfen empfohlen. Ggf. Arzt konsultieren.

Ammoniak. Abb. 2: Schema einer Ammoniakerzeugungsanlage.
Vorkommen. A. ist das biologische Abbauprodukt zahlreicher organischer Stickstoffverbindungen und kommt im Ergebnis der Verwesung pflanzlichen und tierischen Materials, üblicherweise in Form von Ammoniumsalzen, in der Natur vor. Auch einige Minerale enthalten geringe Mengen A.
Gewinnung. A. wird heute nahezu ausschließlich durch direkte Vereinigung der Elemente Stickstoff und Wasserstoff nach dem Prinzip des Haber-Bosch-Verfahrensgewonnen. Die Umsetzung N2 + 3
H2
2 NH3, ΔH = -92,5 kJ/mol, bedarf infolge der hohen Dissoziationsenthalpie des N2-Moleküls
energischer Aktivierung. Der exotherme Charakter der Reaktion begrenzt jedoch eine thermische Anregung, weil sich die Gleichgewichtslage mit steigender Temperatur nach links verschiebt. Es wurden deshalb Katalysatoren entwickelt (Eisenoxide mit geringen Anteilen Aluminium-, Calcium-, Kalium-, Magnesium- und Titandioxid u. a. als Promotoren, die nach Reduktion durch Wasserstoff in die aktive Form des α-Eisens übergehen), mit denen bei Reaktionstemperaturen um 400 °C technisch verwertbare Umsätze erreicht werden.
Abb. 2 zeigt das Schema einer Ammoniakerzeugungsanlage. Das Synthesegas mit der Zusammensetzung Stickstoff : Wasserstoff = 1 : 3 wird durch Wärmeaustausch mit dem bereits umgesetzten Gas auf die Arbeitstemperatur des Katalysators (400 bis 500 °C) vorgeheizt und dem Synthesereaktor zugeführt. Nach jeder Katalysatorschicht wird durch Zuführung von Kaltgas wieder auf die optimale Arbeitstemperatur des Katalysators abgekühlt. Nach etwa der 5. bis 10. Katalysatorschicht ist die Gleichgewichtszusammensetzung erreicht. Nach Passieren eines Abhitzekessels, eines Wärmetauschers zur Vorwärmung des Einsatzgases und eines Wasserkühlers scheidet sich ein Teil des A. ab. Die vollständige Entfernung aus dem Kreislaufgas erfolgt in einem mit A. gefüllten Tiefkühler. Das nicht umgesetzte Gas wird zusammen mit dem Frischgas erneut dem Reaktor zugef'ührt. Für den Ausgleich des Druckverlustes sorgt ein Kreislaufkompressor. Durch ständiges Entspannen eines Teilstromes wird verhindert, daß sich Inertgase (Argon und Methan) im Kreislaufgas anreichern. Aus diesen Entspannungsgasen kann Argon gewonnen werden.
Im Laboratorium stellt man A. durch Einwirkung starker Basen auf Ammoniaksalze her.
A. kommt verflüssigt in Stahlflaschen oder in Wasser gelöst als 25-30%iges konz. A. (Ammoniakwasser, Trivialname Salmiakgeist) in den Handel.
Verwendung. A. ist die Basis nahezu aller technisch hergestellter Stickstoffverbindungen. Der größte Anteil des produzierten A. wird zur Herstellung von Stickstoffdüngemitteln verwendet. Auch als Ausgangsprodukt zur Gewinnung von Harnstoff oder Ammoniumsulfat kommt A. letztlich in der Landwirtschaft zur Anwendung. A. dient zur Herstellung von Soda, Salpetersäure, verschiedenen Ammoniumsalzen, Natriumcyanid, Blausäure, Hydrazin, Nitrilen, Aminen, Amidharzen, Chemiefasern, Farbstoffen, Sprengstoffen u. a. Es wird in der Kältetechnik und in der Metallurgie (zur Nitrierhärtung) eingesetzt. Ammoniakwasser wird in der Bleicherei, in der Färberei, beim Lichtpausverfahren und allgemein als billige Base verwendet.
Copyright 1998 Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg

12.4
Kation Oxidationsflamme Reduktionsflamme
Ag+ silber-weiß
Fe2+; Fe3+ rotbraun grünlich
Mn2+ violett farblos
Co2+ blau blau
Ni2+ gelb grau
Cr3+ grün grün
Al3+ farblos farblos
Cu2+ heiß: gelb, kalt: blauheiß: farblos, kalt: rotbraun
Ti4+heiß: gelblich, kalt: farblos
farblos