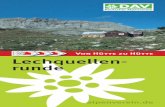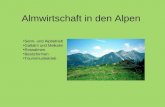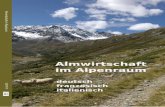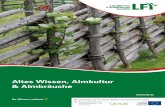Almwirtschaft%20als%20beitrag%20zu%20einer%20nachhaltigen
-
Upload
lfi-oesterreich -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Almwirtschaft%20als%20beitrag%20zu%20einer%20nachhaltigen

Die Almwirtschaft hat einelange Tradition und ist ein her-ausragendes Beispiel nachhalti-gen Wirtschaftens. UnzähligeTäler und ganze Regionen desAlpenraumes hätten vom Men-schen ohne die Nutzung des al-pinen Grünlandes als Futter-grundlage für die Hauswieder-käuer nie besiedelt werden kön-nen. Rinder, Schafe und Ziegenhaben mit ihrem komplexenVerdauungssystem die Fähig-keit, Gründlandfutter als Ener-gie- und Nährstoffquelle zu nut-zen. Die in den Grünlandpflan-zen gespeicherte Sonnenenergiekonnte mit Hilfe dieser Wieder-käuer für den menschlichen Ge-brauch erschlossen werden.Zugkraft, Milch, Fleisch, Wolle
und Leder waren die wesentli-chen „Produkte“ dieses biologi-schen Umwandlungsprozesses,die den Menschen das Überle-ben in den Alpen ermöglichten.
Mit der Natur
Aus dem unmittelbaren Be-obachten und Erfahren heraushaben unsere Vorfahren gelerntihre Almen so zu verwalten,dass Almweidewirtschaft überdie Jahrhunderte möglich war.Bäuerinnen und Bauern frühe-rer Generationen hatten keineandere Wahl als sich bewusstoder unbewusst den mitunterrauen natürlichen Gegebenhei-ten der Alpen anzupassen undsich in das ökologische Gefüge
einzuordnen. Das land-wirtschaftliche Systemwurde von erneuerbarerEnergie in Gang gehaltenund man hat penibel dar-auf geachtet, dass dieBodenfruchtbarkeitdurch lokale Nährstoff-kreisläufe (Boden -Pflanze - Tiere - Dünger -
Boden) auf Dauer aufrecht er-halten oder sogar verbessertwurde.
Das Wirtschaften im Ein-klang mit der Natur, wie dasnoch heute auf vielen Almenpraktiziert wird, wird jedochmehr und mehr von den Aus-wirkungen der fortschreiten-den Intensivierung der Land-wirtschaft bedroht.
Nachhaltigkeit undLandwirtschaft
Der Begriff der Nachhal-tigkeit wurde 1987 durch dieVeröffentlichung des soge-nannten Brundtland-Berichtes(WCED, 1987) einer breitenÖffentlichkeit verständlich ge-macht:
„Nachhaltige Entwicklungwird definiert als eine Ent-wicklung, durch die die Be-dürfnisse der gegenwärtigenGeneration befriedigt werden,ohne die Fähigkeit zukünftigerGenerationen deren Bedürfnis-se zu befriedigen, zu beein-trächtigen“.
Der Alm- und Bergbauer10 10/06
23. Internationale Almwirtschaftstagung 2006
Die Futterration derAlmkühe soll vorallem durch dieNutzung der Almwei-den gedeckt werden
von Dr. Wilhelm Knaus
Almwirtschaft als Beitrag zu einer nachhal-tigen Erzeugung tierischer Lebensmittel
Die Almwirtschaft bleibt auch von der zunehmendenIntensivierung in der Landwirtschaft nicht verschontund damit ist auch das Prinzip der Nachhaltigkeit,das auf eine ökologisch verträgliche Landwirtschafthinzielt, in Gefahr. Futterrationen von Wiederkäuern,die zu einem beträchtlichen Teil auf Getreide basie-ren - die Fütterung einer „9.000-Liter-Kuh“ verlangtim Durchschnitt einen Kraftfutter-Anteil in der Fut-terration von 44 % - sind zu hinterfragen. Eine ver-antwortbare Leistungsgrenze (5.000 bis 7.000 kgMilch je Kuh und Jahr) ist besonders in der Almbe-wirtschaftung einzufordern. Im folgenden Beitrag le-sen Sie eine Kurzfassung des Referates von Dr. Wil-helm Knaus im Rahmen der 23. Internationalen Alm-wirtschaftstagung 2006.
Dr. Wilhelm Knaussprach sich in seinemReferat unmissver-ständlich für einenachhaltige Erzeugungvon Lebensmitteln aus
Foto
s: J
enew
ein

Nach Heitschmidt et al.(1996) kann nachhaltige Land-wirtschaft allgemein definiertwerden als eine ökologischverträgliche Form der Land-wirtschaft. Im engeren Sinnbetrachtet ist es eine Form derLandwirtschaft, die man aufewig betreiben kann. Agrari-sche Produktionssysteme ver-dienen daher nur dann das At-tribut nachhaltig, wenn sie imWesentlichen von solarer En-ergie in Gang gehalten werden,sich an den ökologischenGrenzen in Hinblick auf Nähr-stoffein- und -austrag orientie-ren und dadurch die Boden-fruchtbarkeit und (Grund-)Wasserqualität auf Dauer ge-währleisten.
Eine Form der Landwirt-schaft, die nur durch den mas-siven Einsatz von nicht erneu-erbarer Energie (Treibstoffe)betrieben werden kann, aufder Ausbeutung natürlicherRessourcen (Humusabbau)beruht und auf die Verwen-dung von umweltschädlichenchemisch-synthetischenPflanzenschutzmitteln setzt,verliert auf Dauer ihre Pro-duktionskraft. Der Einsatzvon großen Mengen betriebs-fremden Futter- und Dünge-mitteln bedingt einen hohenEnergieeinsatz und führt zuNährstoffverlagerungen, dieflora-, fauna- und grundwas-serbelastende Nährstoff-Im-balanzen nach sich ziehen.Eine solche Form der Land-wirtschaft, die die natürlichenGrenzen der ökologischenTragfähigkeit nicht anerken-nen will und diese andauernd
verletzt, ist jedenfalls nichtnachhaltig.
Almwirtschaft
„Auch im Industriezeital-ter ist die Agrikultur die Vor-aussetzung für jede anderemenschliche Kultur“ (Haiger,1985). Umfassend nachhaltigeLandwirtschaft im Sinne einerAgrikultur wird nach wie vorauf vielen tausenden Almenbetrieben. Stärker als in derVergangenheit wird heutzuta-ge auch die Multifunktiona-lität der Almwirtschaft (Fut-terressourcen, Erholung, Tou-rismus, Biodiversität, Sied-lungsschutz, etc.) hervorgeho-ben und in das Blickfeld derbäuerlichen und nichtbäuerli-chen Bevölkerung gerückt.
Das Wissen über eine nach-haltige und daher zukunfts-fähige Almweidewirtschaft istebenso erhalten geblieben, wiedas Bedürfnis vieler Menschenwährend des Sommers auf derAlm zu leben und zu arbeiten.
Jahrzehnte der Forcierungeiner rücksichtslosen Indus-trialisierung der Landwirt-schaft haben vereinzelt be-sorgte Wissenschafter in denverschiedenen Ländern veran-lasst, auf die drohenden Um-welt- und Energieproblemehinzuweisen und nachhaltiges(Land-)Wirtschaften einzufor-dern. In einer wissenschaftli-chen Abhandlung zum Thema„Ökosysteme, Nachhaltigkeitund landwirtschaftliche Nutz-tierhaltung“, die im renom-mierten amerikanischen Jour-nal der Nutztierwissenschaf-
ten (Journal of Animal Scien-ce) erschienen ist, kommenHeitschmidt et al. (1996) zudem Schluss, dass beispiels-weise „das Beweiden von bo-denständigem Grasland eineder nachhaltigsten Formen derLandwirtschaft ist“. Traditio-nelle Almweidehaltung istvon externen, begrenzt ver-fügbaren und/oder umwelt-schädlichen Ressourcen wiefossiler Energie, Mineraldün-ger und Pestiziden weitge-hend unabhängig.
Gras oder Getreide?
Es steht außer Zweifel,dass der Mensch in erster Liniesolche Wiederkäuerarten do-mestiziert hat, die durch evolu-tionäre Anpassung faserreicheFutterstoffe, die für denmenschlichen Konsum unge-eignet sind, leicht verwertenkönnen (v. Engelhardt et al.,1985; Hofmann, 1989).
Nach heutigem Wissens-stand wurden Rinder, Schafeund Ziegen vor ca. 8.500 bis11.000 Jahren domestiziert,um sich in erster Linie nach-haltige Lebensmittelquellen zuerschließen, die auf Weidefut-ter basierten. Wiederkäuer ha-ben in der Entwicklungsge-schichte des Menschen auchnur deshalb eine so große Be-deutung erlangt, weil sie nie
Der Alm- und Bergbauer 1110/06
23. Internationale Almwirtschaftstagung 2006
>
Anpassung der Wieder-käuer an ihre natürli-che Futtergrundlage

Nahrungskonkurrenten desMenschen waren. Nach Hof-mann (1989) erscheint es da-her „antibiologisch“, wennnicht gar unmoralisch, dassheutzutage in den reichen Län-dern die Futterrationen derlandwirtschaftlich genutztenWiederkäuer auf Getreide ba-sieren. Wie brisant diese Ent-wicklung ist, hat Haiger be-reits 1996 in einer Publikationmit dem Titel, „Wird die Kuhzur Sau gemacht?“, ausführ-lich dargelegt. Der Trend zurMaximierung des Kraftfutter-einsatzes - insbesondere beiMilchkühen - hat sich bis zumheutigen Tag noch verstärkt.Wie sich der Energiebedarf jeKilogramm Milch und der An-teil an Kraftfutter in den Ra-tionen für Milchkühe mit stei-gender Leistung verändert, istin Tabelle 1 dargestellt.
Der Nährstoff- und damitFutterbedarf für die Erhaltungeiner Kuh (37,7 MJ NEL bei ei-ner Lebendmasse von 650 kg)ist - unabhängig von der Leis-tungshöhe - nahezu konstant,macht aber einen beträchtlichenTeil des Gesamtbedarfes (Sum-me aus Erhaltungs- und Leis-tungsbedarf) aus. Je höher die
Milchleistung umso geringer istder Anteil der aufgenommenenNährstoffe (Energie, Eiweiß,etc.), der zur Deckung des Er-haltungsbedarfes nötig ist. ImFalle einer höheren Milchleis-tung können somit die Futter-kosten, die wegen der Deckungdes Erhaltungsbedarfes anfallenauf mehr Kilogramm erzeugterMilch umgelegt werden. Eskommt somit zu einer „Verdün-nung“ des Aufwandes für dieErhaltung. Mit jeder zusätzli-chen Leistungssteigerungnimmt jedoch dieser „Verdün-nungseffekt“ ab. Eine Kuh mit5.000 kg Laktationsleistungbenötigt 21 % weniger Energieje Kilogramm Milch als eineKuh mit 3.000 kg. Eine Leis-tungssteigerung von 5.000 auf7.000 kg reduziert den Energie-bedarf je Kilogramm Milch um10 %. Wird die Laktationslei-stung noch einmal um 2.000 kg,d. h. von 7.000 auf 9.000 kg,gesteigert, vermindert sich derEnergiebedarf für jedes Kilo-gramm Milch nur noch um 6 %.
Höherer Kraftfutteranteil
Höhere Milchleistungenbedingen eine höhere Futter-
aufnahme und damit die Be-reitstellung größerer Mengenan Nährstoffen für die Kuh.Wegen der, im Vergleich zuKraftfutter, geringeren Nähr-stoff- und Energiedichte vonGrundfuttermitteln (Weide,Grassilage, Maissilage undHeu) stößt man bei alleinigerVerfütterung von Grundfutterfrüher an physische Grenzender Futteraufnahme (begrenz-tes Volumen des Verdauungs-traktes) als bei einem teilwei-sen Einsatz von Kraftfutter.Die Fütterung einer 9.000-Li-ter-Kuh verlangt im Durch-schnitt einen Kraftfutter-Anteilin der Futterration von 44 %(Tabelle 1).
In reinen Grünlandgebie-ten werden die ökologischenGrenzen der Leistungssteige-rung allein durch den Nähr-stoff-Import aufgrund desKraftfutter-Zukaufs früher er-reicht, als auf Betrieben, dieihr Kraftfutter selbst erzeugenkönnen. Je höher die Leistungaus dem betriebseigenenGrundfutter ist, umso höherkann die Gesamtleistung sein,ohne dass am Betrieb einStickstoff-Überschuss durchKraftfutter-Zukauf entsteht.Auch bei sehr hohen Grund-futterleistungen ist bei Stall-durchschnitten von über 7.000kg wegen des Nährstoff-Im-ports über das zugekaufteKraftfutter keine ausgegliche-ne Stickstoffbilanz mehr mög-lich. Vom Standpunkt derÖkologie ist daher mit 5.000bis 7.000 kg Milch je Kuh undJahr (mit Ausnahmen bis zu8.000 kg) eine verantwortbare
Der Alm- und Bergbauer12 10/06
23. Internationale Almwirtschaftstagung 2006
305-Tage-Laktation
kg
mittlereTagesleistung
kg
Energiebedarfje kg MilchMJ NEL1)
Abnahme desBedarfes in %
Futteraufnahme2)
TM KFkg/Tag %
3.000 9,8 7,0 13,2 3
4.000 13,1 6,1 -13 14,9 9
5.000 16,4 5,5 -8 16,3 15
6.000 19,7 5,1 -6 17,6 22
7.000 23,0 4,8 -4 18,7 29
8.000 26,2 4,6 -3 19,7 36
9.000 29,5 4,4 -3 20,6 44
10.000 32,8 4,3 -2 21,3 511) Energiebedarfsberechnung in MJ NEL:
Erhaltungsbedarf für eine 650 kg schwere Kuh = 37,7Leistungsbedarf für 1 kg Milch mit 4 % Fett = 3,17(z. B. 9,8 kg x 3,17 31,1 + 37,7 68,8 : 9,8 7,0)
2) TM = Trockenmasse, KF = Kraftfutter
Tab. 1: Leistungshöhe,Futteraufnahme undKraftfutterbedarf inder Milcherzeugung(Haiger 2005)

Leistungsgrenze erreicht (Hai-ger, 2005). Werden höhereMilchleistungen angestrebt,sinken die Futterkosten je Ki-logramm Milch nur mehr ge-ringfügig, der Kraftfutteranteilin den Rationen nimmt starkzu und in der Folge kommt eswegen der hohen Düngermen-gen selbst im Grünland zu ei-ner Belastung des Grundwas-sers mit Stickstoff.
Um während der Almperi-ode auf den Einsatz von Kraft-futter verzichten oder diesenaus ökologischen Gründenmöglichst gering halten zu kön-nen, ist es wegen des zu erwar-tenden großen Leistungsein-bruchs hochlaktierender Tiereempfehlenswert, nur Kühe aufder Alm zu melken, die sich be-reits in der 2. Hälfte der Lakta-tion befinden. Ist eine Teilungder Milchkuhherde aus arbeits-wirtschaftlichen Gründen füreinen Betrieb nicht möglich,muss bei einer ausschließlichauf Almweide basierenden Füt-terung insbesondere bei hoch-leistenden Kühen (> 25 kgMilch/Tag) mit einem starkenLeistungsrückgang gerechnetwerden. Trotzdem ist zu erwar-ten, dass genetisch besser ver-anlagte Kühe auch unter Alm-bedingungen mehr Milch er-zeugen als schlechter veranlag-te Kühe (Haiger, 1985).
Wird auf der Alm auf die Zu-fütterung von Kraftfutter gänz-lich verzichtet, was aus ökologi-scher Sicht wünschenswert wäre(Grabherr, 1993), sind wegendes Leistungsrückgangs wäh-rend der Almperiode im Durch-schnitt einer Herde Laktations-
leistungen von über 6.500 kgwohl kaum zu erreichen.
Fazit
Die Erzeugung von tieri-schen Lebensmitteln auf Al-men ist ein unverzichtbarerBeitrag zur alpenländischenAgrikultur. Durch die Nutzungvon Almweiden als Futter-grundlage für Rinder, Schafeund Ziegen werden für denMenschen nicht direkt konsu-mierbare vielfältige alpinePflanzenbestände in hochwer-tige Lebensmittel (Milch,Fleisch) umgewandelt. Wün-schenswerte und in der Ver-gangenheit zu wenig beachteteNebeneffekte der Almwirt-schaft sind das Offenhalten derBerglandschaft, die Erhaltungeiner großen Biodiversität(Pflanzen- und Tierarten) so-wie die Aufrechterhaltung ei-ner erhöhten Schutz- und Er-holungsfunktion bewirtschaf-teter Almflächen.
Almwirtschaftssystemekönnen im Wesentlichen vonerneuerbarer (solarer) Energiein Gang gehalten werden.Tierbesatz und Lebendmasseder Tiere sollten sich aber je-denfalls an der Ertragsleistungund der Neigung der Almbö-den orientieren. Eine Heu-beifütterung von bis zu 2kg/Tier und Tag kann im Fallvon zu weicher Kotkonsistenzzur Verbesserung der Struktur-wirksamkeit des Futters emp-fohlen werden. Eine Energie-ergänzung über Kraftfutter istwegen des Transportaufwan-des und des Nährstoffeintrages
in das Almsystem nicht gene-rell zu empfehlen. Wird jedochKraftfutter auf die Alm trans-portiert, sollte dieses energie-reich sein und nur in einemmöglichst verhaltenen Aus-maß (< 2 kg/Tier und Tag) ein-gesetzt werden.
Literatur
v. Engelhardt, W., D. W. Dellowand H. Hoeller. 1985: The potentialof ruminants for the utilization of fi-brous low-quality diets. Proc. Nutr.Soc., 44, 37-43.
Grabherr, G. 1993: Naturschutzund alpine Landwirtschaft in Öster-reich. Zeitschrift für Ökologie undNaturschutz, 2, 113-117.
Haiger, A. 1985: Landwirt-schaft, Rinderzucht und Almwirt-schaft. Sonderdruck aus „Der Almund Bergbauer“, 35. Jahrgang, Fol-ge 1/2.
Haiger, A. 1996: Wird die Kuhzur Sau gemacht? Ernte-Zeit-schrift, 5, 22-23.
Haiger, A. 2005: NaturgemäßeTierzucht bei Rindern und Schwei-nen. Österreichischer Agrarverlag.Leopoldsdorf.
Heitschmidt, R. K., R. E. Short,and E.E. Grings. 1996: Ecosy-stems, Sustainability, and AnimalAgriculture. Journal of AnimalScience, 74, 1395-1405.
Hofmann, R. R. 1989: Evolutio-nary steps of ecophysiological ad-aptation and diversification of rumi-nants: a comparative view of theirdigestive system. Oecologia, 78,443-457.
WCED, 1987: The World Com-mission on Environment and Deve-lopment, Our Common Future, ed.Gro Harlem Brundtland (Oxford,England: Oxford University Press,1987).
Der Alm- und Bergbauer 1310/06
23. Internationale Almwirtschaftstagung 2006
Zum Autor:Ao.Univ.Prof.Dr.Wilhelm Knaus ist amInstitut für Nutztier-wissenschaften,Department fürNachhaltige Agrarsys-teme, an der Univer-sität für Bodenkulturin Wien tätig
Betriebsfremde Futter-und Düngemittel in
größeren Mengenstören den Kreislauf
der Nachhaltigkeit