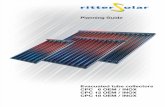Die neue grafische Oberfläche für LIMA Michael Badura, Guido Zender Köln, 31. März 2009.
Badura, Bernhard; Ritter, Wolfgang zwischen Neuanfang und ... · B. BAOUFIA U. W. RITTER sorgung...
Transcript of Badura, Bernhard; Ritter, Wolfgang zwischen Neuanfang und ... · B. BAOUFIA U. W. RITTER sorgung...
www.ssoar.info
Zehn Jahre nach der Ottawa-Charta: diebetriebliche Gesundheitsförderung am Scheidewegzwischen Neuanfang und MarginalisierungBadura, Bernhard; Ritter, Wolfgang
Veröffentlichungsversion / Published VersionZeitschriftenartikel / journal article
Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:Badura, B., & Ritter, W. (1997). Zehn Jahre nach der Ottawa-Charta: die betriebliche Gesundheitsförderung amScheideweg zwischen Neuanfang und Marginalisierung. Journal für Psychologie, 5(3), 3-12. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-29110
Nutzungsbedingungen:Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (KeineWeiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung diesesDokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich fürden persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alleUrheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichenSchutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokumentnicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Siedieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zweckevervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oderanderweitig nutzen.Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie dieNutzungsbedingungen an.
Terms of use:This document is made available under Deposit Licence (NoRedistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to using this document.This document is solely intended for your personal, non-commercial use. All of the copies of this documents must retainall copyright information and other information regarding legalprotection. You are not allowed to alter this document in anyway, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit thedocument in public, to perform, distribute or otherwise use thedocument in public.By using this particular document, you accept the above-statedconditions of use.
GESUNDHEITSPSYCHOLOGIE UND
GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Zehn Jahre nach der Ottawa-Charta. Die betrieblicheGesundheitsförderung am Scheideweg zwischen
Neuanfang und Marginalisierung
ENTSTEHUNG UND EINFLUSS DER OTTAWA
CHARTA
Die Ottawa-Charta verdankt ihre Entstehung einer ganzen Reihe intellektuellerWurzeln und Akteure. Ohne Anspruch aufVollständigkeit sollen einige besonders augenfällige rückblickend betrachtet erwähntwerden. Die Ottawa-Charta war zunächsteinmal das Produkt einer internationalen Organisation, die ihre Existenz weniger durchkonkrete politische Funktionen denn durchein weltumspannendes Angebot an Ideenund technischen Hilfeleistungen rechtfertigen muß. In der Deklaration von Alma-Atawar es dieser Organisation gelungen, mitder Vision der gesundheitlichen Primärver-
Bernhard Badura und Wolfgang Ritter
Bundesrepublik von besonderer Turbulenz.1989 wurden der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) durch die Gesundheitsreform vom Gesetzgeber besondere Kompetenzen zur Gesundheitsförderung und zurBekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen zugewiesen. Orientiert an der OttawaCharta entwickelten eine Reihe vonKrankenkassen Gesundheitsförderungsaktivitäten, die auf schädigende Verhältnisseund Verhaltensweisen in der Arbeitswelteinwirken sollten. Von der zunehmendenDiskussion um die Bezahlbarkeit unseresSozialstaates sind auch die Gesundheitsförderungsaktivitäten der gesetzlichen Krankenversicherer (GKV) betroffen, die nun innicht näher definierter Weise von den Berufsgenossenschaften (GUV) fortgesetztwerden sollen. Nach der beachtenswertenaber kurzen Hochkonjunktur droht der Gesundheitsförderung nun die Marginalisierung.
Die neunziger Jahre waren für die betriebliche Gesundheitsförderung gerade in der
ZusammenfessungWer heute einen modernen Produktionsbetrieb betritt, erwartet nicht mehr ernsthaft,daß Arbeiter beispielsweise noch an 20 oder30 Jahre alten Drehbänken stehen und denWerkzeugschlitten von Hand bewegen. DasBild wird dagegen bestimmt von computergesteuerten Entwicklungs- und Bearbeitungsautomaten, zu deren Bedienung gut ausgebildete Facharbeiter nötig sind. Was dagegenkaum auffällt, ist, daß in den meisten der Betriebe immer noch mit einem weit über 20Jahre alten Konzept des Arbeitsschutzes überdie Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten »gewachtcc wird. Bereits 1986wurde in der kanadischen Hauptstadt Ottawader Grundstein für einen Wandel von einerpathogen geprägten zu einer salutogenenGrundhaltung gelegt. Die in der Ottawa-Charta formulierten Prinzipien einer adäquatenGesundheits- und Sozialpolitik setzten neueMaßstäbe auch für die betriebliche Gesundheitsförderung. Die Gesetzlichen Krankenversicherer setzten diese Anforderungen, forciertdurch das Gesundheitsreformgesetz von1989, in zahlreiche Aktivitäten um. Heute nachnun mehr •• 10 Jahren Ottawa-Charta(( ist dieGesundheitsförderung wieder in Frage gesteilt und droht dem Kostendruck zum Opferzu fallen. Im folgenden werden die wirtschaftlichen und sozialen Notwendigkeiten und diehieraus resultierenden Anforderungen aneine qualitativ hochwertige Gesundheitsförderung dargestellt. Abschließend sollen derheutige Stand und zukünftige Entwicklungsaufgaben näher analysiert werden.
5. JAHRGANG, HEFT 3 3
B. BAOUFIA U. W. RITTER
sorgung (»primary health care«) so etwaswie eine intellektuelle Führerschaft in Sachen Weltgesundheit zu übernehmen. Diesgalt insbesondere für die Gesundheitsplaner in der Dritten Welt. In den entwickeltenIndustrienationen wurde Primärversorgung(fälschlicherweise) recht bald mit » Billigmedizin für die Habenichtse« gleichgesetztund fand entsprechend wenig Akzeptanz.Zentrales Problem dieser Länder war nichtdie Unterversorgung ihres Gesundheitswesens mit Geld und Technik, sondern derzunehmend mit der Entwicklung der modernen Medizin an den Rand gedrängte vorbeugende Gesundheitsschutz. Dieser vorbeugende Gesundheitsschutz wurde vonder Weltgesundheitsorganisation lange Jahre nahezu ausschließlich als Gesundheitserziehung verstanden. Dies erwies sichaber am Beginn der 8Der Jahre als höchstineffiziente Strategie, weil er sehr personalintensiv und wenig wirksam war. Die sichhier allmählich auftuende Lücke an Ideenund Visionen mußte früher oder später aufgefüllt werden.
Etwa zeitgleich entstand an der neugegründeten Universität Konstanz - am Ende der7Der Jahre - eine Gruppe junger Soziologen,Politik- und Verwaltungswissenschaftler,die, gefördert durch das damalige Bundesministerium für Forschung und Technologie, an einem Gutachten zur Entwicklungsozialwissenschaftlicher Gesundheitsforschung arbeitete. Dieser Gruppe gehörteauch 1I0na Kickbusch an, die spätere Archi-'tektin des Ottawa-Prozesses. Mangels einschlägiger Vorbilder bastelten wir damals aneiner Collage unterschiedlicher Ideen undAnsätze zum Thema »Gesellschaft undGesundheit«. Wesentliche Orientierungspunkte lieferte Ivan lilich mit seiner Kritikder Expertenmacht und seiner Forderungnach Übereignung der Gesundheit und derGesundheitskompetenz an die bisher allzusehr passivierten Konsumenten medizinischer Dienste (»empowerment«) (Il1ich1979). Ein zweites wichtiges intellektuelles
4
Vorbild war für uns Thomas McKeown(McKeown 1982) mit seiner nachdrücklichen Betonung krankmachender Einflüsseaus der Umwelt und dem Verhalten sowieArchibald Cochrane mit seiner These vonder inflationären Entwicklung der kurativenMedizin (Cochrane 1972). Dies alles fügtesich in unseren Köpfen zu einem Bild, indem die Gesundheitspotentiale der Gesellschaft in den Vordergrund und die HighTech-Medizin eher in den Hintergrund traten - ganz im Gegensatz zur damals undauch heute noch weithin herrschendenLehre, daß Investitionen in Gesundheitgleichzusetzen seien mit Investitionen indie moderne Akutmedizin.Unsere politische Vision gipfelte in der Forderung nach Autonomie und Selbsthilfe, undunsere wissenschaftlichen Arbeiten konzentrierten sich zunächst auf die soziale Unterstützungsforschung und die Entwicklungder Sozialepidemiologie (Badura 1981).
Ihr großes Engagement und die Teilnahmean internationalen Kongressen zum ThemaSelbsthilfe und Gesundheit ermöglichten1I0na Kickbusch Anfang der 8Der Jahre dannden Sprung aus der Wissenschaft in die Position eines »Regional Officers« für Gesundheitserziehung im Europäischen Büroder WHO in Kopenhagen. Hier konnte sieweitere wichtige Erfahrungen in SachenGesundheitspolitik (auch in Sachen Innenpolitik der WHO) sammeln, bis es ihrschließlich gelang, Halfdan Mahler, den damaligen Generalsekretär der WHO, davonzu überzeugen, daß es wieder einmal Zeitist für eine große Gesundheitskonferenzmit weltweiter Ausstrahlung. Daß die Wahlauf den Konferenzort Ottawa fiel, war ebenfalls alles andere als ein Zufall. Hier hattebereits der im Auftrag der kanadischen Bundesregierung erstellte Lalonde-Report, mitseiner Betonung der Achse »Umwelt undGesundheit«, wesentliche Vorarbeiten geleistet für eine Neuorientierung der Gesundheitspolitik. 1985, ein Jahr vor dieser denkwürdigen Konferenz, versuchten 1I0na Kick-
JOURNAL FÜR PSYCHOLOGIE
busch und der Senior-Autor dieses Artikelsso etwas wie eine intellektuelle Zwischenbilanz der wissenschaftlichen Grundlagender Gesundheitsförderung, die in dieKonzeption des Bandes llHealth PromotionResearch« mündete. Er konnte wegen notorischer hausinterner Verzögerungen erst1991 als offizielle Publikation von WHO Euro erscheinen (BaduraiKickbusch 1991).
ÖKONOMISCHE UND SOZIALE HERAUSFOR
DERUNGEN FÜR SALUTOGENE ANsÄTZE
Nicht nur die Bundesrepublik Deutschland,sondern die meisten westlichen Industriestaaten befinden sich in einem dynamischen Prozeß, der bisherige Organisationsund Produktionsprozesse als zu unflexibelerscheinen läßt. Die zunehmende internationale Konkurrenz auf den Weltmärktenbringen die Unternehmen in eine verschärfte Wettbewerbssituation mit zunehmendenSättigungstendenzen, dabei kommt es zueinem ständigen Innovationsdruck, der nureinen kurzen Produktionszyklus bei einerimmer längeren und aufwendigeren Forschungs- und Entwicklungsvorlaufzeit bietet (vgl. Ohmae 1985: 13). Der Aufwand zurErarbeitung der innovativen Basistechn0logie wird stetig größer. Der Zeitdrucknimmt zu, die innovativen Ideen für eigeneProdukte zu nutzen. Insgesamt zeichnetsich ein Strukturwandel in der Industriegeseilschaft ab. Breite Bereiche des sekundären Sektors lösen sich auf. Allein in den USAfand in den letzten 20 Jahren ein Rückgangum 25 -30% statt, wobei der tertiäre Sektoreine immer größere Bedeutung gewinnt(vgl. Omae 1985: 14). Auch die europäischeIntegration mit der Globalisierung von Märkten setzt Unternehmen unter einen verstärkten Wettbewerbsdruck.
Diese Faktoren haben für die Unternehmen, d.h. für die dort arbeitenden Menschen, konkrete Folgen. Für die Beschäftigten bedeutet dies oft eine Intensivierungder Arbeit. Sowohl in der Produktion, aberauch im Dienstleistungsbereich können
5. JAHRGANG, HEFT 3
ZEHN JAllAI; NACH._
zunehmende Überforderung jedoch konkrete negative Folgen für die Qualität vonProdukten oder Dienstleistungen haben.Viele Organisationen versuchen diesen dynamischen Einflußgrößen mit neuen Technologien sowie neuen Managementkonzepten zu begegnen. llLean management«,llKaizen« oder llBusiness Reengineering«setzen verstärkt den arbeitenden Menschen als Produktivkraft in den Mittelpunkt.Im Gegensatz zu den tayloristischen Ansätzen verlagern sich bei den neuen Konzepten die Anforderungen auf die geistigen undsozialen Fähigkeiten sowie auf Selbstverantwortung und das Engagement der Beschäftigten.
Auch wenn Gesundheitsförderungsexperten der Tatsache mit Skepsis gegenüberstehen: ihr Handeln wird zukünftig immerhäufiger an den zu erwartenden Kosten unddem volks- sowie betriebswirtschaftlichenNutzen gemessen werden. Je eher wir unsdarauf einstellen, um so besser wird es unsgelingen, zukünftig diese Erwartungen mitden Bedürfnissen der Beschäftigten vor Ortund mit unserem eigenen professionellenSelbstverständnis in Einklang zu bringen.Aus volkswirtschaftlicher Sicht trägt Gesundheitsförderung dazu bei, Kosten, dieden GKV, aber auch den Unfallversicherungsträgern, entstehen, etwa durch Invalidität, Krankengelder oder Reha-Maßnahmen, zu verhindern bzw. zu verringern.Gesundheitsförderung trägt ferner dazu bei,daß Beschäftigte, insbesondere hochqualifiziertes Fachpersonal. den Unternehmenlänger zur Verfügung stehen, d.h. Frühverrentung verhindert oder hinausgeschobenwird. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht lassen sich Kosten spezifizieren, die sich ausAbsentismus, innerer Kündigung, Fluktuation, verringerter quantitativer/qualitativer Arbeitsleistung sowie Produktionsausfällen ergeben. Indirekte Kosten für ein Unternehmen ergeben sich aus den Arbeitgeberanteilen an den Sozialversicherungsbeiträgen.Ein Trend, der nicht zuletzt auch ökonomi-
5
8. fIADtJRAU. W. RITIER
sche Auswirkungen hat, ist der demographische Wandel in der Bundesrepublik Deutschland. Eine zunehmend älter werdende Arbeiterschaft stellt die derzeitige Frühberentungspolitik in Frage. Sowohl aus volkswirtschaftlicher als auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht erscheinen »gesunde« Arbeitsplätze sinnvoller als ein vorzeitiger Verschleiß der Arbeitskraft durch arbeitsbedingte Erkrankungen oder Berufskrankheiten. Die Berufsgenossenschaften haben1992 rund 7 Mrd. DM für Renten an Erkrankte, Verletzte und Hinterbliebene ausgegeben, davon entfielen über 70% auf dieErkrankten und Verletzten (HVBG 1993).Jede fünfte Frühinvalidenrente wird aufgrund eines Rückenleidens ausgezahlt (vgl.Konstanty 1992: 9).Der Versuch, auf diese Anforderungen mitden bisherigen traditionellen Arbeitsschutzstrukturen zu reagieren, erscheint wenigerfolgversprechend. Technisch-normierteRahmenrichtlinien sowie medizinische Erkenntnisse sind im betrieblichen Arbeitsund Gesundheitsschutz immer noch vorherrschend. Entscheidend dabei ist, daß dieinstitutionelle Logik des Arbeitsschutzsystems sich bislang fundamental an Vorschriften und formalen Normen orientiert. Insofern fällt es den Akteuren schwer, sich überhaupt außerhalb des Einflusses bestehender Vorschriften und Normen durchzusetzen, denn »nicht normiertes oder normierbares Präventionswissen ist über dieseHandlungsmuster kaum zu transportieren«(Pröll 1991: 152).
NEUE SALUTOGENE DENKANSTÖSSE DURCH DIE
O'rrAWA-CHARTA
Die lange vorherrschende pathogene Sichtweise greift heute zu kurz. Die sich nun herausbildenden Arbeits- und Produktionsstrukturen erfordern einen Wandel derbetrieblichen Gesundheitspolitik von der Pathogenese zur Salutogenese. Eine entscheidende Zielsetzung von Gesundheitsförderungspolitik sollte das Wohlbefinden unddie Gesundheit der Beschäftigten sein. Sie
6
läßt sich messen durch Indikatoren, die sichauf den seelischen, sozialen und körperlichen Zustand der Beschäftigten beziehen,sowie durch Indikatoren der in einem Unternehmen wirksamen Gesundheitspotentialeund Risikofaktoren. Im Vordergrund solltedabei die Förderung der Gesundheitspotentiale stehen. Sie verspricht in der modernenArbeitswelt den größten Gesundheitsgewinn und erhöht zugleich die Fähigkeit zurschädigungsfreien Bewältigung unvermeidlicher Belastungen und befristeter Überforderungen. Diesem von der Ottawa-Chartapropagierten salutogenen Konzept schließtsich auch das Europäische Parlament sowie der Rat der Europäischen Union an, dieein Aktionsprogramm zur Gesundheitsförderung damit begründen, daß dieser Wandel einen deutlichen Einfluß auf die Sozialkosten haben kann:
»Das wichtigste Kennzeichen der Bemühungen um Gesundheitsförderung mußsein, daß sie stets gesundheitsorientiertsind, nicht krankheitsorientiert. Dies bedeutet, daß sich die Gesundheitsförderungnicht mit medizinischer Versorgung, Behandlung und Betreuung befaßt, sondernbei konsequenter Durchführung zu einerSenkung der Kosten von Behandlung undGesundheitsversorgung führen kann.« (Mitteilung der EU-Kommission 1994)
Diese Form der Gesundheitspolitik ist mitdem traditionell eher pathogen geprägtenGesundheitsbegriff schwer durchführbar.Insofern ist statt eines statischen auf»Krankheit« fixierten Begriffs eine dynamische Definition, die auf die Interdependenzvon Personen und Umwelt setzt, eine treffendere Prämisse. Gesundheit ist eine Fähigkeit zur Situationsbewältigung - z.B. zurBewältigung von Problemen bei der Arbeit -,durch die ein positives Selbstbild, positiveGefühle und körperliches Wohlbefinden erhalten oder wiederhergestellt werden. Gesundheit ist beides: Voraussetzung und Ergebnis einer kontinuierlichen Auseinander-
JOURNAL FÜR PSYCHOLOGIE
ZEHN
setzung des Menschen mit seinen sozialenund physischen Lebensbedingungen in derArbeitswelt, in der Familie und in der Freizeit gleichermaßen. Soziale und fachlicheKompetenzen sowie ein positives und stabiles Selbstwertgefühl bilden wichtige persönliche Gesundheitspotentiale. Ein Klimagegenseitiger Unterstützung, gut geplanteArbeitsabläufe und ausreichende Handlungsspielräume bilden wichtige soziale undorganisatorische Gesundheitspotentiale.Förderung persönlicher und betrieblicherGesundheitspotentiale sollte ein zentralerBestandteil von Gesundheitsförderung sein(Badura, 1993: 76). Die WHO plädiert somitauch für eine Reorientierung der gesundheitspolitischen Prioritäten:
- von häufigen monokausalen biomedizinischen Leistungen zu einer vernetzten undvorausschauenden Umwelt- und Strukturpolitik,- von expertenorientierten lltop downll-Ansätzen zu partizipatorischen llbottom UPllVerfahren,- von pathogenen Fragen bzw. krankheitsorientierten Konzepten zu salutogenen Bemühungen, d.h. zur Erschließung von Gesundheitspotentialen (Badura 1993 b: 21).
Das Wissen über Gesundheitsrisiken undkrankheitsbegünstigende Arbeitsbedingungen - im Sinne der pathogenen Fragestellung - ist recht umfassend erforscht. Auf diesem Hintergrund überwiegen jedoch in derForschung ))negative Gesundheitsbegriffell ,also Gesundheit wird als Abwesenheit vonKrankheit definiert (vgl. Udris et al. 1994:198). Der klassische Verhütungsbegriff hatdie Gesundheitsschutzziele bisher auf dieseVorstellung vom llFreisein von Krankheit undUnfällenll fixiert. Soll Gesundheitsförderungjedoch als qualitativ hochwertig begriffenwerden, so muß sie sich an den aktuellenRahmenbedingungen und zukünftigen Herausforderungen orientieren und ein integratives Handlungskonzept darstellen, daß vor allem die salutogenen Einflüsse gerade in der
5. JAHRGANG, HEFT 3
Arbeitswelt fördert. Was wissen wir darüber?Melvin Kohn und seine Mitarbeiter habendurch ihre Studien, die in zahlreichen international vergleichenden Arbeiten repliziertwurden, den Zusammenhang zwischen denobjektiven Arbeitsbedingungen einerseitsund dem Selbstbild, der intellektuellen undsozialen Kompetenz der Beschäftigten andererseits betont. Nach ihren Ergebnissenhat intellektuell anspruchsvolle Arbeit, dieeigenständige Initiative und Urteilskraft fordert, einen persönlichkeitsfördernden Einfluß. Intellektuelle Unterforderung wirktsich längerfristig negativ aus, da sie zumVerlust von Problemlösungskompetenzenbeiträgt.Ähnliches gilt nach Kohn et al. für die mitanspruchsloser Arbeit oft einhergehendenBedingungen wie geringer Handlungsspielraum und hochgradige Routinisierung derArbeit (Kohn 1990). Gerade die Gesundheitsrelevanz von Handlungsspielräumenbei der Arbeit ist durch eine Reihe von Untersuchungen (Karasek/Theorell 1990; Sigrist 1996) gut belegt. Handlungsspielräumebeeinflussen die wechselseitige Adaptabilität von Arbeitsaufgaben und Arbeitsleistungen an die spezifischen Bedürfnisseund Befähigungen der Beschäftigten undbilden deshalb eine wesentliche Voraussetzung schädigungsfreier Problemlösung. Neben der Komplexität der Arbeitsaufgabenund den zu ihrer Bewältigung gewährtenHandlungsspielräumen, haben insbesondere die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatzeine erhebliche Gesundheitsrelevanz. Positiv bewertete soziale Kontakte und Interaktion gelten als Gesundheitspotentiale,wie dies Studien über soziale Unterstützungbelegen (Pfaff 1988).
llStreßlI ist eines der populärsten Stichworte zum Thema Arbeit und Gesundheit. Vonbesonderer Bedeutung sind Arbeitsbedingungen, die chronische Überforderung imquantitativen und qualitativen Sinne hervorrufen. Diese chronischen Stressoren können sich zum einen aus der Aufbauorga-
7
8. BAooAA u. W. RITTER
nisation selbst (Komplexität und Umfang),aber auch aus der Ablauforganisation (Arbeitszeit und Qualifikation) und den sozialenBeziehungen (Konflikte mit Vorgesetzten,Kollegen etc.) ergeben. Auch hierfür gibt eseine Reihe von Studien mit z.T. konkretenHinweisen auf Möglichkeiten gesundheitsförderlicher Arbeitsgestaltung (vgl. BaduralPfaff 1989). Gesundheitspotentiale wieQualifikation, soziale Unterstützungen oderHandlungsspielräume lassen die pathogeneSichtweise. die auch in der Streßthesenoch enthalten ist. als nicht mehr zeitgemäß erscheinen.Salutogene Einflüsse in der Arbeitsweltmüssen dementsprechend Gesundheitsförderung im Kontext der Arbeits- und Organisationsgestaltung sehen. Verhalten undVerhältnisse stehen in enger Wechselwirkung miteinander. Jede Strategie der Gesundheitsförderung muß sich dessen bewußt sein. Die Arbeitsbedingungen wurdenin der betrieblichen Gesundheitsförderungder Bundesrepublik bisher zu sehr vernachlässigt. Experten für Gesundheitsförderungmüssen zukünftig nicht nur verstärkt mit Arbeitsschützern, sie müssen vor allem auchverstärkt mit Ingenieuren und Betriebswirten zusammenarbeiten, wenn aus der Vision einer vorausschauenden Gesundheitsförderung durch Arbeits- und Organisationsgestaltung Realität werden soll. Gesundheitsförderung und Organisationsentwicklung bilden somit einen integrativen Ansatzzur Salutogenese von Arbeit. Daraus folgtdie Notwendigkeit zur Entwicklung integrierter, d.h. abgestimmter, am Menschenund seiner Arbeitsumwelt ansetzender Interventionskonzepte.
UMSETZUNG DER OTTAWA-CHARTA IN BETRIEB
LICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNGSPRAXIS
Gerade der Arbeitsplatz biete wie kaum einanderer Ort die Möglichkeit, ein umfangreiches, langfristiges Präventionsprogrammmit großen, relativ konstanten Personengruppen durchzuführen, die darüber hinausaus präventivmedizinischer Sicht derzeitig
8
eine besonders günstige Altersstruktur aufweisen. Längerfristig sollte eine Integrationvon arbeitswelt- und gemeindebezogenerGesundheitsförderung angestrebt sowieeine nicht nur verhaltens-, sondern aucheine strukturbezogene Gesundheitsförderung betrieben werden. Bezogen auf dieBetriebe bedeutet das eine Gesundheitsförderung. die durch Maßnahmen der Arbeits- und Organisationsgestaltung dazubeiträgt, sowohl die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern als auch das Betriebsergebnis zu verbessern. Eine Strategie der betrieblichen Gesundheitsförderung muß daher mehrere Zielbündel berücksichtigen, und sie muß nicht nur kurz,sondern auch mittel- und längerfristig ausgerichtet sein (vgl. Kirschner et al.: 1995).Gesundheitsförderung sollte:
1. Gesundheitspotentiale für Beschäftigtemobilisieren sowie die Steigerung ihrerKreativität, Selbstvertrauen und der Einsatzbereitschaft ermöglichen.2. Zu einer Verringerung krankheitsbedingter Fehlzeiten, längerfristigem Erhalt der Arbeitskraft und Verhütung krankheitsbedingter Frühberentung beitragen.3. Als Unternehmensziel anerkannt, strukturell abgesichert sein durch Einstellung entsprechenden Personals und Bereitstellungvon Ressourcen.4. Neue Instrumente zur Diagnostik und Intervention hervorbringen und einer systematischen Evaluation unterzogen werden.
Die von vielen Krankenkassen entwickeltenModelle der betrieblichen Gesundheitszirkel versuchen das beschriebene Zielbündelin ein Stufenkonzept zu integrieren. Neben derAnwendung der klassischen Arbeitsschutzmaßnahmen zur Verminderung von Krankheiten, werden auch gesundheitsförderndeAspekte, wie beispielsweise Förderung inder Persönlichkeitsentwicklung und Kreativität von Beschäftigten für mehr Arbeitszufriedenheit, berücksichtigt. Insgesamtliegt dieser Methode ein verhaltens- und
JOURNAL FÜR PSYCHOLOGIE
verhältnisorientierter Ansatz zugrunde, derdie Beschäftigten an den Planungs- undUmsetzungsprozessen beteiligt.
Das Verfahren der llbetrieblichen Gesundheitsberichte, und Gesundheitszirkel« ist einsolches integriertes Konzept, das sich ausden Instrumenten bzw. Phasen »Gesundheitsberichtec, IIMitarbeiterbefragungec, llGesundheitszirkel« und llUmsetzung der erarbeiteten Verbesserungsvorschläge« zusammensetzt. Die in einer Phase erzieltenErgebnisse, Daten und/oder Informationensind für das effektive Funktionieren dernächsten Stufe von großer Bedeutung. Erstdie im Gesundheitsbericht erhobenen Daten über Krankheitsauffälligkeiten in bestimmten Organisationsbereichen ermöglichen den Entscheidungsträgern, den Interventionsbereich für die nachfolgenden Stufen festzulegen. Die Grundidee jeder betrieblichen Maßnahme zur Gualitätssicherung ist die Entwicklung von Lernschleifenzur Selbstbeobachtung und Zurückmeldung, über den Zustand von Strukturen,Prozessen und Ergebnissen mit dem Ziel einer kontinuierlichen Fehlersuche, einer kontinuierlichen Verbesserung oder bei Bedarfauch einer grundsätzlichen Überarbeitungvon Aufbau- und Ablauforganisation. Lernschleifen enthalten die immer gleichenSchritte der Situationsanalyse (z.B. Gesundheitsbericht, Mitarbeiterbefragungl. derZielsetzung (z.B. Bestimmung des Interventionsortes und der Interventionsartdurch betriebliche Entscheidungsträger),der durchgeführten Intervention (z.B. Gesundheitszirkell und der Evaluation. Mehrfach durchlaufene Lernschleifen sollten zueiner Lernspirale und diese zu einem sichselbsttragenden, lernenden System führen(Badura/Ritter 1996).
NEUORIENnERUNG DER GESUNDHEITS- UND So2IALPOUTIK: DIE GESUNDHEITSFÖRDERUNG AM
SCHEIDEWEG
Die skizzierte Vorgehensweise einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsförderung
5. JAHRGANG, HEFT 3
konnte bisher erst ansatzweise entwickeltund erprobt werden. Mitte 1996 deutetensich dann erhebliche Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen an, die derGKV für die betriebliche Gesundheitsförderung die weitgehenden Kompetenzen entzogen. In den Vordergrund rückten hier dieGesetzlichen Unfallversicherer (GUV), diebis dato den klassischen Arbeitsschutz abdeckten. Entscheidend für diesen Akteurswechsel waren eine Reihe von Gesetzen:
1. Das Beitragsent\astungsgesetz (BeitrEntlG),das die Kompetenzen der Kassen hinsichtlich der Gesundheitsförderungsaktivitätenneu festlegt (§20 SGB V).2. Die Gesetzesentwürfe zur Neuordnungvon Selbstverwaltung und Eigenverantwortung in der gesetzlichen Krankenversicherung (1. und 2. NOG).3. Das neue Arbeitsschutzgesetz, das diebisherigen EG-Rahmenrichtlinien in nationales Recht umsetzt.4. Das Gesetz zur Einordnung der gesetzlichen Unfallversicherung in das SGB VII.5. Die Kürzungen der Lohnfortzahlungen imKrankheitsfall (vgl. BKK-News 2/96: 6).
Die einzelnen Novellierungen sollen in diesem Artikel nicht in allen Einzelheiten kommentiert und diskutiert werden. Die meisten Änderungen zielen auf eine verstärkteKompetenzzuweisung für die Unfallversicherer, ohne dabei die hierfür nötigenInstrumente näher zu beschreiben. Auf dereinen Seite wird damit die langgeforderteVernetzung aller am Arbeits- und Gesundheitsschutz beteiligten Akteure forciert,gleichzeitig werden jedoch durch dasBeitrEntlG und das NOG bestehende und inEntwicklung begriffene Strukturen bei denKassen stark beschnitten bzw. abgebaut.Zudem führt die Rückbindung an die klassischen Strukturen des Arbeitsschutzes unterder Federführung der einzelnen Berufsgenossenschaften zu erheblichen Schnittstellen- und Kooperationsproblemen. Sicherlichbedeutet die Schwerpunktlegung der ge-
9
B. BADtI~IA U. W. RITTER
setzlichen Regelungen auf die GUV und Arbeitgeber nicht das unmittelbare und sichere llAus« für die Krankenkassen im Bereichder betrieblichen Gesundheitsförderung.Immer noch haben viele Kassenverbändestarke Ressourcen und Wissensbeständefür dieses Politikfeld. Insofern leuchtet nichtunbedingt ein, warum bestehende und sichlangsam etablierte Kompetenzen unter denAkteuren umverteilt werden sollen und dieUnfallversicherer plötzlich mit völlig neuenAufgaben beauftragt werden. Wie und mitwelchen Akteurskonstellationen lassen sichzukünftig sinnvolle Gesundheitsförderungsaktivitäten durchführen? Welchen Wegwird die Gesundheitsförderung gehen?
Mit den Berufsgenossenschaften hat zwarnicht ein neuer Akteur das Politikfeld llbetriebliche Gesundheitsförderung« betreten.Jedoch ist diese Institution weitaus eherdem traditionellen Arbeitsschutz verpflichtet, als den vorliegenden Erkenntnissen zurbetrieblichen Gesundheitsförderung. Wieund in welchem Umfang die GKV und GUVan dem Bestehen bzw. der Weiterentwicklung der Gesundheitsförderung beteiligtsein werden, hängt von einer Reihe Punktenwie Handlungsoptionen, Kompetenzen,Strategien, Machtpotentiale, aber auch Unterstützung durch gesetzliche Rahmenbedingungen, ab. Die zukünftige Gestaltungvon Gesundheitsförderung ist daher weitgehend unklar. Daher sollen hier kurz diebisherigen Konfliktpunkte und die sich evtl.hieraus ergebende Marginalisierung derbetrieblichen Gesundheitsförderung zwischen den GKV und den GUV aufgezeigtwerden. Es sollen aber auch die Kooperationsmöglichkeiten zwischen den beidenAkteuren dargestellt werden.
Mögliche Konfliktpunkte sind die bereitsoben angedeuteten institutionellen Selektionsprozesse und Defizite des klassischenArbeitsschutzsystems. Konkrete Gefährdungsexpositionen llmüssen« messbar undstreng naturwissenschaftlich belegbar sein.
10
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen tragen zu dieser Konkretisierung wenig bei, dahier die GUV mit ihrem Regelwerk das Abstraktionsniveau mit arbeitswissenschaftIich abgesicherten Instrumentarien undGefährdungspunkten ausfüllen. Die bereitsbeschriebenen Gesundheitsförderungskonzepte, aber auch das neue Verständnisvon Gesundheit, genügen diesen »dinglichen« bzw. technisch-normierbaren Ansprüchen nicht und werden es schwerhaben, sich durch die llinstitutionellen Filter« der Unfallversicherer durchzusetzen.Das Festhalten der Berufsgenossenschaften an den alten Leistungskatalogen, dieimmer noch von der unmittelbaren Meßbarkeit von Gefährdungsexpositionen ausgehen, scheint diese Annahmen zu stützen.
Ein weiteres mögliches Konfliktpotentialstellt u. E. auch die bisherige IIBedarfsorientierung« der Berufsgenossenschaftenam Klientel der Unternehmen dar. Geradedie GUV sehen die Gefahr, daß durch denneugeschaffenen Dualismus von Kassenund Berufsgenossenschaften, den Betrieben doppelte Belastungen auferlegt werden. Es ist anzunehmen, daß die Bedarfsangebote der Berufsgenossenschaften sichhier wohl an der Nachfrage der Unternehmen orientieren werden, nicht zuletzt, weilihre anteilige Finanzierung durch die derBetriebe gedeckt wird. Hier wird nicht derobjektive Bedarf an Prävention und Gesundheitsförderung entscheiden, sondernsich möglicherweise die unproblematischste Version für die einzelnen Betriebedurchsetzen. Die Forderung vieler Unternehmen nach der Umsetzung des Gesetzesfür Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall lassen nicht gerade auf einen Bedarf nachkomplexen und aufwendigen Gesundheitsförderungsprogrammen schließen. DerKrankenstand soll schnell und kostensparend gesenkt werden.Trotz der zahlreichen Schnittstellenprobleme und Konfliktpotentiale, gibt es eine Reihe von Anknüpfungspunkten, die die bei-
JOURNAL FÜR PSYCHOLOGIE
den Hauptakteure in dem Politikfeld »betriebliche Gesundheitsförderung« kooperationsfähig erscheinen lassen. Hier kann auf diebestehenden Kooperationsversuche zwischen Kassen und verschiedenen Berufsgenossenschaften, wie etwa das KOPAGProgramm zwischen dem Bundesverbandder BKK und dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, hingewiesen werden. Ferner sind von der AOKKooperationen mit den Berufsgenossenschaften geplant. Sowohl auf sektoraler alsauch auf regionaler Ebene ließen sich hierdie jeweiligen Kompetenzen und Wissensbestände zusammenführen. Auf der Seiteder Berufsgenossenschaften sind hier diehohen betrieblichen Kompetenzen sowiederen starke fachliche Spezialisierung aufBranchenebene zu nennen. Starke Anknüpfungspunkte für die Kassen stellen insbesondere die teilweise Nutzung der bereitsvorhandenen Präventionsinstrumente beiden Berufsgenossenschaften dar. Hier sehen auch die GUV Chancen, den Routinedatenbestand der Krankenkassen für eineZielpopulations- und Bedarfsermittlung zunutzen. Die salutogen orientierten und aufsozialwissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Gesundheitsförderungskonzepteder GKV können die technisch und medizinisch geprägten Interventionen sinnvoll ergänzen bzw. erweitern und tendenziell auchsublimieren.Für ein kooperatives Handeln der beidenAkteure im Hinblick auf eine integrative undqualitativ hochwertige Gesundheitsförderung sind u.E. jedoch einige Voraussetzungen zu erfüllen, die hier thesenartig dargestellt werden sollen.
1. Erhebliche Bedeutung für kooperativesHandeln kommt den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu. Staatliche Steuerungspolitik kann hier einen Anstoß zu einem Interessen- und Machtausgleich geben, um somit eine ausgewogene Gesprächsbasis fürdie zukünftigen Möglichkeiten von Arbeitsund Gesundheitsgestaltung zu schaffen
5. JAHRGANG, HEFT 3
ZEHN ,JAI1~ "AQ1•••
(vgl. Kuhn 1995). Kurzfristige und einseitigeKompetenzzuweisungen sowie die Beschränkung auf rein ökonomische Probleme erschweren eine qualitativ hochwertigeund integrative Gesundheitsförderung. DaßBelastungen, Beanspruchungen und darausresultierende Fehlzeiten beispielsweisedurch Lohnfortzahlungsgesetze bekämpftwerden, verkennt u.E. die meist polykausalen Zusammenhänge der Probleme undkonzentriert sich somit vorwiegend aufkurzfristig wirksame Ergebnisse bzw. Erfolge.
2. Prinzipiell sollte bei allen Akteuren derGesundheitsförderung ein grundlegendesVerständnis von Qualitätsstandards für Diagnostik, Intervention und Evaluation herrschen. Hier sind keine apodiktischen Festschreibungen von seiten staatlicher Akteure gefragt, sondern vielmehr ein breitesKonsensusverfahren von Arbeits- und Gesundheitsschutzexperten und Beteiligtenaus der Praxis. Für die Schaffung solcherStandards werden konzertierte Aktionennötig sein (vgl. BaduralRitter 1996 b).
3. Gemeinsame Standardsetzung kann institutionelle Egoismen der einzelnen Akteure minimieren und ein kooperatives Handeln im Politikfeld ))betriebliche Gesundheitsförderung« entwickeln helfen. Als zukünftige ))Vision« sollte eine ))ProfessionGesundheitsförderer« stehen, die sich dengeschaffenen Qualitätsstandards und -anforderungen über den institutionellen Grenzen und Verständnissen hinweg verpflichtetfühlt.
Das Gelingen der von uns als Idealtypus skizzierten Gesundheitsförderung wird sowohlinnerhalb der Unternehmen als auch aufsektoraler und regionaler Ebene von derKooperation aller Akteure abhängen. Dieneuen einseitig ausgerichteten Rahmenbedingungen, verbunden mit den möglicheninstitutionellen Egoismen, drohen die Gesundheitsförderung zu marginalisieren.
11
B. BADUaA U. W. RITTER
LiteraturBADURA, B.; RITTER, W. (1996): Die betriebliche
Gesundheitsförderung - Herausforderungen, Defizi
te, Gewinne und Entwicklungsaufgaben. In: Doku
mentation zur Veranstaltung »Wirksam Gesundheit
fördern - Vielfältig und Vernetzte< am 01.11.1995
vom BKK-Landesverband Nord, Hamburg
BADURA, B.; RITTER, W. (1996 b): Oualitätssiche
rung in der betrieblichen Gesundheitsförderung
Die Entwicklung einer Projektskizze. In: Eva Bam
berg et al. (Hrsg.) (Voraussichtlich 1997): Betrieb
liche Gesundheitsförderung (Arbeitstitel). Wien
BADURA, B./GRANDE, G./JANßEN, H./SCHOTT, T.
(Hg.) (1995): Oualitätsforschung im Gesundheitswe
sen. Ein Vergleich ambulanter und stationärer kar
diologischer Rehabilitation. Weinheim, Juventa
BADURA, B./KJCKBUSCH, I. (Ed.) (1991): Health Pro
motion Research: towards a new social epidemiolo
gy. World Health Organization. Regional Office of
Europe, Copenhagen, Bd. 37, Eigendruck
BADURA, B. PFAFF, H. (1989): Streß, ein Modernisie
rungsrisiko? Mikro- und Makroaspekte soziologi
scher Belastungsforschung im Übergang zur postin
dustriellen Zivilisation. In: Kölner Zeitschrift für So
ziologie und Sozialpsychologie, 41. Jg., 4, S. 644-008
BADURA, B. (1993): Gesundheitsförderung durch Ar
beits- und Organisationsgestaltung. Die Sicht des
Gesundheitswissenschaftlers. In: Pelikan, J.lDem
mer, H./Hurrelmann, K.: Gesundheitsförderung
durch Organisationsentwicklung. Weinheim/Mün
chen, Juventa, S. 20-33
BADURA, B. (1993b): Soziologische Grundlagen der
Gesundheitswissenschaften. In: Hurrelmann/Laaser
(Hg.): Gesundheitswissenschaften. Handbuch für
Lehre, Forschung und Praxis. Weinheim/ Basel;
Beltz, S. 63-90
BADURA, B. (Hg.) (1981): Soziale Unterstützung und
chronische Krankheit: zum Stand sozialepidemiol0
gischer Forschung. Frankfurt a.M., Suhrkamp
COCHRANE, A. (1972): Effictivness and efficiency:
Random refleetions on health services. London, The
Rock Carling Fellowship
EUROPÄISCHE KOMMISSION (1994): Mitteilung der
Kommission über Gesundheitsförderung, Aufklä
rung, Erziehung und Ausbildung im Zuge des Ak
tionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesund
heit. Generaldirektion V, Rev. 6.5, Luxemburg
GEORG, A. (1994): Literaturbericht. Teilstudie im
12
Projekt - Betriebsratshandeln im präventiven Ar
beitsschutz-. Sozialforschungsstelle Dortmund Lan
desinstitut. Dortmund, Eigendruck
HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOS
SENSCHAFlEN (1993): Geschäfts- und Rechnungser
gebnisse der gewerblichen Berufsgenossenschaf
ten '92. St. Augustin
ILUCH, I. (Hg.) (1979): Entmündigung durch Exper
ten: zur Kritik der Dienstleistungsberufe. Hamburg,
Rowohlt
KONSTANlY, R. (1992): Hallo Grenzwert: Das ge
schundene Rückgrat. In: Forum Arbeit. Magazin für
Arbeitspolitik und Arbeitsumwelt. Heft 3/92, S. 3
KUHN, J. (1995): Entstehung und Zielsetzung des
Arbeitskreises »Betriebliche Gesundheitsförde
runge< im Verein Gesundheit Berlin e.V. In: Pröll, U.
u.a. (Hg.): Regionale Kooperationsnetzwerke Arbeit
und Gesundheit. Modelle-Projekte-Erfahrungen Ta
gungsdokumentation. Duisburg, WAZ-Druck, S. 31-37
MCKEOWN, T. (1982): Die Bedeutung der Medizin:
Traum, Trugbild oder Nemesis. Frankfurt a.M., Suhr
kamp
OMAE, K. (1985): Die Macht der Triaden: die neue
Form des weltweiten Wettbewerbs. Wiesbaden,
Gabler
PFAFF, H. (1988): Streßbewältigung und soziale Un
terstützung. Weinheim, Deutscher Studien Verlag
PRÖLL, U. (1995): Arbeit und Gesundheit als Ge
genstand institutionenübergreifender Zusammenar
beit in der Region. In: Pröll, U. u.a. (Hg.): Regionale
Kooperationsnetzwerke Arbeit und Gesundheit. Mo
delle-Projekte-Erfahrungen. Tagungsdokumentation.
Duisburg, WAZ-Druck, S. 11-30
RITTER, W. (1994): Gesundheitszirkel und Mitarbei
terpartizipation im betrieblichen Arbeits- und Ge
sundheitsschutz. Unveröffentlichte Diplomarbeit an
der Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, Bie
lefeld
SIEGRIST, J. (1996): Soziale Krisen und Gesundheit:
Eine Theorie der Gesundheitsförderung am Beispiel
von Herz-Kreislauf-Risiken im Erwerbsleben. Göttin
gen/Bern!Toronto/Seattle, Hogrefe
UDRIS, I; RIMANN, M; THALMANN, K. (1994): Ge
sundheit erhalten, Gesundheit herstellen: Zur Funk
tion salutogenetischer Ressourcen. In: Bergmann,
B. /Richter, P. (Hg.): Die Handlungsregulationstheo
rie. Von der Praxis einer Theorie. Göttingen,
Hogrefe, S. 198-217
JOURNAL FÜR PSYCHOLOGIE