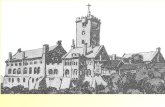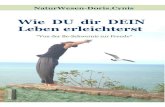Bild' Dir Dein Ergebnis
Transcript of Bild' Dir Dein Ergebnis
Nachrichten aus der Chemie | 59 | Juli I August 2011 | www.gdch.de/nachrichten
Forschung und Bildung �Notizen� 703
Bild' Dir Dein Ergebnis � Zahlenwerte laden zum Zweifeln ein: Ist dieses Maximum vielleicht nur ein Ausreißer, stimmt jene Null-stelle, und können wir uns über die dritte Dezimalstelle überhaupt noch sicher sein? Quantitative Messver-fahren haben in vielen Gebieten Fortschritt gebracht, wo vorher nur eine qualitative Aussage möglich war, aber genau wegen der punkt-genauen Exaktheit, die sie uns ver-sprechen, sind wir stets geneigt, die Zahlen zu hinterfragen, auch und gerade dann, wenn sie zu einer an-sprechenden Grafik verarbeitet wur-den.
Diese Kritikfähigkeit kann aber schlagartig verschwinden, wenn die Ergebnisse gleich als Abbildungen der untersuchten Objekte daher-kommen. Etwa als fluoreszenzmi-kroskopische Aufnahme von einer lebenden Zelle oder als Querschnitt durch ein denkendes Hirn, möglich dank der Kernspintomographie. Was wir da sehen, ist ja ein Abbild der Wirklichkeit, also muss es ja stim-men – es sei denn, jemand hätte es absichtlich gefälscht. Oder etwa nicht?
Wenn wir so ein ansprechendes Bild von einem natürlichen Objekt betrachten, vergessen wir nur zu gerne, dass es das Resultat von höchst artifiziellen Bildgebungsver-fahren ist, die in den meisten Fällen einfach eine sonst unüberschaubare Menge von Zahlen der Geographie des untersuchten Objekts zuordnen. Bei der funktionellen Kernspintomo-graphie wird zum Beispiel die Sauer-stoffverteilung im Gehirn gemessen. Höhere Sauerstoffkonzentrationen deuten auf erhöhte Hirnaktivität hin. Alle Vorsichtsmaßnahmen, mit denen wir Zahlenergebnisse behan-deln, sollten also auch für solche Bil-der gelten, selbst wenn sie noch so schön sind.
Hirnforscher Craig Bennett er-reichte breite Aufmerksamkeit für dieses Problem, indem er ein ganz normales und selbstverständliches (wenn auch skurril anmutendes) Kontrollexperiment durchführte. Wie der Spiegel ausführlich und ge-
nüsslich berichtete, schob Bennett einen toten Lachs in seinen Kern-spintomographen und konfrontierte das Tier mit Bildern von Menschen in verschiedenen Emotionszustän-den.
Bennett erhielt ein unerwartetes Ergebnis, das er folgerichtig im Jour-nal of Serendipitous and Unexpected Results publizierte.1) Sein Lachs zeig-te nämlich durchaus Hirnsignale, die er als psychologisch relevante Ergeb-nisse hätte interpretieren können, wenn er nicht genau gewusst hätte, dass sein Proband zu psychologi-schen Reaktionen unfähig war. Scho-ckierend war vor allem der zweite Teil von Bennetts Nachforschungen. Durch Literaturstudien fand er he-raus, dass mehr als ein Viertel der in angesehenen Journalen publizierten Hirnstudien die nötigen Korrekturen und Kontrollen nicht verwendet hat-ten.
Demnach dürfte ein guter Teil der oft und gerne in der allgemeinen Presse verbreiteten Studien darüber, welche Hirnregionen aktiv werden, wenn man beim Einparken an sein Schatzerl denkt, etwa genauso aus-sagekräftig sein wie die tomographi-schen Bilder von Bennetts Lachs.
Vorsicht ist auch bei diagnosti-schen Verfahren geboten – nur weil
„Anstelle eines Ge-
hirns nur pech-
schwarze Leere!“
„Aber womit
erkennt er im Test
dann sogar schwie-
rige chemische For-
meln?“ (Cartoon:
Roland Wengen-
mayr, Frankfurt)
ein Verfahren ein Bild von einem un-tersuchten Organ und nicht nur ei-nen Zahlenwert ausspuckt, muss die suggerierte Information nicht unbe-dingt korrekt und relevant sein.
Es ist in gewisser Weise verständ-lich und natürlich, dass wir durch das, was wir „mit unseren eigenen Augen“ zu sehen glauben, leichter verführbar sind als durch Informa-tionen, die auf intellektuelleren Ka-nälen empfangen werden.
Andererseits sollte sich heute, da jeder seine Fotos zuhause am Com-puter bearbeiten und manipulieren kann, doch auch die rationale Er-kenntnis durchsetzen, dass ein Bild nicht immer recht hat. Es sagt viel-leicht mehr als tausend Worte, doch womöglich enthält ein Bild nicht mehr nützliche Information als die Zeitung gleichen Namens.
Michael Groß www.michaelgross.co.uk
1) C. M. Bennett, A. A. Baird, M. B. Miller,
G. L. Wolford, JSUR 2010, 1, 1–5. Leider
ist der Beitrag „Neural Correlates of In-
terspecies Perspective Taking in the
Post-Mortem Atlantic Salmon: An Ar-
gument for Proper Multiple Compari-
sons Correction“ bisher der einzige Ar-
tikel in diesem neuen, vielverspre-
chend klingenden Journal.