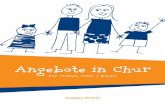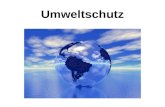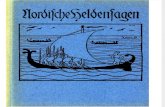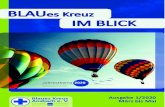Blaues Kreuz Quartalszeitschrift Nr. 2 2014
-
Upload
blaues-kreuz-zuerich -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Blaues Kreuz Quartalszeitschrift Nr. 2 2014
blaues kreuzFür Lebensqualität. Gegen Abhängigkeit.
blaueskreuzzuerich.ch Ausgabe 2_ 2014
JA!zur kantonalen Volksinitiative «Keine W
erbung
für alkoholische Getränke auf Sportplätzen sowie
an Sportveranstaltungen im Kanton Zürich»
Abstimmungsempfehlung zum 18. Mai 2014:
© Patrick B. K
raem
er, K
eystone
2
blaueskreuzzuerich.ch Ausgabe 2_ 2014
Darum geht es
Alkoholwerbung und gesunder Sport sind unvereinbar
Weil Alkoholwerbung den Alkoholkonsum fördert. Insbesondere bei leicht beeinflussbaren Kindern und Jugendlichen.Sport wird positiv wahrgenommen und weckt Lebensfreude. Gefühle, die die Alkoholindustrie zur Imageverbesserung ihrerProdukte nutzt. Es entsteht der Eindruck, dass der Alkoholkonsummit Leistung und Gesundheit einhergeht. Im Sport finden die Jugendlichen positive Vorbilder, Idole und Teams, erfahren Wert-schätzung und zeigen sich Leistungsbereit. Diese Werte sollten nichtmissbraucht werden, um den Alkoholkonsum zu fördern.
Weil Werbung wirkt.Der schädliche Einfluss der Alkoholwer-bung auf Kinder ist eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache. Die
Schlussfolgerungen einer Vielzahl von länderübergreifenden Studien
wie z.B. Projekt AMMIE 2011 sind eindeutig: „Sportsponsoring ist für
die Alkoholindustrie eine sehr attraktive Form der Werbung. […] das al-
koholische Getränk, das eine potenziell gesundheitsschädigende Wirkung
hat, (wird) in Verbindung mit sportlicher, als gesund eingestufter Aktivi-
tät gebracht.“ Minderjährige trinken früher und sie trinken mehr.
Weil die bestehende Regelung Lücken aufweist undkompliziert ist. Die bisherigen Regeln von 2008 zum Schutz von Jugendlichen vor
Alkoholwerbung wurden nie durchgesetzt und erst auf Druck der
Initiative um einige komplizierte Massnahmen ergänzt.
Schlupflöcher weist allerdings auch diese neue Regelung auf. Werbung
auf den Trickots bleibt erlaubt. Auch das halbherzige Verbot soge-
nannt „weitherum sichtbarer“ Werbung kann nicht zuletzt durch die
Fernsehbilder spielend umgangen werden. Zudem bleibt die Werbung
für alkoholische Getränke wie Bier erlaubt, während Schnaps nicht
beworben werden darf. Falls Sie das unlogisch finden, haben Sie abso-
lut recht. Vielleicht weil Schnaps die Gesundheit eines Jugendlichen
noch schneller ruiniert?
Am 18. Mai
Um die Beeinflussung von Jugendlichen durch Alko-holwerbung in einem gesundheitlich wichtigen Um-feld zu stoppen.
Für ein einfaches, pragmatisches Gesetz, das Lückenschliesst und komplizierte Regeln ersetzt.
Für wirksame Kontrollen. Die Sportveranstalter erhalten mit Annahme der Initiative klare Vorgaben imSinne des Jugendschutzes.
Um die klare Forderung der Gesellschaft zu erfüllen,den durch Alkohol geförderter Vandalismus im Sportnicht auch noch zu bewerben.
Um die gesellige Tradition von Bier und Bratwurst anSportfesten zu erhalten. Denn eine erfolgreiche Durch-führung gelingt auch mit Sponsoren, die das Bier nuran Erwachsene verkaufen ohne gleich daneben Wer-bung zu platzieren.
Das können Sie tun
Stimmen Sie am 18. Mai mit JA! Überzeugen und motivieren Sie Ihre Bekannten und Freunde dies ebenfalls zu tun.
Engagieren Sie sich und verteilen Sie in den nächstenWochen Abstimmungsflyern in Ihrer Nachbarschaft.Ihr Einsatz ist unser glaubwürdigstes Argument.
Flyer und Broschüren sowie weitere Informationen erhalten Sie unter
www.alkoholwerbung-nein.ch. Sie erreichen uns unter derNummer 044 272 04 27oder senden bitte ein Mail [email protected].
„Keine Werbung für alkoholische Getränke auf Sportplätzen sowie an Sportveranstaltungen im Kanton Zürich“
JA! zur Initiative am 18. Mai
„Ohne Bier kein Fussball! – Alkoholwerbung in Stadienvermittelt jungen Menschen den Eindruck, Sport und Alkohol gehöre unzweifelhaft zusammen. Ein ernst-gemeinter Jugendschutz ist deshalb mit Alkoholwerbungan Sportveranstaltungen nicht vereinbar.“ Esther Maurer,
bis 2010 Zürcher Stadträtin
JA
JA
JA
JA
JA
3
Den ersten Schluck mit zehn.Ein Betroffener berichtet.
Da wurde ich erstmals mit Alkohol konfrontiert.
Der Aufforderung «He, Kleiner, trink doch auch einen Schluck»
habe ich erstmals mit 10 Jahren Folge geleistet und mit ungefähr
13 Jahren hatte ich bereits den ersten Vollrausch.
In der Lehre zum Zimmermann war es gang und gäbe, dass in
den Pausen und über Mittag ein Glas Bier getrunken wurde.
An den Aufrichtfesten gehörte reichlich Alkohol dazu. Erst als ich
meine Frau kennenlernte, konnte ich meinen Alkoholkonsum
besser unter Kontrolle halten. Als mein Vater starb, begann mein
exzessives Trinken. So wurde ich vor rund zehn Jahren für die
Öffentlichkeit auffällig. Unsere drei Kinder waren damals zwischen
drei und sieben Jahre alt und besuchten den Kindergarten. Da die
Kinder nicht eben täglich frische Kleider trugen, schaltete sich das
Jugendamt ein. Ich selber verlor in dieser Zeit die Arbeit, da die
Firma das Werk in unserer Nähe schloss. Gleichzeitig war ich
Alkoholiker.
Um die Familie kümmerte ich mich kaum mehr. Meine Frau,
bei jeder Herausforderung auf sich allein gestellt, war bald
überfordert. In dieser Situation stand ich vor der Wahl, eine
Therapie zu machen oder die Kinder zu verlieren. Ich begann
eine Therapie, die ich jedoch nach sieben Wochen abbrach –
wenig später wurden unsere Kinder einer Pflegefamilie im
Nachbardorf übergeben. Das tat weh. Meine Frau war am
Boden zerstört und ich am Tiefpunkt angelangt.
Aus eigenem Antrieb nahm ich mit der Diakonie Kontakt auf
und entschloss mich zu einer körperlichen Entgiftung und einer
achtwöchigen stationären Therapie. Dann wechselte ich für
sechs Wochen in eine Tagesklinik. Ich begann wieder zu leben,
ohne Alkohol, freute mich, wenn alle zwei Wochen übers
Wochenende die Kinder bei uns zu Besuch waren. Mein neuer
Lebenswille war wieder so gross, dass ich beim Jugendamt durch-
setzen konnte, meine Kinder wieder nach Hause zu holen.
Die Kinder kamen an diesem Tag – es war ein Freitag, den ich nie
vergessen werde – von der Schule nach Hause zur Pflegefamilie.
Dort wurden sie informiert, dass sie zu den Eltern gefahren
würden. Die Kinder waren zunächst verwirrt, freuten sich aber.
Zu Hause schlossen wir uns in die Arme – nach fünf Jahren hatte
die Familie wieder zusammengefunden!
Nach einer Ausbildung zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer
arbeite ich heute freiwillig bei einer Fachstelle des Blauen Kreuzes
und konnte dort eine Selbsthilfegruppe aufbauen.
Hier möchte ich meine Erfahrungen einbringen. Es muss nicht
sein, dass in andern Familien die Kinder ebenso leiden wie bei
uns damals.
Ich wuchs mit zwei älteren Geschwistern auf. Wenn abends der Vater nach Hause kam, galt sein erster Griff dem Jägermeister. Wenn sich mein ältererBruder mit seinen Kollegen in der Garage traf, gab esauch mal Alkohol zu trinken.
„Kinder und Jugendliche im Rahmen sportlicher Events für Alkohol zu begeistern ist inakzeptabel. Die Freude amgesunden Wettkampf, an Fairness und Leistung sollte nichtden Alkoholkonsum fördern.“
Christoph Zingg, Gesamtleiter Sozialwerke Pfarrer Sieber
4
Wir sprechen über Alkohol
Der missbräuchliche Konsum von Alkohol zerstört die Lebensqualität und beendet das Leben schlimmstenfallsvorzeitig. Zahlreiche Studien beweisen diesen Zusammenhang seit Jahrzehnten. Selbst Alkoholproduzentenoder deren Interessenverbände bezweifeln diese Fakten längst nicht mehr. Kaum ein Arzt, der noch zum täglichen Glas Rotwein raten würde. Trotzdem fällt es den politischen Entscheidungsträgern immer wiederschwer, auf diesen Befund adäquat zu reagieren. Wieso eigentlich?
Auf kantonaler Ebene konnte das Blaue Kreuz schon einen Erfolg ver-
buchen: Die Alkoholtestkäufe sind zu einem festen Bestandteil der Ju-
gendschutz- und Gesundheitsgesetze geworden. Die unendliche
Diskussion über das Für und Wider dieses wirksamen Präventions-
mittels ist entschieden. Aber erst nach einer zermürbenden und lang
anhaltenden Diskussion, zu der eine Vielzahl von Ratsmitgliedern
Voten beisteuern wollten. Für ein Gesetz, das bereits in der zweiten
Lesung beraten wurde, war dies äusserst ungewöhnlich. Ungewöhn-
lich war auch die Koalition der Gesetzgegner, sprachen sich doch die
SVP und Teile der Grünen dagegen aus, wenn auch aus unterschiedli-
chen Gründen. Alkohol, so scheint es, erhitzt die Gemüter. Selbst
wenn sich im Prinzip alle einig sind, dass Minderjährige nicht an Al-
kohol gelangen sollten. Auch auf nationaler und internationaler Ebene
regiert der Konsens: der übermässige Alkoholkonsum ist wie der
Tabak dafür mitverantwortlich, dass jährlich Millionen Menschen
schwer erkranken. Misst man die Zerstörungskraft einer Droge nicht
nur an den unmittelbaren Auswirkungen auf den Konsumenten, son-
dern auch auf die Gesellschaft, ist der Befund noch erschreckender:
Alkohol ist gefährlicher als Heroin!
Zwar weniger tödlich für den Trinkenden, doch mit einem enormen
Potenzial, die Familien, Freunde sowie überhaupt alle zwischen-
menschliche Kontakte zu zerstören. Die Folgekosten für die Sozial-
und Gesundheitssysteme sind nur schwer zu schätzen, dürften aber in
Milliardenhöhe liegen. Generell spielt Alkohol bei Gesetzesverstössen
häufiger als andere Substanzen eine Rolle. Nicht nur, aber am auffäl-
ligsten bei Fussballspielen und häuslicher Gewalt.
Gleichwohl besteht die Lösung nicht darin, Alkohol einfach zu
verbieten. Die Prohibition, wie sie einst in den USA galt, machte nur
die organisierte Kriminalität reich und einflussreich. Alkohol ist Teil
unserer abendländischen Kultur und gehört bei vielen Anlässen
durchaus dazu.
Viel sinnvoller wäre es, und hier ist die Politik gefordert, gezielt den
Vieltrinkern Ausstiegsprogramme zu erleichtern, die Alkoholwerbung
konsequent zu verbieten und vor allem die Preise für Alkohol zu erhö-
hen. Die Politik muss so ehrlich werden und der Bevölkerung klar
kommunizieren, dass die Mehrheit der erwachsenen Leute, die es bei
einem oder zwei Bier bewenden lassen, diese auch weiterhin konsu-
mieren können. Und sie sollte so mutig sein, eine ehrliche Drogenpo-
litik zu verwirklichen. Die Gefährlichkeit des Alkohols sollte nicht
wegen seiner Alltäglichkeit verharmlost, sondern nach seiner tatsächli-
chen Zerstörungskraft ernst genommen werden. Es ist ohne Zweifel
bequemer, der Alkohol konsumierenden Bevölkerungsmehrheit (ver-
meintlich) zu gefallen, als eine kleine vielleicht kiffende Randgruppe
auszugrenzen. Aber jede Droge birgt ihre eigenen Risiken für Konsu-
ment und Gesellschaft und genau danach müssen sich in Zukunft
auch die Massnahmen richten.
„Oft gehen Alkohol und Gewalt einher, auch im Sport. Hier muss es eine Veränderung geben. Gesunder Sport und Alkohol gehören nicht zusammen. Bei der Werbung fängt es an.“
Pamela Weisshaupt, Ruderweltmeisterin 2008/2009
5
Alkohol und Gewalt gehen Hand in Hand
„Der Sport ist unter Teenagern eine wichtige Ressource und bietet gesunde Sozialkontakte. Ausgerechnet indiesem Bereich für Alkohol zu werben, um den Konsumzu fördern, ist aus präventivmedizinischer Sicht falsch.“
Martin Schmitz, Leitender Arzt Forel Klinik
Vor einem Zürcher Gericht stehen zwei junge Handwerker. Nennen
wir sie Rolf und Marco. Bis zu einer Nacht vor einem halben Jahr
haben die beiden Schweizer ein unbescholtenes Leben geführt.
Gearbeitet, Steuern bezahlt, in die Ferien gegangen. Und am
Wochenende fahren sie gerne mal in die City, um zusammen in
einer der zahlreichen Bars zu feiern – ganz so, wie viele Tausende
Menschen in der Schweiz.
In der fraglichen Nacht befinden sich die jungen Männer nach einem
ereignislosen Abend in der Stadt etwas frustriert und verfrüht auf dem
Nachhauseweg. Während der Fahrt mit der S-Bahn in die Agglomera-
tion kommt es zu einer reichlich sinnlosen, dennoch gravierenden
Auseinandersetzung, die das Leben aller Beteiligten nachhaltig er-
schüttert. Was genau den Streit ausgelöst hat, ist nicht mehr lückenlos
nachvollziehbar. Fest steht, dass es zu einem verbalen Geplänkel
zwischen den beiden Freunden und einem Dritten kommt. Es fliegen
Beleidigungen und zerknüllte Sandwichpapiere zwischen den Zugab-
teilen hin und her. Irgendwann zieht Rolf ein Taschenmesser und
drückt es Marco in die Hand. Feuert ihn an: «Los, chum! Mach’s!»
Enthemmung zentralIhr Widersacher ist bereits ausgestiegen, doch die beiden folgen ihm.
In der Menschenmenge können sie den Mann auszumachen, Marco
folgt ihm und stösst das Messer in seinen Rücken. Nur dank Glück
endet die Attacke glimpflich und das Opfer wird nicht lebensgefähr-
lich verletzt. Nun stehen Rolf und Marco vor dem Richter, angeklagt
der versuchten schweren Körperverletzung. Das Gericht urteilt milde:
Statt den von der Staatsanwaltschaft beantragten dreieinhalb Jahre
unbedingt, kassieren Rolf und Marco je zweieinhalb Jahre teilbedingt.
In den Erläuterungen streicht der Richter die «enthemmende Wirkung
des Alkohols» hervor. Diese vermöge das Verhalten der beiden aber kei-
neswegs zu entschuldigen oder zu erklären: Die Täter wiesen je rund ein
Promille auf. Alkohol ist gerade bei solchen Delikten oft im Spiel. Laut
verschiedenen Fachberichten bei über vierzig Prozent aller Gewalttaten.
Bei Körperverletzungen, Tätlichkeiten, Raub und häuslicher Gewalt
liegt der Schnitt erheblich höher. Hier zeigen die Statistiken, dass
zwischen 60 und 70 Prozent der Täter unter Alkoholeinfluss standen.
Fatale WechselwirkungNationale und internationale Experten sind sich einig, dass das Risiko,
Täter oder Opfer einer Gewalttat zu werden, mit den Promille an-
steigt. Staatliche Stellen formulieren nüchtern: «Alkohol verändert dieEmotionen und verringert die Sensibilität. Alkohol und Gewalt stehen ineiner wechselseitigen Beziehung: Jeder ist gleichzeitig Auslöser und Be-schleuniger. So überrascht nicht, dass sich in vielen gerichtspsychiatrischenGutachten dieser Satz findet: Der Angeklagte neigt unter Alkoholeinflusszu Gewalttaten.»
Wieso Alkohol strafmindernd wirken kannAlkohol ist in manchmal auch ein Strafminderungsgrund. Daher die
verbreitete Vermutung, in manchen Fällen vielleicht zu Recht, dass
sich Gewalttäter absichtlich «volllaufen» lassen, um mit einer milderen
Strafe davonzukommen. Hat man tatsächlich über 2,5 Promille intus,
wird man mindestens als leicht, wenn nicht mittelgradig schuldunfä-
hig erklärt. Das kann die Haft bis auf die Hälfte reduzieren kann.
Was auf den ersten Blick skandalös wirkt, hat aber eine traurige Logik:
Wer mit einem solchen Blutalkoholwert noch zu delinquieren vermag,
ist in aller Regel kein Gelegenheitstrinker. Liegt aber beim Täter oder
der Täterin eine schwere Alkoholerkrankung vor, wird neben der Be-
strafung oft eine Therapie angeordnet. Zumindest ist eine Therapie
(und langfristige Genesung) für eine friedlicheren Gesellschaft sinn-
voller als eine stumpfsinnige Haft.
6
impressum
Wir sind da
Ein deutliches JA! am 18. Maizum Schutz unserer Jugend
Für Lebensqualität. Gegen Abhängigkeit.
Für Spenden, Beiträge und Legate sind wir stets sehr dankbar. Das Blaue Kreuz ist seit 1990 durch die ZEWO zertifiziert.
Das Gütesiegel bescheinigt:
den zweckbestimmten, wirtschaftlichen und wirkungsvollen
Einsatz Ihrer Spende
transparente Information und aussagekräftige Rechnungslegung
unabhängige und zweckmässige Kontrollstrukturen
aufrichtige Kommunikation und faire Mittelbeschaffung
blaueskreuzzuerich.ch
GeschäftsstelleMattengasse 52
Postfach 1167
8031 Zürich
044 272 04 37
Spendenkonto80-6900-0
Alkohol und Sportanlässe – alle kennen die Probleme, die aus
dieser Kombination entstehen. Es widerspricht dem gesunden
Menschenverstand, dass Alkoholwerbung ausgerechnet an Sportver-
anstaltungen erlaubt ist. Dies umso mehr, als viele Kinder und
Jugendliche diese Veranstaltungen besuchen.
Ein JA zur Initiative:Schliesst die Gesetzeslücke, da die unzureichenden Regeln
durch ein wirksames Gesetz ersetzt werden.
Ermöglicht wirksame Kontrollen. Die Sportveranstalter
erhalten mit Annahme der Initiative klare Vorgaben im Sinne
des Jugendschutzes.
Lässt weiterhin grosse Sportveranstaltungen (z.B. Zürich
Marathon mit 7’000 Teilnehmenden) zu.
Unterstützen Sie uns schon heute und helfen Sie uns,
einen wirksamen Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
Alkoholwerbung
zu realisieren.
Ihre Spende ermöglicht
unsere Präventions-,
Beratungs- und Selbsthilfearbeit.
Wenn Sie darüber hinaus unsere Initiative unterstützen möchten,
dann spenden Sie bitte via Postkonto mit dem Vermerk
„Initiative“: Spenden PC 80-6900-0
Eine grosse Hilfe ist uns auch Ihr freiwilliges Engagement im Laufe der
nächsten Wochen durch die Verteilung von Abstimmungsflyern in
Ihrer Nachbarschaft. Ihr Einsatz ist unser glaubwürdigstes Argument.
Ein JA am 18. Mai für einen wirksamen Schutz unserer Jugend und
für einen ehrlichen Sport.
www.alkoholwerbung-nein.ch
In der Schweiz leben rund 300'000 alkoholabhängige Menschen.
Etwa eine Million Familienangehörige sind von dieser Erkrankung
mit betroffen.
Über 5’000 Personen sterben jährlich an den Folgen des Alkohol-
konsums oder an alkoholbedingten Krankheiten. Dazu gehören
Krebserkrankungen, degenerierte Blutgefässe oder Herzinfarkte.
Das Blaue Kreuz Zürich verhindert und mindert diese alkohol- und
suchtmittelbedingten Folgen. Wir wollen, dass junge Menschen in
einer Gesellschaft aufwachsen, die sie stark macht und vor dem Miss-
brauch von Suchtmitteln schützt. Wir wollen, dass niemand mehr
unter den Folgen des Alkoholmissbrauchs zu leiden hat.
blaues kreuz ist die Zeitschrift des Blauen Kreuzes Kantonalverband Zürich für die Mitglieder, Spenderinnen und Spender. Die Zeitschrift erscheint 4-mal jährlich. Die Auflage beträgt 15'000 Exemplare.
Verlag Blaues Kreuz Kantonalverband Zürich, Zürich. Redaktion Henrik Viertel, Stephan Kunz. Fotos Patrick B. Kraemer, Keystone, Blaues Kreuz, Fotolia.Gestaltung koch. werbung & kommunikation
blaueskreuzzuerich.ch Ausgabe 2_ 2014