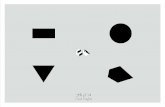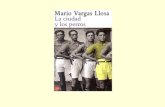Debatare.de – Veranstaltungszeitung zur LiMA 2012
-
Upload
marc-seele -
Category
Documents
-
view
224 -
download
5
description
Transcript of Debatare.de – Veranstaltungszeitung zur LiMA 2012

Der letzte Linke Seite 6
21. bis 25. März \\ Veranstaltungszeitung zur Linken Medienakademie 2012 in Berlin
Der erste
Pixelpinsler Seite 18

2 debatare.de
QR-Softwarerunterladen
15 debatare.de
QR-Codefotografieren
15 debatare.de
Details im Web ansehen
15 debatare.de
QR-Codes aktivieren
Was ist ?Nicht Meldung, sondern Meinung. Nicht Tempo, sondern Tiefgang. Nicht monomedial, sondern multimedial: Das ist der Anspruch von Debatare.
Debatare ist ein neues Magazin – ge-macht von jungen Journalisten. Die junge Perspektive bringt frische Ide-en und neue Ansätze in die Berichter-stattung. Der kultivierte Streit ist ein zentraler und notwendiger Bestandteil des menschlichen, gesellschaftlichen Lebens. Ohne kritisches Hinterfragen von bestehenden Positionen und den fortwährenden Zwang zur besseren Be-gründung von Standpunkten fehlen wichtige Motoren für gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Fortschritt. In dieser Tradition hinter-fragt Debatare und bietet Meinungen und Hintergründe.
Fotos: Armin Linnatz, Hans Wollny. Montage: debatare

3debatare.de
Der Mensch dahinter
Es gibt Menschen, die kennt scheinbar jeder. Aber die Person dahinter kennen nur sehr wenige. Denn das, was wir über sie wissen, wissen wir nur durch die Medien. Sie bestimmen, was wir sehen, wie wir sehen, und somit am Ende auch, was wir denken. Bilder transportieren Eindrücke, die uns auf Wirklichkeit schließen lassen. Dass dahinter nicht immer die Wirklichkeit steht, ist im Zuge der digitalen Bildbearbeitung für fast jeden leicht erlernbar geworden. Einer der ersten, der sich in Deutschland mit den Möglichkeiten der Bildbearbeitung am Computer befasst hat, ist Hans Baumann. Mit ihm sprachen wir über die Glaubwürdigkeit von Bildern. Die andere Seite im Wechselspiel von Medien und Politik hat Gregor Gysi im Blick. Als Politiker überlegt er sich, wie er seine Inhalte rüberbringen kann. Und er reflektiert über das Verhältnis der Linken zu den Medien. Das ist, kurz gesagt, kompliziert. Mit linken Medien abgeschlossen hat der Publizist Henryk M. Broder bereits. Für ihn ist linker Journalismus Gefälligkeitsjournalismus. Was ihn noch an linkem Journalismus stört, hat er im Interview erklärt. Bei der Linken Medienakademie in Berlin trafen sich Medienmacher aus ganz Deutschland. Dabei ging es auch um die Arbeitsbedingungen in der Branche. Welche Probleme es gibt, wenn Journalisten streiken, erläutern Gewerkschafter im Heft. Aber egal auf welcher Seite, ob auf Seite der Medien oder der Politik. Dahinter steht immer ein Mensch. Den Einzelnen im Blick – und dabei das große ganze nicht aus den Augen verlieren. Das wäre doch ein schöner Anspruch, für Medien und Politik. Gregor Landwehr
Diese Ausgabe von Debatare entstand auf der 9. Linken Medienakademie, die vom 21. bis 25. März 2012 in Berlin stattfand.
Herausgeber: debatare - Akademie für neuen Journalismus gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt. Vertreten durch: Gregor Landwehr, Sebastian Serafin.
Anschrift: Friedrichstraße 95, 10117 Berlin, HRB 139826 B, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg. Internet: www.neuer-journalismus.de, info@neuer-journalis-
mus.de. Telefon: 030/3993.0212. Fax: 030/3993.0209
Chefredaktion (V.i.S.d.P.): Barbara Engels, Christina Quast, C. Gregor Landwehr. Redaktion: Stella Napierella, Natalia Weicsekova, Katja Herzberg, Nalan
Sipar, Michael Wahl, Ralph Hutter. Bildredaktion: Jonas Fischer, Patrick Stösser (realfragment.de). Layout: Sebastian Wenzel, (www.sebastianwenzel.de)
Druck: Märkische Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH Potsdam. Auflage: 20.000 Exemplare. Besonderer Dank: An Christoph Nitz (ermöglichte dieses
Projekt), Marc Seele und Andreas Kiesgen (verantwortlich für die grafische Grundgestaltung und das Logo).
IMPRESSUM
Fotos: Armin Linnatz, Hans Wollny. Montage: debatare

4 debatare.de
Inmitten von 200 Workshops und Vorträgen, deren Selbstver-ständnis in der Förderung des linken Journalismus liegt, ist die Frage, wie politisch Jounalismus sein darf, meistens alles
andere als im Mittelpunkt. Hakt man aber nach, wird überall, wo man sich erkundigt, klar: Journalismus darf politisch sein, er kann gar nicht anders. Die Zeitungslandschaft wird von politi-schen Tendenzen regiert, die bei linken Medien eben deutlicher ausfallen. Beim Maß, wie viel politisches Statement der Journa-lismus verträgt, scheiden sich jedoch die Geister.
Einerseits wird gefordert, den linken Journalismus und seine Rolle als „Störfaktor“ der Mainstream-Medienlandschaft zu stärken. Andererseits soll er aber die Regeln des journalisti-schen Handwerks nicht vergessen und sich nicht von vorge-fertigten Meinungen den Blick versperren lassen. Eine Grat-wanderung, die sich hinsichtlich der Zielgruppe als nicht ganz einfach erweist. Im besten Fall sollte diese nämlich ein breites Spektrum umfassen, damit überhaupt die Rede da-von sein kann, alternative Standpunkte und neue Inhalte als Gegenpunkt zu den sogenannten bürgerlichen Medien zu bieten.
Am ersten Tag der LiMA 2012 bekommt man jedoch im TU-Gebäude einen anderen Eindruck. Viele der Teilneh-mer sehen den Tatsachen ins Auge, dass linker Journalis-mus jene erreicht, für die alternative Informationen zur alltäglichen Informationsbeschaffung gehören. Moti-viert oder demotiviert durch ihre Unzufriedenheit mit den herrschenden Verhältnissen werden dann manch-mal noch einige Menschen aufgesammelt, die vorher noch nicht zum linken Lager gehörten.
Hieraus entsteht eine doppelte Herausforderung, der sich der linke Journalismus in Deutschland stellen muss: Gegen den Einheitsbrei der restlichen Medien neue Perspektiven aufzeigen und Kritik äußern, wo sie sonst nicht gefragt ist. Gleichzeitig darf er sich aber auch nicht im Nischendenken verzetteln und
Neutral gibt es nicht
sollte auch den bereits „Aufgeklärten“ auf den Schlips treten können. Von allen Sei-ten kritisch beäugt, erfordert die Lage des linken Journalisten eine besondere Stand-haftigkeit. Dieser Standhaftigkeit kann sich entziehen, wer kein linker Journalist ist. Der kleine Unterschied nimmt diese Jour-nalisten aus der Schusslinie in den siche-ren Schoß des Mainstream. Doch sind sie dadurch keineswegs weniger politisch. Nur leider wird „links“ als seitlich von der Mitte gedacht und die Mitte scheint neutral. Die Mitte hat allerdings nichts mit Neutralität zu tun. Sie ist ein anderer Standpunkt und damit politisch. Doch bevor hier zu leichtfertig der Mainstream in die Mitte gestellt wird, ist zu betonen, dass dieser seine Kreise auch teilwei-se gerne weit nach rechts zieht.
Diese Auswüchse des Journalismus sind jedoch weit davon entfernt sich selbst als „rechts“ zu bezeichnen. Daher wird hier eher selten die Kritik laut, der Mainstream sei zu politisch. Doch genau das ist er. Und umso einflussrei-cher, je mehr er als politisch neutral getarnt bleibt.
In diesem Sinne: Journalismus ist immer poli-tisch und so darf es auch der linke sein. Linker Journalismus sollte sich aber nicht auf seinen Standpunkten ausruhen und sich die Fähigkeit zur Selbstkritik erhalten.
Denn nur so kann der Journalismus aufdecken und Perspektiven setzen ohne sich selbst zu einer Randerscheinung zu beschränken. Auch wenn das Publikum dadurch nicht automatisch größer wird, bleiben aber zumindest die Türen geöffnet.
Berlin
Mag es, wenn Gedan-ken immer wieder neu überdacht werden.
NataliaWeicsekova (28)
Darf Journalismus politisch sein, und wenn ja, wie sehr? Eine
berechtigte Frage, die man sich gerade im Rahmen einer Linken
Medienakademie durchaus stellen kann. Ein Kommentar.

5debatare.de
OhneWorte
„Wor-te sind wertvoll“
- dieses Motto hatte der Arbeitskampf von Journalisten bei
Tageszeitungen, die im vergangenen Jahr zwischen Februar und August gegen die Ta-rifwünsche von Verlegern gestreikt haben. Viele Worte wurden über den Streik nicht geschrieben und die Leser konnten ihre Zei-tung täglich aus dem Briefkasten oder vom Kiosk holen. „Das eine komplette Ausgabe nicht erschienen ist, das hat es seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr gegeben“ sagt Ul-rike Maercks-Franzen, die Bundesgeschäfts-führerin der Deutschen Journalisten Union (dju) in der Gewerkschaft Verdi gewesen ist und nun ehrenamtlich tätig ist. Ein Streik von Journalisten wird in der Öffentlichkeit weni-ger wahrgenommen, als wenn Flugzeuge nicht starten oder Kindergärten geschlossen bleiben.
Dafür gibt es ganz viele Gründe: „Journalisten, die streiken, können auch nicht darüber be-richten“, erklärt Ulrike Maercks-Franzen, „Und die Verleger haben auch kein echtes Interesse an der Berichterstattung.“ Denn Verleger und Redakteure sind im Arbeitskampf nicht unpar-teiisch. Ein Mal hat die „Neue Westfälische“ aus Nordrhein-Westfalen über den Streik berichtet, obwohl die Journalisten der Zeitung an mehr als dreißig Tagen die Arbeit niederlegten. „Mich hat enttäuscht, dass andere Medien wie Nachrichten-agenturen und der WDR, die nicht am Arbeits-kampf beteiligt waren, nur sehr zurückhaltend berichtet haben“, erzählt Corinna Lass, die Redak-teurin bei der Neuen Westfälischen ist und mitge-streikt hat.
Wenn J o u r n a l i s t e n
ihre Arbeit niederlegen, kann eine Zeitung trotzdem mit
Worten gefüllt werden, weil Nachrichten-agenturen und Public Relations Abteilungen ihre
Texte in die Redaktionen schicken. „Kurzfristig kann eine Zeitung heute mit einer handvoll Leuten gefüllt werden“, weiss Ulrike Maercks-Franzen. Diese handvoll Leute gibt es in nahezu allen Redaktionen, weil immer mehr Journalisten in prekären Ar-beitsverhältnissen stecken: Sie sind Leiharbeiter, Pauschalisten oder freie Mitarbeiter, so dass sie ihren streikenden Kollegen als unfreiwillige„Streikbrecher“ in den Rücken fallen. Auch wenn die Zeitungen nicht sichtbar auf Worte verzichten, macht sich ein Streik der Journalisten nach einer längeren Zeit dennoch bemerkbar: „Es sind weniger Seiten erschienen und die Qua-lität der Artikel hat nachgelassen. Das haben auch die Leser gemerkt und sie waren teilweise genervt“ berichtet Corinna Lass von der Neuen Westfälischen.
Über 100 Redaktionen haben sich am mit Streiks an den Ta-rifverhandlungen im vergangenen Jahr beteiligt. „Streikende Journalisten können nicht so einen großen ökonomischen Druck ausüben, sondern eher eine moralischen Druck“, meint Ulrike Maercks-Franzen. Zudem ist nur ein kleiner Teil der arbeitenden Journalisten auch festangestellt. Die Gewerkschaften DJU und DJV vertreten bei Tarifverhand-lungen nur noch 15000 Redakteure. „Früher waren es we-sentlich mehr“, bedauert Ulrike Maercks-Franzen.
Während der Tarifverhandlungen im vergangenen Jahr haben über 2000 Journalisten gestreikt, weil sie mehr arbeiten, aber weniger Geld bekommen sollten. Vor al-lem zukünftige Journalisten hätten insgesamt ein Vier-tel weniger verdient. „Journalisten fühlen sich zwar immer ihren Leser verbunden, wollen aber auch nicht, dass ihr Beruf so massiv entwertet wird“, erklärt Ulri-ke Maercks-Franzen. Schließlich haben sich Verleger und Gewerkschaften auf einen unveränderten Man-teltarifvertrag und eine minimale Gehaltserhöhung geeinigt, die unter der Inflation liegt. Zu diesen Be-dingungen füllen die Redaktuere bis Mitte 2013 die Zeitungen mit, dann stehen die nächsten Tarifver-handlungen an.
Dortmund
Ist Mitglied im Deut-schen Journalisten Verband (DJV), hat aber noch nie gestreikt.
Christina Quast (30)
Ein
durchgewirbelter
Flugplan und geschlossene
Kindergärten – dafür haben
Mitarbeiter am Flughafen
Frankfurt und im öffentlichen
Dienst mit Streiks gesorgt.
Wenn Journalisten auf
Worte verzichten, liegt die
Zeitung trotzdem jeden
Morgen im Briefkasten.
Foto: Patrick Stößer

6 debatare.de
Herr Broder, haben Sie linke Medien abonniert? Ich lese jeden Tag die taz. Ist das ein lin-kes Medium? Die taz hat streckenweise richtig gute Debatten, die gibt es in der Frankfurter Rundschau nicht. Die ist ein gleichgeschaltetes linkes Amtsblatt. Ich glaube übrigens nicht, dass man mit den Begriffen links und rechts heute weit kommt. Die entscheidende Frage ist: Was tun die im konkreten Falle? Alliieren sie sich mit Diktatoren? Halten sie die Fresse gegenüber Nordkorea, Syrien und Libyen, knutschen sie mit Gaddafi, gehen sie ihm an die Eier oder an die Gurgel – das ist für mich entscheidend. Die Begriffe links und rechts sind für mich passé.
Aber Sie kritisieren die linke Berichter-stattung.Ja, das tue ich. Man kommt an bestimmten Etiketten nicht vorbei. Aber ich nenne sie übrigens nicht linke, eher antiimperialisti-sche oder antikapitalistische Berichterstat-tung.
Was ist linker Journalismus?Ich glaube, linker Journalismus ist Gefällig-keitsjournalismus. Es gibt linke Journalisten überall, auch beim Stern oder Spiegel, nicht nur bei offiziell linken Medien. Das sind Leu-te, die schreiben für ihre Gemeinde, sie sch-reiben, um ihnen zu gefallen. Wenn ich eine Gemeinde hätte, würde ich alles dafür tun, sie vor den Kopf zu stoßen. Ich schreibe das, was mich interessiert und habe keine Agenda. Ich schreibe aus einem Staunen heraus, indem ich versuche, mir etwas zu erklären.
Glauben Sie, dass linke – oder antiimperi-alistische – Journalisten insofern eine Ge-meinsamkeit haben, als dass Sie alle gleich über Israel und den Nahostkonflikt denken?Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber vermutlich haben Sie Recht. Die Koaliti-on ist zumindest sehr breit. Von links außen bis rechts außen – und irgendwann wissen Sie nicht mehr, ob da die Linke oder die NPD mar-schiert, denn sie haben dieselben Parolen. Es fällt mir schwer, jetzt noch über die Linken und ihre Nahost-Berichterstattung zu reden. Ich habe da so viel drüber geschrieben und es inzwischen für mich abgehakt. „Vergesst Auschwitz!“ ist für mich ein Schlusspunkt.
Regt sie das Thema zu sehr auf?Nein, ich bin durch. Ich glaube nicht, dass ich da noch einen für mich neuen Gedanken fassen kann. Ich habe kapiert: Diese Leute sind uns vo-raus. Wenn ich es geschafft habe, irgendeine Attitüde zu erkennen und zu analysieren, sind die linken Antisemiten schon zwei Schritte weiter. Jetzt will ich mich wirklich mit den relevanten Dingen des Lebens be-schäftigen. Mit Essen, Sex und Reisen. Und Tee trinken, natürlich.
Sollte Journalismus generell unpolitisch sein?Nein, ich kann da überhaupt keine Forderungen stellen. Politischer und unpolitischer Journalismus gehören dazu wie eine breitgefä-cherte Speisekarte, wo Sie von Minestrone bis Zabaione alles finden.
Dann gehört eine linke Nahost-Berichterstattung auch auf die Speisekarte.Ja, sicher gehört die dazu. Ich will ja auch nichts verbieten. Der Dreck, den Jürgen Elsässer als Journalismus verbreitet, der gehört auch dazu. So wie zu jedem Berliner Biergarten Buletten gehören, die aus Pferdeäpfeln hergestellt werden. Ich muss es nicht goutie-ren, ich muss es nicht konsumieren.
Ist linker Journalismus gefährlich?Nein. Wie wollen Sie entscheiden, was gefährlich ist oder nicht? So gesehen ist alles gefährlich. Wenn man den Wirtschaftsteil der FAZ nicht versteht, kann das auch gefährlich werden. Wenn man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, was gefähr-lich ist oder nicht, kann man eigentlich nur noch zuhause still vor sich hindämmern.
Was unterscheidet Sie von linken Journalisten?Der Unterschied zwischen den linken Journalisten und mir ist, dass die danach schreien, dass ich aufhöre zu schreiben. Ich hingegen verlange das nicht. Ich sehe ein, dass die mit dazugehören, bedauerlicherweise, so wie Krebserkrankun-gen und Sittlichkeitsverbrechen dazu gehören. Im Jour-nalismus kann jeder machen, was er will. Ich lese immer wieder: Der Broder, der darf seine Ansichten ungehindert und ungestraft verbreiten. Ja, wer soll mich denn daran hindern? Die grüne Bürgermeisterin von Aachen? Nor-man Paech und sein Dackel? Ich mach das ganz anders. Ich stelle die Hassbriefe, die ich bekomme, alle online.
Was würden Sie jungen, angehenden Journalisten sagen, die eine gewisse linke Grundhaltung haben und entsprechend sich auch gegenüber Israel posi-tionieren?Ich würde wahrscheinlich fragen: Und was sagst du zu Hanoi? Schon mal in Syrien gewesen? Was berührt dich an Israel? Obwohl – ich würd’s eigentlich gar nicht mehr fragen, weil’s mir egal ist. Ich bin ja nicht dazu da, die zu erziehen, ich bitte Sie. Dann käme ich gar nicht mehr zum Tortit-Essen (Tortit ist ein israelischer Schokoladenriegel, Anmerkung der Re-daktion).
Vor wenigen Wochen stand in einem Kommentar im Neuen Deutschland, es gebe eine Anti-Iran-Besoffenheit. Ist das antizionistisch? Oder antise-mitisch? Das sind antisemitische Fantasien, ganz eindeutig. Das ist der leise Wunsch, der Iran möge das Geschäft beenden, das die Väter und Großväter dieser Leute nicht zu Ende gebracht haben. Ahmadinedschad hat gesagt, Israel sei ein Krebsgeschwür, das entfernt werden müsse. Wer da von einer Anti-Iran-Besoffenheit spricht und nicht von einer Anti-Israel-Besoffenheit, der hat eindeutig Stellung bezogen.
Das ist also offener Antisemitismus für Sie, oder?Das ist der zeitgenössische Antisemitismus, der sich im Antizionismus artikuliert.
Gibt es ideologisch belastete Begriffe, die in Artikeln in linken Medien über den Nahostkonflikt immer wieder vorkom-men?„Besatzungspolitik“ und „selbstgebastel-te Raketen“ zum Beispiel kommen immer wieder vor. Oder „Hegemonialmacht“: Ein Zwergstaat von 20.000 Quadratkilometern wird als Hegemonialmacht bezeichnet.
Glauben Sie, dass die Journalisten, die diese Begriffe verwenden, nicht wissen, was diese eigentlich bedeuten?Nein. Da gibt es keine Unschuldsvermutung. Da gibt es einen begründeten Generalverdacht. Die wissen ganz genau, was sie schreiben.
Sie waren früher auch ein Linker und haben für linke Medien in Deutschland geschrie-ben. Was hat Sie dazu gebracht, mit den Lin-ken zu brechen? Ich bin immer noch links, die sind nicht mehr links. Die Linke ist autoritär und totalitär ge-worden. Es ist kein Zufall, dass in Ostdeutsch-land viele NPD-Sympathisanten die Linkspartei wählen, weil sie ihre autoritären Inhalte in der Linken wiederfinden und wissen, die Stimme ist nicht verschenkt – während Stimmen für die NPD im Gully landen. Es gibt keine Linke mehr in Deutschland. Wenn Sigmar Gabriel oder Gesine Lötzsch, links sein sollen, dann möchte ich mit de-nen noch nicht einmal im selben Intercity sitzen. Ich bin links, die nicht.
In Rage mit RiegelDer Publizist Henryk M. Broder will nicht mehr über linke Journalisten und ihre
Nahostberichterstattung reden. Für ihn gibt es in Deutschland keine Linke mehr.
Er selbst ist aber links geblieben. Barbara Engels hat mit ihm gesprochen.

7debatare.deFoto: Barbara Engels

8 debatare.de
60
V.i.S.d.P. Ulrich Maurer
60
gehts nicht!Das Magazin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
Publikationen frei HausFordern Sie unser kostenfreies Infopaket mit aktuellen Flug blättern, Broschüren und Zeitungen der Fraktion an. Abonnieren Sie clara, das Magazin der Fraktion DIE LINKE und den querblick, das Informationsblatt für feministische Politik und Geschlechter gerechtigkeit.So erfahren Sie mehr über unsere Positionen zur Rente und zur Gesundheitspolitik, über die geforderte Kindergrundsicherung, eine gerechte Familienpolitik oder auch zum Mindestlohn und zu vielen anderen Themen.
www.linksfraktion.de
- Anzeige -
Wissens-Tanker
Eins, zwei, drei, viele: Auf
der LiMA gibt es zahlreiche
Vorträge und Seminare. Zu
viele, um alle zu besuchen.
Michael Wahl fasst deshalb
ausgewählte Seminare
zusammen. Heute: Schreiben
für das Internet.
Tablet-Benutzer lesen in der U-Bahn, das Smartphone verleitet zum schnellen Überschriften-Scannen. Anders als früher ist ein Moment vor dem Laptop ein Moment der digitalen Entspannung. Dies sollte sich jeder klar machen, der für das Internet textet, sagt Gabriele Hoffacker von der Journalistenakademie München, die auf der LiMA 2012 „Texten fürs Web“ unterrichtet.
Aber wie fessle ich diese verschiedenen Leser mit meinem Text? Und wa-rum sollte der Smartphone-Nutzer überhaupt auf die Überschrift klicken und weiterlesen, wenn er später einen Moment mehr Zeit hat? Deswegen erfahren alte und banal wirkende Journalistenweisheiten heute eine Re-naissance. Wer sich im Vorfeld keinen Gedanken gemacht hat über an-gemessene Textlängen, prägnante Zwischenüberschriften und vor allem einen interessanten Teaser, wird es schwer haben, Leser zu finden.
Genau so wie der Vorspann bei einem Artikel in einer Zeitung muss der Teaser anregen, darf dabei nicht alle Informationen des Textes vor-wegnehmen. Außerdem sollten Autoren beachten, dass die Zielgruppe wesentlich heterogener ist. Eine einheitliche Leserschaft gibt es meist nur bei Fachmedien. Die Frage „Für wen schreibe ich?“ sollten Autoren sich dennoch stellen. Die, die durch Suchmaschinen zufällig auf die Seite kommen, sollte man versuchen einzufangen, nicht einzulullen. Deswegen: Wichtiges zuerst und die fünf W-Fragen zügig beantwor-ten – aber Weiterschreiben nur, wenn man für den 15. Absatz auch wirklich noch interessante Informationen hat. Denn ein Klick macht man schneller als eine Zeitung in den Papierkorb zu werfen.
Die letzte Lektion heißt Verlinken! Denn mit Blogs, Twitter, Face-book oder der eigenen Homepage steht einem Autor im Internet eine Fülle an Plattformen zur Verfügung, die er zum User-Anlo-cken einsezen kann. Auch der Text selber freut sich über Struktur durch den ein oder anderen Link. Im besten Falle springt der Le-ser direkt zum nächsten Artikel.
Berlin
Hat auf der LiMA vieles für sei-nen Berufsalltag gelernt.
Michael Wahl (25)

9debatare.de
Wir haben es geschafft: Wir sind wieder Weltmeister. Verdrängungsweltmeister. Und natürlich ist das kein Grund zu ju-beln. Keine der knapp 40 am Afghanis-tan-Einsatz beteiligten Nationen geht derart wortlos mit dem um, was gerade am Hindukusch passiert. Wir müssten uns streiten, wir müssten uns schämen, wir müssten auch mit Stolz von dem re-den, was trotzdem erreicht wurde. Statt-dessen: Schweigen.
Uns geht der Krieg in Afghanistan allein schon deswegen etwas an, weil die aller-meisten Deutschen in den vergangenen zehn Jahren eine Partei gewählt haben, die den Einsatz unterstützt hat. Die Bundes-wehr ist eine Parlamentsarmee. Deutsche Soldaten werden nicht von Generälen in den Krieg geschickt, sondern von Abgeord-neten. Und damit von uns allen. Der grüne Studienrat von nebenan hat genauso Krieg geführt wie der liberale Unternehmer aus dem Villenviertel oder der christdemokrati-sche Handwerksmeister vom Stadtrand. Es ist schlichtweg verlogen, sich dieser Verantwor-tung zu entziehen. Gegenüber den Afghanen, denen die Bundesregierung eine bessere Zu-kunft versprochen hat. Und auch gegenüber den Soldaten und Wiederaufbauhelfern, die ihr Leben für eine Sache einsetzen, die (fast) alle wollten, aber an die sich jetzt niemand mehr erinnern will.
Wenn doch über Afghanistan geredet wird, dann fast nur noch über die Art und Weise des Abzugs. „Raus aus Afghanistan!“, plakatiert die Linkspartei seit Jahren. Und was ist mit denen, die nicht raus können? Ich habe selbst in Mazar-e-Sharif mit einem jungen Anglisten reden kön-nen, der für die Bundeswehr als Übersetzer ar-beitet. Er ist einer von bis zu 200.000 Afghanen, die mit den Deutschen während der vergangenen zehn Jahre zusammengearbeitet haben. „Natür-lich werden sie mich suchen. Und sie werden mich auch finden“, antwortete er auf die Frage, was nach einem Machtwechsel passieren würde. Er vertraue auf die Hilfe der Deutschen. Sie wür-den ihm und seiner Familie schon Zuflucht bieten. Es war nicht ganz einfach, ihm zu erklären, dass
Deutschland führt Krieg in Afghanistan. Und das
Erstaunliche ist, dass dies niemanden in der Republik
so wirklich zu interessieren scheint. Der Krieg geht uns
alle etwas an, sagt Sebastian Christ. Wie sehr, werden
wir spätestens beim Abzug merken.
Unser Vietnam
die meisten Deutschen sich überhaupt nicht für ihn und seine Familie interes-sieren. Dass es den meisten Deutschen völlig egal zu sein scheint, was nach dem Abzug der Isaf-Truppen passiert. Dass es den meisten nur um eine schnelle Been-digung des Krieges geht. Womit auch ge-klärt wäre, wie die brutale Seite des bun-des deutschen Pazifismus aussieht. Gut dazu passt auch, was der SPD-Bundestags-abgeordnete Gernot Erler im Februar auf einer Diskussionsveranstaltung der Uni Freiburg sagte: „Die einzige rote Linie, das ist die Rückkehr von Al Quaida.“ Sonst ist dem „Friedenspolitiker“ mittlerweile alles gleich, wenn es um den Rückzug aus Afgha-nistan geht.
Um unsere Versprechen einzuhalten, müss-ten wir noch mindestens zwanzig Jahre am Hindukusch bleiben. Aber das will natürlich kein deutscher Politiker mehr, auch kein amerikanischer und kein französischer. Und vor allem: Auch die Afghanen haben mittler-weile genug.
Der Afghanistankrieg ist unser Vietnam. Nicht, was die Opferzahlen betrifft. Es geht um die moralische Dimension. In zwei, drei Jahren werden wir Verdrängungsweltmeister vorm Fernseher sitzen und sehen, wie Men-schen im Chaos umkommen, die uns einst vertraut haben. Wir werden sehen, wie deut-sche Wiederaufbauhelfer von der GIZ evaku-iert werden müssen. Vielleicht sogar vom Dach ihres Kabuler Anwesens? Erst dann werden wir merken, dass Deutschland keine „Supermacht der Werte“ ist. Sondern allenfalls ein Land, das Angst vor sich selbst hat.
Das Lager „Camp Marmal“ in Mazar-e-Sharif: Ende mit Schrecken – und danach?
Berlin
Hat in Afghanistan erlebt, dass auch Untätigkeit bisweilen eine Form von Gewalt ist.
Sebastian Christ (31)
Foto
: Seb
stia
n C
hrist

10 debatare.de
Nach der Extremismustheorie der Politikprofessoren Eckhard Jesse und Uwe Backes können die politi-
schen Kräfte einer Gesellschaft wie ein Huf-eisen angeordnet werden. Dabei befindet sich die „freiheitlich-demokratische Gesinnung“ in der Mitte des Eisens. Die extremen Kräfte werden durch die sich annähernden Enden rechts und links symbolisiert. Die rechtschaf-fende Mitte muss sich gegen ihre Feinde an den äußeren Rändern zur Wehr setzen. Extrem rechte Gruppierungen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie nicht alle Menschen als gleich anerkennen. Extrem linke Gruppen da-gegen übersteigern diese Gleichheit. Beide „Ex-tremismen“ aber weisen hinsichtlich dogmati-scher Einstellung, der Schaffung von einfachen Feindbildern und prinzipieller Gewaltbereit-schaft Gemeinsamkeiten auf. Zu einem dieser Extremismen zu gehören, bedeutet laut der The-orie, die freiheitlich-demokratischen Grundord-nung (fdGO) abzulehnen, die sich unter anderem aus Grundsätzen wie den Menschenrechten, der Gewaltenteilung und dem Mehrparteiensystem zusammensetzt.
Ausgehend von dieser Theorie begann Familienmi-nisterin Kristina Schröder ihre Kampagne gegen
Aus Sicht der anitfaschistischen Linken in Berlin wird linkspolitisches Engagement
durch die Extremismustheorie pauschalisiert und kriminalisiert. Sie wollen, dass
Demokratie streitbar bleibt, dazu muss Menschenfeindlichkeit kritisierbar bleiben.
Der totale Vergleich: Über „extreme“ Äpfel und Birnen im Hufeisen
den „Linksextremismus“ mit der Durchsetzung der Extremis-musklausel. Aufgrund dieser Klausel werden Vereine, die vom Bund gefördert werden, verpflichtet, von ihren Partnern und Mitarbeitern schriftliche Bekenntnisse zur fdGO einzuho-len. Darüber hinaus muss geprüft werden, ob Partner oder Mitarbeiter im Verfassungsschutzbrief erfasst wurden, also unter „Extremismusverdacht“ stehen.
Durch die massive staatliche Kontrolle, wurde die Zusam-menarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren, An-tifaschisten und Staatsprogrammen stark erschwert, so die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Auch linke Medien wie „Neues Deutschland“, die in der Broschüre „Demokratie stärken – Linksextremismus verhindern“ finanziert vom Familienministerium fälschlicherweise als „linksextre-mistisch“ bezeichnet wurden, sind Geschädigte dieser politischen Kampagne.
Friedrich Burschel, Referent der Rosa-Luxenburg-Stif-tung für politische Bildung stellte schon 2011 fest, dass das den „Linksextremisten“ zugeschriebene Ziel, die Veränderung der Gesellschaft oder die Überwindung des Kapitalismus weder verboten, noch im Rahmen der fdGO verfassungsfeindlich ist. „Die Stigmati-sierung kritischer, auch sehr kritischer, ja selbst verfassungskritischer Meinungsäußerung als ,ext-remistisch‘ ist dagegen antifreiheitlich und unde-mokratisch“, kritisiert er.
Die von Schröder gesehene Gefährdung der Demokratie durch eine linke Bedrohung kann mit dieser theoretischen Grundlage in Frage gestellt werden, finden die Sprecher der antifaschistischen Linken Berlin. Im ei-gentlichen gäbe es den „Linksextremismus“ nicht. Stattdessen fordern sie, dass die ein-zelnen linkspolitischen Vereine und Gruppen wesentlich differenzierter dargestellt werden müssen. Die inhaltlichen Unterschiede seien zu groß, als dass man sie derart verallgemei-nern könne. Sie müssen einzeln und konkret betrachtet werden. Ansonsten bleibt die Gefahr Andersdenkende zu kriminalisieren. Auch die vermeintlichen Gemeinsamkeiten linker und rechter „Extremisten“, wären dann nicht mehr pauschal aufzuzählen.
Berlin
Unterstützt Freiheit im Denken und
eine freieGesellschaft.
Stella Napieralla (29)

11debatare.deFoto: Jonas Fischer

12 debatare.de
DEBATTE
Brauchen wir ein Leistungsschutzrecht?Das Urheberrecht wird leiden-schaftlich diskutiert – aus gutem Grund. Kein anderes Rechtsgebiet ist für die Entwicklung des Inter-nets so wichtig wie dieses. In vir-tuellen Welten muss geregelt sein, wie mit virtuellen Gütern umge-gangen wird. Nur so kann Wachs-tum stattfinden und Kreativität sich entfalten. Alle Beteiligten der Debatte haben in den vergangenen Jahren viel voneinander gelernt. Grundhaltungen sind mit Verve beschrieben, verteidigt und ange-griffen worden. Trotzdem haben viele Debattenteilnehmer zugleich auch etwas Nachvollziehbares und Verständliches in der Position der anderen gefunden.
Das gilt auch für Presseverlage. Sie haben verstanden, dass Nutzer moderne Angebote und Geschäfts-modelle schätzen, ein legitimes Interesse an einfachem Zugang zu kreativen Werken haben, die-
se in Blogs auszugsweise verwen-den und verändern wollen, nicht mit übertriebenen Abmahnungen überzogen werden möchten und Stoffe, die sie interessant finden, mit anderen zu teilen wünschen. Umgekehrt ist in der Netzgemein-de das Verständnis dafür gewach-sen, dass auch Urheber und ihre Verlage von etwas leben möchten und sich dagegen wehren, gegen ihren Willen kostenlos kopiert zu werden.
Auf dieser Grundlage könnte die Debatte nun in eine sachlichere Phase eintreten. Es wäre wichtig, jetzt die einzelnen Projekte für eine Modernisierung des Urhe-berrechts zu definieren. Manches wird sich außerhalb des Gesetzes klären lassen, zum Beispiel das unkomplizierte Einholen von Nut-zungsgenehmigungen über digita-le Plattformen. Manches müsste vielleicht im Gesetz geklärt wer-
den, zum Beispiel die Erleichte-rung der Privatkopie. Manches muss auf jeden Fall vom Gesetz-geber novelliert werden, etwa der Umgang mit verwaisten Werken, die Regeln für Public Viewing oder die Schaffung eines Leis-tungsschutzrechts für Presse-verlage. Ein fairer Ausgleich zwi-schen Nutzern, Urhebern und Werkmittlern (Verlagen, Pro-duzenten, Musikfirmen) kann aber nicht auf der Straße unter Fahnen und Plakaten gefunden werden. Die Lösung liegt am Verhandlungstisch.
Durch die hitzige Debatte der vergangenen Jahren sind Tü-ren aufgestoßen, nicht zuge-schlagen worden. Alle inte-ressierten Gruppen sollten jetzt zusammen finden und vernünftige Lösungen suchen. Die Presseverlage sind dazu bereit.
„Gewerbliche Anbieter im Netz, wie Such-
maschinenbetreiber und News-Aggregato-
ren, sollen künftig für die Verbreitung von
Presseerzeugnissen (wie Zeitungsartikel)
im Internet ein Entgelt an die Verlage zah-
len.“ Diese Formulierung aus dem Koaliti-
onsausschuss von CDU und FDP beschreibt
das sogenannte Leistungsschutzrecht.
Dieses wird schon länger diskutiert, jetzt
werden die Pläne für eine Einführung aber
konkreter. Durch das Leistungsschutzrecht
würden Verlage an den Gewinnen gewerbli-
cher Internetdienste beteiligt. Denn diese
verdienen bislang Geld mit den Inhalten, die
sie kostenfrei nutzen können, so die Argu-
mentation. Das bestehende Urheberrecht soll
den Urhebern eine angemessene Vergütung
für die Nutzung ihrer Werke sichern. Durch
die Überarbeitung des Urhebervertragsrechts
Hintergrund
Christoph Keese
Konzerngeschäftsführer Public Affairs der Axel Springer AG, leitet gemeinsam mit Prof. Robert Schweizer den Arbeitskreis Urheberrecht der Verlegerverbände BDZV und VDZ.
Pro
Foto
: Axe
l Spr
inge
r AG

13debatare.de
Dr. Till Kreuzer
Rechtsanwalt und Mitbegründer von iRights.info. Mitglied der Deutschen UNESCO Kommission und Gründer der „Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht“ (IGEL).
Ein Leistungsschutzrecht für Pres-severlage ist weder notwendig noch zu rechtfertigen. Es ist nicht notwendig, da die Presseverlage schon jetzt ausreichenden Schutz genießen. Sie lassen sich von den Journalisten urheberrechtliche Nutzungsrecht abtreten, die ih-nen eine weit reichende Rechts-position verschaffen. Schon deshalb ist ein neues Leistungs-schutzrecht nicht zu rechtfer-tigen. Umso weniger gerecht-fertigt ist es, weil es erhebliche Kollateralschäden herbeiführen würde. Und zwar unabhängig davon, wie es letztlich konkret ausgestaltet wird.
Schon die angeblich zwingen-den Gründe, die für das neue Recht vorgebracht werden, sind äußerst fragwürdig. Da heißt es, den Verlagen gehe es schlecht. Online-Piraterie nehme bedrohliche Ausmaße an. Rechte seien aufgrund der vielen Autoren nicht durch-setzbar und gewerbliche Nutzer sowie Suchmaschi-nen würden sich am „geis-tigen Eigentum“ der Verlage bereichern, indem sie deren
Online-Inhalte zu kommerziellen Zwecken verwenden. All das soll das neue Leistungsschutzrecht än-dern können.
Hieran ist schlichtweg gar nichts richtig. Weder wäre ein Verleger-leistungsschutzrecht ein Wunder-mittel zu Lösung dieser angebli-chen Probleme. Noch erweist sich auch nur eine dieser Behauptungen nach näherem Hinsehen als haltbar oder gar belegt. Und: Selbst wenn alle oder einige dieser Aussagen zuträfen, wäre dies kein Grund, ein Leistungsschutzrecht einzuführen. Das ist der Grund, warum sich die Fachwelt, die Online-Community und annähernd die gesamte deut-sche Wirtschaft gegen ein solches Leistungsschutzrecht ausgespro-chen hat.
Ein Beispiel: Um es Verlagen zu er-leichtern, sich gegen die angeblich massenhafte Piraterie ihrer Inhalte zu wehren, braucht man kein neues Leistungsschutzrecht einzuführen. Man müsste nur eine simple Re-gelung schaffen, nach der Verlage im Zweifel befugt sind, die Rechte an den von ihnen veröffentlichten Werken gerichtlich durchzusetzen.
Hiergegen hätte im Zweifel nie-mand etwas. Freilich ist fraglich, ob eine solche Maßnahme überhaupt notwendig ist. Wo ist der Beleg für die angeblich massenhafte Pira-terie von Online-Presseinhalten? Oder anders gefragt: Warum soll-ten Beiträge, die für jedermann frei zugänglich im Internet stehen, in großem Stil raubkopiert und über andere Webseiten verbreitet wer-den?
Und die Sache mit den gewerbli-chen Schmarotzern? Die Verlage stellen ihre Beiträge freiwillig für jeden Nutzer kostenlos ins Netz. Sie dürfen also gelesen werden und Suchmaschinen dürfen Aus-schnitte anzeigen, damit sie auch gefunden werden können (zuguns-ten aller Beteiligten). Alles andere (kopieren zu gewerblichen Zwe-cken, Einstellen ganzer Artikel auf anderen Webseiten und so wei-ter) ist schon nach dem geltenden Urheberrecht nicht erlaubt. Die Verlage können also gegen solche Handlungen vorgehen. Ein zusätz-liches Leistungsschutzrecht, das erhebliche Auswirkungen auf die Kommunikationsgrundrechte hät-te, brauchen sie hierfür nicht.
wird Urhebern eine “prinzipielle Vergü-
tung” jeder Nutzung zugesprochen. In der
Praxis, wenn es etwa um die Verwendung
von Texten im Internet geht, wird dies
jedoch nicht immer eingehalten. Bei der
weiteren Überarbeitung des Urheberrechts
soll das „Leistungsschutzrecht“ gesetzlich
verankert werden. Dies hat der Koalitions-
ausschuss von CDU und FDP bestätigt. Im
Internet wird über das neue Immaterialgü-
terrecht kontrovers diskutiert, viele große
Verlage setzen sich für die Einführung eines
solchen Rechtes ein.
Hintergrund
Contra
Beziehen Sie Stellung zum
Thema Leistungsschutzrecht.
Dazu einfach online gehen
und mit debattieren.
Foto
: Jan
a Po
falla

14 debatare.de
EineschwierigeBeziehung
Fotos: Jonas Fischer

15debatare.de
Gregor Gysi blickt differenziert auf sich und seine Partei. Eine
bessere Öffentlichkeitsarbeit und das Internet könnten es
einfacher machen, eigene Ziele zu kommunizieren. Nicht alle
haben das verstanden. Die Alternative: nur mit ausgewählten
Journalisten sprechen. Von Gregor Landwehr.
Es war kurz nach der Wiedervereinigung, da lernte Gregor Gysi (Linke), dass er im Fernsehen eine Doppelquote bringt. „Ich bin damals häufig in Talk-shows eingeladen worden. Das hatte damit zu tun, dass wir in den Nach-
richten nicht vorkamen. Aber damit sie mich einladen konnten, mussten sie mir bösartige Fragen stellen. Sie erklärten mir damals, dass ich eine Doppelquote bringe. Die, die mich mögen, und die, die mich hassen, schauen zu“, erklärt der Politiker. Durch die Auftritte konnte Gysi das Bild von sich und seiner Partei in der Öffentlichkeit verändern – und er lernte grundlegendes über das deutsche Mediensystem. Mittlerweile kommt seine Partei in den Nachrichten vor. Doch das Verhältnis der Linken zu den Medien – es ist ein besonderes, es ist kompli-ziert. Der Linken-Fraktionschef Gregor Gysi sagt dazu nur: „Die Linke hat ein Verhältnis zu den Medien, was besser sein könnte.“ Und er fügt an, dass die Lin-ke unzureichend verstanden werde. Dieser ständige Eindruck, missverstanden oder gar bekämpft zu werden, ist ein Merkmal jenes besonderen Verhältnisses.
„Massenmedien versuchen auf die Willensbildunglinker Parteien Einfluss zu nehmen“ Wie tief das Misstrauen gegenüber Medien aller Art sitzt, zeigt ein Aufruf von Mitgliedern und Sympathisanten der Linken unter dem Titel „Mannschafts-spiel gegen Medienmacht“. Die Partei sieht sich von den Medien bedroht, von den Medienkonzernen sogar „bekämpft“. „Die Massenmedien versuchen auf die Willensbildung linker Parteien Ein-fluss zu nehmen, etwa über die Trennung in vermeintliche ,Fundis‘ und ,Realos‘ oder vermeintliche ,Regierungsbefürworter und –gegner‘“, heißt es dort. Daher sollten sich Mitglieder und Führungskräfte „überwiegend in den dafür vorgesehenen Gremien sowie parteiinternen bzw. partei-nahen Medien (Neues Deutschland, Junge Welt, Blogs, Disput etc.)“ äu-ßern. „Interviews und Beiträge in den großen Massenmedien sollten vor allem für Werbung für die Positionen der Linken genutzt werden.“ Ist das für den linken Spitzenpolitiker Gysi ein geeigneter Weg? „Das funktio-niert überhaupt nicht. Ich kann mir die Medien nicht aussuchen“, stellt er nüchtern fest. Die Medien seien sehr unterschiedlich und natürlich gebe es Journalisten, die den Linken nicht wohl gesonnen seien. Das grundsätzliche Problem der Linken liegt dabei tiefer. Es ist ein syste-misches Problem. Denn Medien haben Eigentümer. Und diese hätten kein Interesse daran, das kapitalistische System zu überwinden, meint Gysi. In der Folge heißt dies: Medien haben daher auch kein Interesse an der Linkspartei. Doch Gysi stimmt auch selbstkritische Töne an „ Wir müssen versu-chen, selbst Öffentlichkeit herzustellen.“ Gysi hat konkrete Pläne. Das Internet könnte Rettung bringen.„Schon weil Diktaturen es fürchten sollten wir das unterstützen.“ Eigentlich ist die Linke im klassischen Medienbereich gut unterwegs. So beziffert die Arbeitsgemeinschaft „Rote Reporter“, eine Interessenvertretung linker Medienmacher, die Auflage der Medien „rund um Die Linke“ mit über einer Million Exemplaren, die allerdings nicht täglich, sondern meist monatlich erscheinen. Auch bei der Arbeitsgemeinschaft sieht man die Medi-enkonzerne als Gegner von Parteien wie der Linken.
Gregor Gysi ist gedanklich schon weiter. Es hat lange, gedauert bis die Partei einen Zugang zum Internet gefunde hat – jetzt möchte sie das Netz stärker nutzen. Selbst wenn das im Jahr 2012 bei den Genossen noch holprig klingt. Gysi beantwortet „Email-Briefe“ aber „twittern, davon halte ich nicht viel“. Damit ist er fast schon wieder auf Parteilinie.

16 debatare.de
Es geht um das Thema Renten, genauer gesagt Renten für Übersiedler aus der ehemaligen DDR. Diese wurden bei der Eingliederung in das Rentensystem der Bundesrepub-
lik integriert. Für die Rentenberechnung wurde der Durchschnitt der westdeutschen Berufskollegen zu Grunde gelegt, es galt das Fremdrentengesetz. Doch für die Betroffenen kam die Überraschung viele Jahre spä-ter mit der Rentenzahlung. Die Berechnungsgrundlage wurde geändert, jetzt gilt das Rentenüberleitungsgesetz (RÜG). Dabei werden die tatsächlich in der DDR erworbenen Rentenan-sprüche als Grundlage genommen. Ein Betroffener ist Jürgen Holdefleiß.: „Offiziell ist darüber nichts mitgeteilt worden. Bei mir persönlich war es so: Ich hatte bei der Rentenversiche-rung eine Frage, die auf ganz anderem Gebiet liegt. Und da-bei habe ich es zufällig erfahren. Vielen anderen ist es ganz ähnlich gegangen.“ Die Betroffenen haben sich mittlerweile organisiert. Jürgen Holdefleiß ist der Vorsitzende der Inter-essengemeinschaft ehemaliger DDR-Flüchtlinge. Sie klagen teilweise über deutliche finanzielle Einbußen. „Die Transformation der DDR-Erwerbsbiographien der Übersiedler und Flüchtlinge im Zuge ihrer Eingliederung waren Rechtsakte, auf deren Bestand sich die Betroffenen verlassen haben.“ So schreiben es SPD und Grünen in einem Antrag an den Bundestag. Sie wollten in diesem Jahr eine gesetzliche Regelung für das Problem schaffen, doch der Antrag wurde von der Regierung abgelehnt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl Schiewerling findet das Anliegen der Betroffenen zwar politisch ver-ständlich, eine neue gesetzliche Regelung sei jedoch verfassungsrechtlich bedenklich. Er schreibt den Betroffenen in einem Brief: „In Gesprächen mit den Fachleuten und den Fachabteilungen der Ministe-rien sind wir jedoch zu dem Ergebnis gelangt, dass starke rechtliche und verfassungsrechtliche Beden-ken gegen die neue gesetzliche Regelung bestehen, wie sie die SPD vorschlägt. Die Rentenversicherung
Verrentet und verraten? Beim Petitionsausschuss im
Bundestag liegt seit dem
Jahr 2006 eine Akte. 120
Seiten umfasst sie mitt-
lerweile, es gibt zwar eine
Beschlussempfehlung, eine
Entscheidung ist aber noch
lange nicht in Sicht. Einsehen
kann man sie nicht.
kann nicht ohne weiteres der Ort sein, wo sämtliche Aspekte des sozialistischen Un-rechtregimes aufgearbeitet und kompen-siert werden können.“ Doch genau das spielt eine Rolle: System-träger von damals bekommen häufig mehr Rente. Der Grund sind diverse Sonderver-sorgungssysteme aus DDR-Zeiten. Dieje-nigen, die vorhatten die DDR zu verlassen, zahlten in der Regel nicht in diese Versor-gungssysteme ein.
Es geht für die Betroffenen um das Vertrauen in den Rechtsstaat. Die Frage lautet: Was ist gerecht? Die bisherige Regelung mag rechtlich korrekt sei – darauf verweist auch das Sozial-ministerium gerne – doch es geht um die Aus-sage, die damit verbunden ist: Wer mehr Rente bekommt, der kann damals nichts Schlimmes getan haben – so sehen es die Opfer. Und die Debatte wird zunehmend emotional, so erlebt es Jürgen Holdefleiß: „Dass es seit so vielen Jahren anhält dieses Problem, dass die Petition schon seit 2006 beim Petitionsausschuss liegt, und eine Bearbeitung überhaupt nicht zu erken-nen ist, obwohl eine Beschlussempfehlung vor-liegt. Dass die Regierungsfraktionen, wie die Kat-ze um den heißen Brei einen Bogen machen und sich nicht klar bekennen. Das ist das Schlimme. Und weiterhin ist auch noch das Schlimme, das man uns das persönliche Gespräch verweigert.“ Auch wenn es bei diesem Problem um Geld in Form der Rentenhöhe geht – was wesentlich stär-ker wiegt ist die Aussage, die damit verbunden ist. Ein Rechtsstaat zeichnet sich auch dadurch aus, dass er in der Lage ist, Fehler zu korrigieren. Über-fällig ist diese Korrektur schon lange.
Gregor Landwehr (28)
Tübingen
Erinnert sich an die DDR noch nicht einmal aus seinen Kindertagen.
Foto
: Gre
gor L
andw
ehr

17debatare.de
Richard Geis kippt die deut-
sche Vergangenheit auf den Tisch. Aus einer goldenen Kaffeetüte purzeln Spielzeug-Tannen und Würfel. Geis öff-net einen grauen Schnellhefter. Im In-nern versteckt sich eine Zeichnung, eine bunte Märchenwelt. Aus dem gemalten Traumschloss winkt der gestiefelte Kater, im Zauberwald pfeift der Wind durch die Wipfel. Unter jedem Baum versteckt sich ein Schatz: zum Beispiel Aschenputtels Ballschuh oder Dornröschens Spindel. Für Geis ist der wertvollste Schatz der Mär-chenwald selbst. Er ist ein Überbleibsel aus einem untergegangenen Land. Die Zeich-nung gehört zum Gesellschaftsspiel „Saga-land”, oder besser: einer sehr speziellen Ko-pie davon. Handgefertigt in der DDR.
Es sind Unikate wie diese „Sagaland”-Ost-kopie, die der Student Richard Geis zusam-men mit seinem Kommilitonen Martin Thiele sucht und vor dem Mülleimer rettet. „Viele Menschen haben leider kein Bewusstsein da-für, dass sie etwas Besonderes besitzen. Das wollen wir ändern”, sagt Geis. Die zwei Freun-de sammeln die Spielekopien und präsentie-ren im Internet und in Ausstellungen die Ge-schichten dazu.
Als „Sagaland” 1981 in der BRD erschien, wur-de es schnell zum Klassiker unter den Gesell-schaftsspielen. Doch auf der anderen Seite der Mauer bekam man davon nichts mit. Die SED hatte den Verkauf von Westspielen untersagt, sie galten als systemfeindlich und gefährlich. Doch natürlich bewirkten die Verbote wie so oft das Gegenteil. Die DDR-Bürger schmuggelten die Originale eben in den Osten und kopierten sie mit Schere, Buntstiften und Kleber. Die Spiele made in DDR waren keine Seltenheit, das Nachmachen wurde ein regelrechter Volkssport. Vorlagen gab es genug: Klassiker wie „Monopoly”, „Malefiz” und „Vier gewinnt” oder damals moderne Brett- und Kartenspiele wie „Sagaland”, „Heimlich & Co” oder „Kuhhandel” wurden liebevoll improvisiert.
Verspielte DDR-Kopien
Woher kam das große Interesse an West-spielen? „Sie waren nicht erhältlich und genau aus diesem Grund populär”, sagt Geis. Eine andere mögliche Erklärung: Die Ostspiele langweilten die DDR-Bürger. Der Gründer des Deutschen Spiele-museums, Peter Lemcke, schreibt in einem Aufsatz: „In der DDR gab es praktisch keine komplexen Spiele, keine innovativen neu-en Spielformen. Woran hat das gelegen? Zum Spiel gehört auch das Querliegende, Unangepasste. Dabei sind Abweichungen vom Üblichen, die Unordnung, die Unsicherheit und die Umkehr-funktion von Spielen oft eine latente Bedrohung von vorherr-schender Ordnung. Spiel stellt die Mächtigen in Frage.”
Beispiel „Monopoly”: „Während des Kalten Krieges war das Spiel im Ostblock verboten. Bereits Josef Stalin wollte sich wegen dessen angeblicher Dekadenz nicht damit anfreunden. Grund genug, das Spiel aus dem kapitalistischen Ausland zu verbieten”, heißt es beim Spielehersteller Hasbro. „Mono-poly” sollte auch das Territorium der DDR nicht erreichen. Exemplare in Westpaketen wurden konfisziert. Doch nicht nur die einfachen DDR-Bürger ignorierten die Anweisung. Sammler Thiele erinnert sich an die Begegnung mit einem ehemaligen Soldaten: „Der Mann arbeitete in der Natio-nalen Volksarmee. Dort bastelte er ein „Monopoly”-Brett, um sich die Zeit mit seinen Kameraden zu vertreiben. Da-mit seine Vorgesetzten es nicht entdeckten, versteckte er es auf der Rückseite eines Bildes. Das Gemälde hing in der Stube an der Wand und wurde bei Bedarf herunter-genommen und umgedreht.” Thies schiebt einen Stapel Kärtchen auf den Tisch. Die Ereignis-Karten sind Teil einer „Monopoly”-Version aus Leipzig. Auf eine Karte ist gekritzelt: „Dein Kind hat sich ein Bein gebrochen, gehe in die Querstraße und bezahle.” An der Adresse stand früher die Leipziger Kinderchirurgie.
Thiele und Geis wünschen sich, dass sie noch viele solche Schätze entdecken. Je mehr Spielekopien sie in Ausstellungen präsentieren, desto lebendiger bleibt die verspielte Vergangenheit der DDR. Bis es soweit ist, schützt die goldene Kaffeetüte Pöppel, Würfel und Karten vor dem Vergessen.
Weil es westdeutsche
Gesellschaftsspiele in der
DDR nicht gab, wurden sie
im Osten einfach nachgebaut.
Ob “Monopoly”, “Sagaland”
oder “Malefiz”, alle Klassiker
des Klassenfeindes wurden in
den volkseigenen Bastelstuben
kopiert.
Wiesbaden
Besitzt mehr als hundert Brettspiele und leitet in seiner Freizeit www.zuspieler.de
Sebastian Wenzel (33)
Foto: Sebastian Wenzel

18 debatare.de
In Kassel geboren wollte er dort eigent-lich an der Kunsthochschule studieren. Doch die lehnte ihn drei mal ab. Bis er
das Prinzip verstanden hatte. „Es liegt nicht daran, was man einreicht, sondern das man ein Passepartout drum hat.“ Er packte einen kleinen Rahmen um seine Werke, bekam einen Studienplatz und studierte Kunstpäd-agogik. Es war die Zeit nach dem Jahr 1968, Baumann lebte in einer Wohngemeinschaft, arbeitete in einem linken Buchladen und en-gagierte sich in Hochschulgremien – ein ty-pisches linkes Studentenleben. Keine Lust aufKunstpädagogik mit Kindern Im Jahr 1976 war er fertig. Doch dann kam die Erkenntnis: „Ich habe gemerkt, dass ich mit Kindern eigentlich nichts am Hut habe.“ Daher studierte er noch mal, dieses mal Kunstwissen-schaften, gleich im Anschluss promoviert er über die Darstellungsfunktion von Bildern. Und er hat ein klareres Ziel: Eine wissenschaftliche Karriere, eine Professur für Ästhetik schwebte ihm vor. Doch da gab es in seiner Vita noch das Berufsverbotsverfahren. Das wurde zwar später eingestellt, aber: „Ich hatte keinen Bock mehr auf Mobbing und Vetternwirtschaft an der Hoch-schule.“ Der gebürtige Hesse blieb seiner Heimat treu, zog aber aufs Land. Dort hatte ein Freund ein Fach-werkhaus gekauft. Baumann half beim Renovie-ren. Er war fasziniert von den Motorrädern, die sein Freund umbaute. Besonders angetan hatten es ihm die bemalten Tanks – aus kunstwissen-schaftlichem Interesse. Ihn interessierte die Iko-nographie der Motive. „Aber mit meinem kunst-
wissenschaftlichen Wissen kam ich nicht weiter.“ Denn die Leute die sich die Tanks bemalen ließen, hatten gar nicht den kulturellen Hintergrund. Für Baumann waren die Tanks der Einstieg in die Bikerszene. Er wurde Chefredakteur des Magazins „Bikernews“. Und er blieb dies zwanzig Jahre lang. Der Anfang bei den Motor-radfahrern war nicht leicht: „Da ich gerade von der Uni kam und mich auch so ausdrückte.“ Allerdings hatte er auch einen Vorteil: „Ich sah damals schon so aus wie heute.“ Hans Baumanns Stil mit langen Haaren, die mittlerweile grau geworden sind, half ihm in der Szene akzeptiert zu werden.
Nach einer Weile war er dort integriert. Bis 1996 war er Chef-redakteur des Magazins, bis 2005 noch dessen Herausgeber. „Dann wurde es mir zu viel.“ Beruflicher Wandel:Vom Biker zum Bildbearbeiter Es war im Jahr 1984 als Baumann bei dem Freund, der auch die Motorräder umbaute, den ersten Mac sah. Davor hatte er nie über Computer nachgedacht. Aber dieser hatte eine Maus zum malen, Dokumente konnten in den Papierkorb geworfen werden, das fand er toll. „Ich habe umgerechnet, was ich auf 20 Jahre spare.“ Und er kaufte sich einen Mac, und ein zweites Diskettenlaufwerk noch dazu. Ein Jahr später lautete das Zauberwort „Desktop-Publishing“ (DTP), das Gestalten von Dokumenten am Computer. Baumann nutzte es für seine Zeitschrift und für ein Buchprojekt. Dabei ging es um ein ganz anderes Thema, die Dreharbeiten des Films „Der Name der Rose“.
Durch Zufall kam er zu den Dreharbeiten, fuhr nach München, fragte Bernd Eichinger der sein Okay gab. Baumann machte sich an die Arbeit, aber das In-terview mir Sean Connery dauert sehr lange, daher schlug er dem Verlag vor, das Buch selber zu setzen. So entstand in Deutschland das erste Buch, das vom Autor selbst mit DTP gestaltet wurde. Nach dem Beststeller hatte Baumann ein neues Thema: DTP.
Ein Mann mit vielen Ebenen Dogma – eine unumstößliche Lehrmeinung. Auch wenn Dr. Hans Baumann sein Maga-
zin Docma mit einem c schreibt, wenn es um das Thema Bildbearbeitung mit Photo-
shop geht, ist er einer der Experten in Deutschland. Und seine Meinung hat Gewicht.
Dass aus dem hessischen Kunstwissenschaftler der Photoshop-Papst „Doc Baumann“
wurde, war mehr Zufall. Von Gregor Landwehr.
Darüber schrieb er für verschiedene Maga-zine Artikel. Bis der Anruf einer Redakteu-rin kam, die fragte, ob er ein neues Grafik-programm testen wolle. Es hieß Photoshop.Der erste Gedanke der ihm kam: Mit dem Namen, das kann nichts sein. Am Ende war es aber doch etwas. Baumann spezialisiert sich auf das Thema Gestaltung mit Photo-shop. 2001 gründet er seine eigene Zeit-schrift, sie hieß „Doc Baumans Magazin für digitale Bildbearbeitung“, aus dem sperrigen Namen wurden die Akademischen Titel der Herausgeber, kurz: „Docma“ für Dr. und Ma-gister.
4.000 Wolkenbilderim eigenen Fotoarchiv Photoshop hat den Umgang mit Bildern ge-ändert. „Durch Photoshop können viel mehr Leute in Bilder eingreifen.“ Das habe aber auch dazu geführt, dass viele nicht mehr so naiv an ein Bild rangehen. Was für ihn ein gutes Foto ausmacht? Ein Bild habe den Anspruch, die Szene so erlebbar zu machen, wie sie der Foto-graf erlebt hat. „Beim Bearbeiten wird das Bild nicht verfälscht, sondern dem angenähert, was der Fotograf gesehen hat.“ Heute lebt Baumann in einem alten Tanzpalast in der hessischen Pro-vinz. Den Tanzsaal braucht er für seine Bücher – 20.000 Stück. Die Zahl der Fotos in seinem Archiv ist noch größer.
Wenn Baumann selbst fotografiert, dann nur Rohmaterial für seine Arbeit. In seiner Bildda-tenbank gibt es allein 4.000 Wolkenformationen. Insgesamt hat er 80.000 Bilder in seiner Daten-bank. „Irgendwann braucht man es“, weiß er aus Erfahrung.
Docma im
Internet lesen

19debatare.deFoto/Montage: Jonas Fischer

20 debatare.de
Bildsprache
(1) Zum Aufwärmen ein leichtes Bilderrätsel: Hier wird das aktuelle Unwort des Jahres 2011 gesucht, dass eine Serie von Verbrechen türkisch- und griechischstämmigen Menschen bezeichnet, die vor Jahren in Deutsch-land begonnen hat. Der Begriff wurde von der Polizei und von Jour-nalisten verwendet, um die schrecklichen Ereignisse zusammenzu-
fassen. Die Jury kritisierte, dass das gesuchte Wort verharmlosend wirkt und den schweren Verbrechen eine folkloristisch-stereotype Etikettierung verpasst.
Denn die Opfer, die als Kleinunternehmer in Deutschland arbeiteten, werden kli-scheehaft unter einem beliebtem Schnellgericht zusammengefasst und deutlich auf
ihre Herkunft reduziert.
(2) Dieses Bilderrätsel steht für die Em-pörung der Menschen, dass politische Entscheidungen über ihre Köpfe hin-weg getroffen werden.
Oft tauchen in den Medien sprachliche Bilder auf, die nicht den gemeinten Kern treffen oder sogar ganz falsch sind.
In den Händen von Journalisten werden Worte zu spitzen Waffen. Eine Auswahl der instrumentalisierten Begriffe
zeigen die sechs Bilderrätsel. Viel Spaß beim Raten!
(3) Als nächstes wird der beschönigende Begriff für die Standorte zur Stromgewinnung gesucht. Das zusammen-gesetzte Wort wurde von den Betreibern gestreut, weil es eine recht harmlose Bezeichnung für einen gefährlichen
Vorgang ist, der 1986 in der Sowjetunion und im vergangenen Jahr in Japan außer Kontrolle geraten ist. Zudem sollte es auch Assoziationen mit den verheerenden Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg vermeiden.
Foto: Patrick Stößer
Foto: Jonas FischerFoto: Patrick Stößer

21debatare.de
(5) Dieses Bilderrätsel ist recht leicht zu lösen: Es meint einen Begriff, der sich auf die neuen Bundesländer bezieht und diesen Teil des Landes stark
abwertet. Das beleidigende Wort wurde vor allem in den 1990er Jahren verwendet und leitet sich angeblich von den beiden Ds in der nicht mehr
existierenden DDR ab.
(4) Gar nicht so leicht zu erraten ist dieses Bilderrätsel – es zeigt ein Wort, dass neue Geräte für die Sicherheitskontrolle an den Flughäfen einseitig dramatisiert. Damit sollen Waffen und Sprengstoff, die direkt am Körper getragen wird, gefun-den werden. Der gesuchte Begriff bezieht sich darauf, dass Strahlung die Kleidung von Passagieren durchdringt und recht intime Einblicke ermöglicht.
(6) Das letzte Bilderrätsel zeigt wieder ein Unwort des Jahres – dieses Mal aus dem Jahr 2004. Es meint das ökonomische Potenzial von Menschen, das sich aus ihren Fähigkeiten, Kenntnissen und der absolvierten Ausbildung ergibt. Nur unter diesen Voraussetzungen kann ein Mensch in der Wirtschaft produktiv ar-beiten. Der Begriff macht aus Menschen eine rein ökonomisch interessante Größe. Lösung: (1) Dönermorde. (2) Wutbürger. (3) Kern-kraftwerk. (4) Nacktscanner. (5) Dunkel-deutschland. (6) Humankapital.
Foto: Sebastian Wenzel Karte: Lencer and NordNordWest/CC BY-SA 3.0
Foto: Ruben Neugebauer

22 debatare.de
Angebote & Rechnungen mit wenigen Klicks erstellen!
www.scopevisio.com
Online-Bürosoftware für Freiberufler!
Scopevisio,weil ich dann mehr
Zeit für die wichtigen
Dinge habe!
Jetzt kostenlos testen!
Wie lautet Ihre persönliche Schlagzeile des Tages?
Kurt Feisel, Pensionär, 74 Jahre: „Manchmal Chaotisch, aber sehr gut – und interessant“ Ich denke, das würde mich als Schlagzeile ganz gut beschreiben.
Deniz Yücell , Journalist, 36: „Lind-ner oder Tod!“ Das war eine Schlag-zeile, die ich heute für die TAZ gemacht habe. Es geht um den Über-lebenswahlkampf der FDP in NRW.
Nergis Ceylan, TAZ-Praktikantin, 30: „Türkisch-deutsche Massen-hochzeit – eine kleine Party wird zur stadtübergreifenden Feier!“ Das wäre bestimmt ein gutes Fest.
Ruth Hankemayer, Studentin, 25: „Überfordert vom LiMA-Programm“ Es sind so viele Veranstaltungen alle gleichzeitig, das hat mich beim Früh-stück ziemlich beschäftigt.
Burkhard Lüdtke, Dozent, 63: „Tris-te Wiederholung. “ Heute ist noch nicht viel passiert. Ich habe kaum was gelesen, aber mein Tag beginnt ja auch erst.
Konstanze Bade, Studentin, 27: „Guten Morgen!“ – Ich bin gerade erst aufgestanden, insofern eine pas-sende und aussagekräftige Schlagzei-le für diesen Tag. .
Meike Eckstein, Studentin, 26: „Ne-benjob, ja oder nein?“ Ich hatte gera-de ein Vorstellungsgespräch hier bei dem Asta und hoffe wirklich, dass es geklappt hat.
Christian Specht, Arbeitssuchen-der, 43: „Dagmar Reim darf nicht RBB-Intendantin bleiben!“ Sie hat den Radiosender Multikulti abge-schafft.
- Anzeige -
Fotos: Jonas Fischer, Patrick Stößer

23debatare.de
Vor über fünfzig Jahren
schlossen Deutschland und die
Türkei ein Abkommen über die Anwer-
bung von Gastarbeitern. Über eine halbe
Million Menschen verließen ihre Heimat. Richtig
angekommen sind sie in Deutschland bis heute
nicht – zumindest aus rechtlicher Sicht.
Von Urs Eplinius.Noch immer existieren rechtli-che Diskriminierungen”, fasst die Rechtswissenschaftlerin
und die Türkei Referentin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht Duygu Da-mar den Stand der Dinge zusammen. Handlungsbedarf sieht in diesem Zu-sammenhang auch Holger Hoffmann, Professor für Staatsrecht und Dekan des Fachbereichs Sozialwesen an der Fach-hochschule Bielefeld. Er nennt Benach-teiligungen insbesondere beim erstmali-gen Zugang nach Deutschland in Hinblick auf den Ehegattennachzug und bei der Erteilung von Visa als Beispiele für die Diskriminierung türkischer Staatsbürger. So müssen seit 1980 türkische Staatsange-hörige vor der Reise in die Bundesrepublik im Vorfeld ein Visum beantragen – selbst, wenn sie nur als Familienmitglieder Ver-wandtschaftsbesuche abstatten.
Dabei hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2009 entschieden, dass auch für sie die europarechtliche Dienstleistungsfreiheit gilt und sie daher kein Visum benötigen, so Hoffmann. „Das Urteil besagt, dass infolge eines Zusatzprotokolls zum Assoziierungs-abkommen zwischen der EU und der Türkei keine strengeren Visumsregelungen gelten dürfen als zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Protokolls, also am 1. Januar 1973.” Die all-gemeine Visumspflicht für türkische Staatsan-gehörige sei in Deutschland jedoch erst 1980 eingeführt worden. Obwohl der Gerichtshof klarstelle, dass diese Verschärfung der Visums-bestimmungen mit dem Zusatzprotokoll des Assoziierungsabkommens von 1973 unverein-bar war und die alten Regelungen weiter gelten, halte die Bundesregierung daran fest. “Sie ver-tritt bisher die Auffassung, die EuGH-Entschei-dung sei ein Einzelfall und gelte ausschließlich beschränkt für Lastkraftfahrer, also nur für Per-sonen, die Dienste erbringen. Touristen hingegen würden welche in Anspruch nehmen und benö-tigten deswegen auch weiterhin ein Visum.” Bei dieser Praxis liege das Problem weniger bei einer rechtlichen Diskriminierung – die beantragten Visa seien letztlich zumeist erteilt worden. “Es geht mehr darum, dass die Möglichkeiten zur Be-antragung in den deutschen Konsulaten und der Botschaft in der Türkei als unwürdig empfunden wurden”, so Hoffmann. Auch die lange Vorlauf-zeit nach Antragstellung und der Umstand, für
Türken werden nochimmer diskriminiert
Besuchsvisa mehrere Hundert Euro in Deutsch-land als Sicherheit für die Rückkehr hinterlegen zu müssen, verspürten viele als erhebliche Belastung. “Denn viele Familien mit Migrationshintergrund verfügen nicht über diese Mittel.”
Für nicht minder problematisch hält der Rechtsexperte die Regelungen zum Ehegattennachzug. Zwar ist diese Form der Familienzusammen-führung rechtlich in Artikel 6 des Grundgesetzes verbrieft, allerdings ist es für türkische Staatsangehörige viel schwieriger, ihre Ehepartner nach Deutschland zu holen als für Angehörige anderer Nationalitä-ten, die als sogenannte Positivstaater ohne Visum nach Deutschland einreisen dürfen. Dabei handelt es sich um EU-Bürger und solche aus den Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes, wozu neben der Schweiz, Israel, Japan, Kanada, Süd-Korea, Neuseeland, die USA auch Andorra, Honduras, Monaco und San Marino gehören. “Der nachziehende Ehegatte muss dabei nicht dieselbe Staatsangehörig-keit wie der Stammberechtigte besitzen”, so Hoffman. Dies bedeu-te, die türkische Ehefrau eines schweizerischen, kanadischen oder US-amerikanischen Staatsangehörigen darf nach Deutschland einreisen, ohne Deutschkenntnisse nachweisen zu müssen.
Dagegen die türkische Gattin eines türkischen oder deutschen Staatsangehörigen nicht. Begründet werde dies mit der „tra-ditionell engen wirtschaftlichen Verflechtung” der „Positiv“-Staaten mit Deutschland. Diese Begründung streift nach sei-ner Auffassung die “Grenze der Lächerlichkeit” angesichts des tatsächlichen Handels zwischen der Türkei und Deutschland. “Offenbar ging der Gesetzgeber bei Erlass dieser Regelung davon aus, dass in Beziehung zur Türkei eine nicht in der-selben Weise ‘traditionell enge wirtschaftliche Verflechtung mit Deutschland’ besteht, wie zum Beispiel mit Andorra oder Honduras.”
Durch diese Regelungen würden türkische und deutsche Staatsangehörige in gleicher Weise gegenüber Unionsbür-gern und anderen „Positivstaatern“ diskriminiert. Kritik blieb bislang ungehört. Als das Bundesverwaltungsgericht in einer Entscheidung im März 2010 die Regelungen als vereinbar mit dem Grundgesetz, der Familienzusammen-führungsrichtlinie und dem Assoziationsrecht bestätigte, habe dies nicht nur zu Verwunderung und Unmut in der türkischen Gemeinschaft und bei deutschen Ausländer-rechtlern geführt, so der Bielefelder Experte. Auch die EU-Kommission habe sich der Sache zum wiederholten Mal angenommen und in einer schriftlichen Erklärung im Mai dieses Jahres deutlich gemacht, dass Integra-tionsanforderungen und Sprachtests nicht als Aus-schlusskriterien oder Einreisebedingungen fungie-ren oder dem Ziel einer Familienzusammenführung entgegenstehen dürften. “Leider hat allerdings die Bundesregierung in Beantwortung einer Anfrage der Linken am 20. September 2011 erneut verdeutlicht, dass sie an ihrer bisherigen Rechtsauffassung weiter festhalte”, so Hoffmann.

24 debatare.de
Mitlesen, mitschreiben, mitmachen. www.debatare.de