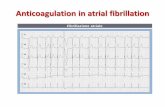DELIRIUM N°03
-
Upload
olivier-montebelli -
Category
Documents
-
view
221 -
download
3
description
Transcript of DELIRIUM N°03

Herbst 2014N°03
1

2

3
Doch bestimmten Wendungen wird grosses Vertrauen entgegengebracht. Ähnlich wie der Patellarsehnenreflex Freude macht; nach dem Stolpern und nach dem rettenden Einsatz der Nerven wird zurückgeblickt und gedacht: «Ja, das war jetzt wohl ein Glück, dass da nichts passiert ist.» Zu verstehen, was sich dort in den Muskeln, Sehnen und Nerven durch den ganzen Körper und wieder zurück gezogen hat, ist nicht vielen von ihnen gegeben. Manchmal wird mehr gewusst, manchmal weniger. Wie seltsam muss es demjenigen Körper vorkommen, der von sich gerettet wird, ohne zu merken, was passiert ist.
Alleweil bieten uns dann so manche Wendungen Zuflucht, wenn im Gespräch die Luft knapp wird. So konnte ich es schon erleben, wie ein adretter Herr, der sich eben noch voller Lust ins Gespräch vertiefte, nun ganz abwesend darin, das Zuhören vergisst. Auf die erwartungsvolle Miene des seinen Ärger über einen Streit mit einer abwesenden Drittperson kundtuenden Mädchens, das von ihm die gebührende Zustimmung fordert, gibt er zur Antwort: «Ja, das Leben ist schon schwer.» Damit hat er zumindest die Haltung gewahrt – und vielleicht auch das Interesse, sodass ihm durchaus ein Stein vom Herzen fallen könnte. In der Form ist solch ein Satz zwar vergleichbar mit der Fasson einer Hose aus dem Sortiment eines grossen schwedischen Kleidungsproduzenten, aber jemand von gutem Geschmack offenbart sich ungeachtet des Ursprungs seiner Hose.
So manch ein Literaturwissenschaftler (und manch anderer Leser) spricht in ganz lyrischer Schwärmerei davon, wie dieser oder jener Schriftsteller die Sprache doch völlig neu erfunden habe, aber bei genauem Bedenken wird diese Aufgabe wohl keinem auch noch so verhassten Geschöpf gewünscht werden. Überhaupt ist es fraglich, wieso man Sprache neu erfinden sollte, wenn man doch so manche kleine und feine Wendung zur freien Verfügung hat, die ein ums andere Mal wiedergekäut werden kann. Insofern wünsche ich den Leserinnen und Lesern ein grosses Vergnügen und viel Freude beim Blättern in diesem Magazin und mögen sie sich bloss nicht zu sehr auf Neues freuen.
SAMUEL PRENNER
Edit
ori
al
Editorial

4
Mit freundlicher Unterstützung Universität Zürich
Seminar für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (AVL)

5
Inhalt
38Doppelt verklärte
LiteraturDALIBOR SUCHANEK UND
DOLORES ZOE
40Vor dem Laden ist
ein SchildMICHELLE STEINBECK
45
41In and out
MANUEL MÜLLER
42Die BesserwisserALBRECHT FÜLLER UND
FABIAN SCHWITTER
35Genealogien
MERET BACHMANN
36Jede Odyssee führt
in den WaldCONRADIN ZELLWEGER
19Der Kannibale
JÁNOS MOSER
24Der halb richtige
SchlussSAMUEL PRENNER
27, 28kapri,
weltendrehenMICHELLE STEINBECK
30Simulation eines
KommentarsDEMIAN BERGER
5Notizen zur
Zweifelhaftigkeit des literarischen Programms
DOMINIK HOLZER
8Das Herz der
Finsternisoder
Dann gute Nacht, Schubertherz!
MAREIKE HAASE
16Dazuge-hörig
ORLANDO SCHNEIDER
13Hörig
TATIANA HIRSCHI
LITER AT U R | K R ITIK
R EIN R EDEN
V ER A NSTA LT UNGEN
Inh
alts
verz
eich
nis
5

6
…und er hörte
sein Jungsein auf der
Strasse rumplatschen
und hörte den Schnee
auf dem Holunder
und es langweilte ihn
schon, dieses sein
Jungsein, er wusste
haargenau, dass
es dasselbe war, wie
jedes andere…

Lite
ratu
r
7
Notizen zur Zweifelhaftigkeit des literarischen Programms
Odysseusbitches, willkommen im Delirium, Mütter bleicher VerlockungenJason träumt, und hängt mit seinen immergleichen Abschiedsgedichten an meinen falschen TittenWillkommen im Delirium, Betonengel, Willkommen in der Hölle, ihr Sebaldwixer, betrunken selbstgesetzgebende, zeilenstrolchende Mönche mit grenzenlos unvollendeten SchuberterektionenFickt die Nacht nur, bis sie blutet, Schubert singt euch ins ForellendaseinJa, entrückte, liebevolle Tagebuch- und BriefeschreiberJa doch, nehmt sie, bis sie blutet, Schwanzzerreiter, ihr Tänzer auf den griechischen Amphoren,Reitet weiter, reitet Schwänze, bis ihr schwarz seidDas singt mein weisses, haariges Ithakaherz mit the voice of a black womanOh Jason, tanze mir, vom drögen Oszillieren zwischen Form und Stoff,Ja, Jason, träume mir, von Langeweile, Dichtkunst und vom schwankend hohen MasteDeines LyrikbootesWillkommen Leser, deine Seele gehört schon lange mirUnd höreWas sie mir ins rote Öhrchen singt:Beinahe, beinahe, beinaheWillkommen im Delirium, ihr Möchtegerne, Kritiker und Streber,Schreiberlinge und ihr anderenEuch gehör ich allen zuEsst mein Herz aus, Wixt euch eins auf Sebald und dann gute NachtDie Luft riecht auch bei euchNach Holunder und nach Facebook.
Gefragt sind künstlerische Antworten auf die bereits angeregten Diskussionen in denAusgaben N°01 und N°02.
So gewinnst du:
Hannes satteltGötterverlassne Männer Frauen nicht?
Willkommen im Delirium, ihr Medealecker!Esst mein SchubertherzUnd dann gute NachtWillkommen Freunde des Guten und SchönenWillkommen, oh ÄnäispenetrantenWillkommen im Delirium, oh HipsteranuspenetrantenVollendet ihr mein SchubertherzSonst vollendet es mein dummes JünglingsherzUnd stürzt mich wieder in den alten Dichterschmerz.

Literatur
8
Er ging die Strasse lang und hörte nichts und dachte: Das ist es also jetzt, das ist dieses Jungsein, das mich bald nicht mehr hat, das ist es jetzt, dieses ungesunde Jungsein, das ist nun also dieses vergängliche Jungsein, von dem die Dichter sprechen, wenn sie alt sind, und er ging weiter auf dieser Strasse und dachte nichts und hörte eine Nachricht, schaute nach, sein Vater, der Musikwissenschaftler war, hatte ihm eine SMS geschrieben: Hallo, du, wie geht es dir, lass mal von dir hören, und er hörte sein Jungsein auf der Strasse rumplatschen und hörte den Schnee auf dem Holunder und es langweilte ihn schon, dieses sein Jungsein, er wusste haargenau, dass es dasselbe war, wie jedes andere, und er sagte seinem Jungsein: Ja, ich höre die Flocken fallen, aber ich denke nicht, dass es das Echo der Glocken im Tal ist, es ist ja alles so scheissprofan, und eine fette Flocke fiel ihm ins Aug, genau als er das dachte, und er fluchte und es war kalt und er wusste, dass das Schneien das Seufzen der Wolken ist, who cares, dann rief er seinen guten Freund John an, der nicht mehr wirklich jung war, mit dem er also auch kein Jungsein teilen musste, und sie gingen in eine Bar und betranken sich gottlos und als er zu einem Lied zu tanzen anfing, in dem ein weisser, überaus vulgärer, vollkommen ideenloser Rapper sagte: Fickt die Nacht nur, bis sie blutet, da merkte er, dass er jetzt wirklich heimgehen musste, und er ging dann auch wirklich, und es war ihm alles egal ausser die SMS von seinem Vater, der Musik- wissenschaftler war, er sass auf dem Klo und wusste nicht, was zurückschreiben, und schlief ein und als er aufwachte, kam ihm das Lied wieder in den Sinn, und war immer noch auf dem Klo und dann schrieb er vollkommen betrunken, was ihm in etwa noch geblieben war vom Lied: Lieber Papa, wer vollendet dir dein Schubertherz? Ja, was einem alles so in einer Schneenacht halt begegnet, nicht, dann gute Nacht. Ich vermisse dich, dein Jason.
DOMINIK HOLZER

9

Kritik
10
Das Herz der Finsternis
oder Dann gute Nacht,
Schubertherz!Der titelgebende Verweis auf Sebastien Fanzuns
gleichnamigen Essay aus delirium N°02 fordert nahezu obligatorisch die Prüfung von Dominik Holzers Text auf die Richtung des zugrunde liegenden Programms ein: Zeigt sich hier der Wille zur Gestalt? Und wie gross ist die Übereinstimmung zwischen Form und Bedeu-tung? Der Text gliedert sich in zwei Teile, wobei erst der zweite Teil – analog der Aufgabe, die eine Kritik zu erfüllen hat – die Einordnung des ersten Teils er-möglicht. Dadurch wird die unauflösliche Verquickung zwischen Form und Inhalt erkennbar, gleichzeitig die Unkontrollierbarkeit von Bedeutungen vor Augen geführt und deren Herr-werdung via Formgebung versucht.
Erster TextDass ein Gedicht immer auch Verdichtung impli-
ziert, zeigt der erste Text überdeutlich, quasi nicht nur mit dem Zaunpfahl, sondern mit einem ganzen Latten-zaun winkend. Der Form nach als Gedicht in Erschei-nung tretend, verweist dieser Text explizit auf seine Dichte, indem er (fast) alle Texte der zweiten Ausgabe von delirium nennt und damit auf engstem Raum komprimiert.
Willkommen!Das erste Wort des ersten Verses zieht uns schon
mitten hinein in die griechische Sagenwelt («Odysseus- bitches») und in den folgenden Rausch bzw. Kon-text des Gedichts («Delirium»). Sofort hören wir von Jason und reihum erfolgt die Begrüssung einer bun-ten Publikumsvielfalt, eingeladen zum Spektakel, das sich aus der Zusammensetzung verschiedener Figuren und Zitate vergangener delirium-Texte zu ergeben ver-spricht: «Mütter bleicher Verlockungen», «Betonengel», «Sebaldwixer», «zeilenstrolchende Mönche», «Tagebuch- und Briefeschreiber» u.v.m.
Der Leser ohne Vorkenntnis der intertextuellen Anspielungen auf vergangene delirium-Texte kratzt
sich seinen Weg über eine spiegelnde Oberfläche aus Namen und sexuell-expliziten Beleidigungen. Diese Beleidigungen gelten nicht nur dem Leser, da er durch das «Willkommen Leser» zum Teil der Oberfläche ge-macht wird, sondern umfasst zugleich alle «Möchte-gerne, Kritiker und Streber, / Schreiberlinge und ihr anderen».
Die gehäuften Willkommensgrüsse lassen das Bild einer Manege entstehen, in der, begleitet von eupho-rischen Fanfaren und bunten Lichtern, der Zirkus- direktor den Beginn der Vorführung ankündigt, sodass sich die Erwartung eines bunten und vielfältigen Nach-, Neben- und Durcheinanders an Attraktionen herausbildet. Das wiederholte «Willkommen»-geheis-sen-Werden wirkt dabei wie der Gesang der Sirenen, denen Odysseus auf seiner Reise begegnet und die zwar schöne Lieder singen (Form), deren eigentliche Absicht (Inhalt) jedoch eine tödliche ist.
Ein Bilderregen prasselt nieder. Wir lesen vom lyrischen Ich, das dazu auffordert, sein Herz auszu- essen, dem die Seele des Lesers schon lange gehört und das in Anklang eines Zeugmas allen ‹Möchte-gernen, Kritikern und Strebern, Schreiberlingen und anderen› in einer dadurch erzeugten Gleichzeitigkeit «zu(ge)hört». Durch das Hören im Akt des Lesens ent-steht ein Ge-hören, ein Sich-zu-eigen-Machen. Das Sich-zu-eigen-Machen impliziert auch ein Sich-Ein- verleiben, also ein «Ausessen», zu dem der Leser aufge-fordert wird. Ähnlich wie Jason, der auf seinem Lyrik-boot wie Odysseus übers Meer treibt (oder getrieben wird), können auch wir nicht anders, als schwankend durch die Verse zu schweifen und dabei dem Gesang des lyrischen Ichs zu lauschen, das bereits im Besitz unserer Seele ist.
Doch dann folgt eine jähe Zäsur, die den Leser aus dem Bilderfluss und dem Textinneren heraus- und hinaufreisst auf eine Meta-Ebene. Dies geschieht durch das Zitat der Aufforderung zur Produktion von «künstlerische[n] Antworten auf die / bereits ange- regten Diskussionen in den / Ausgaben N°01 und N°02» von delirium. Darauf folgt der Verweis auf das Wie des Gewinnens, durch den der Leser flugs am Fuss gepackt und zurück zum lyrischen Ich gezerrt wird, das sich an der zurechtgebogenen Homonymie einer der Auto-rennamen probiert und aus Hannes Sättele ein «Han-nes sattelt» macht. Diese Zäsur wirkt wie eine Erklä-rung oder gar Rechtfertigung für den vorgängigen Gedichtabschnitt – wie eine grosse Fussnote, die je-doch bewirkt, dass das Leseerlebnis unterbrochen wird, der Bilderfluss ins Stocken gerät und das Gedicht den

Kri
tik
11
künstlichen Beigeschmack einer Auftragsarbeit erhält. Als könnte es nicht aus sich selbst heraus bestehen und wäre ohne diesen Einschub unverständlich. Aus Angst vor einer möglicherweise zuschreibbaren Schwäche oder Unfähigkeit für sich selbst zu stehen? Oder ver-steht sich das Zitieren dieser Aufforderung als Teil des Gedichts, so als sei alles, was delirium umfasst, zugleich schon künstlerischer Ausdruck?
In noch grösserer Dichte erfolgt im Anschluss da- ran ein vierfacher Willkommensgruss des lyrischen Ichs an «Medealecker», «Freunde des Guten und Schönen», «Änäispenetranten» und «Hipsteranuspenetranten». Nach so vielen Willkommenheissungen warten wir gespannt auf den Beginn der Vorstellung. So wirkt das Gedicht im Ganzen wie ein Prolog – verharrt je-doch in diesem Stadium. Es wird erneut zum Verzehr des Herzens, jedoch nun spezifisch des ‹Schubert- herzens›, aufgefordert, um es zu vollenden. Und erst in den letzten drei Versen erscheint ein Paarreim, der Form und Stoff nun als Quintessenz des Mäanderns zwischen ebendiesen miteinander eindeutig zu einem ‹tatsächlichen› Gedicht verbindet, wobei diese Ver- bindung ins Kitschige abgleitet und damit das Gedicht als solches karikiert, indem «Jünglingsherz» und «Dichterschmerz» zusammenfinden.
O(h)rientierungslosNachdem die Nacht gefickt wurde, wird sie im
Verlauf des Gedichts zwei Mal gut gewünscht. Und die «grenzenlos unvollendeten Schuberterektionen» schliessen zum «Schubertherz» und dessen Vollendung auf. Nebst dem Delirium und Jason stellen die Nacht und Schubert die zentralen und wiederkehrenden Motive des Gedichts dar, zwischen denen Wort- und Textbausteinnetze in losem Zusammenhang aufge-spannt werden. Wir fühlen uns wie die Fliege im Spin-nennetz – hängen vielleicht auch am seidenen Ariadne- faden – und delirieren tatsächlich, insofern als dass uns beim Lesen schwindlig geworden ist, da wir kom-plett die Orientierung verloren haben. Und so findet sich die Odyssee, auf die im Gedicht gleich zu Beginn verwiesen wird, gespiegelt in der Leseerfahrung: Wir wissen nicht mehr, wo wir sind, und auch nicht, wo es hingehen soll.
Zweiter Text Gehörlos
Wir gehen eine Seite weiter und landen mit-ten in einem Prosatext. Nun ist von einem «Er» die Rede, der über sein Jungsein reflektiert. In einer Art
Bewusstseins-Strom in Form eines einzigen, unend-lich langen Satzes (so unendlich wie Schuberts Unvoll- endete und letztlich ironischerweise mit dem unvoll- endeten Schubertherz und dem danach folgenden Fragezeichen erst zu einem Ende gelangend) wird die Tonalität der Kurzgeschichte Auerbach von Sebastien Fanzun aus delirium N°02 nachahmend umkreist. Die-ser «Er», der sich schliesslich als Jason herausstellt, geht eine Strasse entlang und hört nichts, bis er durch die SMS seines Vaters aus seinen Gedanken herausge-rissen wird. In der Folge gruppieren sich alle seiner weiteren Sinneswahrnehmungen ausschliesslich um das Hören herum, was an das Gedicht von Elsbeth Zweifel aus delirium N°02 und ihre darin wiederholte Aufforderung «und höre» erinnert:
«[…] und er hörte sein Jungsein auf der Strasse rumplatschen und hörte den Schnee auf dem Holunder
und es langweilte ihn schon, dieses sein Jungsein, er wusste haargenau, dass es dasselbe war, wie jedes
andere […]»
Nun hört Jason also das Jungsein auf der Strasse, die fallenden Flocken, das Seufzen der Wolken und das Lied des ideenlosen Rappers. Und wieder erfolgen intertextuelle Anspielungen auf vergangene delirium-Texte.
Im Text selbst ist die Kritik als Akt implizit enthalten, indem das vorgängige Gedicht kontextualisiert wird als von einem weissen, vulgären und ideenlosen Rapper stammend. So erfährt es eine Einordnung – wie sie auch eine Kritik leistet – und nimmt den Leser an die Hand. Seine vormalige Orientierungslosigkeit wird be-endet, weil Form und Inhalt des Gedichts nun wie ein zusammengehöriges Ganzes wirken.
Teile des Gedichts finden ihr Echo in der Erzählung wieder: Das Delirium stellt sich hier als Betrunkensein dar. Die ‹götterverlassnen Männer› finden sich im ‹gott-losen› Besäufnis von Jason und John. Auch die Odyssee spiegelt sich im Herumirren Jasons auf der Strasse und der Einsicht in die Notwendigkeit zur Heimkehr, die indirekt durch das SMS-Schreiben an den Vater bzw. überhaupt den Gedanken an ihn und die Hin-wendung zu ihm stattfindet. Auch die Aufforderung zu «künstlerische[n] Antworten» könnte aus der SMS des Vaters, der darum bittet, ‹etwas von sich hören zu lassen›, gelesen werden, und die künstlerische Antwort darauf aus der SMS, die Jason schreibt und die – genau wie das Gedicht – mit dem Schubertherz und dem Gute-Nacht-Wünschen schliesst.

Kritik
12
Zum Ende der Erzählung hin sucht Jason auch den buchstäblichen Ort des Abschlusses und Beendens des Verdauungsvorgangs auf – das WC (schliesslich wurde ja im Gedicht zuvor ein Herz ausgegessen, das irgend-wann ausgeschieden werden muss). Somit findet auch das ‹Ausdrücken› in Form der Hervorbringung von literarischen Produktionen, das im Essay Verbuggte Literatur von Cédric Weidmann aus delirium N°02 durch die Metapher des Sitzens auf der Kloschüssel darge-stellt wird, ein Echo. Jason schläft jedoch auf dem WC sitzend ein – ‹produziert› vermutlich somit nichts in dieser körperlichen Hinsicht eigenes – und wacht auf, um sich an Teile des Rap-Lieds zu erinnern – re-produ-ziert somit nur bereits Gewesenes. Eine Verdoppelung desjenigen Produktionsvorgangs, der massgebend und grundlegend für das Entstehen der Texte war.
Un/vollendungDas Verfehlen des Austauschs zwischen Vater und
Sohn knüpft an die Homonymie in «unerhört» an – Literatur entsteht aus dem Erzählen einer unerhörten Begebenheit. Dominik Holzers Geschichte erzählt je-doch von einem Nicht-Wahrnehmen zwischen Vater und Sohn und damit einem «Un-erhörten» im Sinne des akustischen Unvermögens. Im Zustand der Trunken- heit – also im Delirium, verortet somit zugleich im Alkoholrausch wie im Magazin – lässt Jason von sich hören, reproduziert aber nur Textfetzen, die aufgrund der Form der SMS in einem beschränkten Erklärungs-spielraum wie trunkenes, freies Assoziieren wirken. Das Von-sich-hören-Lassen erfolgt somit nur in der Form (SMS) und der Tätigkeit (sich melden via SMS), jedoch ohne tatsächlichen Inhalt (Stoff).
Zwischen Form und InhaltWie Dolores Zoe in der zweiten Ausgabe in ihrer
Replik auf delirium N°01 schreibt, sei «Oszillieren zwischen Form und Stoff» für den Kritiker nur der erste von zwei Schritten, dem das Gewahr-Werden der eigenen Kritikerhände beim «Nachtasten der dichterischen Gestaltungskraft» folgen sollte, um sich dabei der «Selbstbestimmung der Dichterin oder des Dichters» bewusst zu werden. Diese Selbstbestimmung in Form einer Selbstgesetzgebung kann natürlich nur einge-schränkt oder beschnitten erfolgen, insofern als dass die vorliegende literarische Produktion die Form der ‹künstlerischen Antwort› auf vergangene Diskussionen haben soll. Innerhalb dieser lotet Dominik Holzer die
Grenzen jedoch horizontal und vertikal und aus der Nähe (Kritik) und Ferne (Leser) vielgestaltig und viel-gestaltend aus. Ein wenig erschlagen ob der Fülle der Bezüge und der Unterschiedlichkeit, in der sie herge-stellt werden, bleibt die Kritikerin zurück. Mit tausend Bildern bzw. angerissen Szenen im Kopf, dabei aber – ein wenig wie Jason seinen Vater – den einen einzigen, dafür vertieften Bezug vermissend, da der Erzähltep-pich in seiner Dichte (Dicht-ung) zwar Halt bietet, dies jedoch auf Kosten grosser Maschen tut. Durch diese würde man dann doch gern ins Offene und in die für das Zu-eigen-Machen oder Sich-zugehörig-Machen not-wendigen, interpretationsweiträumigen Leerstellen fallen.
Die Aufteilung des Texts auf zwei Seiten trägt ent-scheidend zu seiner Wirkung bei. Jeder Textteil für sich allein stehend könnte nicht halb so viel Spannung er-zeugen, wie sie der wechselseitige Bezug erst herzu- stellen vermag. Auch dies ist als Metapher lesbar für die Spannung zwischen Text und Kritik – und die Kraft des Dritten, das im Dazwischen entsteht. Das eine fliesst hemmungslos, das andere lenkt in geordnete Bahnen. Das eine wühlt auf, wenn kontextunwissend konsumiert, während das andere auffängt, verständlich und verstehbar macht und dem Leser ermöglicht, (einen) Sinn zu erschliessen – wenngleich dieser immer auch in der Färbung derjenigen Brille erscheint, die der Kritiker beim Blick auf den Text getragen hat.
Künstlerische Antwort?Die ausführlichsten ‹künstlerischen Antworten›
erhalten die Kurzgeschichte Auerbach von Sebastien Fanzun und das Gedicht Jason träumt von Andreas Fischer. Beide werden gleichsam der aristotelischen Aussage entsprechend «Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile» miteinander zu einem neuen, gemeinsamen Dritten verbunden. Dies in Form einer Vater (Musikwissenschaftler, Schubert-Bezug) und Sohn (Jason) Beziehung, womit der Bezug zu ver- gangenen Texten auf der inhaltlichen (in der Geschichte als Vater und Sohn) und auf der Form-Ebene (Gedicht: Jason – Prosa: Auerbach-Text-Form) herzustellen ver-sucht wurde.
Die künstlerische Antwort auf Diskussionen aus den vorangegangenen delirium-Ausgaben beschränkt sich im Gedicht – liest man es als für sich und allein stehend – auf die blosse Nennung und Aneinander- reihung von Texttiteln und Wortfolgen bzw. Satzteilen bereits erschienener Texte. Anstatt vertieft inhaltlich

Kri
tik
13
den Faden vergangener Texte aufzunehmen, um z.B. Geschichten fortzusetzen, ergötzt sich der Autor wie-derholt an Homonymien: die Dichte in der Dichtung des Gedichts, das Delirium als Rausch des Ichs und Medium des Autors, die Unvollendetheit des Herzens und der Sinfonie Schuberts.
Zusammenspiel von Form und BedeutungDie Frage danach, wie Form und Bedeutung in
Anlehnung an Fanzuns Essay Zur Zweifelhaftigkeit des literarischen Programms tatsächlich zusammenspielen, lässt sich mit einer Formulierung aus ebenjenem Es-say beantworten. Das darin entworfene Bild entspricht jenem, das beim Lesen des Texts entstand:
«[Die Literatur] ergreift ihren Gegenstand und stürzt sich, ihren Gegenstand stets eng umschlungen
haltend, zusammen mit ihm in den reissenden Strom der Bedeutungen.»
Tatsächlich entfaltet sich eine Assoziationskette im Gedicht, dessen Bedeutung sich wandelt durch die Erklärung in der anschliessenden Erzählung: Nimmt der Leser das Gedicht als in sich geschlossen an (zunächst ohne Kenntnis der anschliessenden Auf- klärung), erscheinen «Odysseusbitches», «Schwanz-zerreiter» und «Medealecker» als reine Provokation, ja vielleicht sogar Verstörung, die aufgehoben wird durch die Kontextualisierung als Rap-Text.
Das unvollendete HerzDass die Frage danach, wer dem Vater das Schubert-
herz vollenden wird, unbeantwortet den Schlusspunkt gemeinsam mit der darin angedeuteten unerhörten Be-ziehung zwischen Vater und Sohn in der verzögerten und aneinander vorbeiführenden SMS-Kommunikation bildet, erscheint fast wie eine Aufforderung zum fort-gesetzten «Delirieren» im delirium. Scheherazade gleich sollte auch das Erzählen, Kritisieren und Diskutieren im delirium nie zu einem Ende gelangen, da sich Texte und Kritiken in konstanter und wiederholter Wechsel- und Rückbezüglichkeit erst zu jenem Neuen und Dritten entwickeln können, das den programmatischen An-spruch von delirium erfüllt, einen inspirierenden und inspirierten Ort für konstanten Austausch und Dialog in der literarischen Szene Zürichs darzustellen.
MAREIKE HAASE

14
…Und schenk Gehör ich dir…

Lite
ratu
r
15
HörigBesingen könnt ich dich bis ans Endedes Tages. Doch was da erklingt, es bleibtVages.
Wahrhaftig – doch blickst du dir nie ins Gesicht. Wirst du auch nie –doch hörbar werden, vielleicht.
Meermündig, unhörbarElliptische EcholalieRabenschwarz beinah das HaarEinmal mehr erinnernd, Todesfern.
Spiel mir die Duftnoten – bring sie zu Gesicht Zeichne die Topographie deines Körpers,Ortlos, formvoll. Eine stumme Sprache sprechend
Bis das Lied erkaltet in den NiederungenWo wir liegen, umschlungenein um das andre MalWo es sinnend singend versinkt.
wese an wese aus, wag es, vages
Spiel mir die Hohepriesterin und das Radam Wagen.

Literatur
16
Meine Ruhe ist die Ruhe einer vibrierenden SaiteDreh dich doch mal auf die andere SeiteDein Rücken ist immer hinter dir, unentrückt.
Mein Körper erinnert sich an dichDie eine stumme Sprache spricht Die immer wiederLaut wird.
Und schenk Gehör ich dirso kann ich sein Da ist das Wort nicht meinund das ist es nirgendsund da bin ichOrtlos.
So kann ich sein da ich hörenicht gehöre, mir nichts gehörtund find dich so hörendganz betörendUnd werd ganz ungehörig hörig –
Meermündig, unerhörtEcho gen unverklungen – Rauschen – Zähmen wir noch unsere Zungen?Einmal mehr erklingtTodesfern
Die Note, von deinem Rippenbogen umspanntBleibt unbenannt.
TATIANA HIRSCHI

17

Kritik
18
Dazuge-hörig?Texte beziehen sich bekanntlich, bewusst oder unbe-
wusst, auf vorhergehende Texte, doch ein literarisches Erzeugnis soll stets auch für sich selbst stehen können. Wir kennen das: Die unentbehrliche Frage nach dem Weg, auf welchem der Versuch zu einem Verstehen von Literatur zustande kommen kann oder soll. Im Fall von delirium liegt es dem Kritiker nahe, sich als Methode von der textimmanenten Lektüre ab- und der Intertex-tualität zuzuwenden: Denn der Bezug zwischen den Ausgaben und der daraus entstehende Diskurs ist, wie wohl die meisten LeserInnen wissen werden, in diesem Magazin Programm. So ist Tatiana Hirschis Gedicht Hörig offensichtlich auf Elsbeth Zweifels und höre sowie auf die dazugehörige Kritik von Hannes Sättele aus delirium N°02 bezogen. Es scheint daher auch sinn-voll, dass sich diese Kritik an den Vorgängern des Gedichts orientieren wird.
Die InstanzenBei der ersten Lektüre von Hörig entsteht un-
weigerlich der Eindruck, es handle sich um eine Form von Liebesgedicht oder besser, um die Schilderung eines zärtlichen Verhältnisses zwischen einem Ich und einem Du. Doch nirgends wird so recht deutlich, wer oder was die Stelle dieser beiden bereits in der ersten Zeile exponierten Instanzen einnehmen soll. Mit einem Blick auf die dem Gedicht vorangehenden Texte will ich eine Möglichkeit der Besetzung dieser Personal-pronomen vorschlagen: In Ein überlebender Mythos von Hannes Sättele wird der Leser des Gedichts vom lyrischen Ich zum Hören aufgefordert und verliert sich immer stärker in der vom Gedicht hervorgerufenen Welt. Zu Beginn noch in einer einsamen Zweisamkeit mit dem lyrischen Ich, zieht sich dieses, gemeinsam mit der poetischen Bildhaftigkeit des Gedichts, bis zur vollständigen Abwesenheit zurück und überlässt den Leser in seinem neu erlangten Zustand sich selbst. Dieser Zustand ist der eines neuen Hörens, durch den ein «unvermittelter Bezug zu Dingen [...] auch jenseits der gedichteten Welt» hergestellt werden kann. Bei dem soeben hervorgehobenen Aspekt dieser Kritik knüpft Hirschi an: Das angesprochene Du ist das lyrische Ich aus Elsbeth Zweifels Gedicht, während das lyrische Ich von Hörig das und höre-lesende Subjekt verkörpert. Diese Behauptung soll so nicht im Raum stehen bleiben, sondern verlangt nach einer Legitimation
durch das Gedicht. Um sich nun nicht in ein verwir-rendes Netz von lyrischem Ich und Du der beiden Gedichte zu verstricken, werden sich diese Begrif-fe, wenn nicht anders erwähnt, fortan auf Hirschis Gedicht beziehen.
Wie soll man sich das lyrische Ich des Gedichts und höre vorstellen? Das einzig denkbare Resultat muss ein «Vages» bleiben und so wird durch das ganze Gedicht Hörig immer wieder von Neuem versucht, das lyrische Du zu «besingen» und irgendwie fassbarer zu machen. Deutlich ist diese Annäherung zum Beispiel in den Beschreibungen und Entwicklungen von Körper und Stimme zu beobachten und so wird der Fokus der Kritik vor allem auf diesen Aspekten liegen. Ferner sind Be-züge des lyrischen Ich zu den Vorgängertexten erkenn- bar und stützen den vergleichenden Ansatz dieser Kritik.
Entwicklung der KörperlichkeitBereits in der zweiten Strophe erscheint ein Ge-
sicht, das sich nie selbst sehen wird. Vielleicht weil es nicht sehen kann, da es sich um die Physiognomie des Gedichts selbst handelt. «Rabenschwarz beinah das Haar» könnte eine durch die Typografie angeregte Assoziation beschreiben, da die Schrift durch das sie umgebende Weiss nie ganz rabenschwarz erscheint und diese hier auf das Haar des lyrischen Du über- tragen wird. So entsteht aus der Materialität des Gedichts langsam eine Gestalt: «Todesfern» ist sie, weil sie eben im Entstehen begriffen ist. Das Du wird aufgefordert, «die Topographie [s]eines Körpers» zu zeichnen, der zwar nirgends verortet werden kann (wie in der zehnten Strophe auch das lyrische Ich), aber doch bereits Form angenommen hat. Darauf folgt in der fünften Strophe das umschlungene Liegen. Bis hier ist also zu beobachten, dass sich das lyrische Du langsam aus seinen Teilen zusammensetzt, bis die Um-armung und somit die Vereinigung der Körper ermög-licht wird. Kaum Gestalt angenommen, wird das lyri-sche Du zu einem Transformationsprozess aufgefordert, in welchem es «die Hohepriesterin / und das Rad / am Wagen» spielen soll. Nur zum Spiel werden zum letzten Mal «spirituelles Heil und gesellschaftliche Annehm-lichkeit», als die vermeintlichen Glücksversprecher in Sätteles Kritik, vorgetäuscht. Weiter interessant scheint mir, dass es in der neunten Strophe der Körper ist, der sich erinnert. Dies zeigt, dass die Erinnerung hier in der gegenständlichen Welt stattfindet und nicht in der gedichteten. Doch kann diese Welt durch das neu

Kri
tik
19
erlangte Hören «immer wieder Laut» und dadurch ver-gegenwärtigt werden. Ansonsten rückt die Körper-lichkeit in der zweiten Hälfte des Gedichts zugunsten der Klanglichkeit stärker in den Hintergrund, bis bei-des in der letzten Strophe noch einmal gegenüberge-stellt wird, was auch die Relevanz dieser zwei Aspekte deutlich macht.
Stimme und KlanglichkeitStimme und Klanglichkeit vollziehen in Hirschis
Gedicht eine etwas unscharfe bzw. «vage» Entwicklung. Zu Beginn spricht das lyrische Ich vom Besingen und Erklingen und bereitet den Leser dadurch gleichsam als Einleitung auf das Gedicht vor. Darauf wird die Möglichkeit aufgestellt, dass die Stimme des lyrischen Du «vielleicht» einmal hörbar wird, doch bleibt sie vor-erst «unhörbar», nämlich in Form einer «Elliptischen Echolalie»: Ein wortwörtliches Wiederholen von un-vollständigen Sätzen, wie man die zwei logopädischen Fachbegriffe verknüpfen könnte. Nachdem das Nach-sprechen – als Symptom einer Sprachstörung – unhör-bar blieb, erklingen in der vierten und fünften Strophe «Duftnoten» und ein «Lied». Gleichzeitig wird die «stumme Sprache» gesprochen, die wiederum die unhörbare Echolalie in Erinnerung ruft. Nachdem die Musik wieder verklungen ist, wird die Ruhe des lyrischen Ich in der achten Strophe als eine «vibrie- rende Saite» verbildlicht. Das Prinzip ist auch hier ein ähnliches: Eine Saite klingt und bewegt sich, wenn sie vibriert, wird an dieser Stelle im Gedicht aber als Ruhe dargestellt. Durch diese Ruhe und durch das Gehör-Schenken in der zehnten Strophe kann das lyrische Ich «sein», kann sogar «ortlos» sein. So beschreibt Hirschi das neue Hören, welches die Texte vor ihr bereits in anderer Form darstellten. Doch was will sie in der da-rauf folgenden Strophe mit der schon fast nervig über-triebenen Folge von «höre – gehöre – gehört – hörend
– betörend – ungehörig hörig» aussagen? Soll dies das «Zähmen der Zungen» sein, das nicht mehr gelingt? Jedenfalls «betört» die Strophe nicht durch Musikalität, sondern steht eher als Fremdkörper im Gedicht.
Die Vorgängertexte und das GedichtZwei sehr markante Bezüge zu den Vorgängertexten
möchte ich zum Schluss noch anführen, um die aufge-stellte These nochmals zu stützen. Deutlich ist die se-mantische Nähe von den «Niederungen» in der fünften Strophe zum «tal» aus und höre zu erkennen. In Ver- bindung mit der Umarmung verweist diese Strophe zu-dem auf eine Stelle in Sätteles Kritik, in welcher die
Stille der «uns gemeinsam vereinsamten Welt» evoziert wird. Auch die Stelle «Und schenk Gehör ich dir» der zehnten Strophe zeigt einen deutlichen Bezug zu der in Zweifels Gedicht mehrfach wiederholten Aufforderung an den Leser, er solle hören. Gerade in dieser Strophe kommt das Glück, welches dieses Hören auszulösen vermag, deutlich zum Vorschein: Das lyrische Ich ist nicht mehr vom Wort abhängig und scheint «ortlos» in einer ruhevollen Stimmung zu verweilen.
Intertextuelles SchreibenWir haben es hier mit einem sehr vielschichtigen
Gedicht zu tun. Diese Schichten konnten keineswegs vollständig berücksichtigt werden und vieles musste unerwähnt bleiben. Grundsätzlich konnte jedoch fest-gestellt werden, dass Hirschi sich nicht bloss in freier Assoziation von den Vorgängern inspirieren liess. Viel-mehr zeigt sich die ganze Entwicklung des Lesers, wie ihn Sättele beschreibt, in ihrem Gedicht mehr oder weniger chronologisch nachvollzogen und an gewis-sen Stellen ausgedehnt. Es scheint ganz, als hätte Sät-teles Gedichtauslegung – ob diese zutrifft oder nicht, ist belanglos – eine neue Tür aufgestossen, in welche Hirschi eingetreten ist. Ihr Gedicht ist also durch und durch ein intertextuelles und ihre Methode ist inter-textuelles Schreiben. So könnte man auch hier in Fa-bian Schwitters Worten sagen: «Damit ist die Aufgabe von delirium mehr als erfüllt». Und doch finde ich, ist an dieser Stelle die Frage angebracht, was mit der Auto- nomie des einzelnen Gedichts geschehen ist? Kann dieses ohne die vorausgehenden Texte bestehen? Zu prüfen wäre das durch eine erneute, unvoreingenom-mene Auslegung des Gedichts. Ich bin mir allerdings
– trotz des durchaus ergiebigen Verhältnisses zu den Intertexten – nicht sicher, ob Hörig sich von seinen Vor-gängern loslösen könnte. Für das auf Intertextualität basierende delirium indessen könnte dies produktive Fragen aufwerfen.
ORLANDO SCHNEIDER

20
…Leider war es da noch
nicht zu Ende…

Lite
ratu
r
21
Der KannibaleMan hätte nicht sagen können, dass seine Lesungen besonders aufregend waren,
bevor der Kannibale kam.Das heisst, vielleicht regte er sich ab und zu auf, weil er bei einer Textpassage husten
musste oder weil es beim Apéro Rotwein statt Weisswein gab oder weil die Oliven nicht gut schmeckten oder weil die Sitze unbequem waren, aber sonst war das alles für ihn schon längst Routine geworden. Er kam in den Raum, durchschritt nickend das Publikum, setzte sich an den Tisch – der in Zürich, Basel oder Bangkok ohnehin überall gleich aus-sah –, rückte das Mikrofon zurecht, nahm einen Schluck Wasser, räusperte sich, raschelte mit den Blättern und begann zu lesen. Manchmal sass er auch schon eine Stunde früher da und plauderte mit dem Mann, der die Lesung moderierte – meist ein älterer Literatur- kritiker mit Schnauz und Brille – um zu erfahren, welche langweiligen Fragen ihm gestellt werden würden. Er hatte sich schon einmal überlegt, einen Text über Literaturkritiker zu schreiben, war sich aber nicht sicher gewesen, ob das bei dem literaturkritischen Publikum so gut ankommen würde. Jedenfalls standen seine Empfindungen so ganz im Gegensatz zu denjenigen des Publikums, das bei jedem zweiten Wort aaachte und ooohte. Wie konnten die Leute so mitgerissen sein, obwohl sie denselben Text schon zigmal gehört hatten? Hätte er sich nicht so über diese Tatsache geärgert, sie hätte sich bestimmt für eine witzige Anekdote geeignet, aber so erklärte er auf die Frage hin, wie er es geschafft habe, der Gesellschaft schonungslos den Spiegel vors Gesicht zu halten, jedes Mal bloss bescheiden, dass er es eben anscheinend irgendwie geschafft habe und froh darüber sei, dass sein Buch so grossen Anklang fände. Nur einmal hatte er sich während der Diskussionsrunde zu einem frechen Scherz hinreissen lassen, doch das war früher gewesen, als er noch jung und unerfahren war und sein allererstes Buch frisch in den Regalen stand. Heute sah es anders aus. Er hatte längst begriffen, dass man es als Schriftsteller mit solchen Sprüchen höchstens auf die dritte oder vierte Seite des Blicks oder einer anderen Boulevardzeitung schaffte, was auch nicht die Welt war und eher ätzend als toll.
Auch das sollte sich ändern, als er den Kannibalen traf.Freilich spürte er zunächst wenig von dieser Veränderung, zumal er ja noch nicht
wusste, mit wem er es zu tun hatte. Der Kannibale sass unerkannt im Publikum, klatschte nach Abschluss der Lesung ein wenig lauter als die anderen oder trampelte mit den Füssen. Das war nicht aussergewöhnlich. Es gab eben an Lesungen ab und zu Leute, die lauter klatschten als andere, und es gab auch solche, die mit den Füssen trampelten, weil sie den Schlusssatz oder den Anfangssatz oder einen Satz in der Mitte besonders gut gefunden hatten. Auch, dass der Kannibale bei jeder Lesung dabei war, fiel ihm nicht sonderlich auf, denn es gab eben Leute, die immer dabei waren. Früher hatten ihm solche Leute noch geschmeichelt, nun kannte er nur noch die Hälfte von ihnen, und er bemühte sich auch nicht mehr sie kennenzulernen, ja, er hatte überhaupt genug vom Kennenlernen.
Erst, als das mit dem Mineralwasser passierte, wurde er stutzig.Als lesungserprobter Dauergast hatte er es sich angewöhnt, vor jeder Lesung ein
Fläschchen Mineralwasser zu kaufen und es in die Jackentasche zu stecken. Die Fläschchen kaufte er sich im Supermarkt in der Stadt; sie waren nichts Besonderes, aber er mochte das Besondere ohnehin nicht, und sie erfüllten ihren Zweck. Wenn nämlich das Leitungs- wasser, das ihm der Literaturkritiker vorsetzte, mal wieder scheusslich schmeckte – und das tat es oft – nahm er einfach das Fläschchen aus der Tasche und trank einen Schluck. Kritische Stimmen hatten sich auch schon darüber lustig gemacht. Ob Leitungswasser

Literatur
22
oder Mineralwasser, das würde doch keine Rolle spielen, sagten sie, und überhaupt, wie kann jemand in Sachen Wasser so pingelig sein? Für ihn hatte das jedoch nichts mit Pingeligkeit zu tun. Es war vielmehr ein Lebensstil.
Als er jedenfalls an diesem einen Abend zur Lesung in Köln kam – ein wenig verspätet und wegen des Regens durchnässt –, sah er es: Auf dem Tisch stand ein Fläschchen Mineralwasser. Wie angewurzelt blieb er stehen, und seine Hand löste sich von seinem eigenen Fläschchen in der Jackentasche. Er fiel aus dem Konzept; schon erreichten ihn die ersten fragenden Blicke des Literaturkritikers. Dann fasste er sich, umrundete den Tisch und setzte sich vor das Publikum. Während der Literaturkritiker die einführende Rede begann, starrte der Autor immer wieder auf das Fläschchen. Es war halb leer getrunken, doch der Deckel war verschlossen. Das Wasser schwappte noch ein wenig hin und her, so, als ob es jemand erst vor Kurzem hastig auf den Tisch geknallt hätte. Ein mulmiges Gefühl stieg in ihm hoch, obwohl es eigentlich keinen Anlass dazu gab. Dann hatte der Literatur-kritiker eben von seiner Gewohnheit erfahren und dafür gesorgt, dass ein Fläschchen auf den Tisch kam. Oder jemand aus dem Publikum hatte sich erbarmt… hastig schweifte sein Blick über die Leute in der vordersten Reihe. Er hatte diese Leute schon lange nicht mehr angesehen. Sie kamen ihm seltsam fremd vor. War der Dritte von links nicht sein Verleger? Und die vierte Frau von rechts, diese Frau im Pelz, wie hiess sie noch mal? Und der Mann, der direkt vor ihm sass? Etwas an ihm schien besonders verdächtig. Er trug kleine, goldene Ohrringe, hatte eine runzelige Stirn und grosse Ohrläppchen. Seine Augen funkelten, und über sein ganzes Gesicht zog sich ein breites Grinsen. Und diese Zähne… diese spitzigen Zahnreihen. Er sah aus wie ein Kannibale. Ein Schauer fuhr ihm über den Rücken. Hatte dieser Mann das Fläschchen auf den Tisch gestellt?
Der Literaturkritiker hatte seine Einführungsrede bald beendet. «Angeekelt findet man sich im Zoo-Geschäft, wo zum Teil die Grundeigenschaften menschlichen Daseins weit auseinanderklaffen, noch bevor sie überhaupt begonnen haben», sagte er abschliessend und das Publikum raunte anerkennend. Dann richteten sich alle Blicke auf den Autor. Er rückte das Mikrofon zurecht, nahm zögerlich einen Schluck Wasser, raschelte mit den Blättern und begann zu lesen.
«Diese totale innere Leere», begann er. Dann folgte eine traurige Geschichte über ein Mädchen, das in den Sumpf des Verbrechens gerät und in einer Jugendstrafanstalt landet. Es versucht sich gegen die jugendlichen Mithäftlinge durchzusetzen, gerät aber immer mehr ins Hintertreffen und wird schliesslich eines Morgens von den Wachmännern tot in der Zelle gefunden.
«Dieses pure Böse», schloss er mit dunkler Stimme.Die Wirkung, die der Text auf das Publikum hatte, war wie immer gross. Zunächst erklang
das Rascheln von Taschentüchern, dann vereinzeltes Schluchzen. Daraufhin begannen einige, zu klatschen, und bald war der Saal erfüllt von ergriffenem, tosendem Applaus. Für ihn hatte das alles jedoch keine Bedeutung mehr. Alles, worauf er sich konzentrierte, war der Kannibale, der direkt vor ihm sass. Wie alle anderen klatschte der Mann, doch sein Klatschen übertönte alles. Zusätzlich trampelte er mit den Füssen auf den Boden und rief immer wieder Dinge wie «Ich werde dich fressen! Hörst du, ich werde dich fressen!»
Unausweichlich stieg in ihm Verachtung für diesen Mann hoch. Er war sich mittler-weile sicher, dass er es gewesen war, der das Mineralwasser auf den Tisch gestellt hatte. Eine anmassende Frechheit.
Leider war es da noch nicht zu Ende. Bei jeder weiteren Lesung, die er hielt, sass der Kannibale in der vordersten Reihe und grinste. Und jedes Mal stand eine Mineralwasser-flasche auf dem Tisch. Zu allem Übel hinzu rückte der Kannibale mit dem Stuhl von Mal zu

23

Literatur
24
Mal näher, sodass ihn der Literaturkritiker zuletzt streng, aber freundlich zurechtweisen musste, was den Mann jedoch nicht beeindruckte. Von da an war für ihn klar: Der Kannibale musste weg. Nur wie? Er durfte sich bei seinen öffentlichen Auftritten nicht zu viel erlauben, oder sein Ruf wäre ruiniert. Er musste ihm dennoch auf irgendeine Weise dezent klar machen, dass er ihn nicht in seiner Nähe wünschte. Nach schlaflosen Nächten kam ihm endlich die Lösung. Sie war einfach, aber hoffentlich wirkungsvoll: Ab sofort würde er keinen einzigen Schluck mehr vom präparierten Mineralwasser trinken, sondern demonstrativ sein eigenes Fläschchen benutzen.
Der Saal war bereits voll, als er ihn am nächsten Abend betrat, und der Kannibale sass wie immer in der vordersten Reihe. Bei seinem Gang durch das Publikum würdigte er ihn keines Blickes. Auch nicht, als er sich an den Tisch setzte und die Flasche San Pelegrino vor sich sah. Stattdessen wandte er sich sofort dem Literaturkritiker zu und setzte einen so interessierten Blick wie möglich auf. Dieser sprach gerade über die «Aneinanderreihung psy-chischer Fantasien» – was das auch immer mit seinem Buch zu tun haben sollte. Dann sprach der Kritiker von «anspruchsvollen Lesern mit Mitgefühl, Menschlichkeit und Courage». Am liebsten hätte er laut aufgelacht. Doch es blieb ihm keine Zeit mehr dazu, denn schon ruhten alle Blicke auf ihm und warteten darauf, dass er ihnen das lieferte, was sie wollten. Sein neuer, noch unveröffentlichter Bestseller behandelte ein Leben, das eigentlich nur Liebe suchte in dieser Wegwerfgesellschaft, gerade weil man sich nichts zu sagen hatte. Auf solche Themen, das wusste er, sprangen die meisten an.
Für einen kurzen Augenblick, einen winzig kleinen nur, blickte er während des Lesens auf.
Das war ein Fehler gewesen.Wie hatte der Kannibale das geschafft? Er hing regelrecht über dem Tisch. Ein leises Lachen drang zwischen seinen spitzen
Zähnen hervor, während sein Speichel auf die Buchseiten tropfte.Der Autor zuckte zurück. Zitternd kramte er nach dem Mineralwasser in der Tasche.
Jetzt oder nie. Er öffnete den Deckel und trank.Und … es wirkte!Das Gesicht des Kannibalen verzog sich zu einer gequälten Grimasse und Tränen
kullerten ihm über die Wangen. Abwechselnd blickte er auf die San Pelegrino-Flasche und auf diejenige in den Händen des Autors. Tatsächlich. Der Kannibale fühlte sich hinter- gangen. Für einen Moment sah es sogar so aus, als ob enttäuschte Liebe im Spiel wäre und nicht nur Fressgelüste – und wer mochte sagen, vielleicht hatte Liebe tatsächlich mit Essen zu tun, ging sie doch durch den Magen? Schwerfällig stand der unheimliche Mann auf und verliess den Saal, leise schluchzend, mit hängenden Schultern. Als die schwere Tür zukrachte, wurde es still.
Der Autor mochte diese Formulierung nicht besonders, obwohl – oder gerade weil – er sie schon so oft verwendet hatte, aber: ihm fiel ein Stein vom Herzen. Für die folgenden Textpassagen liess er sich Zeit. Die Gefahr war gebannt und er musste nicht mehr um sein Leben fürchten. Die entspannte Art, wie er nun mit dem Text umgehen konnte, zeigte auch über die Lesungen hinaus ihre Wirkung: So wurde das Buch zum grössten seiner bis- herigen Erfolge und brach alle Verkaufsrekorde.
Nur ein einziges Mal noch – doch das wusste der Autor nicht – hatte der Kannibale versucht, seine Gunst zu erringen. Da er sich lange Zeit Gedanken gemacht hatte und zum naheliegenden, wenn auch nur halb richtigen Schluss kam, die Abweisung müsse mit der schlechten Mineralwasserflasche zusammenhängen, die er dem Autor hingestellt hatte, bemühte er sich in einem letzten Anlauf, es wieder recht zu machen. Statt San Pelegrino

Lite
ratu
r
25
kaufte er ein Valser und liess die Flasche zufällig im Hotelzimmer liegen. Anbei legte er einen Brief, in dem er sich für die San Pelegrino-Flasche entschuldigte und die Vorzüge von Valser pries. Doch der Autor würde die Flasche nie sehen: noch am selben Abend musste er überstürzt zu einer Buchmesse abreisen und er achtete nicht auf den Tisch, auf dem das Fläschchen stand.
JÁNOS MOSER

Kritik
26
Der halb richtige Schluss
– An einer der Lesungen, welche von den Redak-toren von delirium veranstaltet wurde, sagte ein Autor eines literarischen Beitrages, er danke seiner Kritikerin für ihre Ausführungen. Er habe sich in dieser Kritik sehr verstanden gefühlt. Der vorliegende Text ist in der Überzeugung geschrieben worden, dass solche Sätze als Antwort auf eine Kritik unmöglich sind, ja, dass es sogar an blanken Unsinn grenzen muss, so etwas zu sa-gen, und dass entweder die Kritikerin, der Autor oder – viel wahrscheinlicher – beide schrecklich missverstan-den wurden.
«Man hätte nicht sagen können, dass seine Lesungen besonders aufregend waren, bevor der Kannibale kam.»
– Es gibt die verbreitete Vorstellung, einer der schreibt, müsse etwas erlebt haben, um davon erzählen zu können. ‹Etwas erlebt›: In der diffusen Formulierung steckt eines der Mysterien des Autors, an welchem die Zuhörer seiner Lesungen nur zu gern Anteil hätten. Sie stellen ihm Fragen, als gäbe es dort etwas zu offen- baren, träfen sie doch nur das Zauberwort. Was meinen denn die Leute, wenn sie nach diesem Erlebten fragen? Es ist dieselbe Überzeugung, welche dem gängigen Satz «Wenn einer eine Reise tut, hat er was zu erzählen» zugrunde liegt. Jene, dass Erzählen etwas Ausserge- wöhnliches Darstellen heisst. Der Alltag lässt sich nicht erzählen. Eine klebrig gefestigte Überzeugung, wie eine Gewohnheit eingenistet – nicht in den Köpfen (Forschung hat ergeben, dass in den Köpfen nur Hirne sind) – aber in vielem Fragen, Reden und Schreiben.
«Es war vielmehr ein Lebensstil.» – Herodot schreibt eine Geschichte: Psammenit der Ägypter- könig wird von Kambyses dem Perserkönig besiegt und gefangen genommen. Der abgesetzte Herrscher soll nun gedemütigt werden. Man bindet ihn neben eine Strasse, über welche der persische Triumphzug führt. Zunächst tritt die Tochter des Psammenit an ihm vorbei. Sie ist schäbig bekleidet, ihr Schicksal als Dienstmagd steht fest. Psammenit lässt aber seine Tochter wortlos und ohne ein Zeichen der Trauer vorüberziehen. Als Nächstes zieht sein Sohn auf dem Weg zur Hinrichtung an ihm vorbei. Das ganze Volk der Ägypter jammert ob des Schmerzes, der
seiner Herrscherfamilie widerfährt, doch Psammenit bleibt stumm. Kein Zucken geht durch ihn. Als Drittes schleppt sich sein Gefolge vorbei, und als der gefallene Herrscher einen alten und armen Mann aus den Reihen seiner Diener erkennt, da gibt Psammenit alle Zei-chen der Trauer zu erkennen. Herodot erzählt diese Geschichte nicht darauf hin, dass der Ägypterkönig bei seinen Angehörigen stoisch bleibt. Vielmehr arbeitet die Geschichte auf den Ausbruch der Trauer hin. Um dies zu erreichen, muss zunächst eine Gewohnheit etabliert werden, um danach zur Abweichung zu kommen. Das letzte Moment, welches das Unerklär-liche der Geschichte ist, ist auch dasjenige Moment, welches erratisch von aller Wiederholung, Gewohnheit und vom Alltäglichen entfernt ist.
«Leider war es da noch nicht zu Ende.» – Am Ende der Erzählung steht die Pointe. Man erkennt das Ende, denn es wird darauf hingearbeitet. Das ist alles doch sehr klassisch.
«‹Dieses pure Böse›» – Einer erklärt einem Andern, wie Kritik funktioniert: «Es gibt eine einfache und gleichzeitig bestechend effiziente Form von Kritik. Es braucht dazu nicht viel, keine besonderen Fähigkeiten oder dergleichen. Du musst nur den richtigen Aus-schnitt desjenigen, was du kritisieren willst, an der richtigen Stelle wiederholen. Das Zitat selbst ist eigentlich schon die Kritik.» «Das Zitat selbst ist eigent-lich schon die Kritik», wiederholt der Andere für sich, wie er es zu tun pflegt, um das Gespräch zu verstehen.
«[S]ie waren nichts Besonderes, aber er mochte das Besondere ohnehin nicht» – Im Französischunterricht wird vermittelt: Für die Dinge, welche man in der Ver-gangenheit aus Gewohnheit tat oder immer noch tut, verwendet man das imparfait. Sollte sich aber etwas Unvorhergesehenes zutragen, dann verwendet man das passé composé. So wird auch eine Geschichte voll- endet. Indem man diese Dinge zusammenstellt.
«‹Diese totale innere Leere›» – Es gibt eine schwarz-weisse Filmaufnahme. Ein Mann sitzt auf einer weis-sen Gartenbank auf der Wiese. Rechts neben ihm schwanken die Äste eines Baumes ins Bild. Er hat die Beine übereinandergeschlagen, sein Arm liegt ausge-breitet auf der Lehne der Bank. Er sagt: «Ich bin kein Geschichtenerzähler. Geschichten hasse ich im Grund. Ich bin ein Geschichtenzerstörer, ich bin ein typischer

Kri
tik
27
Geschichtenzerstörer. In meiner Arbeit, wenn sich irgendwo Anzeichen einer Geschichte bilden oder wenn ich in der Ferne irgendwo hinter einem Prosa- hügel die Andeutung einer Geschichte auftauchen sehe, dann schiess ich sie ab.» Dieser Mann, der schreibt, tut dies nicht auf eine besondere Pointe hin. Er ver-sucht, den Alltag zur Literatur zu machen. Seine Texte sind geprägt von Protagonisten, die ihren Gewohn- heiten nachgehen, sie sitzen in Museen und betrachten Bilder, oder aber pflegen es, zu spazieren. Solche Kniffe verhindern, dass eine Geschichte zu ihrer Vollendung kommt. Man fragt sich, wie ernst man solche Angriffe aufs Geschichtenerzählen nehmen soll. Man fragt sich auch, ob man überhaupt noch wie Herodot eine Geschichte erzählen kann.
SAMUEL PRENNER

28
…wann haben die genug
uns streiche zu spielen…

Lite
ratu
r
29
kapri
wir stehen oben am fels in kapriweisse reichenschiffe ziehendurchs blau und wir denkenversuchen uns vorzustellenwie wir das sehen würden wärenwir goethe oder aus seiner zeitweil wir kamen mit dem flugzeug
da kommt eine uralte denweg heraufgeschlurpft wienasse wollfäden ziehen diejahre an ihren gliedern bis
sie in sich zusammenfällt und sie fängt anbellissima madonninabellissima madonninabellissima madonnina
wir hören die maschine des todes dröhnenund wir sind jungund gehen
und wie wir über die felsen rutschenkommt aus den bäumen eine stimmegeflogen wie ein matratzenverkäufer ein zirkusrufer durchs megafon eine messevon zuoberst auf dem bergund ich denke an die altevor dem altar wie sie lauschtund es ist ihr requiem das da durch felsen und sträucherübers meer scheppert

Literatur
30
weltendrehen
wir sind im haus und die andernsind draussensie spielen uns einen streich
sie rennen auf der erdeso schnell
– drehen wie am hebel der spieldose sodass das lied davonrennt –dass wir im haus
umkippenund der vogelkäfig kippt
wir rufen seht! sie haben die richtung der weltgedrehtund wir fallen im haus übereinander
und die vögel sind im käfig erstarrt weil das haus in der eiswüsteund die vögel im käfig sind verbranntweil das haus von eis zu heisswüste kugeltwir machen das fenster schnell wieder zu
wann haben die genug uns streiche zu spielen wir hocken im schrankden vogelkäfig mit tüchern verwickeltund warten
und irgendwann dreht die welt wieder normalund es eist und heisst nicht mehr durch den türspalt
und die andern kommen zur tür hereinund lachen
MICHELLE STEINBECK

31

Kritik
32
Simulation eines Kommentars
VorbemerkungNach dem von Adorno konstatierten Selbstver-
ständlichkeitsverlust alles dessen, was die Kunst be-trifft, hat jedes künstlerische Gebilde, das diese Be-zeichnung verdient, sich selbst und sein Verhältnis zum gesellschaftlichen Ganzen mitzuverhandeln. Ebenso hat sich eine Literaturkritik, die ihrem Anspruch ge-recht werden will, zu fragen, welchen Anspruch der pu-blizistische Rahmen, innerhalb dessen sie sich aktua-lisiert, überhaupt noch zulässt. Und hier beginnt die Schwierigkeit. Denn ein Ziel von delirium, nämlich Pro-duktion und Kritik in einem Heft zusammenzubringen, scheint mir anachronistisch zu sein. Diese Idee lässt sich als Versuch verstehen, die tendenzielle Auflösung und Zersetzung von Literatur in ihrem Kern abzuwen-den durch die Wiedererrichtung einer heilen Kunst-Welt, die noch nicht unmittelbar in politische und öko-nomische Verwaltung genommen ist. Obgleich sich ein solches Unternehmen der Intention nach gegen die Fiktion einer absoluten Autonomie von Kunst stellt, in-dem sie dem Literarischen seine gesellschaftliche Re-levanz zurückzugeben sucht, zehrt sie daher selbst von diesem Mythos. Man könnte von einer Simulation des Literaturbetriebs im Kleinen sprechen, wobei sich der Simulationscharakter auf die Verfahren der Literatur-kritik überträgt: sei es auf die benjaminsche Mortifi-kation der Werke als «Umbildung der Sachgehalte zum Wahrheitsgehalt», sei es auf die kunstrichterliche Aus-breitung von Gelehrsamkeit, oder sei es auf eine lite-raturwissenschaftlich fundierte Lyrikanalyse. Stets bleibt der Verdacht, dass alle Kritik, so ernst sie ge-meint, bloss simuliert sei. Diesem Missstand ist viel-leicht dadurch abzuhelfen, dass jene Konzeption von Kritik als Simulation radikalisiert wird. Sie täuscht sich selbst nur vor, sie meint es nicht ernst, und kommt, wie «die andern» in Michelle Steinbecks Gedicht, «zur tür herein / und lach[t]». Sie beurteilt die Qualität des Gedichts, aber sie spielt diese Beurteilung nur. Sie schlägt sich auf die Seite der «andern» und spielt de-nen, die es sich «im haus» gemütlich einrichten, «ei-nen streich». Sie will dem Gedicht nicht gerecht wer-den, sondern übt Ungerechtigkeit am Gedicht, indem sie es instrumentalisiert für die Frage nach der Stel-lung des sprachlichen Kunstwerks zu seiner Umwelt.
Sie liest die Dichtung als Vertiefung und Verlängerung der Vorbemerkungen, und transformiert diese damit zum Gegenstand der Analyse selbst. Eine solche Kritik verweigert sich der Idee von Literaturkritik – womit sie die im Modell delirium schon angelegten Simulations-tendenzen fortschreibt.
LektüreDas Erste, was an Michelle Steinbecks Gedicht
weltendrehen auffällt, ist dessen antithetische Struktur, die bereits in den ersten Zeilen mit der Innen-Aussen-Dichotomie bzw. der Opposition wir - die andern expo-niert wird: «wir sind im haus und die andern / sind draussen / sie spielen uns einen streich». Fortgeführt wird diese Struktur mit weiteren Gegensatzpaaren, die sich um die semantischen Pole Passivität (wir, drin-nen im Haus) und Aktivität (sie, spielend draussen auf der Erde) gruppieren: Gefangenschaft («vogelkäfig») vs. Freiheit («spielen», «rennen»); Sprechen und Kontemp-lation («wir rufen seht!») vs. Tun und Aktion («sie ha-ben die richtung der welt / gedreht»); Starrheit («die vö-gel sind im käfig erstarrt») vs. Dynamik («weil das haus von eis zu heisswüste kugelt»); Ernst («wann ha-ben die genug») vs. Unernst («uns streiche zu spielen»). Die Verben «warten» und «spielen» in der sechsten und der ersten Strophe bilden gleichsam die Klammer um diese antithetische Ordnung (die dann in der siebten Strophe aufgelöst wird: «die andern kommen zur tür herein / und lachen»). Die Antithetik provoziert eine allegorische Lektüre, die im Gedicht eine poetologi-sche Reflexion über die Stellung von Lyrik zu ihrer Um-welt, zu ihrem andern sichtet: Verhandelt wird der Ge-gensatz von Kunst («wir»: die Schreibenden) und Welt («sie»: die Nichtschreibenden), von Artistik und Leben
– allerdings im Zeichen einer eigentümlichen Inversi-on oder «Welten-Drehung»: Nicht mehr drinnen, in der Kunst-Welt, wird gespielt, sondern draussen, in der Lebens-Welt. Dies aber zu Lasten der künstlerischen Gegenwelt («sie spielen uns [den Schreibenden; D.B.] einen streich»), die, verdammt zur Passivität, den An-strich kunstwidrigen Ernstes bekommt (der im Gedicht durch prosaisches Konstatieren des Unheils sprachlich manifest wird). Die Künstler leben nicht, wie bei Tho-mas Bernhard, in einem frei umherziehenden Wohn-wagen, sondern scheinen gefangen in einem unbeweg-lichen Haus, das «von eis zu heisswüste kugelt». Demnach lässt sich das Gedicht als Geschichte vom Zerfall der Lyrik und Literatur unter Bedingungen der Postmoderne lesen. Autonome literarische Praxis

Kri
tik
33
kann, wie die vorliegende Kritik, zwar simuliert wer-den, stellt aber die blosse Reaktion auf dasjenige dar, was draussen, «auf der erde» geschieht. Draussen wird gerannt, drinnen gewartet. «sie [...] drehen wie am he-bel der spiel / dose so / dass das lied davon / rennt». Draussen dreht die Welt, draussen drehen «sie» so, dass «das lied» – das Lied des Vogels im Käfig, unser Lied – davon rennt. Ihr Spiel ist mechanisch, es simu-liert ein Lied («wie am hebel [...]»), welches das (organi-sche) Lied des Vogels austreibt. Sie drehen, wir kippen, weil wir die Drehung nicht mitvollziehen können, aber genötigt werden, sie nachzuvollziehen. Sie drehen die Richtung der Welt, wir können diesen Prozess nur be-obachten; oder, nur rufen, dass wir beobachten, also si-mulieren, dass wir beobachten, und im Gefolge dieser Schein-Beobachtung im Kunst-Haus übereinander fallen. Nicht mehr die Literatur verdreht, kraft ihrer Imagina-tion, die Welt, vielmehr kommt die Drehung von aussen, von der sich umdrehenden Welt, deren Dreh-Richtung von den Weltlichen («sie») gedreht wird. Die gewohnten Verhältnisse (normale Drehung der Welt, «irgendwann dreht die welt wieder normal»; «Ver-Drehung» der Welt in der Literatur) werden verkehrt, verdreht, umgedreht. An der Literatur aber ist es, diese Drehung in Gestalt ei-ner (Um-)Kipp-Figur mitzumachen. Solange sie noch dazu fähig ist:
«und die vögel sind im käfig erstarrtweil das haus in der eiswüsteund die vögel im käfig sind verbranntweil das haus von eis zu heisswüste kugelt»
Wie die Singvögel im Haus inmitten der Eiswüs-te, erstarrt in diesen Zeilen die lyrische Rede inmitten der weltlichen Sprachwüste: Die Rede friert als Ana-koluth nach «eiswüste» ein, setzt dann mit dem Paral-lelismus «und die vögel [...] weil das haus [...]» neu an, um nach der (anorganischen) Paronomasie «heisswüs-te» erneut um Worte zu ringen (grafisch markiert durch die Leerzeichen); zur Vervollständigung des Satzes, zu ihrer eigenen Legitimation: « kugelt». Das Wort ist gefunden, doch die Passivität der umherkugelnden Literatur nicht durchbrochen. Gegenüber den wach-senden (Sprach-)Wüsten vermag sich das Haus nicht zu isolieren: Die Vögel im Käfig erstarren vor Käl-te (Unmöglichkeit von Kommunikation) oder sie ver-brennen in der Hitze (Ubiquität von Kommunikation). Die Kunst-Monade ist für einmal nicht fensterlos, ten-diert aber zur Abdichtung («wir machen das fenster schnell wieder zu»), wobei diese Versuche gegenüber
der unabwendbaren Erstarrung und Verbrennung ver-geblich anmuten. Und die Abschottung geht weiter:
«wann haben die genuguns streiche zu spielen wir hocken im schrankden vogelkäfig mit tüchern verwickeltund warten»
Die lyrische Rede kulminiert in der hilflos-erns-ten Interrogatio «wann haben die genug [...]». Gegen-über dem Unernst der «andern», ist der aufgezwunge-ne Ernst der Kunst ohnmächtig. Was bleibt, ist Rückzug (vom Haus in den Schrank), Abdichtung (selbst vom leeren Vogelkäfig darf nichts nach aussen dringen) und Geduld («warten»). – Warten bis zum «irgendwann». Die Schlussstrophe setzt sich formal von den übrigen sechs Strophen ab. Einerseits durch die zentrierte Dar-stellungsweise, andererseits durch die polysyndetisch-parataktische Ordnung der Verse:
«und irgendwann dreht die welt wieder normalund es eist und heisst nicht mehr durch den türspaltund die andern kommen zur tür hereinund lachen»
Die Ungewissheit über die Dauer des Wartens, die Unbestimmtheit des «irgendwann» einer wiederein-kehrenden Normalität, der biblische Sprachrhythmus und die formale Abgesetztheit dieser Strophe – das al-les verschiebt das darin Gesagte in ein utopisches Nir-gendwo. Das Zentrum, die ersehnte Normalität als Auf-hebung der Kunst-Welt-Antithese ist fingiert, fungiert aber dennoch als Regulativ, indem es die skizzierte An-tithetik als eine des Ausnahmezustands sichtbar macht. Ungewiss bleibt der Charakter dieses Utopias, denn das Lachen derer, die eintreten, ist ambig: Dessen befreien-des Moment im Ausnahmezustand verkehrt sich, uni-formiert und normalisiert, als kollektives Gelächter zum Höllensignal. Die Normalität des «irgendwann» bezeichnet dann nicht die Utopie der Aufhebung von Kunst in Lebenspraxis, sondern die Dystopie einer un-tergehenden Kunst im sich ausbreitenden Gelächter.
UrteilSo viel zur simulierten Gedichtlektüre. Weiter zur
simulierten Beurteilung. Beschreibt das Gedicht mit lyrischen Mitteln die Erstarrung und Zersetzung bis hin zur Auflösung von Kunst richtig, gelingt also das Gedicht, dann muss es im Medium der Lyrik zugleich scheitern. Beides, sein Gelingen und sein Scheitern

Kritik
34
sind im Folgenden aufzuweisen. – Das Gedicht welten-drehen zeichnet den Prozess eines Funktionsverlusts von Kunst nach, zu der konstitutiv eine Dialektik von Autonomie und gesellschaftlicher Vermittlung gehört. Es beschreibt, was jedem sprachlichen Kunstwerk wi-derfahren muss, das sich nicht ohne Weiteres in Ver-waltung nehmen lässt: Das Kunstwerk büsst an Auto-nomie ein, verliert seinen Werkcharakter, wird zum blossen Nachvollzug dessen, was «draussen» vor sich geht, neigt zum Verstummen, zur Sprachlosigkeit und
– als Gegentendenz – zur Abdichtung vor der gesell-schaftlichen Realität. Einnehmende Bilder beschreiben diesen in der völligen Auflösung von Kunstautonomie endenden Vorgang: Das Lied rennt davon, der Vogel-käfig (mit den Singvögeln) kippt durch Richtungsände-rung der Welt um, «wir fallen im haus übereinander» (sprachlich reflektiert durch das «Übereinanderfallen» der Verse der fünften Strophe), die Vögel im Käfig sind erstarrt und verbrannt, der Käfig ist mit Tüchern ver-wickelt, und die im Haus Gebliebenen verbarrikadieren sich im Schrank, um den Streichen der «andern» – den Streichen, die ja auch Schläge sind – zu entgehen. Zu-letzt treten diese unter Gelächter zur Tür herein. – Die Aporien von Lyrik heute, die ihr Scheitern begründen, müssen sich im Gedicht auf der Formebene wiederfin-den lassen. So kämpft das Gedicht, trotz hoher Beherr-schung lyrischer Techniken, aus objektiven Gründen um die angemessene Sprache: Es kippt, wie der Vogel-käfig, vom einen sprachlichen Extrem in das andere: vom allgemein experimentellen Charakter zur starren, allzu schematischen Antithetik und Allegorik. Oder vom Tonfall prosaischer Lyrik – unterstützt durch Wegfall von Interpunktion, Reimen und Versmass so-wie durch konsequente Kleinschreibung – zu, beina-he, rhetorischem Überschwang (Anaphern, Metaphern, Polyptoton, Parallelismus, Anakoluth, Paronomasie, Interrogatio, Neologismen etc.). Zwar sind solch rhe-torische Mittel im Gedicht kaum je unmotiviert, doch zeigt sich hier ein stilistisches Problem. Einerseits po-sitioniert sich das Gedicht auf der Höhe seiner Zeit und bedient sich daher (post-)moderner Schreibverfahren, etwa durch grafische Anordnung der Textbausteine un-ter Ausnutzung der Zweidimensionalität (so wird die Handlungshemmung, das Zögern, die Passivität der Hausbewohner gleichsam visualisiert). Andererseits geriert sich das Gedicht im Allgemeinen erstaunlich zeitlos, etwa durch jene Rhetorizität der Mittel, mehr noch aber im Gebrauch einer suggestiven, fast möchte man sagen, ‹klassisch› lyrischen Bildsprache, die sich
teils zu einer Art Endzeit-Pathos verdichtet («seht! sie haben die richtung der welt / gedreht», «erstarrt», «ver-brannt», «eiswüste»), allgemein durch die Verwendung einer intakten, wenig brüchigen lyrischen Sprache, die eine längst nicht mehr gegebene Intaktheit der lyri-schen Subjektivität simuliert. Gereichen die erwähn-ten, auf sprachliche Heterogenität verweisenden ästhe-tischen Eigenheiten dem Gedicht nicht zum Nachteil, da sie als Resultat gerade des Ausagierens der Apori-en zeitgenössischer Lyrik lesbar sind, so lässt sich da-gegen die sprachliche Pseudo-Klassizität als Qualitäts-einbusse anführen: Indem sich das Gedicht dergestalt
– wie der mit Tüchern verwickelte Vogelkäfig – von sei-ner Umwelt, die eine ganz andere Sprache spricht, ab-dichtet, gelingt es ihm nicht, den reflektierten Lyrik-Zerfall konsequent in die eigene Sprache aufzunehmen. Was man vermisst, sind sprachliche Elemente gerade des Lyrik-Fremden: etwa die allgegenwärtige Sprache der Werbung, der politischen Propaganda, der Gratis-zeitungen, die Sprache von Facebook, Twitter und Co., die Sprache der Banken und Grosskonzerne etc. Das ist kein Plädoyer für eine Politisierung der Lyrik, sondern die Forderung, die zentralen sprachlichen Modi hiesi-ger Sozialisierung lyrisch zu spiegeln. Verschliesst sich die lyrische Produktion solchen Entwicklungen, unter-wirft sie sich demselben Verfahren, dem sich der Autor dieser Zeilen für die Zeit ihrer Niederschrift verschrie-ben hat: der Simulation literarischer Praxis.
DEMIAN BERGER

35

36
…In der Schweiz war es nie so göttlich wie damals in
Griechenland. Dass die Sonne krebserregend sei,
erfuhren wir auch erst hinterher. Und dass wir
Brillen hätten tragen sollen, um die Augen zu schützen,
in die wir uns so tief geblickt hatten. Ja, mein Sohn, da
war sie schon schwanger.…

Kri
tik
37
GenealogienGötter Gedächtnis
«Du fragtest mich nach griechischen Göttern. Du fragtest mich, ob ich glaube. Und du fragtest mich, woher du kommst. Ich muss sehen, ob ich mich noch erinnern kann. Ja, mein Sohn, lange ist es her, dass es die Götter nicht mehr gibt, und die kuhäugige Europa grast allein die Felder ab. Kein Zeus kommt sie mehr entführen. Vielleicht wachsen uns neue Götter mit der Zeit. Als ich jung war, hatten wir noch einen. Wenigstens einen Gott. Einen, den letzten. Den zähesten wahrscheinlich.
Damals, und der Pfarrer hatte eine zitternde Hand, wenn er die runde Scheibe brach, vor unser aller Augen. Er klebte auf der trockenen Zunge, der Leib, und während des Halle-lujas wurde gehustet. Der weichwangige Pfarrer starb, als ich nicht mehr in die Kirche ging. Ja, mein Sohn, und da wurde es ruhig in der Kirche wie in einer Totenhalle. Deine Mutter erzählte mir später, dass auch er tot sei, Gott. Der letzte Gott. Sie hatte es gelesen irgendwo.
Lange ist es her, dass wir uns kennenlernten, ja, mein Sohn. In dem Sommer gingen wir nach Griechenland. Am Strand glaubten wir, es romantisch zu haben. Götter gab es keine mehr, auch dort nicht, aber viele Menschen und wenig Geld. Wir wollten uns gold-gelb braten, assen die Oliven und tranken den Wein. Mehr als in der Kirche damals, viel mehr Wein. Ja, mein Sohn, und da habe ich sie gefragt, Magdalena, ob sie deine Mutter werden will. Herrlich war der Sommer. Ihre Haut pellte sich rot von den Schultern. Die dunklen Haare wurden heiss wie eine Herdplatte und mit weissen Zähnen strahlten wir uns an, küssten uns mit sandigen Lippen und waren die Ersten und Einzigen. Eine Per-le fing sich in ihren Brauen, wir schwitzten. Das Salz der Erde an einem Strand voller Touristen.
In der Schweiz war es nie so göttlich wie damals in Griechenland. Dass die Sonne krebserregend sei, erfuhren wir auch erst hinterher. Und dass wir Brillen hätten tragen sollen, um die Augen zu schützen, in die wir uns so tief geblickt hatten. Ja, mein Sohn, da war sie schon schwanger. Arbeit hatten wir beide keine und eine Hochzeit kostet viel. Wir wollten sie nicht unter freiem Himmel feiern, auf schönes Wetter konnte man sich nicht verlassen und draussen verstand man weniger. Ja, mein Sohn, so war das.
In unserer Kirche gab es dann eine Pfarrerin. Ich weiss nicht, wie es dazu kam. Für Magdalena war es wichtig, auch wenn sie nicht an Gott glaubte, an keinen. Sie wusste ja, dass er schon tot war. Ihr Kleid war gross und weiss, die Pfarrerin trug schwarze Hosen und sprach den runden Bauch nicht an. Aber vom neuen Leben sprach die Pfarrerin in der kühlen Kirche und vom Glauben aneinander. Magdalena glänzte, meine Hände waren etwas feucht. Ich war furchtbar nervös. Ja, mein Sohn und dann kamst natürlich du. So war das nämlich, damals. Mit Göttern hatte es wenig zu tun. Mit Griechenland vielleicht. Kennst du die Geschichte mit den Bienchen? Ambrosia sei honigsüss. Wie Messewein. Wie Götterblut.»
MERET BACHMANN

Kritik
38
Jede Odyssee führt in den Wald
Fast gebetartig antwortet der Vater dem Sohn auf die Frage seines Ursprungs: «Ja, mein Sohn». Es bleibt uns verwehrt, die genauen Fragen des Sohnes in Erfahrung zu bringen. Die griechischen Götter, der Glaube des Vaters und die Herkunft des Sohnes sind die Ausgangsthemen des Textes, welche der Vater zu Beginn wiederholt, um daraus einen Exkurs über eben-diese Götter, den christlichen Glauben und seine Ehe mit Magdalena zu entfalten. Mit trockenem Humor und schönen Urlaubsbildern liest sich Genealogien leicht und unterhaltend. Aber Achtung – die Querverweise und undeutlichen Anspielungen führen den Leser auf eine Odyssee, auf der man schnell die Orientierung verliert und sich irgendwo in einem unübersichtlichen Wald zwischen Athen, Nazareth und der Schweiz wieder- findet. Meret Bachmann verfolgt einen Stammbaum, der unsere Kultur aus ungewohnter Perspektive zeigt.
Die WurzelWie es der Titel vermuten lässt, wird im Text eine
Art Familiengeschichte wiedergegeben. Diese Ge-schichte bleibt jedoch in Fragmenten. Es werden wenige Momentaufnahmen aus der Kindheit, dem Griechenlandaufenthalt und der Hochzeit der werden-den Eltern gezeigt. Also kaum genügend Bodenhaf-tung und Informationen, um den Text als Genealogie zu bezeichnen. Wie sollen wir also diese Familien- geschichte komplettieren? Dafür gibt es das kollektive Gedächtnis, die Geschichte, die Überlieferung, das «Götter Gedächtnis». Wenn uns in der Genealogie von Vater, Mutter und Sohn etwas fehlt, dann ist sogleich ein interkontextueller Verweis zur Stelle, der die Gedanken auf eine neue Fährte bringt. Einfach ist das nicht, aber Genealogien sollen auch nicht einfach sein, das wissen wir dank der griechischen Mythologie.
Der StammSeine zitternden Hände brachen die Hostie und der
Pfarrer pappte das geschmacklose Gebäck auf die Zun-ge. Der Vater wandte sich bald ab von der Kirche, der Pfarrer starb. Warum sich der Vater von der Religion lossagte? Das bleibt vorerst unklar. Denn eine leichte Sehnsucht nach Göttern und Religion scheint in Vaters
Monolog immer wieder durchzudringen – nicht for-dernd oder flehend, sondern äusserst subtil. «Wenigs-tens einen Gott. Einen, den letzten» hatte der Vater da-mals in der Kirche noch. Später, am Ende des Textes, vergleicht er die Geburt des Sohnes mit «Götterblut» und der Götterspeise «Ambrosia», die «honigsüss» sei.
Ein wenig mehr über die religiöse Ausrichtung er-fahren wir bei Magdalena, der Namensvetterin von Ma-ria Magdalena, die Jüngerin von Jesus und Zeugin von dessen Auferstehen war. Von einigen Quellen wird sie sogar als die Gefährtin Jesu ausgegeben. Abgesehen vom Namen werden weitere verwirrende Parallelen zur Geschichte von Jesus erkennbar. So wird Magdalena wie Maria, die Gottesmutter, nicht nur unverheiratet, sondern metaphysisch schwanger. Als Zeugungsgrund wird im Text suggeriert, Magdalena wäre durch die Sonne und den ungeschützten Augenkontakt schwan-ger geworden:
«In der Schweiz war es nie so göttlich wie damals in Griechenland. Dass die Sonne krebserregend sei, erfuhren wir auch erst hinterher. Und dass wir Brillen hätten tragen
sollen, um die Augen zu schützen, in die wir uns so tief geblickt hatten. Ja, mein Sohn, da war sie schon schwanger.»
Die Vereinigung der beiden biblischen Figuren, der Mutter und der Gefährtin Jesu, in einer Person lässt nicht nur Verwirrendes, sondern geradezu Verstören-des erahnen. – Erstaunlicherweise will sich Magdale-na dann doch kirchlich trauen lassen, obwohl sie gar nicht an Gott glaubt: «Magdalena war es wichtig, auch wenn sie nicht an Gott glaubte, an keinen. Sie wusste ja, dass er schon tot war.» Warum also die Trauung? Und gab es früher einen Gott, aber jetzt nicht mehr? Wie überall im Text bleibt uns die Autorin klare Antwor-ten schuldig.
Die KroneGott ist tot. Nietzsche lässt grüssen, fragt sich aber
zugleich über die Schwammigkeit der Aussagen, wel-che einen toten Gott unglaubwürdig machen. Denn im Text finden sich gleichwohl Indizien für und gegen den Tod Gottes. Nicht zuletzt bei profanen Aussagen ver-wendet der Vater plötzlich Adjektive wie «göttlich» und er vergleicht die getrunkene Weinmenge in Griechen-land mit jener, welche in der Kirche getrunken worden war. Sakrale Elemente wie die Hochzeit kommen hin-gegen äusserst unpoetisch, leidenschaftslos und realis-tisch daher:

Kri
tik
39
«[D]ie Pfarrerin trug schwarze Hosen und sprach den runden Bauch nicht an. Aber vom neuen Leben sprach die
Pfarrerin in der kühlen Kirche und vom Glauben aneinander. Magdalena glänzte, meine Hände waren etwas feucht. Ich
war furchtbar nervös.»
Ganz anders jedoch die Zeilen über Griechenland und den Strandurlaub, in welchem der besagte Sohn wohl gezeugt worden ist. Da spricht der Vater «göttlich» und wesentlich lyrischer:
«Die dunklen Haare wurden heiss wie eine Herd- platte und mit weissen Zähnen strahlten wir uns an,
küssten uns mit sandigen Lippen und waren die Ersten und Einzigen. Eine Perle fing sich in ihren Brauen,
wir schwitzten. Das Salz der Erde an einem Strand voller Touristen. In der Schweiz war es nie so göttlich wie damals
in Griechenland.»
Der WaldWas geschah nun nach der Hochzeit? Was hat es
mit der Sonne, die «krebserregend» ist, und den feh-lenden Sonnenbrillen auf sich? Will dieser Text über-haupt direkt eine Botschaft vermitteln oder geht es vielmehr um ein kafkaeskes Bild, bei dem nicht klar ist, ob es nun die Götter sind, welche die Fäden in der Hand halten, oder doch das Paar – Magdalena und der Vater –, welches ein uneheliches Kind zur Welt bringt, gezeugt unter freiem Himmel bei Oliven und Wein an der Geburtsstätte von Zeus & Co.? Oder sind es schluss-endlich doch die Bienchen, welche das Leben bringen, und die UV-Strahlen der Sonne, welche es dann wie-der nehmen?
Mit Genealogien gelingt es Bachmann ein äusserst verwirrendes und anregendes Gedankenlabyrinth zu erschaffen, welches aber nur auf den ersten Blick auf-lösbar scheint. Denn jeder Pfad führt tiefer in den Wald des Unverständnisses. Immer mit der Hoffnung, dass man in den schicken Sätzen und schönen Bildern ei-nen tieferen Sinn entdeckt, um den Finger darauf hal-ten und sagen zu können: «Da! Da ist der Wendepunkt! Da kommt die wirkliche Einstellung des Vaters zuta-ge». Dieser Punkt kommt nicht, was vielleicht auch die Leistung des Textes ausmacht. Bei Themen wie Religi-on, Geburt und Existenz ist es schwierig und daher lo-benswert, für einmal nicht die Welt erklären zu wollen. Schliesslich führen alle Wege ans Ziel – tiefer in den Wald hinein.
CONRADIN ZELLWEGER

Rein
reden
40
Doppelt verklärte Literatur«Wozu Literaturkritik?», wollte Fabian Schwitter am 4. Mai im Café Zähringer an der Podiums-
diskussion zu Kritik im delirium wissen. Und die einhellige, vermessene Antwort von uns Kritiker- Innen der zweiten Ausgabe war natürlich: «Ohne Literaturkritik keine Literatur». Geschrieben und gelesen wird zwar auch ohne Kritik, aber solange sich in das libidinöse Verhältnis zwischen den Schreibenden und ihren imaginierten LeserInnen bzw. zwischen den Lesenden und der sich in der Lektüre konstituierenden AutorInnengestalt nicht die störende dritte Instanz der Kritik schiebt, ist alles Literatur oder gar nichts Literatur – was auf dasselbe hinausläuft. Erst durch die Anerkennung der Möglichkeit, sich darüber zu verständigen, was Literatur ist und was nicht, also Unterscheidungen zu treffen, deren Verbindlichkeit über den Augenblick hinausweist, eröffnet sich der soziale Raum, in dem Literatur überhaupt erst stattfinden kann.
Womit freilich noch nichts darüber gesagt ist, wie sich die Instanz der Kritik institutiona- lisieren soll. Ist die Literaturkritik ein akademisches Handwerk, ist sie Aufgabe der Kultur - JournalistInnen oder ist sie dem Literaturbetrieb und damit den Verlagen zu überlassen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass jede und jeder immer schon KritikerIn ist, und es nur darauf ankommt, das Ausüben dieser Rolle zu kultivieren? Experimente wie delirium stehen im Span-nungsfeld zwischen dem prekären Versuch, der Autorität herkömmlicher Institutionen die eine oder andere kleine Nebenöffentlichkeit entgegenzusetzen, und dem Umstand, dass solche Unterfangen immer schon auf die bestehenden Institutionalisierungen zurückverweisen.
Jedenfalls versuchten sich im delirium bis anhin nur (angehende) AkademikerInnen in der Literaturkritik. Dies mag am Produktionsumfeld des Magazins liegen oder aber auch am erforder- lichen Mut, sich frischer Texte ohne verlässliche Rezeption überhaupt anzunehmen. Wie dem auch sei: Vor dem Hintergrund der nicht unproblematischen, aber spannenden Anlage der Lite-raturkritiken im delirium stellten sich uns an der Podiumsdiskussion vor allem Fragen in Bezug auf das Kritisieren als Form des Schreibens. Wie sich aus dem akademisch strukturierten Duktus lösen? Wie Voraussetzungsreiches weglassen, ohne zu banalisieren? Welche Sprache zu welchem Publikum sprechen? Und wie zaubert man überhaupt so etwas wie Verbindlichkeit her- bei, wenn alles zur Disposition steht: institutioneller Rahmen, diskursive Selbstverständnisse und wer überhaupt zum «Wir» der Verständigung gehört?
«Narren, die den Verfall der Kritik beklagen.», lästert Walter Benjamin in einer Notiz mit dem Titel Diese Flächen sind zu vermieten und doppelt gleich nach: «Denn deren Stunde ist längst abgelaufen. Kritik ist eine Sache des rechten Abstands. Sie ist in einer Welt zu Hause, wo es auf Perspektiven und Prospekte ankommt und einen Standpunkt einzunehmen noch möglich war». Benjamin negiert damit radikal, dass eine je eigene Distanz zum Gegenstand der Kritik überhaupt noch verhandelt werden könnte. Zeugt der Wille zur Literaturkritik heutzutage also bestenfalls noch von Inkompetenz!? «Die ‹Unbefangenheit›, der ‹freie Blick› sind Lüge, wenn nicht der ganz naive Ausdruck planer Unzuständigkeit geworden», belehrt uns Benjamin.
Diesbezüglich mögen uns auch Sebastien Fanzuns Notizen zur Zweifelhaftigkeit des literarischen Programms vom letzten delirium auf die Sprünge helfen: «Theoretiker des Poststrukturalismus und Dekonstruktivismus haben genügend Text dazu produziert». Weil sich der «Strom der Bedeutungen […] nicht nach Belieben kanalisieren» lässt, sollte man das mit dem Unterscheiden zwischen «guter Kunst» und «schlechter Kunst» vielleicht besser sein lassen, meint er. So kann an die Stelle von Kritik und programmatischer Selbstkritik der rechtschaffen-geschäftige «Wille zur Gestalt» treten, mit den beiden für ihn einzig denkbaren Imperativen: Schreiben! Lesen!

Rei
nre
den
41
Den Prozess des Verhandelns können wir dann getrost der unsichtbaren Hand überlassen. Deren Produktions- und Konsumimperative sind bekanntlich von nicht zu unterschätzender Authentizität: «Der heute wesenhafteste, der merkantile Blick ins Herz der Dinge», schreibt Benjamin, «heisst Reklame». Diese «reisst den freien Spielraum der Betrachtung nieder und rückt die Dinge […] gefährlich nah uns vor die Stirn». Eine kritische Distanz zu den Sachen ist nicht mehr möglich, seit wir nicht mehr selbstständig über deren Präsenz bestimmen können; seit uns die Dinge als Plakate, Werbeprospekte und Reklame auf den Leib gerückt sind. Permanent sind wir von begehrenswerten Objekten umgeben, die sich uns in verführerischer Aufmachung darbieten. Auch was unter «Literatur» gehandelt wird, ringt dergestalt um unsere Aufmerk- samkeit: zur Ware fetischisiert. An die Stelle der Literaturkritik tritt die Rezension, die fürs je- weilige Zielpublikum massgeschneiderte Konsumempfehlung.
Aber was macht den merkantilen Fetisch so viel begehrenswerter als das entzauberte Resultat von Produktionsverhältnissen? Diese Frage stellt Benjamin rhetorisch und antwortet darauf gleich selbst in gewohnt kryptischer Manier: «Was macht zuletzt Reklame der Kritik so überlegen? Nicht was die rote elektrische Laufschrift sagt – die Feuerlache, die auf dem Asphalt sie spiegelt». Nicht die Abbildung des Objekts in der Werbung verführt uns, sondern seine gedoppelte, verschleiernde Spiegelung. Erst die beiläufige Projektion der Dinge auf die emotionale Folie des menschlichen Begehrens brennt sie uns ein. Im Vorübergehen, ehe wir auch nur mit uns selbst über unseren inneren «Spielraum der Betrachtung» hätten verhandeln können.
Und müssen. Die doppelte Verklärung der Literatur ermöglicht uns, sie als Gut zu geniessen, gänzlich losgelöst von aller hinter ihr stehenden Arbeit. Schreibarbeit, Verlagsverhandlungen, Lektorat, all die ausgehandelten Kompromisse bis zur Publikation, ganz zu schweigen von der Ver- teilung materieller Überschüsse, welche die Literaturproduktion überhaupt erst ermöglicht – all das verschwindet in einem Dunstkreis, den wir höchstens noch als künstlerisch befeiern wollen. Schliesslich macht dies alles viel einfacher: Mythos AutorIn, Projektionsfläche für die individuellen Kontingenzen frei strömender Bedeutsamkeit. Bloss: Man ahnt, dass es nicht solche Selbstbespiegelungen sind, zu denen das Begehren, von dessen Stachel die Kunst getrieben wird, befreit sein wollte.
DALIBOR SUCHANEK UND DOLORES ZOE
…Jedenfalls versuchten sich im delirium
bis anhin nur (angehende) AkademikerInnen in der
Literaturkritik…

Rein
reden
42
Vor dem Laden ist ein SchildVor dem Laden ist ein Schild: Früchte und Konfitüren. Ich gehe hinein. Die Frau im Laden ist ein wenig rabiat, sie packt mir eine Riesenmelone ein. Was ist das, sage ich, Apfel sagt sie, das ist ein grosser Apfel. Sie packt ihn in Papier. So das wär‘s, sagt sie. Ich möchte gern noch die Konfitürenabteilung sehen, sage ich, denn draussen auf dem Schild stand: Früchte und Konfitüren. Die Frau nimmt einen gusseisernen Schlüssel von der Kasse und öffnet die Tür zum Lift. Der Lift ist gross, wie ein ganzes Zimmer gross, er hat sogar zwei Fenster, dazwischen steht in krakeligen Buchstaben Lift geschrieben.
Die Tür schmatzt zu, der Lift fährt hoch und die Frau rollt die Augen nach oben und summt ein kleines Lied. Dann fängt der Lift an zu drehen, so, dass wir schräg stehen, und ich muss mich an der Wand festhalten, damit ich nicht umfalle. Auch die Frau hält sich fest und wir fallen trotzdem, denn der Lift steht jetzt auf dem Kopf und dreht immer noch. Die Frau drückt die Hand an die glatte Wand, wie ein Matrose bei Seegang, und summt immer noch. Dann rummst der Lift auf, und wir stehen wieder gerade.Wir steigen aus. Wir stehen unten am Hügel, oben das Dorf mit dem Früchteladen. Vor uns ein kleines Haus. Hier sind die Konfitüren, sagt die Frau. Es tut mir leid, aber wenn wir sagen, dass der Lift das Haus verlässt, dann möchte keiner mehr Konfitüren. Ja, sage ich, das verstehe ich gut.
MICHELLE STEINBECK
…Die Frau im Laden ist ein wenig rabiat, sie packt mir eine Riesenmelone ein…

Rei
nre
den
43
In and outSiehe – links und rechts des schmalen Wegleins, auf dem wir hier schreiten, hat es viel wüstes
Gelände: Liegt nicht links das Gestrüpp des nur für andere Schreibens – und rechts der Schlafmohn des nur für sich Schreibens?
Denke: Ganz anständig – oder unumgänglich – meinen wir manchmal, sei es! – für andere zu schreiben, ganz von uns abzusehen, uns nur daran haltend, was bekanntermassen gefällt. Winkt uns doch (oh Ehrgeiz) Glanz und Glitter der Welt. Dann wieder – trunken ab uns selbst – schreiben wir nur für uns, meinen, niemanden beachten zu müssen, und beschränken uns eitel auf das, was uns in den Kram passt. Was kümmert die Welt!
Bei uns selbst und bei den anderen reden wir – wohlgemerkt – nicht von Einzelnen. Sagen wir: Es sind stets Leute, für die geschrieben ist. Schreiben wir für uns, dann schreiben wir für die Unsrigen, die Gleichgesinnten, für wer uns verstünde. Schreiben wir für die anderen, dann für Leute, mit denen wir wenig teilen, für diejenigen, die uns fremd sind, die unser Schreiben zu verbiegen und verwässern drohen, oder es verknorzen und versalzen.
Sind wir aber notwendig besser dran, wenn wir nur für uns schreiben; wenn wir für ein ‹kreatives Umfeld› denken, dem wir schon angehören; für eine Klasse, eine Szene, in der man sich bald und gern kennenlernt? Haben wir es zwangsläufig besser mit uns selbst? Droht nicht die Gefahr, es uns zu früh und zu gerne in einem geistigen Ghetto gemütlich zu machen und dann zu behaupten: Das - hier - ist - die - Welt?
Wahrscheinlich sind wir, wie alle, vor solcher Bequemlichkeit nicht gefeit. Und, zugegeben, es stellt keine Heldentat dar, hier zu hadern. Doch gerade wir sollten uns an Orten wie diesem fragen: Wer kann von sich behaupten, sein Text würde an einer Kilbi, in einem Fussballstadion, vor einer Dönerbude auf Gegenliebe stossen? Oder, was entgegnen wir Tolstoi, wenn er in Was ist Kunst (1889) schreibt: «Erklären! Was erklären sie [die Kritiker; M.M.] denn? Der Künstler hat, wenn er ein wahrer Künstler ist, durch sein Werk die von ihm empfundenen Gefühle übermittelt»?
MANUEL MÜLLER
…Wer kann von sich behaupten, sein Text würde an einer Kilbi, in einem Fussballstadion, vor einer Dönerbude auf
Gegenliebe stossen?…

44
Die BesserwisserFüller contra Schwitter
Füller: Ich muss grinsen: Erst war die Hausmetapher nur auf das delirium bezogen, jetzt reden wir von der Literatur als Haus. Wir müssen aufpassen, dass wir da nichts vermischen. Du sagst, es geht darum, Leute mit Leidenschaft in dieses Haus zu holen, die dieses Haus be- wohnen. Welches Haus? Das delirium oder die Literatur?
Schwitter: Es geht ja nicht um einen Gemischtwarenladen, da bin ich völlig einverstanden. Wenn Literatur relevant sein soll, dann brauchen die Texte eine Öffentlichkeit, die über das Amazon-Rating hinausgeht, egal wie gering die Reichweite ist. Da treffen sich «die Literatur» und delirium. – Meinetwegen: delirium ist die Keimzelle des zukünftigen Odeons in Zürich. So, und nun können wir über den Anstrich des Hauses diskutieren – einige mögen es lieber dezent beige bis grau, andere ziehen rot vor. Dann steht natürlich die Frage im Raum, ob ein roter Einband schon ein gutes Buch ausmacht – ohne zu sagen, dies sei bei einem schwarzen Einband der Fall.
Füller: Ich glaube, da kommen wir jetzt zu einem interessanten Punkt, zwischen der Suche nach Öffentlichkeit und dem, was du den Anstrich des Hauses nennst. Worum soll es gehen? Soll mit neuem Anstrich nur einmal mehr der Versuch unternommen werden, die bürgerliche Öffentlichkeit wiederzubeleben? Literarische Öffentlichkeit heisst immer auch bürgerliche Öffentlichkeit, ausser es handelt sich um eine Gegenöffentlichkeit. Und deswegen meine Frage, was ist die Haltung: Nicht nur von delirium, sondern auch der AutorInnen heute. Denn wenn die Haltung sich bloss im Anstrich zeigt, wird sie zur Farce: sie bleibt Fassade, sie blättert schnell ab, und sie kann je nach Lage umgetüncht werden. Ich glaube gerade dieses Lamento gegenüber der Literatur ist Ausdruck einer Problemstellung, bei der die Kunst noch der alten bürgerlichen Öffentlichkeit hinterher hechelt, obwohl diese nicht mehr existiert. Hier wäre eine mutige Haltung angebracht, die über die Literatur hinaus blickt. Oder anders aus- gedrückt: Wir sollten nicht Literatur-Häuser entwickeln wie Projektmanager und diese hübsch und konsumentenfreundlich ausrichten, sondern die Häuser besetzen und zu revolutionären Keimzellen machen, um es jetzt platt entlang dieser Hausmetapher auszudrücken.
Schwitter: Das Problem: Es gibt nur konservative Politik heute – hüben wie drüben, links wie rechts. Und wenn Literatur einmal politisch war, so hat sie sich heute genau deshalb in die reine Ästhetik geflüchtet. Politik taugt heute wenig. Was also tun? Es geht doch nicht um die bürgerliche Öffentlichkeit. Es geht um Öffentlichkeit überhaupt. Mein Problem: Ich sehe diese ganze Geschichte mit dem Bürgertum zu wenig deutlich. Aber mit Keimzellen kann ich mich auf jeden Fall anfreunden. Insofern hat delirium durchaus sein Potenzial, auch wenn mir die Revolu-tion zumindest in unseren Breitengraden und in unserer Zeit suspekt ist. Es geht um ... scheisse, mir fehlt das Adjektiv, nicht klandestine, aber so ähnlich... Räume – ich will ja auch nicht bei der erstbesten Gelegenheit weit über Zürich hinaus expandieren. Die internationale Facebook-Realität ödet mich an. Aber wo ist jetzt die Literatur?
Füller: Ich weiss, ich wiederhole mich, aber die Frage ist nicht: Wo ist Literatur? – Diesen Begriff können wir hinter uns lassen. Die Frage ist, was für ein «Haus» ist delirium? Der Begriff «Literatur» zaubert eine Vorstellung her, die eine bürgerliche Öffentlichkeit voraussetzt. Alles

45
kann Literatur sein, wir leben in postmodernen Zeiten und müssen das anerkennen. Was uns aber bleibt, ist uns zu fragen, was für eine Haltung wir einnehmen. Nicht Politik – Achtung – sondern Haltung. Nochmals: Was für ein Haus wird hier mit dem delirium aufgebaut, wie wird es belebt, in was für einer Nachbarschaft befindet es sich, wie verhält es sich. Denn darum geht es: um die gesellschaftlichen Verhältnisse und wie man sich in ihnen positioniert. delirium hat hier meiner Meinung nach einen tollen Ansatz, nämlich den der Kritik, die mit gedacht wird und mit enthalten ist. Aber es exponiert sich auch einer Gefahr, nämlich bloss ein weiteres belangloses Magazin zu werden für angehende Autoren, die nichts weiter wollen als Erfolg und hier eine Publikations- möglichkeit sehen. Selbst Scheisshaussprüche können mit viel Witz und Sprengkraft formuliert sein, aber ohne Verständnis um die Verhältnisse und ohne eine Haltung kann selbst die talentierteste Autorin keinen Scheisshausspruch hinkriegen. Die Frage also: Was will die Literatur hier in diesem Magazin?
Schwitter: Natürlich lassen wir die Frage hinter uns, die war auch eher rhetorischer Art. – Nach meinen neusten Studien ist delirium ein urdemokratisches Konstrukt, d.h. es steckt insofern eine demokratische Haltung hinter dem Haus: Die Türen sind offen. Wer etwas zu sagen hat, der sage etwas: Etwas. Wozu das führen wird, weiss ich nicht. Das ist ja gerade das Demo- kratische. Ich bin kein kommunistischer Fünfjahresplaner, der sagen kann, wohin die Reise geht. Ganz im Sinne des Films La haine: Wir nähern uns dem dritten Stockwerk – Jusqu‘ici tout va bien. Selbstzitate nur in diesem Kontext: «delirium ist ein Experiment – nirgends wurde das deutlicher als in den Teilnahmebedingungen, die von literarischen Autorinnen und Autoren neben ihren eigentlich Texten zusätzlich Essays verlangten. Kaum ein Essay traf ein. Aus redaktioneller Sicht also ein glorios gescheitertes Experiment – ansonsten hochinteressant. Die Parameter müs-sen angepasst werden. Ein Experiment muss schliesslich irgendwie funktionieren. Wie es funk-tioniert und was dabei herauskommt: eine legitime Frage.» (delirium N°02 ) – So, Karten auf den Tisch, Füller: Worauf willst du hinaus, du sokratischer Geburtshelfer?
…Wenn wir Dürrenmatt anschauen, dann erweist es sich ja eben: Noch der fetteste, vollste Bauch hindert nicht daran, streitlustig
zu sein…

Rein
reden
46
Füller: Hehe, «sokratischer Geburtshelfer» gefällt mir. Worauf ich hinaus will? Dass die Autoren streiten. Dass es um etwas geht. Dass es um mehr als bloss Literatur geht. Ich glaube das ist nicht zu viel verlangt. Was meinst du?
Schwitter: Ganz deiner Meinung. Aber da liegen verschiedene Stolpersteine im Weg. Eine Rezeptur: 1. Probleme müssen sich ergeben – besonders in einem Land der vollen Bäuche. 2. Eine Kultur des Streitens muss etabliert werden, sofern sie verlernt wurde – besonders in einem Land der vollen Bäuche. 3. Um die nötige Leidenschaft zu entwickeln, ohne sich gleich meta-phorisch oder auch nicht die Köpfe einzuschlagen, braucht es das nötige Vertrauen ineinander – besonders in einem Land der vollen Bäuche. – Auch wenn ich den literarischen Fettwanst der Nation, Friedrich Dürrenmatt, sehr schätze, schaffen wir den Weg zurück in die Kronenhalle und zu den Disputen zwischen ihm und Frisch wohl nicht. Ganz abgesehen ist das auch nicht wün-schenswert. Hinweg mit aller Nostalgie: «Tut dies fort, schafft dies hinweg!»
Füller: Da gebe ich dir nur auf halbem Wege recht. Wenn wir Dürrenmatt anschauen, dann erweist es sich ja eben: Noch der fetteste, vollste Bauch hindert nicht daran, streitlustig zu sein. Ich würde es nicht auf die gesellschaftlichen Umstände abwälzen, wenn die Leute sich um eine Haltung drücken und nicht streiten möchten. Es ist ihre eigene Saftlosigkeit, ihre Mutlosig- keit. Es ist nicht ihre Sattheit, es ist Feigheit, jung zu sein und sich mit der Welt, wie sie ist, zufrieden zu geben.
Schwitter: Da bin ich voll d‘accord. Aber wenn die Ziele eben klar sind, geht es um die Wahl der richtigen Mittel. Ich langweile mich zu Tode, wenn immer nur lamentiert wird. Geduld, Geduld – ich bin gerade dabei, einen Rosengarten anzulegen.
Füller: Dann sind wir einer Meinung, wunderbar! Literatur muss streiten, muss ins Leben eingreifen wollen, sonst ist sie feige. Wie siehst du das denn in den Beiträgen im delirium, ist das vorhanden?
Schwitter: Nun sind wir wieder am Anfang, d.h. bei der Binnenperspektive. Sag du es mir, dann kann ich immerhin davon ausgehen, dass du die ersten beiden Ausgaben wirklich gelesen hast ;)

Veranstaltungen
Sag es, wie du willst!
Offene literarische Bühne:
Sa, 25. Oktober im Rahmen von «Zürich liest»
So, 23. November
So, 21. Dezember
Jeweils ab 21.00 Uhr im Café Zähringer, Zähringerplatz 11, Zürich
delirium im Karl
Di, 18. November, 20.00 Uhr: Instant Poetry
Bringt eure Laptops mit wir generierenzusammen im Minutentakt Gedichte
Do, 18. Dezember, 20.00 Uhr: Kritiker-Stammtisch
An alte und neue KritikerInnen:Wir diskutieren über Kritik im delirium – zu Wurst und Bier
Anmeldung erforderlich!
Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14, Zürich
Infos: www.delirium-magazin.ch
Ende März 2015: delirium N°04!
Ver
anst
altu
ng
en
47

HocherfreutHocherfreut
Liebes delirium, willkommen im Redaktionszimmer von Karl der Grosse. Aktuelles Programm: www.karldergrosse.ch
Werb
un
g
48

Imp
ress
um
Herausgeber:Verein deliriumBremgartnerstr. 808003 Zürich
Redaktion:Fabian SchwitterLaura BassoSamuel Prenner
Layout:Mauro SchönenbergerCaptns & Partner GmbHwww.captns.ch
Illustration:Mélanie Tannerwww.melanietanner.com
Fotografie Cover:Pius BacherCaptns & Partner GmbHwww.captns.ch
Auflage: 500
Druck:Basisdruck AGSchulweg 63013 Bern
Kontakt:[email protected]/Magazindelirium
Beitragende:Meret Bachmann Demian BergerAlbrecht Füller Mareike HaaseTatiana Hirschi Dominik Holzer János MoserManuel Müller Samuel PrennerOrlando SchneiderFabian Schwitter Michelle SteinbeckDalibor Suchanek Conradin ZellwegerDolores Zoe
Impressum
49

Werb
un
g
50


MEHR WURST!Du kannst es besser?
Wirf die Wurstmaschine an und schick uns deinen literarischen Text bis am 31.Dezember 2014 an:
So gewinnst du:Bezug zu Vorgängerausgaben!max. 15‘000 Zeichen, deutsch
Bezug zu Vorgängerausgaben!?
Gefragt sind künstlerische Antworten auf die bereits angeregten Diskussionen in den
Ausgaben N°01 bis N°03.
MEHR SENF!delirium braucht scharfe Meinungen. Wenn
du kritikfähig bist, melde dich für eine Bratwurst:
52




![International Journal of Hematology Research€¦ · BD) - amentia, epileptiform exaltation, delirium, delusional disorders[3,12,13,14]. V.I.Maksimenko (1967) observed 2 cases of](https://static.fdokument.com/doc/165x107/605f3573a4122e5a080b9225/international-journal-of-hematology-research-bd-amentia-epileptiform-exaltation.jpg)