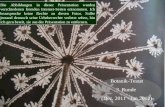Der Dialog in Pharmazie, Chemie und Botanik: Zum Anteil einer literarischen Gattung in der...
Transcript of Der Dialog in Pharmazie, Chemie und Botanik: Zum Anteil einer literarischen Gattung in der...
BerWissGesch 3, 23-34 (1980)
Guido Jüttner
Der Dialog in Pharmazie, Chemie und Botanik
Berichte zur WISSENSCHAFTSGESCHICHTE c Akademische Verlagsgescllschaf'l 19Hil
Zum Anteil einer literarischen Gattung in der Darstellung, Vermittlung und im Unterricht der Naturwissenschaften 1
Summary: The use of dialogue in scientific writing is for many reasons, as also L. Thorndike and R. Multhauf have mentioned, worth to investigate. This treatise concerning dialogues on pharmacy, chemistry, botany and also on medicine tries a classification and gives several interpretations of these important sources for the history of sciences, which in some disciplines were rather neglected in historiography for many reasons. One of these may be the difficulty to distinguish in this form of Iiterature the poetical fiction from reality, the traditional topoi from contemporary controversies. The different aims of the dialogue, teaching, conversation, scientific discussion and also satirical intentions give the determination for the several literary forms of those colloquies, which have been important for progress and communication in sciences.
Schlüsselwörter: Alchemie, Apologie, Botanik, Chemie, Colloquium, Dialog, Fachliteratur, Lehrschriften, Medizin, Pharmazie, Polemik, Satire, Wissenschaftsvermittlung, XVI Jh, XVII Jh.
Die Form des Dialoges2 als eines der Antike entstammenden literarischen Mediums hat in der Medizin und Chemie nicht eine derart spektakuläre Rolle gespielt bei der Formulierung und vor allem Verbreitung und damit auch Popularisierung neuer Erkenntnisse wie in der Physik, physikalischen Astronomie und Kosmologie. Hier sind vor allem Galileis Gespräch über zwei Weltsysteme (1632), seine Unterredung über zwei neue Wissenszweige (1638), dazu die Dialoge Giordano Brunos und lange zuvor, ftir die Entwicklung der quantifizierenden Wissenschaften bedeutsam, des Nicolaus von Cues ldiota de staticis experimentis (1450) zu nennen.
Zwar ist Robert Boyles Sceptical Chemist (1661) in literarischer Anlage und Durchfuhrung vergleichbar, wobei er sich mehr auf Cicero, Galilei mehr auf Plato beruft, doch waren die Auswirkungen, bedingt durch Art und Entwicklungsstand seiner Wissenschaft, der Chemie, bescheidener. In dialogischer Auseinandersetzung werden hier wie dort die aristotelische Weitsicht, die Vier-Elementenlehre, bei Boyle noch dazu die spagyrischen Prinzipien 3 in Frage gestellt und von Galilei das ptolemäische Weltbild gänzlich überwunden. Galilei hatte eine von Copernicus und Kepler zuvor mathematisch begründete These vorzutragen, die ob ihrer theologisch-politischen Brisanz intensiv beachtet und von den bekannten Reaktionen der Kirche gefolgt war. Boyle dagegen hat zwar die bis-
24 Guido Jüttner:
herige Elementenlehre und damit die Basis der Alchemie aufgrund seiner Vorstellung einer aus antikem Vorbild modifizierten Korpuskulartheorie und seinem Experimentbegriff fur ungenügend erklärt, doch war fur die Formulierung neuer Vorstellungen die Mathematisierung und Physikalisierung der Chemie noch nicht weit genug fortgeschritten.
In der Medizin sind zuvor und später halmbrechende Neuerungen meist in Form von Einzelabhandlungen und systematisierenden Darstellungen vermittelt worden4
• Die gleichwohl auch hier überaus reichl1altige Dialogliteratur hat dagegen entweder mehr didaktischen Charakter, oder sie bietet eine Fülle von gelehrten Erörterungen zu medizinischen Autoritäten der Antike und des Islam im Hinblick auf philologische Fragen, auf Identifizierung und Vergleich der materia medica. Die Dialoge haben somit oft lehrhaften oder aber gelehrt-kommentierenden Charakter. Die etablierte Hochschulmedizin hat im allgemeinen weniger den polemischen und den apologetischen Dialog genutzt, sondern akademische Lehrformen, wie quaestio 5 und disputatio, zu Dialogen ausgeformt und sich im übrigen des Traktates, des Kommentars und der epistola zur Vermittlung iluer Inhalte bedient6•
Grenzbereiche, sowohl neue Theorien in anerkannten Disziplinen, als auch neue, aus der reinen Empirie und techne aufstrebende Wissenszweige, öffnen sich leichter der lebendigen, oft streitbaren dialogischen Vermittlung, wie die Pharmazie, die durch die Drogen der Neuen Welt erweiterte materia medica, Mineralienkunde, Montanistik und die Chemiatrie. Die Autoren sind auch hier zumeist Mediziner. Die praktische und die spekulative Alchemie hat dazu noch mittelalterliche Dialogformen - iluem Charakter entsprechend - bis ins 17. J aluhundert statisch gepflegt, während sie andererseits iluen Gegnern häufig Anlaß zum Gebrauch des scherzhaft-satirischen Dialoges zu iluer Bekämpfung geboten hat.
Auffallend ist der von L. Olschki7 und anderen festgestellte hohe landessprachige Anteil der naturkundlichen Dialoge. Dies diente jedoch nicht nur zur Popularisierung schon etablierter Wissenschaft, sondern zeigt in vielen Fällen auch den Praktiker, der unter Aufteilung des Stoffes auf Gesprächspartner, in Scheindialogen, zur Verständnishilfe sein Wissen in einfacher Weise vennittelt. Die vielfältigen Formen des Dialoges, der Erörterung, finden sich also gerne da, wo Wissenschaften aus ihrer akade1nischen Enge ausbrechen oder wo ein Fach aus zuvor handwerklichem Tun oder allgemein akademischer Ferne emporstrebt, expandiert. Sie finden sich auch bei der Entstehung neuer Theorien und der Verunsicherung alter Vorstellungen, in überzeugungs- und in Verteidigungshaltung, im Humanismus, Arabismus, in der Chemiatrie und der Alchemie. Im 17. und 18. J aluhundert wird diese Gattung jedoch seltener. Der Titel des Werkes von W. Ong über Ramus weist auf die Gründe: Method and decay of dialogue: From the art of discourse to the art of reason 8• Mit Descartes ist die dialogische Erörterung durch die folgernde Abhandlung, durch die Mathematisierung und später die Formelsprache zurückgedrängt worden.
In der Theoriendiskussion der expandierenden Physik wird heute wieder auf den Dialog als einer zutiefst humanen Form der Darstellung und Vermittlung, unter anderem von Werner Heisenberg9
, zurückgegriffen. Im Dialog steht der Mensch im Vordergrund; die Waluheit wird sokratisch erfragt oder in didaktischen Schritten faßbar gemacht, oder es werden einzelne Theorien gegeneinander abgewogen; der Prozeß des intellegere wird nachvollzogen. Dieser ist wesentlich als Erkenntnisprozeß, mit dem das Erkenntnisziel greifbar wird 10• Das Individuum, das sich nicht inm1er unvermittelt mit diesem Ziel zu verbinden vermag, wird im dialogischen Prozeß zu diesem Ziele hin geformt. Der über-
Der Dialog in Pharmazie, Chemie und Botanik 25
Zeugungscharakter des echten Dialogs ist in Krisenzeiten in der Literatur der Wissenschaft, Politik und Religion gerne und oft genutzt worden. Zudem hat ihn seine spezifische Kunstform gelegentlich zur literarischen Mode, wie vor allem in der Renaissance, werden lassen.
Der Dialog, zwischen Poetik und Dialektik stehend und damit auch individuell und mitunter leidenschaftlich, hat in der Antike Ethik vermitteln helfen, in der Renaissance neue Sozialstrukturen mit der Popularisierung, aber auch Infragestellung etablierter Wissenschaften gestützt, er hat im Humanismus die Auseinandersetzung der Gelehrten nachgezeiclmet und in der Reformation mit Leidenschaft die volkstümliche Bewegung getragen. Dies ist vielfach in zeitgenössischer Theorie, etwa bei Sigonius, Tasso und Speroni 11
,
in Bezug auf Klassifizierung und literarische Möglichkeiten abgehandelt und in der Literaturgeschichte seit Ende des 19. J aluhunderts im einzelnen untersucht worden 12•
Hiervon abzugrenzen sind die rein katechetischen Texte, die Frage- und Antwortsammlungen, die auch gerade in Pharn1azie und Chemie reichhaltige Repetitorienliteratur 13•
Diese der quaestio nal1estehenden und aufgrund der heutigen Prüfungspraxis wieder auflebenden Examinatonen enthalten zwar rudimentär didaktische, entwickelnde Inhalte der Lehrgespräche, doch nur in dem Ralunen gesicherter Definitionen, so daß sie am eigentlichen Wissenschaftsprozeß nicht teilnehmen lassen.
In Dialogform, aber mit statischem, deskriptivem Charakter wurden in Pharmazie, Botanik und Mineralogie auch die sogenannten Kataloge verfaßt Sie haben nicht die Dynamik des sokratisch-philosophischen, noch die des satirisch-mimischen, auf Lukian basierenden Gesprächs. Der Ausgewogenheit in der Exposition der Meinungen in den convivia und colloquia des Cicero entnehmen sie nur formale Strukturen, wie prologus und scenarium. In den Aufzählungen wird nicht ein Gegner überzeugt oder eine didaktische Auswalll getroffen, auch selten eine Theorie entwickelt. Sie fassen meist neue Errungenschaften oder naturkundliche Entdeckungen wie Pflanzen, Mineralien und auch Heilmittel zusammen und könnten auch in anderer Form dargeboten werden, wie in dem im Mittelalter und dann wieder im Barock so beliebten Lehrgedicht 14 oder in der Epistel, im Sendschreiben. Die Dialogform ist hier eine mehr zufillige, ein Vorbild oder eine Tendenz nachahmend, und kann in den Bearbeitungen und übertragungen wieder entfallen, wie dies durch Carolus Clusius ( 1526-1609) in seiner lateinischen übersetzung von Garcia da Ortas Dialogen mit der Begründung der übersichtlichkeit, Straffung und der Vermeidung von Wiederholungen auch geschehen ist15
•
In der Vielfalt der Dialogformen nimmt das Zweiergespräch (Zwiegespräch) einen großen Raum ein 16. Als colloquium ("Zusmensprechung", 16. Jahrhundert) ist die Gattung zusammengefaßt; das soliloquium, seit Augustinus bekrumt und in der Alchemie wieder aufgegriffen 17
, verlagert den Dialog ins Innere. Das Streitgespräch (conflictus, Contrasti, Debat, Tensons, altercatio ), im Mittelalter als Streitgedicht 18 im Dialog zwischen Objekten (Pflanzen, Körperteilen) und Allegorien häufig, ist in der Reformationszeit wieder beliebt und bringt neben seinem Weiterleben in der Alchemie auch eine pharmazeutische Variante hervor, in der ein theologischer conflictus vom sachkundig allegorisierten Apothekeninventar ausgehandelt wird 19.
Die Alchemie mit dem Problem, das Unreine vom Reinen im weitesten Sinne zu scheiden oder es in letzteres zu überfUhren, zu transmutieren, ist zumindest seit dem 14. Jahrhundert mit Rupescissa auch auf der Heilmittelsuche nach der Quinta Essentia, der Panacee, dem Aurum potabile. Sie bewahrt eine eigene dialogische Tradition, bis ilu im 18. J aluhundert unter anderem mit der Entdeckung des Sauerstoffs und damit mit dem Ende der Phlogistonlehre der letzte spekulative Hintergrund aristotelischer Naturphilo-
26 Guido Jüttner:
sophie gänzlich entzogen worden ist. Sonderformen sind der Gelehrtenkonvent, die Turba, die auf die Deipnosophistai des Athenaios und andere Symposionliteratur in arabischer Tradierung zurückgeht und die szenarisch reichen, auf arabische Lehrschriften und Fabeln21 verweisenden Gespräche zwischen Morienus und Calid22
, Rhazis Cestrensis und Merlin und die Dialoge der Maria Judaea, Aegytiaca oder Prophetissa; sodann zeigt das alexandrinisch-alchemistische Corpus eine frühe Tradition des dialogischen Textkommentars. Ansonsten herrscht zunächst aber die knappe dialogische Aufbereitung von quaestiones und Lehrinhalten durch die Verteilung auf magister-discipulus, senex-iuvenis (filius) mit Gebetsfloskeln in Pro- und Epilog vor. Monologisch steht daneben der Lehrbrief mit kurzer Anrede.
L. Thorndike 23, der den literarisch ausgeformten naturkundlichen Dialog im Mittelalter mit Adelard von Bathund Wilhelm von Conches im 12. Jahrhundert ansetzt und für das 14. und 15. Jahrhundert sieben Dialoge behandelt, verweist auf die steigende Zahl dieser Lehrgespräche, von denen er im 16. Jahrhundert, als einem Kulminationspunkt, 26 aufzählt. Auch die hermetische Literatur und ihre mittelalterliche Tradition, die die magischmedizinischen virtutes der drei Naturreiche miteinbezieht, bedient sich häufig der dialogischen Form24• üblicher noch als in anderen Bereichen sind in der Alchemie seit dem 14. Jahrhundert Pseudoepigraphien zur Autoritätsmehrung. Ein Beispiel sei die Bearbeitung eines Werkes von Rupescissa (Je an de Roquetaillade) im Dialogus Monaldi Monachi ac Raymundo (Incipit: Contristatus erat Raimundus). Dieser Dialog war handschriftlich als De secretis naturae sive de Quinta Essentia libellus weitverbreitet und ist seit 1518 (Augsburg) mehrfach gedruckt worden. Als interlocutor (Gesprächspartner) findet sich Raimundus Lullus auch im Dialog Lignum vitae (1542) des Giovanni Bracesco, der in einem weiteren kommentierenden Dialog auch Geber auftreten läßt25• Ursprünglich landessprachige Fassungen, auch diejenige des Bracesco, sind ebenso wie pharmakagnostisch-botanische Dialoge des 16. Jaluhunderts- bald nach ihrem ersten Erscheinen latinisiert worden. Eigentümlich ist der bewußte Rückgriff auf die Vielfalt der Literaturformen des Mittelalters in den späten alchemistischen Dialogen und deren Einkleidung in visio und somnium. Ein Tatbestand, der in der heutigen Historiographie der Alchemie gelegentlich Erwähnung findet 26, ohne daß jedoch der wenig beachtete, gleichwohl aufschlußreiche frühe Versuch von H. Kopp27, eine Klassifizierung nach Gattung und literarischer Einkleidung zu finden, weiter fortgesetzt worden wäre. Albertsen 28 stuft den genannten stilistischen Rückgriff, ohne die Möglichkeit einer gewachsenen Tradition zu sehen, als klassizistisch und damit artifiziell, rezeptiv und formal ein, als Aufstülpung esoterischer Form auf Nichtssagendes. Damit wird allerdings auch übersehen, daß in diesen späten Dialogen, als Prolog oder als Recapitulatio, direkt oder metaphorisch der Extrakt oft weitschweifiger Abhandlungen geboten wird. Der Geschichtsschreibung der literarischen Gattung geht es, soweit Alchemie behandelt wird, mehr um den Kampf und die Satire gegen die Alchemie als verbreiteten literarischen Topos29 .
Kampf und Spott gegen die Alchemie haben sich nämlich seit der Aufforderung der ratio an die spes, den Traum der Transmutation aufzugeben, in Petrarcas Remediis utriusque fortunae (1366) bis hin zu dem 1524 in die Colloquia familiaria des Erasmus von Rotterdam eingefugten Alcumista und weiteren Dialogen bis ins 18. Jahrhundert eine eigene dialogische Form gegeben. Einerseits ist es der Dialogo didattico-polemico, also etwa die überzeugungeines erfolglosen Goldmachers zur echten Naturuntersuchung, andererseits und häufiger der Dialogo scherzo-satirico, die Widerlegung und Verspottung alchemistischer Betätigung30 .
Für eine Untersuchung der eigentlichen alchemistischen Dialoge sind die literaturge-
Der Dialog in Pharmazie, Chemie und Botanik 27
schichtliehen Arbeiten hinsichtlich der verschiedenen poetischen Gattungen des Mittelalters allerdings noch nicht genügend herangezogen worden 31 . Dies ist jedoch notwendig, um neben einer genauen Analyse der Textstruktur Zugang zu den hier auch in späterer Zeit auftretenden Gesprächsformen des certamen, altercatio, conflictus, disputatio, "Redekrieg", der Objektdialoge, der fmgierten Prozesse, des iudiciums und der Einkleidung, wie der Allegorie, des Rätsels, des somnium und der visio, im Gefolge von Hennoch, Ciceros Somnium Scipionis, von Prudentius und Martianus Capella zu erhalten 32.
Erklärenden, einfuhrenden Charakter, als Exposition, zeigt der der Preciosa margarita novella ( 1546) vorangestellte Dialogus nuncupatorius zwischen Lacinius und Petrus Bonus33. Als Dialogus scholasticus bezeichnet Christopher Horn sein eherniatrisches Werk De auro (1615). Kommentarcharakter haben des Bracesco erwähnte Gespräche. DerDialogus apologeticus dagegen behandelt zum einen die technischen und praktischen Errungenschaften der Alchemie und setzt sich von der Goldmacherkunst ab, wie dies im Chrysorrhoas oder Gülden Fluß (um 1560)34 geschieht, wo Paracelsus selbst als interlocutor mit dem Gesprächspartner Chrysophilus auftritt35. Andererseits tritt der Dialogus apologeticus wie de~jenige des Thomas Moffet (Muffet) De iure et praestantia chymicorum medicamentorum ( 1548) fiir Cherniatrie, für Paracelsus, gegen Arabismus und Galenismus ein36. Gleiches beabsichtigt ein von Benedictus Figulus 1608 herausgegebener Dialog zwischen Alexander von Suchten und einem interlocutor namens Bernhard 37.
Neben Dialogen über einzelne Substanzen, wie drei Dialoge De auro von Abraham a Porta Leone im 16. Jahrhundert, kommen auch in rni ttelal terlicher Weise, dem Dialogus membrarum oder Certarnen Rosae et Liliae vergleichbar, einzelne Substanzen, in anderen die Natur und die Götter zu Wort: Handschriftlich ist im 15. Jahrhundert eine Disputatio auri et mercurii verbreitet. Aegidius de Vadis wird ein Dialogus inter Naturam et filium Philosophiae (1521) zugeschrieben. Von Sendivogius (1556-1636) wird 1607 der Dialogus Mercurii, Alchemistae et Naturae, als dessen Autor Alexander Seton gilt, veröffentlicht38. Ist die Natur hier Schlichterin eines Streites, so wird sie zur Anklägerin in Remontrances ou la campZainte de Nature a l'Alchymiste et ResponsedeL 'Alchymiste a Nature, welcher Dialog in die Fortsetzung des Rosenromans des Jean de Meung eingefügt- sich als Demonstratio Naturae bald verselbständigt und in deutscher Fassung als Wasserstein der Weisen (1609) erscheint. Eine vergleichende Analyse des Naturbegriffes in diesen Dialogen wie auch in des Paulus Niavis (siehe unten) Werk steht noch aus. Gericht, iudicium und Streit zeigt der erst spät (1680) gedruckte Ritterkrieg des Johann Sternhals, und zwar zwischen Gold (Sol) und Eisen (Mars) vor Mercurius, während der 1604 anonym erschienene Uralthe Ritterkrieg (Disputatio SoZiset Mercurii cum Lapide Philosophorum) es direkt zum Kampf zwischen den Kontrahenten kommen läßt 39. Sendivogius erneuert zusätzlich zu einem Dialog zwischen Senior und Adolphus den Visio-TraumgesichtTopos zwischen einem Philosophus und Saturn beziehungsweise einer Vox in einer Recapitulatio seines Sulphur-Traktates (1613 und 1644). Diese Gesprächspartner hat auch Mylius 1622 eingeftihrt40. Der seit dem "Morienus" beliebte gelehrte Mönch oder Einsiedler (vgl. Anrn. 22) findet sich auch im Gespräch Alberti monachi Carmelitensis cum Mercurio (1658), ediert von einem "Filius Sendivogii", welches von Johann Joachim Becher im Chymischen Glückshafen (1682) gleichfalls veröffentlicht worden ist. Grasshoff (Grassaeus und als Pseudonym Hermann Condeesyanus)41 hat verschiedene Dialoge veröffentlicht. Ihm selbst werden allegorische Gespräche zwischen Chernist und Bauer als Der Große und Der Kleine Bauer zu Beginn des 17. Jahrhunderts zugeschrieben. Alchemistische Vorstellungen finden sich auch in den Dialogen des J ohann Rudolf Glauber (1603-1670)42, der in seinem Libellus dialogorum von drei Chemikern die Herstellung
28 Guido Jüttner:
und Wirkung von Universalmedizinen oder -tinkturen erörtern läßt. Rezeptanleitungen zu den verschiedensten Medizinen hat Francesco Gerosa in La magia trasformatrice (Bergamo 1608) in Gesprächen zwischen Ioconda, Tristano und einem Chimisimplio abgehandelt. Bei Glauber findet sich aber auch die spätmittelalterlichen Arzneibüchern oft vorangestellte oder ganz in die Struktur integrierte Frage-Antwort-Form, indem er den ftinften Teil seiner Pharmacopoea Spagyrica (Amsterdam 1663) in diese katechetische Form faßt. J ohann Placotomus hat diese Form (ebenfalls zu Ausbildungszwecken, "in usum tyronum") in seiner Pharmacopoea in compendium redacta (Antwerpen 1560) schon angewendet.
Während sich diese Literatur in Werken nach Art von Hermbstädts Katechismus der Apothekerkunst bis zu heutigen Examinatorien fortsetzt, sind die Dialoge von G. Roussel Les secrets descouverts (1618)43 und von D. AudaPractica dei Spetiali in dialoghi (Venedig 1674) echte Unterrichtsgespräche mit apothekarischem Szenarium. In diese pharmazeutische Ausbildungsliteratur ist von Anfang an die entwickelnde Frage didaktisch integriert, die in dem naturkundlichen Schulunterricht trotz der pädagogischen Erneuerung mit den Schülergesprächen seit dem 16. Jahrhundert kaum zu finden ist. Nach W. Schöler sind ftir den naturwissenschaftlichen, speziell chemischen Unterricht erst im 19. J aluhundert Gesprächsmodelle eingeftihrt worden, gegenüber dem bisherigen umständlichen Memorieren wechselnder naturkundlicher Systeme44.
Die bekannten umfangreichen Dialoge des 16. Jahrhunderts über Materia medica und Pharmazie sind dagegen als lateinische Humanistendialoge gelehrte, meist von Medizinern verfaßte Literatur, Neben dem naturkundlichen Inhalt wird vor allem die literarische Kunstform durch wechselndes reiches Szenarium, Digressionen und scherzhafte Einschübe zur Belebung der wissenschaftlichen Materie gepflegt. Das unterhaltende Element wird in den Dienst der Belehrung gestellt45 • Des Euricius Cordus lebendige Auseinandersetzung von Empirie und Autopsie mit den Autoritäten in seinem Botanologicon ( 1534 )46 ist hier zu nennen, ebenso wie des Georg Agricola Bermannus (1530), in dem sich der Praktiker Bermannus mit den Medizinern Ancon, einem Arabisten und Naevius, einem den antiken Autoritäten mehr zugewandten Humanisten, über den Bergbau, aber auch über die medizinischen Indikationen und über die Nomenklatur der Mineralien unterhält47. Zum montanistischen Aspekt seines lateinischen Dialoges konnte Agricola auf des Ulrich Rülein von Calw deutsches Berg- und Probierbüchlein48 mit dialogischem Pro- und Epilog zwischen einem Daniel und einem Knappins zurückgreifen. Bekannt war ihm auch des Paulus Niavis Iudicium Iovis49, in dem die visio eines Eremiten mit dem Prozeß-Topos als Klage der Erde gegen das Bergwerk des Menschen -nach Art der Göttergespräche des Lukian -vereint sind. Das Werk des Cordus hat des Carolus Figulus 50 dialogischen Botanomethodus (Köln 1540) beeinflußt. Figulus hat in gleicher Form eine Ichthyologia verfaßt; zoologischen Inhaltes ist auch des Gybertus Longolius (Gisbert Longueil, 1507 -43) Dialogus de avibus.
Bedeutenden Einfluß auch ftir die Wahl der Dialogform ftir pharmazeutische und botanische Themen haben die umfangreichen lateinischen Dialoge examina betitelt - des Arztes Antonio Musa Brasavola (1500-1555) aus Ferrara51. Die einzelnen Heilpflanzen werden als Simplicia und als Composita, die verschiedenen Arzneiformen, unter anderem Sirupe, Electuaria, öle, Pillen, Pulver, Pflaster, Salben "quorum usus in publicis est officinis", ihre Zubereitung und Literatur in mehreren Dialogen mit wechselndem Schauplatz, oft in einer Apotheke abgehandelt und besprochen. Die Unterredung wird mit einem senex geftihrt, in einzelnen Dialogen kommt ein herbarius, in anderen ein pharmacopolus hinzu. Zum Teil von Brasavola beeinflußt, wie Garcia da Orta in seinen Colloquios (1563)
Der Dialog in Pharmazie, Chemie und Botanik 29
bezeugt, ist die Dialogform der gleichzeitigen und späteren pharmakagnostischen Literatur über Heilpflanzen der Neuen und der Alten Welt, deren Autoren zunächst Spanier und Portugiesen gewesen sind. Verbreitet wurden diese Werke vor allem durch die lateinischen Übersetzungen und Bearbeitungen des Carolus Clusius52, der die ursprüngliche Dialogform zugunsten einer systematischen und übersichtlichen Abfolge aufgab. Nicolaus Monardes führt in der Pharmacodilosis (1536) Gespräche mit einem Ambrosia boticario (Apotheker) über Drogen der Neuen Welt 53. Christobai Acosta berichtet über Heilpflanzen unter anderem aus Mozambique und Indien 54• Garcia da Orta55, der Hospitalarzt des Vizekönigs von Goa und Gründer des Botanischen Gartens in Bombay, berichtet in seinen Gesprächen von indischen Pflanzen, aber auch von einigen amerikanischen Drogen wie Tabak und Guajak. Auf Garcia bezieht sich in animadversiones nahezu hundert Jahre später J acobus Bontius, der seine Mitteilungen über indische Heilkunde, De conservanda valetudine, in Dialoge mit Andreas Duraeus einkleidet56• In die Flora Vorderasiens fuhren die Dialoge des Prosper Alpinus 57, der in De plantis Aegypti (1592) seinem Lehrer und Direktor des Botanischen Gartens in Padua, Melchior Wieland (Alpinus wurde auch sein Nachfolger), seine in Ägypten erworbenen Kenntnisse der materia medica mitteilt. In De Balsamo wird Prosper von einem aegyptischen und einem hebraeischen Arzt in Kairo über Art, Zubereitung und Indikation dieses Heilmittels belehrt 58.
Der auf Cicero zurückgehende Topos des locus amoenus für derartige Gespräche wird in den botanischen Dialogen meist durch das viridarium, den grünen Garten, Park, oder auch in einzelnen Fällen mit einem Botanischen Garten gegeben.
In ähnlicher Umgebung, in horto Academico aedibus, im viridarium, aber auch in seinem chemischen Universitätslaboratorium handeln die Dialoge des Apothekers und Chemikers Johann Conrad Barchusen59 in seiner Historia Medicinae (1710). Zum Professor der Chemie innerhalb der medizinischen Fakultät in Utrecht ernannt, hat er an dieser Universität dieses Fach in eherniatrischer Ausrichtung durch praktische Laboratoriumsausbildung als auch durch seine Schriften erst eigentlich eingefuhrt und ausgebaut, olmejedoch das bekannte Leydener Vorbild zu erreichen. Dem Anspruch einer Historia Medicinae sucht er in sorgfaltiger Diskussion der chronologisch abgehandelten medizinischen Theorien und Schulen gerecht zu werden. Seiner Ausbildung und Tätigkeit gemäß, nimmt in den neunzehn Dialogen die Iatrochemie, die Diskussion der Werke von Paracelsus, Severinus, Croll, Helmont, Tackenius, Sylvius und anderer einen großen Raum ein und bildet eine wertvolle Quelle zum Selbstverständnis dieser Schule zu einem um die Wende zum 18. J aluhundert ···· schon relativ späten Zeitpunkt. Das Werk schließt mit einer ausführlichen Diskussion der Theorien von Georg Ernst Stahl, die dieser erstmals in seiner Zymotechnia (1697) vorgetragen hatte. Der Quellencharakter wird dadurch vermehrt, daß Barchusen fast ausschließlich Personen aus seinem Bekannten- und Kollegenkreis, unter ihnen Boerhaave (Bourhavius), zu Worte kommen läßt. Daher bemüht er sich auch, wohl um keine Schwierigkeiten mit seinen Kollegen zu bekommen, die (sicher nicht vollständige) Fiktion seiner Dialoge in der Widmung hervorzuheben:
Neminem itaque ex caeteris Ieetoribus arbitror adeo stupidum fore ut si fortisan aliquid erroneum vel incongruens invenerit in his Dialogis dictum, id imputet ci quem introduxi loquentem, sed mihi, velim, si forte ullo in loco erratum est, imputet tantum.
FünfJahre später hat Barchusen, offenbar um das Verständnis fur die Dialog-Struktur der Historia zu vertiefen, in einer theoretischen Abhandlung De dialogo conscribendo, die Argumente der ihm gut bekannten Dialogtheoretiker des 16. J ahrhunderts 60 vorgetragen und sie insbesondere auf die Darstellung naturkundlicher Themen erweitert61
.
Doch dieser Versuch der Wiederbelebung des Dialoges als eines Mediums der Vermittlung
30 Guido Jüttner:
naturwissenschaftlicher und medizinischer Thematik mußte scheitern, da diese Fächer schon längst andere Formen ihrer Darstellung gefunden beziehungsweise erweitert hatten62.
1 Bei diesem Aufsatz handelt es sich um die durch den Anmerkungsteil erweiterte, im übrigen wenig verände1ie Fassung des Vortrages, den der Verfasser auf dem Symposium über "Medien und Formen der Wissenschaftsvermittlung" der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte im Mai 1979 in Berlin gehalten hat.
2 Einbezogen wurden Gesprächsformen im weiteren Sinne, auch in ihrer Reduktion auf katechetische Literatur, die der Quaestio nahesteht. Somit wurde ein Rahmen, der vom Dialog bestimmte poetische Strukturen und eine echte Dialektik fordert, nicht streng eingehalten. Die Untersuchung vieler dieser Schriften als Quellen zur Wissensr-haftsgeschichte steht noch aus. Amegungen hierzu für die Chemiegeschichte gibt R. P. Multhauf: Some Nonexistent Chemists of the Seventeenth Century. Remarks on the Use of Dialogue in Scientific Writing. In: A. G. Debus and R. P. Multhauf: Alchemy and Chemistry in the Seventeenth Century. Papers read at a Clark Library Seminar. University of California Los Angeles 1966, S. 31-50. Sein Ziel formuliert Boyle im Titel der lateinischen Ausgabe (1668) dieses Gespräches zwischen dem Aristoteliker Eleuterius und dem Skeptiker, dem nur dem Experiment vertrauenden Carneades (andere, gleichwohl eingeftihrte Partner kommen nicht zu Wort): "Chymista scepticus vel Dubia et Paradoxa chymico-physica circa spagyricorum Principia, vulgo dicta Hypostatica, prout proponi et propugnari solent a Turba Alchymistarum." Vgl. R. P. Multhauf (wie Anm. 2), s. 40.
4 Vgl. W. Artelt (a): Die Experimente des 17. Jahrhunderts und der Strukturwandel der Medizinischen Literatur, in: Il metodo sperimentale in Biologia da Vallisneri ad oggi. Padova 1962. Zur Ikonographie mittelalterlicher Dialog- und Disputationsszenen vgl. W. Artelt (b): Die Quellen der mittelalterlichen Dialogdarstellung. (Kunstgeschichtliche Studien 3) Berlin 1934. Aus der Fülle der medizinischen Dialoge seien erwähnt: Bassiano Landi: Dialogus, qui Barbaromastix, seu Medicus inscribitur. In: Novae Academiae Florentinae Opuscula. Venedig 1533, S. 2-23; J. Dantzius: De simplicium medicamentorum facultatibus. Basel, 1543; J. Guinther von Andernach: De Medicina Veteri et Nova Faciunda Commentarius secundus (8 Dialoge). Basel 1571; A. F. Bertini: La Medicina Difesa Dalle Calunnie Degli Uomini Volgari, E Dalle Opposizioni De Dotti. Lucca 1699; vgl. L. Thorndike: A Glimpse of seventeenth century medicine. Annals of Medical History N. S. 6 (1934), S. 124-27. Auch ärztliche Consilia wurden gelegentlich in Dialogform veröffentlicht, wie z.B. des Paulus de Sorbait: Pestconsilium. Wien 1681 und 1701.
5 Vgl. Brian Lawn: The Salernitan Questions. Oxford 1963. 6 Vgl. W. Artelt (wie Anm. 4a). 7 L. Olschki: Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Literatur. Bd 1 Heidelberg 1919,
2 Leipzig 1922, 3 Halle 1927. Insbesondere Bd 2: Bildung und Wissenschaft im Zeitalter der Renaissance in Italien (Reprint Vaduz 1965), S. 301--331: Die Formen der wissenschaftlichen Darstellung. Vgl. auch A. Buck: Der Beitrag des Renaissance-Humanismus zur Ausbildung des naturwissenschaftlichen Denkcns. Marburger Sitzungsberichte 87 (1966) Heft 2, S. 33-45; derselbe: Die humanistische Tradition in der Romania. Bad Homburg/Berlin 1968.
8 W. Ong: Method and decay of dialogue: From the art of discourse to thc art of reason. Cambridge, Mass. (1958).
9 W. Heisenberg: Der Teil und das Ganze. Gespräche im Umkreis der Atomphysik. München (dtv) 1973; G. Jaffe: Drei Dialoge über Raum, Zeit und Kausalität. Berlin 1954; J. M. Jauch: Die Wirklichkeit der Quanten. Ein galileischer Dialog. München 1973.
10 Vgl. H. Gundert: Der Platonische Dialog. Heidelberg 1968; und als Standardwerk vor allem für den Dialog in der Antike R. Hirzel: Der Dialog. 2 Bde, Leipzig 1895 (Reprint Bildesheim 1963).
11 C. Sigonio: De Dialogo Liber (1562), in: Opera omnia. Milano 1737; T. Tasso: Discorso dell'arte del dialogo (1586), in: T. Tasso: Prose. Edit. E. Mazzali. Milano/Napoli 1959, S. 331-346; S. Speroni: Apologia dei dialoghi (1596), in: Opere. 1, Venedig 1740.
12 Vgl. E. Norden: Die antike Kunstprosa. Vom 6. Jahrhundert vor Christus bis in die Zeit der Renaissance. Leipzig 1898; M. Grabmann: Geschichte der scholastischen Methode. 2 Bde, Freiburg (1911); G. Niemann: Die Dialogliteratur der Reformationszeit. (Probefahrten 5) Leipzig 1905; 0. Gewerstock: Lukian und Butten. (Germanische Studien 31) Berlin 1924; W. Lenk
Der Dialog in Pharmazie, Chemie und Botanik 31
(Hrsg.): Die Reformation im zeitgenössischen Dialog. Berlin 1968; G. Wyss Morigi: Contributo allo Studio del Dialogo all'Epoca dell'Umanesimo e del Rinascimento. Monza 1950 (Tesi, Bern 1947); Ch. H. Herford: The literary relations of England and Germany in the sixteenth century. Cambridge 1886; E. Merill: The dialogue in English literature. (Yale studies in English 42) New York 1911; R. Wildbolz: Der philosophische Dialog als sprachliches Kunstwerk. Sprache und Dichtung77 (1952); G. Bauer: Zur Poetik des Dialogs. Darmstadt 1969.
13 Als Beispiele seien genannt: S. F. Hermbstädt: Katechismus der Apothekerkunst oder die ersten Grundsätze der Pharmazie ftir Anfänger. Berlin 1792; W. Artus: Repetitorium und Examinatorium über pharmazeutische Waarenkunde. Weimar3 1856; W. Artus: Repetitorium und Examinatorium der pharmazeutischen Chemie. Weimar 1858; A. Casselmann: Die Analyse des Harns in Frage und Antwort. Gießen 1874; W. Zimmermann: Die pharmazeutische Vorprüfung in Fragen und Antworten. Stuttgart 2 1944; 0. K. Linde/H. J. Knigge: 1000 Fragen Pharmazie. Frankfurt 2
1971. 14 Vgl. L. L. Albertsen: Das Lehrgedicht. Aarhus 1967; A. M. Schmidt: La poesie scientifique en
France au XVIe siecle. Paris 1938. 15 Garcia da Orta: Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium histo
ria ... latino sermone in Epitomen contracta a Carolus Clusius. Antwerpen 1567, S. 5: "Latinum itaque eum feci, atque in Epitomen contraxi, paulo forsitan commodiore ordine singula componens, quam ante fuerant, atque nonnulla etiam rejiciens quae non multum ad rem facere videbantur. Nam cum singulis fere simplicibus suum dialogum adscripserit, et ordinem alphabeticum sequutus sit noster auctor; multa illum suo loco haud apte reponere et pleraque repetere necesse fuit, ut fere in Dialogis contingere solet." Die erste, portugiesische Ausgabe der Colloquios von Garcia erschien in Goa 1563. .
16 Statt es von dialegesthai (auseinandersetzen) abzuleiten, deutet es das Mittelalter gelegentlich als dy-alogos (Zwie-gespräch) und bildet je nach Anzahl der Teilnehmer Trialog, Tetralog, Heptalog oder Dodekalog. Vgl. R. Hirzel (wie Anm. 10) Bd 1, S. 2-6.
17 Ph. Ferne!: Soliloquium Salium. Neapel1649. 18 H. Jantzen: Geschichte des deutschen Streitgedichtes im Mittelalter. Germanistische Abhandlun
gen 13 (1896); H. Walther: Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters. München 1920 (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters 5,2).
19 Dialogus oder gesprech des Appostolicums Angelica und anderer Specerey der Appotecken Antreffen Doctor M. Lutters ler und sein anhanck. o.O., o.J.; W. D. Müller-Jahnke: Die Apotheke als Schauplatz eines Reformationsdialoges: Zu Ulrich Boßlers "Dialogus oder Gesprech ... " von 1521. Beiträge zur Geschichte der Pharmazie 27 (1975), Nr. 2, S. 9-12 (Beifage der Deutschen Apotheker-Zeitung). - Simplicia, wie u.a. die Radix Angelica und Composita, wie das Unguentum apostolicum diskutieren ftir und wider Luthers Lehre und andere theologische Streitpunkte. Der beliebte Topos des "belauschten Gespräches" wird auch hier genutzt.
20 Vgl. M. Plessner (Hrsg. F. Klein-Franke): Vorsokratische Philosophie und griechische Alchemie. Studien zu Text und Inhalt der Turba Philosophorum. Wiesbaden 1975; J. Martin: Symposion. Die Geschichte einer literarischen Form. Studien zur Geschichte der Kultur des Altertums 17 (19 31).
21 Vgl. R. Reitzenstein: Alchemistische Lehrschriften und Märchen bei den Arabern. Gießen 1923 (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 19,2), S. 63-86.
22 Das Lehrgespräch des Einsiedlers Morienus mit Calid, dem Omajadenprinzen Khalid Ibn Jazid, ist bis ins 13. Jahrhundert zurück zu verfolgen. Vgl. L. Stavenhagen: The original text of the latin Morienus. Ambix 17 (1970), S. 1-12; R. Reitzenstein (wie Anm. 21), S. 67-73.
23 L. Thorndike: A history of magic and experimental science. Bd 1-7, New York/London 1923-1958 (Bd 6, 1941, S. 583).
24 Vgl. R. Reitzenstein: Poimandres. Leipzig 1904 (Repr. Stuttgart 1966). In diesem Zusammenhang sei auch auf die "Gespräche der sieben Weisen" verwiesen, wie u.a. die Fassung des Jean Bodin: Colloquium Heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis. 1592/93 (gedruckt 1875).
25 G. Bracesco: Demogorgon. Venedig 1544; Lignum Vitae. Venedig 1542. Diesen italienischen Originalen folgen bald lateinische und später deutsche Fassungen. Vgl. W. Brechthold: Dr. H. Wolff. Med. Diss. Würzburg 1959.
26 Vgl. A. E. Waite (a): The secret tradition in alchemy. London 1926; derselbe (b): Lives of the alchemistical Philosophers. London 1888; J. Read (a): Humour and Humanism in chemistry. London 1947; derselbe (b): The Alchemist in Life, Literature and Art. London 1947, sowie die zahlreichen Arbeiten von A. G. Debus.
32 Guido Jüttner:
27 H. Kopp: Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit. 2 Teile, Heidelberg 1886 (Reprint Hildesheim 1971); Teil 2, S. 308~396: Anhang. Beitrag zur Bibliographie der Alchemie. (Zu Rätsel, Visio und Somnium S. 350~54).
28 L. L. Albertsen (wie Anm. 14), S. 73. 29 Vgl. die in Anm. 12 und 14 genannten Autoren, sowie G. Carbonelli: Sulle fonti storiche della
chimica e dell' alchimia in Italia. Rom 1925. 30 Gefolgt wurde der Einteilung von G. Wyss Morigi (wie Anm. 12): Dialoglu insegnativi (D. didat
tici veri e propri; D. didattico-polemici); Dialoghi piacevoli (rappresentazioni di ambiente); Dialoghi scherzo-satirici; Dialoghi affine alle commedie.
31 Vgl. Anm. 12. 32 Vgl. M. Voigt: Beiträge zur Geschichte der Visionenliteratur im Mittelalter. Leipzig 1924; J. Mar
tin (wie Anm. 20); I. B. Friedreich: Geschichte des Rätsels (1860). 33 J. Lacinius stellt diesen auch ,Colloquium nuncupatorium' genannten Dialog seiner Bearbeitung
und Ausgabe (Venedig 1546) des Werkes des Petn1s Bonus (ca. 1335) voran. Vgl. Ch. Crisciani: The conception of alchemy, as expressed in the Pretiosa Margarita of Petrus Bonus. Ambix 20 (1973), s. 165~181.
34 In G. Gratarolus: Verae alchemiae artisque metallicae ... doctrina. Basel 1561, Pol. 5v~8r. In anderer Fassung: Chrysorrhemon sive de arte chemica dialogus. Hanau 1565 und 1593. Im Theatrum chemicum 2 (Straßburg 1659, S. 139 ff.) fälschlich unter die Schriften des Bernard Penot eingereiht. Deutsche Fassung in: Aureum vellus oder guldin Schatz und Kunstkammer. Rarschach 1598; und in Th. Caesar: Aleherny-SpiegeL Darmstadt 1613. Vgl. G. Jüttner: W. Gratarolus B. Aretius. Naturwissenschaftliche Beziehungen der Universität Marburg zur Schweiz im sechzehnten Jahrhundert. Diss. Marburg 1969, S. 254~300.
35 Für die Untersuchung der damaligen Einschätzung des Paracelsus und seines Werkes ist die wohl einmalige Interlocutor-Fiktion des Hohenheimers wertvoll.
36 In diesem 1584 in Frankfurt erschienenen Dialog wird ein Philerastus (Thomas Erasthus hatte in einer 1572 ebenfalls als Dialog erschienenen Disputatio de nova medicina Parace/si die Chemiatrie scharf angegriffen) von einem Chemista allmählich überzeugt und zu einem Philalethes geläutert. Vgl. A. G. Debus: The Paracelsian Compromise in Elizabethan England. Ambix 8 (1960), S. 88~93; M. E. Welti: Englisch-baslerische Beziehungen zur Zeit der Renaissance in der Medizin, den Naturwissenschaften und der Naturphilosophie. Gesnerus 20 (1963), S. 125~126.
37 In: Pandora magnalium naturalium et benedicta. Straßburg 1608, S. 49~111. Das Werk enthält auch posthume Arbeiten von Suchten. Vgl. W. Haberling: Neues aus dem Leben des Danziger Arztes und Dichters Alexander von Suchten. Archiv fiir Geschichte der Medizin 24 (1931), S. 117 --123; A. E. Waite (wie Anm. 26), S. 260~63.
38 M. Sendivagins (Sensophax, Sedziwoj): Novum Lumen Chymicum. Prag 1604. Der Dialog wurde in die Ausgaben Köln 1607 und Paris 1608 aufgenommen. Der Topos des Alchemistenkonvents wird hier aufgegriffen: "In illo tempore convenerunt chemistae et consilium fecerunt". Von Benedictus Figulus ist er als Colloquium hermetico-spagyricum 1770 in dessen "Neue Sammlung von einigen alten und sehr rar gewordenen Schriften", Bd 2, herausgegeben worden. Der im Folgenden erwähnte Dialog im Sulphur-Traktat schließt in der Übernahme handelnder Personen an obigen Dialog an. Vgl. E. Ostachowski: Michael Sendivogius, the Polish alchemist. Archives Internationales d'Histoire des Seiences 33 (1954), S. 267~75; Vgl. A. E. Waite (wie Anm. 26), S. 242~245; St. J. Linden: Jonson and Sendivogius, some new light on "Mercury vindicated from the alchemists at court" Ambix 24 (1977), S. 39~54.
39 Vgl. H. Buntz: Die europäische Alchemie vom 13. bis zum 18. Jahrhundert, in: Alchimia. Ideologie und Technologie. Hrsg. von E. E. Ploss/H. Roosen-Runge u.a. München 1970. (Zu Sternhals S. 173~ 75); vgl. H. Buntz: Deutsche alchimistische Traktate des 15. und 16. Jahrhunderts. Diss. München 1968.
40 J. D. Mylius: Philosophia reformata. Frankfurt 1622 (Der Dialog zwischen Philosoph, Schüler und Saturn: S. 317~356).
41 J. Grasshoff: Arcani artificiosissimi aperta arcana ... Frankfurt 1617. 42 J. R. Glauber: Libellus Dialogorum oder Gespräch-Büchlein. Amsterdam 1663, Vgl. K. F. Gugel:
Johann Rudolph Glauber. Leben und Werk. Würzburg 1955. 43 G. Roussel: Les secrets descouverts des Arts, tant de Pharmacie que celuy de Distiller, vulgaire
ment nomme Alchemie, ou Spargirie. Paris 1618 (Entre-parleurs, le maistre et l'aspirant en la maistrise de Pharmacie). In dieser Dialogtradition steht noch "Ein Gespräch pharmazeutische Gegenstände betreffend" zwischen "Albert" und einem "Denker" in J. B. Trommsdorffslournal der Pharmazie 1,2 (Leipzig 1794), S. 1~24, welches von Trommsdorff selbst stammen könnte.~
Der Dialog in Pharmazie, Chemie und Botanik 33
In gebundener Form, Lehrgedicht und Merkvers vereinend, erschien 15 37 das pharmazeutische Lehrbuch von Thibault Lepleigney (auch Du Bois de l'Espine): Promptuaire des medicines simples en rhythme joyeuse.
44 W. Schöler: Geschichte des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Berlin 1970, S. 168-171. 45 Das delectare war schon immer eine Forderung an die Dialogform. So weisen die deutschen Titel
auch oft darauf hin: "ein lehrhaft und vergnügliches (oder "unterhaltsames") Gespräch". Die naturkundlichen "Unterredungen" des 18. Jahrhunderts betonen den unterhaltenden Aspekt, in einer Zeit, die bevorzugt auch naturkundliche Themen in die Conversation einbezog. Vgl. J. F. Martinet: Katechismus der Natur. (Aus dem Holländischen nach der 4. Auflage übersetzt von J. J. Ebert) Leipzig 1779.
4 6 E. Cordus: Botanologicon. Köln 15 34. Vgl. Peter Dilg: Das Botanologicon des Euricius Cordus. Diss. Marburg 1969.
47 G. Agricola: Bermannus sive de re metallica. Basel 1530. Bearbeitung und deutsche Übersetzung von H. Wilsdorf: Georgius Agricola. Ausgewählte Werke, Bd 2, Berlin 1955.
48 U. Rülein von Calw: Ein nutzlieh bergbuchleyn. [Leipzig, ca. 1500] Augsburg 1505. Vgl. W. Piepert: Ulrich Rülein von Calw und sein Bergbüchlein. (Freiberger Forschungshefte D 7: Kultur und Technik) Berlin 1955.
49 P. Niavis (Schneevogel): Iudicium Iovis [Leipzig, ca. 1490]. Bearbeitung und deutsche Übersetzung von P. Krenkel in: Freiberger Forschungshefte D 3. Berlin 1953. Es geht hier um die Nutzungsrechte des Menschen an der Natur, auch bei der Gefahr ihrer Beeinträchtigung: Die Klagen der Erde, unterstützt durch Ceres, Nais (Quellnymphe), Bacchus, Pallas, Pluto, Charon und die Faune werden durch den Ankläger Merkur dem Jupiter vorgetragen. Der Mensch und die ihn unterstützenden Penaten werden zu ihrer Verteidigung gehört und Jupiter urteilt auf den Rat der Fortuna hin, der Mensch könne in der Nutzung fortfahren, habe aber die früheren oder späteren Folgen zu tragen. Niavis trägt mit seinen Schülergesprächen (u.a. Latinum idioma pro parvulis) zur Verbesserung der Unterrichtspraxis bei. In dem Thesaurus eloquentiae (ca. 1486) greift er auch zu montanistischen Dialogthemen. - Mit den Colloquia des Erasmus von Rotterdam, die seit 1518 in mehrfach erweiterten Fassungen erschienen sind, verläßt diese Dialogart ihren ursprünglichen, nur didaktischen Zweck und wird zur Kunstform, weitgehend von Ironie und Satire bestimmt, wie etwa im erwähnten Alcumista. Vgl. A. Bömer (a): Die lateinischen Schülergespräche der Humanisten. Berlin 1897 (Texte und Forschungen zur Geschichte der Erziehung, Bd 1); denselben (b): Paulus Niavis. Neues Archiv für sächsische Geschichte 19 (1898), S. 51 ff.
so C. Figulus: Dialogus qui inscribitur Botano-methodus sive herbarum methodus. Köln 1540. 51 Die Reihe seiner Dialoge, die mit leichten Titeländerungen mehrfach aufgelegt worden sind, be
ginnt mit dem "Examen omnium simplicium medicamentorum, quarum in officinis usus est." Rom 1536; Lyon 1537. Vgl. A. F. Castellani: De Vita Antonii Musae Brasavoli commentarius historico-medico-criticus. Mantua 1767 .; vgl. D. Duveen: Brassavohis Examination of medicinal Simples. Journal of the history of Medicine 5 (1950), S. 448; W. J. Bishop ebendort 6 (1951), S, 262; R. Schmitz: Äußerungen im 16. und 17. Jahrhundert zur Geschichte der Pharmazie. In: Festschrift flir Otto Zekert. Salzburg 1969, S. 185-201 (Salzburger Beiträge zur ParacelsusForschung H. 8).
52 Vgl. Anm. 15. 53 N. Monardes: Dialogo llamado pharmacodilosis o declaracio medicinal. Sevilla 1536. Neben ande
ren, auch medizinischen Dialogen verfaßte Monardes das 1605 von Clusius latinisierte und 1615 in Leipzig deutsch erschienene "Ein lustig und nützlich Gespräch von Stahl und Eisen, darin dieser Metallen Arztney Tugenden angezeiget werden". Vgl. F. Guerra: Nicohis Bautista Monardes. Su vida y su obra. Mexico City 1961. - Bekannt wurde er bald durch seine Arbeiten über amerikanische Pflanzen und ihre Heilkräfte: Dos libros. El uno que trata de todas las cosas que traen de nuestras Indios Occidentales (Sevilla 1565) und: Segunda parte ... (Sevilla 1572).
54 Ch. Acosta: Tractado de las Drogas y Medicinas de las Indias orientales. Burgos 1578- eine Bearbeitung und vor allem Erweiterung des Werkes von Orta (wie Anm. 55), den er auf seinen Reisen in Goa getroffen hatte; unter seinen verlorengegangenen und offenbar nicht gedruckten Werken befanden sich auch: Tres dialogos teriacales.
55 G. da Orta: Coloquios dos simples e drogas he cousas medicinais da lndia. Goa 1563. Vgl. Anm. 15.
56 J. Bontius: Historia naturalis et medicae Indiae orientalis libri sex. Amsterdam 1658 (2. Buch in Dialogen: De conservanda valetudine seu de diaeta sanorum in indiis hisce observanda Dialogi).
57 P. Alpini: De plantis Aegypti liber. Venedig 1592.
34 Guido Jüttner:
58 P. Alpini: De Balsamo Dialogus. Venedig 1591. 59 J. C. Barchusen (Barckhausen): Historia medicinae, in qua si non omnia pleraque saltem Medico
rum ratiocinia, dogmata, hypotheses, sectae etc. quae ab exordio Medicinae usque ad nostra tempora inclaverunt, pertractantur. Amsterdam 1710. Zu den weiteren Schriften vgl. 0. Hannaway: J. C. Barchusen (1666-1723)- contemporary and rival of Boerhaave. Ambix 14 (1967), S. 96-111. Die zweite Auflage der Historia erschien unter dem Titel "De Medicinae Origine et Progressu Dissertationes." Utrecht 1723. Beachtung verdient auch der umfangreiche 14. Dialog über die chinesische Medizin: Historia medicinae 1, 1710. Zur Dialogform schreibt Barebusen in der Vorrede: " ... interdum varias resquarum gratia alii ab aliis opinionum dissensione discreparunt, uno membro vel Dialogo colligavi: ut id, de quo alter, cum altero dissentit, deinceps innotesceret. Hoc factum inveniet in Dialogis, in quibus elementa, caussas, temperamenta, naturam, facultates etc. pertractavi."
60 Vgl. Anm. 11. 61 J. C. Barebusen: De Dialogo conscribendo. In: Collecta medicinae practicae generalis. Amsterdarn
1715, s. 403-405. 62 Vgl. W. Artelt (wie Anm. 4a).
Prof. Dr. Guido Jüttner Institut für Geschichte der Medizin der Freien Universität Berlin Augustastraße 37 D-1 000 Berlin 45