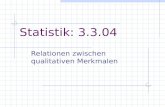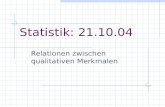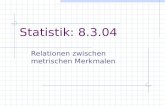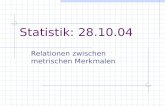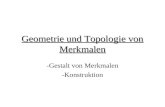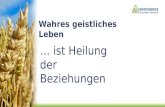Die Beziehungen der eidetischen Anlage zu körperlichen Merkmalen
-
Upload
siegfried-fischer -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of Die Beziehungen der eidetischen Anlage zu körperlichen Merkmalen
(Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik der Universit~t Breslau. Direktor: Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. Wollenberg.)
Die Beziehungen der eidetischen Anlage zu kSrperlichen Merkmalen.
Eine Kritik und Erwiderung. Von
Privatdozent Dr. S i e g f r i e d F i s c h e r (Breslau).
(Eingegangen am 19. April 1927.)
I m Jahre 1920 erschien eine Arbeit von W. Jaensch: Uber Wechsel- beziehungen von optisehen, cerebralen und somatischen Stigmen bei Konst i tut ionstypen (Vorlkufige Mitteilung) 1, in der Verf. behauptete, dab die subjektiven optischen Anschauungsbilder (AB) zu den Merk- malskomplexen zweier Konst i tut ionstypen gehSren, ni~mlich des T- (tetanoiden) und des B-(basedowoiden)Typus. Die AB, behauptete der Verf., sind optische J~quivalente der somatischen Stigmen dieser Konsti tut ionen und zeigen in ihren n~theren Eigenttimlichkeiten, je naehdem sie zum T- oder B-Typ gehSren, einen wesentlich verschiedenen Charakter. Untersuchungen yon anderer Seite ~ konnten die Ergebnisse yon W. Jaensch nicht besti~tigen. Die Widersprtiche mit seinen Ergeb- nissen fiihrte Jaensch 3 zum Teil auf Mil~versti~ndnisse zurtick, die sich daraus ergeben hatten, dal~ die Nachpriifenden sich nur auf die ,,Vor- lkufige Mitteilung" stiitzten. Nunmehr liegt ein g ro l angelegtes Werk 4 yon mehr als 400 Seiten vor, in dem die genannten Beziehungen ein- gehend besprochen und auf Grund der Ergebnisse Biotypen aufge. stellt werden.
1 Diese Zeitschr. 59. a) S. Fischer und H. Hirschberg, Die Verbreitung der eidetischen Anlage
im Jugendalter und ihre Beziehungen zu k6rperliehen Merkmalen. Diese Zeitschr. 88. 1924. - - t)) P. Karger, Die eidetische Anlage der Jugendliehen in ihrer Be- deutung ffir die Klinik und die Schulleistungen. Klin. Wochenschr. 1925, S. 2247. - - c) Leven, Die eidetische Anlage des Jugendliehen. Klin. Wochenschr. 1926, S. 271.
3 W. Jaensch, l~ber psychophysische Konstitutionstypen (einige Bemer- kungen und Richtigstellungen zu der in dieser Zeitschr. [1924] erschienenen Arbeit von S. Fischer und H. Hirschberg: t3ber die Verbreitung d. eid. An- lage im Jugendalter und ihre Beziehungen zu kSrperlichen Merkmalen). Diese Zeitschr. 97, 1925.
4 Grundziige einer Physiologie und Klinik der psychophysischen PersSn- liehkeit. Ein Beitrag zur funktionellen Diagnostik. Berlin 1926.
S. Fischer : Beziehungcn der eidetischen Anlage zu k6rperlichen Merkmalen, 681
Verf. versueht in dem vorliegenden Bueh eine Brficke zwisehen klinischer sowie physiologischer Betrachtungsweise und experimentell ermittelten Tatsachen der Psychologie herzustellen. Er geht dabei aus yon der besonders im Jugendalter zu beobaghtenden eidetischen An- lage, die sich darin manifestiert, dab das Individuum neben den Vor- stellungsbildern (VB) und Nachbildern (NB) auch fiber Anschauungs- bilder als Gedi~chtnisbilder (GB) verfiigt. Gegentiber der frfiher yore VerI. gebrauchten Nomenklatur hat es sich ihm jetzt als zweckmi~6ig erwiesen, yon h6herer oder niederer Ged~chtnisstu/e dann zu sprechen, je nachdem es sich urn ein Nachbild, Anschauungs- oder Vorstellungs- bild handelt. Von der Ged~tchtnis stu/e ist die Ausgepri~gtheit der Ph~no- mene scharf zu unterscheiden. Deshalb werden auBerdem Grade unter- schieden, die ffir alle Stufen eine gleichartige Bedeutung haben; sie driicken niimlich den Grad der Auspri~gung der Erscheinungen auf der jeweiligen Ged~chtnisstufe aus. Alle Phi~nomene hoher Ged/ichtnisstufen haben das gemeinsame Merkmal einer weitgehenden Plastizitiit, im Sinne yon Ver~nderlichkeit. Die Art, in der sich diese Ver~nderungen vollziehen, ihre n~here Beschaffenheit ist ab- h/ingig yon der Ged~chtnisstufe, nicht aber yore Grad. Man kann daher au6er der Plastizit/~t schlechthin, die nur das AusmaB der Ver- anderlichkeit bezeichnet, noch eine ,,spezifische Plastiziti~t" unterschei- den, die die ni~here Art angibt, in der die Ver~nderungen vor sich gehen und die yon der Ged~tchtnisstufe abh~ngig ist (S. 24). Die allgemeine Plastiziti~t bezeichnet also die Quantititt, die spezifische Plastiziti~t die Modalit~t der Ver/inderungen. W~hrend die letztere an die Stufe, ist die erstere an den Grad der eidetischen Phi~nomene gebunden. Die spezifische Plastititi~t wird yore Verf. bei der Feststellung des vorhandenen Grades nicht beriicksichtigt (S. 187). Andererseits nimmt die Bewegiichkeit und Ver~nderlichkeit fiberhaupt mit steigendem Grad etwas zu. Eine hochgradige Beweglichkeit und Veri~nderlichkeit ist verschieden und verschiedenen Gesetzm~tl3igkeiten unterworfen, je nachdem wires mit hochgradigen AB hSherer oder niederer Gedi~cht- nisstufen (d. h. yore ]3- oder T-Typus), also je nachdem mit welcher spezifischen Plastizit~t w i r e s zu tun haben. ])as Auftreten einer ge- wissen Beweglichkeit und Veri~nderlichkeit fiberhaupt ist kein unmittel- barer Hinweis auf den Typus, wohl aber ist die spezifische Plastizit~tt in erster Linie dutch die Ged~tchtnisstufe und damit durch den Typus bes t immt (S. 187). -- I)iese nicht ganz leicht zu verstehenden Ver- h~ltnisse sind hier ausffihrlicher und zum groBen Teil wSrtlich wieder- gegeben, da die spezifische Plastizit~t, die die besondere Art der Ver- i~nderlichkeit bei den verschiedenen Typen der eidetischen Phi~nomene kennzeichnet, sich nach Verf. zugleich als ein Kennzeichen der ver- schiedenen Biotypen erweist (S. 24).
682 S. Fischer:
Die Priifung der spezifischen Plastizit~t wird vom Verf. (S. 194) so vorgenommen, dal~ z.B. yon kompliziertea Vorlagen ein AB er- zeugt und die Vp. gefragt wird, ob sie an dem AB irgendwelche Ver- ~nderungen anbringen kSnne. Gelingt das nicht, so wird die Vp. auf- gefordert, bestimmte Ver~nderungen vorzunehmen. Schon eine solche Aufforderung oder gar eine mehrmalige ist beim B-Typus nieht er- forderiich. Bei einfachen Vorlagen hat das AB yon guter spezifischer Plastiziti~t die Eigenschaft, sieh der Form nach an gleichzeitig gegebene Wahrnehmungsinhalte anzugleichen. Aul]erdem zeigen derartige AB besonders leieht Bewegungserscheinungen (Fluxion).
Die fiir die beiden Typen charakteristisehen Merkmale der AB be- stehen, kurz gesagt, darin, dal~ die tetanoiden AB ihrem Verhalten nach den physiologisehen NB niiherstehen, wahrend die basedowoiden den VB in ihrem Verhalten in hohem Grade nahekommen. Beide Arten von AB aber werden im buchst~blichen Sinne gesehen. Neben den AB fiel auf, dab auch die NB besonders bei tetanoiden Fallen eine Ver- l~ngerung ihrer Dauer und Intensiti~t zeigten. Durch Kalkdarreichung kann die Dauer der physiologischen NB herabgesetzt werden, und zwar parallel mit dem Riickgang der somatischen Erscheinungen und der AB. Hieraus schlol~ Verf. auf die Zugeh6rigkeit auch des gesteigerten reinen NB zum tetanoiden Komplex (S. 38). Diese Wirkung des Kalkes zeigte sich auch in Misehfi~llen von B- und T-Typen. Die Untersuehungen yon Jaensch ergaben nun, da[~ die H~ufigkeit und die Ausgepri~gtheit der Merkmalskomplexe der beiden Typen innerhalb einer bestimmten jugendlichen Altersstufe mit der H~ufigkeit und der Ausgepri~gtheit der AB einen weitgehenden Parallelismus zeigt. Es konnte aber auch bei erwachseren Eidetikern der entsprechende somatische Stigmen- komplex nachgewiesen werden, wKhrend erwachsene Nichteidetiker im allgemeinen nut selten somatische Stigmen yon der Art zeigen, wie sie sieh bei ausgepri~gten Eidetikern oder latenten Eidetikern finden. Diese Stigmen zeigen sich im allgemeinen sofort wieder aueh bei Er- wachsenen, wenu sie eine ausgepr~gte oder latente eidetisehe Anlage erkennen lassen (S. 39/40).
Mit den beiden Ausdriicken basedowoid und tetanoid -- das betont Verf. ausdriicklich -- wird jedoch nie etwas Krankhaftes bezeichnet. Die Typen fassen nur Beobachtungstatsachen zusammen, die in enger Korrelation miteinander auftreten. Man k6nnte, sagt Verf., die erfah- rungsm~Big ermittelten Typen sogar mit ganz indifferenten Namen oder Buchstaben bezeichnen, die an klinische Zustandsbezeichnungen gar nieht anklingen (S. 42).
In der nun folgenden eingehenden Besprechung der Biotypen wird zun~tchst (S. 49) erwi~hnt, dab die somatischen Konstitutionsstigmen an einem gro$en Material normaler Individuen gepriift worden sind.
Die Beziehungen der eidetischen Anlage zu k6rperlichen Merkmalen. 683
Vorweg betont Verf. (S. 39, 52), dab die k6rperlichen und psychischen Phitnomene durchaus nicht immer in ihrer St~rke parallel zu gehen brauchen. Er land auch Fi~lle, in denen die sti~rkere Erregbarkeit sich nur auf optischem Gebiete auswirkte, und die doch aus entschei- denden (!) Grtinden dem gleichen somatischen Komplex zugerechnet werden muBten (S. 52).
Ausftihrlich werden dann die beiden kSrperlichen Typen besprochen, und zwar zuerst der T-Typus, die galvanische Untersuchung der moto- risehen und sensiblen peripheren Nerven, die galvanische Untersuchung des Nervus acusticus, opticus und der Geschmacksnerven, die mecha- nische Untersuchung der peripheren Nerven und der Muskelerregbarkeit, die physiognomischen und mimischen Stigmen des T-Typus und der allgemeine Eindruck der Gesamtpers6nlichkeit, schliel~lich die optischen Stigmen und die Akzidentien des T-Typus.
Bei der Untersuchung der galvanischen Erregbarkeit der peri- pheren Nerven machte Verf. zuni~chst weder einen Unterschied zwischen B- und T-Typus, noch einen solchen zwisehen h6heren und niederen Graden der eidetischen Anlage (S. 57). Es ergab sich dabei yon der jtingeren zur 51teren Jahresklasse eine ansteigende H~ufigkeit der h6heren Reizschwellen fiir die KathodenschlieBungszuckung (yon 0,5 MA ar~ und dariiber) und eine absinkende Hi~ufigkeit der niederen Reizsehwellen (0,4 MA und darunter). Absolute Zahlen werden yore Verf. auch in den folgenden Kapiteln nicht angegeben. Soweit sich aus den Angaben S. 59 und der Tabelle S. 218 entnehmen l~Bt, handelt es sich um zwei Gruppen yon Untersuchten, von denen die eine ein Durchschnittsalter yon 12,5, die andere ein solches von 18,5 hatte. Auf Grund dieser Ergebnisse formuliert Verf. : die jtingere Jahresklasse zeigt gegeniiber der ~lteren durchschnittlich einen h6heren Grad der galvanischen Erregbarkeit. -- Bei der AnodenSffnungszuckung land sich eine Erregbarkeit unter bzw. bis 5 MA bei 84,21% der jiingeren, die KOZ solcher St~rke bei 10,53 %, in der ~lteren Jahresklasse dagegen eine solche AOZ in 58,33%, eine KOZ in 16,67% (!). Diese Zahlen -- die absoluten Zahlen sind nicht angegeben -- werden im Sinne des obigen Satzes ausgewertet (?) (S. 60), obwohl die ~lteren Jahrgi~nge einen h6heren Prozentsatz einer KOZ < 5 MA zeigen als die jiingeren.
Unter Heranziehung der Ergebnisse yon Stintzing, der unter seinem Material (Altersdurchschnitt 32 Jahr) fiir die KSZ auBer der untersten Reizschwelle yon 0,6 MA einen Mittelwert yon 1,6 MA land, kommt Verf. zu dem Schlul~: ,,Nach welchem Gesichtspunkt wir auch die Individuen einer Rangordnung unterwerfen, immer ergibt sich in gleicher Weise die enge Beziehung bestimmter somatischer Erregbarkeitsver- h~ltnisse zu gewissen eidetischen Dispositionen. Stets ergibt sich dieser Parallelismus zwischen den somatischen Erregbarkeitsgraden und den
684 S. Fischer :
Zeichen der eidetischen Anlage (S. 65). Diese somatischen und opti- schen Stigmen nehmen an Haufigkeit und Hochgradigkeit parallel laufend in dem Mal~e ab, als das Alter zunimmt, um bei Erwachsenen im allgemeinen nur noch selten aufzutreten, wahrend sie sich auch hier sofort wieder zeigen, wenn sieh bei dem betreffenden Erwachsenen eidetische Anlagen nachweisen lassen (S. 66). Veff. betont, da~ sich dies bei der zusammenfassenden Untersuchung einer grSBeren Zahl yon Fallen ergibt (S. 66). Der Parallelismus der somatischen und optisehen Stigmen ist ebenso wie bei den Jugendlichen so auch bei Erwachsenen im Einzelfalle zwar nicht immer ein strenger, wohl aber tr i t t dieser Parallelismus selbst dann schon scharf hervor, wenn man z.B. eine gr5~ere Zahl erwachsener Eidetiker mit dem Durchschnitt der Er- wachsenen vergleicht. Ftir das Gros der Eidetiker aller Altersstufen ist dieser Parallelismus trotzdem deutlich. Ein Erwachsener, der die jugendliche Abwandlung der Zuckungsformel zeigt, fallt nicht in das Gebiet des Pathologischen, sondern er hat sich nur den jugendlichen Reaktionstypus bewahrt (S. 85). Die galvanisehen Erregbarkeits- stufen werden demnaeh in einen Normaltypus des Jugendalters und einen solchen des erwachsenen Lebensalters gesehieden. -- Die mecha- nische Untersuehung der Nervenerregbarkeit ergab in dem Material des Verfs. ein positives Chvosteksches Phanomen bei etwa 40% aller alteren Kinder ' (S . 98). Auch hier soll eine Parallelitat zwisehen diesem Phanomen und der eidetischen Anlage nachweisbar sein.
Zur Erlauterung der physiognomischen und mimischen Stigmen des T-Typus lehnt sich Verf. an die yon U//enheimer gegebene Schil- derung des Tetaniegesichts an. Das Gesicht macht einen knifflichen Eindruek, das spezifisch Kindliche ist aus ihm gewichen und an seine Stelle ein Ausdruck wie von Naehdenklichkeit und Sorge getreten. Vor allem fehlen ibm die Stigmen, die dem B-Typus zukommen sollen.
Die optischen Symptvme, die bei diesem Typus gefunden wurden, sind AB, deren wichtigste Eigenschaft eine relative Starrheit ist, d. h. schwere Beeinflul~barkeit und weitgehende Abgespaltenheit von der GesamtpersSnlichkeit. Dieses AB steht nach der Mehrheit der Kriterien und gerade nach den entscheidendsten Maftstaben dem NB naher, und zwar aueh dort, woes durch Vorstellungs- und Willensakte beeinflui~- bar ist. Die Unterscheidung, ob das AB mehr zu dem B- oder dem T-Typus zu reehnen ist, ist in zweifelhaften Fallen dureh Kalkzufiihrung mOglieh, durch die nur das dem T-Typ zugehSrige AB oder der diesem Typ zugeh(~rige Anteil des AB beeinflu~t wird.
Der T-Typus im ganzen wird als um so ausgesprochener angesehen, je mehr Stigmen desselben und je hochgradiger dieselben vertreten sind (S. 227).
Die Beziehungen der eidetischen Anlage zu kSrperlichen MerkmMen. 685
Die kiirperlichen Stigmen des B-Typus sind in abgeschwiichter Form die Charakteristica der Basedowkrankheit in allen Kombinationen und Abstufungen (S. 140). Das beherrschende und hervorstechendste Stigma des B-Typus ist ,,die 1Jbererregbarkeit der Gesamtheit der- jenigen nerv6sen Organisationen, die aufs engstc mit den psyehischen Funktionen hSherer Ordnung, vor allem mit den Affekten verkniipft sind" (S. 147). In diesem Zusammenhang gibt Verf. eine Charakteristik der T- und B-Typen, die sich nach der Schilderung (S. 143--145) vor- wiegend oder mindestens auch auf Erwachsene beziehen. W~hrend dem T-Typus eine gewisse Unnahbarkeit, verletzende Geffihlsk~tlte, philistrSse Geffihlsverarmung beigelegt wird, glaubt man beim B-Typ einen Bezirk seelischer Ausstrahlungen wahrzunehmen, die sich dem anderen, sofern er daffir empf~nglich ist, sofort mitteilen. Zur Er- l~uterung der Stigmen des B-Typus werden dann die klassischen Base- dowsymptome geschildert, die in abgeschw~chter Form diesen Typ charakterisieren. Zu erw~hnen ist, da{~ Verf. annimmt, da{~ alle hierher- gehSrigen Augensymptome auch Zeichen einer normalen basedowoiden Konstitution sein kSnnen. Da Verf. beobachten konnte, dag eine Schilddrfisenresektion AB vom B-Typus, die durch Kalk nicht beein- fluBbar waren, abschw~chte, und daI~ umgekehrt fibertriebene Schild- drfisenzufuhr in einem Falle eidetische F~higkeiten weckte, so -- fiihrt Verf. fort -- steht er nicht an, diese Verhi~ltnisse f/ir einen ausschlag- gebenden Hinweis darauf anzusehen, dal] seine Ausfiihrungen fiber die Zusammenhi~nge zwisehen AB und vegetativer Stigmatisierung bzw. aueh Schilddrfisenfunktion und basedowoidem Konstitutionskomplex in der Tat zu Reeht bestehen (S. 159/160). Die AB des B-Typus ffigen sich wegen ihrer maximal hohen Biegsamkeit (spezifisehe Plastiziti~t des B-Typus) leieht und vollst~ndig dem Vorstellungsablauf ein. Sie sind yon gr613ter Deutlichkeit, Diehte und Intensitat, Sehiirfe der Einzel- heiten, bei k6rperlichen Vorlagen vollk6rperlieh und selbst bei ein- fachen homogenen Vorlageobjekten urbildmi~Big. Gegentiber Kalk- zufuhr verhalten sie sieh immer refrakti~r. Sie sind aufs leiehteste beeinflugbar sowohl dureh experimentelle Mal~nahmen wie dutch den W illen und die Vorstellungen des Beobaehters. Aueh das AB des B-Typus kann ebenso wie seine psyehisehen Xquivalente isoliert auf- treten, d.h. ohne begleitende k6rper]iehe B-Stigmen (S. 162). Zahlen fiber das untersuehte Material gibt Verf. nieht.
Der bis hierher mitgeteilte Inhalt des Buehes stfitzt sieh, wie Verf. des 5fteren betont, auf rein empirisehe Forsehung, w/~hrend in den wei- teren Absehnitten die Lehre auf Grund des so gewonnenen Materials in versehiedenen Riehtungen weiter ausgebaut wird. Es ist deshalb bereehtigt, das bisher Mitgeteilte zun~ehst einer Betraehtung zu unter- ziehen.
686 S. Fischer :
Die yore Verf. aufgestellten kSrperlichen Typen schliei~en sich an bekannte Krankheitsbilder an; die Typen selbst gehSren nach Jaensch nicht in das Gebiet des Pathologischen. An welchen k6rperlichen Merk- malen sind nun die Typen zu erkennen ?
Beginnen wir mit dem B-Typus. Wann ein kSrperlieher Typus noch angenommen werden daft, geht aus den Ausfiihrungen Jaenschs nicht klar hervor. Jedes einzelne Stigma, wenn es auch in abgeschw~ch- ter Form vorhanden ist, scheint naeh Jaensch fiir das Vorliegen dieses Typus zu sprechen. Insbesondere gilt das nach den Ausfiihrungen S. 150 fiir die Augensymptome. Die Behauptung jedoch, dab ein der- artiges Zeichen als Symptom eines Konstitutionstypus anzusehen ist, ist durch nichts gerechtfertigt. Insbesondere gilt das ffir das Glanzauge, auf das sich Jaensch in seiner ,,Vorliiufigen Mitteilung" und in einer Tabelle des Buches besonders stfitzt. Es gibt, wie ich friiher dargetan babe 1, genfigend Ursachen ffir das Glanzauge, die mit dem Basedow in keinerlei Beziehung stehen. Wieviel solcher F~lle Verf. in seinem Material beobachtete, dariiber linden sich keinerlei zahlenm~l~ige An- gaben. Auch darfiber sagt Verf. nichts, wieviel der untersuchten Indi- viduen den einzelnen Altersklassen angeh5ren. Es wird nur darauf hin- gewiesen, dal~ sich ,,die Ausfiihrungen auf Beobachtungen sttitzen, die weit fiber das in diesem Buche angeffihrte Material hinausreichen". Zur Stfitze seiner Behauptung fiber die Wichtigkeit des einzelnen Symptoms kSnnte Jaensch einwenden, ,,diese Stigmata setzen sich im allgemeinen sogar schon bei geringer Auspragung in der ganzen Physiognomie des Individuums durch, ja sie kSnnen auch schon in solehen Fi~llen der GesamtpersSnliehkeit ihren eigenttimliehen Stempel aufpri~gen, der sieh auch schon ffir den unmittelbaren Eindruck bemerkbar macht" (S. 140). ])ann w~re dazu aber mancherlei zu sagen. Zuni~chst sind dies einmal keine kSrperlichen Symptome, die berechtigen wfirden, yon einem k6rperlichen Typus zu sprechen. Weiter aber mfil~te man fragen, was denn dieser PersSnlichkeitstyp, den Jaensch schildert, fiberhaupt ffir Beziehungen zum Basedow oder Basedowoid hat. ,,Beim B-Typus . . . ist stets ein Etwas in dem Flieflen des Muskelspiels, das man als ,Be- seelung' oder aber, im wortnegativen Falle, als seelisch bedingte Mani- riertheit bezeichnen kann." (S. 141) , , . . . Die GesamtpersSnliehkeit ist in ihrer Totaliti~t jeweils und in jedem Augenblieke in allen ihren Lebens- ~u~erungen gewissermal~en selbst anwesend, und zwar in jeder ihrer verschiedenartigsten Reizbeantwortungen, empfindungsm~l~iger, senso- fischer, sensibler, psychischer, vorstellungsmi~Biger und anscheinend aueh motorischer Art" (S. 141). Diese Sehilderung, die im einzelnen hier nicht weiter ausgefiihrt werden kann -- Verf. spricht noch yon seelischer Anmut und Grazie in der Motorik --, mag vielleicht irgend-
1 Diese Zeitschr. 88. 1924.
Die Beziehungen der eidetischen Anlage zu k6rperlichen Merkmalen. 687
einen Charakter typus getroffen haben - - mit dem Basedow hat dies aber nichts zu tun. Die Hastigkeit des Basedowkranken oder des Base- dowoiden dfirfte gerade das Gegenteil von dem darstellen, was Verf. hier schildert. Und sollte hier etwa Verf. seinen Satz S. 42 anziehen: ,,Man kSnnte die rein erfahrungsm~Big ermittelten Typen sogar mit ganz indifferenten Namen oder Buchstaben bezeichnen, die an klinische Zustandsbezeichnungen gar nicht anklingen. Da{] wir den Zusammen- hang mit klinischen Zustandsbildern sehon in den Bezeichnungen zum Ausdruck bringen, geschieht lediglich aus Zweckm/~l~igkeits- grfinden, n~imlich mit Rficksicht auf das auch klinische Interesse jener an sich normalen Konst i tu t ionstypen" - - nun so ist unsere Ansicht yon der Beziehungslosigkeit des aufgestellten Charaktertyps zum Basedow damit gestfitzt.
Wenden wir uns zum kSrperlichen T-Typus, den Verf. auf 58 Druck- seiten beschreibt, abgesehen von den fiberall sonst noch eingestreuten Bemerkungen. Auch bier werden an keiner Stelle absolute Zahlen sondern immer nur Prozentzahlen angegeben; jede Angabe also fiber das tatsgchlich untersuchte Material fehlt.
Verf. glaubt an seinem Material festgestellt zu haben, dab Jugend- liche eine geringere Reizschwel]e ffir die galvanische Erregbarkeit peripherer Nerven haben als Erwachsene. Ffir die KOZ kann dies, soweit aus unseren eigenen Untersuehungen an 140 Schulkindern zu entnehmen ist, nicht gelten; auch Benzing land unter 250 Schulkindern nur 6real eine KOZ unter 5 MA. Jaensch dagegen behauptet (S. 87), dab im Sinne des Jugendtypus u. a. eine KOZ yon 3,0--5,0 MA in weitem Umfange als normal anzusehen ist. Aber insofern dfirften die Angaben yon Jaensch den Tatsachen entsprechen, als sich bei Jugendlichen wenigstens nach unseren Untersuchungen, die allerdings in den sog. Tetaniemonaten stattfanden, die /iberwiegende Mehrheit (109 yon 140) eine AOZ unter 4 MA zeigte. Vorausgesetzt dab tats~chlich die elek- trisehe t3bererregbarkeit bei Jugendlichen eine andere ]~eizschwelle zeigt, so ist es t rotzdem nicht berechtigt, yon einem , , Jugendtypus" bei Erwachsenen zu sprechen, wenn diese derartige Erregbarkeits- grade zeigen. Denn es gibt zahlreiche Erwachsene, die tetanoid sind - - und diese muB man doch, wenn sie auch schon ans Pathologische grenzen, hierher rechnen - - , die in keiner Weise als Jugendtypus angesprochen werden dfirfen.
Betrachten wir aber die Untersuchung etwas genauer. Verf. geht ,,beim Studium der Erregbarkeitsverhgltnisse nicht yon einer ffir alle Lebensalter gleichartigen mehr oder weniger ausgepr/tgten Krankhei t aus, sondern yon einer physiologischen nach den einzelnen Lebens- altern und bei einzelnen Individuen verschieden ausgepragten, genetisch gleichartigen Eigentfimlichkeit : von der eidetischen Anlage iiberhaupt.
688 S. Fischer :
Dadurch wird ein physiologisches Marl des tetanoiden Zustandes gewonnen, ein Gesichtspunlct, der allen bisherigen einschl~igigen Untersuchungen mangelte" (S. 57). Damit wird aber zunachst das, was erst bewiesen werden soll, namlich die Parallelitat zwischen kSrperlichen Merkmalen und bestimmten Formen der eidetischen Anklage, also die Behauptung, als bewiesen vorausgesetzt. :Da~ dies dann auch tatsachlich geschieht, geht aus der sich wiederholt findenden Behauptung hervor, das sog. tetanoide AB kSnne sich auch allein linden, ohne kOrperliche tetanoide Merkmale, es sei dann aber allein ein Stigma ffir den T-Typ. Diesetben Behauptungen finden sich entsprechend beim B-Typ. Mit einer solchen Argumentation ist natiirlich alles zu beweisen.
Anders allerdings wfirden die Dinge liegen, wenn tatsachlich an vielen Fallen die Parallelitat der kSrperlichen und psychischen Sym- ptome nachgewiesen w~re. Dal~ das nicht der Fall ist, wird noch ein- gehend darzulegen sein. Hier kam es vorlaufig nur darauf an zu zeigen, dab zunachst ein sog. tetanoides AB nicht als Zeichen eines tetanoiden Typus angesehen werden daft.
Wie kommt nun Jaensch zur Aufstellung seiner kSrperlichen T- Typen ? Tatsi~chlich untersucht wurden von Jugendlichen, soweit sich aus den Angaben entnehmen l~I~t, solche im Durchschnittsalter von 12,5 und 18,5 Jahren. lJber die Untersuchung dazwischenliegender Jahrgange ist keine Bemerkung zu finden.
Unter den galvanischen Erregbarkeitstypen normaler Art unter- scheidet Jaensch einen Normaltypus der Erwachsenen und einen solchen von Kindern und Jugendlichen. Innerhalb dieser Typen warden wieder- um je drei Stufen unterschieden. Abgesehen vonder schon oben er- wi~hnten Annahme des Ver[s., dait eine KOZ < 5 MA noch als normaler Wert bei Jugendlichen angesehen werden mul~, fi~llt bei Betrachtung dieser Tabelle (S. 90) auf, dal~ die einzelnen Werte derart ineinander- fibergehen, da~ de facto eine sichere Unterscheidung der Typen auf Grund dieser Tabelle zumindest ~ui]erst schwierig ist. Es mull hierbei noch auf die (S. 60) gegebenen Prozentzahlen hingewiesen werden. Verf. land eine KSZ von 0,6 MA bei den 12,5jahrigen in 15,79%, bei den 18,5jahrigen in 25% der Fi~lle, eine KSZ yon 0,5 MA bei 2,63 bzw. 12,5%. Abgesehen davon, dal~ die KSZ nicht beweisend ist fiir die elektrische ~bererregbarkeit, zeigen die Zahlen einen so geringen Unterschied, dal~ daraus nichts geschlossen werden kann. Deutlicher sind die Werte ffir die AOZ bis 5 MA 84,21% bei den jfingeren gegen- fiber 58,33 % bei den ~lteren. Am wichtigsten fiir die Beurteilung der galvanischen Erregbarkeit ist aber nach alter klinischer Erfahrung die KOZ. I-Iier aber zeigt sich nun gerade das Gegenteil von dem, was Jaensch beweisen will, die jiingeren zeigten eine KOZ < 5 MA in 10,55%, die alteren in 16,67%. Wenn Jaensch auf die relativ hau-
Die Beziehungen der eidetischen Anlage zu kSrperlichen Merkmalen. 689
figer vorkommende niedere AOZ zur Entkritftung seines Ergebnisses hinweist, so ist das nicht beweisend, da, wie erw~hnt, die KOZ eine viel gr61~ere Beweiskraft besitzt. Das also, was Jaensch beweisen will, beweisen seine Zahlen nicht.
In diesem Zusammenhange sei erw~hnt, da6 Verf. an seinem Mar- burger Material einen aul3erordentlieh hohen Prozentsatz starker me- chanischer 1]bererregbarkeit der peripheren Nerven fand, n~mlich das Chvostekche Ph~nomen bei 40% aller Jugendlichen, w~hrend wir dieses Symptom in Breslau in 21 yon 140 gesunden Jugendliehen, also in 15% der F/~lle, fanden. Daraus dfirfte hervorgehen, selbst vor- ausgesetzt, daI~ nicht die Jahreszeit eine Rolle spielt, dab m6glicher- weise in versehiedenen Gegenden die tetanoide Erregbarkeit verschie- den verbreitet ist, wie Jaensch dies annimmt. Ist dies aber der Fall, so ist auch damit wiederum die Bereehtigung fiir die Behauptung auf- gehoben, dab die sich in gewissen Grenzen bewegende t]bererregbarkeit einen Normaltypus der Jugendlichen darstellt. -- Sehlie61ich sttitzt sich Verf. u. a. noch auf die physiogn0misehen und mimischen Stigmen dieses Typus. Auch hier gilt das Gleiche, was oben entspreehend beim B-Typus gesagt wurde. Es sei durehaus nicht bezweifelt, dag Jaensch bier einen Gesiehtsausdruck und einen psychisehen Habitus beschrieben hat, der an sich yon grogem Interesse ist. Mit der Tetanie oder dem Tetanoid abet hat dieser Typus wenig zu tun. Da6 bei Kindern das U//enheimersche Tetaniegesicht zuweilen zu finden ist, ist eine fest- stehende klinische Tatsache. Aber daraus resultiert durchaus nicht, da6 irgendwelehe Ahnlichkeiten im Gesichtsausdruek, die sieh bei Jugendlichen oder Erwachsenen finden, mit dem Tetanoid etwas zu tun haben. Bei unseren 140 normalen Jugendliehen und bei dem zahl- reichen klinisehen Material an tetanischen Jugendlichen und Erwach- senen konnten wir diesen Gesiehtsausdruek nur in den allerseltensten F~llen finden. Jaensch betont zwar auch bei Bewertung der Stigmen, dag mimische Zeichen nur unter Ausschaltung mancher Fehlerquellen zu verwenden sind, ,,dann aber sind sie oft als ganz eindeutige Hinweise zu verwenden" (S. 127). Welche Fehlerquellen das aber sind, und warum er selbst diese Zeichen als eindeutigen Hinweis verwendet hat, wird nicht angegeben. Andererseits aber behauptet er (S. 40), dab die Art der Augen den reinen T-Typus in jedem Falle vom B-Typus und seinen MisehfMlen unterscheidet.
Die psychischen Phiinomene, die den beiden k5rperlichen Typen entsprechen sollen, sind AB, die sieh in ihrer Eigenart voneinander unterscheiden. Wenn wir die wichtigsten Kriterien, die Jaensch auf S. l l2f f , und S. 160 angibt, herausgreifen, so ergibt sich fiir das NB und AB des sog. T-Typs (ABT) folgendes: Es besteht meist eine ver- l~ingerte Nachdauer und eine gr61~ere Intensit~t und Dichte des NB.
690 S. Fischer:
Hochgradige AB bleiben im allgemeinen im Hinblick auf Schiirfe der Einzelheiten, Wirklichkeitstreue und Beeinflu[tbarkeit durch Willen und Vorstellung (Plastizitiit) etwas zuri~ck hinter den gleich hoch- gradigen AB des B-Typus. Reine AB vom T-Typ bleiben (trotz gleich hohen eidetischen Grades mit gewissen AB vom B-Typ) immer inner- halb der niederen Gediichtnisstufe, also der NB . . . . Dieses AB steht nach der Mehrheit der Kriterien und gerade nach den entscheidensten Ma~staben dem NB naher, und zwar auch dort, wo es durch Vorstellungs- und Willenakste beeinfluBbar ist. Es ist immer relativ starr und ver- haltnismal~ig schwerer zu beeinflussen als das AB vom B-Typus. Diese relative Starrheit, d. h. schwere BeeinfluBbarkeit und weitgehende Ab- gespaltenheit yon der GesamtpersSnlichkeit . . . . ist das Hauptkriterium der AB vom T-Typ. Das AB des B-Typus (ABB) ist von gr61tter Deut- lichkeit, Dichte und Intensitat, Scharfe der Einzelheiten, bei k6rper- lichen Vorlagen vollk6rperlich und selbst bei einfachen homogenen Vorlageobjekten urbildmal~ig. Es fiigt sich wegen seiner maximal hohen Biegsamkeit (spezifische Plastizitat des B-Typus) leicht und vollstandig dem Vorstellungsablauf ein.
Man sieht, daI~ nach diesen Ausfiihrungen, die immer durch ein ,,relativ" und,,verhaltnismaI~ig" in ihrer Pragnanz abgeschwacht werden
- - aber auch ganz abgesehen davon --, der Unterschied dieser beiden AB nieht immer ganz leicht zu treffen sein wird. Ist dies aber schon bei den reinen und ausgepriigten Fallen so, wie soll dann eine Entschei- dung bei weniger hochgradigen oder gar bei sog. Mischfallen m6g. lich sein.
Die Gedachtnisstufe und damit der Typus bestimmt nun, wie Jaensch an verschiedenen Stellen (u. a. S. 187) ausfiihrt, die spezifische Plastizitat der AB, und zwar haben die AB vom B-Typus eine wesent- lich starkere spezifische Plastizitat als die vom T-Typus. Auf der Nicht- beriicksichtigung dieser Verhaltnisse -- die Jaensch iibrigens erstmalig in dem vorliegenden Buch erwahnt -- soll ein grofter Teil der Einwande beruhen, die Hirschberg und ieh 1924 gegen diese Typenaufstellung erhoben haben. Es wird im nachsten Absehnitt dargetan werden, dab dieses Argument nicht stichhaltig ist. Zunachst soll auf eine andere UnterscheidungsmSglichkeit eingegangen werden, die Jaensch angibt. Es sollen namlieh die AB vom T-Typ durch Zu]iihrung yon Kallr ab- geschwacht und sogar zum Verschwinden gebracht werden kSnnen, diejenigen vom B-Typ dagegen nicht. Die Wirkung des Kalks erstreckt sich auch auf die kSrperliehen Zeiehen des T-Typus, und damit ist nach Jaensch die ZusammengehSrigkeit evident. Es soll nicht bestritten werden, da[~ Kalkgaben einen EinfluI~ auf die eidetische Anlage haben. Wir haben zwar friiher Zweifel geauIiert und haben diese auch jetzt noch, da diese Anlage auch ohne Kalkzufiihrung haufig na~h relativ
Die Beziehungen der eidetischen Anlage zu k6rperlichen Merkmalen. 691
kurzer Zeit nicht mehr nachzuweisen ist, aber wir haben keine geniigen- den eigenen Erfahrungen und unterstellen dies deshalb als richtig. Aber woraus leitet sich dann die Berechtigung her, die durch Kalk beeinflut3ten AB zum T-Typ zu rechnen ~. Es ist zwar eine klinische Erfahrungstatsaehe, dab das Calcium gfinstig auf die Tetanie und ihre Symptome wirkt, aber es ist kein Spezifieum gegen Tetanie. Es wirkt ebenfalls auf andere Arten nerv6ser 1]bererregbarkeit, insbesondere wird es mit Vorliebe als therapeutisehes Mittel bei der Basedowschen Krankheit verwandt. Warum sollte das Calcium dann nieht aueh auf die AB wirken, die dem B-Typ zugeh6ren ? I)er Beweis ex juvantibus kann also bei der Unspezifit~t des Kalks gegentiber der Tetanie nieht anerkannt werden.
Nunmehr kommen wir zu einem der wiehtigsten Punkte, n~mlieh der Frage naeh der Zugehdrigkeit bestimmter A B zu bestimmten kdrper- lichen Typen. Zu diesem Zweeke ist es erforderlieh, einen grogen Teil der vorangegangenen Einwi~nde zu vernaehl~ssigen und die vom Verf. behaupteten Verhgltnisse als riehtig anzunehmen, da ja sehon auf Grund des Vorstehenden ein groger Teil der Voraussetzungen ffir die Frage naeh der Zugeh6rigkeit der psyehisehen zu den k6rperliehen Symptomen hinfMlig geworden ist.
Ausgegangen ist Verf. yon zwei Fiillen, in denen ein sehr stark ausgepri~gtes Facialisphiinomen (Chvostek, F. Schultze) sieh gleiehzeitig mit zwei bereits an pathologische Formen grenzenden Fi~llen yon AB fanden. Ferner sagt Verf. (S. 159) : Wenn wir nun beobachten konnten, dab eine Schilddriisenresektion AB vom B-Typus, die durch Kalk nicht beeinflugbar waren, abschwiichte, und dab umgekehrt fiber- triebene Schilddrfisenzufuhr in einem yon uns beobachteten Falle eidetische Fi~higkeiten weckte, so stehen wir nicht an, diese Verh~tlt- nisse ftir einen ausschlaggebenden Hinweis darauf anzusehen, dab unsere Ausffihrungen fiber die Zusammenh~nge zwischen AB und vege- tativer Stigmatisierung bzw. auch Schilddrfisenfunktion und base- dowoiden Konstitutionskomplex (B-Komplex) in der Tat zu Recht bestehen". Zu diesem letzten Satz sei zun~chst bemerkt, dab ein post hoc in einem einzigen Falle einer Schilddrfisenresektion noch nichts fiir ein propter hoc besagt. Bemerkenswert ist dabei, dab irgendwelche Einzelheiten fiber die Art der Abschwi~chung bzw. der Ver~nderung der eidetischen F~higkeit in dem sehr umfangreichen Buch nicht angegeben sind, obwohl gerade diese Angaben yon ganz besonderer Wichtigkeit gewesen w~ren. Wenn man nun den mSglichen Einwand, Schilddrfisenresektionen seien insbesondere bei st~rkeren Eidetikern nicht so h~ufig -- obwohl man das yon vornherein bei der Zugeh6rig- keit der ABB zum Basedowoid annehmen m fiBre -- und deshalb sei die Beschr/~nkung auf einen Fall durch die Umst~nde notwendig,
692 S. Fischer :
gelten li~Bt, so ist nicht versti~ndlich, warum nicht in vielen anderen Versuchen Schilddriisengaben angewandt wurden, um wenigstens den zweiten Fall nachzuprfifen. So gefi~hrlich ist die Zuftihrung yon Schild- driisensubstanz bei klinischer Beobachtung und Kontrolle des Gas- stoffwechsels nicht, dab eine Nachpriifung nicht mSglich wi~re.
Auf je zwei Fi~lle stfitzen sich also die eklatantesten Beobachtungen. Aber das ist nicht das Hauptmaterial. Worauf stfitzt sich also Jaensch welter ?
Man miiBte annehmen, dab nun an einem grSgeren Material eine Parallelit~t der kSrperlichen und psychischen Eigenschaften zahlen- m~tl~ig nachgewiesen wird, und dag sich auf diese Ergebnisse die weitere Forschung aufbaut. Von einer Mitteilung absoluter Zahlen der vom Verf. untersuchten Individuen findet sich aber in dem ganzen Buche nichts bis auf einige Tabellen, yon denen noch zu sprechen sein wird. Verf. betont nur an mehreren Stellen, dag sich seine Beweisffihrung auf ein Material stiitzt, das er nicht vollstimdig wiedergibt. ,,Alles hier beigebrachte Material ist also nur ein Beispiel." Von einem wie grol3en Material wird jedoch nirgends gesagt.
Wie beweist nun Jaensch die ParalMitat ? Zun~ichst der T-Typ. Jaensch hatte angeblich festgestellt, dag yon der jiingeren zur i~lteren Jahresklasse die H~ufigkeit der 0ffnungszuckungen unter und bis 5,0 MA abnahm (S. 61). Er hatte ferner angeblich festgestellt, dal~ auch in dieser Richtung die eidetische Anlage abnahm, und daraus schliellt er die ZugehSrigkeit der eidetischen Anlage zum kSrperlichen T-Typ. Wenn dieser Schlug beweisend sein soll, so f~llt zuni~chst einmat auf, dab der B-Typus, der nach Jaensch bei den Jugendlichen ja eben- falls sehr verbreitet ist, dabei gar nicht beriicksichtigt ist. Wie soll, wenn der obige Satz zu Recht besteht, dann der B-Typus hier einge- schaltet werden ? Aber yore k6rperlichen B-Typus und der eidetischen Anlage wird dasselbe sp~ter, wenn auch nicht so apodiktisch, behauptet. Und so mu13 man sich fragen, ob Verf. nun meint, dab der k6rperliche T- oder der B-Typus der eidetischen Anlage parallel geht. Jaensch selbst schliel~t abet, jeder einzelne k6rperliche Typ gehe der eidetischen Anlage parallel.
Mit weleher Art yon AB, ob solehen vom B- oder vom T-Typ die k6rperliehen Zeiehen parallel absinken, darfiber sprieht sieh Jaensch nieht aus. Er sprieht viehnehr immer nur yon eidetiseher Anlage. Wenn also selbst der oben erwithnte Sehlug nieht falseh wi~re, so wiire ffir die Zugeh6rigkeit bestimmter Formen der AB zu den bestimmten k6rperliehen Typen aueh niehts bewiesen.
Noeh ein weiterer Widersprueh. E. R. Jaensch, Zeman 1 sowie Hirschberg und ieh haben die Akme der eidetischen Anlage im 12. bis
1 Zeitschr. f. Psychol. 69.
Die Beziehungen der eidetischen Anlage zu k6rperlichen Merkmalen. 693
14. Lebensjahre gefunden. Vom 9.--12. Lebensjahre steigt die eidetische Anlage an, dann sinkt sie, jedoch nieht gleichm~tBig, sondern mit man- cherlei Anstiegen. Wie stark im allgemeinen die eidetisehe Anlage vor dem 9. Lebensjahre verbreitet ist, dariiber liegen iiberhaupt noch keine Untersuchungen vor. Wenn Jaensch nun behauptet, dab die galvanische Erregbarkeit mit Ausnahme des Sauglingsalters mit stei- gendem Alter abnimmt, so geht sic demnach also nicht parallel der Verbreitung der eidetischen Anlage.
Die Behauptung des Verfs. (S. 85), dab ftir das Gros der Eidetiker aller Altersstufen der Parallelismus zwischen k6rperlichen T-Stigmen und eidetischer Anlage deutlich ist, wird also schon allein auf Grund der vorstehenden Ausfiihrungen hinfallig. Ist aber dies schon tier Fall, so ist es yon vornherein auch unwahrscheinlich, dab sich bei der Gegen- iiberstellung einer groBen Anzahl yon Einzelf~llen k6rperlicher Typen mit der ihnen entsprechenden besonderen Art der eidetischen Anlage eine Korrelation ergibt. Nur eine solche Beweisfiihrung k6nnte die vom Verf. aufgestellten Thesen rechtfertigen. Nur durch Mit- teilung einer groBen Anzahl yon Fallen, ihres k6rperlichen Befundes und der Eigenart ihrer AB kann eine solche These bewiesen werden -- jede andere Beweisffihrung muB als nicht beweiskr~ftig abgelehnt wer- den. Verf. behauptet zwar S. 42 : ,,Die Typen sind . . . . rein erfahrungs- m~,Big aufgestellt. Sie fassen nur Beobachtungstatsachen zusammen, die in enger Korrelation untereinander auftreten." Aber tats~chlich wird diese Korrelation nirgends zu beweisen unternommen, a~Ber in Tabelle IV (S. 238), in der 28 F~,lle mitgeteilt werden. Unter diesen befinden sich im ganzen 6 reine T-F~lle und 3 reine B-F~lle. Da Misch- falle zun~chst nichts beweisen, solange nicht eine hohe Korrelation innerhalb der reinen F~lle eindeutig festgestellt ist, scheiden diese vorerst als Grundlage aus. Es beruht also yon dem mitgeteilten Material die Aufstellung der Typenlehre auf diesen 6 bzw. 3 F~tllen. Dabei ist abet noch zu bemerken, dab Verf. zu den reinen T-Fallen z. B. einen mit folgender Zuckungsformel z~hlt: KSZ 0,7, ASZ 0,4, AOZ 3,0, KOZ > 5,0. Die sensiblen Symptome bei galvaniseher Reizung, die bei diesem Falle angefiihrt sind, k6nnen nicht als beweiskraftig an- gesehen werden. Auch bei den B-Fallen legt Verf. besonderen Wert auf das Vorhandensein des Glanzauges, eines Symptoms, das in keiner Weise charakteristisch fiir das Basedowoid ist.
Wenn abet, wiederum abgesehen von allen vorhergehenden Ein- w~nden, die vom Verf. behauptete Korrelation zu Recht besteht, so miiBte sich zumindest in der Mehrzahl der F~lle eine Parallelitat bei Untersuchung der einzelnen Falle naehweisen lassen. Verf. hat, wie erwahnt, diesen Nachweis nicht geffihrt. Nachuntersuchungen liegen yon Karger, Leven sowie yon Hirschberg und mir vor. Keiner
Z. f. d. g. Neut . u. Psych . 109. 45
694 S. Fischer :
der erw~hnten Autoren konnte den vom Verf. behaupteten Satz be- statigen. --
Dem Verf. haben die Untersuchungen der genannten Autoren be- reits bei Abfassung seines Buches vorgelegen, u n d e r hat teils in dem Buch, teils in anderen frfiheren Arbeiten dazu Stellung genommen. Die wesentlichsten Einwande, die er erhebt, seien deshalb hier be- sprochen.
Verf. wendet gegen unsere Ergebnisse ein (S. 163), dal~ ,,wir kSrper- lich ausgepragte B-Typen mit ausgepragten T-Typen in bezug auf die bei ihnen vorhandenen eidetischen Erscheinungen ohne weiteres ver- gleichen. Denn es ist ja keineswegs gesagt, dab vorhandene eidetisehe Erseheinungen bei dergestalt herausgesuchten Individuen gleiche Grade zeigen." Nach den frfiheren Ausftihrungen Jaenschs mfil~te dies eigent- lich angenommen werden. Uns kam es nur auf die Feststellung an, ob sich bei den beiden k6rperlichen Typen auch verschiedene Arten von AB nachweisen lieBen; ob die eidetische Anlage dabei stark oder schwach ausgepragt war, war fiir unsere Fragestellung gleich- giiltig. Aber eben diese Korrelation konnte an unserem ausffihrlich mitgeteilten Material auch nicht im geringsten festgestellt werden. DaB unsere Ergebnisse sich nicht mit denen des Verfs. decken, fiihrt Jaensch weiterhin darauf zuriick, dab wir beim Vergleich beider Typen untereinander eidetische Phanomene verschiedenen Grades einander gegentiberstellen. Dieser Gesichtspunkt war in der Tat fiir uns nicht maBgebend, aber ich sehe auch heute noch nicht ein, warum eine eide- tisehe Anlage etwa drit ten Grades nicht ebenso die Merkmale des B- oder des T-Typus aufweisen soll wie die ausgepr~gteren des 4. Grades. Zu- fallig wird aber auch dieser Einwand gegenstandslos, da von den mit- geteilten typischen ABB unseres Materials 4 zur Stufe 4, 1 zur Stufe 3 geh6rten, also -- da unsere Stufe 4 die h6chste war -- Material heran- gezogen wurde, das den Anforderungen Jaenschs entspricht. Da wir reine B-Fi~lle und T-Falle in psychischer Hinsicht nicht fanden, kann sich dieser Einwand also nur gegen diese in Tabelle XV unserer Arbeit mitgeteilten F~lle richten. Aber bei diesen eidetischen B-Fallen fanden wir dreimal Zeichen einwandfreier Ubererregbarkeit in Form einer stark erniedrigten KOZ.
Andererseits hat ten wir die kSrperlich ausgepri~gten B- bzw. T-F~lle zusammengestellt und auf ihre eidetische Anlage geprfift. Aber aueh hier land sich damals nicht die geringste Korrelation. Die Bereehtigung eines derartigen Vergleiches ergibt sich ohne weiteres aus der These des Verfs. Jaensch seinerseits teilt derartiges Material nicht mit. Wenn Jaensch auf eine derartige Nachpriifung und auf unsere Ergebnisse erwidert (S. 377), dab er nur von ,,relativen" Unterschieden rede, und dal~ es sich nur um ,,relativ starre" Bilder oder ,,relativ bewegliche"
Die Beziehungen der eidetischcn Anlage zu k6rperlichen Merkmalen. 695
handele, so wird dadurch die Beurteilung derart verschwommen, daI] eine Nachpriifung allerdings, selbst bei gleichem Material, zu ~rSllig verschiedenen Ergebnissen kommen kann.
Schlieltlich wendet Verf. ein, wir h~tten bei unseren Untersuchungen die spezifische Plastizit~t, yon der oben schon eingehend gesprochen wurde, nicht beriicksichtigt. Diese k~me dem ABB zu, den ABr da- gegen nicht. Dieser Begriff wird von Jaensch erst in seinem Buche neu eingefiihrt. Abgesehen davon, dab in den friiheren VerSffentlichungen davon keine Rede war, ~ndert dies aber nichts an unseren Ergebnissen, denn der Unterschied zwischen Plastizit~t, die dem eidetischen Grade zukommt und der spezifischen Plastizit/~t, die durch den Typ bestimmt wird, ist nach den Ausf/ihrungen des Verfs. (S. 187 u. a.) iiberhaupt nicht mit voller Sch~rfe zu erfassen. Wenn wit als ausgesprochene psychische B-Fi~lle solche ansahen, bei denen das AB naeh Vorlage spontan die verschiedensten Ver~nderungen zeigte, und in denen die Vp. eine Person oder einen Gegenstand sich so , ,vorzaubern" konnte, dab sie ihn buchsti~blich sah, so glauben wir, dab dieser Art der eide- tischen Bef~higung auch das Pr/~dikat der spezifischen Plastizit/~t zuer- kannt, vor allem aber, dab sie dem B-Typ zugerechnet werden muB. Fiir das andere von uns mitgeteilte Material hat dieser Einwand keine Geltung, da reine psyehische T-Finite sieh in unserem Material fiberhaupt nicht linden.
Kurz sei schlieBlich noch auf die Frage eingegangen, ob es berech- tigt ist, von einem basedowoiden und tetanoiden Konstitutionstypus zu reden. Schon in der Arbeit yon Hirschberg und mir wurde die Be- rechtigung hierzu bestritten. Jaensch gibt in seinem Buche keine Defi- nition dafiir, in welchem Sinne er selbst den Ausdruck Konsti tution gebraucht, obwohl er die Definitionen vieler Autoren anzieht. In dem weiteren Verlauf des Buches wird der Ausdruck Konstitution nur setten gebraucht, Verf. spricht h/~ufiger von Typen und versteht, wie er (S. 4) angibt, darunter, was Lubarsch mit Konstitution bezeiehnet, ni~mlich die Reaktionsart auf Umweltreize. Es erfibrigt sich daher nach dem Gesagten, nochmals zu der Frage, ob Konstitution oder nicht, Stellung zu nehmen.
Wichtiger als diese Frage erscheint aber diejenige nach der Be- reehtigung, die Typologie auch auf Erwachsene auszudehnen. Bei diesen soll sich aueh der Typus in den h6chsten geistigen Schichten zeigen. Vorausgesetzt, dab fiir Jugendliche die Typenfeststellung tat- s~chlich richtig ist, so darf eine lJbertragung auf Erwachsene nur dann erfolgen, wenn auch hier systematisehe Untersuchungen vorliegen. Das hierffir beigebrachte Material (Goethe, Johannes Miiller) ist nicht ausreichend und nieht beweisend ffir die Aufstellung derart weitreichen- der Schliisse. Das geht ferner aus der Behauptung hervor, dab sieh
45*
696 F. Fischer: Beziehungen der eidetischen Anlage zu kSrperlichen Merkmalen.
bei Erwachsenen die somatischen Stigmen der normalen somatischen Konstitution der Jugendlichen sofort wieder zeigen, wenn sich bei dem betreffenden Erwachsenen eidetisehe Anlagen nachweisen lassen (S. 66). Das vom Verf. fiir diese F~lle angeffihrte Material (S. 218) yon 8 er- wachsenen Eidetikern, bei dessen Mitteilung iibrigens nichts dariiber angegeben ist, ob die eidetische Anlage dem B- oder T-Typ zuzurechnen ist, ist zu gering und nicht einwandfrei, da die Werte der galvanischen Erregbarkeit zum Teil durehaus in der Breite der Norm liegen und als basedowoides Symptom nur das -- nicht beweiskraftige -- Glanzauge angefiihrt wird. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn unsere eige- nen gelegentlichen Untersuchungen an erwachsenen Eidetikern mit diesen Ergebnissen nicht fibereinstimmen. Auch Bauer (Die konsti- tutionelle Disposition zu inneren Krankheiten, Berlin 1924, S. 205) kommt zu dem Ergebnis: die yon Jaensch behauptete Korrelation zwischen dieser optischen Gedachtnisform und bestimmten allgemeineren somatischen Konstitutionstypen (basedowoide und spasmophile Kon- stitution) trifft nicht zu.
Nach den vorstehenden Ausffihrungen kann deshalb die yon W. Jaensch postulierte ZugehSrigkeit bestimmter Formen der eidetischen Anlage zu bestimmten kSrperlichen Typen nieht als bewiesen angesehen werden. Es mag vielleicht PersSnliehkeitstypen geben, die dem B- oder T-Typ entsprechen, mit dem Basedowoid oder Tetanoid haben diese aber nichts zu tun, und vor allem, eine bestimmte Art der eidetischen Veranlagung kommt diesen Typen, wie im Vorstehenden bewiesen wurde, nicht zu.