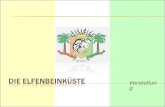Die Dorfstrasse
-
Upload
lea-hartmann -
Category
Documents
-
view
231 -
download
0
description
Transcript of Die Dorfstrasse

Lea Hartmann
Die
und ihre Bewohner

IMPRESSUM
Herausgeberin: Lea Hartmann
Text: Lea Hartmann
Fotos: Lea Hartmann, Tabitha Hartmann
Gestaltung und Satz: Ruedi Friedli, Zofinger Tagblatt AG, Lea Hartmann
Druck und Bindung: Keller Druck AG, Aarau
Vorwort
Sechsundneunzig im Internet eingetragene Adressen –Haushalte, Geschäfte, Kirche, Schule und Gemeindehaus. Män-ner, Frauen, Kinder und Tiere – Träume, Wünsche, Erlebnisseund Geschichten. Das ist die Dorfstrasse in Brittnau.
In diesem Buch erwarten Sie elf Porträts von völlig unter-schiedlichen Dorfsträsslerinnen und Dorfsträsslern. Familien,Singles, Senioren – Hobbygärtnerinnen, Tierfreunde und Bü-cherwürmer. Leute, die meist nur eine Gemeinsamkeit besitzen:ihre Adresse.
Im Rahmen der Selbstständigen Arbeit an der Fachmittel-schule Aarau habe ich von Mai bis Oktober 2008 an diesemProjekt gearbeitet – direkt und indirekt. Ich habe Bücher undPorträts gelesen, ein Schreibtagebuch geführt, Briefe geschrie-ben, Termine vereinbart, Gespräche geführt, Porträts verfasstund das Layout gestaltet. Herausgekommen ist dieses Buch,das Sie nun in Ihren Händen halten.
Viel Spass beim Schmökern und Lesen - es lohnt sich!
Lea Hartmann, im Juli 2008

Inhalt
Verliebt in eine Alp 8Eugen Wälchli
Ohne Hausnummer, dafür mit Herz 12Anni Wälchli
Hagenbuttentee und frittierte Maden 16Sandra Kurmann
Einmal Bünderland und zurück 20Karin, Oliver und Silas Huber
Vom Totenkopf zur Blume 23Manuela Koller
«Mir war noch nie langweilig.» 28Klara Hochuli
Basteln, wenn andere schlafen 32Marie-Therese Gerber
Ein Mann kommt selten allein 36Susi und Ueli Lienhard
«Wir halten zusammen.» 40Therese, Jürg, Manuela, Jonas und Lars Bonderer
Leben für den Laden 44Gabi, Dani, David und Michael Gabi
Mit dem Töff durch schwere Zeiten 47Rosa Vonäsch

7 Dorfstrasse 4

nahmen den Hof der Eltern. Diese halfen aber trotzdem nochlange Zeit in Haus und Hof mit. Geni dagegen hielt es einfachnicht im Stall, er brauchte Abwechslung. Handwerklich arbei-ten mochte er, deshalb wurde er Mitarbeiter der Ackerbaustel-le. Sein Job war es, Parzellen zu punktieren und den Leuten diePrämien vom Gemeinderat auszuzahlen, denn der Bund be-zahlte die Bauern für alles, was sie auf ihrem Land anpflanz-ten. Als weitere Abwechslung zur tagtäglich gleichen Arbeitauf dem Bauernhof machte er, wie sein Vater, den Viehinspek-torkurs in Aarau. So bekam er Einblick in andere Bauernhöfe,die er zu kontrollieren hatte.
Doch das war ihm noch lange nicht genug. «Ich war auchnoch Präsident der Viehversicherungskasse», ergänzt er. «Achja, Feuerwehrkommandant war ich auch.» Im Laufe des Ge-sprächs fallen ihm immer mehr Vereine ein, deren Präsidentoder Mitglied er war: Mitarbeiter der Güterregulierung, Präsi-dent der Bodenverbesserungsgesellschaft, Präsident der Auto-bahn und Wiggerkorrektion und Mitglied des Vorstands deraargauischen Saatzuchtgenossenschaft. Nebenbei sang er aus-serdem 47 Jahre lang im Männerchor.
«Glücklicherweise arbeitete immer noch ein junger Burschemit», findet Geni. Sonst hätte er nicht so viele Arbeiten ausserHof übernehmen können. Auf Anfrage erhielten die Wächlisdamals nämlich einen Saisonnier aus Spanien, den Anita unddie dreijährige Tochter Christine am Bahnhof Aarau abholten.«Für Christine war Fernando wie ein grosser Bruder», schwärmt
Geni. «Ausserdem war er sehreinsatzfreudig.» Zu Beginn alsSaisonnier, nachher als Jahres-aufenthalter, blieb der Spanierüber 20 Jahre bei den Wälchlis.
Ich frage ihn, ob es denn heu-te nicht langweilig sei, so ganzohne auswärtige Verpflichtun-gen. «Ich bin froh, dass es mirnoch so gut geht», sagt Genidazu, «ich möchte nicht klagen.»
Und fügt an: «Eigentlich bin ich jetzt auch ganz froh, einmalentspannen zu können.» Seit die beiden 1993 den Hof aufge-geben haben, gehen sie das Leben ruhiger an. «Ich lese viel undgerne», erzählt Eugen. Stolz berichtet er, wie er innerhalb einesTages ein ganzes Buch las. «Ich bin leider nicht ganz fertig ge-worden. So las ich die letzten zwanzig Seiten gleich nächsten
So steht es am Bauernhaus, das zu den ältesten SiedlungenBrittnaus gehört. In ihm wohnen Anita, 76 Jahre, und EugenWälchli, 86 Jahre alt. Die beiden sind sich einig: «Wir versuch-ten immer, uns diesen Spruch zu Herzen zu nehmen.»
Ich sitze in der heimeligen Stube mit grünem Kachelofen.«Also, ich weiss so viel zu erzählen, ich weiss gar nicht, wo be-ginnen», sind Eugens erste Worte. Ich müsse schon sagen, wasich genau wissen wolle, er habe so viel erlebt. Seine Augenleuchten, ich merke, wie sehr er sich freut, jemandem seine Er-lebnisse schildern zu können. «Ich gehe dann mal», be merktAnita, «er hat so viel erlebt, soll er nur erzählen.» Sich ganzraushalten schafft sie dann jedoch nicht. Ab und zu ruft sie auseinem anderen Zimmer und erinnert Eugen an Dinge, die erdoch noch erwähnen sollte.
Der «Eidgenosse»Das Haus, in dem das Ehepaar wohnt, war schon im mer im
Besitz der Familie Wälchli. «Der Grossvater meines Vaters bauer te schon hier», erzählt Geni. Er musste, als ältester vonvier Buben, auf dem Bauernhof mithelfen. Das war damals üb-lich. Nach der Schule ging er in die Landwirtschaftliche Schu-
le nach Brugg. Diese ging zwei Winter lang, im Sommer half erauf dem Hof. Zwei Jahre später rückte er in die Rekrutenschu-le in Aarau ein, wo er der Kavallerie zugeteilt wurde. «Als Bau-ernsohn war es für michklar, dass ich etwas mitTieren machen möchte»,begründet Geni. Er erin-nert sich gerne an die Zeitim Militär zurück, auchwenn sie, wie er betont,sehr anstrengend war.«Wir machten 50 Reit-übungen pro Jahr, und amWochenende fand dieSpringkonkurrenz statt.» Er lässt es sich nicht nehmen, dasFoto zu suchen, auf dem er an einem dieser Springwettkämpfezu sehen ist: Ein junger Mann in Uniform mit Krawatte undPolice, der stolz auf seinem «Eidgenossen» – so nennt man dieKavalleriepferde – sitzt. Dieses Pferd, und das ist Geni sehrwichtig, wurde von jedem Rekruten der Kavallerie ersteigertund die Hälfte vom Staat finanziert.
Eugens Ausführungen beeindrucken und erstaunen, sindsie mir doch so fremd. Ich habe das Gefühl, jemand erzählt mirGeschichten aus dem vorletzten Jahrhundert, es ist fast nichtzu glauben, dass ein heute lebender Mensch solch vollkommenandere Zeiten erlebt hat.
Bauer sein war ihm zu langweiligNach der Zeit im Militär kehrte Geni zurück nach Brittnau
auf den Bauernhof seiner Eltern. Er verliebte sich in Dori Däs -ter, die gleich nebenan wohnte. 1949 heirateten sie und über-
Verliebt in eine Alp
«Sonne und Regen sind himmlisch Gaben,sind nicht um alles Gold zu haben.Des Hauses innern Sonnenscheinträgst du im Herzen mit hinein.» «Ich weiss so
viel zu erzählen. Ich weiss gar nicht,
wo beginnen.»Eugen Wälchli
9 Dorfstrasse 4 Dorfstrasse 4 8
«Ach ja, Feuerwehr-
kommandant war ich auch.»
Eugen Wälchli
Eugen Wälchli, 86, in seinem Garten.

11 SchulhausDorfstrasse 4 10
Morgen, nach dem Erwachen.» Auch diese Anekdote zeigt:Wenn Eugen etwas beginnt, dann zieht er es durch. Bei ihmgibt es kein langes Warten oder Trödeln.
Die VisionAuch nicht, als es um die Wahl der richtigen Frau ging.
«Meine erste Frau, mit der ich eine Tochter, Annemarie, habe,starb 1968 an der Zuckerkrankheit. Ich war sehr traurig, dochauch realistisch. Es musste eine neue Frau her, ich konnte janicht alleine den Hof führen und ein Kind erziehen.» Das seieine sehr komplizierte Ge-schichte, erklärt Geni, alsich ihn frage, wie er dennAnita kennengelernt hat.«Eines Nachts hatte icheine Vision. Ich sah Anitaauf meinem Feld Runkelnhacken», erzählt Eugen.«Ich kannte Anita aber garnicht richtig, nur so vomSehen», fügt er an. Für ihnwar das aber ein klaresZeichen. Zusammen mit der Schwägerin arrangierte er einTreffen mit Anita – und tatsächlich: Die beiden verliebten sichund heirateten gleich im nächsten Jahr, 1969. Anita arbeitetevon nun an auch auf dem Bauernhof und führte den Haushalt.
Anita hört Eugens Erläuterungen schmunzelnd zu. Als wirbeide einige Minuten alleine sind – da Eugen mir ein Foto heraussuchen will – frage ich sie, ob es für sie nicht hart war,ihren Job aufzugeben. Doch Anita beruhigt mich: «Mir gefiel esschon immer, draussen zu arbeiten. Und das Schöne ist auch,dass man viel miteinander macht. Grundsätzlich gefällt mirdas viel besser als mein vorheriger Beruf.»
Seine zweite LiebeEigentlich müsste man sagen, dass Eugen nicht nur mit
Anita verheiratet ist. Seine zweite Geliebte ist zwar keine Frau,aber eine Alp. «Ja, die Wernisegg ist ihm wirklich viel wert»,findet Anita. Die Wernisegg, ein Ausläufer des Napfs, liegtrund 30 Kilometer von Brittnau entfernt im Kanton Luzern. Zuder Alp gehören 143 Hektaren Land und sechs Gebäude, darunter ein Ferienhaus. «Mein Vater war schon Rechnungsre-visor bei der Aargauischen Alpgenossenschaft Wernisegg. Als
er aufhörte, wurde ich sofort sein Nachfolger», beginnt Eugendie lange Liebesgeschichte. Die Aargauische Alpgenossen-schaft Wernisegg schickt jährlich Rinder aus dem ganzen Kan-ton auf die Wernisegg, wo sie den Sommer über von zwei Hir-ten gehütet werden. Die Genossenschaft wurde 1872 von ei-nem Zofinger Stationsvorstand gegründet, der über denVerkauf dieser Alp Bescheid wusste. Er wollte sie retten undrief eine Versammlung der Bauern ein. «Herr Zimmerlin arran-gierte, dass man Anteilscheine der Alp kaufen konnte, die ei-nem erlaubten, seine Rinder im Sommer auf die Alp zu brin-gen. 140 von 180 Anteilscheinen wurden tatsächlich auch ge-kauft», erklärt Eugen. Die restlichen 40 kaufte der Kanton, «zurFörderung der Simmentaler Fleckviehrasse», wie er sich erin-nert. «Bis in die 70er-Jahre konnte tatsächlich nur diese Rasseauf der Wernis egg grasen, heute wird das nicht mehr so strenggehandhabt.»
Eugen gehörte nicht nur zu den Bauern, die ihre Rinder aufdie Wernisegg schickten, sondern war ausserdem über zwanzigJahre Präsident der Genossenschaft. Vor drei Jahren legte ersein Amt aufgrund seines hohen Alters nieder. Aber er lässt essich trotzdem nicht nehmen, immer noch daran teilzunehmen.«Letzte Woche war Alpaufzug, das durfte Eugen natürlich nichtverpassen», schmunzelt Anita.
Mit der Wernisegg verbindet Geni viele wunderschöne Erinnerungen. Er hatte auf dieser Alp die Chance, viele ver-schiedene Arbeiten zu organisieren. «Er war bei den Rindli, imWald, war mit dem Strassenbau beschäftigt», zählt seine Ehe-frau auf. Stolz zeigt mir Geni Fotos von «seiner» Alp und denArbeiten, die er dort verrichtete.
Er würde mir gerne all die Geschichten und Anekdoten er-zählen, an die er sich noch erinnert. Doch er sagt es selbst undhat es schon zu Beginn bemerkt: «Das würde Tage dauern…»
«Ich war sehr traurig, doch auch
realistisch.Es musste eine neue Frau her.»
Eugen Wälchli

13 SchulhausSchulhaus 12
Ohne Hausnummer, dafür mit Herz
Die Gemeinde- und Schulbibliothek Brittnau hat keine of-fizielle Adresse, ebenso wie das Schulhaus, in dessen Parterredie Bibliothek liegt. Trotzdem haben im Jahr 2007 über 400 Le-se ratten den Weg in das Zimmer mit den knarrenden Dielengefunden - die rund 300 Schülerinnen und Schüler, die von derSchule aus Bücher ausleihen, ausgenommen.
Der schulzimmergrosse Raum ist der Arbeitsort von AnniWälchli, 47 Jahre alt. Neben ihr arbeiten momentan noch zweiandere Frauen in der Bibliothek, im Herbst kommt jemandDrittes dazu.
Traumjob gefundenAnni Wälchli wohnt in Brittnau und arbeitet seit acht Jah-
ren in der Bibliothek. «Susi Fässli, die damals die Vorlesestun-den für Kinder durchführte, hörte auf und suchte eine Nachfol-gerin», erzählt Anni. «Susi fragte mich, da sie wusste, dass ichKindergärtnerin bin, und ich sagte zu.» So begann ihr Werde-gang in der Bibliothek Brittnau.
Bald las sie nicht mehr nur vor, sondern trat auch dem Vor-stand des Vereins Pro Bibliothek bei. Dieser unterstützt die Bi-bliothek finanziell und sorgt damit für ein ständig wachsendesAngebot an Büchern und anderen Medien. Als kurze Zeit spä-ter jemand für das Bibliotheksteam gesucht wurde, war Annisofort dabei.
Für sie als Leseratte ein echter Traumjob. 2001 machte siedann noch die Ausbildung zur Nebenamtlichen Gemeinde -bibliothekarin, wo sie neben dem Katalogisieren per Computerauch noch das Karteisystem lernte. Nach 153 Lektionen be-stand sie das Attest, und bekam das Zertifikat als Bibliotheka-rin SAB (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der allgemeinöffentlichen Bibliotheken).
Vom Vater geerbt«Die Liebe zum Lesen ist bei mir sozusagen vererbt»,
schmunzelt Anni. Ihr Vater, ein Lehrer, liebte seine Bücher, fürdie er als Leiter der Schulbibliothek Zofingen verantwortlichwar. «Er sass stundenlang in dieser dunklen Kammer, band dieBücher ein und katalogisierte sie»,kann sich Anni erinnern. Sie undihre Geschwister besuchten ihn je-weils in den Ferien. Die alten Bü-cher, die ihr Vater da hütete, warenaber nicht nach Annis Geschmack.«Ich ging lieber in die Stadtbiblio-thek. Da hatte es Bücher, die michinteressierten», erinnert sich Anni.Sie verschlang Buch um Buch, dasLesen wurde fast zu einer Sucht.«Als ich dann ins Töchti ging, hatte ich leider immer wenigerZeit fürs Lesen, der Bücherkonsum schränkte sich automatischein», erzählt Anni Wälchli. Auch heute ist es die Zeit, die Annifehlt, um Bücher zu lesen. «Ich lese immer noch sehr gerne,doch leider hat man als Hausfrau immer viel zu tun.»
Falls Anni doch einmal Zeit für ein Buch findet, sind es his -to rische Romane, die sie faszinieren. «Ich mag Geschichtenüber Frauen im Zweiten Weltkrieg, Biografien und ab und zueinen Liebesroman. Auch Schweizer Literatur lese ich gerne»,zählt Anni auf.
Wie es ein Buch in die Bibliothek schafftIm Gegensatz zu den Zeiten, als Annis Vater die Bibliothek
Zofingen leitete, kann man heute viel mehr als nur Bücher ineiner Bibliothek ausleihen. «Wir haben nebst Büchern Kasset-
ten, CD-Roms, Hörbücher und seit 2007 auch DVDs.» Insge-samt verfügt die Bibliothek Brittnau über einen Bestand von9200 Medien. Anni ist für die rund 4000 Kinder- und Jugend-bücher zuständig. Sie informiert sich über Neuerscheinungen,kauft neue Bücher und staubt alte aus. Besonders die Phase vordem Neukauf von Büchern ist für die Bibliothekarinnen ar-beitsintensiv. «Ich lese jeweils das Magazin des Schweizer Bi-bliotheken-Dienstes und informiere mich dort über neue Bü-cher, die zum Kauf empfohlen werden», sagt Anni. Ab und zuempfiehlt ihr die sechzehnjährige Tochter Bücher, die gerade«in» sind. «Ich kenne meine Leser», betont Anni aber auch.«Tiergeschichten, Comics und Fortsetzungsgeschichten sindbei ihnen der Renner.»
Hat sich Anni für einige Bücher entschieden, gibt es zweiMöglichkeiten des Bestellens. «Entweder bestelle ich direktbeim SBD, oder ich gehe selbst in eine Buchhandlung», erklärtAnni. Die Vorteile der Bücher, die über den SBD bestellt wer-den: Die Katalog-Daten werden gleich mitgeschickt, die lästigeArbeit des Katalogisierens entfällt. «Das ist aber relativ teuer.Und ausserdem mag ich es, in eine Buchhandlung zu gehenund die Bücher selbst durchzublättern», fügt Anni hinzu.
Anni bedauert, dass sie relativ wenig Zeit hat, diese Bücherselbst zu lesen. «Ich würde sagen, ich habe maximal zehn Pro-zent der Bücher, die wir in der Bibliothek haben, gelesen»,schätzt Anni. Sie würde liebend gerne mehr lesen, um auch dieKunden besser beraten zu können.«Ich frage dann halt häufig die Leser,die ein Buch zurückbringen, wie esihnen gefallen hat», sagt Anni. DenKontakt mit den Leserinnen und Le-sern mag sie an ihrem Beruf nämlicham allermeisten. Sie findet es perfekt,dass die Bibliothek so klein ist und sie fast alle Kunden kennt.«Als Leiterin des Mukiturnens kenne ich jeweils etwa drei Kin-der einer Kindergartenklasse nicht, alle andern schon»,schmunzelt sie. «Ich bin immer wieder erstaunt, was für eingrosses Vertrauen die Kinder dadurch in mich haben.»
Auch das Beraten von Erwachsenen macht ihr Spass, auchwenn sie das häufig an ihre bibliothekarischen Grenzen bringt.«Ich finde es schwierig, eine Empfehlung abzugeben, wenn je-mand nicht weiss, was er lesen soll. Ich schaue dann jeweils imComputer nach, was die Person schon ausgeliehen hat, um ih-rem Geschmack auf die Spur zu kommen», erklärt Anni.
«Die Liebe zum Lesen ist bei
mir sozusagen vererbt.»Anni Wälchli
«Ich kenne meine Leser»
Anni WälchliAnni Wälchli, 47, an ihrem Arbeitsplatz.

Der Kunde ist KönigKein Aufwand ist für Anni zu gross, die Weisheit «Der Kun-
de ist König» beherzigt sie vollends. «Früher kamen häufig Kin-der, die ein Buch für einen Vortrag brauchten», erzählt Anni.«Oft hatten wir das passende Buch nicht, doch dann gingen wirhalt in die Buchhandlung und kauften eines.» Heute kommt esdurch das Internet fast nicht mehr zu solchen Situationen.Aber es ist auch jetzt noch möglich, einen Buchwunsch anzu-bringen. «Eine Frau sagte, dass sie gerne einmal italienischeBücher ausleihen würde. Also werden wir beim nächsten Be-such der Bibliomedia ein paar italienische Schmöker mitbrin-gen.»
Die Bibliomedia in Solothurn ist sozusagen eine Bibliothekfür Bibliotheken. «Wir haben etwa dreihundert Bücher von dortausgeliehen, jeweils für zwei Jahre. Nach einem Jahr wechselnwir den halben Bestand aus», erklärt Anni. So gibt es immerwieder Wechsel im Angebot der Bibliothek Brittnau, und da-durch ist es auch möglich, persönliche Wünsche anzubringen.
Zu alt um zu lesen?Seit einiger Zeit bietet sie beispielsweise Grossdruckbücher
an, um Senioren, die sich sonst nicht mehr an ein Buch wagenwürden, wieder zum Lesen zu begeistern. Vor einem Monatveranstaltete die Bibliothek deshalb speziell einen Anlass fürSenioren, bei dem Anni Wälchli das Angebot vorstellte. «Es ka-men dann auch einige Frauen, die zwar zuhörten, aber nichtsehr interessiert an unserem Angebot waren», lacht Anni. Diemeisten fanden, sie wären einfach zu alt fürs Lesen, und nurzwei haben dann tatsächlich ein Buch ausgeliehen. «Die eineFrau brachte das Buch kürzlich zurück mit der Einsicht, sie seiwirklich zu alt. Die andere Frau hat ihr Buch noch nicht zu-rückgebracht, ich glaube aber nicht, dass sie es ernsthaft liest.Sie ist immerhin schon 94», erzählt Anni.
Andere Anlässe in der Bibliothek laufen besser. An denVorlesestunden, die von November bis April monatlich statt-finden, nehmen jeweils 15 bis 20 Kinder teil, was Anni Wälch-li als Organisatorin sehr freut. «Ich suche jeweils extra für dieVorlesestunden neue Bilderbücher aus und mache Werbung imKindergarten», erklärt sie. Die gelernte Kindergärtnerin magKinder immer noch sehr und geniesst das Vorlesen. Ihre Töch-ter, 16, 18 und 20 Jahre alt, sind leider aus dem Alter raus, indem Bilderbücher interessant sind.
15 Dorfstrasse 14 Schulhaus 14
«Zwei meiner Töchter haben die Leidenschaft fürs Lesenaber von mir geerbt», findet Anni. «Die Jüngste verschlingt dieBücher regelrecht. Wie ich damals.» Auch ihren Mann bezeich-net sie als Leseratte.
Jugendliche kommen seltenIn der heutigen Zeit ist es eher ungewöhnlich, dass eine so
kleine Bibliothek überhaupt noch rentiert. Im 164. Jahr des Be-stehens ist es für Anni klar, das sie auch noch lange weiterbe-stehen wird. «Die Zahl derLeser ist seit Jahren kon-stant, nur das Alter der Leserhat sich verschoben. «Eskommen viele Unter- undMittelstufenschüler zu unsund Erwachsene. Doch Ju-gendliche sehe ich eher sel-ten», ist Annis Eindruck. Siehätte auch nichts gegen ei-nen grösseren Anteil männ-licher Leserschaft. «Beson-ders bei den Kindern ist esfast beängstigend, wie viel mehr Mädchen Bücher ausleihen.»Auch bei den Männern sieht das Ganze nicht anders aus. «Wirhaben ein paar treue Männer, die regelmässig Bücher auslei-hen», erzählt Anni Wälchli. «Und viele Frauen fragen mich, obich nicht ein Buch hätte, das auch ihr Mann lesen würde»,schmunzelt Anni. «Dann gebe ich ihnen jeweils eines der neu-en Grossdruckbücher mit nach Hause. Man weiss ja nie, viel-leicht trauen sie nur nicht zu sagen, dass sie die kleine Schriftgar nicht mehr lesen können.»
«Viele Frauen fragen mich,
ob ich nicht ein Buch hätte, dasauch ihr Mann lesen würde.»
Anni Wälchli

Dorfstrasse 14 16 17 Dorfstrasse 14
Hagebuttentee und frittierte Maden
Sandra Kurmann ist ein echtes «Reisefüdli». Zusammen mitihrem langjährigen Freund Marcel hat sie schon fast die ganzeWelt bereist. «Wir waren in den USA, Mexiko, Thailand, denPhilippinen, Kuba, Sri Lanka, Australien, Neuseeland und nochan vielen anderen Orten, an die ich mich jetzt gar nicht mehrerinnern kann», zählt Sandra auf. Obwohl sie erst 35 Jahre altist, könnte sie bestimmt problemlos einen Reiseführer schrei-ben.
Mann zu vergebenSandra ist seit 14 Jahren mit Marcel Banz zusammen, der
ganz in der Nähe der Dorfstrasse einen Töff-Laden führt. Diebeiden lernten sich durch die Mutter Marcels kennen, die mitSandra zusammenarbeitete.«Sie foppte mich immer undsagte: Ich hätte da noch ei-nen Mann zu Hause, schauihn dir doch mal an», erzähltSandra schmunzelnd. DieKollegin liess nicht lockerund überredete Sandraschliesslich. «So versprachich ihr halt doch, dass ichihn mir mal anschaue», fährtsie fort. Zusammen mit einerKollegin ging sie in Marcels Stammbeiz, damit die Möchte-gern-Schwiegermutter sie endlich in Ruhe lässt.
«Als wir die Beiz betraten und lauter junge Männer sahen,fiel uns ein, dass wir ja gar nicht wissen, wie Marcel aussieht»,erzählt Sandra. Glücklicherweise kannte die Kellnerin ihrenStammgast und zwinkerte den beiden zu, als Marcel zur Tür
hereinkam. «Marcel bestellte einen Hagebuttentee. Da war ichgeschockt. Ich wollte doch keinen Mann, der Hagebuttenteetrinkt!», lacht Sandra.
Marcels Mutter klärte Sandra dann jedoch am nächstenMontag auf, dass ihr Sohn nur erkältet sei. «Da war ich beru-higt. Aber trotzdem kam er für mich nicht in Frage. Schon nurdeshalb nicht, weil ich mich vorher immer weigerte, ihn anzu-schauen», gibt sie zu. Sie gestand sich nicht ein, dass er eigent-lich genau ihr Typ wäre. Marcels Mutter gab nicht auf. Auf ih-ren sechzigsten Geburtstag arrangierte sie ein weiteres Zusam-mentreffen der beiden – und tatsächlich: Sandra und Marcelverliebten sich.
Eine etwas andere TouristinSeit die beiden ein Paar sind, reisen sie jedes Jahr in ein an-
deres Land. Seit 14 Jahren schliesst das Töffgeschäft immerAnfang Jahr für drei Wochen, und Sandra und Marcel erkun-den einen weiteren Fleck Erde. «Marcel und ich schreiben dieLänder auf, die uns interessieren würden, und dann diskutierenwir, bis wir einer Meinung sind», erklärt Sandra das Auswahl-verfahren der Feriendestination.
Sandra ist überhaupt keine Touristin, die während denganzen Ferien am Hotelpool sitzt und sich bräunen lässt. Siewill die Kultur des jeweiligen Landes sehen. «Wir mieten unsein Auto und fahren durch das ganze Land. Mehr als drei Tagebleiben wir eigentlich nie an einem Ort.» Sandra findet, es wür-de jedem Menschen gut tun, einmal Einblick in ein anderesLand zu bekommen. «Ich schätze mein Leben jeweils wiederviel mehr, nachdem ich andere Kulturen gesehen habe», findetsie. Auswandern käme jedoch nicht in Frage. Die Familie ver-lassen zu müssen wäre für sie undenkbar.
Eine Wohnung – zwei Schwestern«Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen drei Schwes -
tern», erklärt Sandra. Die Geschwister treffen sich regelmässig,mindestens einmal im Monat. Sie unternehmen viel zusam-men, telefonieren und sind immer füreinander da. Schon seitihrer Kindheit verstehen die Schwestern sich blendend. Vor al-lem zu Connie, der zwei Jahre jüngeren, hat Sandra ein sehr in-niges Verhältnis. «Wir gingen zusammen in den Ausgang undhatten den gleichen Freundeskreis», erzählt Sandra. Ihre Bezie-hung war so gut, dass die beiden beschlossen, zusammen ineine Wohnung zu ziehen. «Kollegen sagten schon, dass wir dasnicht lange aushalten würden und es bald Streit gebe», gestehtSandra. Doch dazu kam es nie. Erst als beide hoffnungslos ver-liebt waren, zog es sie auseinander. Connie zog zu ihremFreund und Sandra zu Marcel.
Mit Marcel hat Sandra schon viele lustige, traurige undspannende Dinge erlebt – ganz besonders auf ihren gemeinsa-men Reisen. Mulmig wurde es ihr zum Beispiel in Mexiko, alssie Zuhörerin einer Schiesserei wurde. Zwei Männer hattensich, morgens um zwei, in ihrem Hotel gegenseitig abgeschos-sen. «Mir war schon nicht ganz wohl. Ich wusste ja nicht, obdie gleich in mein Zimmer stürmen und auf mich zielen», er-klärt Sandra. An diese Reise hat sie jedoch nicht nur deswegenschlechte Erinnerungen. Die Armut, welcher sie auf ihrer Fahrtdurch das Landesinnere Mexikos begegnete, machte ihr sehr zuschaffen. «Ich habe nur noch geweint», kann sich Sandra erin-nern. Ihr ist der Appetit vergangen, als sie in einem Restaurantsassen und draussen die Leute um etwas zu essen bettelten. Indie für sie schlimmste Situation gelangten die beiden jedoch inThailand. Beim Goldenen Dreieck, einer Region im Grenzgebiet
«Ich wollte doch keinen Mann,
der Hagebuttentee trinkt!»
Sandra Kurmann
Sandra Kurmann, 35, zeigt eines ihrer zahlreichen Fotoalben.

Dorfstrasse 14 18 19 Dorfstrasse 17A
der Staaten Laos, Myanmar und Thailand, wurden sie vom Mi-litär angehalten. Der eine Mann streckte den Lauf seiner Flinteins Auto, der andere bewachte die zweite Autotür. «Marcelmachte Witzchen und tat so, als verstehe er die Männer nicht.Ich war furchtbar nervös. Denn sie wollten uns ausrauben undwas hätten wir getan, wenn sie unseren Pass mitgenommenhätten?», erzählt Sandra. Dadurch, dass Marcel ruhig blieb undden ahnungslosen Touristen mimte, waren die Männer nacheiniger Zeit so genervt, dass sie das Auto durchwinkten.
In Thailand fanden sie ausserdem einen Schweizer Aus-wanderer, der in voller Lautstärke Polo Hofer hörte und ihnenvor allem die Esskultur der Thailänder näher brachte. So pro-bierte Sandra frittierte Maden, die wie Erdnussflips schmeckensollen, oder trank Schnaps, worin eine tote Schlangeschwamm. «Ich habe schon viel bestellt und gegessen, ohne zuwissen, was es ist», schmunzelt Sandra. Sie hat mit Marcel aberauch schon Situationen erlebt, über die sie sich heute nochamüsiert. Auf der allerersten Reise ging es nach Amerika. San-dra konnte fast kein Wort Englisch und Marcel bluffte mit sei-nen Sprachkenntnissen herum. «In einem Restaurant fragte
mich Marcel, was für einenKaffee ich haben möchte. Ichwünschte mir einen CaféCrème. Er bestellte dann einenganz normalen, schwarzenKaffee», beginnt Sandra zu er-zählen. «Als der Kellner denKaffee brachte, fragte ichMarcel, wo denn jetzt dieMilch sei. Er sagte, das seikein Problem, er bestelle mirnoch ein bisschen Milch.»
Sandra lacht, als sie erzählt, was ihr der Kellner schliesslichbrachte: Ein ganzes Glas Milch. «Noch Jahre später zog ich ihndeswegen auf», schmunzelt sie.
Die EntdeckerinAber was macht Sandra den Rest des Jahres, wenn sie nicht
gerade frittierte Maden isst oder einer Schiesserei zuhört? «Ichbin Non-Food-Leiterin des Migros Schönbühl in Luzern», klärtSandra auf. Auf die Frage, was sie denn dort den ganzen Tagmache, antwortet sie gewitzt: «Chef sein und warten, bis derTag vorbei ist.»
Ganz so locker ist es dann doch nicht. Sie ist zwar wirklichChefin über sieben Leute, hat aber auch viel mit den Kunden zutun.
Sandra machte eine Ausbildung als Kleiderverkäuferin undbildete sich danach zur Branchenspezialistin Kleider weiter.Heute ist sie jedoch nicht mehr für Kleider, sondern für das ge-samte nicht essbare Sortiment der Migros zuständig.
Als Angestellte der Migros kann sie kostenlos eine gewisseAnzahl Kurse in der Migrosklubschule besuchen. Von diesemAngebot macht Sandra regenGebrauch und war schon in denverschiedensten Kursen: Kochen,Englisch, Sophrologie, einemPC-Kurs, einer Farb- und Stilbe-ratung und Fussballkunde fürFrauen. «Ich probiere immer wie-der etwas Neues aus», kommen-tiert Sandra ihre Wahl.
Sandra ist eine richtige Entdeckerin. Nicht nur beim Rei-sen, auch im Beruf: Zweimal dasselbe zu tun findet sie lang-weilig, sie ist ständig am Entdecken von Neuem und Unbe-kanntem. «Nächstes Jahr möchte ich in den Norden Europas,da waren wir noch nie», bestätigt Sandra die Theorie. «Ich habe schon
viel bestellt und gegessen,
ohne zu wissen, was es ist.»Sandra Kurmann
«Ich probiere immer wieder
etwas Neues aus.»Sandra Kurmann

Dorfstrasse 17A 20 21 Dorfstrasse 17A
Einmal Bündnerland und zurück
«Die Erdbeertorte, die ich dir servieren wollte, ist leidernoch nicht fertig. Irgendwie hinken wir heute im Zeitplan hin-terher.» Karin und Oliver Huber, beide 35, begrüssen michherzlich und voller Elan. «Ich muss nur noch schnell Silas insBett bringen», bemerkt Oliver, doch der einjährige Silas hatdarauf jetzt keine Lust mehr. Er findet den Besuch furchtbarspannend. Er schaut mich mit seinen grossen blauen Augenvoller Neugier an und lächelt breit.
Wir nehmen auf dem kleinen Balkon im zweiten Stock desMehrfamilienhauses Platz. Es herrscht wunderbares Wetter,leise hört man einen Rasenmäher und die Nachbars-WG, dieam Pokern ist.
Sportliche FamilieDie Hubers wohnen seit September 2007 in diesem Mehrfa-
milienhaus in Brittnau. Das Dorf gefällt ihnen, vor allem we-gen der Lage. Es liegt genau zwischen Holziken, wo ihre Fami-lien wohnen, Langenthal, wo Oliver arbeitet und Zofingen, woKarin als Hauswirtschaftslehrerin eine Stelle hat. Ausserdemliegt die Dorfstrasse im Zentrum Brittnaus, was Karin betref-fend Einkaufen praktisch findet. «Silas liebt es ausserdem, denSchülern auf dem Pausenplatz zuzuschauen», erzählt Karin.Und ihr gefällt es, dass sie die Turner vom Balkon aus beob-achten kann. Oliver hingegen betreibt lieber gleich selbstSport. «Ich mache gerne Sport, besonders Joggen. Und da fin-de ich die Nähe zum Wald perfekt.» Auch Karin gefällt dasLändliche, in einer Stadt zu wohnen wäre für sie undenkbar.
Es wäre wohl auch ein allzu grosser Kulturschock gewesen,wenn sie vom idyllischen Bergdorf in eine Stadt gezogen wä-ren. Denn die beiden lebten, bevor sie nach Brittnau zogen,drei Jahre in Cazis, einem 1500-Seelen-Dorf im Bünderland.
Karin arbeitete als Hauswirtschaftslehrerin an der Schule St.Catharina in Cazis, einem halbprivaten, christlichen Internat.«Es war eine harte Zeit, ich habe noch nie so viel gearbeitet wiedamals», sagt Karin rückblickend. «Dort ist Hauswirtschaft vielwichtiger. Ich unterrichtete die Fächer Ernährung, Kochen undHauswirtschaft, nicht wie hier an der Volksschule. Ich arbeite-te jeweils bis spät in die Nacht, musste alle Arbeitsblätter neuentwickeln. Die Theoriestunden kamen mir ewig vor.» Derenorme Druck und die ständige Präsenz an der kleinen Schulemachten ihr zu schaffen. Und dennoch war es ihre Traumstel-le: «Die Atmosphäre der Schule war mir von Anfang an sym-pathisch. Dort zählt das Argument nicht, man möchte kein zugrosses Pensum, um genügend Zeit für die Familie zu haben.»Ausserdem genoss Karin die christlichen Aspekte der Schule:das Beten vor Sitzungen, das Beten für die eigene Familie undder enge Zusammenhalt.
Vom Glauben und dem BergseeKarin ging schon als kleines Mädchen regelmässig und
gerne in die Sonntagsschule. «Meine Eltern wollten einfacheine Stunde Ruhe, doch mit der Kirche konnten sie nichts an-fangen.» Ganz im Gegenteil zu Karin. Sie traute sich später fastnicht ihren Eltern zu sagen, dass sie Sonntagsschulleiterinwerden möchte. Der christliche Glaube war ihr auch wichtig,als es um die Partnerwahl ging. Und damit punktete Oliver beiKarin überhaupt nicht. Und dennoch sind Karin und Oliver seitfast sieben Jahren ein glückliches Ehepaar.
Auf die Frage, wo und wann sie sich kennenlernten, kön-nen sie keine exakte Antwort geben. Sie gingen an dieselbeSchule, Karin in die Bez und Oliver in die Sek. «Ich wussteschon, wer er war, doch ich fand an ihm wirklich nichts Be-
sonderes», schmunzelt Karin. Erst ein paar Jahre später im Aus-gang hat es dann gefunkt. Sie spielten gemeinsam Billard,quatschten miteinander und lernten sich immer näher kennen.Oliver wusste, dass Karin in der Kirche engagiert war. Als Karinhoffnungsvoll die Frage nach seinem Glauben stellte, antworteteOliver dennoch ziemlich unromantisch: «Ich glaube an Einzel-ler.» Für Karin brach eine halbe Welt zusammen. «Ich hatte so ge-hofft, mal einen Christen kennenzulernen. Als Oli mir das sagte,brach ich in Tränen aus.» Karin war schon wieder in einen Nicht-Christen verliebt… Doch Oliver war bereit, sich mit dem Glaubenauseinander zu setzen. Karin zuliebe kam er sogar mit in denGottesdienst. Als sie dann eines Tages zusammen in den icf Zü-rich (International Christian Fellowship) gingen, entschied aucher sich endgültig für Gott. Und im Bündnerland liess sich Oliver
schlussendlich im eiskalten Wasser eines Bergsees taufen. Der Glauben war auch ausschlaggebend für den Umzug
von Holziken nach Graubünden. Oliver arbeitete in einer Bankin Küttigen, und es ging ihm zunehmend schlechter. Alles wur-de zu viel. Er war Präsident des Turnvereins, arbeitete ehren-amtlich in der EMK (Evangelisch-methodistische Kirche),machte neben seinem Job ein Diplom zum eidg. dipl. Bank-fachmann - welches er nicht bestand - und hatte enorme Pro-bleme mit seinem Chef. Er begann sich zu fragen, wo dennüberhaupt seine Berufung liege und machte sich über einenNeuanfang Gedanken.
Zu dieser Zeit arbeitete Karin schon sieben Jahre in Stren-gelbach als Hauswirtschaftslehrerin. Als sie eines Tages ein In-serat des Internats Cazis in einer Lehrerzeitschrift sah, begann
Silas, 1, Karin, 35 und Oliver Huber, 35, auf dem Spielplatz hinter ihrem Haus.

Dorfstrasse 17A 22 23 Dorfstrasse 17A
ihr Herz schneller zu schlagen. «Ich wurde ganz nervös. Allestönte so perfekt: 100%-Pensum an einer Halbprivatschule alsHauwirtschaftslehrerin. Unterricht in den Fächern Ernäh-rungslehre, Hauwirtschaft und Kochen.» Ohne Oliver etwas zuerzählen, rief sie im Internat an, in der Hoffnung, das Ganzehabe irgendeinen Haken. Doch das Gegenteil war der Fall: DieLeiterin der Schule war Ka-rin von Beginn an sympa-thisch. Ganz aufgeregt er-zählte sie Oliver am Abendvon den Begebenheiten.«Ich sagte: Oliver, hast dugewusst, wir gehen insBünderland!», berichtet Ka-rin. Oliver erzählt, er habedas damals nicht so ernstgenommen und fand, siesolle sich doch einfach mal bewerben. «Karin sagt noch viel,doch ich habe nicht geglaubt, dass sie das ernsthaft tun wird.»,gibt Oliver zu.
Doch da täuschte sich Oliver gewaltig. Für das Ehepaarheute schier unglaubliche Dinge geschahen: Die einzige Woh-nung, die in Cazis zu vermieten war, stellte sich als die Traum-wohnung der beiden heraus, die Beziehung zu den Vermieternwar super und die Schule war der Wunsch-Arbeitsort Karins.
So entschieden sich die beiden schweren Herzens, von derFamilie und Freunden Abschied zu nehmen und zogen im Juni2004 nach Cazis. «Wir sahen dies als Zeichen von Gott undstellten uns deshalb dieser Herausforderung.»
Silas«Es war eine schwierige, aber wertvolle Zeit», sagt Oliver
rückblickend. Als Karin im Internat arbeitete, hatte er keineArbeit. Er war auf der Suche nach einem Neuanfang, wolltenicht mehr in einer Bank arbeiten. Er hatte viel Zeit um nach-zudenken, für die Beziehung, Freunde, Sport und ehrenamtli-che Arbeiten. «Ich wartete auf ein Zeichen Gottes», sagt Oliverzu diesem Lebensabschnitt. Schlussendlich fand er doch wie-der einen Job in einer Liechtensteiner Bank, 40 Autominutenvon Cazis entfernt. Als Karin schwanger wurde, war der langeArbeitsweg mit ein Grund für die Frage, wie es weitergehensoll. «Wir fragten uns, ob wir unser Kind hier aufwachsen las-sen wollen, weit weg von der Familie. Und wir merkten, dass
wir eigentlich ganz gerne wieder zurück ins Unterland gehenmöchten.» Im September 2007, nach drei Jahren Bündnerland,zog die nun dreiköpfige Familie deshalb nach Brittnau.
Auch dort spürten sie die Gegenwart Gottes, als es um Oli-vers Job ging. «Ich fand im Internet eine super Stelle, jedochwar die Anmeldefrist schon seit zwei Wochen abgelaufen. Ichschrieb trotzdem mal ein Mail und wurde schlussendlich zu ei-nem Bewerbungsgespräch eingeladen.» Alles ging furchtbarschnell. Oliver arbeitet nun seit Oktober in der Klinik SGM inLangenthal als Verantwortlicher der Informatik. Er ist Chefüber 65 PCs, verantwortlich für Server, Netzwerk, Support undSchulungen. Er hat sich schon immer gerne mit Computern be-fasst und hat nun seinen Traumjob gefunden. In nächster Zeithat er vor, eine Weiterbildung zum Informatiker zu machen.
Als Karin von der 80%-Stelle erfuhr, war sie erst ent-täuscht. «Ich habe mich schon auf die Rolle als Mutter undHausfrau gefreut.» Finanziell war es jedoch nötig, dass auch siearbeiten geht. Und heute empfindet sie es als Bereicherung,zwei Tage pro Woche in Zofingen Schule geben zu können.
Karin und Oliver Huber betonen immer wieder, wie un-glaublich sie es finden, was ihnen alles in die Hände gefallenist. Sie sind dankbar für die Zeit im Bündnerland und sehen sieals echte Bereicherung.
Die Erdbeertorte – zweiter TeilNach unserem Gespräch auf dem schmucken Balkon - Va-
ter und Sohn haben sich unterdessen kameratauglich umgezo-gen - geht es für das Foto runter auf den Spielplatz. Silas hat-te sowieso keine Lust zu schlafen, plapperte ständig vor sichhin oder übte sich imRumpfbeugen machen(Kommentar Karins:«Der kommt ganz nachseinem Vater, eine echteSportskanone!»). DieSchaukel gefällt Silas,wenn es nach ihm ginge- so seine Mutter - würde er sich stundenlang von Mama an-schupsen lassen. Doch dafür ist heute keine Zeit. Es steht einBesuch bei den Grosseltern von Silas an und Karin muss janoch die Erdbeertorte fertig machen, die sie mir eigentlich ser-vieren wollte.
«Ich sagte: Oliver, hast du
gewusst, wir gehen ins Bündnerland!»
Karin Huber
«Ich wartete auf ein Zeichen Gottes.»
Oliver Huber
Vom Totenkopf zur Blume
Ich bin kein WG-Typ», findet Manuela Koller, 24-jährig.Aus diesem Grund lebt sie alleine in ihrer aufgeräumten Woh-nung im zweiten Stock. Sie wünschte sich ab und zu eine Mit-bewohnerin oder einen Mitbewohner, der ihr eine Tasse Tee ansBett bringt, wenn sie krank ist. «Ich bin manchmal schon trau-rig, wenn ich nach Hause komme und alles noch genau amgleichen Platz liegt wie als ich ging. Ich fände es schön, wenndie Wohnung schon leben würde, wenn ich heimkomme. Mu-sik, jemand der einem begrüsst oder so.» Doch Manuela betont,dass sie sowieso nicht allzu oft zu Hause ist. Wenn sie nicht ge-rade den Haushalt machen muss, ist sie in Strengelbach.
Ihr wahres ZuhauseStrengelbach ist Manuelas eigentliches Zuhause, insbeson-
dere die Freie Missionsgemeinde Strengelbach. Ob Jungschi,Teamgebet, Jugendgottesdienst, Kleingruppe oder Planungs-sitzung: Fast jeden Abend läuft irgendetwas. Und auch amWochenende ist sie kirchlich engagiert. Jeden zweiten Samstagleitet Manuela die Ameisli, die jüngsten Kinder der Jungschar.«Und dann gibt es nochdas jährliche Auffahrts-lager und das Sommer-lager, das jedes zweiteJahr stattfindet», er-gänzt sie. ManuelasAugen leuchten, als sievom gerade vergange-nen Auffahrtslager er-zählt. «Ich war im Vor-bereitungsteam, hielteine Andacht, half Auf-
stellen und leitete bis zumSchluss mit», zählt sie auf.Es sei schon ein grosserAufwand, doch das, wasdie Kinder zurückgeben,sei wunderbar.
Als sie vor zwei Jahrenin die Gemeinde kam, wares für sie klar, dass sie sichengagieren möchte. «Ichwollte möglichst schnellLeute kennenlernen. Das geht am einfachsten, wenn du mit-hilfst», erklärt Manuela. Da sie schon Erfahrung im Leiten vonKindern und Teenagern hatte, war die Jungschi am nahelie-gendsten. Später wurde ihr auch bestätigt, dass ihr Engage-ment genau zur rechten Zeit kam. «Die Jungschileiter vergli-chen mich schon mit dem Puzzleteil, das ihnen gefehlt hat undgenau passt», erzählt sie.
Ein Grund mehr, dass sich Manuela in dieser Kirche wirk-lich zuhause fühlt und dort ihre «Familie» gefunden hat, mitder sie ihr ganzes Leben teilen kann.
Schwimmend Freundin gefundenZu ihrer wirklichen Familie fühlt sie sich seit ihrer Bekeh-
rung vor fünf Jahren distanziert. «Sie akzeptieren meinenGlauben, können ihn aber nicht verstehen. Sie finden, dass sieja auch Christen sind, den Unterschied sehen sie nicht», ver-sucht Manuela zu erklären. Der Unterschied liegt für sie darin,dass sie «wiedergeboren» sei, sich also konkret für Jesus ent-schieden habe. Dieser Entscheid ist für sie das schönste Erleb-nis ihres bisherigen Lebens. Sie muss zuerst nach Worten su-
«Ich fände es schön, wenn die Wohnung schon leben würde,
wenn ich heimkomme.Musik, jemand der
einem begrüsst oder so.»
Manuela Koller
«Die Jungschileiter verglichen mich schon mit dem Puzzleteil, das
ihnen gefehlt hat und genau passt.»
Manuela Koller

Dorfstrasse 17A 24 25 Dorfstrasse 17A
chen, die ihre damaligen Gefühle beschreiben können, denn siesind für sie kaum fassbar. Doch bis es zu diesem für Manuelahistorischen Moment kam, brauchte es seine Zeit.
Die Geschichte begann im letzten Lehrjahr als Industrie-polsterin. Damals bekam sie eine neue Unterstiftin, Ursi. «DasKlima im Geschäft war sehr schlecht, wir sagten uns nicht ein-mal mehr «Guten Morgen». Doch Ursi war immer gut aufgelegt,lachte und begrüsste alle. Ich dachte, das macht sie auch nichtlänger als zwei Wochen», schmunzelt Manuela. Doch als Ursinach zwei Monaten immer noch lächelnd die Werkstatt betrat,war Manuela sprachlos. «Da wir beide übergewichtig waren,beschlossen wir eines Tages spontan, zusammen schwimmenzu gehen.» Die ersten Male noch aufs Schwimmen konzen-
triert, nahm Manuela einmal all ih-ren Mut zusammen und fragte Ursi,weshalb sie immer so gut gelaunt sei.«Sie erzählte mir, dass ihr ihr Glau-ben die Kraft dazu gebe.» Manuelawar interessiert an diesem Glauben,und so verbrachten sie die nächstenBadibesuche eher mit Reden als mitSchwimmen. «Eines Tages erzählte
Ursi mir auch, dass sie jeden Sonntag in die Kirche gehe», kannsich Manuela erinnern. Sie weigerte sich, Ursi zu begleiten, sieschlafe ja sowieso ein. Doch Ursi versprach ihr, in eine Kirchezu gehen, wo sie sicherlich nicht einschlafen werde.
Manuelas Neugier siegte, und sie erlebte in Zürich, in derJugendkirche icf, einen unvergesslichen und überhaupt nichtermüdenden Gottesdienst. «Es gefiel mir so gut, dass wir dienächste Woche gleich wieder dorthin gingen», lacht Manuela.Und dann kam der Moment, der Manuelas Leben um mindes -tens 180 Grad wendete, wie sie es ausdrückt.
Notbremse vor dem Abgrund«Ich war ein schlimmer Teenager», findet Manuela. Doch
ihre Kindheit war auch nicht ganz einfach. Als sie drei Jahre altwar, diagnostizierte man bei ihrem damals einjährigen BruderKrebs. «Meine Eltern kümmerten sich von da an fast nur nochum meinen Bruder. Ich fiel nur noch negativ auf, das Positiveging unter.» Um beachtet zu werden, übte Manuela nun regel-recht, sich schlecht zu benehmen, und der Hass auf ihren Bru-der stieg. «Mein Bruder nutzte die Beachtung natürlich auchaus, besonders als er geheilt war», weiss Manuela.
Ihr Übergewicht warein weiterer Faktor, der ihrihre Kindheit wortwörtlicherschwerte. Sie wurde nichtnur in der Schule gemobbt,auch ihr Bruder gab seineKommentare ab. Manuelabegann sich zu wehren,verbal oder mit Gewalt.«Ich schlug zu, war inSchlägereien verwickeltund sicher jedes zweiteWort war gelogen», erin-nert sich Manuela zurück.Sie imitierte eine dickeHaut, doch die Beleidigun-
gen verletzten sie zutiefst. «Irgendwann glaubte ich selbst, ichsei hässlich», sagt sie. «Ich wurde geduldet, jedoch nicht ange-nommen.» Manuela ging es sehr schlecht, sie wusste nichtmehr weiter. Sie betont, dass es damals nicht mehr lange soweitergegangen wäre. «Jesus war die Notbremse vor dem Ab-grund», ist sich Manuela sicher.
«Peng!»Nach dem zweiten Besuch des icf gerieten Ursi und Ma-
nuela in einen Stau, verursacht durch einen schweren Unfall.«Die Rega kam, und ich fragte Ursi, was wohl mit mir gesche-hen würde, wenn ich in diesem Auto gesessen hätte und nuntot wäre», erzählt Manuela. Ursi sagte ihr, dass es für sie wohlnicht so rosig aussehen werde. Damit meinte sie, dass Manue-la ihrer Meinung nach in die Hölle käme, da sie noch kein rich-tiger Christ sei. «Da war für mich klar, dass ich mich bekehrenwill.» Sie ging nach Hause, hörte eine Worship-CD, kniete sichvor das Bett und betete. Manuela sucht die passenden Worte,um ihre damaligen Gefühle, die sie noch ganz genau in Erin-nerung hat, zu beschreiben. «Ich fühlte mich wie aus einem Kä-fig befreit. Ich spürte eine extreme Liebe und Wärme, ich wuss-te: Jetzt bin ich daheim», beschreibt sie. Einfach gesagt: Esmachte «Peng!».
Dieses «Peng!» veränderte Manuela von Grund auf. «Anmeiner Zimmertür hing zum Beispiel ein Totenkopf und ein«Privat»-Schild. Gleich nach meiner Bekehrung wechselte ichden Totenkopf mit einer Blume und das «Privat»- mit einem
«Ich war ein schlimmer Teenager.»Manuela Koller
«Gleich nach meiner Bekehrungwechselte ich den
Totenkopf mit einer Blume und
das «Privat-» mit einem «Herz-lich willkommen»-
Schild aus.»Manuela Koller
Manuela Koller, 24, auf ihrem selbst gepolsterten Sessel.

Dorfstrasse 17A 26 27 Dorfstrasse 18
«Herzlich wilkommen»-Schild aus», kann sichManuela noch haarge-nau erinnern. Ihre El-tern verstanden die Weltnicht mehr, taten dieVeränderung der 18-jährigen Tochter mit derTatsache ab, dass diesewohl die Pubertät hintersich habe. Doch für Ma-nuela begann ein voll-kommen neues Leben.
Innerhalb von dreiJahren ging sie in siebenAdonia-Lager, in denen junge Christen eine Woche lang inten-siv ein Musical üben, welches noch im Lager vor jeweils gros-sem Publikum aufgeführt wird. Die Gemeinschaft mit anderenjungen Christen, eine Woche nur für Gott zu leben, faszinier-ten sie. Manuela machte den Leiterkurs und leitete danach Ju-nior-, Teens-, und Family-Lager. «Ich stehe gerne zu meinemGlauben», sagt Manuela und freute sich an jedem Glaubens-schritt, den ihre «Schützlinge» machten.
Brittnau - Region der KirchenMit Hüpfburgen und Fussbällen Lebensunterhalt verdie-
nen. Adonia führte Manuela schlussendlich auch nach Britt-nau. «Ich lernte den Teensleiter von Adonia kennen, und derlud mich ein, einmal mit nach Strengelbach in die FMG zukommen.» Die Gemeinde gefiel ihr sehr gut und sie merkte, wasfür ein grosses Angebot an Freikirchen rund um Zofingen zufinden ist, ganz im Gegensatz zum Luzerner Hinterland, wo siewohnte. Dies und die Tatsache, dass viele Adonia-Anlässe indieser Region stattfinden, bewogen sie zu dem Schritt, nachBrittnau zu ziehen. «Es ist meine erste eigene Wohnung undauch die einzige, die ich mir damals anschaute. Doch als ich siebetrat, war mir klar: Das ist meins.»
Mit Hüpfburgen den Lebensunterhalt verdienenNun wohnt Manuela seit zwei Jahren in «ihrer» Wohnung.
Einmal im Monat besucht sie dort ihr Bruder, mit dem sie heu-te ein sehr gutes Verhältnis hat, und sie kocht für ihn. Auch inihrem Beruf fühlt sie sich wieder wohl. Nachdem sie eine zwei-
te Ausbildung als Dekorationsnäherin gemacht hat, arbeitet sienun seit sieben Monaten in einer Werbefirma als Werbetechni-kerin. Dort näht sie riesige aufblasbare Dosen, Tiger, Fussbälleund Hüpfburgen. «Mir gefällt der Job sehr, es ist eine sehr ab-wechslungsreiche Arbeit. Doch mein grösster Wunsch ist dieBibelschule zu machen und danach für das Reich Gottes zu ar-beiten», sagt Manuela. «Und ich möchte natürlich einen liebenMann kennenlernen, Mutter werden und meinen Kindern diechristlichen Werte vermitteln.»
Da hat Manuela noch einiges vor. Doch sie hat Recht: «Ichbin ja noch jung!»
«Es ist meine erste eigene Wohnung
und auch die einzige, die ich mir damals
anschaute. Doch als ich sie
betrat, war mir klar: Das ist meins.»
Manuela Koller

Dorfstrasse 18 28 29 Dorfstrasse 18
«Mir war noch nie langweilig.»
Klara Hochuli liebt die Natur. Auf ihrem Balkon stehen ver-schiedenste Topfpflanzen – in allen Grössen und Formen.«Aber das ist nur ein kleiner Teil meines Gartens», bemerkt sie.«Unten habe ich dann noch einen richtigen, nicht nur so Töp-fe.» Glücklicherweiseregnete es in den letztenTagen, und so mussteKlara die Pflanzen nichtgiessen. Denn sie merkt,dass sie nicht mehrzwanzig ist. «Rücken-schmerzen, Arthritis,was man halt im Alterso hat», zählt die 80-Jährige ihre Leiden auf.«Aber man muss das anschauen, was man kann und nicht das,was man nicht kann!»
Diese Devise hat sich Kläri zu Herzen genommen. KeinSeufzer, kein «Ach hätte ich das doch damals anders gemacht»oder «Es wäre halt doch schön, wenn…». «Ich bin mit dem zu-frieden, was ich habe und an das andere denke ich nicht», er-zählt Klara im Brustton der Überzeugung.
Zuhören ist ihre StärkeKläri ist auch viel zu beschäftigt, um auf solche Gedanken
zu kommen. «Mir war noch nie langweilig», ist sie überzeugt.Sie hatte immer etwas zu tun und sorgt auch heute dafür, dassdas so bleibt. «Nur noch auf dem Sofa sitzen – Das möchte ichmöglichst lange hinausschieben», erklärt Kläri. Wegen ihrerHerzoperation vor zwei Jahren musste sie jedoch mit einigenTätigkeiten aufhören. So zum Beispiel mit der freiwilligen Mit-
arbeit im Altersheim Zofingen, wo sie 15 Jahre arbeitete oderdie zehnjährige Mitgliedschaft im Vorstand des Frauenvereins,wo sie für die Hauspflege zuständig war.
Kläri hat aber immer noch genug zu tun. Sie ist bei den Na-turfreunden Brittnau und nimmt an den monatlich zwei- bisdreimal stattfindenden Wanderungen teil. Ausserdem ist sie –sozusagen als Weiterführung ihrer Mitarbeit im Altersheim –Mitglied des Besuchsdienstes. «In der Kirche erzählte der Pfar-rer, dass sie Leute suchen, die regelmässig ältere Menschen be-suchen, um mit ihnen zu plaudern und ihnen vor allem zuzu-hören», beginnt Kläri. Sie konnte sich diese Mitarbeit gut vor-stellen und meldete sich. Nun geht sie oft ins Altersheim undbesucht «ihre» Leute. «Es sind auch Freundschaften entstan-den», findet Kläri. «Ich kann gar nicht mehr nicht gehen, dieLeute warten auf mich.» Kläri blüht in dieser Arbeit auf, siekann von ihrer grossen Stärke – dem Zuhören – profitieren.
Auch wenn sie lieber zuhört, zu erzählen hat Kläri genug.Sie wohnt seit ihrer Geburt in diesem Haus, ging nur ausbil-dungshalber für acht Jahre von Brittnau weg. Kläri findet, dasses vor 80 Jahren an der Dorfstrasse gar nicht so anders aussah.«Eigentlich war es fast gleich, ausser dass statt dem Gemeinde-haus eine alte Scheune stand», erklärt sie. Ausserdem warendie Bewohner jahrzehnte-lang dieselben, man kanntesich gegenseitig. «Ich binnoch die Einzige, die vondiesen Leuten von damalslebt», bemerkt sie.
Der Hausteil, in demKläri heute lebt, war früherein Holzlager. Ihr Vater war
Schreiner und hatte im gleichen Haus seine Schreinerei, eineEtage höher wohnte die Familie. Die Lehrlinge, die Kläris Vaterausbildete, wohnten im selben Haus und assen mit der Familie.So lernte Kläri auch ihren zukünftigen Mann kennen.
«Max war Schreinerlehrling bei meinem Vater und wardeshalb allgegenwärtig. Er ass am gleichen Tisch, schlief imgleichen Haus, da konnte ich ihn einfach nicht übersehen»,schmunzelt Kläri. Sie war 14 Jahre alt, als sie ihn kennenlern-te. Nach der Schulzeit ging sie für ein Jahr ins Welsche undmachte danach verschiedene Nähkurse, die für ihre Ausbil-
«Man muss das anschauen, was
man kann und nicht das, was man nicht kann.»
Klara Hochuli
«Nur noch auf dem Sofa sitzen - das möchte ich möglichst lange hinausschieben.»
Klara Hochuli
Klara Hochuli, 80, auf ihrem Balkon.
dung Grundlage waren. In dieser Zeit kamen sich Kläri undMax näher und verliebten sich. «Mein Vater merkte nichts, ob-wohl wir unsere Liebe nicht speziell versteckten», lacht Kläri.
Die Liebe gefunden...Nach dem Absolvieren der zahlreichen Nähkurse ging Klä-
ri mit 17 von zu Hause weg, um die Hausbeamtinnenschule inSt. Gallen zu besuchen. «Ich konnte mich zwischen Schreinerinund Hausbeamtin entscheiden», erklärt Kläri. «Meine Elternhätten mir erlaubt, Schreinerin zu werden, obwohl das damals

Dorfstrasse 18 30 31 Dorfstrasse 22
für eine Frau sehr speziell gewesen wäre. Aber ich entschiedmich dann doch für die Hausbeamtin.» In der zwei Jahre dau-ernden Schule lernte sie, einen Haushalt zu führen und zu or-ganisieren. Danach arbeitete sie in einem Berner Privathaus-halt und später in der Postküche in Bern. «Ich war Hausbeam-tin eines Mediziners, der im selben Haus seine Praxis hatte. Ichleitete die zahlreichen Angestellten, half im Haushalt und inder Praxis mit», beschreibt Kläri ihren Job.
Kläri ging regelmässig zurück nach Brittnau und die Liebezu Max wurde immer grösser. Mit 25 war es schliesslich soweit: Die beiden heirateten. Kläri gab ihren Job auf und warnun für den Haushalt und das Büro der Schreinerei zuständig.Ihr machte dieser Wechsel nichts aus, hatte sie ja schon immerberuflich mit dem Haushalt zu tun. «Das Schöne war ja auch,dass Max die ganze Zeit im Haus war», findet Kläri. «Die vierKinder halfen auch viel unten in der Schreinerei und sahen ih-ren Vater deshalb sehr viel.»
1982 starb Max an einem Herzinfarkt. «Er hatte schon ein-mal einen Herzinfarkt, und wir wussten, dass es jederzeit wie-der passieren könnte.» Trotzdem war Kläri geschockt, als einesTages das Telefon klingelte und ihr mitgeteilt wurde, dass ihrMann bei einem Kunden einen zweiten Herzinfarkt erlittenhabe. «Ich stellte mich an die Strasse und stoppte irgendeinAuto, um möglichst schnell zu dem Haus zu gelangen, in demMax zusammengebrochen war», erzählt Kläri. Doch auch dieHerzmassage und Beatmung nützte nichts mehr: Max war tot.
… und verloren«Es war ein harter Schlag», sagt Kläri. «Plötzlich musste ich
alle Dinge alleine tun, die ich früher mit Max tat. Und ichkonnte niemandem mehr etwas erzählen, wenn ich nach Hau-se kam.» Eine schwierige Zeit, doch Kläri betont, dass sie sichschnell wieder beschäftigte, um auf andere Gedanken zu kom-men. Für sie war klar, dass sie die Schreinerei übernimmt. Siewollte es zumindest versuchen.
Kläri hatte zwar einen Mitarbeiter, sass jetzt aber nichtmehr nur im Büro.
Glücklicherweise besuchte sie schon ab 1970 handwerkli-che Kurse, unter anderem im Teppichverlegen, und war somitfähig, die Schreinerei zu führen. «Ich ging zu den Kunden nachHause und verlegte dort Teppiche», erzählt Kläri. «Die zweiMitarbeiter halfen mir beim Tragen des schweren Teppichs.» Eswar eine enorm anstrengende Zeit, Kläri lebte nur noch für die
Arbeit. Nach sieben Jah-ren wurde es ihr zu vielund ihr Sohn übernahmdie Schreinerei. «Ich ahn-te, dass er das nicht langedurchziehen würde, woll-te ihm aber eine Chancegeben. Ich konnte dieSchreinerei ja später im-mer noch verkaufen», sagtKläri. «Mir war es einfachwichtig, dass ich meineKinder nicht zwinge, dasGeschäft zu übernehmen.»1993 wollte der Sohndann tatsächlich nicht
mehr, und Kläri machte sich auf die Suche nach einem Käufer.Sie fand tatsächlich einen ehemaligen Mitarbeiter, der bereitwar, die Schreinerei zu übernehmen. Kläri war froh um dieEntlastung und wollte sich nun endgültig von der Schreinereidistanzieren. 1994 verkaufte sie dem ehemaligen MitarbeiterBruno Meier gar das gesamte Haus und gab ihm ein Darlehen,damit er das nicht mehr benötigte Holzlager in eine Wohnungumbauen konnte. Sie wusste nämlich, dass Bruno ein Haus fürseine Familie suchte und war bereit, ihm die Wohnung über derSchreinerei gleich mitzuverkaufen.
Nun wohnt Kläri zur Untermiete in dem Haus, in dem sieüber 70 Jahre ihres Lebens verbracht hat. Wo früher das Holzauf Verwendung wartete, löst Kläri heute Rätsel, klöppelt undnäht. Langeweile oder ödes Warten – das kennt Kläri nicht.
«Plötzlich musste ich alle Dinge alleine tun, die ich früher mit
Max tat. Und ich konnte niemandem
mehr etwas erzählen, wenn ich nach Hause kam.»
Klara Hochuli

4 Dorfstrasse 22 Dorfstrasse 22 3 Dorfstrasse 22 32 33 Dorfstrasse 22
Basteln, wenn andere schlafen
Ein süsser Duft empfängt mich, als ich die «Gerbera» betre-te. Schnell merke ich, woher dieser Duft kommt: Es ist das Par-fum von Marie-Therese Gerber, der Inhaberin des Ladens. Diefröhliche 60-Jährige plaudert gerne und viel, besonders mit ih-ren Kundinnen und Kunden. Aber auch mir hat sie so einigeszu erzählen.
Die gelernte Röntgenassistentin führt seit 15 Jahren eineneigenen Geschenkladen. «Ich habe zwei Kinder und gab mei-nen Beruf auf, um für sie da zu sein. Als die Kinder gross ge-nug waren, dass ich wieder arbeiten gehen konnte, war ichschon zu lange weg vom Fenster», erklärt Marie-Therese. Siehätte eine Zusatzausbildung machen müssen, um wieder alsRöntgenassistentin einzusteigen. Deshalb entschied sie sich,
gleich etwas ganz anderes zumachen. Während der Zeit zuHause überlegte sie sich, wel-cher Beruf ihr gefallen würdeund kam auf die Idee eines ei-genen Ladens. Marie-Theresemachte eine Ausbildung imVerkauf, lernte ein Geschäft zuführen und besuchte Kurse inBuchhaltung. «Mein Manndachte damals, das sei dannhalt so eine Freizeitbeschäfti-gung von mir», schmunzeltsie. «Er hat nicht damit ge-rechnet, dass das eine Art Le-bensaufgabe wird.» Marie-Therese suchte ein Ladenlokalund wurde in Brittnau fündig.
Klein begonnenDas Ganze war ein riskantes Vorhaben. Sie wusste nicht, ob
so ein Laden in und um Brittnau überhaupt gefragt ist, dennein Geschäft dieser Art gab es bisher gar noch nicht. Um nichtalles aufs Spiel zu setzen, fing Marie-Therese klein an. «Ichhatte nur Occasionsgestelle in meinem Laden», nennt sie alsBeispiel. Sie wusste, dass sie nur bestehen kann, wenn sie einbreites, aber hochwertigesSortiment hat. Mit Geschenk-artikeln angefangen, ging esweiter mit Mercerie, Bastelar-tikeln, Modeschmuck, Kera-mik, Glas, Bébé-Artikeln, Ker-zen, Bändern, Servietten undnoch vielem mehr. Der Ladenwurde immer voller, es fehltean Platz. Nach sechs Jahrenwar das Lokal dann endgültigzu klein, und es musste ein grösseres her. «Ich fühlte mich ver-pflichtet, in Brittnau zu bleiben», erklärt Marie-Therese. «Ichkann ja meiner Kundschaft nicht einfach sagen, mich gibt esjetzt nicht mehr.» Sie fand dann auch tatsächlich ein Lokal,nicht weit von ihrem alten entfernt. Und nun sind ihre Serviet-ten, Windlichter und Diddl-Etuis in der ehemaligen Metzgereiuntergebracht. Wo vorher die Würste hingen, haben nun dieFoulards ihren Platz.
Topflappen-Strickanleitung-Suchen gehört dazuUm immer auf dem neusten Stand zu bleiben, machte sie
zahlreiche Weiterbildungen in Management und Buchhaltung.Doch nicht nur das hat sie durch ihren Laden gelernt. «Das Ge-
schäft ist eine Lebensschule», erwähnt sie mehrmals. «Manlernt, sich zurückzunehmen und den Umgang mit Menschen»,erklärt sie mir. «Ich sage heute zum Beispiel einem Kundennicht mehr: Schauen Sie, dieses Windlicht ist einfach fantas -tisch. Nein, ich sage: Und wie wäre es mit dem?» Sie habe ge-lernt, ihren eigenen Geschmack in den Hintergrund zu stellenund den der Kundschaft zu respektieren.
Sie mag ausserdem den engen Kontakt mit den Menschen.«An der Bahnhofstrasse in Zürich wäre das nie so. Dort zu ar-
«Mein Mann dachte damals,
das sei dann halt so eine Freizeit-beschäftigung von mir. Er hat
nicht damit gerechnet,
dass das eine Art Lebensaufgabe
wird.»Marie-Therese Gerber
«Ich fühlte mich verpflichtet,
in Brittnau zu bleiben.»
Marie-Therese Gerber
Marie-Therese Gerber, 60, in ihrem Laden.
beiten könnte ich mir schon auch vorstellen, doch es ist schön,wenn man näher auf die Kunden eingehen kann», sagt sie. Ma-rie-Therese liebt es, die Kundinnen und Kunden zu beraten undauch mal mit ihnen ein Schwätzchen zu halten. «Dadurch, dassich meine Kunden und ihren Geschmack kenne, kann ich dasSortiment ihnen anpassen», betont sie.
Kurz nachdem der Laden geöffnet hat, betritt eine ältereFrau das Geschäft und ich kann live miterleben, was Marie-Therese unter diesem engen Kundenkontakt versteht. Sie fragt

4 Dorfstrasse 22 Dorfstrasse 22 34 35 Dorfstrasse 24B
nach den Wünschen der Frau und wie es ihr so gehe und suchtihr danach eigenhändig den passenden Wollknäuel heraus.Liebevoll berät sie die Frau, als diese nach einer Anleitung zumTopflappenstricken fragt und sucht in ihrem Laden danach.Der Frau ist das alles gar nicht recht, wegen ihr soll sie dochnicht so lange suchen. Doch Marie-Therese gibt nicht lockerund verspricht ihr, die Anleitung vorbeizubringen, falls sie sieheute noch findet.
«So geht das den ganzen Tag», lacht sie, als die Frau die Türhinter sich schliesst. Sie freut sich immer wieder über das Ver-trauen, das ihr ihre Kunden entgegenbringen. «Die Mütter wis-sen, dass ich ihren Kindern nicht einfach irgendetwas andre-he», erklärt mir Marie-Therese. «Ich lasse die Kinder ruhigschauen und gebe ihnen dann auch etwas Süsses mit auf denHeimweg.»
Bastelberatung kostenlosDas Leben als Geschäftsinhaberin besteht aber nicht nur
aus Kundenberatung. Waren müssen bestellt werden, Messenbesucht werden und Beispiel-Artikel gebastelt werden. DieseArbeiten müssen vor oder nach der Arbeit getan werden, undauch am Sonntag schuftet sie. «Die Hausmessen besuche ichjeweils am Sonntag, sonst habe ich ja gar nie Zeit», erzählt sie.«Und durch die Woche stehe ich jeweils so um zwei Uhr mor-gens auf. Dann bastle ich Beispiele, damit die Kunden sich vor-stellen können, was man mitmeinen Produkten über-haupt machen kann.»
Die Erfahrung mit ihreneigenen Kindern war wie einFundament, auf das sie ihrWissen aufgebaut habe,denkt Marie-Therese. Siebastelte viel, ihr ganzesHaus war voll von Dekorati-onsgegenständen.
Ihre Ader fürs Dekorie-ren kann sie nicht nur in derSchaufenstergestaltung aus-leben. «Manchmal kommenKunden zu mir und fragenmich, was sie mit ihren Kin-dern basteln könnten. Oder
ich packe für sie ein Päckli ein, mache Hochzeitsgeschenkeoder entwickle eine Idee für eine Hochzeitsdekoration», fährtsie fort.
Enten als AusgleichAls Ausgleich zur ständigen Konfrontation mit ihrem Ge-
schäft werkelt Marie-Therese gerne in ihrem Garten herumoder kümmert sich um ihre Tiere. «Ich habe 50 Enten», erzähltsie. Das bringt sie dann jeweils wieder auf den Boden zurück.Denn mit einem Geschäft herrscht ständig Bewegung, erklärtsie mir. «Ich kann nicht einfach einen Monat Pause machen,oder mein Sortiment einfach immer gleich belassen.» Schon ei-nige Male hatte sie fast keine Kraft mehr, ständig in dieser Be-wegung zu bleiben. «Doch dadurch, dass man nicht einfachvon heute auf morgen aufhören kann, machte ich halt dochimmer wieder weiter.»
«Durch die Woche stehe ich jeweils so um zwei Uhr morgens auf.
Dann bastle ich Beispiele, damit die Kunden sich vorstellen, was
man mit meinen Produkten überhaupt
machen kann.»Marie-Therese Gerber

Dorfstrasse 22 3 Dorfstrasse 24B 36 37 Dorfstrasse 24B
Ein Mann kommt selten allein
Kaum betritt man die Wohnung der Lienhards, wird manvon den zwei Laufhunden Muck und Jago herzlich begrüsst.Vergnügt wedeln sie einem um die Beine und lassen sich be-reitwillig streicheln. Die zwei Hunde sind die einzigen Tiere,die Susi und Ueli Lienhard noch bei sich zu Hause haben. Dassah auch schon anders aus. «Einmal pflegten wir ein Wild-schweinchen, das das Bein gebrochen hat», erzählt Susi. «Oder,weisst du noch, Ueli, den Hasen, den wir im Badezimmer hat-ten. Der frass mir die Vorhänge an!»
Ob Wildschwein, Hase, Reh, Hirsch, Wellensittich oder Sie-benschläfer: Die Lienhards, beide 70, hatten schon so ziemlichalle heimischen Tiere ums oder im Haus.
Vom Grossvater geerbtBesonders Uelis Leidenschaft ist das Tierreich. «Ich war als
kleiner Junge regelmässig bei meinen Grosseltern auf demBauernhof. Dort lernte ich von meinem Grossvater alles überSträucher und Pflanzen und über die Tiere auf dem Hof», be-richtet Ueli. Das Interesse für Tiere war geweckt, das Funda-ment eines recht imposanten Werdegangs gelegt.
Heute ist Ueli Lienhard Naturwissenschaftlicher Konserva-tor des Museums Zofingen, Jagdaufseher, Autor von wissen-schaftlichen Publikationen und eines Kinderbuches, seit über50 Jahren Vogelberinger und international anerkannter Prü-fungsrichter für Volierenvögel. Doch alles der Reihe nach.
Nach der obligatorischen Schulzeit war es für Ueli klar: Erwollte Zoologie studieren. Doch sein Vater wollte zuerst eineabgeschlossene Berufslehre sehen und wenn möglich eine Kar-riere im Militär, bevor er seinem Sohn ein Studium erlaubte. Solernte Ueli halt Offset-Drucker und widmete seine Freizeit zoo-logischen Studien. Nach der Lehre, wie der Vater es wünschte,
ging er ins Militär, wo er später Brieftaubenchef wurde. Wäh-renddessen machte er einen Fernkurs in Zürich in Zoologie,Botanik, Mathematik und Latein.
Ein Buch zum GeburtstagAuch wenn die Tiere für ihn in dieser Zeit das Wichtigste
waren, die Frauen vergass er nicht. An einem Jodlerabendlernten sich Susi und Ueli kennen. Nicht nur der Funkensprang über, auch die Leidenschaft für Tiere übertrug sich aufSusi. Nach der Heirat 1961zog sie nach Brittnau zuUeli und sorgte von nunan für die Tiere, die er beisich zu Hause aufpäppelte.«Ich machte den Haushalt,kochte, wusch und schau-te zu den Tieren.» Susi er-zählt von den Tieren, wiewenn es ihre eigenen Kin-der wären. Voller Liebekümmerte sie sich um diepflegebedürftigen Rehe,Hirsche, Wildschweine und Vögel, während Ueli in einer Bas-ler Grossdruckerei als Obermaschinenmeister arbeitete.
Ueli betont, dass er das alles nie ohne seine Frau geschaffthätte. «Susi hat genug gemacht. Ohne sie wäre das alles nichtmöglich gewesen», sagt er rückblickend.
Da übertreibt Ueli sicherlich nicht. Nach der Heirat war eres, nach dem sich Susi richtete. Auch wenn sie sagt, dass sie esgerne tat: Susi opferte viel für ihren Ehemann und passte sichseinem Leben an. Es ist beeindruckend und bewundernswert,
wie viel Susi hergab, um ihren Mann in seinen Vorhaben zuunterstützen, ohne davon zu profitieren. Denn noch heutesteht Susi im Schatten ihres Ehemanns, unterstützt ihn im Hin-tergrund, wo ihre Arbeit kaum beachtet wird.
Uelis Schaffen wurden im Gegenzug dazu umso mehr ge-würdigt. In einem Buch ist seine Biografie verewigt und eineListe all seiner Publikationen abgedruckt. Ausserdem kommendarin Persönlichkeiten zu Wort über Uelis berufliche und ne-benamtliche Tätigkeiten. Das grüne Büchlein war ein Geschenkvon Anita Moor auf Uelis siebzigsten Geburtstag.
Ueli, der schon als Jugendlicher begann wissenschaftlicheTexte über verschiedenste Tiere für die Zeitung zu schreiben,hat heute über 230 Artikel veröffentlicht. Als 2003 die Wiggerüber ihre Ufer trat und den Keller der Lienhards überflutete,wurde es Ueli Angst und Bange um seine Bücher und Akten-sammlung: Teile seiner Bibliothek mit über 10000 Buchtitelnstanden unter Wasser! Anita Moor, eine langjährige Freundinder Familie, half beim Retten der Bücher. Sie nahm die vielenOrdner mit den Zeitungsartikeln zu sich nach Hause und trock-nete das Sammlungswerk.
«Weisst du noch, Ueli, den Hasen,
den wir im Badezimmer hatten.
Der frass mir die Vorhänge an.»
Susi LienhardUeli und Susi Lienhard, beide 70, mit den Laufhunden Muck und Jago.

Dorfstrasse 24B 3 4 Dorfstrasse 24B Dorfstrasse 24B 38 39 Dorfstrasse 32
Es kam, dass sie die Artikel las und fand, die müssten docharchiviert werden. «So machte sie daraus heimlich ein Buch,das mir zu meinem siebzigsten Geburtstag überreicht wurde»,berichtet Ueli. Es war eine Riesenüberraschung, die ihn heutenoch sprachlos macht.
Sein Wissen über Tiere, das er sich als Hörer von zoologi-schen, ornithologischen und weiteren Vorlesungen an der zoo-logischen Fakultät der Universität Basel sowie am Institut fürWaldbau an der ETH Zürich erlangte, reichte nicht nur für Ar-tikel in der Regionalzeitung. Das Wissen, welches sich wäh-rend diesen sieben Jahren ansammelte – neben seinem Berufals Obermaschinenmeister – ermöglichte ihm das Amt alsJagd- und Fischereiverwalter des Kantons Aargau.
Durch die zahlreichen autodidaktischen Lehrgänge, dieUeli absolvierte, und die guten Kontakte zu prominenten Wis-senschaftlern, wie Adolf Portmann und Professor Lang, wurdeer vor 45 Jahren auch Leiter des Hirschparks auf dem Heiternin Zofingen und 1994 Zoologischer Leiter der Naturwissen-schaftlichen Abteilung des Museums Zofingen.
Die leuchtenden MineralienIm Museum in Zofingen begann auch die Geschichte, die
ihn 2005 zu einem Kinderbuchautor machte. «Wir haben eineMineralienausstellung im Museum, durch die ich seinerzeiteine Schulklasse aus dem Engadin führte. Die Kinder waren sofasziniert von den leuchtenden Steinen, dass ich für sie einMärchen erfand. Der Lehrerin gefiel das Märchen so gut, dasssie es haben wollte.» Ueli erklärte ihr, dass er das spontan er-funden hatte, doch die Lehrerin wollte das Märchen unbedingt.«Also habe ich es für sie aufgeschrieben», erzählt Ueli. KurzeZeit später war das Märchen im Radio Rumantsch zu hören,und Ueli begann es weiterzuentwickeln.
Fast zehn Jahre später stiessen ein paar Kollegen auf dasMärchen, alle total begeistert. Durch eine Menge guter Kon-takte entstand daraus binnen kurzer Zeit ein Buch, das in allevier Landessprachen übersetzt und gedruckt wurde.
Ueli ist stolz auf sein Werk, betont aber, dass die Einnah-men vollumfänglich dem Museum Zofingen zugute kommen.«Mir geht es dabei nicht um den Profit», sagt er.
«Wir sind pensioniert, haben aber trotzdem nie Zeit»,schmunzelt Susi. Grosszügigerweise nimmt Ueli seine Bücherjeweils mit nach Hause und liest sie nicht in der Bibliothek, da-mit sie nicht so alleine ist. Denn vor rund einem Jahr zogen die
Lienhards von ihrem Haus, in dem Ueli sein gesamtes Lebenverbrachte, in diese Wohnung im Dorfkern. «Es ging in demHaus einfach nicht mehr. Wir wohnten im zweiten Stock unddie steilen Treppen waren für Susi, die seit vielen Jahren unterArthrose leidet, nichtmehr überwindbar», er-klärt Ueli. Ausserdembrauchte der Sohn, dermit seiner Familie im Par-terre wohnte, mehr Platz.
Das Alter macht nichtnur Susi zu schaffen.Auch Ueli musste einigeseiner Ämter abgeben,wie zum Beispiel die Ar-beit im Hirschpark. Auchdie ornithologischen Ex-kursionen mit Schulklas-sen sind nicht mehr mög-lich, denn ihn plagt seiteiniger Zeit ein lästigerTinnitus. «Den habe ich mir seinerzeit beim Artillerieschiessenim Militär eingefangen», erklärt er.
Dennoch wird es Ueli noch lange nicht langweilig. «Dugehst ja immer noch jedes Jahr als Wildhüter und Jagdpächterauf die Jagd», bemerkt Susi.
Und die vielen Erinnerungen und Eindrücke, die Ueli ge-sammelt hat, wird er wohl auch nie vergessen. Besonders andie Reisen mag er sich gerne zurückerinnern. «Als internatio-naler Preisrichter von Volierenvögeln war ich in Belgien, Hol-land und der Tschechoslowakei. Das sind wunderschöne Erin-nerungen.» Zudem führte er im sibirischen Altaigebirge imAuftrag der russischen Akademie der Wissenschaften eine Ex-pertise zur Anwesenheit des Maralhirsches durch.
Schöne Erinnerungen sind für Susi die zwei LaufhundeMuck und Jago: Erinnerungen an die Zeit, als sie mehr Zeit mitUelis Wildschweinen, Wellensittichen und Hirschen verbrach-te, als mit ihrem Ehemann.
«Als internatio-naler Preisrichter von Volierevögeln war ich in Belgien, Holland und der
Tschechoslovakei.Das sind
wunderschöne Erinnerungen.»
Ueli Lienhard

Dorfstrasse 24B 3 4 Dorfstrasse 24B Dorfstrasse 32 40 41 Dorfstrasse 32
«Wir halten zusammen.»
Ein Ehepaar, drei Kinder, Katzen, Hunde, Hasen, Meer-schweinchen, Hamster, Vögel und Goldfische: Das ist FamilieBonderer. Ein Porträt über diese grosse Familie zu schreiben istkeine leichte Aufgabe. Denn die Bonderers sind eine so vielfäl-tige Familie, dass eigentlich für jedes Familienmitglied ein ei-genes Porträt verfasst werden müsste. Dennoch wird Zusam-menhalt und Gemeinschaft in der Familie bei den Bonderersgross geschrieben.
Ein unterschiedliches Ehepaar«Für uns ist der Familienkreis sehr wichtig und wir halten
immer zusammen», sagt Therese, 50 Jahre alt. «Wir warten zumBeispiel mit Essen, bis alle zu Hause sind. Auch wenn dasmanchmal länger dauern kann.» Therese ist eine sehr offeneund herzliche Frau. Sie lacht viel und weiss immer wieder et-was zu erzählen. Ihr Mann Jürg, ebenfalls 50, ist dagegen eherstill. Auch in Sachen Hobbys sind die beiden sehr verschieden.
Jürg ist leidenschaftlicher Schütze und Chef der Schiessan-lage Brittnau. «Ich bin für die Vermietung zuständig, mussmich um das Grünzeug kümmern und bei einer Störung werdeich gerufen», erklärt Jürg. Passend dazu liest er in seiner Frei-zeit gerne Bücher über den Zweiten Weltkrieg, insbesondereSachliteratur über die da-maligen technischen Mit-tel. «Mich fasziniert derenorme technische Fort-schritt, der in dieser Zeitgeschah», lautet seine Be-gründung.
Therese kann mit die-sem Hobby rein gar nichts
anfangen. Höchstens die Pflege der Grünanlage käme für sie inFrage, schmunzelt sie. Die gelernte Gärtnerin gab ihren Berufauf, als sie das erste Kind erwartete. Dennoch liebt sie das Gärt-nern immer noch und ist, wann immer möglich, im Garten beiihren Blumen. «Mein grösstes Hobby ist aber die Familie», istsie überzeugt. «Ich bin mit Leib und Seele Mami.» Ihr ist eswichtig, ihre Kinder aufihrem Weg zu begleitenund sie zu unterstützen.Ihre eigenen Wünschestellt sie dabei in denHintergrund. Wünsche?«Ja, mein Traum wärees, einen eigenen klei-nen Laden zu führen, indem ich meine selbst gemachten Dekorationen verkaufen wür-de», erklärt Therese. Doch diesen Wunsch schiebt sie noch einbisschen hinaus, bis die Kinder grösser sind.
Die Kinder, das sind Manuela, 20, Jonas, 18 und Lars, 14Jahre alt. Manuela ist - zum grossen Bedauern der ganzen Fa-milie - in letzter Zeit nicht mehr so oft zu Hause. «Ihr zweitesDaheim ist in Horgen bei ihrem Freund», erklärt Therese. Undist sie nicht gerade beim Freund, macht sie die Ausbildung zurKleinkindererzieherin. «Ich finde es nicht so schlimm, dass ichManuela nicht mehr so viel sehe», findet Therese, «denn ich binja auch mit 20 oder 21 von zu Hause weggegangen.»
Am Turnfest kennengelerntTherese ist in Brittnau aufgewachsen und musste damals
berufeshalber nach Holziken ziehen. An ihrer dortigen Arbeits-stelle lernte sie eine Kollegin kennen, die von Vilters, einem
Dorf im Sarganserland, stammte. Diese besuchte ihre Eltern,die noch dort wohnten, regelmässig, und auch Therese durfteein paar Mal mitreisen.
«Einmal gingen wir dann zusammen an ein Turnfest inVättis. Und dort lernte ich Jürg kennen», erzählt Therese. Diebeiden verliebten sich und führten einige Jahre eine Fernbe-ziehung. Schlussendlich konnte Therese ihren Jürg ins Unter-land locken, und vor 24 Jahren heirateten sie. «Ich vermisse dieBerge», gibt Jürg zu. Er bedauert den Umzug nach Brittnaunicht, es gefällt ihm hier schliesslich auch. Den Dialekt willJürg jedoch nicht hergeben. «Den werde ich behalten, egal wo
ich wohne», ist er überzeugt. Er freut sich besonders, dass Ma-nuelas Freund auch aus Graubünden stammt. «So haben wir ei-nen Bündner mehr in der Familie», schmunzelt er.
Jürg ist von Beruf Schmied und Landmaschinenmechani-ker. Momentan arbeitet er bei der SBB in Olten und ist für dieRevision von Zügen zuständig. «Ich bin für alles Mechanischeverantwortlich», lautet die Kurzbeschreibung seines Jobs.
Auch für Jonas beginnt in wenigen Monaten das Berufsle-ben. «Ich hatte die Wahl zwischen Lastwagenfahrer und Koch»,erzählt er. «Die Wahl fiel dann eindeutig auf Koch.» Jonas hat-te es sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu finden. Er
«Mein grösstes Hobby ist die
Familie. Ich bin mit Leib und Seele
Mami.»Therese Bonderer
«Den Dialekt werde ich behalten.
Egal wo ich wohne.Jürg Bonderer
Jürg, 50, Lars, 14, Therese, 50, und Jonas Bonderer, 18. Manuela, 20, ist gerade bei ihrem Freund.

Dorfstrasse 32 3 4 Dorfstrasse 32 Dorfstrasse 32 42 43 Dorfstrasse 34
schrieb Dutzende von Bewerbungen, bekam jedoch immer nurAbsagen. Als Überbrückung macht er momentan das zehnteSchuljahr, in der Hoffnung, in diesem Jahr eine Lehrstelle zufinden. Und tatsächlich. In ein und derselben Woche bekam ereine Zusage als Koch und als Lastwagenfahrer.
Eine schwierige ZeitNicht nur die Lehrstellensuche, sondern auch die gesamte
Schulzeit war für Jonas eine schwierige und harte Zeit. «DasGanze begann damit, dass Jonas in die Einschulungsklassemusste», erzählt Therese, die sich an diese Zeit noch sehr genauerinnern kann. Mit der Lehrerin dieser Klasse kam Jonas über-haupt nicht zurecht und zog sich immer mehr in sich zurück.Als danach der Eintritt in die Kleinklasse besprochen wurde,waren Therese und Jürg geschockt. In der Kleinklasse, in derKinder aller Altersstufen waren, ging es Jonas psychisch im-mer schlechter. «Er hatte Ängste, Angst vor der Schule», be-schreibt Therese. Als Integrationsmassnahme der Schule wur-
de Jonas später in die Regel-klasse geschickt, wo er sichsehr wohl fühlte. Er fand erst-mals Kontakt zu anderen undwurde von den Klassenkame-raden respektiert und ange-nommen. Doch nach zweiJahren musste er wieder zu-
rück in die Kleinklasse, was für Jonas den totalen Zusammen-bruch bedeutete. Rückblickend sieht Therese das Problem dar-in, dass Jonas so viel hin und her geschoben wurde und sichnie ganz in eine Klasse integrieren konnte.
Auch Manuela hatte es in ihrer Schulzeit nicht ganz leicht,wobei sie sich nicht in sich zurückzog, wie es Jonas tat, son-dern sich aktiv wehrte. «Lars ist es aber ganz ähnlich ergangenwie Jonas», sagt Therese. «Und das macht uns als Eltern schonratlos. Ich frage mich häufig, was ich falsch gemacht habe,dass meine Kinder solche Probleme in der Schule haben.» Warich zu überbehütend? War ich eine zu gute Mutter? Das fragtsich Therese häufig. «Bei Elterngesprächen muss ich regelmäs-sig weinen», gibt sie zu. «Ich leide unter dieser Situation sehr.»
Therese und Jürg wissen aber, dass die Schulprobleme ih-rer Kinder nicht von irgendwoher kommen. «Ich war eineschlechte Schülerin», erzählt Therese, «aber ich habe schonnicht damit gerechnet, dass jedes meiner Kinder so heraus-
kommt.» Jürg meint dazu: «Ich war auch nie ein guter Schüler,aber ich musste einfach mitmachen, in so einem kleinen Berg-dorf.» Auch er leidet mit seinen Kindern mit, frisst seine Ver-zweiflung jedoch eher in sich hinein.
Es zwitschertGlücklicherweise ist die Schule nicht das ganze Leben. Jo-
nas spielt in der zweiten Liga Handball und geht schiessen,ganz wie sein Vater. «Ich mag es, wenn’s chlöpft», erklärt er.Jonas konnte mit seiner Vergangenheit abschliessen und blicktnun guten Mutes in die Zukunft. Lars’ Ausgleich sind seineNymphensittiche, Zebrafinken und Diamanttauben, die wäh-rend des gesamten Gesprächs fröhlich rumzwitschern. Es tönt,als möchten die Vögel auch noch so einiges erzählen. Dochfalls die auch so viel erlebt haben wie Familie Bonderer, würdedieses Porträt wohl noch lange kein Ende nehmen.
«Ich mag es, wenn’s chlöpft.»
Jonas Bonderer

Dorfstrasse 32 3 4 Dorfstrasse 32 Dorfstrasse 34 44 45 Dorfstrasse 34
Leben für den Laden
Als mir Gabi Gabi die Tür öffnet, schlägt mir warme, in-tensiv nach Milch riechende Luft entgegen. Ich komme mir vorwie Kleopatra in einem Milchbad. Gabi führt mich in den obe-ren Stock, in die gemütlich eingerichtete und nicht mehr nachMilch riechende Stube. Dort warten schon gespannt Dani Gabiund die zwei Söhne David, 6 Jahre alt, und Michael, 3 Jahre.
Das Geschäft ruftDie Milch spielt bei den Gabis eine wichtige Rolle. Seit
1999 führen sie in Brittnau die Dorfchäsi, die genau unter ih-rer Wohnung liegt. Sie produzieren Joghurt, Chäschüechli undFrischkäse und sammeln die Milch von Bauern der Region. Ne-ben diesen Produkten verkaufen sie im eigenen Laden Käse,Früchte und Gemüse und andere Lebensmittel für den tägli-chen Bedarf. Ausserdem besitzen sie einen Milchwagen, mit
dem Dani sechsmal dieWoche durch Brittnauund Nachbargemeindenfährt. Das tönt nach vielArbeit. Und das ist esauch. Von Montag bisSamstag, von morgensbis abends, fast jedenTag ruft das Geschäft.«Man vermisst manch-mal schon die Freizeit.Doch ich sehe ja dafürmeine Frau und dieKinder fast den ganzenTag. Das haben andereVäter nicht», erklärt
Dani. Auch die Freunde und Kollegen der Familie kommenhäufig zu kurz, seufzt die 35-Jährige. Nicht einmal für grosseHobbys hat die zweifache Mutter Zeit. «Ich lese gerne, doch dieRomane dürfen nicht zu anspruchsvoll sein. Nach dem Arbei-ten bin ich einfach zu müde.» Dani ist in der Feuerwehr undsingt im Männerchor Brittnau mit. Doch für mehr Hobbys hät-te er eindeutig keine Zeit mehr.
Man fragt sich, weshalb die beiden sich das antun, weshalbsie nicht einfach Angestellte - mit zwei freien Tagen pro Wo-che und vier Wochen Ferien im Jahr - geworden sind. Gabigibt zu, dass sie die Entscheidung manchmal bedauert, dochdann sieht sie gleich wieder das Positive. Typisch Familie Gabi.Nicht ein einziges Mal klagen sie über den Stress, die Verant-wortung ihres eigenen Geschäfts oder die Freizeit. Sie sehen inallem das Positive. Auch wenn als Aussenstehende wirklichnicht viele Vorteile in diesem Beruf zu entdecken sind: Gabiund Dani lieben ihn. Dani merkte schon früher beim Schnup-pern, dass der Beruf des Käsers zu ihm gehört.Deshalb machteer nach der Schule eine Lehre zum Käser. «Als Käser hat manmit der Landwirtschaft zu tun, wird körperlich gefordert undhat Kontakt mit den Kunden. Das waren die Gründe für mich,den Beruf zu lernen.», sagt er und fügt an, dass es ihm bis heu-te nicht verleidet sei. Gabi machte eine Lehre als Floristin. Siearbeitet heute zwar nicht mehr in diesem Beruf, kann ihrekreative Ader jedoch in Käseplatten, Früchtekörben und in derSchaufensterdekoration ausleben. «Mir macht der Job Spass,ich mache es nicht einfach für Dani», betont sie.
Wir behalten die Chäsi, bis wir pensioniert sind!»Doch weshalb gründet man in so jungen Jahren schon ein
eigenes Geschäft? Dani, 36, hat eine einfache Antwort: «Wir
waren jung und dachten: Wenn wir mal einfach etwas machenkönnen, dann jetzt. Wenn es in die Hose geht, sind wir ja nochjung genug, um etwas Neues zu beginnen.» Sie bereuen denEntscheid bis heute nicht. Erst vor kurzem, als der Kauf einerneuen Käsevitrine bevorstand, stellten sie sich wieder die Fra-ge: Wie lange wollen wir überhaupt noch den Laden führen?Natürlich war es für die Gabis klar: «Wir behalten die Chäsi biswir pensioniert sind!»
Durch die effiziente Arbeitsteilung ist ein Arbeitstag aberauch nur halb so stressig. Gabi führt den Laden und Dani istChef über den Milchexpress. «Ich rede ihm nicht drein und ermir nicht», erklärt Gabi das Konzept. Sie finden es schön, dasssie sich, im Gegensatz zu anderen Pärchen, am Morgen, Mittagund Abend sehen. «Wir sind eigentlich fast immer zusammen»,
«Man vermisst manchmal schon
die Freizeit. Doch ich sehe ja dafür meine Frau und die
Kinder fast den ganzen Tag.
Das haben andere Väter nicht.»
Dani Gabi
Dani, 36, Gabi, 35, David (links), 6, und Michael Gabi, 3, in ihrer Chäsi.
stellt Dani fest. Ein perfekter Nährboden für Konflikte, könnteman meinen. Doch das Ehepaar findet, dass sie halt einfachmehr Toleranz gegenüber dem anderen aufbringen müssen. «Esherrscht schon nicht immer Frieden bei uns. Aber danachgeht’s wieder. Eigentlich streiten wir vor allem wegen unwich-tigem Seich», lautet Danis Fazit.
In Brittnau kennengelerntGabi und Dani scheinen ein perfektes Paar zu sein. Vor 15
Jahren auf dem Herbsttanz in Brittnau kennengelernt, vorzehn Jahren geheiratet, vor sieben Jahren das erste Kind. Siepassen auch gut zusammen, nicht nur was seinen Nachnahmenund ihren Vornamen betrifft: Beide sind bescheidene, kommu-nikative, lebensfrohe und bodenständige Leute. «Für uns ist es

Dorfstrasse 34 3 4 Dorfstrasse 34 Dorfstrasse 34 46 47 Dorfstrasse 34
das Grösste, an einem Sonntagmit den Kindern in den Waldbräteln zu gehen», verdeutlichtGabi.
So müsste sie, wenn esnach ihr ginge, auch nicht un-bedingt in die Karibik in dieFerien, wie es ihr Ehemannwünscht. «Ich wäre auch mitFerien in den Bergen zufrieden.Hauptsache, einfach mal nichtstun.»
Die Motivation, überhauptweiterzumachen, auch wenn halt keine Ferien – nicht einmalFerien in den Bergen – in Sicht sind, ist für sie der Kunden-kontakt. Besonders für Dani sind die Kunden sehr wichtig. «Fürmich macht das den Beruf überhaupt erst interessant», meinter. Auf seinen Touren mit dem Milchexpress freut er sich des-halb auch auf einen kurzen Schwatz mit den Kundinnen undKunden. «Besonders die älteren Leute, die sonst niemandenmehr haben, klagen mir ihr Leid und ihre Sorgen.» Dani nimmtsich für sie Zeit, hört ihnen zu und versucht manchmal einenRat zu geben oder zu trösten. «Ich sage immer: Ich bin eigent-lich ein zweiter Pfarrer», schmunzelt er.
Happy DayDer Milchexpress, ein Laden auf vier Rädern, tourt sechs-
mal die Woche durch Brittnau, Wikon, Strengelbach und Mät-tenwil. Den Wagen konnten die Gabis von ihrem Vorgängerübernehmen, als sie 1999 nach Brittnau kamen. Da sie mit derProduktion von Käse aufhörten, war es finanziell nötig, dieTour auszubauen und nicht nur Brittnauerinnen und Brittnau-er zu beliefern. Der Milchexpress war auch Auslöser für dasHighlight des Berufslebens der beiden. Als dieser nämlich imAugust 2007 den Geist aufgab, wussten die Gabis nicht mehrweiter. Finanziell konnten sie sich eine Reparatur zwar schonleisten, doch dies hätte nicht mehr rentiert. «Dann hätten wireinfach zwei bis drei Jahre gratis durch die Gegend kurvenmüssen», erklärt Dani.
Die Wikoner Frauen, die selbst immer Stammkunden imMilchexpress waren, wollten den Gabis helfen und meldetendie Familie bei der Sendung «Happy Day» des Schweizer Fern-sehens an.
«Für uns ist es das Grösste,
an einem Sonntag mit den Kindern in den Wald bräteln zu gehen.»
Gabi Gabi
Mit dem Töff durch schwere Zeiten
«Bin über 60 und fahre immer noch Dreirad» – Das standauf Rosa Vonäschs heiss geliebtem Motorrad. Es schmerzt dierüstige 70-Jährige heute noch, dass sie es vor gut einem Jahraus finanziellen Gründen verkaufen musste. Mit ihm erlebteRosa Vonäsch viele Abenteuer. Die einwöchige Reise zu ihrerCousine in Spanien bleibt ihr wohl ewig in Erinnerung. «Daswar ein Erlebnis. Unbeschreiblich», erzählt sie mit leuchtenden
Augen. «Ich kann michnoch ganz genau erin-nern, wie ich mich mit-ten in der Nacht breit-beinig in die Mitte einesKreisels gestellt habe,um jemanden nach demWeg zu fragen. Ohne einWort Spanisch zu spre-chen.» Rosa ist stolz, sichganz alleine auf so eineweite Reise gewagt zuhaben.
«Meine Söhne sag-ten: Du spinnst! Dugehst dort sicher nichtalleine hin!» Doch datäuschten sie sich. Rosapackte eines Mittwoch-
morgens klammheimlich eine Tasche mit dem Nötigsten undfuhr davon. Ihre Söhne erfuhren von der Abreise erst, als sieschon dutzende Kilometer von zu Hause entfernt war.
Die arme Frau: mutterseelenallein in einem unbekanntenLand unterwegs. So könnte man denken. Doch Rosa Vonäscherklärt, dass sie gerne alleine unterwegs ist. «Ich kann einfachtun und lassen, was ich möchte.» Wer Rosas Vergangenheit
kennt, weiss aber, dass dies nicht der einzige Grund für dieVorliebe des Alleinseins ist. Sie ist zweifach geschieden, warverheiratet mit Männern, die sich keine Frau wünschen würde.«Ich will keinen Mann mehr, auch wenn er Milliardär wäre», er-klärt sie nüchtern.
Haushälterin statt EhefrauRosas Vergangenheit sieht allgemein sehr düster aus. Auf-
gewachsen als Älteste von vier Kindern auf einem Bauernhofin Strengelbach, der Vater ein Trinker, waren sie, ihre Ge-schwister und ihre Mutter für den Haushalt und die Felder zu-ständig. «Wir hatten eine himmeltraurige Jugend», sagt sierückblickend. Der Vater besass damals als einziger einen Trak-tor und ackerte anderen die Felder. Auf dem Heimweg machteer Halt in der Beiz und verprasste den gesamten Lohn für Al-kohol.
Mit siebzehn wurde sie zu einer Familie in den Thurgau ge-schickt, um den Haushalt zu führen, und mit achtzehn lerntesie ihren ersten Mann kennen, von dem sie ein Jahr späterschwanger wurde. Ihre Mutter zwang sie zur Heirat, ein unehe-liches Kind kam nicht in Frage. «Dann heiratete ich halt. Aberrichtige Liebe war es bei ihm nie. Er sagte mir auch, ich sei fürden Haushalt und für ihn da. Ich müsse zu Hause sein, wenn erkomme und er schrieb mir die Kilometer beim Auto ab, damitich mit seinem Auto ja nicht zu weit weg fahre.» Es ist er-staunlich und schrecklich zugleich, wie sachlich Rosa Vonäschvon dieser Zeit berichtet.
Nach 25 Jahren Ehe und vier daraus hervorgegangenenKindern traute sich Rosa endlich, sich von ihrem Mann zutrennen. Bis es jedoch so weit kam, erlebte sie Dinge, die in ei-nem Krimi stehen könnten: «Wir gingen fast jeden Freitag-abend auf die Fennern. Er liess sich volllaufen, und ich mussteihn danach nach Hause fahren. An einem Abend erzählte ich
«Ich kann mich noch ganz genau
erinnern, wie ich mich mitten
in der Nacht breitbeinig in die Mitte eines Kreisels gestellt
habe, um jemanden nach dem Weg
zu fragen.»Rosa Vonäsch
Und prompt standen eines Morgens Susanne Kunz und ihrFernsehteam in der Chäsi. Den ganzen Tag wurde gefilmt, In-terviews geführt und Szenen wiederholt. «Es war anstrengen-der als arbeiten», findet Dani. «Am Abend war ich total kaputt.»
Gabi mochte das Rampenlicht überhaupt nicht, sie hältsich lieber im Hintergrund. «Das haben die vom Fernsehendann auch gemerkt und mich meist in Ruhe gelassen», ist siefroh. Doch der ganze Rummel hat sich nicht nur bezüglich Be-kanntheitsgrad der Gabis und ihrem Milchexpress als Vorteilerwiesen. Auch die Einnahmen stiegen durch die Sendung. Esnutzen mehr Leute den Milchexpress als früher, was sich fi-nanziell bis heute auszahlt.
Die Chäsi – Ein Entscheid fürs LebenEgal was für Fragen man den Gabis stellt, sie kommen im-
mer wieder zum selben Thema zurück: Die Chäsi. Die beidenmögen sich an die Zeit zwischen Heirat und erstem Laden inRothrist gar nicht mehr erinnern. «Das ist schon so lange her»,findet Gabi. Es ist halt wirklich so, wie sie es selbst formuliert:«Wir leben für unseren Laden.»

Dorfstrasse 34 3 4 Dorfstrasse 34 Dorfstrasse 34 48 49 Dorfstrasse 34
dummerweise meinem Schwager von unserer Beziehung. MeinMann erfuhr davon und überraschte mich auf der Toilette desRestaurants. Er packte mich am Hals und beschimpfte mich zu-tiefst.» Nach diesem Abend suchte sie Zuflucht bei einem Be-kannten in Brittnau, bei dem sie über ein Jahr lang blieb.
Berufswunsch: Bäuerin«Ich hatte gar nie Zeit, mir über meine Berufswünsche Ge-
danken zu machen», sagt Rosa Vonäsch. Sie tat, was ihr befoh-len wurde, sie selbst wurde nie nach ihren Zukunftsplänen ge-fragt. Dabei wären diese sehr bescheiden gewesen. «Ich wollteBäuerin werden. Doch es war klar, dass der einzige Sohn derFamilie den Hof übernimmt, obwohl er das gar nicht wollte.
Mich fragte nie-mand.» Ausserdemträumte sie davon,Schreinerin zu wer-den, was jedoch indieser Zeit für eineFrau nahezu un-denkbar war. So lebtRosa Vonäsch haltmit 70 Jahren ihrefrüher verdrängtenLeidenschaften aus.«Als ich noch aufdem Scheuerbergwohnte, baute ichein dreiteiliges Hüh-
nerhaus», erzählt sie stolz. Ausserdem zimmerte sie ein Vogel-häuschen, ein Vordach und Bänke für ihre Blumen.
Ihre Liebe zum Schreinern wird sichtbar, als sie detaillierterklärt, wie sie das Vordach - ohne Löcher zu bohren - an derSitzplatzmauer befestigt hat. Ein anderes ihrer Hobbys ist dasGärtnern, was die vielen Blumen auf dem Sitzplatz bezeugen.Die grosse Plastikenten-Lampe auf der Eckbank verdeutlichtauch noch einmal, wie gerne Rosa einen Bauernhof mit Tierenund einem grossen Garten gehabt hätte. Als Ersatz dafür gehtsie regelmässig - im Sommer fast jeden Tag - zu ihrem Sohnund seiner Familie und werkelt in ihrem Garten herum.
Vier Kinder und neun Grosskinder hat Frau Vonäsch. Mitden drei Söhnen hat sie mehr oder weniger regelmässig Kon-takt, die Tochter will mit ihr nichts mehr zu tun haben. «Sie hat
den Kontakt abgebrochen, nachdem ich mir 1995 den Töff ge-kauft hatte. Ich weigerte mich nämlich einen Helm zu tragen,obwohl damals noch keine Helmpflicht galt. Das konnte sienicht akzeptieren.»
Sie sei wohl eifersüchtig, mutmasst Frau Vonäsch. Dieschlechte Beziehung zu ihrer Tochter beschäftigt sie und machtsie traurig. «Ich will einfach keinen Helm tragen, ich bin sogarextra auf die Polizei gegangen, um meiner Tochter zu bewei-sen, dass dies auch gar nicht obligatorisch sei.» Die Helmpflichtwar dann auch der Grund, dass sie 2007 ihren Töff verkaufte.Doch der Kontakt zu ihrer Tochter wurde nicht besser.
Mehl gegen das AlleinseinSie vermisst den Töff noch heute, auch wenn ihr die Dorf-
strasse besonders wegen dem Postauto gefällt. So ist sie mobil,auch wenn sie ausser einem Dreiradvelo kein Fahrzeug mehrbesitzt. Dennoch spielt sich ihr Leben, wenn sie nicht gerade imGarten des Sohnes ar-beitet, grösstenteils inBrittnau ab. Zweimaldie Woche führt sie inder alten Mühle einenkleinen Laden, in demsie verschiedene Mehl-sorten verkauft.
1987 gründete siediesen, nachdem siezuerst als Putzfrauund dann als Mitarbei-terin bei der Ab - packung des Mehlsaushalf. Noch heutebietet ihr der Ladeneine willkommene Abwechslung zum manchmal recht grauenund eintönigen Alltag. Jeden Dienstag und Samstag verkauftsie einen Morgen lang Mehl. «So lange ich mindestens für 400Franken im Monat Mehl verkaufe und es körperlich schaffe,mache ich weiter», lautet ihre Devise.
Die Motorrad-BrautFrau Vonäschs Leben ist gezeichnet von schweren Zeiten
und harten Schicksalen. Auch der zweite Mann hielt nach derHeirat nicht das, was er vorher versprach. Schon mit 17 lernte
«Ich wollte Bäuerin werden. Doch es war klar, dass der einzige
Sohn der Familie den Hof übernimmt,
obwohl er das gar nicht wollte.
Mich fragte niemand.»Rosa Vonäsch
sie ihn kennen, bevor er nach Kanada auswanderte. Dort, aufeiner ihrer Reisen - gut 30 Jahre später - traf sie ihn wieder undverliebte sich. Sie heirateten, doch er kontrollierte sie ständig,war extrem eifersüchtig und lief nur noch ungepflegt herum.«Ich hielt es nicht mehr aus und sagte mir, so kann das nichtweitergehen.» Rosa stellte ihren zweiten Mann vor die Türe,dieses Mal bevor sie selbst an der Beziehung kaputt ging.
Ihre Leidenschaft fürs Reisen hielt aber beide Ehen durch.Sie bereiste schon die halbe Welt: Rumänien, Bulgarien, Ma-
rokko, Spanien, die USA. Manchmal alleine, manchmal zu-sammen mit ihrer so geliebten knallroten Yamaha 535. «Dassind die allerschönsten Erinnerungen», sagt Frau Vonäsch, derdie schwarze Lederkluft mit den langen Fransen schon furcht-bar gut stand.
«Ich will einfach keinen Helm tragen. Ich bin sogar extra
auf die Polizei gegangen, um
meiner Tochter zu beweisen, dass dies
auch gar nicht obligatorisch sei.»
Rosa VonäschRosa Vonäsch, 70. auf ihrer Terrasse. Im Hintergrund die selbst gezimmerten Bänke für die Geranien.

Danksagungen
Ein engagierter Coach, ein hilfsbereiter Grafiker,eine spontane Korrektorin, eine professionelleKamera, finanzielle Unterstützung - ohne dasund noch viel mehr wäre dieses Buch niemalsentstanden.
Ein grosses Danke geht an: Brigitte von Arx, Zofinger Tagblatt AG, ZofingenTheo Byland, AarauRuedi Friedli, Zofinger Tagblatt AG, ZofingenTabitha, Eva und Max Hartmann, BrittnauSusi und Ueli Lienhard, BrittnauRingier AG, Zofingen
...und ganz speziell an alle Porträtierten, diedurch ihre Offenheit und Ehrlichkeit dieses Buchzu etwas ganz Speziellem werden liessen.