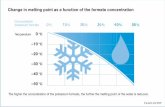Die Zeit 2013 41
Transcript of Die Zeit 2013 41

PREIS DEUTSCHLAND 4,50 €
PREISE IM AUSLAND:DKR 45,00/NOR 65,00/FIN 7,00/E 5,50/Kanaren 5,70/F 5,50/NL 4,80/A 4,60/ CHF 7.30/I 5,50/GR 6,00/B 4,80/P 5,50/ L 4,80/HUF 1960,00
ZEIT ONLINE GmbH: www.zeit.de; ZEIT-Stellenmarkt: www.jobs.zeit.de
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, 20079 HamburgTelefon 040 / 32 80 - 0; E-Mail:[email protected], [email protected]
Kleine Fotos (v.o.n.u.): plainpicture; Pressefoto Baumann/imago
ABONNENTENSERVICE:
Tel. 040 / 42 23 70 70,Fax 040 / 42 23 70 90,E-Mail: [email protected]
Denn sie wissen, was du tust!Neue ZEIT-Serie:Wie das Internet die Privatsphäre überwacht Dossier, Seite 15
Die FDP der vergangenen vier Jahre war ein Ärgernis. Mit der verunglückten Regierungs-arbeit hat sie sich ihre Abwahl redlich verdient. Aber keine zwei Wochen später, da Berlin
nur über Steuererhöhungen diskutiert, wünscht man sich die Liberalen schon fast wieder zurück.
Es ist paradox. Deutschland ist im Auf-schwung, der Staat nimmt mehr Steuern ein denn je und erzielt bereits Überschüsse. Und doch reden alle plötzlich über höhere Abgaben. Jetzt rächt es sich, dass Angela Merkel im Wahl-kampf kein eigenes Programm vertreten hat, al-lenfalls ließ sie – wie im Streit um die Maut – ein kurzes »Mit mir nicht« hören. Ganz anders die Opposition, die sich genau ausmalte, wer mehr bezahlen soll. Jetzt müssen diese beiden Seiten koalieren, und das heißt: eine Mitte finden zwi-schen den Forderungen der SPD und den Nicht-forderungen der Frau Merkel.
Ohne den Anker eigener Vorhaben bewegt sich die Union auf das zu, was die möglichen Partner zur Linken gerne möchten. Und nichts haben die sich im Wahlkampf mehr gewünscht als höhere Steuern. Also war es schon vor dem ersten Sondierungsgespräch ausgemachte Sache: Der Spitzensteuersatz steigt. Alles unter 50 Pro-zent ist offenbar gar kein Problem mehr. Noch bevor die Sozialdemokraten nur einen Schritt getan haben, ist die Union ihnen schon ent-gegengeeilt. Da hilft auch das neueste Dementi aus Bayern nichts mehr.
Die oberen zehn Prozent tragen mehr als die Hälfte der Einkommensteuer
Man kann mit Recht behaupten, das Votum für Merkel sei auch eines gegen neue Belastungen gewesen, weil die Union sie im Wahlkampf ab-gelehnt hat. Aber im Ringen um Koalitionen übt die Position des Verlierers eine eigentümliche Anziehung aus – vor allem da, wo sie sich in ein-fachen Zahlen ausdrückt, zum Beispiel in Steu-ersätzen. Das Problem bei diesem Mechanismus ist, dass er weder nach Wählerwunsch noch nach Sinnhaftigkeit der Kompromisse fragt.
Egal, wie es ums Land bestellt ist, es ist immer absurd, im Ringen um die richtige Wirtschafts-politik mit Steuererhöhungen anzufangen. Das »Wie viel« vor dem »Wofür« zu beantworten ist ein sicheres Rezept, den Staat aufzublähen. Heu-te ist das Vorgehen noch besonders fragwürdig. Deutschland genießt in Europa eine Sonderkon-junktur, nichts weist darauf hin, dass sie schnell vorüberginge. Der Staat nimmt also ohnedies von Jahr zu Jahr mehr ein.
Auch die Erfahrung der vergangenen zehn Jahre spricht gegen die Erhöhung. Im Jahr 2003, als Deutschland der kranke Mann Europas war, lag der Staatsanteil bei über 48 Prozent, heute, da es als einzig gesunder Mann dasteht, geneh-migt sich der Staat weniger als 45 Prozent der
volkswirtschaftlichen Leistung. Ein erfolgreicher Staat ist nicht unbedingt besonders groß, son-dern besonders wirksam: Die deutsche Wende gelang auch deshalb, weil Berlin sparte, anstatt sich zu bedienen.
Es stimmt, Deutschland muss in seine Zu-kunft investieren. Kitas und Schulen, Universi-täten und Forschung brauchen neue Mittel. Ei-nerseits. Andererseits verschleudert der Staat Steuern, für das Betreuungsgeld zum Beispiel, das Mütter aus ärmeren Schichten in die Sack-gasse lockt, weg von der Erwerbsarbeit. Auch für Steuervorteile, wie sie Hoteliers und Firmen-erben genießen, werden Milliarden verschwen-det. All das sollte die Politik erst korrigieren und Steuersünder konsequent verfolgen, bevor sie dem Volk neue Einnahmen abringt.
Es ist ja nicht so, als fehle es der nächsten Re-gierung an Herausforderungen. Die Energie-wende muss gelingen, der Strom sicher fließen, sowohl das Klima wie auch das Portemonnaie der kleinen Leute muss dabei geschützt werden. Der Euro ist noch nicht gerettet, selbst manche Bank in Deutschland wird wieder Hilfe brau-chen – und das, obwohl viele Bürger rettungs-müde sind. Außerdem muss die Politik um die jungen Menschen am unteren Rand der Gesell-schaft kämpfen, die auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben. Das alternde Deutschland braucht sie dringend – das kostet.
Doch wer mehr Gerechtigkeit bei den Abga-ben will, sollte bei der schleichenden Enteignung der Steuerzahler ansetzen: Normalverdiener rü-cken durch eine Gehaltserhöhung im Steuertarif automatisch nach oben und müssen dann höhe-re Prozentsätze zahlen – selbst wenn ihr Ver-dienst nur mit der Inflationsrate steigt. So kann es geschehen, dass sie trotz fleißiger Arbeit an Kaufkraft verlieren. Diese sogenannte kalte Pro-gression treibt vor allem die Mittelschicht in immer höhere Steuerregionen. Sie sollte endlich gestoppt werden.
Im Großen und Ganzen funktioniert die Umverteilung der Einkommen: Die oberen zehn Prozent tragen mehr als die Hälfte der Steuerlast. Anders sieht es bei den Vermögen aus, was auch an der unfairen Struktur der Erbschaftsteuer liegt, welche die Erben von Unternehmen fast vollständig verschont. Für das Argument, da-durch würden Jobs gerettet, gibt es so gut wie keine Belege – wohl aber dafür, dass derzeit viele Millionäre die unfaire Lage nutzen, um ihr Ver-mögen steuerfrei auf die Kinder zu übertragen.
Karlsruhe dürfte das Gesetz im nächsten Jahr zurückweisen. Aber Union und SPD hätten ei-nen triftigen Grund, diese Fehlentwicklung auch ohne das Einschreiten der Verfassungsrichter zu korrigieren, könnten sie damit doch einen eige-nen Fehler beheben: Das Gesetz war eine der letzten Taten der Großen Koalition von Angela Merkel und Peer Steinbrück aus dem Jahr 2009.
www.zeit.de/audio
Erst mal zahlenDer Staat erwirtschaftet Überschüsse, und doch will er die Abgaben
erhöhen. Auch weil er Milliarden verschleudert VON UWE JEAN HEUSER
STEUERN
DIE ZEITW O C H E N Z E I T U N G F Ü R P O L I T I K W I R T S C H A F T W I S S E N U N D K U L T U R 2. OKTOBER 2013 No 41
Der Hahn krähtDer frühere Tennisspieler Boris B. und der frühere Komiker Oliver P. fetzen sich auf Twitter wegen frü-herer Affären und früherer Frauen, was insofern förderlich ist, als jetzt ein Buch über das Leben des Boris B. erscheint. Es illustriert den alten Spruch Omne animal post coitum triste praeter gallum qui cantat(Nach dem Koitus ist jedes Tier traurig, außer dem Hahn, der kräht). Sehr schön, denn nun wis-sen wir, wer der Hahn ist. GRN.
PROMINENT IGNORIERT
68.JAHRGANG C 7451 C
No41
Ein Gespenst hat sich verzogen: die rot-rot-grüne Koalition. Als pro-pagandistisches Schreckensszenario im Wahlkampf erfüllte das linke Bündnis noch seinen Zweck. Doch nun, wo es im Bundestag tatsächlich
eine linke Mehrheit gibt, spielt es keine Rolle mehr. Nur für die ganz Linken in den linken Parteien dient sie noch als schmerzlindernde Utopie.
Die Regierungsbildung allerdings liegt wie selbstverständlich in der Hand der Kanzlerin. Und die scheint nicht sehr zu fürchten, die drei linken Parteien könnten sie stürzen. Die Frage nach der künftigen Koalition lautet schlicht: Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün? Und das, obwohl sich die potenziellen Partner mit einer Regierungsperspektive an Merkels Seite sicht-lich schwertun.
Aus Angst vor der Großen Koalition schraubt die SPD schon jetzt ihre Forderungen so hoch, dass die kommenden Verhandlungen leicht scheitern könnten. Und die Grünen sind vom Wahlergebnis noch so benommen, dass ernst-haftes Nachdenken über die Zumutung einer schwarz-grünen Koalition bei ihnen noch gar nicht begonnen hat. Nur eins scheint allen klar: Es gibt keine linke Option.
Das hat zuerst einmal einen ganz naheliegen-den Grund: Die SPD hat eine solche Zusammen-arbeit vor der Bundestagswahl ausgeschlossen. Zyniker und Politikverächter mögen einwenden, solche Versprechen vor der Wahl hätten nach der Wahl doch keine Bedeutung mehr. Aber das ist falsch. In Hessen hat die SPD 2008 dramatisch erfahren, was es bedeutet, ein solches Versprechen aus purem Machtopportunismus zu brechen. Es ruinierte die Partei und endete im Scheitern.
So geschähe es nun wieder, nur auf der gro-ßen Berliner Bühne. Wer vor der Wahl, wie SPD-Chef Siegmar Gabriel, inständig beteuert, er werde mit dem Land nicht va banque spielen, der tut es auch nicht. Andernfalls ist er politisch tot.
Die Wahl markiert eine Etappe der Entfeindlichung der politischen Lager
Hinzu kommt ein ganz praktisches Problem. Wer versuchen wollte, heute ein Bündnis aus
SPD, Linken und Grünen in Gang zu bringen, müsste sich darüber hinwegsetzen, dass die Mehrheit von vier Sitzen für ein solches Experi-ment arg knapp bemessen ist. Denn immer gäbe es unter den SPD-Abgeordneten aus dem Osten, bei wirtschaftsfreundlichen Grünen oder bei besonders prinzipienfesten Linken potenzielle Abweichler und damit ein permanentes Erpres-sungspotenzial aus unterschiedlichsten politi-schen Richtungen.
So ließe sich das Schlüsselland in der Mitte Europas nicht regierten. Die von ihren Wahl-ergebnissen ernüchterten rot-grünen Spitzen-vertreter sind offenbar nüchtern genug, dieses Risiko zu erkennen.
Noch gravierender wäre allerdings das Legiti-mationsdefizit einer linken Koalition. Ihr fehlt nämlich die gesellschaftliche Mehrheit. Weder stand Rot-Rot-Grün als gemeinsames Koalitions-angebot zur Wahl, noch erreichten die drei Parteien die Mehrheit der Wähler. Dass sie zu-sammen im Parlament über einen knappen Vor-sprung verfügen, ist allein dem Umstand geschul-det, dass FDP und AfD an der Fünfprozenthürde gescheitert sind. Die Mehrheit hat nicht für die drei Parteien aus dem linken, sondern für die drei aus dem rechten Spektrum votiert.
Doch was besagt diese Entscheidung heute überhaupt noch? Wenn die zurückliegenden Wahlen etwas bedeuten, dann doch eher einen weiteren Schritt zur Auflösung der politischen Lager. Denn dass die breite Unterstützung für Merkel auf eine »rechte Mehrheit« in Deutsch-land hindeutet, glauben bestenfalls noch dieje-nigen, die ihre eigene Lagerordnung verbissen verteidigen. Wer Zweifel hegt, wie wenig »Rechtes« in Angela Merkel schlummert, sehe sich auf YouTube die Szene vom Wahlabend an: Da entwindet eine barsche Kanzlerin dem CDU-Generalsekretär Gröhe das schwarz-rot-goldene Fähnchen, mit dem er seiner Sieges-freude Ausdruck verleihen will: Schluss mit dem Quatsch!
Merkel hat ihren Wahlsieg weder mit rech-ten Themen noch im »rechten« Spektrum er-reicht. Sie hat gewonnen, weil sie den Menschen in einem ökonomisch erfolgreichen, wohl-standsgesättigten Land das Gefühl gegeben hat, mit ihr werde es noch eine Weile so weiter-gehen. Ihren unpolitischen Wahlkampf kann man kritisieren, als rechte Kampagne lässt er sich kaum deuten. Das ahnt man natürlich auch bei SPD, Grünen und selbst in der Linkspartei. Deshalb kommen sie jetzt gar nicht auf die Idee, sich gegen Merkel zu verbünden. Es fehlt der ideologische Schwung, ohne den ein solch spektakuläres Experiment nicht durchzuhalten ist. Es fehlt auch der Mut, die hochpopuläre Kanzlerin zu stürzen.
So markiert die Bundestagswahl eine weitere Etappe der Entfeindlichung der deutschen Poli-tik. Statt scharfer, ideologisch befeuerter Geg-nerschaft herrscht weitgehender Konsens. Ob es um Europa oder Afghanistan, um gleich-geschlechtliche Partnerschaften oder prekäre Be-schäftigungsverhältnisse geht, es gibt heute kein relevantes Thema der deutschen Politik, bei dem die Differenzen zwischen den etablierten Partei-en so fundamental wären, dass sich aus ihnen die plausible Begründung für eine rot-rot-grüne Ko-alition ergäbe. Auch deshalb wirkt es jetzt so selbstverständlich, dass die beiden denkbaren Koalitionsvarianten, Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün, die Lagergrenzen überbrücken, statt sie neu zu zementieren. Rot-Rot-Grün durch die Hintertür ist jedenfalls keine Alternative.
www.zeit.de/audio
Kein MorgenrotIm Bundestag haben die Linken eine Mehrheit – in der
Gesellschaft vorerst nicht VON MATTHIAS GEIS
ROTROTGRÜN
Tit
elil
lust
rati
on
: M
art
Kle
in u
nd
Mir
iam
Mig
liazz
i fü
r D
IE Z
EIT
Im Dschungel der Bücher
80 Seiten Literatur zur Frankfurter Buchmesse:Die abenteuerlich schönen Bücher des Herbstesund die vitalen, melancholischen Autoren des diesjährigen Gastgeberlandes Brasilien
4 1 9 0 7 4 5 1 0 4 5 0 0 4 1

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 412 POLITIK
»Ein rotes Licht für eine
Waffenart bedeutet kein
grünes Licht für andere.«Ban Ki Moon, UN-Generalsekretär, über den mit konventionellen Waffen geführten Krieg in Syrien
»Have a good day,
Mr. President.«Hassan Ruhani, Präsident des Irans, verabschiedet sich nach dem ersten Gespräch eines iranischen Staatsoberhaupts mit einem US-Präsidenten seit 1976 von Barack Obama
»Danke, Khoda hafez.«Barack Obama, US-Präsident, antwortet auf Farsi
»Es ist im besten Interesse der
Nation, alle Telefondaten in
ein Schließfach zu tun, das wir
durchsuchen könnten.«Keith Alexander, NSA-Chef, über die umfassende Überwachung der US-Bürger
»Seit 55 Tagen schlafe ich
nicht mehr.«Silvio Berlusconi, ehemaliger Ministerpräsident Italiens, über den möglichen Verlust seines Senatssitzes
»Wenn Ihnen ein paar Gebete
für Italien einfallen, ist das
sicher nützlich für uns alle.«Enrico Letta, Italiens Ministerpräsident, über die politische Krise des Landes
»Wir brauchen Geld, um die
Syrer auf humane Weise
abzuschieben, nicht um ihre
Situation auf libanesischem
Boden zu verbessern.«Gebran Bassil, Libanons Energieminister, über die gut 400 000 syrischen Flüchtlinge im Land
»Es hätte mich sehr
überrascht, wenn die
Wissenschaftler gesagt hätten:
Ihr könnt entspannen, geht an
den Strand.«Connie Hedegaard, EU-Klimakommissarin, über den fünften Bericht des Weltklimarats
»Die Diskussion über
Steuererhöhungen ist bereits
eine Todsünde.«Erwin Huber, bayerischer Alt-Ministerpräsident
WORTE DER WOCHE
Warum er nicht ins Auswärtige Amt sollte
Frank-Walter Steinmeier ist ein hervorragender Politiker und für fast alle Posten geeignet.
Nur in der Außenpolitik hat er sich verrannt VON JÖRG LAU
Eine der wenigen Gewissheiten über die Verhandlungen zu einer Großen Koalition lautet: Will die SPD den Außenminister stellen, wäre Frank-Walter Steinmeier der natürliche Kandidat. Klugerweise hat sich die Partei auferlegt, erst
einmal von Inhalten statt von Posten zu reden. Für den Fall des Falles jedoch gibt es bereits eine Art Manifest für Steinmeiers zweite Amtszeit. Es findet sich ein wenig versteckt in einem dicken Sammel-band unter dem Titel Realismus und Prinzipien-treue. Der Text ist ein Dokument der Wut und Verhärtung. Er lässt ahnen, wie viel fragiler eine Neuauflage der Großen Koalition wäre. Auf 17 Seiten attackiert Steinmeier Angela Merkels An-spruch einer »wertegebundenen Außenpolitik«.
Steinmeier prangert eine Politik an, die sich in »Anklage und Dialogverweigerung« ergehe, »fol-genlose Empörung« zelebriere und einen »Teufels-kreis aus Belehrung und Isolation des Gegenübers« heraufbeschwöre. Von »moralischem Rigorismus« ist die Rede und selbstgenügsamer »Bekenntnis-haftigkeit«. Dagegen plädiert er dafür, auch mit schwierigsten Partnern, vor allem den »aufstreben-den Mächten im Osten« – lies: Russland und China –, Dialog zu führen, ohne sich von »Rück-schlägen« bei Demokratie und Menschenrechten aufhalten zu lassen.
Ein merkwürdiger Gegensatz, den Steinmeier da zeichnet: Realist gegen Hypermoralistin. Ange-la Merkel ist in Wahrheit ziemlich pragmatisch. Sie geht geschmeidig mit Autokraten um, wenn deutsche Interessen es gebieten. Seit sie den Dalai Lama ins Kanzleramt einlud, hat sie über die Lage der Menschenrechte in China kaum mehr ein Wort verloren. Zu Russlands Herrscher Putin hält sie Distanz, kritisiert manchmal offen Fehl-entwicklungen und trifft sich mit Dissidenten. »Wertegebundenheit« ist ein großes Wort dafür. Doch Steinmeier braucht die angebliche Merkel-sche Moralpolitik, um seinen eigenen »realpoliti-schen« Ansatz davon abzusetzen.
Wie realistisch ist Steinmeiers Außenpolitik? Seine wichtigsten Initiativen als Außenminister galten Russland und Syrien. Moskau hat Stein-meier eine »Modernisierungspartnerschaft« an-geboten. Zugleich betrieb er Entspannungspoli-tik gegenüber Damaskus. Bei einer Rückkehr ins Auswärtige Amt würde er beide Themen wieder vorfinden. Wie er sich von 2005 bis 2009 geschlagen hat, ist nicht nur von histori-schem Interesse.
Seine beiden Vorstöße sollten antiwestlich ori-entierte Mächte durch freundschaftliche Umar-mung und stille Diplomatie zur Kooperation er-muntern. Aus »Störern« sollten »Gestaltungs-mächte« werden. Steinmeiers Kalkül war, dass
beide Regime sich auch innerlich öffnen würden, wenn man ihnen die Hand reichte.
Gleich im Sommer 2006 wollter er nach Sy-rien reisen. Assad jedoch brüskierte ihn durch eine wütende Anti-Israel-Rede. Steinmeier sagte ab, holte den Besuch aber nach einer Schamfrist bald nach. Präsident Assad, berichtete er, habe »deut-lich gemacht, dass Syrien nicht länger Teil des Problems im Nahen Osten, sondern Teil der Lö-sung sein will«. Das wurde Steinmeiers Leitmotiv: Anfang 2008 empfing er den syrischen Außen-minister Muallim in Berlin. Das war die diploma-tische Aufwertung eines Paria-Regimes ohne jede Gegenleistung. Angela Merkel war dagegen. Sie
ließ ihn gewähren, distanzierte sich aber öffent-lich. Beinahe kam es zur Koalitionskrise.
Die westliche Linie lautete, Assad müsse sich vom Terror Hamas’ und Hisbollahs lossagen, dann könne man reden. Steinmeier aber suchte das Gespräch ohne Vorbedingungen. Seine Appel-le, Syrien solle eine »konstruktive Rolle« spielen, trafen auf taube Ohren. Die jahrelange Charme-offensive brachte nichts außer Renommee für eine Diktatur, deren Brutalität schon damals kein Ge-heimnis war.
Steinmeier reduziert die sozialdemokratische Entspannungspolitik von Egon Bahr auf die Pfle-ge von »Gesprächskanälen« um jeden Preis. Um
die Annäherung an die Mächtigen nicht zu ge-fährden, darf man Menschenrechtsfragen nicht so hochhängen. Mit dieser Begründung vertritt aus-gerechnet die internationalistische Partei, die sich zu Zeiten Willy Brandts Gerechtigkeit, Solidarität und Fortschritt auf die Fahne geschrieben hatte, in der Außenpolitik die Leisetreterei gegenüber den reaktionärsten Regimen.
Über das Scheitern seiner Syrienpolitik hat Steinmeier bis heute kein Wort verloren. Statt-dessen ruft er nach deutscher Vermittlung, als hätte es seine eigenen vergeblichen Versuche nicht gegeben. Berlin falle als Mittler im Syrienkonflikt aus – als »Folge der kurzsichtigen, nur auf innen-
politische Effekte zielenden deutschen Außenpoli-tik von Frau Merkel«. Und da kommt Russland ins Spiel, das Feld, auf dem Außenminister Stein-meier die größten Ambitionen entwickelte: Seit er nicht mehr im Amt ist, gebe es keine »belastbaren Kanäle zwischen Berlin und Moskau« mehr, hat er in den letzten Wochen mehrfach gesagt.
Das Schicksal seiner eigenen Russlandpolitik steht quer zu der These, die frostige Kanzlerin sei schuld an der Abkühlung. Im Mai 2008 hielt Steinmeier im großen Auditorium der Ural-Uni-versität von Jekaterinburg eine programmatische Rede. Er bot an, bei Reformen zu helfen, warb für Meinungsfreiheit, Rechtsstaat und Demokratie
und erklärte das Zeitalter der Konfrontation für beendet. Nur drei Monate später marschierte Russland in Georgien ein. Der neue Präsident Dmitri Medwedew und sein allmächtiger Pate Putin zeigten sich nie ernsthaft an einer Öffnung der Gesellschaft interessiert. 2009 und 2011 ließ der Kreml die Wahlen manipulieren. 2012 folgte Putin wieder auf Medwedew. In seiner dritten Amtszeit ist die Repression gegen kritische Stim-men, NGOs und Homosexuelle so offensichtlich geworden, dass es schwerfällt, die Lage noch schönzureden. Putins Regime befindet sich nicht auf dem Weg zur Demokratie, auch nicht auf ei-nem Umweg, es entfernt sich von ihr.
Steinmeier führt dies darauf zurück, dass Russ-land eine verletzte Großmacht sei, die nach dem Ver-lust ihres Empires mit Aggression nach außen und innen überreagiert. Was tun? Gelegentlich lässt Steinmeier Zweifel durchscheinen, »dass die Be-reitschaft zum politischen Dialog am Ende nur taktischer Natur ist«. Aber dann wischt er den Ver-dacht entschieden beiseite, um mehr vom Gleichen zu empfehlen. Der Westen müsse eben noch bessere Angebote machen, weil man Russland »nur durch Annäherung zum Positiven verändern kann«.
Steinmeier sieht sich als Russlandfreund. Doch es liegt eine Spur Herablassung darin, das Verhal-ten der russischen Führung als abhängige Variable westlicher Politik zu betrachten. Sie hat sich von Beginn des syrischen Aufstands an auf die Seite Assads gestellt. Sie hat dessen Krieg gegen das ei-gene Volk mit Waffenlieferungen und Diplomatie über zwei Jahre lang gestützt. Putin hätte Assad früher bremsen können, wenn er gewollt hätte. Es bedurfte des moralischen und militärischen Drucks, um eine Änderung der russischen Politik herbeizuführen – von der niemand weiß, ob sie nicht bloß dem Überleben des Regimes dienen soll. Steinmeiers Suggestion, Merkel hätte vermit-teln können, wenn sie nicht so laut über Pussy Riot gesprochen hätte, ist haltlos.
Schwer vorzustellen, wie die beiden noch ein-mal zusammenarbeiten könnten. Nicht weil er sie kritisiert: Merkels wurschtiger Pragmatismus, der sich bei Waffenlieferungen in alle Welt zeigt, kann Widerspruch gebrauchen. Doch Steinmeier greift Merkel von der falschen Seite an. Er stört sich nicht daran, dass Merkels Politik hinter ihrem moralischen Anspruch zurückbleibt, sondern dass sie überhaupt einen formuliert.
Nicht Merkel, Putin hat die Modernisierungs-partnerschaft ruiniert, und Assad hat Steinmeiers Syrienpolitik auflaufen lassen. Aus dem Scheitern ließe sich etwas lernen. Man müsste es dafür erst einmal zur Kenntnis zu nehmen. Frank-Walter Steinmeier ist einer der besten Politiker Deutsch-lands. Er kann Fraktionschef, Arbeits- oder Fi-nanzminister sein. Außenminister besser nicht.
Nähe zu Putin bringt was, predigt Steinmeier. Nur was?
Foto
[M
]: A
rno
Bu
rgi/
pic
ture
-alli
ance
/d
pa

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
durchgehend Deutschland POLITIK 3
Wenn man die SPD und die Grünen so heulen hört in diesen Tagen, möchte man schreien. So sehr sind sie mit ih-ren Niederlagen und mit ihren Ängsten vor
einer Koalition mit den »Schwarzen« beschäftigt, dass ihnen nicht einmal auffällt, wie wunderbar offen die politische Situation zurzeit ist.
FDP raus, AfD nicht drin, Rot-Grün unmög-lich, Union nicht absolut, Koalitionsverhand-lungen mit offenem Ausgang in Berlin und Wiesbaden – es ist, als wären die Wähler mit schweren Pflügen an großen Treckern kreuz und quer durch die politische Landschaft gezogen.
Dies ist, verehrte Grüne, Rote und Schwarze, eine Zeit zum Säen, keine Zeit zum Heulen.
Überall da, wo Politik und Gesellschaft an einer Schwelle stehen, wo das Umschlagen von Quantität in Qualität nur durch die starren al-ten Lager verhindert worden war, überall da kann jetzt Grundlegendes geschehen. Und grund legend ist nicht, wie viele Ministerien die SPD bekommt oder ob die Grünen sich gerade zu schwach fühlen, um Geschichte zu machen, sondern beispielsweise – und es ist eines der ganz großen Beispiele – ob das Demografie-problem gelöst und ob Migration von einem Problemthema zu einem Lösungsthema ge-macht werden kann.
Seit vielen Jahren versucht die Politik nun, mit allen Tricks und viel Geld junge Akademike-rinnen und Akademiker zum Kinderkriegen zu überreden. Das ist gut, das ist schön, das ist aber nicht sonderlich erfolgreich. Was also will man tun? Den Mitteleinsatz pro Baby noch einmal verdoppeln? Selbst das wird nicht genügen, um die Überalterung zu konterkarieren.
Seit vielen Jahren schon wird über Zuwan-derung geredet und über Integration, meist un-ter der roten Überschrift: Problem. Und in der Tat, es gibt Probleme, es gibt aber noch mehr Lösungen. Integration funktioniert tausendmal öfter, als dass sie fehlschlägt. Heute muss man nicht mehr verhindern, dass zu viele Türken kommen, sondern Sorge tragen, dass nicht zu viele gehen, gerade von den Qualifizierten, denn die können gehen.
Längst geht es dabei nicht mehr um In te gra-tion, denn die setzt ja das Innen und Außen vo-raus, das Die und das Wir. Diese Phase liegt hinter uns. Und noch eines ist vorbei: Die Deut-schen, also die ganz ohne und die mit einem lange zurückliegenden Migrationshintergrund, können sich heute leiden. Sie haben keinen Min-derwertigkeitskomplex und keine Angst mehr vor sich selbst, sie brauchen darum auch keinen steif aufgerichteten Stolz mehr auf ihr Deutsch-sein. Sie glauben nicht mehr, dass ein Mensch, der die deutsche und eine andere Staatsangehö-rigkeit hat, seine Loyalität dann immer der ande-ren Nationalität schenkt, weil deutsch zu sein eben so verquält, verkrampft und so heikel ist. Deutsche können Verschiedenheit aushalten, so-gar nationale Ambivalenz.
Aus diesem Selbstbewusstsein heraus sollte es doch endlich möglich sein, doppelte Staats-bürgerschaften zu akzeptieren. Deutschsein ist etwas Gutes und Haltbares, auch wenn man nebenher noch Türke, Libanese oder Italiener ist. Darum wäre es ein hochwichtiges Symbol, wenn die nächste Regierung, sei sie schwarz-rot oder schwarz-grün, diese kleinliche, ängstliche Regelung abschafft, die junge Türken und Ara-ber dazu zwingt, eine ihrer Identitäten, ihre Herkunft oder ihre Zukunft, aufzugeben, wenn sie volljährig werden. Ihre erste erwachsene Entscheidung soll ein Nein sein? Eine Tren-nung? Verrückt.
22. September, die CDU-Spitze feiert ihren Wahlerfolg, General-
sekretär Gröhe schwenkt ein schwarz-rot-goldenes Fähnchen. Doch Angela Merkel kassiert es
rasch ein: Zu nationalistisch. Eine solche Kanzlerin müsste dieses
Land doch öffnen können
geöffnetWarum jetzt die Chance
da ist, die Bundesrepublik
zu einem echten
Einwanderungsland zu
machen VON ÖZLEM TOPÇU
UND BERND ULRICH
Doch ist dies nur das Symbol, tatsächlich geht es um viel mehr: Das Demografieproblem kann ohne Migration nicht gelöst werden, deshalb wird Migration zum strategischen Ziel. Wo immer Ein-wanderung Probleme macht, da muss man die Pro-bleme lösen und kann nicht die Einwanderung stoppen. Sehen konnte man das schon länger, doch jetzt, in dieser atemberaubend offenen politischen Situation, kann es auch Politik werden.
Seien wir radikal, werden wir sachlich:Die Ausgangslage ist günstig, um mit der nächs-
ten Einwanderungswelle nach Deutschland fertig zu werden – pardon, das ist natürlich noch altes Deutsch, es muss heißen: die nächste Einwande-rungswelle zu forcieren. Sie ist bereits im Gange: 2012 kamen laut Statistischem Bundesamt 1 081 000 Menschen nach Deutschland, so viele wie seit 1995 nicht mehr. 712 000 Menschen sind fortgezogen. Bleibt ein Wanderungsüberschuss von 369 000. Das ist ebenfalls der höchste Stand seit 1995. Klingt viel? Wird aber nicht reichen.
Statistiker gehen davon aus, dass Deutschland jedes Jahr etwa 400 000 Zuwanderer braucht, um sein wirtschaftliches Niveau zu halten. Ein Wan-derungsüberschuss dieser Größenordnung ist nicht selbstverständlich für Deutschland in diesen Tagen. 2008 und 2009 stand ein dickes Minus vor den Zahlen – es zogen mehr Menschen aus Deutsch-land fort als herkamen.
Laut der Studie Arbeitslandschaft 2030, die das Forschungsinstitut Prognos im Auftrag der Vereini-gung der Bayerischen Wirtschaft erstellt hat, wer-den bereits 2015 drei Millionen, bis 2030 sogar mehr als fünf Millionen Arbeitskräfte fehlen.
Gewaltige Zahlen, die gewaltige Umbrüche er-fordern werden. Doch noch nie war es politisch güns-tiger, Umbrüche sanft einzuleiten. Man könnte auch sagen: zu helfen, ein Klima zu schaffen, in dem die derzeitige Einwanderungswelle anhält und möglichst viele Menschen in Deutschland sie gut finden.
Deutschland ist das wirtschaft-lich stärkste und politisch stabilste Land in Europa, Berlin hat mittlerweile ein so cooles Image wie London oder Istanbul und zieht junge Leute aus Spanien, Frank-
reich, Polen und anderen europäischen Ländern an. Einige wollen hier studieren, andere entfliehen der Jugendarbeitslosigkeit in ihren Ländern und kom-men als Ärzte, Krankenschwestern, Ingenieure. Sie werden Deutschland helfen, die Renten von immer mehr Alten zu zahlen. Aber sie werden nicht nur den Reichtum des Landes bewahren helfen, sie werden das Land auch verändern. Für diese Gene-ration ist es eben weitgehend selbstverständlich, jederzeit in ein anderes Land zu gehen. Es gab nie Grenzen für sie, der Euro ist die erste Währung, die sie jemals kennengelernt haben. Der Kontinent ist nicht mehr so groß, die Nachbarländer nicht mehr so weit, vor allem nicht, seit es Billigflieger gibt.
Deutschland wird internationaler, und vielleicht weniger deutsch. Zumindest anders deutsch.
Doch auch das ist nicht wirklich neu. Deutsch-land kann das.
Nach dem Krieg waren sich die Deutschen selbst fremd, und trotzdem haben sie es geschafft, sich selbst und, auch wenn sie sich diese Leistung nie eingestanden und sie nie gefeiert haben, Mil-lionen Vertriebene zu integrieren. Auch die waren fremd, fremder als man sagen durfte. Später ka-men die Ostdeutschen, deren Fremdheit ein Tabu und eine Tatsache war. Die beiden Himmelsrich-tungen Deutsch haben sich dann gegenseitig inte-griert, es hat ein Vierteljahrhundert gedauert und viele Investitionen erfordert, aber nun ist es leid-lich gelungen.
Anfang der sechziger Jahre bereits holte das Land die ersten »Gastarbeiter«, die Italiener, Spa-
nier und Portugiesen, deren Enkel es ihnen heute nachmachen, die kommen allerdings mit Einsteck-tuch und Diplom kommen, nicht mit hinten platt gelatschten, schmutzigen Schuhen. Als man sich an die Südeuropäer aus Valencia und Sizilien so gerade gewöhnt hatte, kamen die Südosteuropäer, die Tür-ken, und im Gegensatz zu den Spaniern und Ita-lienern blieben sie. Da war immer dieser zwickende Widerspruch: Man brauchte sie, aber so richtig wollen wollte man sie nicht.
Trotzdem, alle sind jetzt irgendwie drin im Club. Und das Land, es ist nicht untergegangen. Mittlerweile findet die Mehrheit der Deutschen generell, dass Integration eine gute Sache ist, eben-so die Zuwanderung. Wären da nicht die Muslime. Ganz anders als die Gastarbeiter braucht man sie nicht einmal.
Integration ja – Muslime nein, und wenn schon Türken, dann lieber die, die sich hin und wieder einen Raki genehmigen: So in etwa war die Ge-mütslage des ambivalenten Landes, auf das im Herbst 2010 ein Buch niederschlug wie eine Ab-rissbirne auf ein altes Haus. Für manchen war die Debatte um die Thesen von Thilo Sarrazin (kurz zur Erinnerung, weil es mittlerweile so schwer vor-stellbar ist: Muslime sorgen mit ihrer hohen Ge-burtenrate dafür, dass die Intelligenz des Landes insgesamt abnimmt) wie ein Gewitter, das die stickige Luft rausblies. Endlich traute sich mal je-mand, unbequeme Wahrheiten über »die da« aus-zusprechen, all das, was die schönredenden Politi-ker und die meinungsdiktierenden Journalisten verschwiegen.
Für die Mehrheit der Migranten war das eine Zäsur. Sie sahen, wie der Autor und seine Gefolg-schaft die Politik vor sich hertrieben, und sie sahen, wie ihre Bundeskanzlerin zuerst »nicht hilfreich« vor sich hin murmelte und anschließend Multi-kulti mal eben für gescheitert erklärte. Die Elite unter den Nachkommen der alteingesessenen Mig-ranten denkt mittlerweile: Ich kann auch woanders hingehen. Beispielsweise in das Land meiner El-tern. Sie denkt aber auch: Ich lasse mir das nicht mehr gefallen, ich lasse mir den öffentlichen Raum nicht wegnehmen von den Sarrazinisten, ich lasse mir meine deutsche Seite nicht stehlen.
Vieles spricht dafür, dass auch die neuen Mig-ranten lieber dort leben, wo etwas entspannter mit Vielfalt umgegangen wird. Die Frage ist also nicht: Wollen wir sie? Die Frage ist: Wie kriegen wir sie zu uns – und was für Gründe hätten sie zu bleiben? Wie ändert man ein Klima?
Wie wäre es zur Abwechslung mal wieder mit ein wenig Radikalität? Einer politischen Schub-umkehr? Die Union hat schon einmal bewiesen, dass sie auch Radikalität kann. Sie richtete 2005 das Amt der Bundesbeauftragten für Integration ein, die ihren Platz ganz nah an der Macht, näm-lich im Kanzleramt, bekam, und 2006 schaffte der umtriebige Innenminister die Islamkonferenz und fand überdies, dass der Islam zu Deutschland ge-höre. Damals hieß der noch Wolfgang Schäuble. Seit 2011 heißt er Hans-Peter Friedrich. Der kas-sierte den Satz ziemlich schnell, fuhr außerdem die Islamkonferenz gegen die Wand und hinterließ den Eindruck, dass Integration in erster Linie ein Si-cherheitsthema sei.
Also sollte man das Innenministerium doch seinen Hauptjob machen lassen, nämlich die Ge-sellschaft vor Terrorismus von rechts, links und aus islamistischer Richtung zu schützen. So etwas wie eine »Willkommenskultur« für Einwanderungswil-lige strahlt das Ministerium nicht aus. Muss es aber auch nicht. Integration und Migration haben dort nichts zu suchen, sie sollten als das behandelt wer-den, was sie in erster Linie sind: ein arbeits-, bil-dungs- und gesellschaftspolitisches Thema. Also sollten sie auch als ein gleichwertiges Thema an ein entsprechendes Ministerium angebunden werden – oder gleich ein eigenes Ministerium bekommen.
Wichtig ist dabei der qualitative Sprung. Die umtriebige Integrationsbeauftragte Maria Böhmer hat es ganz gut geschafft, die Verbände der Migran-ten im Gespräch und ruhig zu halten. Künftig je-doch muss es die Aufgabe einer Beauftragen oder einer Ministerin sein, Integration zu einer Aufgabe, zu einem Problem und zu einer Lust für alle zu machen, die hier leben.
Die Frage der institutionellen Zuordnung ist aber wahr-scheinlich um einiges leichter zu lösen als die personelle. Zugewandtheit und weniger Ängstlichkeit vor einer Inter-nationalisierung des Landes
lassen sich nicht per Gesetz vorschreiben. Deshalb braucht es eine Persönlichkeit, die, wenn es sein muss, stellvertretend für alle anderen zugewandt und unängstlich ist. Sie müsste den Mut haben, an-zuecken. Sie müsste sich als Vermittlerin verstehen, die erklärt, warum das so wichtig ist mit der Ein-wanderung. Sie müsste einen Imagewandel des Themas Einwanderung schaffen: weg von etwas, das alle nur »ertragen«, hin zu etwas, das man will; weg von der altdeutschen Frage: Wann geht ihr wieder nach Hause? hin zu einem neudeutschen Wunsch: Kommt zu uns, geht nicht in die USA! Und nicht zurück in die Türkei. Diese Persönlich-keit müsste dem türkischen Regierungschef Er-doğan, wenn er mal wieder die Deutschtürken für sich allein haben will, widersprechen und sagen, dass sie unsere Türken mindestens so sehr sind wie seine. Eher mehr.
Diese Persönlichkeit müsste auch zur Mehr-heitsgesellschaft sprechen und ihr etwas mehr In-tegrationsbereitschaft abverlangen: ein paar Festta-ge hier, ein wenig Geschichtswissen da. Ein Volk, das die Mülltrennung gelernt hat, wird auch den Unterschied zwischen Sunniten, Schiiten und Ala-witen kapieren.
Da das Thema oft so emotional diskutiert wird, müsste diese Vermittlerin sich die Deutungshoheit über Debatten erkämpfen wollen. Was sie oder er übrigens nicht sein müsste, wäre Migrant. Wahr-scheinlich wäre das sogar ein Nachteil: Ein Mi-grant, wie sollte es anders sein, kümmert sich um die Migranten, ist ja deren Ding. Modern und wirklich radikal wäre es, wenn man so jemanden zum Außenminister machte. Ein Deutscher, dessen Eltern eingewandert sind, repräsentiert Deutsch-land im Ausland. Wie könnte man besser neue Ein-wanderer bekommen? Und ein Deutscher, dessen Eltern hier geboren wurden, kümmert sich um die, die neu dazukommen.
Und wo wir gerade beim Aufräumen sind: Der Begriff »Integration« hat seine beste Zeit eindeutig hinter sich. Viele aus der zweiten, dritten und vier-ten Einwanderergeneration reagieren oft nur noch mit einem leichten Hochziehen der Augenbraue, wenn sie hören, dass sie sich endlich, jetzt endlich mal in »die« Gesellschaft integrieren sollten. Wohin denn nur? Die Aufforderung tut so, als sei die Mehrheitsgesellschaft seit dem Krieg immer diesel-be geblieben, als gäbe es nur eine Art Deutsche. Aber es gibt so viele, dass einem schwindelig wer-den kann. Letztlich meint Integration Teilhabe. An Arbeit, Bildung, Gesellschaft, Politik.
Den neuen Zuwanderern aus den europäischen Nachbarländern braucht man jedenfalls mit dem Begriff gar nicht erst zu kommen. Nur, was soll man sagen, wenn das Wort Integration nicht mehr funktioniert? Probieren wir es vielleicht vorerst mal mit: Zusammenleben.
Also, ein neues Gesetz zur doppelten Staatsbür-gerschaft, ein neues Ministerium, ein neuer Begriff, und vor allem: eine ganz neue Richtung. Und, liebe Grüne und Sozialdemokraten, auch wenn ihr sonst nicht viel schafft in dieser neuen Regierung: Das wäre schon Geschichte genug.
Foto
(A
uss
chn
itt)
: Ju
ri R
ee
tz/
BR
EU
EL-
BIL
D

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 414 POLITIK
Kraft ist in den Tagen nach der Wahl von der Düsseldorfer Peripherie ins politische Zentrum der Republik gerückt. Ein SPD-Konvent, ein kleiner Parteitag, wird nach den Sondierungs-gesprächen an diesem Freitag entscheiden, ob die Sozialdemokraten in offizielle Koalitionsverhand-lungen eintreten. Ein Viertel der 200 Delegier-ten hört auf Kraft. Sie ist damit die sozialdemo-kratische Schlüsselfigur bei dem komplizierten Unterfangen, das Wahlergebnis vom 22. Sep-tember in eine Bundesregierung zu verwandeln. Gegen ihren Willen geschieht gar nichts. Was also will sie?
Zwischen der holländischen Grenze und dem Nordostzipfel kurz vor Niedersachsen liegen 290 Kilometer Nordrhein-Westfalen. Unter geogra-fisch gebildeten Spitzengenossen gilt die Strecke derzeit als Referenzwert, um die strategischen Fä-higkeiten ihrer stellvertretenden Vorsitzenden zu vermessen: »Hannelore Kraft denkt nur von Aa-chen bis Porta Westfalica.«
Mit ihren Interessen als Ministerpräsidentin begründen sie Krafts Widerstand gegen eine Gro-ße Koalition. Im Mai nächsten Jahres sind Kom-munalwahlen, auch in NRW. Kraft befürchte, für die Juniorpartnerschaft der SPD in einer schwarz-roten Bundesregierung abgestraft zu werden. Ihre Kritiker sehen die gebürtige Mühlheimerin als Gefangene ihres geistigen Ruhrpotts, als Minis-terpräsidentin, die nach der Prämisse handelt: erst das Bundesland, dann die Partei.
Die anderen erkennen in ihr eine kalt berech-nende Machttaktikerin, die keinen sozialdemo-kratischen Vizekanzler über sich duldet und nach dem Motto verfährt: erst ich. Dann die anderen. Als Koordinatorin der SPD-geführten Länder im Bundesrat würde sie zur Gegenspielerin von An-gela Merkel aufsteigen, ob mit oder ohne Große Koalition, eine ideale Ausgangsposition für eine eigene Kanzlerkandidatur. Doch ist das wirklich Krafts Kalkül? Die Umrätselte schweigt und gibt sich harmlos-pragmatisch.
Zwei Erlebnisse prägen Krafts Denken und Handeln: erstens die Bundestagswahlnacht 2009. Kaum hatte die erste Hochrechnung das historische 23-Prozent-Debakel prognostiziert, hatten die Spitzengenossen in Berlin bereits die Posten untereinander aufgeteilt.
Wichtiger noch ist für Kraft die NRW-Landtags-wahl vom Mai 2010. Sie en-dete mit einer Stimme Vor-sprung von Rot-Rot-Grün vor Schwarz-Gelb. Kraft sträubte sich zunächst gegen eine Minderheitsregierung und ging sie dann ein. Sie hatte sich zunächst vor die Frage gestellt gesehen, welchen Teil ihrer Partei sie verlieren wollte: jenen, der die SPD nicht als Juniorpartner einer Großen Koalition haben wollte, oder jenen, der sich gegen jede Zusam-menarbeit mit der Linken stemmte. Sie entschied sich für ein beherztes Weder-Noch, Gespräche mit allen – und parallel dazu für ein Großpalaver mit der Partei. Aus den Neuwahlen ging Kraft gestärkt hervor. Sie hatte die Erfahrung gemacht, dass sich Risiko politisch auszahlen kann, wenn man versteht, es zugleich behaglich zu gestalten. Dass sie damals von den Grünen mehr auf diesen Weg geschoben werden musste, als dass sie ihn beschritt, hat Kraft verdrängt. Das Einbinden der Basis gilt ihr seither als Schlüssel zum Erfolg. Stimmt der Weg, so Krafts Credo, führt er zwangsläufig zum Ziel.
Am Morgen nach der Bundestagswahl ließ Kraft einen engen Vertrauten eine Große Koali-tion öffentlich ausschließen. Danach fasste ihr Landesvorstand einen Beschluss, der eine »breite Beteiligung der Gremien und Mitglieder an möglichen Entscheidungsprozessen« forderte. Mit ihrem Widerstand verhinderte sie, dass die Spitzengenossen in Berlin vollendete Tatsachen schaffen, sie selbst war in eine Schlüsselposition gerückt. Ein erstes Zwischenziel war erreicht.
Am nächsten Tag ließ sie Parteifreunde aus NRW zunächst fordern, die Mitglieder müssten am Ende von möglichen Koalitionsverhandlun-gen entscheiden, dann ließ sie die Idee wieder einsammeln. Es war ein Signal an Sigmar Ga-briel, der die Stimmung in seiner Partei zu lesen weiß. Kurz darauf verkündete er ein Mitglieder-votum als seinen Masterplan. Es sollte nicht so
aussehen, als folge der Vorsitzende seiner Stell-vertreterin – aber so war es. Kraft gab den Kurs vor – und Gabriel setzte die Partei darauf.
Wie Angela Merkel ist Hannelore Kraft eine Quereinsteigerin in die Politik – und in der Kanzlerin wird sie oft gespiegelt. So wie lange Zeit Merkel immer wieder unterschätzt wurde, so werde nun auch die ähnlich abwartende, mit ähnlichem Mutterwitz versehene Kraft unter-schätzt, glauben ihre Anhänger. Nur weil Merkel unterschätzt wurde, dürfe man Kraft jetzt nicht überschätzen, warnen ihre Gegner. Sie werfen Kraft vor, den Widerstand gegen Schwarz-Rot erst befeuert und die SPD-Mitglieder auf die Bäume getrieben zu haben. Nun bekomme sie die dort nicht wieder herunter.
Rund 150 Ortsvereine und Juso-Gruppen sind bis Wochenbeginn der Internetaktion »Gro-ße Koalition? Nein Danke« beigetreten, der nie-dersächsische Ministerpräsident Stephan Weil brachte zum SPD-Konvent am vergangenen Freitag einen Stapel Protestschreiben gegen die Große Koalition mit, noch immer fluten Ableh-nungswellen die SPD-Parteizentralen zwischen München und Kiel.
Hannelore Kraft denke vom Ende her, raunt einer ihrer Vertrauten, wohl wissend, dass das Vom-Ende-Her-Denken so sehr mit Merkelscher Machtraffinesse verbunden ist, das es längst als Ausweis höherer politischer Klugheit gilt. Das Ende, von dem Kraft her denkt, ist ein Anfang, der mögliche Neuanfang für die SPD: die Bun-destagswahl 2017. Will die SPD wieder einen Kanzler stellen, muss sie über 30 Prozent kom-men. Der einfachste Weg dorthin, so sieht das Kraft, wäre eine schwarz-grüne Bundesregierung, die, so sieht sie das weiter, die Kanzlerin eigent-lich anstrebt. Kraft stellt sich darunter eine Ko-alition vor, die an den kulturellen Unterschieden ihrer Partner leidet, über ihr Kernthema Ener-giewende im Dauerclinch liegt und bei Land-tagswahlen immer wieder abgestraft wird. Davon würde die SPD in der Tat profitieren. Funktio-niert Schwarz-Grün jedoch, hätte die SPD ihren strategischen Partner verloren und die CDU ei-nen neuen gewonnen, nachdem ihr die FDP fürs
Erste abhandengekommen ist. Das ist das erste Risiko auf dem Weg, den Kraft ein-geschlagen hat.
2017 ist aber nicht nur die Bundestagswahl, sondern auch die Landtagswahl in NRW. Will Kraft Kanzler-kandidatin werden, muss sie diese Wahl gewinnen. Will sie wirklich Ministerpräsi-dentin bleiben, muss sie es auch. Nur wenn die SPD ein
Maximum an eigenen Forderungen durchsetzen kann, glaubt Kraft, entgeht sie 2017 dem Zorn der Wähler.
Steinmeier, Steinbrück und Gabriel glauben, der Kanzlerin könnten die Befindlichkeiten der SPD herzlich egal sein, mit absoluter Mehrheit in den Umfragen sei sie jederzeit in der Lage, Neuwahlen anzusteuern. Kraft, die ihre Macht selbst Neuwahlen und einer Minderheitenregie-rung verdankt, sieht das anders. Sie geht davon aus, dass Merkel Neuwahlen vermeiden will, solange die AfD beste Chancen besitzt, ins Par-lament einzuziehen. Kraft wettet auf Merkels Risikoscheu. Ausgerechnet sie, die selbst als so vorsichtig gilt, als große Integratorin, treibt die SPD damit in ein hochgefährliches Risiko.
Die Deutschen haben der Politik am Wahltag drei Botschaften mit in die Regierungsfindung gegeben: 1. Angela Merkel soll Kanzlerin blei-ben. 2. Wir wollen die FDP nicht mehr 3. Wir wollen eine Große Koalition. Zehn Tage später sehen sie zwar noch immer nicht die Konturen einer künftigen Regierung. Dafür aber eine SPD im Schockzustand – und eine Hannelore Kraft, die sich rührend um den neuen deutschen Pa-tienten kümmert: die SPD.
Ihre Therapie zielt ganz auf die Befindlichkeit der Genossen, ihre Gefühle. Der Rest Deutsch-lands bleibt außen vor.
Und darin liegt die dritte und größte Gefahr von Krafts Weg. Die Wähler wünschen sich Po-litiker, die es schaffen, nach einer Wahl eine Regierung zu bilden. Hannelore Kraft bildet lieber einen Stuhlkreis – und überlässt Gabriel das Risiko.
Was will Hannelore Kraft? Den Wahlkampf bestritt die beliebteste SPD-Poli-tikerin als eine Art Schat-ten-Kanzlerkandidatin, als sozialdemokratische Sehnsuchtsfigur eines ver-
patzten Gestern und eines besseren Morgen. Bezog Peer Steinbrück in den Medien Prügel, hieß es un-ter Genossen: »Ach, hätten wir doch nur die Han-nelore ...« Sank die Partei in Umfragen, trösteten sie sich: »Beim nächsten Mal kommt Hannelore ...«
Mit dem Wahlabend ist Kraft in die Rolle der Schatten-Parteivorsitzenden gewechselt: Ob die SPD in eine Große Koalition geht oder in die Op-position, ob sie versucht, der CDU eine Minder-heitsregierung und Neuwahlen aufzuzwingen – all das hängt nicht allein von Sigmar Gabriel ab, son-dern mindestens genauso sehr von Hannelore
Kraft. Die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen zieht nicht länger nur Sehnsüchte auf sich, sie handelt.
Niemand aus der engeren Führungsriege hat sich die abgrundtiefe Skepsis der Basis gegen eine Große Koalition so zu eigen gemacht wie sie, nie-mand hat sie so mit seiner Hausmacht verbunden. Damit ist sie gleich in einen doppelten Wettstreit eingetreten: einen mit SPD-Chef Sigmar Gabriel über die Frage, wer in der SPD den Ton angibt. Wer versteht die einfachen Parteimitglieder besser, wer verkörpert die SPD: der Instinktpolitiker aus Goslar oder die Tochter eines Straßenbahner-Ehe-paares von der Ruhr? Und einen mit Bundeskanz-lerin Angela Merkel, die es mit einer Herausforde-rin zu tun hat, die nicht offen als solche auftritt, der manche alles zutrauen und manche nichts – und die darin viele schon an Merkel selbst in ihren An-fängen erinnert.
Lächelt hier die Kanzlerin 2017?
Regierungsbildung: Wer bestimmt die Richtung?
Foto
(A
uss
chn
itt)
: Ste
fan
Th
om
as K
roe
ger/
laif
GeistigerRuhrpott
Hannelore Kraft ist jetzt die starke Frau der
SPD. Doch wofür sie ihren Einfluss nutzen
will, weiß nur sie. Wenn überhaupt
VON PETER DAUSEND
Arbeiterkind
1961 wird Kraft als Hannelore Külzhammer in Mühlheim an der Ruhrgeboren. Ihr Vater ist Straßenbahnfahrer, ihre Mutter Schaffnerin. Kraft macht Abitur und studiert Wirtschaftswissenschaften.
1994 tritt Kraft in die SPD ein, sechs Jahre später erringt sie einen Abgeordnetensitzim nordrhein-westfälischen Landtag.
2010 lässt Kraft sich zur Ministerpräsidentin einer Minderheitsregierungwählen. Nach der Neuwahl im Jahr 2012 reicht es schließlich für Krafts Wunschkoalition Rot-Grün.
Die Neuwahlen in NRW 2010 machten Kraft stärker. Damals hat sie gelernt, dass sich Risiko politisch auszahlen kann

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 POLITIK 5
Tarek Al-Wazir hat eine Menge Wut im Bauch. Mit grimmi-gem Schwung ruckt er seinen schwarzen Rollkoffer über die Schwelle ins Café Zimt und Zucker an der Spree, wo sich die Berliner Grünen dieser Tage
häufig zum Haare-Raufen und Krise-Besprechen treffen. Der hessische Landesvorsitzende der Par-tei hat nach zwei Monaten Wahlkampf tiefe Schatten unter den Augen und pfundweise Ge-wicht verloren. Die Fehler des grünen Bundes-tagswahlkampfs kosteten Al-Wazir eine sicher geglaubte rot-grüne Mehrheit. »Wir Grüne in Hessen sind Teil des großen Abrutschens, auch wenn wir selbst keinen Fehler gemacht haben«, sagt er. »Man wird einfach mit runtergezogen.«
Die Grünen sind erst einmal nicht auf der Re-gierungsbank gelandet, sondern in einem Loch. Fast das gesamte Spitzenpersonal der Partei hat abtreten müssen. In Berlin rufen sie schon lange nach einem wie Tarek Al-Wazir: einem jungen, entschlossenen Realo, der genau die Strahlkraft besitzt, die der alten Führungsspitze zuletzt ganz abging. Jetzt richtet die am Boden liegende Partei fast messianische Hoffnungen auf den 42-Jähri-gen, der offenbar alles richtig gemacht hat – kein Bündnis im Vorfeld ausgeschlossen, keinen Popu-lismus in den eigenen Reihen durchgehen lassen, keine Oberlehrerpose eingenommen.
Wenn er es geschickt anstellt, könnte Tarek Al-Wazir in Hessen den Grünen jetzt doch noch verschaffen, was sie dringend brauchen: die Be-teiligung an einer Regierung, in die sie ohne wei-teren Gesichtsverlust einziehen können. Vor al-lem viele Realos wünschen sich, Al-Wazir möge endlich den Kulturbruch wagen und in Hessen die erste Landesregierung mit der CDU bilden. Schließlich war Hessen schon einmal Pionier-land: Hier entstand – unter Al-Wazirs Lehr-meister Joschka Fischer – die erste rot-grüne Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik. Inzwischen ist das Geschehen auf der hessischen Nebenbühne mit dem auf der Hauptbühne in Berlin noch enger verflochten: Der hessische Mi-nisterpräsident Volker Bouffier wird Teil der Ver-handlungskommission, die für die CDU Sondierungs-gespräche führt. Auch die Grünen denken daran, ihre erfolgreichen Landespolitiker in die Sondierungen ein-zubinden. Gut möglich also, dass Al-Wazir und Bouffier gleich zweimal Schwarz-Grün beschließen.
Nicht ausgeschlossen ist aber auch, dass der Hoff-nungsträger Al-Wazir als tra-gische Figur endet. Dass er nach 14 Jahren par-lamentarischer Knochenarbeit im gnadenlosen Hessischen Landtag einer Großen Koalition ge-genübersteht – als eine Art Zaungast an der Seite der gerupften Liberalen, die erst in den Morgen-stunden der Wahlnacht erfuhren, dass sie es doch knapp in den Landtag geschafft hatten. »Die eine kleine Freude, die dieser Abend uns Grünen be-schert hat, nämlich das Aus für die FDP, war schließlich auch noch dahin«, seufzt Al-Wazir.
Aber Tragik ist nicht sein Fach. Al-Wazirs Fa-miliengeschichte hat ihn abgehärtet. Sein jemeni-tischer Vater wuchs im Gefängnis auf, weil der Urgoßvater 1948 an einem Aufstand gegen den damaligen Regenten Imam Yahya beteiligt gewe-sen war. Der Vater bekam sein erstes Paar Schuhe mit 14 Jahren. Al-Wazirs Großonkel war sogar für zwei Wochen König des Jemen. Dann schlug man ihm den Kopf ab. Al-Wazirs Mutter Gerhild, geborene Knirsch, stammt aus einer sudetendeut-schen Vertriebenenfamilie, die im ländlichen Hessen in der Wetterau landete – dort, wo jene Tankstelle steht, an der sich die CDU-Granden des »Andenpakts« wie Bouffier, Roland Koch und Franz Josef Jung gelegentlich trafen. Der deutsche Großvater von Tarek Al-Wazir war bis zuletzt ein überzeugter Nazi, dessen Enkel mit dem arabi-schen Vater anfangs nicht ins Haus durfte.
Ressentiments begleiteten den Grünen auch in der Politik. Im Jahr 2008 warnte ein Wahlplakat des früheren Ministerpräsidenten Koch: »Al-Wazir, Ypsilanti und die Kommunisten«. Wer der CDU damals Fremdenfeindlichkeit vorwarf, bekam un-schuldig zu hören, das sei nun mal der Name des Grünen-Chefs.
Ein Bündnis mit der hessischen CDU, das wäre eben kein Bündnis mit der liberalen CDU der Altmaiers, Laschets oder von der Leyens. Hier weht noch ein anderer Wind. Als Al-Wazir 24 Jahre alt war und als frisch in den Landtag gewählter Ab-geordneter in der Kantine anstand, murmelte hinter ihm ein CDU-Mann: »Na, Al-Wazir, wenn die Moslems die Macht übernehmen, legst du doch ein gutes Wort für mich ein, oder?« Al-Wazir lächelt sein »Crazy Hessen«-Lächeln. Bei der Hessen-CDU, fügt er mit einer kantigen Handbewegung hinzu, »hat man immer das Gefühl, gleich geht der Schrank auf und die Mumie von Alfred Dregger schaut raus.«
Die CDU-Regierung Volker Bouffiers hat von den Hessen keine guten Noten bekommen, der Ministerpräsident hat sich mit letzter Kraft in den Windschatten der Kanzlerin gerettet. Und so einen sollen nun die Grünen retten? Bouffier ließ ihnen, wie zuvor der SPD, per Boten eine Einladung zur Sondierung zukommen, und die Grünen nahmen an. »Wir reden mit allen«, sagt Al-Wazir, »das haben wir schon immer getan.« Für Bouffier hätte ein schwarz-grünes Bündnis auf Länderebene den Reiz des Neuen – die Große Koalition hingegen würde bedeuten: weniger Ministerien für die CDU und vermutlich kontinuierlichen Ärger mit einer ge-demütigten SPD-Linken, die jetzt wieder wie 2008 mit der Linken flirtet.
»Und täglich grüßt das Murmeltier«, hat Al-Wazir dazu jetzt getwittert. Irgendwie ist es ihm gelungen, die Welt vergessen zu machen, dass auch er 2008 der SPD zum Bündnis mit der Linken geraten hat. Ein Schritt, der die damalige hessische SPD-Chefin Andrea Ypsilanti gegenüber den Wäh-lern wortbrüchig werden ließ und ihre Karriere beendete. »Wir hatten damals ein eindeutiges Wäh-lervotum«, erklärt Al-Wazir im Rückblick. »Roland Koch hatte die Wahl verloren. Wir hatten etwas vor Augen, das in Nordrhein-Westfalen gut ge-klappt hat.« Aus dem Trauma von 2008, dem gescheiterten rot-rot-grünen Bündnis, haben die Grünen eine Konsequenz gezogen: Ein Tole-rierungsmodell kommt für sie nicht infrage. »Wenn die Linken weiter so tun, als fiele Manna vom Himmel, geht nichts«, sagt Al-Wazir. Aber wenn
sie die Schuldenbremse ak-zeptierten und den Haushalt mittrügen, überhaupt Verant-wortung übernähmen, dann könne man reden.
Al-Wazirs Geschmeidigkeit ist stilbildend. Selbst Freunden vom Realo-Flügel fällt kaum eine konkrete Auseinanderset-zung ein, bei der sich Al-Wazir deutlich gegen links positio-niert hätte. »Lasst uns mit dem Flügel-Quatsch endlich auf-
hören«, hat er auch jetzt am Wochenende gefordert. Im Januar hat Tarek Al-Wazir sich für eine Karne-valssendung im hessischen Fernsehen in die linke Claudia Roth verwandelt, mit blonder Perücke, knallroten Lippen, buntem Gewand und Schal. Er hat alle umarmt, die ihm in die Quere kamen. Roth selbst hatte die Requisiten aus ihrem eigenen Klei-derschrank bereitgestellt. Eine Persiflage oder eine Hommage? Al-Wazir legt sich nicht gern fest.
Für Gerhild Knirsch, Al-Wazirs Mutter, ist Tarek ein Rechtsabweichler. Sie ist Mitglied bei Attac. Ginge ihr Sohn ein Bündnis mit der hessischen CDU ein, könnte sie das, glaubt er, »allenfalls ra-tional verstehen, gefühlsmäßig sicher nicht«. Als Tarek klein war, hat sie ihn mitgenommen zu De-monstrationen, in die Hüttendörfer gegen die Start-bahn West. Es gab Tote dort bei den Protesten, wie überhaupt auf Hessens Straßen oft aus politischen Gründen Blut geflossen ist – nach dem Kaufhaus-brand der RAF, bei den Straßenschlachten zwischen Joschka Fischers Putztruppen und der Polizei. Gerade weil die Gräben in Hessen so besonders tief sind, wäre ein Bündnis zwischen CDU und Grünen so eine Sensation. »Nur weil Journalisten Schwarz-Grün so toll finden, ist es politisch noch nicht plausibel«, meint Al-Wazir. »So etwas Neues muss man eigentlich aus einer Position der Stärke heraus machen, nicht wenn es einem dreckig geht«, sagt er. Damit meint er die Bundespartei. Für Hessen gilt weiter: Nichts ist ausgeschlossen.
»Basis und Wähler wollen zu zwei Dritteln, dass wir eine rot-grüne Regierung bilden«, sagt Al-Wazir. Die hessische SPD hat sich unter ihrem Umwelt-politiker Hermann Scheer dem ökologischen Den-ken geöffnet. Tarek Al-Wazir sieht sehr genau, wie
sich der SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel mit den Hessischen Verhältnissen herumplagt. Das Trauma von 2008, die Niederlage, die sich die SPD damals selbst beigebracht hat, sitzt dem SPD-Vor-sitzenden immer noch im Nacken. Wie Schäfer-Gümbel sich auch entscheidet, eine Hälfte seiner Partei wird es als Verrat empfinden. In eine Abhän-gigkeit von der Linken will er sich nicht begeben, aber unter Volker Bouffier als Vize zu dienen, scheint ihm ebenfalls nicht verlockend. Auch wenn sie nie gemeinsame Sache gemacht haben, etwas verbindet die großen hessischen Volksparteien: die klassische Industriepolitik, sprich der Flughafen. Für die Grü-nen steht Letzerer vor allem für Lärm, Natur-vernichtung und Abgase. Der Kampf gegen die Start-bahn ist Teil ihrer Identität. Für CDU und SPD bedeutet der Flughafen 40 000 Arbeitsplätze, Wirt-schaftskraft, Zukunft. Eine echte Hürde für Al-Wazir, der für sich das Amt des Wirtschafts- und Verkehrs-ministers ins Auge gefasst hat.
Bleibt nur eine Möglichkeit, die in diesem Jahr-hundert noch nirgendwo versucht wurde, in keiner Stadt, in keinem Land. Eine Ampelkoalition mit der klein geschrumpften FDP hätte für SPD und Grüne den Charme, sich weder an die verantwortungsfreie
Linkspartei ketten zu müssen, noch unter Volker Bouffier zu amtieren. Aber Tarek Al-Wazir erinnert sich mit Schaudern an die Wahlkampfaktion des FDP-Verkehrsministers Florian Rentsch, der Journa-listen an die A 5 beorderte, um dort Warnschilder vor Radarfallen zu enthüllen. »Die FDP ist bei unserer Basis fast noch mehr verhasst als die CDU«, sagt Al-Wazir zweifelnd. Wer Geschwindigkeitsbegrenzungen als Freiheitsberaubung versteht, steht weit entfernt von den Grünen.
Immerhin sind die Liberalen nun in einem ähn-lich schwarzen Loch gelandet wie die Grünen – nur noch tiefer gefallen und noch wütender auf die CDU, die ihnen auch in Hessen nicht aufhelfen wollte. Nicht ausgeschlossen, dass die FDP sich unter neuer Führung etwa der ehemaligen Kultusministerin Nicola Beer aus ihrer Wagenburg heraustraut und neue Wege wagt. Tarek Al-Wazir jedenfalls ist wie immer zu Gesprächen bereit, das Wort »Ausschlie-ßeritis« ist seine Erfindung. Gut möglich, dass seine politische Geschmeidigkeit, seine Offenheit nach allen Seiten, sein taktisches Geschick Lehren aus den Schroffheiten der eigenen Familiengeschichte sind. Al-Wazir bedeutet übrigens »der Minister«. Und Tarek heißt: »der Kommende«.
Regierungsbildung: Wer bestimmt die Richtung?
Der deutsche Groß-vater von Al-Wazir war ein überzeugter Nazi, dessen Enkel mit dem Vater anfangs nicht ins Haus durfte
Foto
: Pe
ter
Fri
sch
mu
th/
argu
s
Im Land der tiefen GräbenAuf der wichtigsten Nebenbühne der Republik
spielt der Grüne Tarek Al-Wazir eine Hauptrolle –
gelingt ihm in Hessen Schwarz-Grün?
VON MARIAM LAU
Sein Name könnte ein gutes Omen sein –
Tarek Al-Wazir bedeutet wörtlich: Der
kommende Minister
Migrantenkind
1971 wird Tarek Al-Wazir in Offenbach am Main geboren. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater Jemenit. Al-Wazir besitzt die Staatsbürgerschaftenbeider Länder.
1989 wird Al-Wazir Mitglied bei den Grünen, 1995 zieht er in den Hessischen Landtag ein. Seit 2007 ist er Vorsitzender der Landespartei.
2008 will Al-Wazir seine Partei in eine rot-grüne Minderheitsregierungunter Ministerpräsidentin Andrea Ypsilanti führen, doch der Plan scheitert an vier Abgeordneten der SPD.

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
schaft und der Wirtschaft zu verstärken. Zweites Problem: die Justiz.ZEIT: Warum ist der Wandel dort so gut wie un-möglich?Frattini: Weil die Justiz sich sperrt. Aber vor drei Jahren haben wir doch das Verwaltungsrecht so verändert, dass Prozesse jetzt keine Ewigkeit mehr dauern. Leider warten im Zivilrecht noch Millionen von Fällen …ZEIT: ... das Beharrungsvermögen der Justiz ist le-gendär, mit Prozessen, die zehn Jahre dauern. Wieso?Frattini: (seufzt) Das ist eine Machtfrage. Der Anwaltsverband hier, der Richterbund dort – da reicht die Kraft der Regierung nicht aus. Zudem dominieren die Anwälte das Parlament. Berlus-coni und Monti sind mit ihren Vorlagen zur Ver-fahrensbeschleunigung nicht durchgekommen.ZEIT: Und der starre Arbeitsmarkt, der systema-tisch Neueinstellungen verhindert – gerade im kleineren und mittleren Firmensektor?Frattini: Deshalb hat uns die Europäische Zen-tralbank 2011 auch gewarnt und an erster Stelle die Lockerung des Arbeitsrechts gefordert. Nur waren sich alle einig bei ihrem Nein – von der extremen Linken bis zu Mitte-Rechts. Immerhin haben wir unter Monti eines geschafft – die Möglichkeit von Zeitverträgen. Unter der Re-gierung Letta wurden Anreize für die Einstellung junger Arbeiter beschlossen: Drei Jahre lang zah-len Arbeitgeber keine Sozialabgaben.ZEIT: Läuft das schon?Frattini: Noch nicht. Die Vorlage muss noch durchs Parlament.ZEIT: Wir halten die Italiener für so cool, weil sie immer einen Weg finden, was sie arrangiarsi, Durchwursteln, nennen.Frattini: (lacht) Ich nenne es Schwarzmarkt. Die Flexibilität herrscht nicht im legalen, sondern im schwarzen Markt. Eine traurige Realität. Aber: Von unseren elf Prozent Arbeitslosen findet min-destens die Hälfte einen Platz in der Schatten-wirtschaft. Und deshalb sieht man so wenig Ar-mut. Ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts wird schwarz erwirtschaftet. Dieser Sumpf muss ausgetrocknet werden. Die Leute zahlen keine Steuern.ZEIT: Nur zeigt das traurige Schicksal der Re-gierung Monti und jetzt Letta, dass Italien echte Reformen nicht kann.Frattini: Ja, mal hat die linke, mal die rechte Mitte blockiert. Und immer setzt sich das Partei-interesse gegen das nationale Interesse durch. Erst wenn der Albtraum da ist, reagieren die Italiener. Leider hat die Mehrheit es noch nicht verstanden, dass wir uns nicht der EU oder Mer-kel zuliebe ändern müssen, sondern zum eigenen Wohle. La casta, die politische Klasse, will ihre
Privilegien bewahren. Doch all die Skandale haben deren Glaubwürdigkeit ruiniert.ZEIT: Zur Außenpolitik. Warum wollen Sie Nato-Generalsekretär werden – zu einer Zeit, da das Bündnis nur noch à la carte funktioniert und insgesamt abrüstet? Das kann doch keinen Spaß machen.Frattini: Gerade das reizt mich – weil die An-strengungen nachlassen. In der Knappheit müs-sen wir die Mitglieder besser verzahnen, Dopp-lung vermeiden, Ressourcen integrieren ...ZEIT: ... darüber reden wir seit 60 Jahren.Frattini: Richtig, aber wir brauchen das Bündnis heute mehr denn je. Denken sie an weltweiten Terror, die Implosion afrikanischer Staaten von Libyen südwärts. Die Allianz muss sich globali-sieren, weil die Bedrohung sich globalisiert hat. Wir haben eine goldene Gelegenheit, wenn 2014 alle Truppen aus Afghanistan zurückkehren. Dann können wir die Nato neu aufstellen.ZEIT: Wozu?Frattini: Wir könnten fragile Staaten stabilisie-ren, Institutionen aufbauen helfen, Truppen aus-bilden. Wir müssen vor allem global denken –Australien, Südkorea einbeziehen.ZEIT: Das Kernproblem der Nato ist der Verlust des Feindes.Frattini: Ich sehe sehr wohl strategische Bedro-hungen. Nordafrika ist auf der anderen Seite des Mittelmeers. In Libyen haben wir den Krieg, nicht den Frieden gewonnen. Denken Sie auch an Cyberkrieg, auf den wir überhaupt nicht vor-bereitet sind.ZEIT: Aber Europa will doch nicht jenseits seiner Grenzen eingreifen. Es fehlen schon mal die schnell beweglichen Truppen …Frattini: ... schlimmer. Wir haben nicht einmal die politische Kraft, um Prioritäten zu setzen – wo verringern wir, welche neuen Systeme kaufen wir? In Afghanistan hatten wir viele nutzlose Kampf-jets, aber nicht genug Hubschrauber. Wir haben riesige Bodentruppen, aber keine Beweglichkeit.ZEIT: Das wissen wir seit 20 Jahren. Aber wenn der Wille fehlt, fehlen auch die Mittel.Frattini: Wir sollten anfangen mit einem ge-meinsamen Rüstungsmarkt.ZEIT: Richtig, aber für jedes Land ist die Waffen-produktion nationale Industriepolitik.Frattini: Jetzt ist die Gelegenheit da. Deshalb hat die Nato auch eine Zukunft.ZEIT: Wer bewirbt sich noch um das Amt des Nato-Generalsekretärs?Frattini: Niemand bis jetzt.ZEIT: Weil niemand den Job will?Frattini: (lacht)
Die Fragen stellte JOSEF JOFFE
Mail aus: Rio de JaneiroVon: [email protected]: Seniorenschlange
Mail aus: BrüsselVon: [email protected]: Verantwortungslose Eltern?
Wer schon einmal in Brasilien am Postschalter, an einer Supermarktkasse oder an der Rezeption beim Arzt gestanden hat, der weiß: Mit der Dienstleistungsgesellschaft ist es hier nicht weit her. Die Schlangen sind unendlich lang, sie be-wegen sich kaum, und während man in ihnen steht, entwickelt man allerlei Theorien darüber, wie diese endlos langen Schlangen wohl entstan-den sind und warum sie nicht kürzer werden. Bezahlen die ihren Leuten nicht genug? Spinnen die Computer?
Die wenigsten stoßen bei ihren Erklärungs-versuchen auf ein Bundesgesetz mit der Num-mer 10048 vom 8. November 2000, das man aber in Wahrheit ganz wesentlich für das lange Stehen in Schlangen verantwortlich machen muss. Dieses Gesetz räumt Senioren das un-bedingte Recht ein, sich an die Spitze einer jeden Warteschlange zu stellen. Eine sehr menschliche
Regelung, mit unterschiedlichen Effekten. Ers-tens werden seither weniger Senioren in brüten-der Hitze nach stundenlangem Warten ohn-mächtig. Zweitens entdecken viele Brasilianer ab ihrem 60. Lebensjahr eine erfüllende Betätigung darin, dass sie zur Zeit des größten Ansturms und der größten personellen Engpässe in die Be-hörden, Ärztevorzimmer und Telefonläden stür-men, um ihren Sonderstatus entsprechend dem Gesetz 10048 geltend zu machen. Und drittens steht die werktätige Bevölkerung weiter in der Schlange, schäumt bisweilen vor Wut und kommt erst mit reichlicher Verspätung dazu, ihr Einkommen und damit auch die Rente der älte-ren Generation heranzuschaffen.
Und doch: Ein kritisches Wort gegenüber den vorbeiziehenden Alten, ein ruppiges Anraunzen gar nach deutscher Art, das hört man in einer brasilianischen Warteschlange nie.
Brüssel ist laut einer OECD-Untersuchung die am meisten verstopfte Metropolregion der Welt. Nun lässt sich über die Bezeichnung Brüssels als Metropole sicher streiten, zumindest in dieser Statistik aber liegt die belgische Hauptstadt weit vor Los Angeles, London oder Paris. Wer in Brüs-sel zur Hauptverkehrszeit von A nach B will, muss für die Strecke durchschnittlich ein Drittel mehr Zeit einplanen als außerhalb der Stoßzeiten.
»Wie könnt ihr eure Kinder bloß mit dem Fahrrad zur Schule fahren lassen?«, entsetzte sich neulich eine Kollegin meiner Frau. Sie selbst kut-schiert den Nachwuchs mit dem Auto bis zum Schultor, um ihn vor anderen Autos zu schützen. So machen es die meisten belgischen Eltern, was wiederum dazu führt, dass das Verkehrsaufkom-men weiter steigt. Fahrradfahren ist in Belgien zwar Nationalsport, aber wer in Brüssel auf zwei
Rädern unterwegs ist, gilt noch immer als Exot. Kürzlich war es besonders schlimm. Die endlos langen Schulferien waren zu Ende, und Eltern, Berufstätige und Pendler mussten sich nun erst wieder an den Verkehr gewöhnen. Und dann fielen eines Morgens auch noch wesentliche Bus- und Straßenbahnlinien aus. Eine Panne, ein Streik – wer wüsste das hier schon so genau zu unterscheiden. Die Folge: Von den Bürgersteigen quollen Menschen traubenweise auf die Straßen, ein langer Treck unfreiwilliger Fußgänger zog auf den wenigen ausgewiesenen Radwegen stadt-einwärts. Wer mit dem Auto unterwegs war, kam nicht einmal in Schrittgeschwindigkeit voran.
Nur unsere Kinder kamen mit ihren Fahr-rädern auch an diesem Morgen pünktlich in die Schule. Wir fragen uns dafür: Sind wir ver-antwortungslose Eltern?
DIE ZEIT: Die Deutschen lieben Italien ...Franco Frattini: Ich weiß ...ZEIT: ... aber die Italiener mögen Deutsch-
land nicht.Frattini: Das trifft auf die Leute zu, die von populisti-schen Kräften beeinflusst werden. Die glauben, dass Europa eine deutsch-französische Verschwörung ge-gen Italien sei.ZEIT: Wer sind diese Leute?Frattini: Die 25 Prozent, die für Beppo Grillo gestimmt haben. Für die gilt: Deutschland denkt nur an sich, zeigt keine Solidarität und will den schwächeren Staa-ten aufzwingen, was Deutschland noch stärker macht. ZEIT: Das Problem ist doch nicht, dass Deutschland so stark ist, sondern dass Italien so schwach und dys-funktional ist.Frattini: Ich stimme zu. Die Deutschland-Kritiker wol-len keine Reformen für Italien. Die Populisten, auch die weiter rechts, wähnen, es werde Italien nach der Rück-kehr zur Lira besser gehen. Die extreme Linke glaubt, dass Europa nichts für die Ärmeren tue. Es bleibt eine Minderheit, aber eine bedeutsame.ZEIT: Manche Politiker behaupten, Italien sei so arm, weil Deutschland so reich sei.Frattini: Wir wären noch ärmer, wenn uns die starke Wirtschaftspartnerschaft mit Deutschland gefehlt hätte. Diese Leute kennen Deutschland nicht, wissen auch nichts über den Rest der Welt. Sie reisen nicht und kennen keine Fremdsprachen. Eine Tragödie.ZEIT: Gibt es in Italien einen Reformdiskurs?Frattini: (seufzt) Sagen wir’s so: Wir haben eine echte Möglichkeit, uns zu verändern. Unter der Regierung Monti haben die Italiener große Opfer gebracht. Und trotzdem keinen Generalstreik, an keinem einzigen Tag. Das Land hat so den Insolvenzstatus vermieden.ZEIT: Merkels Austerity-Peitsche ist nicht das wirk-liche Problem. Das Problem ist ein »Gesellschafts-vertrag«, ein Arbeitsmarkt, der Insider schützt und Outsider fernhält; deshalb die gewaltige Jugend-arbeitslosigkeit.Frattini: Absolut richtig. Ich habe immer bestritten, dass Deutschland schuld sei an der Krise Italiens. Aber so ist es in der Politik. Wenn es uns gut geht, reklamiert die Regierung den Erfolg für sich. Wenn nicht, ist Europa schuld.ZEIT: Solche Schuldzuweisungen lenken ab von den notwendigen Hausaufgaben. Was muss, kann Italien tun?Frattini: Wir haben es immerhin, anders als Frank-reich, geschafft, das Rentenalter anzuheben – teilweise auf 67 Jahre. Und der Generalstreik blieb aus. Die Leute haben verstanden, dass Italien wegen seiner üblen Demografie länger arbeiten muss. Wir sind auch bei der Defizitverringerung besser als Frankreich. Aber wir müssen mehr für den Arbeitsmarkt tun, die Bürokratie zurückschneiden. Beamte folgen dem na-türlichen Drang, ihre Macht gegenüber der Gesell-
»Wir wären noch ärmer!«Ein Gespräch mit dem Italiener Franco Frattini über Italiens Krise, Deutschlands Kraft – und seine Bewerbung als Nato-Generalsekretär
Am 14. März 1957 wird Franco Frattini in Rom geboren. Er studiert Jura, legt 1979 das Examen ab. 1986 wird er in den Staatsrat berufen (am ehesten mit dem Bundesver-waltungsgericht zu vergleichen). Kurz darauf kandidiert er bei den Kammerwahlen für die Sozialdemokraten, scheitert aber. 1994 macht ihn Silvio Berlusconi zum Generalsekretär des Regierungspalastes. Zwei Jahre später zieht Frattini zum ersten Mal in die Abgeordnetenkammer ein. 2001 macht Berlusconi Frattini zum Minister für öffentliche Dienste, nur ein Jahr später
wird er der jüngste Außenminister in der Geschichte Italiens.2004 wechselt Frattini als Nachfolger Mario Montis in die EU-Kommission, wird deren Vizepräsident und leitet außerdem das Ressort für Justiz- und Einwanderungsfragen. 2008 wird Frattini wieder Außenminister, schei-det aber 2011 aus dem Amt. Er verlässt Berlusco-nis Partei Volk der Freiheit. Derzeit ist Franco Frattini der einzige Kandidat für den Posten des Nato-Generalsekretärs und hat gute Chancen, als erster Italiener seit Manlio Brosio (1964 – 1971) an die Spitze des Bündnisses zu gelangen.
Frattinis politische Karriere
Er war einst Berlusconis
Minister: Franco Frattini
6 POLITIKFo
to:
Wik
tor
Dab
kow
ski/
acti
on
pre
ss

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
W enn Italien bankrottgeht, gibt es kei-nen Euro-Rettungsschirm, unter dem es Platz finden könnte. Die Schulden Italiens sind zu groß, als dass jemand
glaubwürdig dafür bürgen könnte – nicht einmal Deutschland könnte das. Wenn also in Rom, wie es in diesen Tagen wieder einmal der Fall ist, eine Re-gierung zusammenkracht und von Neuwahlen die Rede ist, löst das ein europaweites Beben aus. Ita-liens Krise ist gefährlich. Das ist offensichtlich. (siehe Interview Seite 6)
Wer aber macht die Krise so gefährlich? Wer sind die Akteure, die bella Italia an den Rand des Abgrunds bringen?
Die Antwort fällt auf den ersten Blick leicht: Silvio Berlusconi. Es ist der 77-Jährige, der die ak-tuelle Regierungskrise auslöste. Er zwang seine Partei dazu, ihre Minister aus der Regierung zurückzuzie-hen. Der Medienmogul dominiert seit über zwanzig Jahren die italienische Politik. Er ist es, der Italien ruiniert. Alles richtig, doch als Erklärung nicht aus-reichend. Wenn ein einzelner Mann eine ganze Na-tion in Geiselhaft nehmen kann, dann muss man bei der Ursachenforschung über diesen Mann hinaus gehen; dann muss man über mögliche Baufehler in der Konstruktion dieser Nation nachdenken.
Ein Blick in die Geschichte reicht, um einen solchen Fehler zu finden: Die Einigung Italiens vor über 150 Jahren wurde unzureichend vollzogen, und sie ist bis heute nicht vollendet. Der sichtbarste Ausdruck davon ist der tiefe Graben zwischen Nord und Süd, doch es gibt noch andere Abgründe, die das Land teilen; zum Beispiel jener zwischen Laizis-ten und Katholiken oder der zwischen links und rechts. Berlusconi etwa warnt bis heute vor der kommunistischen Gefahr, obwohl der Kommunis-mus schon seit Jahrzehnten tot ist. Es ist eine Phan-tomdebatte, die ihm aber sehr viele Stimmen ein-bringt. Das ist nur möglich, weil der Rechts–links–Konflikt als tödlich empfunden wird. Der Kalte Krieg wird in Italien immer noch ausgefochten. Das Land ist eine unversöhnte Nation.
Wie sind Italiens Politiker nun mit einem von derart tiefen Rissen durchzogenen Land um-gegangen?
Auch wenn es Unterschiede gab, im Kern haben alle Regierungen der italienischen Nachkriegszeit auf dieselbe Weise geantwortet: Sie versuchten, die Spannungen abzumildern, indem sie alle Lager mit großzügigen Zuwendungen ruhigstellten. Die Kir-che, die Kommunisten, den Süden, den Norden – der Staat hatte für jeden etwas. Die Gelder wurden
in erster Linie nach klientelistischen Kriterien ver-teilt, und der Schuldenberg wuchs an. Das nährte den Glauben, man könne auch ohne größere Refor-men vorankommen.
Doch das ist nur eine Seite des Problems. Die andere ist, dass die politische Elite Italiens zu einer reinen Geldverteilungsmaschine mutierte; sie ent-wickelte nichts, sie gestaltete nichts, sie führte nicht. Ihre einzige, die immer gleiche Idee: Wir erkaufen uns den gesellschaftlichen Frieden.
Das ging solange gut, bis der Euro Italiens Mo-dell zum Vergleich mit anderen Modellen zwang. Erst diese neuen Wettbewerbsbedingungen förder-ten die Untauglichkeit des italienischen Modells zu-tage. Und jetzt, da es eine politische Elite brauchte, die eine klare Vorstellung davon hat, wie man das Land aus der Krise führen kann, stellt man fest, dass diese Elite tief zerstritten ist. Sie ist gelähmt. Sie hat nie gelernt, inhaltliche Kompromisse zu schließen. Sie hat immer nur bequeme Abmachungen darüber getroffen, wer wie viel Geld bekommen soll. Diese Politiker sind nicht Politiker, sondern Krämernatu-ren, die nicht in der Lage sind, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen.
Was also macht Italien so gefährlich? Italien selbst, so wie es heute ist. ULRICH LADURNER
D ie kurze Antwort lautet: ja. Anders lässt sich das Kommuniqué Nr. 1, ein Doku-ment, welches Repräsentanten von 13 Rebellengruppen am 24. September in
Aleppo unterzeichnet haben, kaum deuten. Darin heißt es, alle militärischen und zivilen Gruppen seien eingeladen, sich innerhalb eines »klar islami-schen Rahmens« zu vereinigen. Sie sollten das isla-mische Recht als »einzige Quelle der Gesetzgebung« in Syrien durchsetzen.
Zu den Unterzeichnern zählen einige der ein-flussreichsten Rebellengruppen. Gleiche drei wich-tige Brigaden der Freien Syrischen Armee (FSA) haben unterschrieben. Die neue Allianz ist mäch-tig, sie könnte nach Schätzungen über ein Drittel der insgesamt rund 100 000 bewaffneten Rebellen repräsentieren.
Islamistische Neigungen in FSA-Brigaden sind schon länger bekannt. Das Kommuniqué Nr. 1geht darüber hinaus. Denn zu den Unterzeich-nern zählen auch die »Unterstützungsfront«, Dschabhat al-Nusra, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida alliiert ist, sowie die radikalen Salafisten der »Bewegung der Befreier Syriens«, Ahrar al-Schaam.
Das Abkommen bedeutet eine tektonische Ver-schiebung innerhalb des syrischen Widerstands. Bis-lang war die FSA der de facto bewaffnete Arm der syrischen Nationalkoalition, die auch vom Westen anerkannt wird. Nun ist sie gespalten. Hält die neue Allianz zwischen den Rebellengruppen, wird die Exilopposition massiv an Bedeutung verlieren. Ent-sprechend alarmiert reagierte die Nationalkoalition: Man könne über vieles reden, aber die Einbeziehung der Unterstützungsfront sei ein Fehler: »Es gibt kein Projekt, das uns mit Al-Kaida verbindet.«
Warum verbünden sich große Teile der FSA trotz-dem mit den Dschihadisten? Nur wer auf dem Schlachtfeld sein Leben riskiere, heißt es im Kom-muniqué Nr. 1, habe ein Recht, für die Syrer zu spre-chen. Die Opposition im Ausland, die geplante Über-gangsregierung und die Nationalkoalition würden von den 13 Gruppen daher »nicht anerkannt«.
Mittlerweile spricht die »Front« nur noch von einer gemeinsamen Erklärung, es gebe keine Alli-anz. Aber das ändert wenig. Denn das eigentliche Problem ist die Entfremdung zwischen Kämpfern innerhalb und Politikern außerhalb Syriens. Diese Spaltung spiegelt sich im Kommuniqué Nr. 1. Sie nährt sich aus dem Gefühl, dass die Exilpolitiker
weit weg und machtlos sind. Die FSA-Komman-deure hatten sich bereits darauf eingestellt, dass die USA das syrische Regime wegen seines Giftgasein-satzes angreifen würden. Nun fühlen sie sich betro-gen. Den Plan, das Assad-Regime solle seine Che-miewaffen freiwillig aufgeben, halten sie für eine Falle, die Russland dem Westen gestellt hat. Der Exilopposition werfen sie vor, dass sie den Deal nicht verhindern konnte.
Diese Entfremdung geht augenscheinlich mit einer islamistischen Radikalisierung von Teilen der FSA einher. Die gemeinsamen Kämpfe auf dem Schlacht-feld, nicht zuletzt mit der erfolgreichen »Front«, haben Vertrauen und Bande geschaffen. Und die sind den Unterzeichnern anscheinend wichtiger als die Ver-bindung zur Exilführung. Zudem dürften taktische Motive einfließen: Weder FSA noch Islamisten können das Regime alleine stürzen.
In den kommenden Wochen wird es mehr Klar-heit geben: Weitere Gruppen werden sich positio-nieren, neue Erklärungen sind bereits angekündigt. Wenn der Westen weiterhin mit der Freien Syri-schen Armee kooperieren wird, muss er sehr genau prüfen, ob er nicht indirekt Al-Kaida-nahe Dschi-hadisten unterstützt. YASSIN MUSHARBASH
Wird der syrische Widerstand immer islamistischer?
Analysen POLITIK 7
Warum steht Italien am Rand des Abgrunds?
Fotos: Paul Seheult/Westend61 [M];
Bulent Kilic/AFP/Getty Images (u., Ausschnitt)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Der große Unfug
berührt werden.« Die emotionale Reaktion man-cher Eltern, Polizeibeamten und anderer Erwachse-ner auf derlei Vorkommnisse könne »eine ernstere Verstörung des Kindes zur Folge (haben) als die se-xuellen Kontakte selber«.
Und unter dem Titel Wenn Lolita Rache nimmt ... Liebe mit Abhängigen – mit wem denn sonst? schreibt Leonhardt im letzten Teil seiner Serie: »Mädchen, auch Jungen, sollen gegen jede Art von Vergewalti-gung geschützt werden.« Aber dass es »unerheblich« sein solle, »ob die geschützte Person selbst die Tat
veranlasst oder in sie einwilligt« – diesen Umstand findet Leonhardt »grotesk« und »weltfremd«. Das klingt, als würde er in manchen Fällen den Mäd-chen und Jungen die Verantwortung zuschieben. Stets zeigt er Verständnis für die Männer – nie nimmt er die Perspektive der Minderjährigen ein.
Alles in allem hält Leonhardt zwar kein Plädoyer für den sexuellen Umgang Erwachsener mit Kin-dern, aber seine Texte durchzieht eine aus heutiger Sicht mindestens befremdliche Relativierung der geltenden Normen. Die Verweise auf Adorno und Kinsey deuten darauf hin, dass Leonhardt sich
1969 offenbar im Mainstream eines bestimmten li-beralen Milieus bewegte. Den abgedruckten Leser-briefen nach zu urteilen lösten Leonhardts »Un-zuchts«-Texte beim Publikum der ZEIT jedenfalls keine Empörung aus.
Einige Monate später wiederholte Leonhardt seine These am Beispiel des Dichters Novalis und seiner 13-jährigen Geliebten Sophie von Kühn: »Kann ein Verbrechen sein, was auch Novalis tat, dessen Liebe zu Sophie in unserer Literaturgeschich-te doch als die ›reinste‹ und ›keuscheste‹ verzeichnet
steht?« In der Redaktion gab es auch diesmal keine kritischen Diskussionen über Leonhardts Thesen, wie sich der ehemali-ge Chefredakteur Theo Som-mer erinnert, damals seit ei-nem Jahr bei der ZEIT (siehe Artikel unten).
Als Leonhardt im Frühjahr 2003 starb, hieß es in der Pressemitteilung der Zeitung: »In seiner Arbeit und in seinen großen Artikeln hat Rudolf Walter Leonhardt wesentlich zur Liberalisierung des gesell-schaftlichen Klimas in der Bundesrepublik der 60er Jahre beigetragen. Immer wieder plädierte er für eine moderne, tolerante Gesetzgebung gerade auch gegenüber Minderheiten.« Es sind Sätze, die an-gesichts der vorliegenden Texte wie Hohn klingen.
Auch noch einige Jahre später druckte die ZEITeinen Artikel ab, der problematisch erscheint. Am 3. September 1976 schrieb der Hamburger Pädago-
ge Karlheinz Lutzmann über eine Broschüre, die Kinder seiner Meinung nach auf hysterische Art vor Sexualstraftätern warnt. Am Ende heißt es:
»Die unausgesprochene Behauptung der Bro-schüre, dass jeder sexuelle Kontakt zwischen Er-wachsenen und Kindern schädlich sei, ist für viele Eltern eine schreckliche Vorstellung. Gleichwohl ist sie wissenschaftlich für die nichtaggressiven Se-xualdelikte unhaltbar. ›Ein gesundes Kind in einer intakten Umgebung‹, so der Hamburger Psychia-ter und Sexualforscher Eberhard Schorch, ›ver-arbeitet nicht-gewalttätige sexuelle Erlebnisse mit Erwachsenen ohne Folgen.‹ Abgesehen von den aggressiven Sexualdelikten, die von niemandem beschönigt werden, ist erst die oft bigotte und hys-terische Reaktion der Umwelt für die betroffenen Kinder schädlich. Verhöre bei der Polizei und Aus-sagen vor Gericht belasten die Kinder häufig mehr als die Tat selbst.« Unklar bleibt auch hier, was ge-nau mit den – aus Sicht des Autors anscheinend legitimen – »nichtaggressiven Sexualdelikten« ge-meint sein soll.
Die Abgrenzung zu anderen Akteuren der Re-formpädagogik erfolgte seitens der ZEIT ebenfalls zu spät. Der Sozialpädagoge Helmut Kentler etwa, der in seinen Schriften empfahl, straffällige Jugend-liche »bei pädagogisch interessierten Päderasten unterzubringen«, schrieb noch im Oktober 1986 in zwei Ausgaben des ZEITmagazins die Begleit-texte für Fotostrecken zum Thema Schwanger-schaft und Geburt.
Oben: ZEIT-Artikel aus Leonhardts Serie über Kinder und Sexualität
In der Ära der sexuellen Revolution verharmlosten
einzelne ZEIT-Autoren die Pädophilie. Sie glaubten,
Tabus brechen zu müssen VON MERLIND THEILE
Stets zeigt er Verständnis für die Männer – nie nimmt er die Perspektive der Minderjährigen ein
Irrungen und Wirrungen der ZeitDer ehemalige Chefredakteur THEO SOMMER über den Autor Rudolf Walter Leonhardt und dessen umstrittene Thesen
Als der damalige Feuilleton-Chef Rudolf Walter Leon-hardt im April 1969 in drei Folgen Auszüge aus seinem Buch Wer wirft den ersten Stein? Minoritäten in einer züchtigen Gesellschaft ver-
öffentlichte, war ich stellvertretender Chefredak-teur. Ich kann mich jedoch nicht entsinnen, dass es in der ZEIT-Redaktion eine Diskussion über die heutzutage als Libertinage-lastigen, ja als empörend empfundenen Kapitel seines Buches gegeben hätte. Streit gab es damals – und später immer wieder – vor allem über das KapitelHaschisch, Himmel und Hölle. Daran hatten die seriöseren Ge-müter im Hause schwer zu schlucken; die Chefredakteurin Marion Dönhoff litt darunter nach eigenem Bekunden jahre-lang »wie ein Hund«.
Warum uns die abgedruck-ten Folgen über die Sexualität im Lande nicht weiter aufgeregt haben? Ich weiß es nicht mehr. Zwei Gründe kann ich mir im Nachhinein jedoch vorstellen.
Zum Ersten kannten wir un-seren »Leo«. Er riskierte gern Widerspruch und Empörung und genoss es, Außenseiter zu sein und zuweilen auch Einzel-gänger. So war der Porsche-Fahrer und Whisky-kenner ebenso gegen Geschwindigkeitsbegren-zungen wie gegen die radikale Verfolgung von Alkoholsündern am Steuer. Die Anschnallpflicht lehnte er als Beschränkung unserer Freiheit ab. Die Frage, ob Volksschullehrer studiert haben sollten, war ihm allemal eine Kontroverse wert. Anfangs trat er aus Daffke sogar für den Kauf-hausbrandstifter Baader ein. So war er: Mit Verve stürzte er sich in jedes Schlachtengetümmel der Meinungen und vertrat gern auch einmal unhalt-bare Ansichten.
Zum Zweiten galten damals auf dem Felde der sexuellen Beziehungen noch vielerlei repressi-
ve Verbotsparagrafen, für deren Aufhebung wir eintraten und die inzwischen ja auch längst auf-gehoben worden sind – Paragrafen, die noch vor einer Generation Homosexualität, Ehebruch, Kuppelei und Abtreibung unter Strafe stellten. Womöglich waren wir blind, aber keiner von uns las Leos Text als Aufruf zur Freigabe der Pädo-philie. Eher hörten wir einen klagenden Unter-ton heraus, dass verführerische Lolitas arglose Männer ins Unglück stürzten. So beteuerte der Autor ausdrücklich: »Kinder müssen geschützt werden – aber Erwachsene auch.«
Feinfühlig, wie wir spätestens seit den Miss-brauchsskandalen in der Odenwaldschule und
der katholischen Kirche, seit den Enthüllungen auch über Trittins oder Cohn-Bendits frühere Einstellungen gewor-den sind, kommen uns heute viele Formulierungen Leon-hardts, kommt uns überhaupt seine ganze Grundhaltung un-moralisch vor und verwerflich.
Wäre ich damals Chefredak-teur gewesen und hätte ich sei-nen Text gelesen, ehe er in Satz ging (was die damals letzt-verantwortliche Gräfin Dön-hoff schwerlich getan hat) –
ich möchte hoffen, dass ich Leo den Abdruck mit dem Argument ausgeredet und notfalls un-tersagt hätte, ich dürfe nicht riskieren, dass seine maßlos überzogene Ansicht als Meinung der ZEIT missverstanden würde.
Was uns damals in die Irre führte, war die Idiosynkrasie eines einzelnen, allerdings leiten-den und daher prominenten Redakteurs. Sein Buch schrieb er 1968; die Jahreszahl besagt vie-les. Dass in einem Seismografen wie der ZEITauch die Irrungen und Wirrungen einer sich wandelnden Gesellschaft ihre Spuren hinterlas-sen, ist wohl unvermeidlich. Da hätten wir schär-fer hinschauen müssen. Da haben wir 1969 nicht aufgepasst. Doch niemals ist die ZEIT als Blatt für Pädophilie eingetreten.
Leonhardt leitete von 1957 bis 1973 das Feuilleton
Was wurde verschwiegen, geduldet, hingenom-men, übersehen? In der Debatte um den öf-fentlichen Umgang mit Pädophilie und Päde-rastie, dem sexuellen
Interesse Erwachsener an Kindern beziehungs-weise (prä)pubertären Jugendlichen, muss auch die ZEIT ihre Veröffentlichungen früherer Jahr-zehnte kritisch beleuchten. Seit Ende der sech-ziger Jahre publizierte sie mehrere Artikel, in denen die Autoren die Strafbarkeit sexueller Handlungen mit Kindern und Jugendlichen in-frage stellten. Nach allem, was im Archiv bislang auffindbar ist, wird klar, dass sich die Redaktionin der Ära der sexuellen Befreiung nicht rigoros genug dagegen wehrte, wenn einzelne Autoren dieses Tabu brachen.
Rudolf Walter Leonhardt, von 1957 bis 1973 Feuilletonchef, danach bis 1986 stellvertretender Chefredakteur, veröffentlichte im April und Mai 1969 unter dem Titel Unfug mit Unschuld und Unzucht eine dreiteilige Serie. Leonhardt kriti-siert darin die Tabuisierung der Pädophilie bezie-hungsweise Päderastie. Er bezieht sich auf das »kuriose« Sexualstrafrecht in den USA und fragt: »Woher kommt sie, diese oft romantische, oft sentimentale Verklärung kindlicher Unschuld im Allgemeinen und erotischer Unschuld im Be-sonderen, die es mit sich bringt, dass Verführung
von Kindern mit Strafen bedroht wird, wie sie sonst nur gegen Mörder verhängt werden?«
Leonhardt relativiert den sexuellen Umgang mit Minderjährigen insofern, als er zahlreiche Beispiele aus Geschichte und Literatur anführt, in denen Mädchen mit Männern verkehrten, »von Helena bis Lolita«. »Kurz: alle großen Lie-benden der Weltliteratur kämen heute (...) in Fürsorgeerziehung.« In der Gegenwart konsta-tiert er »sonderbar verquollene Vorstellungen von der ›Unschuld des Kindes‹« und zieht als Kronzeugen unter anderem den Philosophen Theodor W. Adorno heran, den er mit den Sät-zen zitiert: »Das stärkste Tabu von allen ist im Augenblick jenes, dessen Stichwort ›minderjäh-rig‹ lautet und das schon sich austobte, als Freud die infantile Sexualität entdeckte. (...) Alt-bekannt, dass Tabus umso stärker werden, je mehr der ihnen Hörige selber begehrt, worauf die Strafe gesetzt ist.« Leonhardt selbst schreibt: »Dabei ist der Nachweis nicht erbracht, dass Kin-derseelen unheilbaren Schaden nähmen vom Schock der ersten Begegnung mit einer Mani-festation des Sexuellen, also etwa dem vielzitier-ten guten Onkel, der mit Schokolade lockt und dann: ja, was eigentlich macht?«
Auch der damals populäre Sexualforscher Al-fred Charles Kinsey kommt in Leonhardts Arti-kel zu Wort: »Es ist schwer einzusehen, warum ein Kind, wenn es anders erzogen worden wäre, verstört werden sollte, wenn seine Genitalien
POLITIK 9A
bb
: A
rch
iv D
Z (
o.)
; k
l. F
oto
: B
rigi
tte
Fri
ed
rich
/SZ
Ph
oto

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Nobel-Notar Der Sekretär des Nobel-Komitees, Geir Lundestad,sortiert die Nominierungen. 259 sind dieses Jahreingegangen. Namen nenntLundestad aber nicht.
Mehr als Gold
Und diesmal ..?Wer könnte der Preisträger sein, der am 10. Oktober bekannt gegeben wird?Auguren nennen die pakis-tanische Kinderrechtlerin Malala Yusufsai. Auch im Gerüchterennen ist die rus-sische Memorial-Gruppe. Und der Sänger Bono.
Nobelpreis-Jury eher bestimmte Weltanschauungen adeln? Diese Wahlen hätten der Glaubwürdigkeit des Preises Schaden zugefügt, sagt Kristian Berg Harpvi-ken, der Direktor des angesehenen Osloer Peace Re-search Institute. Harpviken und andere zählen zu einer wachsenden Zahl von Kritikern in Norwegen, die Zweifel daran äußern, ob das Nobelkomitee in seiner bisherigen Form neutral und kompetent genug ist, um seiner immensen Verantwortung gerecht zu bleiben.
Geir Lundestad, der Nobelnotar, bleibt die Gelas-senheit selbst, während er sich diese Anwürfe anhört. Obama sei »eine Inkarnation all der Werte«, die der Dynamit-Erfinder und Humanist Alfred Nobel habe fördern wollen: Dialog und Verhandlungen, die zu Abrüstung führen. Und die EU, herrje – es sei doch »so offensichtlich« gewesen, dass sie den Preis habe bekommen müssen. Dreimal sagt Lundestad dieses »so offensichtlich«, mit fast verzweifeltem Gesichts-ausdruck. Er habe, sagt er, die EU schon lange auf seiner Liste der Kandidaten gehabt. »Sie hatte immer nur zu viele Gegner im Komitee.«
2012 war das plötzlich anders. Es bot sich die Ge-legenheit, auf die Lundestad und der Vorsitzende des Nobelkomitees, Thorbjørn Jagland, seit Jahren ge-wartet hatten. Die letzte Gegnerin der EU innerhalb der Jury erlitt einen Schlaganfall.
Lundestad öffnet die schwere Flügeltür, auf die er von seinem Schreibtisch aus schaut. Dahinter liegt der
kleine Saal, in dem das Komitee tagt – es ist ein Raum demonstrativer Würde. Jugendstil-Tapeten mit Fleur-de-Lys-Mustern, ein schwerer, ovaler Tisch aus Eschenholz, um ihn herum sechs Stühle. An den Wänden hängen in kleinen Rahmen Schwarz-Weiß-Porträts sämtlicher Preisträger. Gemäß dem letzten Willen Nobels aus dem Jahr 1895 wird der Preis verliehen »von einem Komitee aus fünf Mitgliedern, die vom norwegischen Storting (dem Parla-ment, d. Red.) ausgewählt werden«. Ent-sprechend den bisherigen Mehrheitsverhält-nissen haben die Sozialdemokraten zwei Vertreter entsandt und die Konservativen, die
rechtsliberale Fortschrittspartei sowie die So-zialisten je einen. Es sind keine aktiven, sondern
ehemalige Politiker, denen nach parteiinternen Absprachen diese Ehre zuteil wird.
Das Schwergewicht unter ihnen ist zugleich der Vorsitzende des Komitees, Thorbjørn Jagland.
Der Sozialdemokrat war zwischen 1996 und 1997 Premierminister, später Außenminister Norwegens und ist derzeit Generalsekretär des Europarats, einer, wenn man so will, ständigen Friedenskonferenz von 47 Ländern. 1990 veröffentlichte Jagland ein Buch mit dem Titel »Mein europäischer Traum«. Andere Mitglieder des Komitees bringen weniger internatio-nale Beflissenheit mit. Die Vertreterin der Fort-schrittspartei etwa leitet nebenbei deren Seniorenor-ganisation. Und die Abgesandte der Sozialisten, Ågot Valle, arbeitete als Physiotherapeutin und engagierte sich in der Kampagne Nei til EU (Nein zur EU). Bis zu diesem Schlaganfall.
»In der Tat, das war der Grund, warum die EU den Nobelpreis bekommen hat.« Der sozialdemokratische Storting-Abgeordnete Svein Roald Hansen kann sich trotz der Tragik des Falles ein Lachen nicht verkneifen. Nachdem Ågot Valle erkrankt sei, berichtet er, habe der ehemalige Bischof von Oslo auf der Nachrücker-liste der christlichen Zentrumspartei für die Jury ge-standen – und entgegen der ablehnenden Haltung der Partei habe er der EU als Preisempfängerin zu-gestimmt. Die Sitzungen des Komitees sind geheim, aber auch andere Politiker in Oslo bestätigen diese Schilderung. Nobelsekretär Lundestad, der jeder Sit-zung beiwohnt, sagt, er werde ihr nicht widersprechen.
Darf der Preis, der wie kein anderer für moralische Integrität stehen soll, wirklich so vergeben werden: von einer Jury, deren Verdienste im Zweifel darin be-
stehen, dass ihre Mitglieder einer norwegischen Partei treu gedient haben – von der Generation Oslo 60 plus also? Es werde Zeit, sagt der Wissenschaftler Harpvi-ken, dass ein Welterbe wie der Friedensnobelpreis endlich auch von einer Weltjury betreut werde statt von Leuten mit, wie Harpviken es ausdrückt, »nicht unbedingt der größten außenpolitischen Expertise«. Wie, schlägt er vor, wäre es mit Persönlichkeiten, die über religiöse, politische und geografische Grenzen hinweg anerkannt seien? Mit ehemaligen Preisträgern wie Kofi Annan oder Shirin Ebadi zum Beispiel? Mit dem indischen Wirtschaftswissenschaftler Amarty Sen oder Brasiliens Expräsidenten Lula da Silva? »Das Pro-blem wäre gewiss nicht, geeinigte Jury-Kandidaten zu finden. Schließlich hat Alfred Nobel nirgendwo fest-gelegt, dass die Komitee-Mitglieder Norweger sein müssen.« Ähnliche Plädoyers für eine Verbreiterung der Weltsicht halten norwegische Parlamentarier.
Thorbjørn Jagland, der Komitee-Vorsitzende, überlegt lange, ob er einem Gespräch zustimmen soll. Immerhin sind die Jurymitglieder zur Verschwiegen-heit verpflichtet, erst nach 50 Jahren dürfen die Pro-tokolle ihrer Sitzungen veröffentlicht werden. Am Ende erklärt Jagland sich als einziges Komitee-Mit-glied bereit, mit der ZEIT zu sprechen. Er sagt im Grunde, dass das Komitee in der Frage, wen es küre, oft gar keine Wahl habe. Die Mitglieder seien ledig-lich Sachwalter des letzten Willens Alfred Nobels, und der sei eindeutig. Der Preis solle an die Person verge-ben werden, die »während des vorangegangenen Jah-res (…) die meiste oder beste Arbeit für die Brüder-lichkeit zwischen den Nationen, für die Abschaffung oder Reduzierung stehender Armeen und für das Ab-halten oder Voranbringen von Friedenskongressen getan hat.« Darum habe es das Komitee gar nicht ver-meiden können, den Preis an Barack Obama zu ver-leihen. »Er hatte den Russen einen ›Reset‹ angeboten und vorgeschlagen, die Start-3-Verhandlungen über die Abrüstung strategischer Raketen wiederaufzuneh-men«, sagt Jagland. »Damit hat er letztlich das ge-samte internationale Waffenkontrollsystem gerettet.« Jagland sieht absolut keinen Grund, am Vergabever-fahren irgendetwas zu ändern. »Der Prozess ist hoch seriös. Deshalb ist der Preis auch glaubwürdig. Ich habe gehört, dass einige Leute in Norwegen Ände-rungsvorschläge haben. Aber ich glaube nicht, dass das eine große Debatte wird.«
Es ist natürlich schon eine, und wahrscheinlich war sie noch nie so berechtigt wie heute. Während des Kalten Krieges wäre es kaum möglich gewesen, sich auf internationale Jurymitglieder zu einigen. Heute würden einem Weltkomitee keine verfeindeten Ideo-logien mehr im Wege stehen, allenfalls wären es un-terschiedliche Auffassungen von Frieden, die – durch-aus fruchtbar – aufeinanderprallen könnten.
Geir Lundestad, der Gralshüter des Nobel-Insti-tuts, wägt solche Argumente gerne. Aber am Ende bleibt er doch Norweger und selbstbewusst genug, um »den liberalen Internationalismus« seines Landes für genau den richtigen Geist des Preises zu halten. »Diese Mischung aus Idealismus und Realismus ist doch gar nicht schlecht.« Mag sein übrigens, dass Al-fred Nobel dem Preis genau dieses kulturelle Erbgut mitgeben wollte. Niemand weiß es wirklich, aber ein Grund, warum der Stifter gewollt haben könnte, dass der Friedenspreis in Oslo und nicht in Stockholm ver-liehen werden soll, könnte sein, dass er für diese Auf-gabe jenem skandinavischen Völkchen am meisten vertraute, das nie Großmachtallüren hatte, das histo-risch unschuldig geblieben war und auf der Weltbüh-ne am liebsten sein reines Gewissen als Gewicht ein-setzte. All das, muss man einräumen, zeichnet den Auszeichner Norwegen natürlich bis heute aus.
Siehe auch Reise Seite 77
www.zeit.de/audio
10 POLITIK
Oslo
Natürlich kann man finden, dass die EU den Friedensnobelpreis verdient hat. Man kann es auch anders sehen. Aber niemand würde doch wohl glauben, dass sie den Preis nur bekommen konnte, weil eine norwegische
Sozialistin im Jahr 2012 einen Schlaganfall erlitt. So war es aber.
Mit der Institution des Friedensnobelpreises ist es wohl wie mit jeder Magie – je näher man hinter ihre Funktionsweise schaut, desto geringer wird die Ehr-furcht. Nach gewissen Einblicken in die Osloer Ent-scheidungsprozesse fragt man sich gar: Wenn dieser Preis sein Prestige nicht auch von seinen objektiven Geschwistern, den in Stockholm verliehenen Wissen-schaftsnobelpreisen, ableiten könnte – genösse er dann eigentlich ein solches Renommee? Es gibt Nor-weger, denen bereitet dieser Gedanke in letzter Zeit gewisse Sorgen.
Das also ist der Raum, aus dem das Gewissen der Welt Bescheid bekommt, jedes Jahr am zweiten Frei-tag im Oktober, gegen halb elf Uhr morgens. Die beeindruckenden Büchermassen, die sich hinter dem Direktor des Nobelinstituts in einer Regalwand bis zur Decke türmen, müssen ihren Teil zu mancher Wahl beigetragen haben. Eine halbe Stunde Vor-sprung, sagt Geir Lundestad, lasse man den Gekürten, bevor die Weltpresse ihre Namen erfahre. In der kommenden Woche wird Lundestad hier wieder zum Telefon greifen, um dem Auserwählten mitzuteilen, dass er oder sie soeben den Friedensnobelpreis ge-wonnen hat.
Lundestad, im Hauptberuf Geschichts-professor, grauhaarig, perfektes Englisch, pflegt eine legere Weltmann-Attitüde. Seit 23 Jahren sortiert er als Sekretär die Nomi-nierungen und bereitet die Beratungen des Nobelkomitees vor. Sollte die Geschichte des Preises irgendwann einmal verfilmt wer-den, Lundestads Rolle wäre mit einem alters-milden Anthony Hopkins gut besetzt. Man kann sich vorstellen, welche salbungsvolle Freude es ihm bereitet, jedes Jahr derjenige zu sein, der die weltliche Heiligsprechung über den Erwählten bringt.
Wollte schon mal jemand den Preis nicht haben?Nein, sagt Lundestad, steht wie zur Bekräftigung
auf und zieht ein Buch aus der Regalwand. Es ist das Oxford Dictionary of Contemporary World History. Auf dem Teetisch vor dem Besucher schlägt er es auf, beim Stichwort Friedensnobelpreis. »The world’s most prestigious price«, steht da. »Alle wollen ihn«, sagt Lundestad und pocht mit dem Finger auf die Zeile wie auf ein Beweisstück. »Sie wissen, es ist die höchste Ehre, die sie bekommen können.«
Ist das so? Ist der Friedensnobelpreis noch immer die höchste moralische Auszeichnung dieser Zivilisa-tion? Sicher ist, dass kein anderer Preis auf den Schul-tern von so vielen Riesen ruht, auf denen von Henry Dunant, von Albert Schweitzer, von Martin Luther King, von Mutter Teresa und Nelson Mandela. Die Liste der 124 Preisträger seit der Erstvergabe 1901 liest sich wie das Heldenregister eines Jahrhunderts.
Einige Preisentscheidungen der jüngeren Zeit al-lerdings haben Stirnrunzeln ausgelöst, an der Börse würde man vielleicht sagen, den Währungswert der Nobelmedaille sinken lassen. 2009 erhielt Barack Obama den Preis, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem er gerade einmal achteinhalb Monate im Amt war. 2012 bekam die EU die Auszeichnung ausgerech-net in dem Jahr, in dem sich am deutlichsten zeigte, welchen Schaden ein überstürzt eingeführter Euro in Europa anzurichten imstande war hatte. Ging es in beiden Fällen wirklich um Verdienste? Oder wollte die
Die Moral-WeltmeisterDer Friedensnobelpreis gilt als die größte Auszeichnung auf Erden. Ist er das noch? In Oslo regen sich Zweifel VON JOCHEN BITTNER
Die Nobel-Medaille. 196 Gramm Ruhm
Foto
s [M
]: a
ctio
n p
ress
; D
ive
rge
nce
/Stu
dio
X (
u.)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Mach’s mit MaoOffener, moderner, freier: So sollte
China unter der neuen Führung
werden. Das hofften viele Chinesen –
vergeblich VON ANGELA KÖCKRITZ
Das 17. Buch des jungen Au-tors Shi ist nicht unbedingt das, was man ein heikles po-litisches Werk nennen wür-de. Es widmet sich Gedich-ten, die chinesische Kaiser einst verfasst haben. Umso
überraschter war Shi, als ihm sein Verlag mitteilte, das Buch dürfe nicht erscheinen. Derzeit seien nur Bücher zu vier Themen erlaubt: Gesundheitstipps. Positives Denken. Erfolg in Beruf und Karriere. Und Werke rund um die Kommunistische Partei.
Willkommen in der Vergangenheit. Seit einem halben Jahr ist Xi Jinping der neue Präsident Chinas, seit knapp einem Jahr ist er Generalsekretär der Par-tei. Bevor er seine Ämter antrat, wusste keiner so recht, wofür er stand, nur eines war bekannt: dass sein Vater ein Reformer war. Das gab manchen Anlass zur Hoffnung. Intellektuelle, ja weite Teile der Gesell-schaft sprachen ungewohnt offen über ihre Sehnsucht nach politischen Reformen: nach ei-ner Herrschaft, die sich nicht auf politische Willkür stützt, sondern auf das Gesetz. Nach einem Rechtssystem und einer Verfassung, die den Namen verdienen. Nach einer freieren öffent-lichen Debatte. Und wirkte dieser Präsident nicht viel moderner als der alte? Stöckelte seine Frau, eine be-rühmte Sängerin, nicht so elegant über das internationale Parkett, dass parteinahe Medien sie als asiatische Michelle Obama feierten?
Doch die Hoffnung trog. Wirt-schaftlich ist Xi offen – soeben wurde in Shanghai eine Sonderzone errich-tet, in der unter anderem eine Öff-nung des Finanzmarktes getestet werden soll –, politisch aber liebäugelt er mit dem Erbe der Mao-Zeit. Da-mals bestimmte allein die Partei den öffentlichen Diskurs. Sie übte ihre Herrschaft nicht durch Gesetze aus, sondern durch Kampagnen, machte den Bürger klein, um selbst übergroß zu werden.
Die Zeiten aber haben sich geändert – auch durch die von der Partei initiierten Reformen. Im Netz etwa geißeln Blogger Korruption und Machtmissbrauch, die Partei fürchtet um ihre Meinungshoheit und letzt-lich um ihre Macht – und schlägt zurück. Anfang September erließ das Oberste Gericht ein Dekret gegen »Gerüchte im Internet«. Demnach haftet jeder Blogger für die »Gerüchte«, die er verbreitet. Wird eine solche Nachricht mehr als 500-mal weitergelei-tet oder von mehr als 5000 Leuten gelesen, drohen
bis zu drei Jahre Haft. Was aber sind Gerüchte? Das bestimmen noch immer die Behörden. Dass das Dekret dazu dient, unliebsame Blogger loszuwerden, zeigte sich kurz darauf. So wurde etwa Charles Xue, ein in den USA geborener chinesischer Unternehmer, Netz-Usern besser als Xue Manzi bekannt, vergange-nen Monat festgenommen, weil er Gruppensex mit Prostituierten gehabt haben soll – Prostitution ist in China illegal und doch allgegenwärtig, der Vorwurf erscheint angesichts der Sexskandale, die sich das Per-sonal der Partei leistet, fast lächerlich. Die Behörden versuchten erst gar nicht, den Zusammenhang zwi-schen Xues Eskapaden und seinem Einfluss im Netz runterzuspielen. Wie ein Tanzbär wurde der Ver-haftete im Fernsehen vorgeführt, parteinahe Medien zitierten aus dem Verhörprotokoll, seine zwölf Mil-lionen Anhänger hätten in Xue das Gefühl erzeugt, »er sei ein Kaiser, der sich um die Belange des Staates kümmere«. Viele seiner Posts seien »Ausdruck seiner schlechten Laune und seiner Vernachlässigung des
positiven sozialen Mainstreams gewesen«. Im August hatte der neue Präsident seine Propa-
gandachefs zu sich zitiert und sie ermahnt, das Heer der Propagandisten müsste eine »starke Armee bil-den«, »um das Feld der neuen Medien einzunehmen«. Wo die Propagandisten nicht weiterwissen, springt der Polizeiapparat bei: Im vergangenen Monat wur-den mehr als 440 Blogger festgenommen, darunter befanden sich viele Kritiker, welche die Behörden teils unter fadenscheinigen Vorwänden festsetzen ließen.
Wo die Willkür regieren soll, muss die Partei über dem Gesetz stehen. Zwar ließ sie in den ver-
gangenen Jahrzehnten das Rechtssystem ausbauen, wusste es aber zugleich stets als effektives Herr-schaftsmittel zu nutzen. Als Gesetze immer wichti-ger wurden, begannen Intellektuelle, noch mehr zu fordern: den Konstitutionalismus. Die Regie-rung selbst solle sich auf die Verfassung stützen. Nichts aber erscheint der Partei offenbar gefähr-licher als die Idee des Konstitutionalismus. Steht sie doch an erster Stelle der sieben Übel, vor denen die Partei ihre Mitglieder in einem internen Doku-ment namens »Nummer neun« warnt. In diesem Sommer verdammten mehr als 200 Zeitungen diesen Vorschlag, hinter dem man eine Intrige des Westens vermutet. Universitätsprofessoren, die Konstitutionalismus lehren, wird das Lehren ver-boten. Allgemein nimmt der Druck auf Professo-ren, Journalisten und Rechtsanwälte zu. Allein im Juli wurden 44 Rechtsanwälte bei ihrer Arbeit be-hindert, festgenommen oder geschlagen. Im ver-gangenen halben Jahr nahmen die Behörden min-
destens 56 Menschen aus politischen Gründen fest, unter anderem den prominenten Bürger-rechtler Xu Zhiyong.
Begeistert knüpft der neue Präsident an maois-tische Traditionen an und erweckt die gute alte politische Kampagne. Soeben hat er dazu aufgeru-fen, die Praxis von Kritik und Selbstkritik wieder-zubeleben. Ganz so, als habe es die Jahre der Kul-turrevolution und des maoistischen Terrors nie gegeben. Propaganda gab es auch in anderen sozia-listischen Ländern, doch nur in China mit seiner konfuzianischen Tradition existierte die »Gedan-
kenreform«. Sie machte es sich zur Aufgabe, den Menschen als Individuum auszulöschen, um ihn als sozialistisches Subjekt neu zu erfinden. Zu ih-ren wichtigsten psychologischen Instrumenten ge-hörten Kritik und Selbstkritik. Und selbst wenn sie heute nicht mehr den Schrecken entfalten kön-nen wie zu Zeiten Maos, stellt sich doch die Frage, warum die Partei an ihre unseligsten Zeiten an-knüpfen möchte.
So müssen Parteimitglieder derzeit die so-genannte Massenlinie studieren, eine Kampagne nach dem Vorbild Mao Zedongs, mit der der neue Präsident seiner Partei »Formalismus, Bürokratis-mus, Hedonismus und Extravaganz« austreiben will. Mächtige Partei- und Regierungsmitglieder müssen Sätze wie diese über sich ergehen lassen: Schaue in den Spiegel. Suche deine Fehler. Prüfe deine Kleidung. Dusche.
Worum geht es dem neuen Präsidenten? Tatsa-che ist, dass er letztlich ein Ziel verfolgt: die Infan-
tilisierung des Bürgers. Schon im-mer war der Bürger in den Augen der Partei ein Wesen, das der per-manenten Erziehung und Maßre-gelung bedurfte – allerorten wird er auf Propagandaplakaten er-mahnt und belehrt. Ein neues Ge-setz verpflichtet die Chinesen, re-gelmäßig ihre Eltern zu besuchen. Vorbereitet wird auch ein Gesetz-entwurf, wonach der Bürger jähr-lich eine bestimmte Anzahl von Büchern zu lesen hat. Derzeit dis-kutiert China über die internen Regelungen einiger Schulen. Etwa jene, dass Klassenkameraden un-terschiedlichen Geschlechts stets mehr als einen halben Meter Ab-stand zu halten hätten.
Bei all dem geht es um Größe-res. Wo die Partei weit über dem Gesetz steht, wo sie es nutzen kann, wie es ihr beliebt, werden dem Bür-
ger die politischen Freiräume beschnitten, die er zu nutzen lernte. Die permanente Maßregelung wirkte schon früher bizarr. In dem Maße aber, in dem der chinesische Bürger über mehr Wohlstand und Wissen verfügt als je zuvor, in dem er sich angewöhnt hat, vor Gericht zu ziehen oder seine Meinung im Netz kundzutun, wirkt seine Infanti-lisierung umso irritierender. Der neue Präsident mag die Vergangenheit umarmen wollen. Der chinesische Bürger aber ist längst ein anderer.
www.zeit.de/audioDer chinesische Präsident Xi Jinping (rechts)
nutzt die Propaganda nach Maos Art
POLITIK 11
Foto
s: W
alte
r B
ibik
ow
/G
ett
y Im
age
s (l
.);
Hu
ang
Jin
gwe
n/
Xin
hu
a N
ew
s A
gen
cy/
acti
on
pre
ss (
r.)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4112 POLITIK
Es gibt Meldungen, die sind so absurd, dass man erst einmal Luft holen muss. Oder die Stirn auf die Schreib-tischkante knallen möchte.
David Cameron will aus der Eu-ropäische Menschenrechtskonvention (EMRK) austreten. Das ist so eine Meldung.
Großbritannien, Leuchtturm der Demokratie, die Nation des Fair Play, will Schluss machen mit den lästigen Grundrechten seiner Bürger, die in der Konvention verbürgt sind? Das Vereinigte König-reich will sich in die symbolische Gesellschaft von Schurkenstaaten und Diktatoren begeben?
Noch ist es nur ein Gedanke, halblaut aus-gesprochen, adressiert vor allem an die Europa-feinde in Camerons eigener Partei und bei den Anti-EUlern der populistischen UK Indepen-dence Party, die den konservativen Premiermi-nister gnadenlos vor sich hertreiben. Aber Ca-merons Gedankenspiel ist kein Versehen.
Seine Innenministerin warb gerade dafür, Einwanderern radikal ihre Rechte zur Anfech-tung von Abschiebungen zu beschneiden, von 17 Anfechtungsgründen sollen nur noch vier bleiben. Rechtsmittel sollen künftig in aller Re-gel nur noch nach der Abschiebung, also vom Ausland aus, eingelegt werden können. Das Ziel sei es, eine »feindliche Umwelt« für illegale Im-migranten in Großbritannien zu schaffen.
Camerons Justizminister Chris Grayling hat angekündigt, die Tories würden mit dem Ver-sprechen in die nächste Wahl ziehen, eine neue Grundrechtscharta zu schaffen, eine britische »Bill of Rights«. Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte, der über die Einhaltung der Konvention wacht, so Grayling, sei eine Quelle »enormer internationaler Frustration«.
Richtig: Die Straßburger Richter nerven auch die Mächtigen in Russland, Rumänien und der Türkei immer wieder, die es mit den Men-schenrechten nicht so genau nehmen.
Es stimmt schon, der Europäische Gerichts-hof für Menschenrechte hat in den vergangenen Jahren auch einige Male gegen Deutschland ent-schieden, etwa um die Rechte von Vätern zu stärken oder die von Sicherungsverwahrten. Aber für Großbritannien hatte die EMRK im-mer eine besondere Bedeutung. Denn das Ver-einigte Königreich besitzt keine geschriebene Verfassung und kannte deshalb auch lange kei-nen ausformulierten Katalog von Grundrechten; erst mit dem Human Rights Act wurde im Jahr 2000 die EMRK ausdrücklich zum Bestandteil der innerbritischen Rechtsordnung. Wenn sich also ein Untertan ihrer Majestät gegen Verlet-zungen seiner verbrieften Menschenrechte weh-ren wollte, dann musste er sich an Straßburg wenden. Und viele taten das.
Immer wieder ist London in Straßburg unter-legen, die Richter kritisierten, dass britischen Strafgefangenen pauschal das Wahlrecht aber-kannt werde, sie erklärten erst jüngst die lebens-lange Haft für menschenrechtswidrig, die in Großbritannien oft wirklich bis zum Lebens ende vollstreckt wird. Und jahrelang stritt Cameron mit den Richtern in Straßburg über die Abschie-bung eines radikalen Islamisten nach Jordanien, dem dort möglicherweise die Folter droht.
Schon Tony Blair erwog nach den Anschlägen vom 11. September, die EMRK auszusetzen, um ein paar Terrorverdächtige an Folterstaaten los-werden zu können. David Cameron polemisierte mehrfach gegen Straßburg, er versuchte sich während der britischen Ratspräsidentschaft an einer grundlegenden Reform, sprich: Entmächti-gung des Gerichts – und scheiterte nicht zuletzt am Widerstand von dessen Präsident, Sir Nicolas Bratza, er ist ausgerechnet ein Brite.
Die EMRK wurde gegründet, um der Barbarei das Recht entgegenzusetzen. Anfangs, im Novem-ber 1950, waren es nur zwölf Regierungen, die die Charta unterzeichneten, als erste übrigens die britische. Heute haben 47 Länder unterzeichnet, und selbst Staaten wie Russland, die Ukraine und Aserbaidschan können es sich nicht erlauben, diesem Klub des Rechts fernzubleiben oder seine Urteile allzu offen zu missachten. Zu groß wäre der Prestigeverlust, zu heftig wären die Proteste.
Bei aller bürokratischen Umständlichkeit und trotz des juristischen Aktivismus mancher Richter – die Konvention und das Gericht sind Institutio-nen, die zu verteidigen sich lohnt. Nicht alle, aber viele Urteile aus Straßburg bewirken tatsächlich etwas, häufig im Stillen, auf Umwegen. Und für viele Menschenrechtsaktivisten ist die EMRK eine Hoffnung, ein Ansporn, ein Versprechen.
Wenn Großbritannien tatsächlich austreten würde, um seine »Souveränität« zu stärken, dann wäre das mehr als ein bürokratischer Akt. Es wäre ein Stück westlicher Selbstaufgabe: normativer Selbstmord. Die Putins, Orbáns und Erdoğans würden es Cameron danken.
Bei unserer Wahlwette im Parlamentsbüro habe ich einen achtbaren achten Platz unter 19 Teilnehmern erreicht, vielleicht war es auch der neunte, nach der Flasche Schampus für den Sieger zählt man ja nicht mehr richtig mit. Hätte ich die Union ein bisschen stärker, die FDP ein bisschen schwächer, die AfD ein bisschen mehr draußen und die Piraten deut-lich mehr untergegangen getippt, wäre auch der sechste Platz drin gewesen. Aber dann hätte ich ja noch meinen Büroleiter verdrängt, ein Un-terfangen, das man nur angehen sollte, wenn man sich sicher sein kann, dass es auch gelingt.
Der Wettstoff wird uns auf absehbare Zeit nicht ausgehen. Wir könnten nun wetten, ob das nächste Kabinett nur eine Große Koalition sein wird oder auch eine große Bundesregie-rung. Ob Schwarz-Grün bis zum SPD-Partei-tag Mitte November steht, bis Weihnachten oder bis Jürgen Trittin Fehler einräumt, die nicht mit »Wir brauchen nicht in Sack und Asche zu gehen« enden.
Am meisten Spaß machen natürlich Wet-ten aufs Personal. Wird Sigmar Gabriel Fi-nanz- oder Superminister, im Verhandlungs-stress ruppig oder nach dem SPD-Mitglieder-votum einen Kopf kürzer? Kann Ursula von der Leyen auch Außen- und Sicherheit oder nur Soziales und Kampfstrahlen? Wer oder was platzt zuerst: Thomas Oppermann vor Ungeduld, endlich Innenminister zu werden, oder die Verhandlung um Schwarz-Rot. Und vor allem: Was wird schneller abgeschafft: die FDP oder diese Kolumne? PETER DAUSEND
Was wird aus Schwarz-Grün, was aus Sigmar Gabriel – und was aus mir?
Berlin im Wettfieber
Für die Große Koalition fordert die SPD sechs Minister und einen ideologischen Preis: Steuern rauf! Die Kanzlerin wird ihn wohl entrichten, da-mit sie Kanzlerin bleibt. Aber wirtschafts- und gerechtigkeitspolitisch ergibt der Spitzensteuersatz der SPD – 49 statt 42 Prozent – keinen Sinn.
Nicht einmal für Klassenkämpfer, schlägt doch das SPD-Modell schon bei 60 000 Euro zu (ledig, keine Kinder). 5000 pro Monat verdient ein Handwerksmeister oder eine Pilotin bei einer Billig-Airline – die gehobene Mittelschicht eben. Da gibt die jetzige »Reichensteuer« (45 Prozent ab 250 000) ein sinnfälligeres Umverteilungs-instrument her.
Zahlen wir zu wenig Steuern? Seit Jahren steigt das Aufkommen (bis auf das Krisenjahr 2009) ge-radlinig nach oben. Ganz ohne Tarif-Fummelei, schätzt das Finanzministerium, werden in den nächsten vier Merkel-Jahren zusätzlich 300 Mil-liarden Euro in die Kassen gespült. Müssen wir wie Griechenland das Defizit stauchen? Deutsch-land ist der einzige große EU-Staat mit praktisch ausgeglichenem Haushalt. Erfordert eine grau-
same Staatsschuld mehr Steuern? Mit rund 80 Pro-zent der Wirtschaftsleis-tung steht Deutschland dezidiert besser da als Frankreich, Italien, Eng-land und Amerika, von Japan (210 Prozent Staats-verschuldung) ganz zu schweigen.
Wozu also den Steuer-eintreiber von der Leine lassen? Die Sozialdemo-
kraten haben plötzlich die marode Infrastruktur entdeckt, die ihnen bis 2009 (Große Koalition I) entgangen war. Faktencheck: Das Weltwirt-schaftsforum hat gerade seinen Bericht zur Wett-bewerbsfähigkeit veröffentlicht. Deutschland steht weltweit an der Spitze – auf Platz drei. Klafft die Gerechtigkeitsschere immer weiter aus-einander? Optisch schon, wenn man die Millio-nengehälter von Hedgefonds-Akrobaten, Ban-kern, Entertainern und Fußballern betrachtet, die von exzessiv bis obszön reichen.
Aber das sind Stammtisch-Storys. Eine ver-lässlichere Messlatte gibt der »Gini-Koeffizient« her, der die Einkommensungleichheit auf einer Skala von null (alle gleich) bis eins (einer hat al-les) misst. Der deutsche gehört mit 0,27 weltweit zu den niedrigsten und liegt knapp unter dem des hochegalitären Schweden. Der Grund: Bei der Umverteilung ist Deutschland ein sozial-demokratisches Traumland. Seine Sozialleis-tungsquote liegt etwa bei einem Drittel der Wirt-schaftsleistung. (Nur Frankreich und Schweden sind etwas besser.)
Statt der SPD nachzugeben, sollte Merkel sie an das Offenkundige erinnern: dass die Schröder-Regierung die Einkommens- und Unternehmens-steuer gedrückt und den eingefrorenen Arbeits-markt aufgetaut hat. Dass Gabriel Steuern noch im August sogar senken wollte. Mithin ist es kein Zufall, dass die hiesige Arbeitslosigkeit heute halb so hoch ist wie die von Euroland. Die Hände weg von den Steuern!, möchte man Merkel zurufen – allein damit sie angesichts früherer Gelübde ihre Glaubwürdigkeit rette.
Die Macht ist wichtig, noch wichtiger aber die Vernunft, die sagt: Der minimale Umverteilungs-effekt wiegt die Nachteile nicht auf. Je höher die Steuern, desto stärker der Drang, Steuern zu ver-meiden. Höhere Sätze bedeuten nicht unbedingt mehr Einnahmen. Prinzipien darf man ruhig ehren, wenn sie auch pragmatisch sinnvoll sind. Die SPD-Steuerwünsche sind es nicht.
Ist ihnen jetzt alles egal?Großbritannien will auf europäische Grundrechte pfeifen. Das würde sich rächen VON HEINRICH WEFING
Foto
: [M
] B
rian
Snyd
er/R
eute
rs
Foto
: B
rendan
McD
erm
id/R
eute
rs
TagesquizTesten Sie täglich Ihre Allgemeinbildung zu aktuellen Themen quer durch alle interes-santen Wissensgebietewww.zeit.de/tagesquiz
ZEIT ONLINE auf FacebookWerden Sie einer von mehr als 200 000 Fans von ZEIT ONLINE auf Facebook und diskutieren Sie aktuelle Themen mit unswww.facebook.com/zeitonline
ZEIT ONLINE twittertFolgen Sie ZEIT ONLINE auf twitter.com, so wie schon fast 300 000 Follower. Sie erhalten ausgewählte Hinweise aus dem Netzwww.twitter.com/zeitonline
Briefkasten-ZertifikatSHA1-Fingerprint: 8F A6 19 69 0E 7E D5 3B 9F 75 4B 09 6A 4E 35 4A 8C 54 CE 2F Wie Sie diesen Fingerprint nutzen, lesen Sie hier: www.zeit.de/briefkasten
In Paris geht der Marathon der Mode-schauen für den kommenden Sommer zu Ende. Was kommt, welcher Trend bleibt, was geht? Jina Khayyer bespricht die High-lights der Kollektionen von Chanel, Louis Vuitton und Stella McCartney
www.zeit.de/mode
Die Aufarbeitung der Finanzkrise wird vor allem mit viel Geld verhindert: Um laufen-de Ermittlungen zu stoppen, sind US-Ban-ken bereit, Geldbußen in Milliardenhöhe zu akzeptieren. Die guten Gewinne machen es möglich
www.zeit.de/wirtschaft
In einem Internet-Video zeigte ein norwegi-scher Amateur, dass er einen Football genauer kickt als viele Profis. Ein NFL-Klub nahm ihn in den Kader auf – und strich ihn wieder. Trotzdem hofft Håvard Rugland noch auf die große Karriere
www.zeit.de/sport
Noch ist offen, wie die künftige Bundesre-gierung aussehen wird. Doch Kompromisse und Trennlinien zwischen den möglichen Koalitionspartnern zeichnen sich schon ab. Welche Partei steht wo? Was ist verhandel-bar, was nicht?
www.zeit.de/deutschland
Foto
: [M
] G
onza
lo F
uen
tes/
Reu
ters
Foto
: [M
] To
bia
s S
chw
arz/
Reu
ters
Aktuell auf www.zeit.de
www.zeit.dePOLITIK WIRTSCHAFT MEINUNG GESELLSCHAFT KULTUR WISSEN DIGITAL STUDIUM KARRIERE LEBENSART REISEN AUTO SPORT
www.zeit.de
FASHION WEEK
Schlusssprint in ParisFINANZINDUSTRIE
Der große AblasshandelNACH DER WAHL
Wie weiter, Deutschland?FOOTBALL
Per YouTube in die NFL
Unvernunftsehe
ZEITGEIST
DAUSEND
25.09.2013
So ein Stress
Heute
Meinung
Josef Joffe
ist Herausgeber
der ZEIT
Ist das eigentlich noch schön? Sind das eigent lich noch Boote – oder seegestützte Flugzeuge? »Segel« jedenfalls heißen die An-triebskörper der Katamarane, die vergangene Woche vor San Francisco um den America’s Cup ins Finale gingen, schon lange nicht mehr. In der Branche spricht man von »Flügeln«. Die Tragflächenkonstruktion des gesamten Gefährts sorgt dafür, dass die Rümpfe das Wasser gar nicht mehr berüh-ren, sondern nur die Schwerter und Ruder-blätter Elementkontakt halten. Solche Renn-ziegen werden bis zu 80 Stundenkilometer schnell. Das könnte ein grandioses Erlebnis sein, aber wir gehen mal davon aus, dass die Aeronauten keine Zeit haben, irgend etwas zu erleben, sondern bloß damit beschäftigt sind, den perfekten Trimm hinzuwischen. So ein Stress. Gewonnen hat den Cup übri-gens Amerika, Neuseeland war zu langsam. Aber das ist keine Neuigkeit. BIT
Warum Merkel der SPD keine Steuererhöhung schenken darfJOSEF JOFFE:
Foto
: V
era
Tam
me
n f
ür
DIE
ZE
IT
Foto
: Jo
hn
G.
Mab
angl
o/
ep
a/p
ictu
re-a
llian
ce/
dp
a

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Schluss mit der SelbstzensurDer Pressekodex muss geändert werden: Journalisten sollten die Herkunft von Straftätern nennen dürfen VON HORST PÖTTKER
misch bemerken, dass »die deutsche Qualitätspresse die Herkunft der mohammedanischen Edelmigran-ten verschweigt«. Und Roland Koch hat 2008 sei-nen Wahlkampf in Hessen auch mit dem Argument geführt, die deutsche Presse würde nicht offen über Ausländerkriminalität berichten. Ohne die Richtli-nie 12.1 hätten solche Behauptungen keine fakti-sche Stütze.
Der Presserat sollte deshalb die allgemein gehal-tene Ziffer 12 seines Kodex beibehalten, die den Journalisten – anders als Richtlinie 12.1 – die volle Freiheit, aber auch die volle Verantwortung für ihr Handeln lässt. Sie lautet:
»Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.« Dieser Satz, den das Grundgesetz ähnlich formuliert, sollte eigentlich reichen. Die bisherige Richtlinie geht von einem Publikum aus, das Vorurteile hat und verführbar ist. Journalisten müssen aber für ein mündiges Publi-kum schreiben, dem sie auf Augenhöhe begegnen, sonst bringt ihre Arbeit die Gesellschaft nicht voran. »Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar«, hat Ingeborg Bachmann gesagt, die auch als Journalistin gearbeitet hat.
rauf zu verzichten, die Rassenzugehörigkeit der Beteiligten ohne zwingend sachbezogenen Anlass zu erwähnen.«
Nachdem die Richtlinie zunächst nur untersag-te, die Minderheitenzugehörigkeit zu erwähnen, wenn diese für das Verständnis des betreffenden Vorgangs ohne »Bedeutung« ist, wurde die bis heute maßgebliche Formulierung 1993 auf Emp-fehlung des früheren Verfassungsrichters Helmut Simon beschlossen. Sie ist strenger, denn sie for-dert das Vorliegen eines »begründbaren Sach-bezugs«. Simon hatte im Auftrag des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma ein entsprechendes Gutachten verfasst und sich darin fast nur auf Ar-tikel 3 des Grundgesetzes bezogen, der den Gleich-heitsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot festschreibt, kaum aber auf den konkurrierenden Artikel 5, der die Presse- und Meinungsfreiheit garantiert. Seitdem überschüttet der Zentralrat der Sinti und Roma den Presserat jedes Jahr mit Se-rienbeschwerden auf der Grundlage der Richtlinie 12.1, in deren vorgefertigte Formulare nur das Datum des beanstandeten Presseartikels und der Name der Zeitung eingetragen werden.
Eine ältere Fassung der Richtlinie ging noch weiter. Dort war nicht nur von »Minderheiten« die Rede, sondern fürsorglich von »schutzbedürftigen Gruppen«. Aber sind die 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die heute in Deutsch-
land leben, tatsächlich schutz-bedürftig? Als der Presserat das Wort 2007 strich, hatte er offen-bar bemerkt, dass das nicht (mehr) der Fall ist.
Über die Wortkosmetik hinaus sollte er die ganze Richtlinie strei-chen, hinter der sich eine pädago-gische und paternalistische Auf-fassung verbirgt.
Die Richtlinie 12.1 gründet auf historischen Umständen, die sich geändert haben. Sie ist ein konkretes Formulierungsverbot und gehört abgeschafft. Bei der Zugehörigkeit eines Täters oder
Verdächtigen zu einer bestimmten, als »Minder-heit« definierten Gruppe geht es schließlich nicht um die Persönlichkeitsrechte des Täters, denn er wird durch deren Nennung ja nicht identifizierbar.
Ist es etwa diskriminierend für Fußballspieler, wenn man die Totschläger von Almere als Fußball-spieler bezeichnet? Ist es diskriminierend für alle Menschen unter zwanzig, wenn sie in den Medien als Jugendliche beschrieben werden? Soll auch auf diese Benennungen verzichtet werden? Das wäre doch wohl absurd. Im Übrigen entlastet das starre Formulierungsverbot Journalisten vom Nachden-ken über mögliche Problemursachen, die mit der Gruppenzugehörigkeit eines Täters zu tun haben könnten. Wer möchte, dass Journalisten verantwort-lich handeln, sollte ihnen die Freiheit zu eigenem Abwägen zugestehen, denn sonst können sie Ver-antwortung weder empfinden noch wahrnehmen. Hinzu kommt, dass die Richtlinie das Publikum für dümmer hält, als es ist. Untersuchungen zei-gen, dass Leser es merken, wenn die Nationalität eines Täters gezielt weggelassen wird. Die führt zu einem Vertrauensverlust, der sich von jenen aus-schlachten lässt, die tatsächlich diskriminieren. Die rechten Blogs konnten im Falle des zu Tode geprügelten niederländischen Linienrichters hä-
Dezember 2012 in Almere bei Amsterdam: Eine Gruppe ju-gendlicher Fußballer prügelt und tritt nach einem Regional-spiel brutal auf den 41-jährigen
Linienrichter Richard Nieuwenhuizen ein, der am nächsten Tag an den Folgen stirbt. Nieder-ländische Medien berichten sofort, dass es sich bei den drei Jugendlichen um Marokkaner handelt. In Deutschland erfährt man dies erst einige Tage später aus rechten Blogs. Warum haben seriöse deutsche Medien die Herkunft der Totschläger verschwiegen? Und haben sie damit korrekt gehandelt? Das sind Fragen, die an das grundlegende Verständnis von Journalis-mus rühren. Und, um es vorwegzunehmen: Mit meinem Verständnis von Journalismus ist eine derartige Selbstzensur nicht zu vereinbaren. Journalisten sollten nicht die Erzieher der Na-tion sein.
So, wie wir uns darauf verlassen möchten, dass Ärzte unser Leben erhalten wollen, möch-ten wir uns darauf verlassen können, dass Jour-nalisten unerschrocken, fair und umfassend über die komplizierte Welt berichten, in der wir leben. Richtig ist natürlich, dass Journalis-ten dabei mit berechtigten Interessen wie dem Schutz von Privatheit oder religiösem Empfin-den in Konflikt geraten. Sie können in ähnli-che Dilemmata geraten wie Ärzte, Anwälte oder Pfarrer, deren Standesethik es verbietet, gewisse Informationen preiszu-geben – selbst wenn diese Infor-mationen womöglich helfen könnten, größeren Schaden zu verhindern.
Deshalb gibt es seit 1956 in Deutschland den Presserat, bei dem sich jeder über Verstöße ge-gen journalistische Grundregeln beschweren kann. Die Verleger und Journalisten des Rates ent-scheiden, ob solche Beschwerden begründet sind. Sie greifen dabei auf einen Pressekodex zurück, der vorschreibt, was Journalisten erlaubt ist und was nicht. Im schlimmsten Fall reagiert der Presserat mit einer öffentlichen Rüge der betreffenden Zeitung oder Zeitschrift.
Die Richtlinie 12.1 des Pressekodex soll Journalisten davon abhalten, Minderheiten zu diskriminieren. Dort heißt es:
»In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein be-gründbarer Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile ge-genüber Minderheiten schüren könnte.«
Nimmt diese Regel die Aufgabe des Journa-listen ernst? Ist sie vereinbar mit dem Anspruch, unerschrocken, fair und umfassend zu berich-ten? Ich glaube, sie ist das nicht.
Die Richtlinie 12.1 geht zurück auf eine Anregung des Verbands der Deutsch-Amerika-nischen Clubs von 1971. Den Jahrbüchern des Presserats aus dieser Zeit ist zu entnehmen, dass es Ziel der Regelung war, »bei der Berichterstat-tung über Zwischenfälle mit US-Soldaten da-
Ey, du Klapptritt!Eine kleine Sprachkritik der Koalitionskämpfe
Nach der Wahl beginnt die Zeit der rasseln-den Nachhutgefechte. Bevor es friedlich werden kann, muss es noch mal martialisch werden, müssen die Feindbilder noch ein-mal gepflegt werden. Die Sprache ist zu-weilen verräterisch. Da wird sondiert, als breche man auf lebensgefährliches Terrain und zu unerhörten Abenteuer auf – obwohl sich die großen Parteien doch so nah sind wie selten zuvor und alle Beteiligten sich aufs Beste kennen.
Im Laufe dieser Aufgeregtheit passieren Ausrutscher. Als Erstes offenbarte Jürgen Trittin, wie er sich seine Wähler vorstellt. Dümmer nämlich als sich selbst: Man habe die Wähler über- und den Gegner unter-schätzt. Der Wähler, der nicht so wählt wie erwünscht, hat es nicht verstanden, er ist schlimmer als der Nichtwähler, er ist ein Falschwähler. Dass er es womöglich genau richtig verstanden hat und deshalb so ge-wählt hat, wie er gewählt hat, kommt im Weltbild des Klassenkämpfers nicht vor.
Der zweite Ausrutscher betrifft den Steigbügelhalter. Das Wort klingt fies, nach Herrenmenschen, Diktatoren, deutschen Stiefeln, Dolchstoßlegenden. Erst wollte Peer Steinbrück nicht der Steigbügelhalter Merkels sein, nun will die SPD nicht der Steigbügelhalter der CDU sein. Der Begriff führt schnell auf Abwege, wie der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweit-zer (SPD) erfuhr, der sich über die angebli-che Arroganz der CDU seit dem Wahltag so aufregte, dass er deren Vertreter mit den Steigbügelhaltern Hitlers verglich. Schweit-zer musste sich natürlich entschuldigen. Der Vergleich ist mehrfach falsch. Ein Steigbü-gelhalter ist nämlich mitnichten einer, der einem anderen den Steigbügel festhält. Ein Steigbügelhalter ist ein Karabinerhaken an einem Lederband, mit dem sich Ersatzsteig-bügel bei langen Ritten so befestigen lassen, dass der Bügel sicher verstaut ist – ein legiti-mes Ansinnen.
Wer es nicht von alleine aufs Pferd schafft und sich ungern helfen lässt, greift zu einem kleinen Klapptritt und steigt von da aus auf. Dass die SPD nicht der Klapp-tritt von Frau Merkel sein möchte, kann man verstehen, es klingt nur blöd.
Einen Menschen, von dem man sich aufs Pferd helfen lassen will, fragt man hingegen üblicherweise höflich: Hältst du bitte mal dagegen? Worauf der Mensch sich mit seinem Gewicht an die gegen-überliegenden Steigbügelriemen hängt, damit Sattel, Pferd und Reiter nicht die Balance verlieren. Dagegen ist nicht viel zu sagen. TINA HILDEBRANDT
1899
Ist das schön. Das waren noch Boote. Schif-fe, die den Namen »Segeljacht« verdienten. Bei diesem hier handelt es sich um die Sham-rock, den wahrscheinlich grandiosesten Ver-liererschiffstyp aller Zeiten. Zwischen 1899 und 1930 forderte der irisch-stämmige Un-ternehmer Thomas Lipton die Amerikaner fünf Mal um den America’s Cup heraus. Beim ersten Mal verlor er. Er baute ein zwei-tes Boot (Shamrock II), mit dem er ebenfalls verlor. So ging das weiter bis zur Shamrock V. Mit ihr unterlag Lipton den Amerikanern ein fünftes Mal. Fail, fail again, fail better,wird sich Lipton mit Samuel Beckett ge-dacht haben; scheitere, scheitere noch ein-mal, scheitere besser. Zu seinem speziellen Scheitern gehörte, dass Lipton dadurch sei-ner Teemarke zu einiger Berühmtheit ver-half. Nach dem letzten Versuch stifteten die Amerikaner ihm einen eigenen Pokal, den für den »besten aller Verlierer«. BIT
So ein Spaß
Damals
Meinung POLITIK 13
Horst Pöttker istProfessor fürJournalistik an derUniversität Dortmund
Foto
s: J
oh
n S
. Jo
hn
sto
n/
Lib
rary
of
Co
ngre
ss,
De
tro
it P
ub
lish
ing
Co
mp
any
Co
llect
ion
; H
ors
t G
alu
sch
ka/
imag
o (
u.)

Wie weiter, Liberalismus?Die FDP ist aus dem Bundestag verschwunden. Überlebt der Liberalismus in der APO? Wird er sich verändern? Wer greift ihn jenseits der FDP auf? Eine Serie zum Thema
www.zeit.de/deutschland
Foto
: p
ictu
re-a
llian
ce/
dp
a
2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
14
Ich war »Mehmet«: Ein Besuch bei Muhlis Ari in der Türkei
Mit 89 Jahren bekommt der Schauspieler Walter Schultheiß seine erste Kino-Hauptrolle
Polyamorie oder: Wie viele Menschen kann man lieben?
»Es geht an unsere Substanz«Dem 8. Oktober sieht Iris Berben, Präsidentin der Filmakademie, gespannt entgegen: An diesem Tag wird das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, ob die deutsche Filmförderung rechtens ist. Falls sie fällt, hat das dramatische Auswirkungen auf die ganze Branche. Darüber unterhielten sich die ZEIT-Redakteure Nina Pauer (l.) und Kilian Trotier mit der Schauspielerin in Berlin, die nicht nur ihren Hund Paul, sondern auch einen guten Freund mitgebracht hatte: Hinter der Kamera stand Jim Rakete FEUILLETON SEITE 48
POLITIK2 Regierungsbildung Warum
Frank-Walter Steinmeier kein guter Außenminister wäre VON JÖRG LAU
3 Einwanderung Wir brauchen ein MigrationsministeriumVON ÖZLEM TOPÇU UND BERND ULRICH
4 SPD Wie Hannelore Kraft dieSozialdemokraten retten willVON PETER DAUSEND
5 Grüne Ein Mann entscheidet: Tarek al-Wazir VON MARIAM LAU
6 Italien Ex-Außenminister Gianfranco Frattini über die Dauerkrise seines Landes
7 AnalysenWas macht Italien so gefährlich?VON ULRICH LADURNER
Was bedeutet die Spaltung der syrischen Opposition?VON YASSIN MUSHARBASH
9 Geschichte Wie die ZEIT 1969 Pädophilie verharmlosteVON MERLIND THEILE
Fatale Freude an der Provokation – ein Rückblick VON THEO SOMMER
10 Friedensnobelpreis Wer ihn bekommt – und warumVON JOCHEN BITTNER
11 China Parole: Zurück zu MaoVON ANGELA KÖCKRITZ
12 Zeitgeist VON JOSEF JOFFE
Großbritannien Ein Land verroht: Menschenrechte als ÄrgernisVON HEINRICH WEFING
13 Politische Korrektheit Wenn Ein-wanderer Straftaten begehen, müssen Medien darüber berichten dürfenVON HORST PÖTTKER
Sprachkritik »Steigbügelhalter« und andere MissverständnisseVON TINA HILDEBRANDT
DOSSIER15 Datenschutz Ein EU-Abgeordneter
kämpft für ein neues Gesetz – und gegen eine Facebook-LobbyistinVON MARTIN KOTYNEK UND
ROBERT LEVINE
GESCHICHTE18 Wahn »Blutige Romantik« – eine
Schau in Dresden über die Wurzeln des deutschen NationalismusVON CHRISTIAN STAAS
19 Aufklärung Genialer Denis Diderot: Ein Porträt zum 300. Geburtstag des französischen PhilosophenVON MATHIAS GREFFRATH
20 FUSSBALLEmotion Warum Wutausbrüche mehr der Selbstdarstellung als dem Erfolg dienen VON CATHRIN GILBERT
WIRTSCHAFT21 Erdgasförderung Norwegen plant
gigantische Maschinenparks in der arktischen Tiefsee VON PHILIP ROHRBECK
Krise Vorsicht vor einfachen Lösungen VON MARK SCHIERITZ
23 Wirtschaftskompetenz Welche Lücke hinterlässt die FDP in der Berliner Politik? VON ELISABETH NIEJAHR UND
PETRA PINZLER
Markus Kerber Im Interview fordert der BDI-Hauptgeschäftsführer Investitionen in die Infrastruktur und kritisiert Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
24 Huffington Post Das erfolgreichste Nachrichtenportal der USA kommt nach Deutschland VON GÖTZ HAMANN
25 Amazon Einige Hersteller wollen ihre Produkte nicht mehr bei Amazon ver-kaufen – um ihre Marken zu schützenVON CHRISTIAN THIELE
26 Hafenwirtschaft Hamburg droht die BedeutungslosigkeitVON DANIELA SCHRÖDER
27 Lettland Ministerpräsident Valdis Dombrovskis sagt im Interview, was es von Griechenland unterscheidetVON ALICE BOTA
28 Glücksspiel Automatenaufsteller streiten um Gewinne VON STEFAN MÜLLER
29 Datenschutz Eine französische Firma verkauft SicherheitslückenVON PHILIPP ALVARES DE SOUZA SOARES
30 Raghuram Rajan Der Chef der indischen Notenbank spricht über die Krise in den SchwellenländernVON ARNE STORN UND MARK SCHIERITZ
31 Europa Billigflieger und Urlaubsreisen zeigen, dass die Realität schon vielweiter ist, als die Krise vermuten lässtVON KARL SCHLÖGEL
Rüstung Warum Rheinmetall und Ferrostaal Rohstoffländern helfenVON HAUKE FRIEDRICHS
Wirtschaftspolitik Ökonomen streiten, ob ein radikaler Sparkurs den Euro-Krisenstaaten hilftVON KATJA SCHERER
32 Was bewegt … Solarworld-Chef Frank Asbeck? VON ANNE KUNZE
WISSEN33 Klima Gewissheit gibt es nicht
VON STEFAN SCHMITT
Physik Der Orientierungsstreit der Forscher VON ROBERT GAST
34 Medien Verändern Online- Kommentare die Wahrnehmung eines Textes? VON JAN SCHWEITZER
35 Archäologie Inka – Die Diktato-ren der Anden VON URS WILLMANN
36 Medizin Demenzkranke im Krankenhaus VON ADRIAN MEYER
37 Grafikseite Giftige Pilze
38 Genealogie Eine App soll Inzest in Island verhindern VON RICO GRIMM
41 KINDERZEITFernsehen Zu Besuch auf »Schloss Einstein« VON ANIKA KRELLER
42 KINDER- & JUGENDBUCHBegegnung Jugendbuchautor KlausKordon VON R. OSTEROTH UND S. SCHASCHEK
43 Neue Bücher Tipps für den Herbst
44 LUCHS des Monats für »Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen«VON KATRIN HÖRNLEIN
FEUILLETON45 Pop Der Sänger der Band
Rammstein schreibt jetzt Gedichte VON MORITZ VON USLAR
Russland Ein Pussy-Riot-Mitglied klagt gegen seine Haftbedingungen VON THOMAS ASSHEUER
46 Nachruf Der Schauspieler Walter Schmidinger ist tot VON MICHAEL SKASA
47 Emanzipation Frauen und soziale RollenbilderVON IRIS RADISCH UND NINA PAUER
48 Kino Filmförderung in Gefahr? Ein Interview mit Iris Berben
49 Theater Andrea Breths »Hamlet«-Inszenierung am Wiener BurgtheaterVON PETER KÜMMEL
50 Internet Die Netz-Intellektuellen sind blind für die Macht der IT-KonzerneVON EVGENY MOROZOV
51 Oper Zum 200. Geburtstag von Guiseppe Verdi VON C. LEMKE-MATWEY
54 Kino Edgar Reitz erweitert seine Triologie um die »Andere Heimat«VON THOMAS E. SCHMIDT
55 Steven Soderbergh verfilmt das Leben von Liberace VON JÖRG LAU
56 Kunstmarkt Alte Meister in den Herbstauktionen VON ULRICH CLEWING
57 Jeff Koons’ »Balloon Dog« in New York VON WOLFGANG ULLRICH
Traumstück Vase aus FlussglasVON ANNA VON MÜNCHHAUSEN
58 Literatur Zum 100.Geburtstag von Claude Simon VON ANDREAS ISENSCHMID
59 Buchmarkt Die Konjunkturkleiner Bookstores in den USAVON MARTIN KLINGST
60 GLAUBEN & ZWEIFELNAssisi Papst Franziskus besucht den Geburtsort des Heiligen FranzVON EVELYN FINGER
Rom Die Laienbewegung »Wir sind Kirche« fordert Mitsprache
61 Musik Spezial auf sechs Seiten
REISEN77 Oslo Das Grand Hotel
richtet das Festessen für den Friedensnobelpreisträger ausVON JOHANNES SCHWEIKLE
79 Azoren Wohnen mit Familienanschluss VON SUSANN SITZLER
82 Fernbusse Der Markt wächst schnell und macht vor allem den Mitfahrzentralen KonkurrenzVON COSIMA SCHMITT
CHANCEN83 Religionspädagogik Ein Gespräch
mit dem islamischenTheologen Mouhanad Khorchide
84 Inklusion Die Finnen schaffen die meisten Sonderschulen ab und setzen auf SpezialpädagogenVON MARTIN SPIEWAK
Gymnasium Berliner Schüler klagen gegen Diskriminierung VON JEANNETTE OTTO
85 Hochschule Erfolgreiche deutsche Unis werden sehr unterschiedlich geführt VON MARION SCHMIDT
Spezial: Wirtschaftsprüfer und
Unternehmensberater
86 Serbien Kann der junge Finanzminister das Land vor dem Bankrott retten?VON JUSTUS VON DANIELS
87 Bürogolf Wie Wirtschaftsprüfer versuchen, ihr Image zu verbessernVON CONSTANTIN WISSMANN
98 ZEIT DER LESER
RUBRIKEN2 Worte der Woche
28 Macher und Märkte
29 Quengelzone
38 Stimmt’s?/Erforscht & erfunden
50 Impressum
59 Finis/ »Berliner Canapés«
97 LESERBRIEFE
Nicht essen!Von diesen und den anderen Pilzen, die auf der Infografik-Seite gezeigt werden, sollte man unbedingt die Finger lassen: Sie enthalten Gifte. Mitunter reichen schon wenige Bissen, um den Löffel für immer abzugeben WISSEN SEITE 37
Vom Mecki zum MinisterVON JUSTUS VON DANIELS
Als Schüler gewann er sämtliche Wettbewerbe in Mathematik. Später studierte Lazar Krstić in Yale. Seit einem Monat ist der 29-jährige Unternehmensberater serbischer Finanzminister. Er soll das Land vor dem Bankrott retten CHANCEN SEITE 86
Illu
.: M
arie
Se
eb
erg
er
Foto
: E
astw
ay
IN DER ZEIT Titel: Im Dschungel der BücherEin Magazin zur Frankfurter Buchmesse
Foto
: Jim
Rak
ete
fü
r D
Z/
Ph
oto
sele
ctio
n
Foto
: T
ob
ias
Kru
se
No41ZEITnah
Anzeigen in dieser Ausgabe
Link-Tipps (Seite 26), Spielpläne (Seite 55), Museen und Galerien (Seite 38), Bildungsange-bote und Stellenmarkt (ab Seite 88)
Früher informiert!
Die aktuellen Themen der ZEITschon am Mittwoch im ZEIT-Brief, dem kostenlosen Newsletterwww.zeit.de/brief
Die so gekennzeichneten Artikel finden Sie als Audiodatei im »Premiumbereich« unter www.zeit.de/audio
Kultur purLesen Sie Auszüge aus den besten Büchern des Herbstes, und hören Sie rein in aktuelle Musikempfehlungen
www.zeit.de/apps

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
15
Begeisternde WutIn der Liga wird geschrien und getobt: Warum rasten Trainer aus, und wie denken die Betroffenen darüber? S. 20
Blutige Romantik Die Geburt des deutschen Nationalismus aus dem Geist der Befreiungskriege – eine Ausstellung in Dresden S. 18DOSSIER
Das Recht auf VergessenDer EU-Abgeordnete Jan Philipp Albrecht kämpft für mehr
Datenschutz in Europa. Erika Mann, Lobbyistin von
Facebook, will ihn daran hindern. In dem harten Machtspiel
geht es um die Frage: Wem gehören die Spuren, die wir im
Internet hinterlassen? VON MARTIN KOTYNEK UND ROBERT LEVINE
Während über Brüssel die Sommersonne scheint, hängt Jan Philipp Al-brecht müde auf dem Sofa in der Ecke seines Büros im achten Stock des Europaparlaments.
Vor ihm liegt sein Gesetz, zerteilt in viele Stapel Papier. Es ist eines der wichtigsten politischen Vorhaben der Europäischen Union. Und jetzt, Anfang Juni 2013, fürchtet Jan Philipp Albrecht, es könnte scheitern.
Seit anderthalb Jahren arbeitet der Grünen- Abgeordnete an dem Gesetz, das im juristischen Sinne eine Verordnung ist, die Europäische Datenschutz-verordnung. Das Parlament hatte ihn beauftragt, den Text dafür mit allen Fraktionen auszuhandeln, Wort für Wort. Eine einflussreiche Position, theoretisch.
Albrecht wollte verhindern, dass Algorithmen die Macht über unser Leben erlangen. Er wollte das beste Datenschutzgesetz der Welt schreiben. Aber jetzt beugt er sich über die Papierstapel und schimpft über »Scheißformulierungen«, die er in den Text schreiben muss. Diese ganzen Kompro-misse werden sein Gesetz verwässern.
Albrecht ist in einem Zwiespalt: Er muss über die Parteigrenzen hinweg möglichst viele Abgeord-nete des Europaparlaments überzeugen, für die Verordnung zu stimmen. Doch das schafft er nur, wenn er ihre Änderungswünsche berücksichtigt. Sie haben sehr viele Wünsche.
Vor allem einen Abschnitt soll er umschreiben: Artikel 17, das »Recht auf Vergessenwerden«. Es geht um die Frage, ob jeder Bürger selbst entscheiden kann, was im Internet über ihn gespeichert ist. Al-brecht will das Recht der Europäer stärken, Daten, die Unternehmen von ihnen gesammelt haben, lö-schen zu lassen: Adressen, Telefonnummern, Infor-mationen darüber, was jemand in eine Suchmaschine getippt oder bei einem Onlinehändler gekauft hat, wie er kommuniziert, reist – lebt. Jeder Mensch soll selbst über seine virtuelle Existenz bestimmen, nicht eine fremde Firma. Das ist Albrechts Ziel.
Abgeordnete aller Parteien haben den Artikel 17 jedoch mit mehr als hundert Änderungswün-schen bedacht.
Der 30-jährige Albrecht ist der jüngste deutsche Europaabgeordnete, ein schmaler Mann mit Fussel-bart. Er steht im Zentrum eines Machtkampfes, wie es ihn in dieser Härte in der Europäischen Union selten gegeben hat.
Seit dem Frühjahr verbringt Albrecht viel Zeit mit seinen Kollegen im Innenausschuss des Parla-ments. Er muss mit einer britischen Liberalen, ei-nem griechischen Sozialisten, einem britischen und einem deutschen Konservativen sowie einer deutschen Linkspolitikerin aushandeln, welche der Änderungswünsche sich am Ende in dem Text wiederfinden werden. Mehr als vierzig Treffen hat-ten sie bisher, aber sie haben sich noch immer nicht geeinigt.
Schon zweimal sollte das Europäische Parla-ment über einen Entwurf des neuen Regelwerks abstimmen. Zweimal musste der Termin verscho-ben werden. Wenn es nicht bald einen neuen gibt, wird es eng bis zur Europawahl im Mai 2014. Denn nachdem sich das Parlament auf einen Text festgelegt hat, muss es sich auch noch mit dem Ministerrat einigen, in dem die einzelnen Staaten vertreten sind. Erst dann kann die neue Verordnung in Kraft treten. Al-brecht läuft die Zeit davon.
Internetkonzerne dringen immer tiefer in die Privatsphäre der Men-schen ein. Sie beuten einen Rohstoff aus, mit dem sich Milliarden ver-dienen lassen: Daten. Wer im Netz unterwegs ist, hinterlässt digitale Spuren, egal, ob er mit seiner Kre-ditkarte einen Flug bucht, sich in einem Sozialen Netzwerk über Kin-dererziehung austauscht oder nach Informationen zum Thema Ho-möopathie sucht.
Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook sammeln solche Daten und verarbeiten sie zu Wissen über die Menschen, von denen sie stammen. Dieses Wissen lässt sich verkaufen – für Werbung im Internet, die auf einzelne Personen zugeschnitten ist.
Wer sich etwa im Netz über Hotels in Miami informiert, wird bald An-zeigen für Reisen nach Florida auf den Schirm gespielt bekommen. Und das ist die simple Variante. Was das Ge-schäft mit persönlichen Daten zu einem Milliardenmarkt macht, ist die Mög-lichkeit, Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenzusetzen – zu einem plastischen Abbild der Wirklichkeit.
Ist eine Frau schwanger, schaut sie sich vielleicht im Netz nach Kinderkrippen um. Kombiniert mit Daten aus Melderegistern und den Beiträgen der werdenden Mutter in einem Sozialen Netzwerk, ergibt sich das Profil einer künftigen Kleinfamilie. Soziale Stellung? Geschlecht des Ba-bys? Der Geburts termin? Manche Firmen, die mit digitalen Daten han-deln, wissen das alles.
Je mehr die Menschen ihnen ver-raten, desto besser für Konzerne wie Facebook oder Google. Ihr ganzes Ge-schäftsmodell ist auf personalisierter Werbung aufgebaut.
Facebook vermarktet Plätze für Anzeigen, die nur zu se-hen bekommt, wer häufig Frühstücksflocken für seine Kinder kauft oder sich wahrscheinlich dem nächst einen Klein-wagen anschaffen wird.
Google verfügt über Programme, die die Nachrichten aller 425 Millionen Kunden des E-Mail-Dienstes Gmail auf die Konsuminteres-sen des Schreibers hin durchsuchen. Auch wer in der Google-Such-maske nach einem Stich-wort sucht, bleibt dabei nicht unbeobachtet. In-zwischen arbeiten die Experten des Unterneh-mens angeblich an einer Art Überwa-chungsprogramm, das jedem Nutzer eine Nummer zuweist und seinen Weg durch das Netz verfolgt. Egal, ob per Smartphone, Laptop oder Tablet-Computer, Google wüsste dann im-mer, wer was gerade sucht.
Unter den Datenschürfern herrscht eine Stimmung wie zur Zeit des Gold-rausches. Der Umsatz des weltweiten Internetanzeigenmarkts stieg 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 16,2 Pro-
zent auf 99 Milliarden Dollar. In den USA verdient Google inzwischen mehr mit Werbung als sämtliche gedruckten Zeitungen und Zeitschriften zusammen.
Die Utopie mancher Datensammler ist es, ihren Rohstoff nicht nur für Marketing zu nutzen. Wenn etwa jemand im Netz nach Kliniken für die Behand-lung schwerer Depressionen sucht – wäre das nicht eine interessante Information für Anbieter von
Berufsunfähigkeitsversicherungen? In den USA werden bereits Verzeichnisse gehandelt, auf denen die Namen von Menschen stehen, die offenbar an einer bestimmten Krankheit leiden, zu 26 US-Cent pro Einzelschicksal. In Deutschland wollte im vergangenen Jahr die Wirtschaftsauskunftei Schufa auf Profile von Facebook und Twitter zugreifen, um die Kreditwürdigkeit der Bundesbürger besser beurteilen zu können. Erst nach Protesten rückte sie davon ab.
Die gesetzlichen Regeln für den Datenmarkt in Europa sind veraltet, sie stammen aus dem Jahr 1995 – ei-ner Zeit, als man sich noch mit tuten-den Modems ins Netz einwählte, als Google noch nicht existierte und der spätere Facebook-Gründer Mark Zuckerberg elf Jahre alt war. Unter Datenschutz verstand man damals den Schutz der Angestellten vor den Vorgesetzten und den der Bürger vor dem Staat.
Von Unternehmen und ihren Kunden war nicht die Rede. Es wa-ren, rückblickend betrachtet, einfache Zeiten.
Jan Philipp Albrecht ist nur ein Jahr älter als Zuckerberg. Wie der
trägt auch Albrecht bei der Arbeit gern T-Shirt, er verbirgt es jedoch unter einem abgenutzten Cordjackett.
In seiner Freizeit tourt Albrecht mit einem klapprigen VW-Bus aus dem Jahr 1969 durch Eu-ropa. Der Bus schafft nur 90 Kilometer pro Stun-de. Das ist Absicht, Albrecht will sich selbst aus-bremsen, damit ihn andere Fahrer überholen. Er will langsamer leben.
Was Albrecht nicht will, ist eine Zukunft, in der einzig das technisch Machbare die Geschwin-digkeit vorgibt, ungebremst durch Regeln aus der analogen Welt. Er spricht von staatlichen Behör-den, die schon heute Meldedaten zu Werbezwe-cken weitergäben, und von Internetfirmen, die
Unsummen mit dem Missbrauch von Nutzer-profilen verdienten. »Fast jedes Unternehmen und fast jede Behörde bricht die Datenschutzgesetze.«
Ein starker Vorwurf. Ihn zu belegen ist nicht leicht, da die derzeit gültigen, veralteten Regeln so unklar sind, dass niemand genau sagen kann, was erlaubt ist und was nicht. Es gibt in Europa kein einheitliches Gesetz zum Datenschutz, nur jene Richtlinie von 1995, die jedes Land in eigenes Recht gegossen hat.
Viele amerikanische Konzerne nutzen das aus: Sie gründen ihre Tochterfirmen in jenen europäi-schen Staaten, die ihrem Geschäftsmodell wenig entgegensetzen. So kommt es, dass die Einträge eines Deutschen auf Facebook nicht den deut-schen Regeln unterliegen. Sondern denen im Da-tenparadies Irland.
Dagegen kämpft Albrecht an. Er will, dass überall in Europa die gleichen, strengen Paragrafen gelten. »Auf der Straße gilt ja auch nicht das Recht des Stärkeren«, sagt er. Das Auto wurde erfunden, es setzte sich durch, dann wurden Vorschriften er-lassen, Stoppschilder aufgestellt. So sollte es auch beim Datenverkehr sein, findet Albrecht.
Er hat nichts dagegen, Spuren im Netz zu hin-terlassen, er ist sogar selbst auf Facebook. Al-brecht nutzt das Soziale Netzwerk, um sich als Politiker darzustellen. Auf den Fotos, die er hoch-lädt, sieht man ihn bei Demonstrationen, auf Reisen im Ausland.
Aber ihm gefällt nicht, dass Internetkonzerne solche Daten verarbeiten oder weitergeben, zum Beispiel an Werbefirmen oder Versicherungen. Sie sollten ausdrücklich um Einverständnis bitten müssen, findet er. Nutzungsbedingungen, die heu-te fast jeder ungelesen akzeptiert, sollten verständ-licher werden. Und jeder, der mal ein Foto von sich ins Netz gestellt hat, sollte es wieder löschen können, falls dieser Wunsch nicht die Meinungs-freiheit anderer Menschen berühre – etwa eines Bloggers, der das Bild verbreitet und darauf hin-weist, dass es einen Politiker im Gespräch mit ei-nem Lobbyisten zeigt.
Dies sind einige der wichtigsten Verkehrsre-geln, mit denen Albrecht die Machtverhältnisse im Netz in die Balance bringen will. Firmen, die sich nicht daran halten, sollen zu Strafen von bis zu zwei Prozent ihres Jahresumsatzes verurteilt wer-den können.
Serie:
Denn sie wissen, was du tust (1)
Oft ohne es zu merken, verwandeln wir unser Leben in Daten. Wir lesen und telefonieren digital, treffen Freunde im Netz, gehen online einkaufen. Jede dieser Bewegungen erzeugt einen digitalen Abdruck, der von Firmen und Behörden analysiert und gespeichert wird. Stück für Stück löst sich so unsere Privatsphäre auf. Wollen wir das? Beginn einer ZEIT-Serie aus der Welt der Daten.
»Statt das ungewollte Verbreiten meiner Daten zu verhindern, verkauft Facebook sie zu Werbe-zwecken«
Jan Philipp Albrecht, Europaabgeordneter der Grünen
»Wenn jemand Ihre Party-fotos woanders veröffent-licht – wie soll Facebook dafür sorgen, dass sie dort gelöscht werden?«
Erika Mann, Chefin des Lobbybüros von Facebook in Brüssel
Das größte Soziale Netzwerk weiß viel über seine rund eine Milliarde Nutzer. Ein Werbekunde will
jene unter ihnen ansprechen, die demnächst einen Kleinwagen kaufen wollen? Facebook hat die
entsprechenden Profile im Angebot
Das Unternehmen späht unsere Wege im Netz so genau wie möglich
aus: was wir kaufen und wissen wollen – wie wir leben. Die
Belohnung: Google dominiert das 100-Milliarden-Dollar-Geschäft mit
der Onlinewerbung
Fortsetzung auf S. 16
Amazon handelt nicht nur mit Waren. Aus dem Sammeln von Konsummustern der Online-
käufer hat das Unternehmen ein Geschäft entwickelt, die Analyse von Datenmengen. Möglicher Kunde unter anderem: die CIA
Mit WhatsApp verschicken Millionen Deutsche Textnachrichten, Fotos
und Videos. Das kostet nichts und hat trotzdem seinen Preis: WhatsApp
saugt die Adressbücher seiner Nutzer leer und überträgt die
Daten an Server in den USA
Illu
stra
tio
n:
Ste
ph
en
-Jo
hn
Sw
ierc
zyn
a fü
r D
IE Z
EIT
/w
ww
.cae
pse
le.d
e;
Foto
s: J
ako
b B
örn
er
für
DIE
ZE
IT/
ww
w.jak
ob
bo
ern
er.
de

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4116 DOSSIER
Albrecht legt sich mit den Giganten des Inter-nets an, mit Amazon, Google, Facebook.
An einem Sonntagnachmittag im Juni, als sich bereits abzeichnet, dass Albrecht festhängt mit sei-nem Textentwurf, dass das Europaparlament also vor der Sommerpause nicht mehr über das neue Gesetz abstimmen wird, da besteigt Erika Mann gut gelaunt den Schnellzug von Brüssel nach Paris.
Am nächsten Tag muss sie bei einem Treffen der Internationalen Handelskammer sein, es geht um die weltweite Vergabe von Internetadressen. Auf dem Weg in die erste Klasse zieht sie ihr Roll-köfferchen hinter sich her, unter ihrem Arm klemmt ein Stapel Papier. Erika Mann ist 62 Jahre
alt und trotz ihres unauffälligen Hosenanzugs eine präsente Erscheinung. Das Zugpersonal hält ihr wie selbstverständlich die Abteiltüren auf.
Erika Mann ist Facebooks oberste Lobbyistin in Europa. Sie ist Mark Zuckerbergs Vertreterin in Brüssel. Dass Albrechts Gesetz immer noch nicht fertig ist, liegt auch an ihr.
Mann war 15 Jahre lang SPD-Abgeordnete im Europaparlament. Sie hat sich damals vor allem mit Telekommunikationsgesetzen und Technolo-giefragen beschäftigt sowie mit der Handelspolitik zwischen Europa und den USA – »Erika Miss America«, das war ihr Spitzname bei den Kollegen. Mann kennt sich aus in der Brüsseler Bürokratie. Auf ihrer Visitenkarte steht »politisches Tier«.
Am Abend nach der Zugfahrt sitzt Mann in einem Restaurant am Pariser Gare du Nord und spricht über ihre Lobbyarbeit und ihre positive Haltung zum Datensammeln. Sie weicht keiner Frage aus und antwortet ohne lange Pausen in druckreifen Sätzen, das Gespräch dauert mehrere Stunden.
»Die Menschen haben heute kein Problem da-mit, mehr von sich preiszugeben, sie sind offener.« Dieser Satz stammt nicht von Erika Mann, son-dern von Mark Zuckerberg. Der Gründer von Fa-cebook hält Privatheit für ein Auslaufmodell. Wenn es aber um Politik geht, setzt sein Unterneh-men eher auf Verschlossenheit: Kaum etwas von dem, was Erika Mann im Gespräch sagt und die ZEIT veröffentlichen will, geben die Facebook-Presseleute später als Zitat frei.
Erika Mann arbeitet seit November 2011 für Zuckerberg. Facebook brauchte damals dringend eine Lobbyistin in Brüssel, es zeichnete sich bereits ab, dass Europa neue und einheitliche Regeln für den Datenschutz bekommen würde. Die kompli-zierte Brüsseler Maschinerie war angesprungen: Die Europäische Kommission diskutierte über ein Konzept für das neue Regelwerk. Auf Basis dieser Skizze würde sich dann das Parlament auf einen Gesetzestext einigen.
Als Erika Mann ihren ersten Arbeitstag bei Face-book hat, ist das Konzept der EU-Kommission schon in Arbeit. Rund zwei Monate später, am 25. Januar 2012, stellt es die Justizkommissarin Viviane Reding der Öffentlichkeit vor. Während Reding ans Mikro-fon tritt, hinter sich die blaue Europafahne mit den zwölf gelben Sternen, sitzt Erika Mann in ihrem neuen Büro und verfolgt die Pressekonferenz der Kommissarin am Computerschirm.
»Ladies and Gentlemen«, sagt Reding, »we have done it.« Dann verkündet sie, dass der EU- Kommission eine umfassende Reform des Daten-schutzes vorschwebe. 72 Prozent der Europäer, sagt Reding, fürchteten den Missbrauch und Wei-terverkauf ihrer persönlichen Daten. »Die Bürger sind sehr besorgt.«
Die Hände der EU-Kommissarin ziehen an diesem Tag viele klare Linien durch die Luft. Re-ding spricht über das Recht auf Vergessenwerden, sie sagt: »Persönliche Daten gehören der Person.« Mehrere Male wiederholt sie diesen Satz. Es hört sich an, als sei alles sehr einfach.
In Redings Konzept steht es so: »Die betroffene Person hat das Recht, die Löschung von sie betref-
fenden personenbezogenen Daten zu verlangen, speziell wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, die die betroffene Person im Kindesalter öffentlich gemacht hat.« Das bedeutet: Schreibt zum Beispiel ein Zwölfjähriger in einem Sozialen Netzwerk, dass er am Computer gerne mit Ego-Shootern herumballert, muss das Netzwerk diesen Beitrag auf Verlangen entfernen. In der extremen Auslegung des Satzes müsste das Soziale Netzwerk sogar mit dafür sorgen, dass der Beitrag aus dem gesamten digitalen Kreislauf verschwindet – also von allen fremden Websites, die ihn ungefragt übernommen haben.
Nach der Pressekonferenz hat Erika Mann viel zu tun, so wie Hunderte andere Internet-Lobbyis-ten in Brüssel. Das Parlament wird bald einen Be-richterstatter bestimmen, der den konkreten Text der neuen Verordnung entwickeln soll: Jan Philipp Albrecht, der sich schon länger mit dem Thema
Datenschutz beschäftigt. Sein Vorschlag wird Manns Zielscheibe sein. Ihre Aufgabe ist es, Pfeile darauf abzuschießen, mithilfe der Abgeordneten.
Nun zeigt sich, wie wertvoll Erika Mann für Facebook ist. Sie kennt viele Parlamentarier noch als frühere Kollegen, sie weiß, wer von ihnen sich für Technik interessiert, wer für die Argumente von Facebook empfänglich sein könnte. Mit sol-chen Abgeordneten trifft sich Mann, mit einigen von ihnen mehrere Male. Sie sollen es für nötig halten, Albrechts Gesetz an den entscheidenden Stellen mit Änderungsanträgen zu attackieren.
Das Büro von Facebook liegt am Brüsseler Schuman-Kreisel, gleich neben der Europäischen Kommission und dem Ministerrat. Die Juristen des Unternehmens arbeiten nun das Kommis-sionskonzept durch, das Facebook das Geschäft mit dem Rohstoff Daten künftig erschweren könnte. Erika Mann berät sich in Videokonfe-renzen mit Kollegen in anderen Ländern. »Was bedeutet der Vorschlag der Kommission für Face-book?«, fragt Mann. »Was gefällt uns? Was ist pro-blematisch?« Ihre Leute schreiben ein Papier, das Mann später benutzen wird, um den EU-Abgeord-neten ihre Position zu verdeutlichen.
Firmen wie Facebook sollen vor der Weiter-gabe von Daten um Einverständnis bitten? »Das birgt das Risiko, Nutzer mit Checkboxen und Warnmeldungen zu überschwemmen«, steht in dem Papier.
Strafzahlung von zwei Prozent des weltweiten Umsatzes? Dadurch wer-de »der Anreiz für Internetfirmen, in der EU zu investieren, untergraben«.
Recht auf Vergessenwerden? Auch hier sieht Facebook Probleme. Die Pressestelle gibt dazu folgenden Satz von Erika Mann zum Zitieren frei: »Wenn einer Ihrer Freunde Ihre Par-tyfotos aus Facebook kopiert und auf einer anderen Webseite veröffent-licht – wie soll Facebook dafür sor-gen können, dass sie auch dort ge-löscht werden?«
Erika Mann und Jan Phillip Al-brecht kannten sich schon, als Mann noch Politikerin war. Sie nennt ihn einen »klugen Kopf«, er schätzt ihre Erfahrung. Beide mach-ten für die Europawahl 2009 im selben Bundesland Wahlkampf, in Niedersachsen. Dort steht Manns Wohnhaus, dort hat Albrecht als Jugendlicher gegen das Atommüll-lager Asse demonstriert.
Albrecht wurde 2009 erstmals ins EU-Parlament gewählt, Erika Mann verlor nach 15 Jahren ihren Sitz. Nicht alle in der SPD-Fraktion bedauerten das. Mann galt zwar als fleißig, aber vielen in der SPD war sie zu nah an der Industrie – sie habe intern für die Kernenergie gestritten, heißt es, und für möglichst harmlose Regeln beim Klimaschutz. Am Ende setzte ihre Partei sie für die Europawahl auf einen hinteren Listenplatz. 23 Abgeordnete zogen für die SPD ins EU-Parlament ein; Mann stand auf Platz 24. Es
war das Ende ihrer politischen Karriere. Erika Mann brauchte einen Plan B.
Sie sagt, sie erinnere sich nicht, wie genau sie zu dem Job bei Facebook gekommen sei. Über die alte Zeit redet sie nicht. Aber das Internet, das nichts vergisst, erinnert sich an ihre Vergangenheit. Demnach hat Mann schon während ihrer Zeit als Abgeordnete enge Kontakte zu Internetfirmen ge-pflegt. Sie gehört zu den Gründern der European Internet Foundation, die Abgeordnete mit In-dustrievertretern zusammenbringt. Dass sie nach der verpatzten Wahl zunächst für einen ameri-kanischen IT-Verband in Brüssel zu arbeiten be-gann und danach für Facebook, brachte ihr heftige Kritik ein.
Mann sagt: »Ich bin ein Zukunftsmensch, ich mag den Fortschritt.« Auch privat hat sie ständig mit Facebook zu tun. Mann ist kunstinteressiert. Sie nutzt Facebook, um überall auf der Welt Künstler und Galerien zu suchen. Gerade stellt sie eine Liste von Künstlern in Buenos Aires zusam-men, die sie im Herbst auf einer Reise besuchen will. In Manns Augen sind neue Erfindungen eine Chance, kein Risiko. Albrechts Sorge kann sie nicht nachvollziehen.
Jan Philipp Albrecht und Erika Mann – beide versuchen sie vom Frühjahr 2012 an, ihrer Sache zum Sieg zu verhelfen. Albrecht ist inzwischen zum Berichterstatter des EU-Parlaments ernannt worden und schreibt am Text der Verordnung, Erika Mann arbeitet daran, die Sicht von Facebook in die Öffentlichkeit zu tragen. Bei Diskussions-veranstaltungen meldet sich eine ihrer Mitarbeite-rinnen aus dem Publikum zu Wort. Mann selbst trifft sich mit Abgeordneten, um ihnen zu erklä-ren, wie harmlos Facebook sei.
Am 10. Januar 2013 stellt Albrecht seinen Textentwurf der Presse vor. Weniger glamourös als die Kommissarin im Jahr zuvor, in einem schmucklosen Sitzungssaal. Den Artikel 17, das Recht auf Vergessenwerden, hat er an acht Stellen geändert. Albrecht hat die Verordnung noch schärfer gemacht.
Er will vermeiden, dass Schlupflöcher entste-hen. Das Recht auf Löschung müsse für alle gel-ten, findet Albrecht – also nicht nur »speziell wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, die die betroffene Person im Kindesalter öffentlich gemacht hat«. Diesen Nebensatz der Kommissarin hat Albrecht gestrichen. Man könnte ihn so aus-legen, als gälten für die Daten von Erwachsenen weniger strenge Regeln.
Albrecht hat in das Gesetz eine Passage hinein-geschrieben, die schon in einer unveröffentlichten Fassung des Kommissionskonzepts stand – und auf Druck der amerikanischen Regierung vor Re-dings Pressekonferenz gelöscht worden war. Es ist Artikel 42. Er soll Unternehmen verbieten, per-sönliche Daten aus Europa an Behörden etwa in den USA weiterzugeben.
Als Albrecht den Artikel 42 wieder in das Ge-setz einfügt, weiß er noch nichts von einem Mann namens Edward Snowden. Erst Monate später, im Juni, wird die Welt durch die Enthüllungen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters erfahren, wie un-gebremst der amerikanische Geheimdienst auf die Daten europäischer Bürger zugreift.
Albrecht ahnt, dass Artikel 42 einmal wichtig werden könnte. Was er nicht ahnt, ist, mit welcher Wucht ihn der Protest der Wirtschaft treffen wird.
In seinem Büro braucht Albrecht nur wahllos Dokumente von der Fensterbank zu klauben, schon hat er Beschwerdebriefe in der Hand – von namhaften Unternehmen und Verbänden wie dem Bundesverband der Deut-schen Industrie und der deutschen Industrie- und Handelskammer, von IBM und der Schufa. Ständig erreichen Albrecht Anfragen von Lobbyisten, die ihn dringend spre-chen wollen.
Zwischen Frühjahr 2012 und Frühjahr 2013 treffen sich Albrecht und seine Mitarbeiter mit mehr als 200 Interessenvertretern – unter an-derem von Adobe, Allianz, Amazon, Bertelsmann, eBay, Facebook, Mi-
crosoft, SAP, Samsung, Siemens, Sony und der Telekom. Werbefirmen fürchten darum, ihr Geschäft an Konkur-renten aus den USA zu verlieren. Kleinunter-nehmer haben Angst vor hohen Kosten, weil für sie dieselben Regeln gelten sollen wie für die reichen Internetkonzer-ne. Anwaltskanzleien, Verlage, Gewerkschaf-ten – alle bringen sie Einwände gegen das Gesetz vor, alle bestürmen sie Jan Philipp Albrecht.
Bald kritisieren manche Lobbyis-ten sogar Teile des Gesetzes-vorschlags, die gar nicht neu, son-dern schon in der Richtlinie aus dem Jahr 1995 festgeschrieben sind. Al-brecht glaubt: Die Unternehmen wollen die Gelegenheit nutzen, um den Standard des Datenschutzes noch unter den der bestehenden Re-geln zu senken.
Eigentlich wollte Albrecht die Bürger schützen. Nun will ihm scheinbar jeder einreden, dass dieser Schutz eine Gefahr bedeutet.
Albrecht sehnt sich nach Entspannung. In Ge-danken plant er seinen Sommerurlaub. Mit seiner Frau will er zu seinen Großeltern nach Südfrank-reich fahren, 1500 Kilometer in dem klapprigen VW-Bus, der mit riesigen Comics von Tim und Struppi bemalt ist. Der Bus muss die Reise über-
stehen, deshalb lässt sich Albrecht an einem Sams-tagmorgen im Frühjahr 2013 vom Navigations-system seines Handys quer durch Hamburg in die Werkstatt leiten – ein Dienst von Google Maps. Während der Fahrt kommen alle paar Minuten SMS und E-Mails herein. Vergiss nicht diesen Ter-min, schick mir noch deinen Vorschlag, bringst du Eierlikör mit? Am frühen Morgen hat Albrecht bereits seine Motorbootprüfung gemacht, später muss er in Berlin bei den Grünen eine Rede hal-ten. Er ist Wochen im Voraus verplant. Ein lang-sames Leben – auch für Albrecht ist das mehr Wunsch als Realität.
Albrecht fürchtet sich nicht vor der Zukunft, doch er fürchtet eine Welt, in der Konzerne über unser aller Schicksal bestimmen. Albrecht will, dass der Film Minority Report, in dem Menschen für Verbrechen eingesperrt werden, die sie in Zu-kunft begehen könnten, Science-Fiction bleibt. Darum, sagt Albrecht, müsse verhindert werden, dass Algorithmen Menschen in Risikoklassen ein-teilen, dass Benachteiligte von Rechenprozessen ausgeforscht und stigmatisiert, dass die Ängste der Leute ignoriert würden, so wie beim maroden Atommülllager Asse. Albrecht sieht das Selbst-bestimmungsrecht in Gefahr.
Albrecht ist gut darin, sich in Rage zu reden und ein düsteres Bild von der Zukunft zu zeichnen. Auf einer Fahrt in seinem VW-Bus durch Hamburg kann einem fast angst und bange werden.
Albrecht ist aber auch Jurist, er weiß, dass in diesem Streit schlicht zwei gegensätzliche Rechts-anschauungen aufeinanderprallen. Für einen Deut-schen wie ihn ist der Datenschutz ein Grundrecht. 1983 hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur Volkszählung das Konzept der »informa-tionellen Selbstbestimmung« entwickelt. Es soll den Menschen die Kontrolle darüber geben, welche ihrer persönlichen Daten weitergegeben werden dürfen. Die deutschen Datenschutz bestimmungen gehören zu den strengsten in Europa.
Für Briten und Amerikaner ist das nicht leicht zu verstehen. Das deutsche Verfassungsgericht lei-tet die »Selbstbestimmung« aus dem Artikel 1 des Grundgesetzes, der Menschenwürde, sowie dem Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung ab – Letzteres lässt sich nicht einmal ins Englische über-setzen. Die Formulierung freedom of personality development klingt in den Ohren eines Angloame-rikaners eher nach Esoterik als nach Recht.
Amerikaner, auch die digital natives im Haupt-quartier von Erika Manns Arbeitgeber Facebook, sehen im Schutz persönlicher Daten kein Grund-recht. In den USA gibt es lediglich ein ein-geschränktes Recht auf Privatsphäre, das zudem nur der Staat zu respektieren hat: »Privacy«, das Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden, schützt Amerikaner vor der Durchsuchung ihres Hauses oder ihres Autos – zum Beispiel durch die Polizei. Es schützt sie nicht vor den Geschäftsinteressen eines Unternehmens. Erlaubt ist alles, wofür sich die Wirtschaft vom Kunden die Zustimmung ge-holt hat.
Es sind diese grundlegenden Unterschiede, wel-che die Giganten des Internets gegen Albrechts Gesetz aufgebracht haben.
Erika Mann verhält sich in diesem Kampf sehr geschmeidig. Sie setzt scheinbar auf Transparenz: Während Unternehmen wie die Deutsche Bank jahrelang nicht im Lobbyregister der Europäi-schen Union zu finden waren, ist Facebook dort längst registriert. Mann achtet penibel darauf, nicht wie eine Fundamentalistin zu wirken. Sie
lobt, dass die Reformer Wachstum und Beschäftigung in Europa för-dern wollen. Offenbar ist das ihre Strategie: Sie gibt sich als grund-sätzliche Befürworterin des neuen Gesetzes aus, aber in den entschei-denden Punkten lehnt sie es ab – dort, wo es das Geschäftsmodell von Facebook beeinträchtigen könnte.
Mann war lange genug Politike-rin, um zu wissen, dass Parlamenta-rier sich nicht als Handlanger von Großkonzernen fühlen wollen. Ab-geordnete verschiedener Fraktionen bezeichnen sie als wenig aggressiv; von den Lobbyisten der Zigaretten-industrie und der Energieunterneh-men sind sie anderes gewöhnt. Facebook, sagt ein konservativer Ab-geordneter, spiele keine große Rolle in Brüssel.
Er irrt sich. Er hat die Strategie der US-Konzerne nicht durchschaut.
In den vergangenen Jahren sind in Brüssel neuartige Organisationen wie das Center for Democracy and Technology und die European Pri-vacy Association entstanden, die von Unternehmen wie Google, Face-
book, Microsoft und Yahoo mitfinanziert werden. Sie organisieren Konferenzen, geben Studien he-raus und laden Parlamentarier zum Frühstück ein. Sie gerieren sich als Vertreter des Volkes, als so-genannte Graswurzelbewegungen, die im Interesse der Zivilgesellschaft handeln. In Wahrheit handelt es sich eher um Kunstrasenbewegungen: In Wa-shington hat man dieser Lobbytechnik den Namen »Astroturf« gegeben. Die Bezeichnung stammt von einer Marke für künstliches Gras, das im Sta-dion des texanischen Baseballteams Houston As-tros verwendet wird.
Auch wegen dieser sehr amerikanischen Lobby-strategie geschieht etwas, das bislang ohne Beispiel in der Geschichte der EU ist: Zu Albrechts Gesetz reichen Abgeordnete mehr als 4000 Änderungs-anträge ein, so viele wie wohl nie zuvor. Oft ist die Handschrift der Interessenvertreter erkennbar, manche Abgeordnete geben die Wünsche von Amazon, eBay und der amerikanischen Handels-kammer eins zu eins wieder.
Die PolitikerinDie 62-Jährige war lange Abgeordnete im Europa-parlament, sie kennt die Abläufe in Brüssel. Ihr Wissen und ihre Kontakte helfen ihr heute.
Die LobbyistinSeit 2011 versucht »Erika Miss America« im Auftrag von Facebook, strengere Regeln für den Daten-schutz in Europa zu verhindern. Ihre Strategie dabei: Sie begrüßt das neue Gesetz im Grundsatz – lehnt es aber in den entscheiden-den Punkten ab.
Erika Mann
Das Recht auf Vergessen
Fortsetzung von S. 15
»Die Men-schen haben kein Problem damit, mehr von sich preis-zugeben, sie sind offener«
Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook, über Privatheit heute
»Der Schutz der Daten muss gewähr-leistet sein. Es braucht eine einheitliche europäische Regelung«
Angela Merkel am 14. Juli 2013 nach den Snowden-Enthüllungen

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 DOSSIER 17
In kurzer Zeit ist die amerikanische IT-Indus-trie zu einer der größten Lobbyisten-Gruppen in Brüssel geworden. Die vielen Millionen Euro, die sie im Kampf gegen die Reform des Datenschutzes ausgegeben hat, zahlen sich nun aus.
Viele Abgeordnete wollen Albrechts Vorschlag in weiten Teilen umschreiben. Vor allem Artikel 17, das Recht auf Vergessenwerden.
Der deutsche Christdemokrat Axel Voss zum Beispiel will all jene persönlichen Daten vor der Löschpflicht bewahren, die zur »Feststellung der Identität oder zur Bestimmung der Bonität« ge-speichert wurden. Seine finnische Fraktionskol-legin Sari Essayah will staatliche Behörden aus-klammern. Baroness Sarah Ludford, britische Abgeordnete der Liberaldemokraten, will das Recht auf Vergessenwerden nur »gegebenenfalls« billigen. Und der deutsche FDP-Abgeordnete Alexander Alvaro will den Begriff »Recht auf Vergessenwerden« sogar komplett aus dem Ge-setz streichen.
Albrechts Büro kommt bald an seine Grenzen. Wochenlang sitzen er und seine Leute bis tief in die Nacht an den Schreibtischen und versuchen, die Flut der Anträge zu bewältigen. Unmöglich, den ersten Abstimmungstermin im April zu hal-ten. Er wird auf Mai verlegt.
Im Mai hat Albrecht den Gesetzentwurf noch immer nicht fertig. Der Onlinezeitung EUobser-ver gibt er ein zorniges Interview, in dem er den Lobbyisten die Schuld daran gibt, dass sein Gesetz inzwischen fast schwächer ist als die gültige Richt-linie aus dem Jahr 1995. Das Interview ist ein Hilferuf an die Öffentlichkeit. Albrecht braucht Verbündete.
Im Juni arbeitet er immer noch Änderungs-anträge ab. Wieder wird der Abstimmungstermin verschoben. Jetzt ist von Juli die Rede. Wenn sich das Parlament nicht bald auf einen gemeinsamen Vorschlag einigt und diesen anschließend mit dem Ministerrat abstimmt, bleibt den Juristen, die das Gesetz noch prüfen müssen, und den Übersetzern, die es in die 24 Amtssprachen der EU übersetzen müssen, nicht genügend Zeit. Es könnte dann sein, dass das Gesetz vor den Europawahlen im Mai 2014 nicht fertig wird, ein strengerer Daten-schutz für Europa wäre auf lange Sicht verschoben. Albrechts Mitarbeiter sind nervös, wochenlang lassen sie alles andere liegen.
In Reaktion auf den Zeitdruck müsste Al-brecht darum kämpfen, die führenden EU-Parla-mentarier aller Fraktionen für sein Gesetz zu ge-winnen. Einige prominente Abgeordnete müssten sich für Albrechts Sache starkmachen, das würde ihm helfen.
Doch Albrecht schafft es nicht, das Interesse an seinem Gesetz zu wecken, die Bedeutung zu er-klären. Er verzettelt sich und verhandelt weiter über einzelne Formulierungen. Er merkt nicht, dass er mit seiner detailversessenen Art viele gegen sich aufbringt.
Wenige Wochen vor der geplanten Abstim-mung kommt es zum Eklat zwischen ihm und seiner Kollegin aus dem Innenausschuss, Baroness Sarah Ludford. Sie wirft ihm öffentlich vor, dass er es nicht geschafft habe, die Meinungen der Ab-geordneten in die Verordnung einfließen zu lassen, dass seine Formulierungen oft schwer zu verstehen seien, dass man schlecht mit ihm arbeiten könne.
Auch der Juli-Termin verstreicht. Jetzt ist von Oktober die Rede. Albrecht fährt erschöpft in den Urlaub.
Und dann, plötzlich und unerwartet, ein Hoffnungsschimmer. Es geschieht etwas, das Al-brecht in seinen schlimmsten Erwartungen be-stätigt und ihm gleichzeitig neuen Mut macht. Die Abhöraktionen der NSA lösen weltweit Er-schrecken aus, die Medien entdecken das Thema Datenschutz. Am 14. Juli sagt Angela Merkel im Fernsehen: »Wir brauchen eine einheitliche euro-päische Regelung.«
Das ist eine völlig neue Haltung der Bundes-kanzlerin, die sich bislang kaum für Albrechts Reform interessiert hat. Die Brüsseler Vertreter der Bundesregierung, so berichten Beobachter, haben den Gesetzgebungsprozess immer wieder verzögert, haben immer neue Fragen gestellt, Vor-behalte angemeldet. Der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) sagte, die Internet-konzerne sollten sich selbst kontrollieren – »regu-lierte Selbstregulierung« nannte er seine Idee. Und nun diese Wendung. Das hätte sich der Grü-ne Albrecht kaum träumen lassen: dass seine Hoffnungen einmal auf einer CDU-Kanzlerinruhen würden.
Nach seinem Urlaub geht Albrecht wieder ins Brüsseler Parlamentsgebäude, und auf einmal ist alles anders.
Plötzlich unterhalten sich Abgeordnete und Mitarbeiter auf den Fluren über Datenschutz. Die Parlamentarier leiten eine Untersuchung ein, um den NSA-Skandal aufzuklären. Und, Albrecht kann es kaum glauben: Endlich haben die Fraktio-nen einen festen Abstimmungstermin für sein Gesetz zugesagt, den 21. Oktober. Ein paar Tage später sollen, auch auf Betreiben der deutschen Bundeskanzlerin, die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen in Brüssel über dieses Thema reden, das nun plötzlich wichtig ist. Es sieht so aus, als könnten sich das Parlament und die Mit-
gliedstaaten der EU wirklich auf eine Reform des Datenschutzes einigen.
Noch sind viele Details offen. Bis kurz vor der Abstimmung wird Albrecht mit seinen Kollegen um einzelne Formulierungen und Artikel ringen, er steht weiter unter dem Druck der Industrie. Aber für den Artikel 42, der die Daten der Europä-er vor dem Zugriff ausländischer Geheimdienste schützen soll, scheint sich jetzt eine Mehrheit ab-zuzeichnen. Albrecht ist optimistisch, dass er auch das Recht auf Vergessenwerden im Gesetz unter-bringen kann.
Vielleicht werden Facebook und andere Inter-netkonzerne also in Zukunft hohe Strafen zahlen müssen, wenn sie das Recht der Europäer auf Schutz ihrer Daten verletzen.
Falls es so kommt, hätte Erika Mann verloren. Und Jan Philipp Albrecht hätte einen utopischen Gedanken in einen Gesetzesvorschlag für Europa
verwandelt: die Idee, dass jeder Bürger selbst darü-ber bestimmen soll, welche digitale Existenz er führen möchte.
Unterdessen haben Google und Facebook neue Geschäftszahlen bekannt gegeben. Google konnte im zweiten Quartal 2013 seinen Umsatz im Ver-gleich zum Vorjahr um 19 Prozent steigern, Face-book sogar um 53 Prozent. Das Geschäft mit den Daten läuft weiterhin prächtig.
Mitarbeit: CLAAS TATJE
Der IdealistDer Abgeordnete der Grünen im Europaparlament, 30 Jahre alt, fährt gern mit dem VW-Bus durch Europa. Er träumt von einem langsameren Leben.
Der PolitikerAlbrecht legt sich mit den Giganten des Inter-nets an, mit Google, Amazon, Facebook. Er will ihr Geschäft erschweren: das Sammeln von Daten.
Jan Philipp Albrecht
Foto
s (S
. 1
6+
17
): J
ako
b B
örn
er
für
DIE
ZE
IT/
ww
w.jak
ob
bo
ern
er.
de
; k
l. B
ilde
r (S
. 1
6):
Re
fle
x M
ed
ia;
Pu
blic
Ad
dre
ss (
Me
rke
l)
Im Ressort Politik: Können Daten Wahlen entscheiden?
Nächste Folge

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
18GESCHICHTE
ZEITLÄUFTE
SCHAUPLATZ: MÜHLHAUSEN
Bitterste Klage dringt aus Hamburgs viel be-sungener HafenCity. Der Wind! Der Wind habe dort mal wieder allen den Sommer ver-dorben. Überall ziehe und pfeife es, Plätze und Promenaden seien völlig ungenießbar. Eine unwirtliche Fehlkonstruktion, diese ganze HafenCity, welch ein Jammer.
Welch ein Jammer, wenn man bedenkt, wie viele Hundert Akademien es gibt für Architek-tur und Städtebau und Institute für Urbanistik und wie viele Unter- und Oberbaudirektoren und International Schools of Irgendwas! Und dann vergessen sie die einfachsten Regeln, die schon Vitruv in seiner Baukunst (1. Jahrhun-dert vor Christus) nennt. I. Buch, Kapitel 6: Wie man eine Stadt vor Winden schützt.
Doch Architektur zum Augenreiben gibt es auch in Bonn. Dort bauen Berliner Architek ten jetzt ein drittes Hochhaus in der Rheinaue, auf dass Bonns weltwunderbares Rheinpanorama, das schon unter dem Abgeordnetenhochhaus von 1969 und dem Post Tower von 2002 zu leiden hat, endgültig vernichtet wird. Aber dies war wohl der geheime, ausgleichende Sinn des sogenannten Hauptstadtvertrags: Berlin wird so provinziell wie Bonn und Bonn so hässlich wie Berlin. B.E.
Das (religiöse) Leben in Deutschland am Vor-abend der Reformation – das ist Thema einer ambitionierten Ausstellung des Museums am Lindenbühl in der alten thüringischenReichsstadt Mühlhausen. Dreihundert zum Teil noch nie gezeigte Bilder und Skulpturen, Alltagsgegenstände und Kultgeräte aus vielen deutschen Sammlungen entfalten ein Pano-rama des städtischen und stiftischen Deutsch-lands zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Es geht um Wunderglauben und Wallfahrten, um Bibeldruck und Prozessionen, Bruderschaften und Humanisten und um die Pfarrkirche als »Ort eines alle Lebensbereiche umfassenden Heilsangebots« – bis hin zum guten Tod. Und natürlich um den Ablass.
Neben Meisterwerken der sakralen Kunst haben die Kuratoren mit viel Liebe Dinge und Szenen des täglichen Lebens, Liebens und Lernens zusammengetragen. Dazu ge-hört, unsere Abbildung oben, auch ein ge-schnitztes Ziergitter, das ursprünglich wohl aus der Nikolaikirche in Zerbst stammt. Ein Figurenpaar inmitten des goldenen Gerankes zeigt einen Schulmeister im Talar, der mit dem Rutenbündel seinen Schüler züchtigt. Schwarze Pädagogik. Aber daran hat Luther ja leider nichts geändert. EZ
»Umsonst ist der Tod. Alltag und Frömmigkeit am Vorabend der Reformation«, bis 14. April 2014, Museum am Lindenbühl, Mühlhausen/Thür., Kristanplatz 7; Tel. 03601/856 60
Wunder und AblassWie fromm war Deutschland am Vorabend der Reformation?
Deutschland baut
er romantische Weg nach innen führte mitunter in den Abgrund der Gewalt. »Und wenn sie winselnd auf den Knien liegen, / Und zitternd Gnade schrein, / Laßt nicht des Mitleids feige
Stimme siegen, / Stoßt ohn’ Erbarmen drein!«, dichtet der Romantiker Theo-
dor Körner zur Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon. Unverhohlen verachtet er das Mitleid als ein Gefühl der Schwäche, das es im Dienste nationaler Ziele zu suspendieren gelte: Körner predigt eine Moral der Erbarmungslosig-keit; er erklärt den Kampf gegen die Franzosen zum Vernichtungskrieg.
Das Militärhistorische Museum in Dresden hat dafür mit dem Titel seiner Ausstellung zur Leipziger Völkerschlacht 1813 einen so drastischen wie treffenden Begriff gefunden: Blutige Roman-tik. Das Museumsplakat zeigt ein blutbespritztes Eichenblatt. Der Traum vom teutschen Vaterland gebiert Verwüstung und Tod. Oder illustriert das Bild die Sicht der national gesinnten Zeitgenos-sen? Blutet hier das Eichenblatt, von einer – fran-zösischen – Kugel durchschossen?
Wer die Ausstellung betritt, dem eröffnet sich noch eine dritte Lesart: Auf dem Fußboden sind die Schlachten der Napoleonischen Kriege auf-gelistet, jeweils mit der Zahl der Opfer. Die Besucher schreiten buchstäblich über die Toten hinweg, und an einer Stelle gibt der Boden sogar den Blick auf ein Skelett frei – auf Knochen und Schädel eines von einer Kanonenkugel getöteten Pferdes, das Ar-chäologen, neben den Überresten von 19 Soldaten, in Leipzig geborgen haben.
Fünf Millionen Menschen, schätzt die Historikerin Karen Hagemann, starben in den Kriegen der Jahre 1792 bis 1815, vom ersten Feldzug des revolutionären Frankreichs bis zur Niederlage Napoleons bei Waterloo. Gemessen an der Bevölkerungsgröße Europas, entspricht dies den Verlusten während des Ers-ten Weltkriegs. Die Epoche der Romantik fällt recht genau mit den mehr als 20 Kriegsjahren zu-sammen. Auch in insofern war sie eine blutige Zeit. Erstmals in der Geschichte stürmten Mas-senheere aufeinander los: In die Leipziger Völker-schlacht zogen rund eine halbe Million Soldaten, auf der einen Seite die Truppen Preußens, Öster-reichs, Russlands und Schwedens, auf der anderen die französischen Streitkräfte. Rund 100 000 von ihnen fielen in den vier Tage währenden Kämp-fen. Am 19. Oktober 1813 waren die deutschen Lande von der französischen »Fremdherrschaft« befreit, und Leipzig glich einem Leichenhaus.
Die Dresdner Schau will nachzeichnen, wie die Ereignisse gedeutet und manchmal schon im Moment des Geschehens romantisiert und zum nationalen Mythos geformt wurden. Ein ehrgei-ziges Vorhaben, vielleicht ein unmögliches, denn um die Wechselwirkung zwischen politischem Geschehen und romantischer Weltbetrachtung auszuloten, brauchte es mehr Erläuterung, als einer Ausstellung zuträglich wäre. Auf Texttafeln weitgehend zu verzichten und den Fundstücken aus der Völkerschlacht (Säbel, Fahnen, Unifor-men, Napoleons Depeschenmappe) einfach nur effektvolle Projektionen romantischer Gemälde von Caspar David Friedrich und Georg Friedrich Kersting entgegenzustellen ist allerdings auch keine Lösung. Die Objekte und Werke sollen für sich sprechen, sagt Museumsleiter Matthias Rogg. Das tun sie auch – oft aber nur zu dem, der schon Bescheid weiß.
Womöglich fürchtete man auch, mit der Frage nach der »blutigen Romantik« vermintes Gelände zu betreten, und beließ die Dinge deshalb in der Schwebe. Erst im Frühjahr hatte eine Kunstschau im Pariser Louvre die – deutschen – Gemüter er-regt. Schon der Titel lud zum Missverstehen ein: De l’Allemagne. 1800–1939. Als führe ein kurzer, gerader Weg von der Romantik in den Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich Unsinn. Doch es wäre ebenso falsch, jeden Zusammenhang zu leugnen. Das hätte also ein wunderbares Thema ergeben: einmal genau zu bestimmen, wo schwelgerische Innerlichkeit in Gewaltlust umschlug, wo das romantische Indivi-duum Sehnsucht nach dem Kollektiv be-kam, wo die Dichter und
Maler mit ihren Out-of-Bed-Frisuren und den offenen Hemdkragen der Drang befiel, Uniform zu tragen und nach Vernichtung zu schreien. Wie erklärt sich diese »Dialektik der Romantik«?
Die Ausstellung gibt darauf nur diese eine Ant-wort: Napoleon. Die sich absolut setzende Auf-klärung, die mit ihren Heeren ganz Europa über-rannte, provozierte ihr Gegenteil, die Beschwörung des Alten und Verlorenen, des Mittelalters, der deutschen Kultur, des deutschen »Wesens«.
Der Sieg über Napoleon war freilich nur mög-lich, weil man von ihm lernte: Massenmobilisie-rung, »Volkskrieg«, nationale Identifikation, das alles waren moderne, »französische« Ideen und Techniken. Am Ende – Ironie der Geschichte – triumphierten mit ihrer Hilfe die Monarchien, nicht die romantischen Nationalisten. Nach Napoleons Untergang, 1815, begann die Epoche der Restaura-tion. Kein einig Vaterland. Doch die Idee lebte fort. Und so erhielt auch die »blutige Romantik«
ihre Bedeutung im Wesentlichen nach den Befrei-ungskriegen. Für diese selbst, für den Sieg in der Völkerschlacht, war sie kaum entscheidend. Frei-korps wie die Lützower Jäger, denen auch der Dichter Theodor Körner angehörte, spielten, das macht die Ausstellung deutlich, militärisch keine Rolle. Eine Koalitionsarmee, kein Heer deutscher Freiwilliger, schlug »die Franzosen«. Erst im Nach-hinein wurde die internationale Völkerschlacht zum nationalen Befreiungsschlag stilisiert.
Sehr wohl bedeutend für die »blutige Roman-tik« waren indes Agitatoren wie Ernst Moritz
Arndt, Friedrich Ludwig »Turnvater« Jahn oder Johann Gottlieb
Fichte – und das schon vor 1813. Mit
fanatischen Tiraden
gegen
alles »Welsche«
(Arndt: »Ich will den Haß!«),
sprachphilosophischer Deutschtümelei (Fichte: Die
Deutschen als »Urvolk«, das Deutsche als »Ursprache«) und martialischen Gemeinschafts-fantasien (Jahn: »Mit dem blutigen Schwert der Rache zusammenlaufen«) heizten sie den Furor gegen die Besatzer an.
Messen lässt sich die Wirkung ihrer Propagan-da natürlich nicht, wie der Kurator der Dresdner Ausstellung, der Historiker Gerhard Bauer ein-wendet. Arndt aber beeinflusste nachweislich die Mächtigen in Preußen. Als Sekretär des Reformers Freiherr vom Stein half er Ende 1812, den preußi-schen König dazu zu bewegen, sich gegen Frank-reich zu stellen. Dass die Romantikschau Arndt & Co. nur am Rand erwähnt, ist daher ein großes
Versäumnis. Zumal sich die »blutige Ro-mantik« an ihnen besonders gut stu-
dieren ließe, Rassismus und ein bereits eliminatorischer Antisemi-tismus inklusive. Ebenso wenig kommen zeitgenössische Kri-
tiker in den Blick, wie etwa der jüdische Publizist Saul Ascher, der die »Germanomanen« so scharf wie ahnungsvoll aufs Korn nahm.
Die Ausstellung vergibt damit eine Chance: Eine Analyse der geistigen Aufrüstung um 1813, das wäre ein großartiger Einwurf zum Gedenkjahr gewesen – und ein interessanter Beitrag zur Ge-schichte der Romantik und ihren bräunlich blut-verkrusteten Rändern. Doch das Dresdner Mu-seum bietet bei näherer Betrachtung gar nicht die Ausstellung über das romantische Zeitalter, die es ankündigt, sondern eine über 1813 und die Völ-kerschlacht im kollektiven Gedächtnis. Und als solche ist sie durchaus sehenswert.
Der Kurator Gerhard Bauer hat etliche zum Teil kuriose Fundstücke aufgetrieben: einen Nacht-topf mit Napoleons Konterfei auf dem Boden. Eine Zielscheibe für ein Schützenfest 1913 mit dem Nachdruck eines Gemäldes, das den Korsen vor dem brennenden Moskau zeigt. Einen Stein-bausatz des Leipziger Völkerschlachtdenkmals, Merchandising anno 1913. Oder das Porträt des Freikorpskämpfers Karl Friedrich Friesen, gezeich-net im empfindsamen Stil der Zeit. Den größeren Zusammenhang stiftet allerdings auch hier erst der Katalog, ergänzt um einen fabelhaften Essayband, der bietet, was die Präsentation der Exponate vermissen lässt: eine schlüssige Erzählung, die auch auf über-raschenden Seitenwegen zur Sache kommt, etwa am Beispiel der als Männer verkleide-ten Soldatinnen, die freiwillig in den Krieg gegen Napoleon zogen. Besonders eindrücklich ist der Aufsatz des französischen Militärhistorikers Pierre Juhel 1813 – das Jahr eines Weltkriegs? Kein euro-päischer Staat, mit Ausnahme des Osma-nischen Reichs, blieb in jenem Jahr vom
Krieg verschont. Und seit Napoleon 1810 in Spanien die Übermacht erlangt hatte, brachen
auch in den spanischen Besitzungen in Süd-amerika bewaffnete Revolten aus. So hätten,
resümiert Juhel, die Konflikte des Jahres 1813 zumindest Züge eines Weltkrieges getragen. Ähnliches gilt für die Gewalterfahrung, die das Massensterben im modernen Krieg zwar präludier-te, ihm aber noch nicht gleichkam. Auch dafür ist die Romantisierung des Leipziger Gemetzels ein Beleg: Die blutige Schlacht veränderte die europäi-sche Landkarte, aber sie bewirkte, anders als der Horror des Ersten Weltkriegs, keinen Kulturbruch. Der Verwesungsgestank, der über Leipzig hing, war schnell verweht, man erzählte sich Heldengeschich-ten und feierte »Märtyrer« wie den jungen Theodor Körner, der 1813 im Kampf gegen die Franzosen umgekommen war. Wenige Stunden vor seinem Tod, heißt es, habe er sein berühmtes Schwertliedgeschrieben: »Du Schwert an meiner Linken, / Was soll dein heitres Blinken? / Schaust mich so freundlich an, / Hab’ meine Freude dran. / Hurra!« – »blutige Romantik« in Reinform, die während des Ersten Weltkriegs tausendfach auf deutschen Feldpostkarten nachgedruckt wurde.
Bis heute prägt das Bild der nationalen Befrei-ungsschlacht die Erinnerung. Die Dresdner Aus-stellung stellt diesem Mythos nüchtern Fakten und Relikte entgegen. Bewusst sind Wände und Decke bläulich angestrahlt – fast so, als gelte es, die Rück-schau schon ins kalte Licht der Weltkriegsschre-cken zu rücken, in die der nationalistische Irrweg Europa hundert Jahre später führen wird.
»Blutige Romantik – 200 Jahre Befreiungskriege«, bis 16. Februar 2014, Militärhistorisches Museum Dresden, Olbrichtplatz 2; Tel.: 0351/823 28 03
»Ich will den Haß!«Der Befreiungskampf gegen Napoleon ließ den Geist des deutschen Nationalismus aus der Flasche.
Doch die große Ausstellung »Blutige Romantik« in Dresden weicht ihrem Thema eher kunstvoll aus VON CHRISTIAN STAAS
18
13
Schießen auf den »Erbfeind«:
Zielscheibe von 1913
D
Foto
s: M
us.
Bau
tze
n;
Mu
s. d
er
Sta
dt
Ze
rbst
(r.
)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
19
I
Natur ohne TodVon allen Genies der europäischen Aufklärung ist er das kühnste,
uns nächste: Denis Diderot. Zum 300. Geburtstag des
Philosophen, Satirikers, Visionärs ein Porträt VON MATHIAS GREFFRATH
n der Tat, die Beweise waren eindeutig. Seit Monaten lagen der französischen Polizei Spitzel-berichte vor, und die Bücher und Manuskripte in seiner Wohnung ließen keinen Zweifel an sei-nen gefährlichen Gedanken. Nach einer Woche im Staatsverlies Vincennes südöstlich von Paris leugnete der Gefangene noch, aber nach wei-teren zehn Tagen, am 10. August 1749, brach er zusammen und gab alles zu. Schließlich war der Haftbefehl unbefristet; die Aussicht, auf unab-seh bare Zeit in diesem Zellenloch sitzen zu müs-sen, hatte das Geselligkeitsgenie Denis Diderot an den Rand des Wahnsinns getrieben.
Ja, er hatte das geschrieben: »Der Gedanke, dass es keinen Gott gebe, hat noch niemanden erschreckt, wohl aber der Gedanke, dass es einen Gott gebe, wie man ihn mir schildert.« Und auch diesen schmuddeligen kleinen Roman, in dem die weiblichen Geschlechtsorgane plaudern können und eine Kurtisane sich über Gott und Descartes lustig macht: »Der erste Wohnsitz der Seele sind die Füße ...«
Der Henker von Paris hatte Diderots Philoso-phische Gedanken zerrissen und verbrannt. An anderen Orten im Lande verbrannte man damals noch Menschen, die bei Prozessionen nicht den Hut abnahmen. Aber gefährlicher für die herr-schende Ideologie als Skepsis und galante Roma-ne war auf lange Sicht Diderots Brief über die Blinden. In ihm war die Physiologie zu einer po-litischen Wissenschaft geworden: Unter ihrem nüchternen Blick löste sich die Seele auf, und mit ihr Gott – und der Glaube an den König. »Wenn die Menschen einmal gewagt haben, den Schutz-wall der Religion anzugreifen – den fürchtens-wertesten und geachtetsten, den es gibt –, dann ist kein Halten mehr. Haben sie erst einmal dro-hende Blicke gegen die Majestät des Himmels gerichtet, dann werden sie alsbald auf die Herr-schaftsverhältnisse auf der Erde schauen.«
Im Verhör schwor Diderot den »geistigen Ver-messenheiten, die meiner Feder entschlüpft sind« ab und unterschrieb einen Revers, auf dem stand: »Es werden die letzten sein.« Daran hat er sich ge-hal ten und zeitlebens nichts dergleichen mehr ver-öffent licht. Jedenfalls nicht unter seinem Namen.
Bis zu diesen Tagen des Sommers 1749, bis zu seiner Haft in Vin-cennes, war der Mann aus der Provinz, Sohn eines Messerschmieds, über ein paar Pariser Salons hinaus kaum bekannt, sein Lebens-
lauf typisch für ein hochbegabtes Aufsteigerkind. Am 5. Oktober 1713 in dem ostfranzösischen Städtchen Langres geboren, kommt er mit 13 Jah-ren in seiner Heimatstadt aufs Jesuitenkolleg. Er will Priester werden, geht nach Paris, gerät dort in die theologischen Kämpfe zwischen den Jesuiten, die am Hof das Sagen haben, und den Jansenisten, die eine Religion für die aufsteigende Mittelschicht predigen. Darüber wird er zum Skeptiker und schließlich zum Materialisten. Er schlägt sich durch, als ewiger Stu dent, als Hauslehrer, als Schnorrer, mit gelegentlichen kleinen Aufsätzen über eine neuartige Drehorgel oder mathemati-sche Probleme. Seinen Vater lässt er wissen, er wolle »nichts werden«, nur immer mehr wissen. Mit 28 heiratet er, »unter Stand« und heimlich, eine schöne, schlichte Frau, eine Näherin.
Frankreich stagniert. Leidet unter den Aus-gaben für Krieg und Versailles. Die Bauern ver-stecken das Vieh vor den Steuerinspektoren und le ben im Dreck. Die Manufakturen bleiben hinter den englischen und preußischen zurück. Vor dem kleri kalen Gesinnungsterror fliehen Handwerker, In genieure und Wissenschaftler nach St. Peters-burg, wo gut gezahlt wird, oder ins Preußische, wo zumindest religiöse Toleranz herrscht. Dabei liegt
so viel Fortschritt in der Luft: chemische Formeln, neue Staatsformen, die Entdeckungen in Übersee, neue Maschinen, neue Vermutungen über den Anfang der Erde, der Tiere, des Menschen.
Der freie Radikale, hochgewachsen, unterwegs stets im grauen Rock und ohne Perücke, muss nun eine Familie ernähren. Und lebt doch weiterhin à la bohème, lässt nichts anbrennen, keinen Gedan-ken, keine Affäre. Um Madame de Puisieux, seine Maitresse, zu finanzieren, schreibt er in einer Wo-che die Indiskreten Kleinode. Im Palais Royal spielt er Schach gegen Rousseau, im Café Procope disku-tiert er mit dem Mathematiker d’Alembert Buch-projekte. Er ist umtriebig neugierig auf allerlei Ge bieten, eloquent und feuerköpfig, und wie vie-le Aufsteiger glaubt er an die Macht der Gedanken.
Der ideale Mann, so befinden seine Verleger, um ein Lexikon der neuen Art herauszugeben, in das sie viel Geld investiert haben: eine Enzyklo-pädie aller Wissenschaften, Künste und Hand-werke. Doch da kommt die Verhaftung. Die Ver-leger protestieren: Was soll jetzt aus ihrem Werk werden? Arbeitsplätze sind in Gefahr, Setzer, Stecher, Drucker ... Das Argument zieht immer, im November 1749 kommt Diderot frei.
Zwei Jahrzehnte, die besten Jahre seines Le-bens, verzehrt die Encyclopédie. Diderot schreibt Tausende von Artikeln, rekrutiert 150 Autoren und geht selber in die Werkstätten der Hand-werker, um die Produktionsverfahren, die Namen von Materialien und Werkzeug zu lernen. Die 28 Bände, die zwischen 1751 und 1772 erscheinen, sind das Meisterstück der Aufklärung.
Ihre Verleger werden reich, Sorge bereiten ih-nen nur die Zensur und ein Herausgeber, der lis tig entschlossen ist, dem »Lexikon« seine Handschrift aufzudrücken. Denn anders als für sie ist das Werk für ihn mehr als nur eine Mischung aus techni-schem Handbuch und Konversationslexikon.
Es wird zur politischen Satire, wenn zum Bei-spiel ein überraschend ironischer Rousseau hier den Hobbesschen Gesellschaftsvertrag persifliert: »Ich werde gestatten, dass Ihr die Ehre habt, mir zu dienen, unter der Bedingung, dass Ihr mir für die Mühe, die ich mir mache, Euch zu komman-dieren, das wenige gebt, was Euch bleibt.« Es wird zum Lebenskunstbrevier mit Kochrezepten und Ratschlägen gegen Depression: »Nicht immerzu glauben, man habe eine Vorzugsbehandlung ver-dient.« Zum Lehrbuch über die Liebe: »Ich ver-mute, daß verschiedene Männer sich derselben Frau verbinden können; die einen lieben sie wegen ihres Geistes, die anderen für ihre Tugend, die dritten wegen ihrer Fehler ...« Befremdet schreibt der fast eine Generation ältere Voltaire aus Genf: »In Ihrem Lexikon wagt man es, ich zu sagen ...«
Es ist ein helles, ein heiteres Unterfangen, und ein Schelmenroman dazu. Die Theologen schäu-men, wenn sie da, wo sie es nicht erwarten, die win zigen materialistischen Viren finden. So steht unter dem Stichwort »Menschenfresser«: »Siehe auch Eucharistie, Kommunion, Altar usw.«
Er braucht Geselligkeit und Cafés, Klatsch und Debatte
Auch der Artikel »Sarazener« dürfte den Autoren viel Spaß gemacht haben. Am Anfang und für die Augen der Zensoren kritisiert er die Wissenschafts-feindlichkeit des Islams. In der Mitte formuliert er die Hoffnung, dass zunehmende Aufklärung und abnehmender religiöser Dogmatismus einan-der entsprechen. Und hinten rechnet er, als Beweis für den Sieg der Vernunft, die abnehmende Zahl der Hostien vor, die in Paris noch ausgeteilt werden.
71 000 Artikel plus 2900 Stiche, deren Legen-den dem Handwerk und den Werkzeugen erst-mals einheitliche Namen geben. Dazu Galantes, Philo sophisches, Politisches. Es ist ein wenig so, als sä ßen heute Harald Lesch, Wilhelm Schmid, Uwe Wesel, Gabriele Goettle, Georg Schramm, Barbara Sich ter mann, Willi Winkler und Alexan-der Kluge beieinander, um als Herausgeber ge-meinsam mit der arbeitslosen Brockhaus-Redak-tion Wikipedia zu füttern.
Das erste Verbot kommt 1751, es wird still-schweigend gelockert. Aber nach einem Atten-tatsversuch auf Ludwig XV. verschärft sich die Repression. Die Encyclopédie wird endgültig ver-boten, der Papst setzt sie auf den Index. Diderot schlägt den Verlegern vor, die restlichen acht Bän-de heimlich im Untergrund zu drucken und nach Fertigstellung alle Exemplare gleichzeitig aus-zuliefern. D’Alembert und Voltaire springen ab und warnen – nicht nur aus Furcht: Ihnen passt die ganze Rich tung nicht mehr, vieles ist ihnen zu plebeisch, zu antireligiös. Sie drängen Diderot, aufzugeben.
Aber der Bürger Diderot arbeitet weiter, pflichtbewusst, wenngleich es keine rechte Freude mehr macht. Das meiste von dem, was er sonst noch schreibt – poetische Schriften, Kunstkritiken, philosophische Erzählungen –, fließt in die Cor-respondence des Melchior Grimm, ein von Hand vervielfältigtes Journal aus Paris, mit dem der deut-sche Baron Europas aufgeklärte Fürsten versorgt. Oder es bleibt in der Schublade, wie der von Lau-rence Sterne inspirierte Roman Jacques der Fatalist und sein Herr, und wird erst später, peu à peu, ge-funden, manches davon noch im 20. Jahrhundert.
Ich habe einen Vertrag zu erfüllen, sagt er allen, die an seinem Encyclopédie-Dienst zweifeln. Aber das allein wird es nicht gewesen sein. Diderot ist weder zum Repräsentanten noch zum Wander-predi ger gemacht, kein Voltaire, kein Rousseau. Er braucht Geselligkeit, die Entzündung durch Neuig-keiten, Streit, Klatsch, seine Cafés, seine Freunde. »Ich dichte nicht, ich bin überhaupt kein Autor. Ich lese, oder ich unterhalte mich; ich frage, oder ich antworte. Wenn Sie nur mich hören, wer den Sie mir vorwerfen, es sei ohne Zusammenhang.«
Ein liebenswerter Kerl, notiert einer der En zy-clopedisten, »ein großer Phi losoph, der aber stän-dig in Exkurse abschweift. Gestern zählte ich in der Zeit von neun bis ein Uhr, während der er bei mir in meinem Zimmer war, derer fünfundzwanzig.« Für Diderot ist die Abschweifung ontologisches Prinzip, denn streng kausal genommen, gibt es sie gar nicht: »Nichts ist ohne Zusammenhang, weder im Kopf eines Träumenden noch in dem eines Nar-ren, und im Gespräch hängt auch alles zusammen.«
Es ist die Logik des Traums und des Gedächt-nisses, die ihn fasziniert. »Ich bin geneigt zu glau-ben, dass alles, was wir gesehen, kennengelernt, wahrgenommen und gehört haben, [...] in uns ohne unser Wissen weiterbesteht. [...] Der Schlaf versetzt mich in Konzerte zurück, die genau so ge spielt werden, wie damals, als ich zugegen war.«
Ich bin geneigt zu glauben: So klingt eine der höf lichen Wendungen, mit denen er sich dem nä-hert, was alle kennen, die sich beob achten – und was sich bislang aller Messbarkeit entzieht: die wah-re Funktionsweise des Gehirns, das Zusammenspiel von Denken und Empfinden, Wunsch und Wille.
Der Schlaf der Vernunft gebiert für ihn keine Ungeheuer, sondern beseelten Materialismus. »Jedes Tier ist mehr oder weniger Mensch; jedes Mine ral mehr oder weniger Pflanze; jede Pflanze mehr oder weniger Tier. [...] Nichts ist seinem Wesen nach nur das eine oder das andere [...]. Und ihr redet von In dividuen, ihr armseligen Philoso-phen! [...] Es gibt kei ne, nein, es gibt keine ... Es gibt nur ein großes Individuum, das ist das Gan-ze. [...] Solange ich lebe, rea gie re ich als einheitli-che Masse, als toter Körper rea giere ich in Mole-külen ... Ich sterbe also gar nicht? ... Nein, in diesem Sinne sterbe ich gewiss nicht ...«
Der so im Halbschlaf vor sich hin spricht, ist der Mit heraus ge ber der Encyclopédie, d’Alembert.
D’Alemberts Traum heißt dieser Dialog, Diderots wohl kühnster und verspieltester Text. Er offenbart eine Art mystischen Materia lismus: mys tisch, weil über alles Erfahrbare hinausgreifend, ma te ria lis-tisch, weil völlig transzendenzfrei. Eini ges von die-sem beseelten Materialismus findet Ein gang in die Encyclopédie: »Die Ausdrücke Leben und Tod haben nichts Absolutes; sie bezeichnen nur die aufeinanderfolgenden Zustände ein und des sel ben Wesens«, heißt es unter dem Stichwort »Ent-stehen«. Und dann leistet sich Diderot eine kleine romantische Spekulation: »Wer weiß, ob die Asche (eines Vaters einer Mutter, eines Geliebten) nicht unsere Tränen spüren und darauf reagieren kann?«
Hat er sich den Mächtigen zu sehr genähert?
Es gibt keine Lücke im Gewebe der Welt, es gibt nur Glieder, die wir noch nicht kennen. Das ist ein Fundamentalismus der heiteren Art. Er zerstört die wunderreichen Fundamente der Religion und anti zipiert, worauf Gehirnforschung, Evolutions- und Molekularbiologie insgeheim hinarbeiten: die Fundamente einer diesseitigen Metaphysik. Er plant ei ne »experimentelle Naturgeschichte des Men-schen«, eine Theorie des Körpers, die ihn als einen Moment der gesamten Materie des Universums betrachtet. »Ich, ein Universum aus Atomen, ein Atom im All«, so wird es 200 Jahre später der geniale amerikanische Physiker Richard Feynman sagen. Die Welt braucht Poesie? Sie ist poetisch.
Und dann radikalisiert sich Diderot noch ein-mal. Die französischen Zustände sind erdrückend, eine Reise zu Zarin Katharina II., die lange um sei-nen Besuch in St. Petersburg gebuhlt, die ihn üppig subventioniert hat, desillusioniert ihn vollends.
Der Philosoph genießt den Charme der abso-luten Macht und lernt ihre – und seine – Grenzen kennen. Hundert Nachmittage verbringt er mit der 15 Jahre jüngeren, deutschstämmigen Zarin, philosophiert mit ihr, »von Mann zu Mann«, wie sie sagt, fragt sie aus, macht ihr Vorschläge zur Ab-schaffung der Despotie. Aber dann sagt sie: »Mon-sieur Diderot, mit all Ihren großen Prinzipien, die ich sehr gut verstehe, kann man schöne Bücher, aber nur schlechte praktische Arbeit machen [...]. Sie arbeiten nur auf Papier, das geduldig ist; es ist einfach, streitet nicht und setzt weder Ihrer Fanta-sie noch Ihrer Feder Widerstand entgegen, während ich arme Zarin die menschliche Haut bearbeite, die ungleich reizbarer und empfindlicher ist.«
Diderots Konsequenz: Er wird zum Ghostwri-ter für einen der größten Bestseller des 18. Jahr-hun derts, die Geschichte der beiden Indien des Abbé Ray nal. Das Buch ist eine radikale Kritik nicht nur des kolonialen Terrors, sondern auch der Fürsten-macht, Ausbeutung und Herrschaft. Diderot liefert Raynals kompilierter Chronik der Er obe rungs -verbre chen die furiosen rhetorischen Spitzen: »Flieht, unglückliche Hottentotten, flieht [...] Der Tiger
nimmt euch nur das Leben. Die anderen aber wer-den eure Unschuld und Freiheit vergewaltigen.« Der Kritik an den Mächtigen folgt die an de nen, die sich beherrschen lassen: »Es gibt die un mensch-liche Gewalt, die unterdrückt, und die schläf ri ge und schwache Gewalt, die unterdrücken lässt.« Und doch weiß er: »Wenn die Völker unglücklich sind, so werden weder eure Meinungen noch die meinigen, sondern die Unmöglichkeit, noch mehr und länger zu leiden, sie zur Rebellion treiben.«
Am Ende all der klandestinen Aufklärungen zieht Diderot eine bittere Bilanz. Hat er sich den Mächtigen zu sehr genähert? Sind die blutigen Rebellionen am Ende nicht wirksamer als das Ver-trauen auf die Aufklärung der Könige, auf die Wirkung von Viren und Nadelstichen? War es falsch, den Revers in Vincennes zu unterschrei-ben? »Die Welt ist das Haus des Starken«, steht am Schluss der Elemente der Physiologie. »Die Angst vor dem Tod ist ein Henkel, an dem der Starke uns packt und führt, wohin er will. Zer-brecht den Henkel und enttäuscht die Hand des Starken.« Denn »es gibt nur eine Tugend, nämlich die Gerechtigkeit, und nur eine Pflicht, nämlich das Glücklichsein, und nur eine Konsequenz, nämlich sich aus dem Leben nicht allzu viel zu machen und den Tod nicht zu fürchten«.
Aber diese Moral ist für Diderot nicht indivi-dualistisch. Glück und Gerechtigkeit sind öffent-liche Güter, man muss auch sie grenzenlos den-ken. So, wie man sie fühlt. Unter dem Stichwort »Tagelöhner« steht in der Encyclopédie: »Dieser Menschenschlag bildet den größten Teil der Na-tion. Sein Schicksal soll eine gute Regierung hauptsächlich vor Augen haben. Ist der Tagelöh-ner unglücklich, so ist die Nation unglücklich.«
Die späten Jahre: ein langsames Verlöschen. In seinem letzten Brief, Februar 1784, man weiß nicht, an wen er ihn gerichtet hat, stehen karge zwei Sätze: »Die Philosophie ist nur das Opium der Leidenschaften, das Greisenalter der Augen-blicke.« Am letzten Samstagmittag im Juli 1784 stirbt Denis Diderot, nach Lammfleisch mit Chicoree. Er greift nach einer Aprikose. »Was zum Teufel soll mir das schaden?«, knurrt er seine Frau an, dann senkt sich sein Kopf.
Normalerweise werden Atheisten ohne Zere-monie verscharrt. Die Familie muss die Gemein-de bestechen, in Saint-Roch findet er ein Grab. Während der Revolution werden Kirche und Grüfte geplündert; auch sein Sarg verschwindet.
Wie es heißt, möchte Präsident François Hol-lande die »Asche Diderots« zum 300. Geburtstag ins Pantheon überführen, zu Rousseau und Vol-taire. Aber längst fordert eine starke Lobby: Mehr Frauen ins Pantheon! Diderot selber wäre be-geistert. Der Artikel »Femme« in der Encyclopédie beginnt mit dem Satz: »Frau – das Wort allein berührt die Seele [...], und der Philosoph, der noch nachzudenken glaubt, ist bald nur noch ein Mann, der begehrt, oder ein Liebhaber, der träumt ...«
17
13
»Jedes Tier ist mehr oder weniger Mensch; jede Pflanze mehr oder weniger Tier«
GESCHICHTE
Schreiben als Dialog: Das berühmte Bildnis Diderots von Louis-Michel van Loo, 1767
Diderots »Encylopédie«, 1751 begonnen, wurde zu einem
Schlüsselwerk der Aufklärung
Ab
b.:
bp
k;
Ari
ane
Bre
yer
(u.)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
20
P ressekonferenzen nach einem Bundesliga-spiel sind selten Orte kollegialen Mitgefühls. Für Jürgen Klopp sind es Momente ausführ-
licher Spielanalysen und launiger Erläuterungen. Doch angesichts seines kümmerlichen Gegenübers wird der Dortmunder Trainer ungewohnt hand-zahm: »Ich wünsche euch viel Spaß in Sevilla, das ist nämlich auch geil, ehrlich gesagt.«
Zum dritten Mal spielt der SC Freiburg im eu-ropäischen Wettbewerb. Trainer Christian Streich hat den sensationellen Erfolg der vergangenen Sai-son maßvoll bejubelt. An diesem Samstag, nach der 0 : 5-Niederlage in Dortmund, erscheint ihm die
bevorstehende Reise nach Andalu-sien beinah als Schreckensszenario. »Wir müssen immer das Maxi-mum erreichen, um in der Bun-desliga ein Spiel zu gewinnen«, sagt er. Das ist seiner Mannschaft in dieser Saison trotz maximalen Aufwandes noch nicht gelungen.
Trainerkollege Thomas Tuchel würde gern im Europapokal spielen. In seinen vier Mainzer Jahren hat er den ehemaligen Vergnügungsverein in der Bundesliga etabliert. Jetzt wünschen sich viele den nächsten Schritt, doch der Herbst in Mainz ist
widrig – nach vier verlorenen Spielen in Serie.
An der Europatauglichkeit von Streich und Tuchel zweifelt kaum jemand. Die beiden kön-nen eine Mannschaft über deren eigentliches Leistungsvermögen emporheben. Die Qualität der
beiden ist unumstritten. An anderen Orten als Mainz und Freiburg würden sie Stars genannt.
Doch wenn die Qualität des Trainers größer ist als die Möglichkeiten des Vereins, dann wackelt das Gesamtgefüge. Es kann ein Spannungsfeld
zwischen dem Ehrgeiz der Chefs und den Grenzen der Mitarbeiter entstehen.
Für die Vereine sollte die Erkenntnis alarmie-rend sein. Der Entwicklungsanspruch der Trainer könnte zur Belastung werden. Bleibt der nächste Schritt unerfüllbar, wird die Veränderung zwangs-läufig. Obwohl sie für alle Gefahren birgt: für den Verein, mit einem neuen Coach auf Normalniveau zurückzufallen, und für den Trainer, in einem an-deren Umfeld eigene Grenzen zu spüren.
Und doch ist der Anspruch verständlich. Kon-tinuität ist tatsächlich wohl nur dort möglich, wo Titel zu gewinnen sind.
Zu gut für den VereinDie beiden Trainer Tuchel und Streich streben nach ganz oben. Ihre Vereine sind nur Mittelmaß. Das kann nicht ewig gut gehen VON KATJA KRAUS
Im Wechsel beleuchten dieehemalige Fußballmanagerin
Katja Kraus und ZEIT-Theater-kritiker Peter Kümmel die
Höhen und Tiefen des Fußballs
FUSSBALL
Was ist in der Liga los? Matthias Sam-mer, Sportdirektor des FC Bayern München, beschimpft vor laufender Kamera die eigene Mannschaft, sie spiele zu »lethargisch«, mache
»Dienst nach Vorschrift« und müsse raus aus »einer gewissen Komfortzone«. Und Dortmunds Trainer Jürgen Klopp schreit den Vierten Offiziellen während eines Champions-League-Spiels mit einer Fratze wie in einem Horrorfilm an, sodass er auf die Tribüne ver-bannt wird.
Klopp und Sammer sind erfolgreiche Führungsfi-guren des Fußballs. Vollprofis. Weshalb verhalten sie sich wie Rowdys? Warum rasten sie aus?
Wenn sie ausrasten Es wird gepöbelt, gewütet und gemahnt: Warum Gefühlsausbrüche
der Betreuer im Fußball so sinnlos sind VON CATHRIN GILBERT
Wenn man die Beteiligten danach fragt, landen alle bei einem Begriff: Bayerns Trainer Pep Guar-diola zum Beispiel rügt den Sportdirektor in seiner charmanten deutsch-spanischen Aussprache als sehr emotionelle, Sammer wiederum beklagt die fehlen-de Emotionalität in der Mannschaft, und Jürgen Klopp entschuldigt seinen Auftritt damit, total emotionsgeladen gewesen zu sein.
Emotion also. Keine Sportart produziert sie so im Überfluss wie der Fußball. Das Geschäft lebt von der permanenten Erregung. Aber wie viel davon ist echt? Sind die Wutausbrüche nur gespielt? Und wem dienen sie eigentlich?
Man muss sich die Fußballwelt wie eine große Arena mit zwei Bühnen vorstellen – die eine steht in der Mannschaftskabine, zu dieser hat die Öffentlich-keit keinen Zugang. Und dann gibt es das äußere Podest fürs Publikum. Dort gilt: Je mehr Spektakel, desto besser. Die Show soll tief ins Mark der Fans dringen – sie sollen über alle Maßen erregt werden.
Um diese Wirkung zu erzielen, muss der Reiz immer stärker werden. Die Musik wird lauter, die Stadien werden größer, die Athleten teurer, es gibt keine Grenzen, das Crescendo soll, nein: darf nie aufhören.
Erfolgreiche Fußballmannschaften werden heute ähnlich wie Wirtschaftsunternehmen nicht mehr nach dem simplen Prinzip von Leistung und Gegenleistung getrimmt (das wäre die so-genannte transaktionale Führung à la Felix Ma-gath). Nicht nur das Ziel, sondern auch die Stim-mung innerhalb der Mannschaft soll das Team zum Erfolg tragen (»transformationale Führung«, zu beobachten etwa beim Mainzer Trainer Tho-mas Tuchel). Moderne Trainer erzeugen Begeis-terung und Zuversicht. Sie reißen die Spieler mit, indem sie ein Gefühl des Stolzes und der Wertschätzung vermitteln.
Jürgen Klopp ist neben Jürgen Klinsmann ei-ner der ersten deutschen Trainer, die Inspiration vorleben. Er fordert nicht nur Begeisterung, er ist auch selbst begeistert und kann damit seine Mannschaft anstecken. Das funktioniert natür-lich nur gepaart mit fachlicher Kompetenz, über die Klopp das Vertrauen der Spieler gewinnt.
Nach außen aber wütet Klopp. Er bedient beide Bühnen, treibt nicht nur die Mannschaft an, er peitscht auch die Zuschauer auf. Die Me-dien feiern ihn als den Mann, der »auf die Pauke haut« und den »Hunger vermittelt«. Spricht man Klopp darauf an, dann spürt man, dass er eine Hassliebe zu diesem Klischee entwi-ckelt hat. Er genießt seine Rolle, weiß aber, dass sie in dem Moment gefährlich werden kann, wenn es ihm nicht mehr gelingt, zwischen Image und Realität zu un-terscheiden, wenn er den Überblick verliert und ei-gene Persönlichkeit, Show-geschäft und Stressbewältigung aufeinanderpral-len. Dann knallt es, und er attackiert den Vierten Offiziellen wie ein Stier den Torero.
In dieser Szene spiegelt sich neben dem Cha-rakter Klopps ein Konflikt, der in die Tiefe des Fußballbetriebes führt. Es geht um die Frage: Was macht erfolgreiche Führung im Fußball aus? Reicht Emotion allein aus? Welche Fähigkeiten zeichnen den modernen Trainer von heute aus?
»Eine der wichtigsten Kompetenzen im Pro-fifußball ist die Kunst, das eigene Verhalten in Drucksituationen nicht von äußeren Reizen und Erwartungen beeinflussen zu lassen«, sagt Philipp Lahm. Der 29-Jährige ist Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Nationalmann-schaft. Es sei nicht leicht, ein Fußballteam zu di-rigieren, gerade »weil alles emotionalisiert wird«.
Der moderne Trainer sollte also auf eine ge-wisse Art eine zwiegespaltene Persönlichkeit sein: Nach innen muss er leidenschaftlich be-geistern können und nach außen in sich ruhen wie ein Mönch beim Meditieren. Gelingt es dem Trainer nicht, seine Emotionen zu kon-trollieren, dann wirkt sich das sofort auf die Mannschaft aus: Wenige Minuten nach dem Ausraster Klopps wurde der Dortmunder Tor-hüter Roman Weidenfeller vom Platz gestellt,
Dortmund verlor das Spiel gegen den Außensei-ter Neapel 1 : 2.
Philipp Lahm ist ein Betroffener der aktuellen Führungsdebatte. Die Wutrede des Sportdirek-tors Matthias Sammer war nicht zuletzt an den Kapitän der Mannschaft adressiert. Die Zeit, in der Trainer wie Giovanni Trapattoni für ihre öf-fentliche Kritik an der Mannschaft von der Ver-einsführung gelobt wurden, ist jedoch vorbei. Das merkt man an der Reaktion des Bayern-Präsiden-ten Uli Hoeneß. »Darüber werden wir sicherlich reden«, rügte dieser Sammer nach dessen Fernseh-auftritt. Es entstehe ein Eindruck vom FC Bayern, der nicht gut sei.
»Ein guter Trainer und Kapitän moderiert, er diktiert nicht«, sagt Lahm. »Schon gar nicht mit-hilfe der Öffentlichkeit.«
Aber wie gelingt es einem Trainer, der seine Mannschaft intern emotional führt, seine Erre-gung nach außen zu kontrollieren, die beiden Bühnen also nicht zu vertauschen?
Pep Guardiola ist ein gutes Beispiel dafür. Er meidet die Öffentlichkeit, Interviews gibt er gar keine. Diese Rolle hat er seinem Sportdirektor Matthias Sammer überlassen, dem sieht man selbst in Phasen der Kritik richtig an, wie stolz er darauf ist, die Sehnsucht des Publikums nach Show bedienen zu dürfen.
Philipp Lahm hat der Auftritt Sammers nicht gefallen. Es gehört aber zu seinem moderaten Stil, das Vorstandsmitglied nicht direkt anzugreifen und trotzdem
deutlich zu werden. Wenn ein Verantwortlicher das Gefühl habe, die Mannschaft kritisieren zu müssen, »dann soll der das doch bitte intern machen«, sagt Lahm. Die heutige Spielergenera-tion sei im Gegensatz zu der früheren dazu erzo-gen worden, über Probleme zu sprechen, Be-gründungen einzufordern und zu diskutieren. Jeder dürfe ihn und seine Mannschaft kritisie-ren. Wenn jemand sich trotzdem für die öffent-liche Wutrede entscheide, dann müssten der Einsatz und die Art sehr gut überlegt sein. »Es dauert, bis man ein Gefühl dafür entwickelt, wann der richtige Zeitpunkt für diese Form ge-kommen ist und in welchem Ton man das macht«, sagt Lahm. »Im Moment der Kritik muss man die Emotionen zurückhalten kön-nen. Wenn der Chef zu emotional ist, dann ver-
liert der irgendwann. Dann ist er nicht mehr so glaub-würdig. Das geht dann im-mer auch vom Chef in die unteren Abteilungen.«
Lahm ist in München ei-ner besonderen Spannung ausgesetzt. Jeder Bayern-Ver-antwortliche spielt eine be-stimmte Rolle – wie im Thea-ter. Weil alle anderen Positionen vergeben sind, hat sich Mat-
thias Sammer in der Funktion des Mahners ein-gerichtet. Da er keinen direkten Einfluss auf die Mannschaft hat, sucht er seine Bühne in der Öf-fentlichkeit. Es ist schwer zu sagen, ob Sammers Auftritt etwas bewirkt hat oder nicht. Das Selt-same an Wutreden ist: Sie überleben sowohl Erfolg als auch Misserfolg. Die Bayern haben seit dem Auftritt ihres Sportdirektors dreimal gewonnen. Einen Zusammenhang zwischen Sammers Kritik und den Siegen wird niemand belegen können.
Lahm sagt etwas, das schärfer ist als die Kritik an der Sache: »Für uns Athleten spielt das, was die Verantwortlichen in der Öffentlichkeit sagen, nicht die ganz große Rolle.« Nehmen die Spieler öffentliche Kritik wie die von Matthias Sammer also gar nicht wahr oder ernst? »Für uns ist wich-tig: Wie agiert unsere Führungsperson intern?« Pep Guardiola mache das ausgesprochen leiden-schaftlich und klug, sagt Lahm. Er spreche das intern aus, was andere über die Öffentlichkeit transportierten. »Wenn wir Spieler merken, dass die Verantwortlichen das Scheinwerferlicht nicht brauchen, dann kriegen sie von uns uneinge-schränkte Rückendeckung.«
Der moderne Trainer soll emotional und ge-fühlskalt zugleich sein – ach, Fußball kann so schön sein.
»Ein guter Trainer und Kapitän moderiert, er diktiert nicht«, sagt Lahm. »Schon gar nicht mithilfe der Öffentlichkeit«
Der Mahner: Matthias Sammer Der Einpeitscher: Jürgen Klopp Der Wüterich: Giovanni Trapattoni Der Antreiber: Christian Streich
Foto
s [M
]: Q
ue
lle:
Sky,
15
.09
.13
; d
dp
; Q
ue
lle:
ZD
F, 1
8.0
9.1
3;
imag
o;
Cit
ypre
ss2
4 (
v.l.n
.r.)
; Illu
stra
tio
n:
Pe
ter
Ste
mm
ler/
Qu
ickh
on
ey
für
DIE
ZE
IT

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
21
Einfach und niedrigDie Brandstwiete in Hamburg war einst die Adresse des Spiegels. Nun steht das Haus leer, es wirkt noch düsterer als zu der Zeit, als man dort noch das Mündungsfeuer des »Sturm-geschützes der Demokratie« (Augstein, der Ältere) blitzen sah. Heute arbeitet die Redak-tion an der Ericusspitze; dort ist es so hell, dass der Chefredakteur im Konferenzraum schon mal die Sonnenbrille aufbehält. Eines ist den sprachbewussten Spiegel-Leuten durch den Umzug immerhin erspart geblieben: der Blick auf die Schneiderei Frech in der Brands-twiete und ihr Schild »Massanfertigung«.
Richtig geschrieben, aber sprachlich falsch war die Forderung des damaligen FDP-Chefs Guido Westerwelle nach einem »niedrigeren, einfacheren und gerechteren Steuersystem«. Ein niedriges System, was sollte das sein? Fi-nanzminister Schäuble hat es nicht verstanden und die Sache ignoriert. Zahlen können hoch oder niedrig sein. 4,8 Prozent der Wähler-stimmen zum Beispiel, die sind einfach, nied-rig und gerecht. RÜDIGER JUNGBLUTH
30SEKUNDEN FÜR
Die Online-PiratenWie die »Huffington Post« Geschichten vermarktet und damit riesigen Erfolg hat S. 24
Vorsicht vor den
radikalen KräftenEinfache Rezepte gegen die Krisesind verführerisch und gefährlich
Was haben so unterschiedliche Ereignisse wie der Erfolg der Euro-Skeptiker in Österreich, die Regierungsturbulenzen in Italien und der Schuldenstreit in den USA miteinander zu tun? Sie künden davon, dass die Krise in eine neue Phase eingetreten ist.
In dieser Phase geht es mehr um Politik als um Ökonomie. Denn auch wenn die wirt-schaftliche Lage im Süden Europas und in Teilen der USA nach wie vor angespannt sein mag: Die Konjunktur hat sich stabilisiert. Es geht allmählich wieder aufwärts. Noch viel zu langsam zwar, aber immerhin.
Der Kampf gegen den Absturz hat die ra-dikalen Kräfte in den Gesellschaften des Wes-tens gestärkt. Harte Sparprogramme auf der einen und milliardenschwere Hilfskredite auf der anderen Seite scheinen den in der Bevölkerung verbrei-teten Eindruck zu bestätigen, dass bei der Rettungspolitik Maß und Mitte ver-loren gegangen sind. Gruppierungen wie die Tea Party in den USA oder die AfD in Deutschland bezie-hen ihre Stärke aus der Sehnsucht nach einfachen Antworten auf die Herausforderungen der Krise.
Doch die gibt es nicht. Rettungspakete und Reformauflagen werden weiter zum politi-schen Alltag gehören. Wenn die Politik das den Menschen nicht zu erklären vermag, steht mehr auf dem Spiel als die zarte Erholung der Konjunktur. MARK SCHIERITZ
Barack Obama kämpft gegen die Tea Party
Von oben betrachtet, wirkt die Ark-tis, als hätten sich die Umwelt-schützer durchgesetzt: Unberührt glitzern Eisberge in der Sonne, nirgendwo ragt ein Bohrturm aus dem Wasser, keine Förderplatt-form stört die Idylle.
Unter dem Wasserspiegel hingegen sieht es aus wie in einem futuristischen Industriekomplex. Dut-zende vollautomatische Bohr- und Zapfstellen sind mit Verteilerstationen, Separatoren, Pumpen und fußballfeldgroßen Kompressoren verbunden. Auf dem Meeresgrund sind gigantische Maschinenparks entstanden. In völliger Finsternis fördern sie Öl und Gas aus dem arktischen Boden, das über lange Pipe-lines an Land gelangt. Weil kein Mensch dort unten überleben könnte, bewirtschaften ausschließlich Roboter die Unterwasserfabriken.
Es ist eine gespenstische Szenerie. Gerade so, als hätten die Regisseure des Films Matrix den Meeres-grund als fossiles Nachschublager in Szene gesetzt.
Noch ist das Treiben unter Wasser eine Simula-tion. Aber sie wird gerade Wirklichkeit. Bis 2020 will der norwegische Energiekonzern Statoil die erste För-deranlage bauen, die sich vollständig unter Wasser befindet. Spinnerei ist das nicht: Schon heute beutet Statoil in der Barentssee das Snøhvit-Feld weitgehend unterseeisch aus. Die restlichen technischen Pro-bleme dürften in den nächsten Jahren gelöst werden, zumal neben Statoil auch Shell, BP, Exxon und Total mehr ihrer Maschinen im Meer versenken wollen.
Als »heiligen Gral« der Öl- und Gasindustrie hat die Nachrichtenagentur Reuters die Unterwasserpro-duktion mal bezeichnet. Die Konzerne könnten damit auch schwer zugängliche arktische Regionen erschließen, wo herkömmliche Bohrplattformen durch starke Stürme und treibende Eisberge von Kleinstadtgröße bedroht wären. Am Meeresgrund wären solche Gefahren gebannt, und man müsste auch keine Arbeiter mehr aufwendig mit Helikoptern zu den Produktionsanlagen fliegen. Stattdessen könnten Mitarbeiter der Konzerne gigantische Res-sourcen vom Büroschreibtisch aus ausbeuten: In der Arktis werden 13 Prozent aller unerschlossenen Ölre-serven vermutet, beim Gas sind es sogar 30 Prozent.
Doch die großen Pläne von Statoil & Co. werfen auch Fragen auf. Wie verlässlich ist die Technik wirk-lich? Wer wird von ihr profitieren? Und was passiert, wenn etwas schiefgeht? Der Untergang der BP-Öl-bohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Me-xiko vor drei Jahren hat zu einer der größten Umwelt-katastrophen geführt – und gezeigt, wie schwierig es ist, Bohrlöcher unter Wasser abzudichten. Wie soll das dann erst in der schwer zugänglichen Arktis ge-lingen, in der das Wasser vielleicht sogar mit einem Panzer aus Packeis verschlossen ist?
Umweltschützer fordern schon lange ein Verbot von Bohrungen in dem fragilen Ökosystem der Ark-tis. Doch Espen Barth Eide, Außenminister unter dem gerade erst abgewählten norwegischen Minister-präsidenten Jens Stoltenberg, hat sich im vergangenen Jahr festgelegt. »Die Ausbeutung der arktischen Ressourcen wird stattfinden«, sagte er. Vor allem »unter Wasser«, wo es keine Witterungseinflüsse gebe.
Im Großraum Oslo versuchen derzeit viele Men-schen, den Plan umzusetzen. Die norwegische Hauptstadt ist zugleich das Zentrum der Unter-wasserforschung. Von dort bis ins 80 Kilometer west-lich gelegene Kongsberg erstreckt sich das sogenann-te Subsea Valley, in dem rund 200 Unternehmen an der Öl- und Gasgewinnung auf dem Meeresgrund tüfteln. Fast alle sind Zulieferer oder Subunternehmer von Statoil, dem mit knapp 30 000 Mitarbeitern größten Konzern Norwegens. Statoils Repräsentanz in Fornebu bei Oslo nimmt die Zukunft zumindest durch futuristisch anmutende Architektur schon vorweg. Das Gebäude besteht aus fünf übereinander-
Fabriken unter WasserAuf der Suche nach Öl und Gas will der norwegische
Energiekonzern Statoil ganze Förderanlagen auf dem
arktischen Meeresgrund verankern. Technisch ist die
Idee brillant und ökonomisch verlockend. Aber ist sie auch
zu verantworten? VON FELIX ROHRBECK
Fortsetzung auf S. 22
Foto
s: S
eaT
op
s;Z
han
g Ju
n/
Xin
hu
a/d
dp
(r.
)
WIRTSCHAFT

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
gestapelten, länglichen Blöcken, die an zufällig auf-einandergeworfene Mikadostäbchen erinnern.
Wie wichtig das Unternehmen für das Land ist, zeigt sich an einem Tag im September. Hunderte Sol-daten haben sich rund um Statoil postiert und robben mit ihren Gewehren bis auf wenige Meter an das Ge-bäude heran. Das Militär übt die Verteidigung gegen eine imaginäre terroristische Gruppe, die wichtige Einrichtungen in Norwegen angreift – solche wie Stat-oil. Der Konzern setzt im Jahr 80 Milliarden Euro um und gehört zu zwei Dritteln dem Staat. Öl und Gas machen ein Viertel des norwegischen Bruttoinlands-produkts aus und sind das wichtigste Exportgut.
Im Innern des Statoil-Gebäudes flitzen Mitarbeiter auf Elektrofahrzeugen durch die Lobby. Besucher re-gistrieren sich an einem Terminal, der zuständige Mit-arbeiter bekommt dann automatisch eine SMS. Zwar ist Rune Mode Ramberg, Statoils Chefingenieur für die Subsea-Technik, gerade in Stavanger, er wird aber per Videokonferenz dazugeschaltet. Der Bildschirm zeigt einen blonden Mann Mitte vierzig, der viel lacht und ziemlich gelassen wirkt. Dabei hat er einen Job von nationaler Tragweite: Er soll Statoils erste kom-plette Unterwasserfabrik verwirklichen.
Man darf sich Ramberg als eine Art technischen Dirigenten vorstellen, der einem internationalen Or-chester aus Lieferanten und Sublieferanten vorsteht. Darunter sind riesige Konzerne wie General Electric,
aber auch deutsche Mittelständler. Sie entwickeln Bauteile, Ramberg gibt Richtung und Zeitpläne vor. »Bei der Unterwasserfabrik«, sagt er, »geht es darum, erstmals alle Subsea-Komponenten auf dem Meeres-grund zusammenzufügen.«
Wie schwierig es für Ingenieure ist, Unterwasser-komponenten zu bauen, erahnt man bei einem Besuch des deutschen Pumpenbauers Bornemann in Obern-kirchen. Stefan Ladig, der bei Bornemann den Subsea-Bereich verantwortet, sagt, unter Wasser gebe es Dinge zu beachten, »an die man im terrestrischen Bereich gar nicht denkt«. Die Herausforderungen seien so groß wie sonst nur in der Weltraumtechnik. Nicht nur, dass Anlagen auf dem Meeresgrund ande-ren Belastungen ausgesetzt sind und ein Vielfaches an Elektronik benötigen. Sie müssen auch deutlich länger halten – und das, ohne dass Techniker sie warten. »Eine Pumpe hochzuholen und zu reparieren ist teurer als die Pumpe selbst«, sagt Ladig. Bei Wassertiefen über 1000 Meter könne es mehrere Millionen Euro kosten.
Roboter sollen defekte Förderanlagen notfalls reparieren
Nicht nur bei Bornemann, auch andernorts in Deutschland haben Ingenieure lange getüftelt. Mit kräftiger finanzieller Unterstützung vom Bundeswirt-schaftsministerium, das ein Forschungsprojekt Go Subsea aufgelegt hat, um die Entwicklung von Unter-wasserfabriken zu fördern und heimische Firmen am Subsea-Boom teilhaben zu lassen.
Das letzte Problem, das Statoil davon abhält, voll-ständige Förderanlagen auf dem Meeresgrund zu ver-
ankern, versuchen die Norweger indes selbst zu lösen: Es fehlt an tiefseetauglichen Gaskompressoren, um den Rohstoff aus der Tiefe pumpen. Daran versucht sich Aker Solutions, einer der wichtigsten Zulieferer von Statoil, dessen Hauptsitz nur wenige Minuten Fußmarsch vom futuristischen Gebäude seines Auf-traggebers entfernt liegt.
Kjell Olav Stinessen arbeitet schon fast 30 Jahre lang an dem Gaskompressionsproblem. Mittlerweile ist der knorrige Chefingenieur von Aker Solutions 71. Er weigert sich, in Rente zu gehen, bevor sein Lebens-werk vollendet ist – und steht jetzt kurz davor.
1985 hat Stinessen seine Idee erstmals auf ein Stück Papier gekritzelt. Es zeigt die Umrisse eines Gaskom-pressors, darüber eine geschlängelte Linie, den Mee-resspiegel. Dazu hat er ein paar Seiten mit der Schreib-maschine verfasst, die, leicht angegilbt, vor ihm auf dem Tisch liegen. Seine Analyse besagt, dass es wenig sinnvoll sei, Kompressoren, mit denen man Gas aus der Tiefsee pumpt, auf Plattformen an der Oberfläche zu installieren. »Je dichter sie am Bohrloch sind, desto weniger Energie verbrauchen sie und desto mehr Gas können sie aus der Erde befördern«, sagt Stinessen. Die Schlussfolgerung: Die Kompressoren müssen runter zu den Bohrlöchern.
Die Reaktionen auf Stinessens Idee waren stets die gleichen: faszinierend, aber technisch unmöglich. Erst als es immer schwieriger und teurer wurde, Gasquellen mit konventionellen Mitteln auszubeuten, steckten die Konzerne Geld in die Entwicklung unterseeischer Kompressoren.
Mittlerweile wetteifern Shell und Statoil um den ersten Gaskompressor auf dem Meeresgrund. Statoil
liegt vorn, denn Aker Solutions hat im Juni bereits den Stahlrahmen geliefert, der ihn tragen soll, ein gelbes Monstrum, 74 Meter lang, 1800 Tonnen schwer. Rund 200 Kilometer nordwestlich von Trondheim wurde er im Meer versenkt. Der Kom-pressor soll bald folgen, schon 2015 soll die Pro-duktion beginnen. »1,5 bis 2 Milliarden Euro« habe Statoil investiert, sagt Chefingenieur Ramberg.
Die Risiken geht der Konzern in der Hoffnung auf enorme Profite ein. Der Kompressor soll aus dem bereits erschlossenen, aber allmählich an Druck verlierenden Åsgard-Feld eine weitere Men-ge an Erdgas herauspressen, die der Energiemenge von 280 Millionen Barrel entspricht – im Verkaufs-wert von mehr als 20 Milliarden Euro. »Die ganze Branche schaut auf dieses Projekt«, sagt Svenn Ivar Fure, der den Subsea-Bereich bei Aker Solutions verantwortet. »Wenn alles klappt, werden auch die anderen großen Öl- und Gaskonzerne bei uns an-klopfen.« Statoils Chefingenieur Ramberg müsste die Puzzleteile der Unterwasserfabrik nur noch zu-sammensetzen. »Wir müssen die Komplexität des Systems verstehen«, sagt er, »lernen, es zu steuern und zu kontrollieren, ohne auch nur einen Men-schen dort unten zu haben.«
Mit dieser Problematik hat sich der Schriftsteller Frank Schätzing schon beschäftigt. In seinem Ro-man Der Schwarm beschreibt er eine Katastrophe am Meeresgrund. In der fiktiven Geschichte verliert der Konzern den Kontakt zu einer automatischen Unterwasserfabrik. Der verantwortliche Mitarbei-ter, im Roman heißt er Clifford Stone, hatte zuvor zwei kritische Gutachten über die Gefahren unter-schlagen. Am Ende liegt die Anlage in Trümmern.
Wie im Roman soll auch die echte Unterwasser-fabrik am norwegischen Kontinentalschelf ent-stehen. »Wahrscheinlich in der Arktis«, sagt Ram-berg, dort also, wo die Ressourcen der Zukunft liegen. Er erwägt auch einen Probelauf in der Nordsee, weil dort die Bedingungen nicht so extrem sind, aber die Arktis ist sein Favorit.
Selbst die Rückseite des Mondes sei gründlicher erforscht als die arktische Tiefsee, sagen Wissen-schaftler. Das könnte den geplanten Unterwasser-fabriken noch Probleme bereiten. Die Meeresbio-login Antje Boetius, die am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven arbeitet, hat von ihrer letzten Expedition in die Ark-tis Videoaufnahmen vom Meeresboden unter dem Eis mitgebracht. An vielen Stellen sieht der Mee-resboden grün aus, obwohl es in der Tiefsee mangels Licht eigentlich keine Pflanzen geben dürfte. Der Grund ist der Klimawandel. Das Eis an der Ober-fläche schmilzt, und was darin gelebt hat, sinkt in die Tiefe. Deshalb ist es dort unten nun, wie Boe-tius sagt, »voll von Eisalgenresten«.
Der Anstieg der Temperaturen könnte gefährlich werden, weil im Gestein, auf dem die Fabriken stehen sollen, außer Öl und Gas auch viel gefrorenes Methan schlummert. Wärmeres Wasser könnte es zum Schmelzen bringen. Schlimmstenfalls, sagt Boetius, könne dann der Boden wegbröckeln, auf dem die Unterwasserfabriken stehen. Alles läge in Trümmern. So wie in Schätzings Roman.
Wie realistisch so ein Horrorszenario ist, vermag niemand sicher zu sagen. Fest steht aber: Am Mee-resboden herrschen andere Gesetze als an Land. Auch seine Bewohner wirken wie aus einer anderen Welt. Auf Boetius’ Video sieht man eine pralle, stachelige Wurst, die die Biologin als »schlamm-fressende Seegurke« identifiziert. Sie treibt träge dahin, wie alles dort unten recht entschleunigt wirkt. Was man nicht sieht: In der Tiefsee herrscht ein gewaltiger Druck. »Es muss sich anfühlen, als stünde einem ein Elefant auf dem Finger«, sagt Boetius. Es ist kein Ort für Menschen. Wer in Tiefen von mehreren Hundert oder sogar Tausend Metern überleben will, muss wie die Seegurke zu 99 Prozent aus Wasser bestehen.
Oder aus Metall. Deshalb sollen Roboter, so-genannte Remotely Operated Vehicles, die Unter-wasseranlagen installieren, instand halten – und im Notfall eingreifen. Das Problem: Der maschinelle Reparaturtrupp muss irgendwie dort runterkom-men. Man könnte die Roboter zum Beispiel, an einem Kabel hängend, von Schiffen herunterlassen. Was aber, wenn es stürmt oder alles vereist ist, sodass die Schiffe gar nicht bis zur Unglücksstelle vor-dringen können?
Die Konzerne wissen um das Problem, glauben aber, es mit technischen Lösungen beherrschen zu
können. Am Norway Marine Technology Research Institute entwickeln Wissenschaftler ein U-Boot, das lange Strecken unter dem Eis hindurchtauchen und die Unterwasserfabriken mit Material und Er-satzteilen versorgen könnte. Parallel dazu entsteht eine neue Generation von Robotern, die nicht mehr von Schiffen herabgelassen werden müssen, sondern permanent in den Unterwasserfabriken bleiben. Sie würden sich unter Wasser selbstständig aufladen und ihre Wartungsaufträge direkt am Meeresgrund erhalten. Das Ergebnis wäre eine Fabrik, die sich selbst steuert und notfalls auch repariert.
Ganz will der Mensch die Kontrolle freilich nicht aus der Hand geben, überwachen will er die Anlagen schon. Wie das vonstattengeht, erfährt man in Moss. Das kleine Städtchen liegt eine Stun-de Autofahrt von Oslo entfernt. Hier produziert Aker Solutions sogenannte Umbilicals, Versor-gungskabel also, die Strom, Daten und Chemikalien zu den Unterwasseranlagen bringen sollen. Das Herzstück der Produktionsanlage erinnert an einen überdimensionierten Webstuhl. In ihm werden bis zu 37 Leitungen und Rohre miteinander verfloch-ten und anschließend mit einer gelben Schutz-schicht umhüllt. Dann werden sie auf Rollen gewi-ckelt, die draußen, auf dem Vorhof der Fabrik, wie bunte Riesenräder auf einem Jahrmarkt nebenei-nanderstehen. Je größer die Rolle, desto länger das Umbilical und desto weiter die Entfernung, die es von Land aus zu Unterwasseranlagen überbrücken kann. Bislang ist bei 140 Kilometer Schluss. Bald schon aber, schätzen Experten, könnten es bis zu 500 Kilometer sein.
Die Datenmengen, die durch solche Umbilicals in den Kontrollraum an Land fließen, wachsen ex-ponentiell mit der Komplexität des Systems. Um sie verarbeiten zu können, entwickelt die deutsche Firma Weisang ein Überwachungssystem für den geplanten Subsea-Gaskompressor von Shell, das Daten aus mehr als 1200 Kanälen sammelt und auf bis zu 20 Terabyte ausgelegt ist. Eine komplette Unterwasserfabrik – sie würde nicht nur Öl- und Gas aus der Tiefsee befördern, sondern auch eine ungeheure Datenflut.
»Wenn Öl austritt, sprudelt es im Zweifel den ganzen Winter hindurch«
Kabel, Roboter, U-Boote, Daten, wenn all die damit verbundenen Probleme gelöst sein sollten, bleiben dennoch viele Fragen. Eine davon stellt sich Rune Mode Ramberg, Statoils Subsea-Chefingenieur, selbst: »Sind wir in der Lage, die Anlage sicher zu betreiben?« Er macht eine kurze Pause vor seiner Antwort, die rhetorischer Natur ist, aber vielleicht auch ein kleines Zögern darstellt: »Ich bin sicher, wir sind es!« Doch reicht Vertrauen in das technisch Machbare? Wissen die Verantwortlichen bei Statoil, Shell Aker Solutions und all den anderen Unter-nehmen wirklich, was sie tun? Oder übernimmt sich der Mensch bei dem Versuch, die letzten Öl-und Gasvorräte des Planeten auszubeuten?
Einerseits, sagt Catalin Teodoriu, der am Institut für Erdöl- und Erdgastechnik der TU Clausthal forscht, seien die Subsea-Sicherheitsstandards »hö-her als die bei Flugzeugen«. Alle Systeme seien doppelt oder sogar dreifach vorhanden. Doch im Unterschied zu Flugzeugen gibt es in Unterwasser-fabriken keinen Piloten. Man könne sie mit auto-matischen Fahrsystemen im Auto vergleichen, sagt Teodoriu. Noch könne die Technik nicht so flexibel wie ein Mensch reagieren. Sollte es trotz aller Vor-kehrungen zu einem Blow-out kommen, einem unkontrollierten Austritt von Öl oder Gas, so wären die Konsequenzen fatal. Spätestens vom Herbst an ist die Arktis zu großen Teilen vereist und mit dem Schiff nicht mehr zu erreichen. »Wenn dann etwas passiert, sprudelt es im Zweifel den ganzen Winter hindurch«, sagt Jörg Feddern, der sich mit dem Thema bei Greenpeace beschäftigt.
Die erste Unterwasserfabrik wird Statoil wohl in der äußeren Arktis bauen, wo sie dank des war-men Golfstroms permanent eisfrei ist. Doch das Wettrennen um ihre Ressourcen wird die Konzerne in immer tiefere Tiefen und schließlich unter das ewige Eis führen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie irgendjemand daran hindern wird. Es gibt kein in-ternationales Umweltschutzabkommen für die Arktis. Es gilt das Seerecht. Die Anrainerstaaten entscheiden, was vor ihren Küsten erlaubt ist. Und Norwegen hat sich schon entschieden.
Fabriken unter Wasser
Fortsetzung von S. 21
Kompressor
Separator
Pumpe
VersorgungskabelUmbilical
WartungsroboterCrawler
Bohrlöcher
Kontinentalschelf
Die Fabrik auf dem MeeresgrundWie Öl und Gas unter Wasser gefördert werden sollen – ganz ohne Plattformen an der Oberfläche
bis zu
3000 m tief
70 m lang, 20 m hoch
trennt Gas und ÖlFörderung von
Gas und Öl
bis zu 140 km von der Küste entfernt
ZEIT-GRAFIK: Dieter Duneka/Quelle: eigene Recherche
22 WIRTSCHAFT

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Ein Herz für die WirtschaftNach dem Ende der FDP entdecken Grüne und SPD ihre liberale Seite und hoffen auf die Zuneigung der Unternehmen VON ELISABETH NIEJAHR UND PETRA PINZLER
Lange bevor Angela Merkels neue Re-gierung steht, ist klar, wofür sie im Bundestag Beifall bekommen wird – und wofür nicht. Sollte die Kanz-lerin höhere Steuern, steigende Mütterrenten oder eine Mietpreis-bremse ankündigen, wird es keine
Pfiffe, Buhrufe oder Schmähreden geben, sondern höchstens ein bisschen Genörgel über Details. Kein FDP-Vertreter wird mehr ordnungspolitische Be-denken vortragen. Denn außer Merkels Union werden nur noch Parteien im Bundestag vertreten sein, die solche Vorhaben gut finden: Sozialdemo-kraten, Linke und Grüne. Der Regierung werden dann zwei linke Oppositionsparteien gegenüber-stehen, und auch die Union selbst wird sich dank eines roten oder grünen Koalitionspartners verän-dern. Noch vor der ersten Sitzungswoche steht fest: Die SPD hat zwar verloren, aber sozialdemokrati-scher war das Parlament noch nie.
»Mein Nachfolger wird es schwer haben, dabei war es schon für uns nicht leicht«, sagt Josef Schlar-mann, der Bundesvorsitzende der CDU-Mittel-standsvereinigung in einem Abschiedsgespräch mit der Presse am vergangenen Freitag. Er will nach acht Jahren an der Spitze der einst stolzen Wirtschaftsver-einigung sich nun in einem Buch über die Kanzlerin den Frust der vergangenen Jahre von der Seele schrei-ben. In zwei Wochen wird sein Nachfolger gewählt, als aussichtsreichster Kandidat gilt neben dem frühe-ren Grünen-Politiker Oswald Metzger der weithin unbekannte 36-jährige Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann. Im achten Jahr von Merkels Kanzlerschaft ist die Personaldecke der Union dünn geworden, ganz besonders beim Wirtschaftsflügel.
»Bitte lachen Sie jetzt nicht«, antwortet ein Spit-zenmanager eines Wirtschaftsverbandes entschuldi-gend auf die Frage, wem man sich verbunden fühle, »aber unser Hoffnungsträger ist eigentlich Günther Oettinger.« Der EU-Kommissar und abgewählte baden-württembergische Ministerpräsident feiert Mitte Oktober seinen 60. Geburtstag. Als aussichts-reichster Kandidat für ein unionsgeführtes Wirt-schaftsressort gilt Alexander Dobrindt. Der CSU-Generalsekretär war zwar vier Jahre lang Geschäfts-führer eines mittelständischen Maschinenbauunter-nehmens, ist seitdem aber nie durch Wirtschaftskom-petenz aufgefallen.
CDU-Wirtschaftspolitiker verzagen, die SPD sucht Verbündete in der Industrie
In der Union könne man als Wirtschaftspolitiker nun mal keine Karriere machen, seufzt ein CDU-Wirt-schaftsexperte. Michael Fuchs, der als Fachmann für Wirtschaft dem Fraktionsvorstand der Union in Berlin angehört, klagt: »In diesem Job gehören sie immer zu den Bösen.« Fast ein Jahr lang erlebte er, dass Demonstranten regelmäßig sein Privathaus in Koblenz belagerten. Jede Woche versammelten sich Demonstranten gegen den »Atom-Fuchs«, weil er die Ausstiegspläne der Bundesregierung kritisiert hatte.
So viel Verzagtheit ist erstaunlich für die Partei Ludwig Erhards, denn gewählt wurde Angela Merkel auch wegen ihres »Neins« zu höheren Steuern und der guten Konjunkturlage, die viele Wähler offenbar ihr zuschreiben. Als die For-schungsgruppe Wahlen kürzlich ermittelte, wem die Deutschen zutrauten, »die Wirtschaft nach vorn zu bringen«, nannten 47 Prozent die CDU und nur 17 Prozent die SPD.
Einflussreiche Parteistrategen bei den Sozialde-mokraten, aber auch bei den Grünen, wollen das ändern. Im Wahlkampf haben beide Parteien zwar kaum um Unterstützer aus der Wirtschaft gewor-ben. Und auch jetzt reden viele ihrer Führungs-kräfte öffentlich noch mit Vorliebe über Steuerer-
höhungen. Aber zugleich schauen sie bereits mit Interesse auf die Konkursmasse der FDP. Wer wird künftig Ansprechpartner und Verbündeter für Unternehmen und Wirtschaftsverbände sein? Seine Partei habe für Erhalt und Stärkung klassi-scher Industrien geworben, als alle Welt von Dienstleistungen sprach, sagt der SPD-Abgeord-nete und wirtschaftspolitische Sprecher Hubertus Heil. In der Finanzmarktkrise habe sich das aus-gezahlt, »heute beneidet uns die ganze Welt«.
Ungewöhnlich schnell und laut haben die gro-ßen Wirtschaftsverbände nach der Bundestags-wahl erklärt, dass sie lieber schwarz-rot als schwarz-grün regiert werden wollen. Von den Sozialdemo-kraten erwarten die Lobbyisten eine deutlich in-dustriefreundlichere Fortsetzung der Energiewen-de als von den Grünen. In den Reihen der neuen SPD-Fraktion sitzen mehrere Parlamentarier, die ein offenes Ohr für die Wünsche der Energiekon-zerne haben, darunter gleich drei Gewerkschafts-funktionäre der besonders konservativen IG Berg-bau, Chemie, Energie (IG BCE): Bernd Westphal, Ulrich Roland Freese und Ulrich Hampel.
Lobbyisten verlassen sich auf die Mitarbeiter in den Ministerien
Wenn es wirklich um etwas geht, wenden sich die Lobbyisten allerdings lieber direkt vertrauensvoll an die mächtigste Frau der SPD, die nordrhein-west-fälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. So wird sich RWE-Chef Peter Terium in den nächsten Tagen mit ihr treffen, nicht zuletzt, um über die Regierungs-bildung in Berlin zu sprechen. Auch der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garrelt Duin und sein Kollege Matthias Machnig aus Thüringen könn-ten die Lücke füllen, die durch den Abschied der FDP aus dem Bundestag entstanden ist.
Sogar SPD-Chef Sigmar Gabriel wird nachgesagt, er würde gern Chef eines Wirtschaftsministeriums werden, das um Kompetenzen aus den Ressorts Um-welt, Verkehr, Außen und Entwicklung angereichert wird. Dass gerade ein Sozialdemokrat Wirtschafts-kompetenz braucht, um Kanzler zu werden, hat er vom Ex-Kanzler Gerhard Schröder oft gehört. Ent-schieden ist noch nichts, aber nach diesem Planspiel könnte Gabriel Superminister werden – der Mann, der Deutschland modernisiert. Er würde nicht nur die Energiewende managen, sondern auch die ge-samte deutsche Infrastruktur renovieren.
Auch bei den Grünen ist Wirtschaftskompetenz neuerdings wieder angesagt, selbst wenn darüber in einer ganz anderen Tonlage gesprochen wird. Die Sozialdemokraten debattieren darüber, ob sie mit Merkel koalieren sollen, die Grünen diskutieren ihre Fehler. Der grüne baden-württembergische Minister-präsident Winfried Kretschmann hat gefordert, seine Partei müsse in der Wirtschaft wieder stärker einen Partner sehen. Kerstin Andreae, Wirtschaftspolitike-rin aus Freiburg, Baden-Württemberg, und Kandida-tin für den Fraktionsvorsitz in Berlin steht für diesen Kurs. Ihr Name fällt immer wieder wohlwollend, wenn man Verbandsvertreter nach Grünen fragt, die mit Unternehmern reden können. »Wir wollen einen offenen Dialog«, sagt Andreae. Sie will beispiels-weise die Forschung steuerlich besser gefördert sehen. Man brauche die Innovation der Wirtschaft schließ-lich, wenn die Energiewende funktionieren soll.
Katrin Göring-Eckardt würde da nicht wider-sprechen. Die Spitzenkandidatin der Grünen im Wahlkampf ist neben Andreae die zweite – und aussichtsreichere – Anwärterin auf den grünen Spitzenjob im Parlament. Viele der klassischen Frontlinien zwischen Politik und Wirtschaft hät-ten sich ohnehin verändert, sagt sie, dafür sorge unter anderem schon der Mangel an Fachkräften. »Wenn man für eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, für Investitionen in Bildung oder für eine andere Integrationspolitik wirbt, gibt es dafür sogar beim BDI Applaus«, sagt sie.
Im Wahlkampf hätten sich die Wirtschaftsver-bände vor allem deshalb auf die Grünen einge-schossen, weil sie nicht als Regierungspartei von morgen galten, heißt es nun allenthalben in der Partei. »Die Festlegung nur auf Rot-Grün war ein Fehler, den wir nicht wiederholen dürfen«, sagt der Finanzexperte Gerhard Schick. Außerdem hät-te die Ökopartei sich mehr Bündnispartner su-chen müssen – bei den Gewerkschaften, aber auch bei innovativen Unternehmen. »Wenn man so heftig angegriffen wird, sollte man nicht nur die blauen Flecken zählen, sondern sich darum bemü-hen, dass einem beim nächsten Mal jemand zur Seite springt«, sagt Schick.
Bei den Wirtschaftsverbänden und auch bei vielen Unternehmen ist das Interesse an solchen neuen Bündnissen groß. Man habe Kontakte in allen Parteien und pflege wechselnde Bündnisse. Vor Kurzem hat der BDI gemeinsam mit der Che-miegewerkschaft IG BCE in einem offenen Brief gefordert, das Fracking zuzulassen, also die Nut-zung der erheblichen deutschen Schiefergasreser-ven. Und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di gegen die Luftverkehrsteuer plädiert, wie auch Air Berlin und andere Fluggesellschaften.
Am allermeisten versprechen sich Lobbyisten aller Ausrichtungen meist ohnehin von guten Kontakten in die Ministerien, nach dem Motto: Politiker kom-men und gehen, die Verwaltung bleibt. »Egal wer dirigiert, wir spielen immer die Neunte«, sagen selbst-
bewusste Abteilungsleiter. Wichtiger als die Minister selbst seien oft deren Mitarbeiter, sagt auch ein Lob-byist in Diensten eines Energieriesen. Und in denen stecke, Bundestag hin oder her, oft »FDP-Denke drin«. Er meint dabei Leute wie Detlef Dauke, den für Energiepolitik zuständigen Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium, oder Werner Ressing, Dau-kes für Industriepolitik zuständiger Kollege, der ge-rade pensioniert wurde. Er hinterließ in der Wirt-schaftswoche ein ganz besonderes Vermächtnis: Der von der Bundesregierung beschlossenen Energiewen-de bescheinigte er, teuer zu sein, instabil – und dem Industriestandort »fatale Risiken« zu bescheren. Auch wenn das im Bundestag keiner mehr laut sagt, werden diese Argumente nicht verschwinden.
Mitarbeit: FRITZ VORHOLZ
»Eitle Wissenschaftler und frustrierte Ehemalige«BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber über die AfD, unnötige Steuererhöhungen und »altmodische« Schuldentilgung
DIE ZEIT: Herr Kerber, was haben Sie gegen Steuererhöhungen?Markus Kerber: Solche Forderungen sind
von gestern. Darüber könnten wir reden, wenn es ein Loch im Haushalt gäbe. Aber das Bundesfinanz-ministerium prophezeit uns schon für das kommen-de Jahr einen ausgeglichenen Haushalt. Danach so-gar Überschüsse! Wir haben bald mehr Einnahmen als Ausgaben. Wer in so einer Lage über Steuererhö-hungen redet, leidet unter kognitiver Dissonanz.ZEIT: Der Finanzminister hat in der ZEIT Steu-ererhöhungen nicht ausgeschlossen. Sie waren ein enger Mitarbeiter von ihm. Was treibt Schäuble?Kerber: Darüber möchte ich hier nicht spekulie-ren. Tatsache ist: Die öffentlichen Kassen brauchen nicht mehr Steuern, der Staat verfügt über ausrei-chende, sogar ständig steigende Einnahmen. Das ist für viele ungewohnt, denn so etwas gab es im-merhin 40 Jahre nicht. Die neue Regierung muss nun entscheiden, wie sie das vorhandene Geld möglichst klug ausgeben will. Sie sollte damit Wachstum und Beschäftigung sichern. Keynes hat auch Rezepte für die guten Jahre.ZEIT: Die CDU will lieber Schulden tilgen.Kerber: Das wäre altbacken. Es ist richtig, wenn die Regierung keine neuen Schulden macht, so wie es die Schuldenbremse vorsieht. Ein ausgegliche-
ner Haushalt ist wichtig. Aber die Überschüsse, mit denen der Finanzminister für die kommenden Jahre rechnet, müssen investiert werden. Deutsch-land leidet unter zu niedrigen Investitionen. ZEIT: Woran machen Sie das fest?Kerber: Deutschland hat einen riesigen Investiti-onsstau. Über Jahre wurde weniger investiert, als nötig gewesen wäre. Die Leute merken, dass viele Straßen und Brücken nicht mehr befahrbar sind, viele Schulen den Kindern nicht mehr zuzumuten sind. Wir brauchen viel mehr Mittel für die Ver-kehrsinfrastruktur. Für Bildung. Für Forschung. Für intelligente Energienetze. Für Kommunika-tionsnetze. Das Deutsche Institut für Wirtschafts-forschung geht von einem Bedarf von drei Prozent des Inlandsproduktes aus, das wä-ren 75 Milliarden Euro im Jahr.ZEIT: Das klingt überraschend aus Ihrem Mund. Sie sind Mitglied der CDU ...Kerber: ... aber in erster Linie bin ich Anwalt der deutschen Indus-trie, und als solcher sage ich, dass die Wirtschaft massiv darunter leidet, dass in diesem Land in den vergangenen Jahren zu wenig in-vestiert worden ist. Mehr Investi-
tionen würden uns dauerhaft auf einen höheren Wachstumspfad führen. Wir können mehr errei-chen, als derzeit der Fall ist. Das erleichtert am Ende auch die Lösung des Schuldenproblems.ZEIT: Was bedeutet das für die Koalitionsverhand-lungen?Kerber: Ich persönlich glaube, so etwas könnte der SPD wie den Grünen eine Koalition mit der Uni-on erleichtern: Man verzichtet auf Steuererhöhun-gen, einigt sich aber darauf, die Haushaltsüber-schüsse zu investieren.ZEIT: Was erwartet die Wirtschaft von der neuen Regierung?Kerber: Für uns sind drei Dinge wesentlich. Ers-tens muss mehr investiert werden. Zweitens soll-
ten die Steuern nicht aus reiner Prinzipienreiterei erhöht werden, denn die Einnahmen erreichen bereits jetzt immer neue Rekorde. Und drittens brauchen wir end-lich eine realistische, konsistente Energiepolitik. Da ist in der letz-ten Legislaturperiode viel liegen geblieben. Wir unterstützen die Energiewende, aber sie muss bes-ser gesteuert und kosteneffizienter werden.
ZEIT: Könnte ein Energieministerium helfen?Kerber: Wir plädieren für eine Koordination der Energiewende im Kanzleramt. Sollte ein Koaliti-onsvertrag dies ausschließen, würde ich das Wirt-schaftsministerium ausbauen. Bündeln wir dort die Zuständigkeit für die Energie: für die Erneuer-baren, die Netze, die Infrastruktur und die welt-weite Vermarktung der Energiewende. Bis jetzt ist die Wende auf sechs Ministerien verteilt. Wie wäre es stattdessen mit einem Superministerium für Wirtschaft, Wachstum und Nachhaltigkeit? So eine effiziente Neuorganisierung der Bundesregie-rung hätte enorm positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und unser Wachstum.ZEIT: Warum haben eigentlich so viele Unterneh-mer die AfD gewählt?Kerber: Es stimmt, dass es in der Wirtschaft ver-einzelt Unterstützung für die AfD gibt. Die Par-tei spricht Leute an, die mit der Globalisierung überfordert sind. Da spielt die Sehnsucht nach Biedermeier und Spitzweg eine Rolle und das Gefühl: Früher war alles überschaubarer. Der allergrößte Teil der Wirtschaft steht aber voll hinter dem Erhalt des Euro. Für mich ist die AfD eine Bewegung von eitlen Wissenschaftlern und frustrierten Ehemaligen. Sie empfinden die Be-schleunigung der Wirtschaftsabläufe als Zu-
mutung. Ich empfinde viele Forderungen der AfD als Zumutung.ZEIT: Wird die AfD die FDP beerben?Kerber: Das hängt sehr davon ab, wie sich die Lage im Euro-Raum weiterentwickelt. Wenn die Kon-junktur so anzieht wie prognostiziert, wird auch die Beschäftigung weiter steigen, und es wird der Euro-Zone langsam besser gehen. Dann sehe ich wenig Chancen für die AfD.ZEIT: Und wenn wir erneut Hilfspakete für Grie-chenland schnüren müssen?Kerber: Natürlich darf der Reformeifer in den Kri-senländern nicht nachlassen. Aber man muss die Größenordnung realistisch sehen. Wir reden von unter 10 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Deutsch-land gibt jährlich 20 Milliarden für die Ökostrom-Förderung aus. Ein einstelliges Milliardenpaket für Griechenland sollte uns wirtschaftlich keine Alb-träume bereiten, zumal eks auf einer Analyse der Troika beruht und wir von der Gesamtsumme nur 27 Prozent tragen. Wir sind in Deutschland auf dem Weg in eine Drei-Billionen-Euro-Ökonomie, in Eu-ropa geht es um 13 Billionen BIP pro Jahr, das sind 13 000 Milliarden. Da sollte man gelassen bleiben.
Die Fragen stellten MARC BROST und PETRA PINZLER
Markus Kerber, Bundes-verband der Deutschen Industrie (BDI)
WIRTSCHAFT 23
Illu
stra
tio
n:
Be
ck f
ür
DIE
ZE
IT/
ww
w.s
chn
ee
sch
ne
e.d
e;
Foto
: U
nke
l/u
llste
in (
u.)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4124 WIRTSCHAFT
Die Online-Freibeuter sind da. In nur acht Jahren ha-ben sie unter Flagge der Huffington Post den ameri-kanischen Medienmarkt ge-entert und sind im Internet die Nummer zwei unter al-
len Nachrichtenangeboten geworden. Nur der Fernsehsender CNN hat online noch mehr Zu-schauer und Leser.
Wo die New York Times abgeblieben ist? Die Washington Post? USA Today? Deutlich dahinter.
»Wir veröffentlichen alle 56 Sekunden etwas Neues«, sagt Jimmy Maymann, Vorstandschef der Huffington Post. 1600 Nachrichten, Reportagen, Kommentare und Kolumnen täglich bringen Leser dazu, immer wiederzukehren. Das allein reicht den Verantwortlichen aber schon lange nicht mehr, die Vereinigten Staaten sind ihnen zu klein, deshalb be-treiben sie nun in sieben weiteren Ländern eigen-ständige Onlineausgaben, unter anderem in Kanada, Großbritannien, Japan, Italien und Frankreich. Kom-mende Woche startet die deutsche huffingtonpost.de.
Es ist kaum zu glauben, aber sie haben wirklich bei null und wirklich erst vor acht Jahren angefangen. Sie waren naive Neulinge, geniale Techniker und ein paar journalistische Haudegen. Angeführt wurden sie von Ariana Huffington, einer Griechin, die in Cambridge Volkswirtschaft studiert hat und seit den 1980er Jahren in den USA lebt. Sie hat die Webseite gegründet und ihr den Namen gegeben. Die Antwort auf die Frage, wie die Huffington Post werden konnte, was sie ist, ist eine der spannendsten Geschichten der Medienindustrie.
Um ihr nachzugehen, lohnt es sich, einige Tage in der New Yorker Zentrale der Huffington Post zu verbringen, auf zwei Etagen in einem Wolkenkratzer, dessen Fassade noch an die Mietskasernen der Jahr-hundertwende erinnert. Allein im oberen Groß-raumbüro sitzen mehr als 300 Redakteure. Wo das eine Ressort aufhört und das nächste anfängt, erkennt man nur an den Büchern, die sich neben den Com-putern stapeln. Hier die aktuellen Wirtschaftsbest-seller und die Grundlagenwerke zur Finanzkrise, da die neuesten Bücher der Technik-Euphoriker und -Apokalyptiker. Die Tischreihen erinnern an den Lesesaal einer Universitätsbibliothek, auch wegen der vielen jungen Redakteure, es herrscht nur mehr Un-ordnung, produktives Chaos.
Einer der erfolgreichsten Online-Freibeuter der Huffington Post hockt, wie könnte es anders sein, vor seinem Laptop. Über seinen linken Unterarm windet sich ein fetter Krake. Darüber, auf den Bizeps, hat er sich einen Engel tätowieren lassen. Es ist wie bei den historischen Freibeutern: Travis Donovan, 27 Jahre alt, hat von seinem Arbeitgeber den Freibrief be-kommen, woanders Geschichten zu stehlen.
Donovan ist journalistischer Chefentwickler der Huffington Post. Vor drei Jahren hatte er noch keine Ahnung von Journalismus und arbeitete als Sozial-arbeiter für behindertengerechtes Wohnen in Flag-staff, Arizona. Dazu hatte er aber irgendwann keine Lust mehr, zog nach New York und bewarb sich auf eine Praktikantenstelle im Umweltressort des Nach-richtenportals. »Ich bin so etwas wie ein Tech-Hippie. Der Klimawandel und Computer waren meine großen Themen, seit ich ein Kind war«, sagt er auf die Frage, was ihn auf den Beruf vorbereitet habe. »Mein Vater hatte immer die neuesten Computer im Haus. Ich bin damit groß geworden.«
Das genügte. Donovan bekam den Job und ent-wickelte sich innerhalb kurzer Zeit zum Musterredak-teur der Huffington Post. Deshalb erklärt seine Ge-schichte so gut, wie das Onlinemedium funktioniert. Was seinen Erfolg ausmacht.
Wettbewerber klagen, das Portal sei kein Medium, sondern ein Parasit
Donovan bekam am ersten Arbeitstag einen Tisch im Newsroom und fing an, im Schichtbetrieb das Internet nach spannenden Geschichten zu Umwelt und Klimawandel zu durchforsten. Sobald er eine fand, suchte er noch zwei, drei weitere Texte zu dem-selben Thema, schrieb eine Zusammenfassung, setzte Links zu den Originalen in den Text, suchte Bilder, entschied sich für eine Überschrift und stellte das Ganze online, sodass es auf der Nachrichtenseite erschien. Schon nach wenigen Monaten machte er seine Sache so gut, dass die Umweltseite der Huffing-ton Post die populärste Internetseite ihrer Art in Ame-rika wurde.
Der journalistische Nobody hatte alle anderen hinter sich gelassen, und damit das so blieb, saß Donovan immer vor dem Bildschirm, auch am Weihnachtsmorgen vor zwei Jahren. »Ich wollte, dass immer etwas auf der Seite los ist, meine Leser immer etwas Frisches sehen. Keiner hat mich dazu gezwun-gen, ich wollte einfach unbedingt dafür sorgen, dass meine Umweltseite die Nummer eins bleibt, egal, ob Weihnachten ist oder nicht.«
Wettbewerber klagen, die Huffington Post sei gar kein eigenständiges Medium, sondern ein Parasit. Sie gründe ihren Erfolg darauf, dass sie billige Laien beschäftige, die bloß die Arbeit der Konkurrenz zusammenfassten, verwursteten, mit reißerischen Überschriften versähen und damit Leser und Wer-bung auf sich ziehen würden. Das Ganze würden sie dann noch mal durch grenzwertige Vermarktung in sozialen Medien wie Twitter und Facebook stei-gern und damit wahren Journalisten die Existenz-grundlage rauben.
Donovan lächelt, er kennt diese Kritik: »Die meisten, die hier anfangen, haben wirklich keine
Alle 56 Sekunden was NeuesIn acht Jahren und inmitten der Medienkrise hat die »Huffington Post« mehr Leser gewonnen als die »New York Times«. Nun startet sie in Deutschland VON GÖTZ HAMANN
Die Huffington Post verlinkt
und verarbeitet Nachrichten
anderer Webseiten
Blogger und Experten
schreiben kostenfrei oder
veröffentlichen Einträge
parallel auf den Seiten der
Huffington Post und auf ihren
eigenen Seiten
HUFFPOST LIVE
Seit einem Jahr gibt es
HuffPost Live, einen
Video-Streaming-Dienst
Reporter werden nach und
nach angestellt und sorgen für
exklusive Geschichten.
Redakteure kümmern sich um
die Suchmaschinenoptimierung
INTERNET-
GEMEINDE
SOZIALE MEDIEN
Leiten einander Zuschauer
bzw. Leser zu
Verbreitet
Huffington-
Post-Artikel
auf Twitter,
etc.
NEWS
Schaut und
kommentiert HuffPost Live
Lädt Tausende aus der Community
ins HuffPost Live-Studio ein
Schreibt Kommentare,
debattiert untereinander
auf huffingtonpost.com
Liest die Huffington
Post und lockt dadurch
Werbekunden
Vermarktet
Artikel so gut
wie möglich auf
Twitter und
WIE DER INHALT
ENTSTEHT
Verstärken
Leserströme
Ahnung von Journalismus, aber eben auch keine Vor-urteile, wie Technologie und Journalismus zusam-mengehören.« Das unterscheidet die Huffington Post von etablierten Medien und deren Onlineablegern – im Zentrum des publizistischen Geschehens steht nicht der Journalist allein, er teilt sich diesen Platz mit einer leistungsfähigen Software, die dazu dient, Leser anzulocken und Nachrichten aggressiv zu vermarkten.
Grob gesagt, beginnt der traditionelle Journalist seine Arbeit mit einer Idee, er liest sich ein, recher-chiert und schreibt auf. Sobald ein Text veröffentlicht ist, endet seine Arbeit. Jetzt soll der Leser kommen.
Bei der Huffington Post kuratieren die meisten Redakteure ein Thema, tragen zusammen, was gera-de so los ist, und schreiben einen kleinen Einleitungs-text dazu. Oder sie bitten Experten, einen Kom-mentar für die Nachrichtenseite zu verfassen – ohne Honorar. Das ist die erste Hälfte des Jobs.
Sobald ein Text veröffentlicht ist, beginnt dann ein zweiter, für die Huffington Post mindestens genau-so wichtiger Arbeitsschritt: die aggressive Vermark-tung der Artikel. Die Redakteure suchen ihre Leser.
Dabei lassen sie sich von einer Software leiten, die von der Huffington Post selbst entwickelt wurde.
Man könnte auch sagen, ein Computerprogramm steuert die Redakteure. »Wir brüten hier eine neue Art von Redakteuren aus, eine Art, die es vorher noch nicht gab. Sie wird von der Technologie geformt«, sagt Donovan, der nach seiner Zeit als Umwelt-Redakteur zum Ausbilder für alle Neu-linge wurde.
Die Technologie soll vor allem Antworten finden auf die zentrale Frage der Huffington Post: Wie er-reichen wir unsere Leser und Nutzer?
Gedruckte Zeitungen bringt der Bote, die Huf-fington Post kommt über Soziale Netzwerke und Onlinemedien wie Twitter und Facebook. Sie ver-sendet ihre Botschaften über diese Dienste und er-reicht so jene Menschen, die ihre Mitteilungen abonniert haben. Was ihnen gefällt, leiten sie an Freunde weiter.
Dieser stete und dichte Strom von Nachrichten führt dazu, dass die Aufmerksamkeitsspanne in So-zialen Netzwerken oft extrem kurz ist. Wenn die Huffington Post in dieser digitalen Welt erfolgreich sein will, muss sie schnell sein. Sie muss grell sein.
Donovan sagt: »Für jedes Thema hat die Huf-fington Post ein eigenes Twitter-Konto, und mit
dem habe ich, als ich noch Umwelt-Redakteur war, viel ausprobiert. Optimal ist es, wenn da alle fünf Minuten eine Kurznachricht rausgeht, um auf einen der Artikel hinzuweisen. Und das 24 Stunden lang, 365 Tage im Jahr.« So viele neue Artikel gab es nicht, also dachte er sich für einen Artikel sechs oder sieben unterschiedliche Lock-rufe aus: Die Überschriften spitzte er jeweils an-ders zu. Was nicht lief, flog raus. Und die ließ er von der Software automatisch über Nacht versen-den, um für neue Aufmerksamkeit zu sorgen. Diese laufende Beschallung und Befütterung, »haben wir uns das nicht ausgesucht. Es ist eine Notwendigkeit, wenn wir für die Nutzer Sozialer Netzwerke relevant bleiben wollen«, sagt Vor-standschef Maymann. Tatsächlich gelangen die meisten Leser über Facebook und Twitter auf die Seiten der Huffington Post.
Die inzwischen berühmte eigene Software hilft den Redakteuren bei ihrem täglichen Kampf um Auf-merksamkeit im Internet. Denn sie misst alle Leser-reaktionen in Echtzeit und liefert sie den Redakteuren in Form von Statistiken auf den Bildschirm. Damit ist sie so etwas wie die Steuerzentrale.
Wenn ein Redakteur eine Botschaft über Twit-ter versendet und damit auf einen Artikel hin-weist, sieht er binnen Sekunden, wie viele den Ar-tikel lesen. Zeigt die Statistik miese Werte, kann er sofort reagieren und einen neuen Lockruf aussen-den. »Wie man eine saftige Überschrift macht oder eine Twitter-Botschaft formuliert, damit die Leser anbeißen, wissen die wenigsten, die hier an-fangen. Aber wenn man ihn mit unserer Software spielen und über Versuch und Irrtum lernen lässt, dann ist ein Anfänger nach gut einem Monat ein super Redakteur«, sagt Donovan. »Die einzige Strategie ist: Wir experimentieren.«
Die Software erzieht die Redakteure, sie ist die Steuerungszentrale
Man kann das auch so sagen: Die Software erzieht die Redakteure, lässt sie lernen, was gefragt ist. Das Prinzip Versuch und Irrtum geht so weit, dass mit der Software derselbe Artikel zur selben Zeit mit verschiedenen Überschriften und Fotos in ver-schiedene Lesergruppen vermarktet wird.
Manche Medienkritiker halten das für Betrug am Leser: erst fremder Journalisten Arbeit klauen, dann ein bisschen mischen und Lockstoffe auslegen. Aber die Leser der Huffington Post fühlen sich offenbar nicht betrogen. Sie hängen an dem Onlineangebot und diskutieren leidenschaftlich über einzelne Artikel. Zur Topnachricht des Tages schreiben sie oft mehr als 10 000 Kommentare, als der frühere Ge heim-dienstmitarbeiter Edward Snowden erste Dokumen-te über das Spionageprogramm des US-Geheim-dienstes NSA veröffentlichte, übertraf die Zahl der Leserkommentare mehrfach die Schwelle von 30 000. »Wir sind nicht nur ein Nachrichtenangebot, wir bieten eine Plattform, auf der unsere Leser unter-einander Konversation betreiben. Und was sie schrei-ben, ist oft mindestens so interessant wie die Artikel selbst«, sagt Vorstandschef Jimmy Maymann.
Die Werbeumsätze wachsen. Die Huffington Post weist nicht direkt aus, wie viel Umsatz sie mit dieser Art von Journalismus macht, weil sie seit 2011 nicht mehr selbstständig ist. Ariana Huffington hat das Portal für rund 300 Millionen Dollar an den Internet-konzern AOL verkauft, ist aber weiterhin treibende Kraft und Chefredakteurin der Huffington Post. In der Bilanz von AOL findet sich die Huffington Post nun zusammen mit anderen kleineren Onlinemedien in einer Sparte wieder, deren Umsätze pro Jahr um 10 Prozent und mehr steigen und die am Ende dieses Jahres irgendwo zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Dollar liegen werden.
Nun soll der deutsche Ableger in München zum Wachstum beitragen. In Kanada verdiene der Kon-zern jetzt schon Geld, in Großbritannien soll es Ende des Jahres so weit sein, sagt der Vorstandschef, und dass er für Deutschland den gleichen Plan habe wie für die anderen Märkte: zwei Jahre, bis der laufende Betrieb Gewinn abwirft, fünf Jahre, bis die Huffing-ton Post eine führende Position im Markt hat. Um diese Ziele zu erreichen, hat sich die Huffington Post mit der Tomorrow Focus AG zusammen getan, einem der großen deutschen Online-Werbevermarkter, der mehrheitlich zum Burda-Verlag gehört.
Ob sich dadurch die deutsche Medienlandschaft verändert? Anfangen werden sie wie die Huffington Post in den Vereinigten Staaten: Eine kleine Redak-tion wird das Internet nach Themen durchsuchen, sie neu arrangieren und über Soziale Netzwerke ver-markten. Schon jetzt bittet die Redaktion mit einer Handvoll angestellter Jungredakteure Blogger und Experten um Beiträge – die allerdings nicht bezahlt werden. Ob das Modell in Deutschland funktioniert, ist noch nicht abzusehen.
So es funktioniert, wird der deutsche Ableger in einigen Jahren den Punkt erreichen, an dem er ein paar erfahrene Reporter einstellt. Das hat zu-mindest die Huffington Post in den USA getan. Allein das Wirtschaftsressort beschäftigt inzwi-schen zwölf Journalisten, die exklusive Geschich-ten recherchieren. Sie betreiben traditionellen Journalismus, inmitten der Nachrichten-vermark-tenden Kollegen. Peter Goodman, ihr Chef und Leiter des Wirtschaftsressorts, erzählt gern folgen-de Geschichte: »Als die Obama-Administration vor einer Weile alle Daten über die Kosten der Gesundheitsversorgung öffentlich gemacht hat, hatten drei Medien einen privilegierten Zugang zu der Datenbank: die New York Times, die Washing-ton Post und wir. Aber nur wir haben den Skandal in den Daten entdeckt: dass die gleiche Untersu-chung in ein und derselben Stadt in einem Kran-kenhaus bis zu dreimal mehr kostet als in einem anderen. Da war ich, ehrlich gesagt, glücklich.«
Und das ist kein Einzelfall mehr. Die höchste Aus-zeichnung für Journalisten in den USA ist seit fast hundert Jahren der Pulitzerpreis, er wird für Enthül-lungen, Essays, brillante Fotos und anderes verliehen, und bislang haben Reporter von der New York Times und vom Wall Street Journal selbstverständlich bei-nahe jedes Jahr welche gewonnen. Manchmal hatte man den Eindruck, sie würden die Hauptpreise un-tereinander aufteilen. Doch im vergangenen Jahr gingen beide Blätter in einer wichtigen Kategorie leer aus: Der Pulitzerpreis für die beste Inlandsbericht-erstattung, eine Artikelserie über das Schicksal von Kriegsveteranen nach ihrer Heimkehr, ging an einen Reporter der Huffington Post.
Weitere Informationen im Internet: www.zeit.de/arianna-huffington
www.zeit.de/audio
Newsroom der »Huff ington Post«: Redakteure suchen im Netz nach Geschichten, die auf Twitter einschlagen
Foto
s: K
ai N
ed
de
n/
laif
(o
.),
Hu
fifn
gto
n P
ost
(u
.);
ZE
IT-G
rafi
k/
Mat
thia
s Sch
ütt
e;
Qu
elle
: e
ige
ne
Re
che
rch
e

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 WIRTSCHAFT 25
Das Netz bringt’s nichtHersteller wie Deuter und adidas fürchten, dass Amazon und Co ihre Marken beschädigen VON CHRISTIAN THIELE
Bernd Kullmann ist nicht bekannt dafür, dass er immer den be-quemsten Weg geht: Als erster und wohl auf absehbare Zeit auch einziger Mensch dieser Welt hat er 1978 den Mount Everest in Jeans bestiegen. Nach einem
schweren Bergunfall – Operationen, Rollstuhl, Krücken – ließ er sich eine Klettersohle unter den Gipsfuß montieren und kletterte Mehrseillängen-routen. Jetzt zieht Kullmann, Chef der Augsburger Rucksackfirma Deuter, seine Produkte aus dem Internet zurück: Deuter-Rucksäcke dürfen seit ein paar Wochen nicht mehr auf Amazon, eBay und anderen Internet-Plattformen verkauft werden.
»In unseren Produkten steckt eine Menge Hirn-schmalz. Uns ist Beratung sehr wichtig«, sagt Kull-mann. Beim Verkauf über Online-Plattformen wie Amazon oder eBay gebe es die aber nicht. Irgendwer bekomme von irgendwoher ein paar Deuter-Rucksäcke in die Hand, fotografiere sie mit dem Handy und stelle sie zu Schleuderpreisen auf einer Internetplattform zum Verkauf. »Und wenn dann der Rucksack drückt, heißt es, Deuter macht schlechte Rucksäcke. Das kann es ja wohl nicht sein!«, sagt Kullmann.
Er hat seinen Abnehmern verboten, Deuter-Ar-tikel auf Plattformen wie Amazon zu verkaufen, und rund 1000 – meist kleinere – Händler aus der Ver-triebsliste gestrichen. »Wenn Amazon nicht sein Ge-schäftsmodell komplett ändert und kompetente Beratung anbietet – und das kann ich mir nicht wirk-lich vorstellen –, wird man unsere Produkte nicht mehr bei Amazon finden.«
Nicht nur Deuter denkt so. Auch die Schuhfirma Lowa und der Schweizer Bergsportartikelhersteller Mammut zählen zu den Internet-Muffeln. Bei der jüngsten Outdoormesse in Friedrichshafen lag ein Hauch von Aufstand in der Luft. Ein Aufstand gegen Online-Händler. Die machten, so fürchtet die Indus-trie, die Marke kaputt. Und vergrätzten die stationä-ren Händler.
Die Outdoorfirmen sind nicht die Ersten, die mit den Onlineplattformen hadern. Adidas hat im Janu-ar sogenannte selektive Vertriebsvereinbarungen mit seinen Händlern abgeschlossen: Wer als Händler
adidas-Produkte bei Amazon verramscht oder nicht gemäß den Vorstellungen der Marke präsentiert, be-kommt keine Ware mehr aus Herzogenaurach. Der Schuhhersteller Asics zog nach.
Beim Stuttgarter Motorsägenhersteller Stihl heißt es, man nutze seit je »das Internet nur als Informationskanal, da aufgrund der Erklärungs-bedürftigkeit unserer Produkte der Kunde beim Fachhandel beraten und dann in den Gebrauch des Produktes eingewiesen wird«. Und die Karls-ruher Drogeriemarktkette dm hat Mitte Juli an-gekündigt, ihre 1700 Artikel aus den virtuellen Regalen des Online-Händlers zu räumen und die Zusammenarbeit mit Amazon zu beenden. Feh-lende Perspektiven, mangelnder Kundenzuspruch, das waren die Argumente.
Es geht also nicht nur um den Outdoor- und Sportartikelhandel. Es geht ein Stück weit um die Zukunft des E-Commerce.
Mittlerweile hat sich allerdings das Bundeskartell-amt eingeschaltet. Es nimmt nun jene Vertriebs-vereinbarungen ins Visier, die adidas und Asics mit ihren Händlern abgeschlossen haben. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen verbietet nämlich Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Europäisches Recht schreibt Ähnliches vor.
Das Kartellamt sucht nach neuen Leitlinien für den Online-Handel
Ob es sich im Fall adidas und Asics tatsächlich um eine Einschränkung des freien Marktes handelt, werden die Kartellwächter jetzt untersuchen. Wie lange das Verfahren dauert und mit welchen Ergeb-nissen zu rechnen sei, dazu könne man keine Aus-kunft geben, sagt der Sprecher der Behörde. Zudem legt er Wert auf die Feststellung, dass es sich bei dem adidas-Verfahren nicht um eine kartellrechtliche »Ermittlung« handle, die Bußgelder und Sanktions-maßnahmen nach sich ziehen werde. Man suche nur nach Leitlinien für die Zukunft des Online-Handels.
»Es geht eigentlich um einen hochkomplexen Dis-tributionskanalkonflikt«, sagt Markus Hepp, Han-dels- und Konsumgüterexperte bei der Boston Con-
sulting Group (BCG). »Auf die Herausforderungen im Online-Handel hat noch niemand die endgültigen Antworten gefunden.«
Die Kernfrage für die Hersteller: Können sie es sich überhaupt leisten, dauerhaft auf den Vertriebs-kanal Amazon mit seinen 20 bis 30 Millionen Nutzern pro Monat in Deutschland zu verzichten? Aber auch umgekehrt ist nach wie vor die Frage: Können es sich die Hersteller gegenüber dem Fach-handel erlauben, ihre Produkte über Amazon zu vertreiben, wenn sie dort zu Schnäppchenpreisen feilgeboten werden?
Zudem muss sich die Sportbranche nach dem Dauerwachstum in den vergangenen Jahren ganz neuen Herausforderungen stellen: Mittlerweile kann man auch bei Aldi und Tchibo Wanderschuhe, Funk-tionsjacken oder Nordic-Walking-Stöcke kaufen. Die Folge sind rabiate Rabattschlachten, um überschüs-sige Ware loszuwerden. Dafür eignet sich das Internet besonders gut. Doch gegen das »Overselling« im Internet treten Unternehmen wie Deuter oder Mam-mut jetzt auf die Bremse.
Sie setzen dabei auf ein Argument, das viel kun-denfreundlicher klingt als die Sorge um Preise und Margen: die Sicherheit. Ein T-Shirt oder eine Hose könne man ja ruhig ohne intensive Beratung online anschaffen. »Aber wenn Sie sich ein Klettersteigset oder einen Klettergurt kaufen, dann geht es schnell um Leben und Tod«, sagt Mammut-Vertriebschef Andreas Kessler. »Deshalb brauchen Sie kompetente Beratung.« Sein Unternehmen hat, ähnlich wie Deu-ter, spezielle Vertriebsvereinbarungen mit den Händ-lern geschlossen; zunächst in Deutschland, vom Herbst an gelten die Verträge auch in den anderen EU-Ländern und in den USA. Darin werden die Händler verpflichtet, die Mammut-Artikel so zu präsentieren, wie es aus Sicht der Konzernzentrale der Marke entspricht. Sie müssen, falls sie per Katalog oder Online verkaufen, eine Beratungshotline vor-halten, in Landessprache und zu den üblichen Laden-öffnungszeiten erreichbar. Rund ein Fünftel der Händler, schätzt Mammut, werden die Kriterien nicht erfüllen und deshalb ausgelistet.
2195 Deuter-Rucksäcke, 2013 Mammut-Artikel und 48 392 adidas-Produkte: Durchsucht man das Amazon-Sortiment an einem beliebigen Tag nach
den drei Marken, ist von einem Online-Boykott erst mal nicht viel zu merken. Immerhin, sagt Deuter-Mann Kullmann, sei es schon weniger geworden. Und adidas – der Konzern will laut Geschäftsbericht bis 2015 gerade einmal 3 Prozent seines weltweiten Gesamtumsatzes im Online-Vertrieb erwirtschaften – hat angekündigt, weitere Identifikationsmerkmale in seine Produkte einzubauen. Die Herzogenauracher wollen damit genauer nachvollziehen können, auf welchen Wegen und Umwegen Drei-Streifen-Artikel im Internet verhökert werden.
»Die Grenzen des Online-Handelssind erreicht«
Auf den Rückzug der Markenhersteller reagiert Amazon mit demonstrativer Gelassenheit. »Selbst-verständlich können Kunden sich bei uns umfassend beraten lassen«, sagt Amazon-Sprecherin Christine Höger. Es gebe auf den eigenen Seiten schließlich, vom Wanderstock- und Fahrradgrößenkalkulator bis hin zum UV-Schutz-Ratgeber, alle möglichen On-line-Hilfen für Kunden. Wenn Firmen das wollten, könnten sie ihre Artikel auf Amazon ja auch mit Er-klärvideos, Kundenhotlines und Expertenchats ver-markten. Der Haushaltsgeräteriese Miele und der Edellautsprecherhersteller Bose zum Beispiel machen das. »Aber viel wichtiger sind die Rezensionen ande-rer Kunden, die diese Produkte besitzen, getestet haben und bewerten«, so Höger.
Wer gewinnt den Machtkampf am Ende? Ama-zon und damit die Hersteller, die auf grenzenlosen Online-Vertrieb setzen? Oder die zurückhaltenden Marken wie adidas, Mammut und Deuter – und mit ihnen der stationäre Handel?
Andreas Bartmann ist Geschäftsführer bei Globe-trotter, einem der europaweit größten Outdoorhänd-ler und ein sogenannter Multichannel-Händler. Er verkauft die Produkte seiner Lieferanten per Katalog und im Webshop. »Wir erkennen eine starke Rück-besinnung auf den stationären Handel«, sagt Bart-mann. »Die Grenzen des Online-Wachstums in unserer Branche sind erreicht.«
Weitere Informationen im Internet:www.zeit.de/amazon
20–30hat Amazon pro Monat in
Deutschland
Wer als Händler adidas-Produkte bei Amazon verramscht oder
nicht wie erwartet präsentiert, bekommt keine Ware mehr aus
Herzogenauchrach
Weil in den Produkten eine Menge Gehirnschmalz stecke, sei Beratung ganz besonders
wichtig, argumentiert der Firmenchef
Millionen Nutzer
adidas
Deuter
Foto
s: P
R (
2)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Das Tor zur ProvinzDer Hamburger Hafen droht im internationalen Wettbewerb um Riesenfrachter bedeutungslos zu werden VON DANIELA SCHRÖDER
Am Terminal von Bremerhaven liegt ein Rekord in Hellblau: Die Mærsk Mc-Kinney Møller. Das größte Transportschiff der Welt kann 18 000 Container aufneh-men. Regelmäßig pendelt es zwischen Südkorea und Skandi-
navien, und alle drei Monate macht es einen Zwi-schenhalt in Bremerhaven. Den nahe gelegenen Hafen von Hamburg erinnert das jedes Mal an eine Niederlage. Vor Kurzem noch war die Mærsk Mc-Kinney Møller auch an der Elbe zu Besuch, damals feierte man ihre Ankunft als Signal für Hamburgs Bedeutung im internationalen Warenverkehr. Nun aber legt der Megafrachter regelmäßig in Bremer-haven an und symbolisiert so die missliche Lage der Hamburger: Deutschlands bislang größer Seehafen droht von der Konkurrenz abgehängt zu werden.
Lange Zeit gehörte der Hafen der Hansestadt zu den zehn größten der Welt, mittlerweile steht er nur noch auf Platz 14. Die direkte Konkurrenz im ent-scheidenden Containergeschäft sitzt an der Nordsee-küste. »Mittelfristig ist mit einer Verschärfung des Wettbewerbs zwischen den Häfen zu rechnen«, räumt die Hamburger Wirtschaftsbehörde ein. »Im Kampf um Marktanteile muss sich Hamburg künftig stärker als bisher behaupten«, sagt Gunther Bonz, Präsident
des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. In der Tat bringt die Entwicklung in der Frachtschifffahrts-branche etliche Probleme für Hamburg mit sich.
Die immer größeren Containerschiffe werden zu wuchtig für die Fahrrinne in der Elbe. Noch 2009 war ein Frachter mit 8000 Standardcontainern auf der Handelsroute zwischen Asien und Europa das Maximum. Längst setzen Reedereien ihre Hoffnun-gen auf Schiffe mit Platz für mehr als 10 000 Boxen. Und die dänische Großreederei Mærsk will ihre 18 000er Flotte auf der Fernostroute bis 2015 auf 20 Frachtschiffe ausbauen. Ähnliches planen Reedereien aus China und den Arabischen Emiraten. Denn je mehr Container ein Frachter tragen kann, desto nied-riger sind die Transportkosten pro Stück.
Hamburg wartet derweil auf ein Gerichtsurteil. Schon vor Jahren begann die Stadt, einen erneuten Ausbau der Elbe zu planen. Es wäre das neunte Mal, dass sie die Fahrrinne in dem von den Gezeiten beein-flussten Strom vertiefen und verbreitern lässt. Das Ausbaggern gilt der Hamburger Hafenwirtschaft als Schicksalsfrage. Doch seit Monaten liegt das Vor-haben auf Eis, weil Umweltverbände dagegen geklagt haben. Wann die Richter entscheiden, ist völlig un-klar. Sollte die Sache sogar vor dem Bundesverfas-sungsgericht landen, so meinen Rechtsexperten, falle das abschließende Urteil wohl erst Mitte 2015.
Doch selbst wenn der Plan Wirklichkeit werden sollte: Für den ganz großen internationalen Fracht-verkehr wird es auch dann nicht reichen. Nach dem Ausbau soll auf der Elbe ein Tiefgang von 14,5 Me-tern möglich sein – voll beladen, brauchen Contai-nerriesen jedoch bis zu 16,5 Meter. Andernorts ist diese Tiefe kein Problem: weder in Rotterdam noch in Antwerpen oder in Wilhelmshaven. Dort eröff-nete im vergangenen Herbst der JadeWeserPort mit 18 Meter Tiefgang. Er ist der einzige deutsche Hafen, in den auch die ganz dicken Pötte einlaufen können, ohne sich nach Ebbe und Flut richten zu müssen.
Ursprünglich war der JadeWeserPort ein gemein-sames Projekt der Länder Hamburg, Bremen und Niedersachsen. Hamburg stieg jedoch wieder aus und setzte auf den Ausbau der Elbe. Möglicherweise war das ein Fehler. »Besonders beim Verteilverkehr in den Ostseeraum wird der JadeWeserPort mit Hamburg konkurrieren«, sagt Burkhard Lemper, Leiter des In-stituts für Seeverkehr und Logistik (ISL) in Bremen. Container von den Asienfrachtern auf kleinere Schif-fe mit Ziel Baltikum, Skandinavien und Russland umzuladen macht traditionell einen Großteil des Containerumschlags in Hamburg aus. Derzeit sind es rund 40 Prozent. Laut einer ISL-Prognose könnte die Hansestadt bis 2025 gut die Hälfte dieses Ge-schäfts an Wilhelmshaven verlieren.
Auch neue Strategien der Reedereien gefährden Hamburgs Zukunft. Vom kommenden Jahr an ko-operieren die drei größten Unternehmen Mærsk Line, die Schweizer MSC und die französische CMA CGM auf den globalen Handelsrouten, um ihre Frachter besser auszulasten. Voll beladene Großschiffe wiede-rum laufen nur noch wenige Häfen mit ausreichend Tiefgang an, erklärt Logistikberater Jan Ninnemann, Professor an der Hamburg School of Business Ad-ministration. Die Reeder dürften zudem Häfen be-vorzugen, an denen sie als Mieter oder Gesellschafter von Terminals beteiligt sind. »Ganz klar«, sagt ein Reedereimanager, der nicht namentlich zitiert werden will, »eine Beteiligung bindet natürlich Interesse.« Schlecht für Hamburg: Denn während Rotterdam und Antwerpen, Bremerhaven und Wilhelmshaven im Containergeschäft auf Reedereibeteiligungen setzen, hat die Hansestadt interessierte Unternehmen bisher abblitzen lassen. Einzig Hapag-Lloyd hält an der Elbe einen Terminalanteil, allerdings ist die Stadt Hamburg auch Hauptaktionär der Reederei.
In Rotterdam bauen Politik und Wirtschaft der-zeit gemeinsam das modernste Containerhafen-Areal der Welt. Ende 2014 soll es in Betrieb gehen, die Fläche des ohnehin größten Seehafens in Europa wird um 20 Prozent wachsen. Der Containerumschlag soll sich in den kommenden Jahren verdoppeln.
»Rotterdam setzt seine Konzepte mit Partnern aus der Wirtschaft um und geht stark auf deren Bedürf-nisse ein«, sagt Claus Brandt, Schifffahrtsexperte bei PricewaterhouseCoopers. Sein Rat: »Auch der Ham-burger Hafen muss sich immer wieder neu positio-nieren.« Die Bereitschaft dazu hält sich in Grenzen. Der teilstaatliche Hamburger Hafenbetreiber in-stallierte jüngst vier Containerbrücken, um die neu-en Megapötte abfertigen zu können, sofern welche anlegen. Ein Gelände, das bisher als eiserne Reserve für einen Hafenausbau galt, will die Stadt erst einmal als Kreuzfahrtterminal nutzen. Für den großen Wurf fehlt es aber an Geld. Jährlich 100 Millionen Euro bekommt der Hafen aus der Stadtkasse, das wäre aber gerade einmal genug, um für den Güterverkehr wichtige Straßen und Brücken zu sanieren. So sind die Aussichten für die Hamburger mau, zumindest gemessen am Selbstbild. »Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Welthafenstadt eine ihr durch Ge-schichte und Lage zugewiesene, besondere Aufgabe gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen«, heißt es in der Hamburgischen Verfassung von 1952. Nun deutet vieles darauf hin, dass das »Tor zur Welt« wieder wird, was es vor langer Zeit einmal war: ein Versorgungsposten für das eigene Hinterland. »Im schlimmsten Fall«, sagt Verbandschef Bonz, »wird der Hamburger Hafen wieder das Tor zur Provinz.«
Marktanteile der kontinentaleuropäischenNordseehäfen im Containergeschäft
Umschlagplätze
ZEIT-GRAFIK/Quelle: Institut für Seeverkehrswirtschaft
und Logistik (ISL), Stand 2010
RotterdamSonstige
Antwerpen
Bremen/
Bremerhaven
Hamburg
25
22
18
14
21
%
26 WIRTSCHAFT
Containerschiffe in Hamburg
Foto
(A
uss
chn
itt)
: H
elm
ut
Wac
hte
r/1
3P
ho
to

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 WIRTSCHAFT 27
»Das nordische Modell stärken«Lettland führt den Euro ein. Ministerpräsident Valdis Dombrovskis erklärt, warum sein Land sparen muss – und was es von Griechenland unterscheidet
DIE ZEIT: Herr Ministerpräsident, zählen Sie schon die Tage?Valdis Dombrovskis: Warum sollte ich?
ZEIT: Weil in drei Monaten Ihr Land den Euro einführt.Dombrovskis: Wir zählen nicht, aber wir freuen uns. Bis dahin haben wir noch eine Menge vorzu-bereiten: Gesetze und IT-Systeme ändern, Münzen prägen, das Geld in Umlauf bringen.ZEIT: Sie haben Lettland durch eine Schockthera-pie aus der Krise geholt – und dabei selbst Ihr Gehalt massiv gekürzt. Werden Sie es jetzt wieder erhöhen?Dombrovskis: Mit unseren eigenen Gehältern sind wir nicht in Eile. Aber es stimmt, dass wir während der Krise eine Menge Einschnitte vornehmen mussten. Im öffentlichen Sektor wurden die Ge-hälter um durchschnittlich 25 Pro-zent gekürzt. Die wollen wir nun wieder Schritt für Schritt anheben. ZEIT: Haben Sie Verständnis da-für, dass Ihr polnischer Kollege Donald Tusk keine Eile mit der Euro-Einführung hat?Dombrovskis: Die Situationen sind unterschiedlich. Es ist kein Zufall, dass die Länder mit festen, an den Euro gekoppelten Wechsel-kursen schneller den Euro haben wollen als jene Länder, die das nicht haben ... ZEIT: ... weil sie mitentscheiden können und Ihr Land Transaktionskosten spart. Dombrovskis: Estland, Lettland und Litauen ha-ben ihre Währungen an den Euro gekoppelt, und siehe da: Estland hat den Euro bereits, wir werden in ein paar Monaten beitreten, Litauen peilt das für 2015 an. Bei diesen Ländern spricht kaum et-was gegen einen Beitritt. ZEIT: Für Polen schon?Dombrovskis: Länder mit flexiblen Wechselkur-sen wie Polen, Ungarn und Tschechien haben in der Krise ihre Währung massiv abgewertet, um ihre Exporte anzukurbeln. In Polen gibt es zudem noch ein besonderes Problem: Die Währung Złoty ist in der Verfassung festgeschrieben. Es braucht
eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, um das zu ändern ...ZEIT: ... ein Volksentscheid wäre auch möglich ... Dombrovskis: ... und es könnte schwer sein, eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen. ZEIT: Lettland tritt der Euro-Zone jetzt mitten in der Krise bei. Dombrovskis: Natürlich hat es uns wegen der Kri-se noch mehr Anstrengung gekostet, die Bürger davon zu überzeugen, dass der Euro gut für uns ist. Einer der Gründe liegt im festen Wechselkurs: Was auch immer mit dem Euro geschehen wird, würde uns ohnehin treffen. Zudem haben wir eine Men-ge Spekulationen gegen unsere Währung erlebt. Neben den Kämpfen gegen die Finanz- und Wirt-schaftskrise mussten wir also auch noch den Lats verteidigen. Wir hätten dem Euro schon 2008 wie
geplant beitreten sollen. ZEIT: Jetzt wird auch Ihr Land für Griechenland zahlen müssen. Wie kommt’s, dass zwei kleine Länder die Krise so unterschiedlich be-wältigen? Dombrovskis: Schwer zu sagen. Aber eines ist interessant: Wir ha-ben zwar eine Menge getan, doch Griechenland wird uns in diesem Jahr überholen. Sie stecken in einer tieferen Rezession als wir damals, und gleichzeitig tun sie mehr für die Konsolidierung ihrer Finanzen.
ZEIT: Sie sind zuversichtlich, was Griechenlands Zukunft angeht?Dombrovskis: Ich sage nur, das Land hat in diesem Jahr mehr getan als wir. Allerdings: Wir haben viel früher damit angefangen und mitten in der Krise um unsere finanzielle Stabilität gekämpft. Deshalb konnten wir auch wieder wirtschaftlich wachsen. Ohne finanzielle Stabilität landet man mitten in der Rezession. Das passiert in Griechenland. ZEIT: Haben Sie mit dem griechischen Regie-rungschef darüber gesprochen?Dombrovskis: Natürlich. Ich kenne Antonis Sa-maras noch aus dem Europäischen Parlament, wir haben beide im Haushaltsausschuss gearbeitet.ZEIT: Was für ein Zufall.
Lettlands MinisterpräsidentValdis Dombrovskis
Dombrovskis: Und ich habe auch oft mit seinem Vorgänger gesprochen. Ihre Taktik, die Dinge zu verzögern, ist gescheitert. Aber die Reaktionen in unseren beiden Ländern waren auch sehr unter-schiedlich – die griechische Regierung stand unter enormem Druck.ZEIT: Können Sie sich erklären, warum die Grie-chen auf die Straße gingen und die Letten kaum?Dombrovskis: Ich wurde im März 2009 Regie-rungschef. Davor waren wir in der Opposition. Wir wurden also nicht als Teil des Problems, son-dern als Teil der Lösung angesehen. Dadurch wa-ren wir bei unserem Sparkurs glaubwürdig. Und es hat geholfen, dass wir mit Gewerkschaften und mit Selbstverwaltungen gesprochen haben. Die Gesellschaft hat verstanden, dass wir uns selbst aus der Krise befreien müssen. ZEIT: Das fehlt bei den Griechen?Dombrovskis: Die Mehrheit hat dort am Anfang den Sparkurs unterstützt. Aber einige Gruppen haben Proteste geschürt.ZEIT: Im Euro-Club sind längst nicht alle gleich. Sind Sie wütend, dass die großen Länder die Re-geln machen, um sie dann zu brechen?Dombrovskis: Genau das war doch das Problem. Fast zehn Jahre lang hat jeder getan, was er wollte.Und jetzt haben wir den Salat. Ich erinnere mich an die vor allem von Deutschland geführte Debat-te über das Bail-out-Verbot. Aber das kann nur funktionieren, wenn alle Länder sich an die Regeln halten. Wenn sie das nicht tun, dann haben wir eben Bail-outs. Genau das ist passiert. Ich hoffe, wir alle haben unsere Lektion daraus gelernt. ZEIT: Gerade die kleinen Länder wie Slowakei oder Lettland betonen Sparsamkeit. Sind die Bal-ten und die Slowakei die neuen Skandinavier? Dombrovskis: Wir können das nordische Modell stärken. Das ist ein guter Club, zu dem man ge-hören will. Aber vor zehn Jahren hieß es, Deutsch-land sei der kranke Mann Europas. Vor fünf Jah-ren hat niemand über die Krise im Süden geredet, sondern nur über die Krise in Osteuropa. Heute reden alle über Griechenland – wer weiß schon, worüber wir in fünf Jahren reden werden?
Das Gespräch führte ALICE BOTA
Bruttoinlands-
produkt pro Kopf : 10 700 €
Einwohner: 2 Mio.
Wirtschaftswachstum:
Inflation:
5,6 %
2,3 %
12,4 %*Arbeitslosenquote:
Angaben für 2012, *März 2013
ZEIT-GRAFIK/Quelle: Eurostat
LITAUEN
ESTLAND
LETTLANDRiga
50 km
Lettland in Zahlen
Livu-Platz in Riga: Reges Treiben in den Abendstunden
Foto
s: A
mo
s C
hap
ple
/G
ett
y Im
age
s, I
ne
s Ju
ano
la/
Re
po
rte
rs/
laif
(l.)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Mit blinkenden und pie-penden Maschinen hat Johann Graf ein Ver-mögen gemacht. Er ist heute einer der reichsten Männer Österreichs und verdient sein Geld mit
Spielautomaten. Was Graf vor 33 Jahren im nie-derösterreichischen Gumpoldskirchen startete, heißt heute Novomatic, ist ein in rund 80 Län-dern aktiver Glücksspielkonzern und setzt jähr-lich mehrere Milliarden Euro um.
Seit der Übernahme der deutschen Traditions-firma Löwen vor zehn Jahren hat Novomatic auch den hiesigen Markt im Griff. Die Unternehmens-gruppe um den schillernden Daddelkönig Paul Gauselmann mag bekannter sein, doch Novomatic ist weitaus größer. Gemessen an der Zahl der Geld-spielgeräte, welche die Österreicher in Deutschland stehen haben, beherrschen sie mehr als die Hälfte des Marktes. Novomatic entwickelt und baut die Geräte aber nicht nur selbst und betreibt sie in ei-genen Spielhallen, sondern vermietet sie zugleich an die Konkurrenz.
Genau das ist das Problem. Denn die ratternden einarmigen Banditen von einst haben sich längst in Computer verwandelt, die von einer Software ge-steuert werden. Die aber könnte von Novomatic manipuliert werden, um die rund 5000 kleinen und mittelständischen Spielhallenbetreiber in Deutsch-land aus dem Geschäft zu drängen, vermutet Kri-tiker Peter Eiba. »Die beliefern uns absichtlich mit Geräten, die nicht vorgesehene Gewinne ausschüt-ten«, schimpft der Augsburger Unternehmer über die Novomatic-Tochter Löwen Entertainment, von der er seine Geräte bezieht.
Löwen beteuert, an die Mieter seiner Geräte aus-schließlich Modelle mit denselben Funktionen zu liefern, wie sie auch in den eigenen Hallen stünden. Eibas Vorwürfe entsprächen nicht der Wahrheit. Zu laufenden Verfahren wolle man keine Stellung-nahme abgeben.
Aus unternehmerischer Sicht ist die Kontrolle über die Ausschüttungen überaus heikel: Fallen sie übermäßig hoch aus, fließt zu viel Geld ab. Sind sie unterdurchschnittlich, gehen die Spieler womöglich in andere Spielhallen. In beiden Fällen gefährdet das die wirtschaftliche Grundlage des Aufstellers. Eiba würde gern detailliert nachvollziehen können, welche Geschäfte er an jedem einzelnen seiner gemieteten Automaten macht. Doch über die ge-nauen Parameter des Programms und die Auszah-lungsquote bekomme er keine Auskunft von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). Die ist für die Zulassung der Automaten zuständig.
Eiba streitet sich schon länger mit Löwen. Denn alle Novo-Superstar-Geräte in seinen Spielhallen haben einen Werksfehler, und das bereits seit Jahren. Der PTB war das schon länger bekannt, und sie hätte dem Hersteller dafür die Zulassung entziehen können, vielleicht sogar müssen. Doch das in der vergangenen Legislaturperiode FDP-geführte Bun-deswirtschaftsministerium forderte Löwen lediglich auf, den Markt »zu bereinigen«. Daraufhin rief das Unternehmen seine Geräte zurück, um sie gegen solche zu tauschen, die der neuesten technischen Richtlinie entsprechen.
Es ist ein großer Aufwand, fehlerhafte Software nachzuweisen
Doch Eiba will die Automaten nicht an Löwen zu-rückschicken. Er möchte es nicht riskieren, irgend-welche Beweise aus der Hand zu geben. Zudem will er auch nicht preisgeben, wo genau sie stehen. »Dann wissen die nach dem Auslesen der Geräte, wo die lukrativen Standorte sind«, vermutet Eiba. Es sei schon einmal vorgekommen, dass in un-mittelbarer Nähe von freien Spielhallen plötzlich der Vermieter eine eigene Halle eröffnet habe. »Die missbrauchen ihre marktbeherrschende Stellung«, wettert Eiba. Löwen weist auch diesen Vorwurf zu-rück, hat Eiba bereits verklagt, die Verträge gekün-digt und eine Liefersperre verhängt.
Die Funktionsweise der Automaten ist von den meisten Aufstellern kaum mehr zu durchschauen.
Eiba aber scheut keinen Aufwand, um seine Ver-luste durch fehlerhafte Software nachzuweisen. Dazu hat er sogar einen Notar und den Informati-onstechnik-Sachverständigen Thomas Noone he-rangezogen. »Was Möglichkeiten zur Manipulation betrifft, sind die älteren Geräte offen wie ein Scheu-nentor«, sagt dieser. Das Spiel Grand Roulette De-luxe beispielsweise habe einen schweren Fehler. Der führe laut Eiba zu einem Einnahmeverlust von 1000 Euro pro Gerät und Monat. Für die Mietdauer seit 2009 fordert er von Löwen Schadensersatz in Höhe von mehreren Millionen Euro, der Fall ist derzeit in Mainz vor Gericht anhängig.
Die schiere Größe der Novomatic-Tochter ist auch anderen Kleinunternehmern ein Ärgernis. Manfred Lanz, der Automaten im hessischen Waldems betreibt, war von Löwen aus denselben Gründen wie Eiba auf die Herausgabe seiner Geräte verklagt worden und erhebt nun seinerseits Vorwürfe, Löwen missbrauche seine marktbeherr-schende Stellung. Dieser Fall beschäftigt derzeit die Justiz in Wiesbaden.
Der Grundsatz, dass Konkurrenten benachteiligt würden, sei gar nicht ungewöhnlich, sagt Ingo Fiedler von der Fakultät für Wirtschafts- und Sozi-alwissenschaften der Universität Hamburg. Ein Team um Professor Michael Adams beschäftigt sich dort mit der Glücksspielbranche. »Das ist ein typi-sches Industrieproblem. In allen Branchen, die mit Netzen zu tun haben, gibt es ähnliche Probleme. Im Endeffekt wird ja ein Programm und kein Auto-mat vermietet«, sagt Fiedler. Und Programme seien manipulierbar. Noone sagt, bei dem erwähnten Roulette-Spiel handle es sich allerdings vermutlich
um einen Programmierfehler, der sich in das kom-plizierte System mehrerer paralleler Programm-abläufe eingeschlichen haben dürfte. Das Problem sei wohl versehentlich entstanden und nicht absicht-lich installiert worden. Aber in anderen, weniger offensichtlichen Fällen, könne das ganz anders sein.
Wie bei einem Flugschreiber sollte alles dokumentiert werden
Bereits 2008 hatte Noone in einer Masterar-beit auf zahlreiche Missbrauchsmöglichkeiten hingewiesen. Seither erstellt er Gutachten für Aufsteller, Gerichte und Staatsanwaltschaften, etwa wenn der Vorwurf des Betruges im Raum steht: Es sei sogar schon vorgekommen, dass Software in großem Stil ausgeliefert worden sei, die gar nicht zugelassen war. Viele Diskussionen könnten schlagartig beendet und zahlreiche Vorwürfe aus der Welt geschaffen werden, wenn eine Pflicht zur Erfassung aller rele-vanten Vorgänge in den Geräten eingeführt würde. Die umfassende Dokumentation hätte in Spielauto-maten die gleiche Funktion wie der Flugschreiber in einem Flugzeug: Gibt es Probleme, lässt sich der Ablauf rekonstruieren. So hatte es sogar der Bundes-rat als Ergänzung zur Regierungsvorlage für eine neue Spielverordnung empfohlen, die vor wenigen Wochen zur Abstimmung stand.
Der Widerstand war gewaltig. Sämtliche Son-der- und Einzelspiele aufzuzeichnen sei gar nicht nötig, meint Dirk Lamprecht, Sprecher des größten Dachverbandes der deutschen Automatenwirt-schaft, in dem auch Löwen und Gauselmann ver-
treten sind. Was an Umsatz in das Gerät rein- und was aus ihm rauskomme werde ja bereits dokumen-tiert. Er fügt an: »Die beiden Großen haben immer darauf geachtet, dass der Markt auch durch ihr Auf-treten als Betreiber von Filialen keine Dominanz bekommen hat.« Löwen beteuert, ebenso wie Gauselmann, stets gesetzeskonform gehandelt zu haben. Missbrauch der Marktmacht gäbe es nicht.
Der Entwurf der neuen Spielverordnung, bei dem es auch um andere Fragen als die Dokumenta-tion geht, stelle für Löwen »die wirtschaftliche Über-lebensfähigkeit der Automatenwirtschaft« infrage. Ein Gesetz in dieser Form wäre »eine Katastrophe für die kleinen Aufsteller mit rund 70 000 Arbeits-plätzen«, heißt es von Gauselmann. »Dann müssten über die Hälfte aller Geräte abgebaut werden.«
Gemeinsam kontrollieren Löwen und Gausel-mann deutlich mehr als 90 Prozent aller 265 000 Geldspielgeräte in Deutschland, die jedes Jahr zu-sammen 4,4 Milliarden Euro an Einnahmen brin-gen. Das »Wiener Modell«, mit Sponsoring und der Hilfe illustrer Freunde das Marktumfeld günstig zu beeinflussen, hat sich längst in Deutschland etab-liert. Bei Löwen etwa führte Ex-Finanzminister Theo Waigel früher den Vorsitz im Aufsichtsrat. Im Mai dieses Jahres haben Österreichs Ex- Kanzler Alfred Gusenbauer und der ehemalige EU- Kommissar Günter Verheugen in dem Gremium Platz genommen.
Und Sorgen wegen strengerer Vorschriften brauchten sich die Spielkonzerne bislang auch nicht zu machen: Die vom Bundesrat empfohlene Do-kumentationspflicht für die inneren Abläufe der Daddelsoftware wurde im Juli noch abgelehnt.
28 WIRTSCHAFT
Black Box in der DaddelhalleUndurchsichtige Software steuert das Innenleben von Spielautomaten. Wird sie von großen Konzernen manipuliert? VON STEFAN MÜLLER
Johann Graf setzt mit seinen Spielautomaten Milliarden um
M+M
Düstere Prognosefür die FlugriesenChristoph Müller, Chef der traditionsreichen irischen Fluggesellschaft Aer Lingus, sieht keine Perspektive für die drei großen etablierten Flug-gesellschaften im europäischen Markt. Luft-hansa, British Airways und Air France/KLMhätten immer größere Probleme, sich auf der Kurzstrecke zu behaup-ten, sagte Müller der ZEIT. »Einstige Staats-linien werden langfristig aus dem Europageschäft verschwinden«, prophe-zeit er. Noch 1995 hätten die einst staatlichen Flug-linien rund 87 Prozent Marktanteil in Europa gehabt, heute liege dieser gerade noch bei 45 Pro-zent. In derselben Zeit habe sich das Angebot im europäischen Markt na-hezu verdoppelt, sagt der deutsche Manager, der bei Lufthansa seine Karriere begann. »Vom Wachstum profitierten jedoch fast ausschließlich Billigflieger«, sagt Müller. Deren Marktanteil liegt bereits bei rund einem Drittel. Müllers These läuft am Ende darauf hinaus, dass Lufthansa und an-dere nur noch zwischen den Kontinenten fliegen und Billigflieger wie Ryanair und easyJet die europäischen Städte verbinden. TAT
Siemens streicht und wächst gleichzeitigSiemens baut im Zuge eines vor rund einem Jahr angekündigten Sparprogamms 10 000 Stellen im Ausland und 5000 Stellen in Deutschland ab. Die am Sonntag von Siemens erstmals genannten Zahlen sorgten für Aufregung, da der Konzern unter seinem mittlerweile abgelösten Vorstands-chef Peter Löscher den Stellenabbau nicht be-ziffert und lediglich das Ziel einer Kostenkürzung um sechs Milliarden Euro ausgegeben hatte. Gut die Hälfte der 15 000 Stellen sind bereits im ge-rade mit dem Monat September abgelaufenen Geschäftsjahr gestrichen worden, ohne dass sich dadurch etwas an der Gesamtzahl der im Kon-zern beschäftigten Menschen geändert hätte. Sie liegt nach wie vor bei rund 370 000 Mitarbei-tern weltweit, weil Siemens in einigen Bereichen gewachsen ist, etwa der Medizintechnik. Sie-mens hatte nach der weltweiten Rezession mit einer kräftigen Erholung der Konjunktur ge-rechnet und zusätzliches Personal eingestellt, aber die Hoffnungen erfüllten sich nicht. Ana-lysten erwarten, dass der neue Siemens-Chef Joe Kaeser vorsichtiger agieren wird. JUN
MACHER UND MÄRKTE
Christoph Müller, Chef von Aer Lingus
Industrie sorgt sichwegen maroder BrückenVon den 66 700 Brücken in deutschen Städten und Gemeinden müssen nach der Einschätzung von Wissenschaftlern mehr als 10 000 in den kommenden 16 Jahren ersetzt werden. Laut einer Studie des Instituts für Urbanistik müssen für den Ersatzneubau bis zum Jahr 2030 rund elf Milliarden Euro auf-gewendet werden. Wei-tere fünf Milliarden Euro würden die not-wendigen Teilerneue-rungen kosten. Laut der Studie, die vom Bun-desverband der Deut-schen Industrie sowie von den Verbänden der Bau- und Stahlindus-trie in Auftrag gegeben wurde, ist jede zweite der kommunalen Brü-cken sanierungsbedürftig. Die Verbände kriti-sieren, dass die Bundesländer wegen der Schul-denbremse ihre Zuweisungen an die Kommunen gekürzt haben. JUN
16Milliarden Euro sindfür die Sanierung von Brücken nötig
Foto
s: P
hili
pp
Ho
rak/
dp
a; N
iall
Car
son
/d
pa
(l.)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Der Suchmaschinenbetreiber Google schrieb im Frühjahr 2011 einen Preis aus. 60 000 US-Dollar sollten an den IT-Spezialisten gehen, der die Sicherungssysteme von Goo-gles neuem Internetbrowser
Chrome als Erster umgehen konnte. Bedingung: Der Gewinner musste Google erklären, wie er bei dem digitalen Einbruch vorging. Dem Franzosen Chaou-ki Bekrar und seinem Team gelang das Kunststück, doch sie verzichteten auf das Preisgeld. Bekrar sagte damals, er wolle seine Erkenntnisse lieber seinen Kunden anbieten – die würden mehr dafür zahlen.
Bekrar ist der Geschäftsführer des IT-Sicherheits-unternehmens Vupen aus Montpellier. Die Firma hat sich darauf spezialisiert, Sicherheitslücken in Com-puterprogrammen ausfindig zu machen. Dass es Schwachstellen in Software gibt, ist an sich nicht ungewöhnlich. Hersteller entdecken immer wieder welche. Sie sind nicht zuletzt der Grund dafür, dass
man sich regelmäßig Updates herunterladen muss, um die Sicherheitslücken zu schließen. Doch Vupen geht anders vor: Die Firma sucht solche Schwach-stellen und hält sie geheim. Dann bekommen die
Schwachstellen einen besonderen Charakter, sie werden zu sogenannten Zero-Day-Exploits. Die Kenntnis solch exklusiver Geheimwege macht es möglich, unbemerkt die Kontrolle über einen frem-den Computer zu übernehmen, Daten von ihm zu stehlen oder sie zu vernichten. Und Bekrars Team gehört zu den Besten, wenn es darum geht, solche Hintertüren in Programmcodes aufzuspüren.
Zero-Day-Exploits bedeuten für ihre Besitzer vor allem eines: Macht. Manchmal dauert es Jahre, bis eine Lücke entdeckt und geschlossen wird. So lange lässt sie sich etwa dazu nutzen, unbemerkt Menschen auszuspionieren oder Geschäftsgeheimnisse zu steh-len. Richtig eingesetzt, können sie sogar zur Waffe werden: Der Computerwurm Stuxnet, den die USA und Israel allem Anschein nach dazu nutzten, um iranische Atomanlagen zu beschädigen, wurde eben-falls über eine solche Hintertür eingeschleust. Vupens Kunden sind diese digitalen Einbruchswerkzeuge viel Geld Wert. Branchenkenner gehen von Marktpreisen um die 100 000 US-Dollar pro Schwachstelle aus, wenn sie sich zur Attacke auf ein weitverbreitetes Programm wie beispielsweise einen Internetbrowser nutzen lässt. Der Umsatz von Vupen hat sich in den vergangenen Jahren jeweils verdoppelt. 2011 mach-te das junge Unternehmen bei knapp einer Million Euro Umsatz rund 415 000 Euro Gewinn.
Doch wer kauft die Sicherheitslücken überhaupt? Bekrar schweigt zu dieser Frage grundsätzlich. Vor-letzte Woche wurde jedoch bekannt, dass der US-Geheimdienst NSA zu Vupens Kunden zählt. Die Anfrage einer Aktivistin nach dem Freedom of In-formation Act brachte einen entsprechenden Vertrag ans Licht. Die Amerikaner haben demnach im Sep-tember 2012 ein Jahresabonnement für Exploits bei Vupen abgeschlossen. Angaben zu Preisen und wei-teren Details wurden geschwärzt. Laut einem Bericht der Washington Post von Ende August gab die NSA in diesem Jahr insgesamt bereits 25 Millionen US-Dollar für Zero-Day-Exploits aus.
Weitere Vupen-Kunden sind nicht bekannt. Be-krar beteuert, dass er nur mit Strafverfolgungsbehör-den und Geheimdiensten aus Nato-Mitgliedsstaaten oder deren Partnerländern zusammenarbeite. Selbst wenn das stimmt: Der Handel mit den exklusiven
WIRTSCHAFT 29
QUENGEL-ZONE
»Nach Gutsherrenart«
MARCUS ROHWETTERS
unentbehrliche Einkaufshilfe
Im Supermarkt wurde mir bewusst, dass ich wo-möglich ein ambivalentes Verhältnis zur Leibei-genschaft habe. Am Wurstregal stehend, fiel mir nämlich auf, dass ich den Ausdruck »nach Guts-herrenart« im Zusammenhang mit Leberwurst als Auszeichnung, bezogen auf Regierungshan-deln jedoch als Missbilligung betrachte.
Was nun?, fragte ich mich. Wie sollte ich mich im Angesicht der Gutsherrenleberwurst verhalten? Einerseits war die Zeit ja recht angenehm, als die Gutsherren auf ihren Landgütern noch das Sagen hatten. Sie konnten ihre Knechte herumkom-mandieren und sie die schwere Arbeit verrichten lassen. In der Küche ließen sie die Wurst so kräftig würzen, wie es ihnen beliebte. Eine feine Sache, vorausgesetzt natürlich, man war der Gutsherr und nicht etwa einer der Knechte. Letztere hatten gewiss einen anderen Blick auf die Thematik, und noch heute wirft man Politikern und Unterneh-mern gerne vor, »nach Gutsherrenart« zu regieren. Also nach eigenem Gutdünken. Ich begann zu grübeln, denn ich stand ja noch am Wurstregal.
Da erinnerte ich mich plötzlich, warum Füh-rungsverhalten und Fleischverarbeitung doch kein Widerspruch sein müssen. Wie schon oft in der Zeitung zu lesen war, handeln Wurstproduzenten bisweilen ja auch nach eigenem Gutdünken, und zwar sowohl bei der Rezeptur (nicht deklariertes Pferdefleisch!) als auch beim Umgang mit den Mitarbeitern der in ihren Fabriken tätigen Sub-unternehmen, denen es ähnlich ergeht wie früher den Knechten. Wie hatte ich das übersehen kön-nen? Lag in dieser Wurst eine tiefere Wahrheit?
Ich habe sie übrigens nicht gekauft. Wegen meiner politischen Einstellung. Und weil man wissen muss, dass Kalbsleberwurst zwar Leber vom Kalb enthält, Gutsherrenleberwurst aber aus-schließlich solche vom Schwein.
Von Verkäufern genötigt? Genervt von Werbe-Hohlsprech und Pseudo-Innovationen? Melden Sie sich: [email protected]
Durch die HintertürEine französische Firma zeigt dem US-Geheimdienst und anderen, wie man in
fremde Computer eindringt VON PHILIPP ALVARES DE SOUZA SOARES
Software-Hintertüren ist legal und wird kaum re-guliert. »Es gibt keine gesetzliche Grundlage, um den Handel mit Zero-Day-Exploits zu kontrollie-ren«, sagt Patrick Pailloux, Direktor der französi-schen Agentur für IT-Sicherheit ANSSI.
Ob Vupen mit französischen Geheimdiensten zusammenarbeitet, ist offen. Ein Sprecher der Re-gierung wollte dies auf Anfrage der ZEIT nicht kommentieren. Und deutsche Behörden? Das Ver-teidigungsministerium räumt zwar ein, dass die Bundeswehr Informationen über Bedrohungen durch Zero-Day-Exploits von Privatunternehmen beziehe, bestreitet aber eine Zusammenarbeit mit Vupen. Laut Bundesinnen-ministerium greift von den ihm unterstellten Behörden lediglich das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-mationstechnik auf solche Informationen von Privat-unternehmen zu. Die Infor-mationen würden zum Schutz der IT-Infrastruktur des Bundes eingesetzt. Zu weiteren Details, etwa den Firmennamen der Lieferan-ten, möchte man keine Auskunft geben. Der Bun-desnachrichtendienst lehnte eine Stellungnahme ab.
Vupen nimmt es gern mit den Großen auf. Bekrar zeigt Softwareherstellern wie Microsoft, Apple oder Google regelmäßig, dass sein Team auch die ausgefeiltesten Sicherungsmechanismen kna-cken kann. Als Microsoft im Herbst des vergange-nen Jahres sein neues Betriebssystem Windows 8 vorstellte, prahlte Vupen bereits zum Verkaufsstart mit einer Hintertür. Nur ein, zwei seiner Leute hätten daran gearbeitet, sagte Bekrar im März am Rande eines Hackerkongresses, nach etwa drei Monaten hätten sie die Sicherung bereits durchbrochen.
Die Hersteller sind gegen den Handel mit Sicherheitslücken. »Das Geschäftsmodell von Vupen kann uns natürlich nicht recht sein«, sagt Thomas Baumgärtner von Micro-
soft. Microsoft setzt auf den Idealismus der Hacker und zahlt keine Prämien, wenn sie Schwachstellen in den eigenen Produkten aufdecken. »Wir wollen diesen Bieterwettbewerb nicht unterstützen«, sagt Baumgärtner.
Bis vor drei Jahren hat auch Vupen Sicherheits-lücken noch kostenlos an die Hersteller gemeldet. Doch Bekrar wollte mit seiner Expertise Geld ver-dienen, das Aufdecken von Zero-Day-Exploits sei schließlich teuer. »Die Softwarefirmen hatten ihre Chance. Jetzt ist es zu spät«, sagt er.
»Der Markt wächst und ist völlig intransparent«, sagt Candid Wüest von Symantec, einem bekann-
ten Hersteller von Anti-Vi-ren-Software. Das Problem sei, dass man nicht genau wisse, was mit den Exploits eigentlich nach dem Verkauf geschehe. Anders als kon-ventionelle Waffen, sind sie beispielsweise mit keiner Seriennummer versehen, die eine Rückverfolgung mög-lich machen würde. Wenn Symantec-Mitarbeiter selbst auf eine Sicherheitslücke
stoßen, melden sie diese kostenlos an die Hersteller und erst danach an ihre Kunden. So bleibt genug Zeit, um die Lücke vorher zu schließen.
Die Europaabgeordnete Marietje Schaake setzt sich als eine von wenigen Politikerinnen für eine härtere Regulierung des Handels mit Software-Schwachstellen ein. Sie will Firmen wie Vupen zwingen, eine Lizenz zu erwerben, die etwa an Ex-portbeschränkungen oder Offenlegungspflichten gebunden wäre. »Wenn wir mehr Sicherheit wollen, müssen wir den Handel mit diesen digitalen Waffen
endlich eindämmen«, sagt sie. Can-did Wüest glaubt indes nicht, dass strengere Regeln helfen. Schon heute würden sich sogar Privatleute heimlich mit Exploits eindecken. »Wahrscheinlich würde der Zero-Day-Handel dann noch intrans-parenter werden.«
»Wir müssen den Handel mit diesen digitalen Waffen eindämmen«

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4130 WIRTSCHAFT
DIE ZEIT: Herr Rajan, in vielen asiati-schen Schwellenländern sind in den ver-gangenen Wochen die Währungen ab-
gestürzt. Droht eine neue Asienkrise?Raghuram Rajan: Keinesfalls. Ich glaube, es han-delt sich um unnötige Aufregung in den Medien und zum Teil auch auf den Finanzmärkten.ZEIT: Haben Sie ein Beispiel? Rajan: Nehmen wir Indien. Unsere kurzfristigen Schulden liegen bei zehn Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Wir verfügen über Wäh-rungsreserven in Höhe von 15 Prozent der Wirt-schaftsleistung. Wir könnten also unsere Schul-den ohne Probleme aus unseren Devisenvorräten zurückzahlen. Und die Staatsverschuldung be-läuft sich auf 45 Prozent der Wirtschaftsleis-tung. Das ist deutlich weniger als zum Beispiel in Deutschland. Eine Schuldenkrise ist unter diesen Umständen vollkommen unmöglich. Ich
habe Vorschläge gehört, dass Indien ein Hilfs-programm des Internationalen Währungsfonds benötigen könnte. Das ist lächerlich.ZEIT: Alles ist gut? Rajan: Natürlich nicht. Wir haben Probleme, aber wir können sie lösen. Wir sprechen hier nicht über ein Land, das sich am Rande des Zu-sammenbruchs befindet. ZEIT: Was sind die drängendsten Probleme?Rajan: Eines der wichtigsten ist die Infrastruk-tur. Indien baut sie aus, aber in einem wesentlich langsameren Tempo als etwa China. Das hat auch damit zu tun, dass wir eine Demokratie sind – und wenn man eine Straße bauen will, muss man in einer Demokratie mit den Leuten reden, die davon betroffen sind. Ich halte das für richtig, aber es bedeutet, dass bestimmte Pro-jekte mehr Zeit beanspruchen, weil ein Konsens gefunden werden muss. Wir haben außerdem
Defizite bei der Berufsausbildung und müssen die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verbessern. Mein Punkt ist aber: Es handelt sich um strukturelle Probleme. Wir müssen uns da-rum kümmern, und das werden wir tun. Aber sie sind nicht neu. ZEIT: Wenn das so ist – warum spielen die Märkte dann verrückt? Rajan: Das hat viel mit der Ankündigung der amerikanischen Notenbank Fed zu tun, ihr An-leiheprogramm zurückzufahren.ZEIT: Die Fed kauft Staatsanleihen, um die lang-fristigen Zinsen zu drücken und die heimische Wirtschaft anzukurbeln. Im Frühjahr hat sie an-gekündigt, das Programm auslaufen zu lassen. Rajan: Und plötzlich richteten alle den Blick auf die Probleme in den Schwellenländern. Darauf-hin gerieten deren Währungen unter Druck. Das kann zu einem Problem werden: Denn es besteht die Gefahr, dass sich diese Abwärtsbewegung an den Märkten selbst verstärkt.ZEIT: Ist die Sorge der In-vestoren nicht legitim? We-gen der Niedrigzinspolitik in den USA ist viel Geld in die Schwellenländer geströmt, weil die Investoren auf der Suche nach höheren Rendi-ten waren. Das hat den Boom in den aufstrebenden Volkswirtschaften befeuert. Wenn in den USA die Zin-sen wieder steigen, werden die Gelder abgezogen. Rajan: Ich will nicht bestrei-ten, dass die Schwellenländer anfällig sind, aber die Ge-wichtung stimmt nicht: In der Berichterstattung über Indien war bis vor Kurzem immer nur von Wolkenkrat-zern und Wirtschaftswachs-tum die Rede, jetzt sind Armut und Krise das Thema. Es gibt Elend, und wir müssen es be-kämpfen, aber es ist ja nicht so, dass sich auf ein-mal alle Errungenschaften der zurückliegenden Jahre in Luft aufgelöst hätten. Die Welt hat sich in der Vergangenheit zu sehr auf die Wolken-kratzer konzentriert – und jetzt fokussiert sie die Armut in übertriebenem Maße. ZEIT: Sollte die Fed die Zinsen in den USA also besser niedrig halten, damit nicht so viel Geld aus den Schwellenländern abfließt? Rajan: Aus unserer Perspektive wäre es besser ge-wesen, es wäre gar nicht erst zu den massiven Ka-pitalzuflüssen gekommen, dann müssten wir jetzt nicht mit den Folgen der Abflüsse fertig werden. Aber wir können in Indien damit umgehen. Das schnelle Geld ist weg, die langfristig orientierten Investoren sind aber noch da. Das ist sehr ermu-tigend. Und unsere Währung, die Rupie, hat sich zuletzt wieder stabilisiert. ZEIT: Viele Experten warnen, dass die Erholung der Weltwirtschaft ins Stocken gerät, wenn die Fed die Zinsen steigen lässt? Rajan: Ich denke, es war richtig, dass die Zentral-banken auf dem Höhepunkt der Krise interve-nierten. Dadurch haben sie wahrscheinlich ver-hindert, dass die Weltwirtschaft in eine Depres-sion fällt, wie in den dreißiger Jahren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob eine Fortsetzung dieser Politik nachhaltiges Wachstum erzeugt. ZEIT: Warum nicht? Rajan: Obwohl die Zinsen sehr niedrig sind, hat die Wirtschaftsaktivität in vielen Industriestaa-ten noch nicht wieder jene Niveaus erreicht, die vor der Krise üblich waren. Man könnte jetzt
argumentieren, dass die Dosis noch einmal er-höht werden muss. Man könnte aber auch argu-mentieren, dass vielleicht die Grenzen dessen er-reicht sind, was mit den Mitteln der Geldpolitik möglich ist – und es nötig ist, sich um die zu-grunde liegenden Probleme zu kümmern. ZEIT: Inwiefern? Rajan: In den USA etwa haben viele Haushalte noch finanzielle Probleme, in Europa müssen die Bilanzen einiger Banken bereinigt werden. Und dann gibt es noch tiefere strukturelle Probleme, die angepackt werden müssen. ZEIT: Welche sind das? Rajan: In den USA driften die Einkommen der Reichen und der Mittelklasse immer stärker aus-einander – und es ist fraglich, ob die Mittelklasse so wie früher am Wirtschaftsleben teilhaben kann. In Europa ist die Produktivität im Dienst-leistungssektor gering. Möglicherweise brauchen wir auch bessere Bedingungen für Innovationen.
ZEIT: Müssen wir uns gene-rell an weniger Wachstum gewöhnen? Rajan: Nicht unbedingt. Dass wir nicht wieder die Raten der Vorkrisenzeit er-zielen, kann bedeuten, dass das Wachstum damals nicht nachhaltig war und wir auf-hören sollten, es wieder er-reichen zu wollen. Und es kann bedeuten, dass wir über unsere Strategie im Kampf gegen die Krise nach-denken müssen. Ich bin der Meinung, dass wir mehr Augenmerk auf Strukturre-formen legen sollten, statt immer neue Maßnahmen zur Stimulierung der Kon-junktur zu ersinnen.ZEIT: Welche Rolle werden
die Schwellenländer in der Zukunft spielen? Rajan: Ich glaube, dass sie weiterhin schneller wachsen werden als die Industriestaaten. Wenn man in Indien eine Straße baut, erzeugt man Wachstum. In Deutschland sind schon fast alle Straßen gebaut. Trotzdem müssen sich die Schwellenländer anpassen, ihre Wirtschaft hängt in vielen Fällen zu stark am Export. Sie müssen die Binnenkonjunktur stärken.ZEIT: Sie haben vor wenigen Wochen Ihren Lehrstuhl an der Universität von Chicago auf-gegeben, um den Chefposten bei der indischen Notenbank anzutreten. Was hat sich durch die-sen Schritt für Sie verändert?Rajan: Der größe Unterschied ist wohl, dass nun auch kleine Entscheidungen das Leben von Mil-lionen von Menschen beeinflussen können. Man trägt eine sehr große Verantwortung. ZEIT: Viele Ökonomen halten sich für die bes-seren Politiker. Sind sie das?Rajan: Wenn Sie ein öffentliches Amt überneh-men, stellen Sie fest, dass die Berater aus der Wissenschaft Sachverhalte in der Regel aus einer bestimmten Perspektive beleuchten. Das ist wichtig, es macht es leichter, die eigenen Gedan-ken zu ordnen. Allerdings wird dabei ein Teil der Realität ausgeblendet, man kann sich nicht nur darauf verlassen. Die Welt ist kompliziert, Ent-scheidungen können eine Reihe von schwer zu prognostizierenden Konsequenzen haben. ZEIT: Was war die größte Umstellung? Rajan: Ich muss vorsichtiger sein, was ich sage.
Die Fragen stellten MARK SCHIERITZ
und ARNE STORN
»Das ist lächerlich«Experten warnen vor einer neuen Krise in den
Schwellenländern. Raghuram Rajan, Starökonom und
Chef der indischen Notenbank, hält dagegen
Veränderungen seit Jahresbeginn
Kursverlauf
Dax
8575+10,6 %
Japan-Aktien
Nikkei 14 455+32 %
Euro
1,35 US$–3 %
Rohöl
103,44 US$/Barrel+11 %
Dow Jones
15 144+13 %
Russland-Aktien
RTS 1419–7 %
Palladium
726 US$/Feinunze +3,7 %
Soja
1319 US Cent/Scheffel –4 %
Kupfer
7332 US $/t–9,3 %
Finanzen
Der Inder Raghuram Rajan lehrte in Chicago und sah die große Krise kommen. In der vergangenen Woche erhielt er den Preis für Finanzökonomie des Centre for Financial Studies in Frankfurt.
Chicago Boy
Besser zum Notar
Wer nicht möchte, dass seine Erben nach der im Gesetz vorgesehenen Folge zum Zuge kommen, der muss ein Testament schreiben oder »errichten«, wie es die Fachleute nennen. Man kann das selbst ma-chen, wobei zu beachten ist, dass die Verfügung kom-plett handschriftlich verfasst und natürlich unter-schrieben sein muss, damit sie gültig ist.
Eine andere Möglichkeit ist der Gang zum Notar. Das kostet zwar Geld. Was viele aber nicht berück-sichtigen: Auch ein eigenhändiges Testament ver-ursacht Kosten. Denn die Erben brauchen dann meist einen Erbschein; in jedem Fall sogar, wenn eine Immobilie zum Erbe gehört. Der Erbschein wird vom Nachlassgericht ausgestellt und ist mit Gebühren ver-bunden, die sich nach dem Wert des Erbes richten.
Das öffentliche Testa-ment, wie man die von ei-nem Notar beurkundete Verfügung nennt, kann den Erbschein ersetzen und den Erben die Ge-richtsgebühren ersparen. Die Notargebühren wur-den zwar gerade kräftig angehoben. Unterm Strich
ergibt sich aber immer noch ein Kostenvorteil ge-genüber dem Erbschein. Überdies ist in der Notar-rechnung die Beratung enthalten.
Ein Vorteil öffentlicher Testamente ist, dass sie nicht verloren gehen oder verfälscht werden kön-nen. Seit dem vergangenen Jahr gibt es in Deutsch-land das Zentrale Testamentsregister. Es wird von der Bundesnotarkammer betrieben. In dem Re-gister steht, wo die Urkunde verwahrt wird. Bis-lang wurden solche Angaben in Karteien von rund 5000 Geburtsstandesämtern festgehalten. Bei je-dem Sterbefall prüft die Kammer, ob Testamente oder Erbverträge vorliegen, und informiert dann das Nachlassgericht und die Verwahrstelle.
Auch eigenhändige Testamente können in ge-richtliche Verwahrung gegeben werden. Wurde der Letzte Wille privat aufbewahrt, muss ihn der Finder nach dem Tod des Erblassers unverzüglich an das zuständige Nachlassgericht abliefern.
Wer ein Testament machen will,sollte professionelle Hilfe nutzen. Das ist oftmals sogar kostengünstiger
GELD UND LEBEN
Diese Woche von Rüdiger Jungbluth
Illu
stra
tio
n:
Kar
ste
n P
etr
at f
ür
DIE
ZE
IT/
ww
w.s
plit
into
on
e.c
om
; Fo
to:
Mu
nsh
i A
hm
ed
/B
loo
mb
erg
/G
ett
y Im
age
s

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 WIRTSCHAFT 31
Europa ist viel weiter, als viele Berufseuropäer annehmen, Europa gibt es wirklich, es muss nicht – wenn auch mit den besten Absichten – erst ausgedacht werden.
Europa ist weiter als die Euro-Zone, seine Grenzen verlaufen nicht einmal entlang der Schengen-Staaten.
Messstationen sind da: Grenzübergänge, Warteschlangen vor den Konsularabteilungen der Schengen-Staaten, Check-in-Schalter, die Veränderung der Immobilienpreise, die Fahr-pläne europäischer Busgesellschaften, die Sta-tistik der Grenzbeamten, die Destinationen des Städtetourismus, die Basare, die Berichterstat-tung von Zeitungen, der Festival- und Kultur-betrieb, die Frequenz von Fähren – jene Kriech-ströme also, die Europa zusammenhalten.
Studenten sind längst unterwegs, vielleicht sogar zu viel unterwegs. Sie kursieren zwischen der Berliner Humboldt-Universität oder der Viadrina in Frankfurt an der Oder und den Universitäten in Krakau, Bergen und Salaman-ca, die Wiederaufnahme der peregrinatio acade-mica aus dem frühneuzeitlichen Europa. Es handelt sich mittlerweile um Hun-derttausende von Erasmus-Studen-ten, die Jahr für Jahr zirkulieren und die, wenn sie schon keine Seminar-scheine erworben haben, so doch le-bensweltlich oft Wichtigeres mit nach Hause bringen: Sprachkenntnisse, Freundschaften, Ehepartner. Es gibt niemanden von den jungen Leuten, der nicht vertraut wäre mit dem Netz-werk und den Möglichkeiten der Bil-ligfliegerei. Ryanair, Wizz Air, easyJet und viele regionale Fluglinien haben ein Netz entstehen lassen, das die Karte Europas und die mental maps in unseren Köpfen dauerhaft verändert. Jeder weiß es aus eigener Erfahrung – ob aus der beruflichen oder bei der Planung des Urlaubs.
Man kann natürlich darüber lächeln oder spotten, dass die Söhne der briti-schen Arbeiterklasse, die in Riga oder Tallinn gelandet sind, nicht einmal wissen, wo sie angekommen sind. Aber irgendwie bleibt doch etwas hängen, und wenn es – neben vielem anderen – nur die Erfahrung von der Grenzen-losigkeit des einen Kontinents ist. Die-se Fluglinien gibt es nicht aus pädago-gischer, sondern kommerzieller Absicht. Sie bringen einen Gewinn, offenbar für beide Seiten, die Unternehmen und die Kunden. So fliegen sie, wenn Nachfrage besteht, so werden sie eingestellt, wenn diese nicht vorhanden ist. Eine Analyse des Streckennetzes der vergangenen zehn bis zwanzig Jahre gäbe uns Auskunft über die attraktivsten Destinationen, über Orte, an denen man etwas holen kann, Orte, die wieder in Bedeutungslosigkeit zurückfallen. Sie sind ein ziemlich guter Indikator für die Neuvermessung Europas. Die Frequenz der Flüge zwischen Schö-nefeld und den Moskauer Flughäfen sagt etwas über die Intensität des Pendelverkehrs zwischen Moskau und Berlin. Die neuen Destinationen in der Ukraine, die man von München aus erreichen kann, sagen etwas darüber, dass die geschäftlichen Beziehungen florieren. Erstaunt nimmt man zur Kenntnis, dass die Busse von München-Hacker-brücke nach Breslau und Lemberg im Sommer zwei Wochen im Voraus ausgebucht sind, offenbar sind Schlesien und Galizien im Kommen.
Die Billigflieger haben Europa irreversibel verändert. Sie haben dafür gesorgt, dass Hun-
derttausende Polen zwischen den englischen Midlands und Gdańsk, Poznań, Łódź und Warschau pendeln und neue transnationale Allianzen wachsen. Die Besiedlung ganzer Landstriche ist durch sie in Gang gesetzt wor-den: die englischen und holländischen Rentner, die im Winter an die spanischen oder bulgari-schen Küsten ziehen, oder die Toskanafraktion-Generation, die sich aus Berlin und Köln bis kurz vor Siena oder Perugia fliegen lässt.
Die Urlaubszonen sind europäische Zonen par excellence geworden: Im Sand der Strände, wo der Mensch nur Mensch ist, kommen die Europäer sich näher, so war es schon in Zeiten des Kalten Krieges an der kroatischen Küste und an den Ufern des Balaton, und so ist es heute erst recht in Antalya und auf Teneriffa, wo die russische und ukrainische Kundschaft der deutschen längst Konkurrenz machen, im Kampf der Geschlechter und auf dem Immo-bilienmarkt.
Der Kultur- und Kunstbetrieb hat die äs-thetischen Konjunkturen und Moden synchro-nisiert. Wer sich in den Museen, Festivals, Ga-
lerien bewegt, bewegt sich in einem Kontinuum des Immer-schon-Be-kannten und Immer-wieder-Neuen. Europäisiert und synchronisiert wer-den die Jubiläen, die Festivals, die Jahrestage: ob 1. September, Okto-berfeste, 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, D-Day, 22. Juni und vielleicht noch der 1. Mai. Synchronisiert werden die Bewegungen, die sich zur Love-Para-de in Berlin oder Woodstock im polnischen Kostrzyn auf den Weg machen. Europäische Museen, euro-päische Erinnerungsorte, europäische Kulturhauptstädte – wir sind immer eingebettet; oder sollten wir sagen: Wir entkommen der integralen euro-päischen Kultur nicht mehr.
Aber von dieser intakten, funktio-nierenden Europäizität spricht man nicht, weil sie immer schon voraus-gesetzt wird und gar nicht der Rede wert ist. Das gilt im selben Maße für das tagtäglich, wöchentlich, monat-lich und Jahr für Jahr aufs Neue ver-fertigte Europa des Verkehrs, des Aus-tausches von Gütern, Personen und Ideen. Man muss sich nur für einen Augenblick vorstellen, was geschieht, wenn die Verkehrsströme, die Europa
zusammenhalten und zusammenschweißen, für einen Augenblick, sagen wir für eine Wo-che, angehalten würden. Das wäre ein Moment des Ausnahmezustandes, in dem die ganze Tragweite jener still funktionierenden Routi-nen und Praktiken ins Bewusstsein rückte.
Es bedarf des Ausbruchs des Vulkans Eyja-fjallajökull und der von ihm in die Atmosphäre geschleuderten Asche, um den Flugverkehr zu unterbrechen und Flughäfen in Notaufnahme-lager für gestrandete Passagiere zu verwandeln. In solchen Augenblicken wird schlagartig klar, worauf unsere Zivilisation basiert: auf dem stillschweigenden Funktionieren von Routi-nen, das sonst nicht der Rede wert ist. Der eu-ropäische Alltag wird aber eben von jenen Rou-tinen und Praktiken konstituiert und dann auch von den Wahlen, Parlamenten, Kommis-sionen und dort verabschiedeten Beschlüssen. Die longue durée der Routinen und der sie ver-körpernden Infrastrukturen ist making of Eu-rope in Permanenz.
Die Karte in den KöpfenBilligflieger, Fernbusse und Urlaubsreisen zeigen ein funktionierendes Europa, das im Krisendiskurs nicht vorkommt VON KARL SCHLÖGEL*
Der Streit ums GeldKönnen Staaten durch Sparen ihre Schuldenprobleme lösen und für Wirtschaftswachstum sorgen? VON KATJA SCHERER
FORUM
Welcher Weg führt aus der Finanzkrise? CDU-Poli-tiker und Ökonomen haben wiederholt von ver-schuldeten europäischen Staaten gefordert, mehr zu sparen. Martin Schulz, SPD-Mann und Präsident des EU-Parlaments, hält das dagegen für die falsche Marschrichtung – und verlangte vergangene Woche: Schluss mit dem Spardiktat!
Nach Ausbruch der Euro-Krise hatten zunächst die Befürworter rigiden Sparens Oberhand. Auf Druck von EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds (IWF) senkten etwa Griechenland und Spanien ihre Investitionen und die Ausgaben für staatliche Transferleistungen, um Schulden abzubauen. Austerität – so nennen Ökonomen eine strikte Sparpoli-tik; es ist ein Wort, das nicht im Duden steht.
Es leitet sich vom englischen Begriff austerity ab und bedeutet »Strenge« oder »Askese«. Die Bri-ten verwendeten das Wort erstmals während des Zweiten Weltkriegs, um die Politik ihres damaligen Wirtschaftsministers Stafford Cripps zu beschreiben, der den Staat durch massive Kürzungen vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren versuchte.
Befürworter der Sparpolitik sind überzeugt, der derzeitigen Krise nicht anders Herr werden zu kön-nen. »Nur wenn die Länder ihre Schulden abbauen, werden sie das Vertrauen der internationalen Finanz-märkte zurückgewinnen«, sagt etwa der Direktor des
arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, Michael Hüther. Die Logik ist folgen-de: Wenn ein Staat keine oder überschaubare Schul-den hat, können Investoren ihm risikoloser Geld leihen, sodass sie niedrigere Kreditzinsen verlangen, was den Staat entlastet. In der Folge kommen auch Unternehmen leichter an Geld und investieren mehr – Arbeitsplätze entstehen, die Wirtschaft wächst.
Tatsächlich funktioniert das in Griechenland bisher nicht wirklich. Zwar ist die Wirtschaft jüngs-ten Schätzungen der griechischen Regierung zufolge
im zweiten Quartal dieses Jahres das erste Mal seit Ausbruch der Krise gewachsen, insgesamt wird sie dieses Jahr aber wohl um rund vier Prozent schrumpfen. Die Schulden dagegen steigen weiter. Dabei haben die Griechen etwa Renten und Sozialleistungen ge-kürzt und die Mehrwertsteuer von 19 auf 23 Prozent erhöht.
Das Problem ist: Von dieser Steuererhöhung sind relativ gesehen vor allem die Ärmeren betroffen, also Rentner, Arbeitslose und Geringverdiener. Wer wenig im Geldbeutel hat, leidet mehr, wenn Brot und Milch plötzlich mehr kosten – und wenn die Sozialleistungen gekürzt werden. Da der wirtschaftliche Aufschwung trotz der Einsparun-gen bisher ausbleibt, ist das, was am stärksten wächst, der Frust der Bevölkerung. Diese Entwicklung be-stärkt die Gegner der Austeritätspolitik in ihren
Zweifeln daran, dass Sparen in der Krise wirklich der richtige Weg ist, die Wirtschaft zu stabilisieren. »Wäh-rend einer Rezession zu sparen ist kontraproduktiv«, sagt etwa der Leiter des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Gustav Horn. »Alles was der Staat weniger ausgibt, nimmt jemand anders weniger ein.«
Unternehmen fehle es an Aufträgen, Haushalten an Transferleistungen. Wenn gleichzeitig auch noch mehr Steuern gezahlt werden müssten, konsumierten die Menschen weniger – und Unternehmen stoppten ihre Investitionen. Die Folge: noch weniger Wachs-tum. »In eine schrumpfende Wirtschaft fassen die Finanzmärkte sicherlich kein Vertrauen.« Sogar der IWF räumte Anfang des Jahres ein, den Schaden für die Konjunktur durch Steuererhöhungen und Aus-gabenkürzungen während einer Rezession unter-schätzt zu haben.
Die Spardebatte scheint unauflösbar. Die einen sagen: Ohne sparen kann es nicht bergauf gehen. Die anderen sagen: Es muss erst bergauf gehen, bevor gespart werden kann. Die aktuelle Krise zeigt zweifellos, dass Staaten viel Zeit brauchen, um Schulden abzubauen, und dass deren Ge-sellschaften nur ein gewisses Maß an Reformen verkraften. Im Mai hat die EU-Kommission Kon-sequenzen aus dieser Erkenntnis gezogen. Die Länder der Euro-Zone, die am meisten mit ihren Schuldenproblemen kämpfen, haben nun bis zu zwei Jahren mehr Zeit, die gesetzten Sparziele zu erreichen.
DER ÖKONOM
Aus te ri tät, die; Reduktion der Staat-
ausgaben auf das Notwendigste,
um Verbindlichkeiten abzubau-
en und einen ausgeglichenen
Haushalt zu erreichen
*Vorabdruck aus: Karl Schlögel: Grenzland Europa. Unter-wegs auf einem neuen KontinentHanser, München 2013; 352 Seiten, 21,90 €
Die Rüstungssparte von Rheinmetall brachte Jahre lang solide Ergebnisse. Und nun das: 2013 sank der Umsatz in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 834 Mil-lionen Euro. Die Bundeswehr spart, die Vereinigten Staaten senken wie andere Nato-Staaten ihre Rüs-tungsausgaben. Wer heute Waffen verkaufen will, muss Kunden außerhalb von EU und Nato finden. »Brasilien, Indonesien, Saudi-Arabien, die Vereinig-ten Arabischen Emirate, Kuwait und Algerien«, zählt Rheinmetall als interessante Märkte auf. Um dort ins Geschäft zu kommen, setzt der Waffenbauer nun auf einen Partner mit globalen Kontakten.
Mit dem Industriedienstleister Ferrostaal gründe-te der Rüstungskonzern Ende September das Joint Venture Rheinmetall International Engineering. Beide hoffen, so einen Milliardenmarkt zu erschlie-ßen. Rheinmetall versucht, seine schwächelnde Rüstungssparte zu stärken: Beim Aufbau ganzer Rüstungsindustrien gibt es weniger Konkurrenz als auf dem Markt für Panzer – und die Kontrolle durch die Bundesregierung fällt nahezu aus. Lediglich für die Ausfuhr von technischen Zeichnungen und Spe-zialmaschinen bedarf es einer Genehmigung; für die Vergabe von Lizenzen zum Nachbau deutscher Waf-fensysteme nicht.
Rheinmetall verbinde im Joint Venture sein »brei-tes Produktportfolio mit dem Aufbau lokaler Pro-duktionsstätten«, kündigte das Unternehmen an. Zum Portfolio gehören Schützen- und Transport-panzer, Artilleriegranaten und Maschinengewehre. Man wolle »an einem wichtigen Markttrend partizi-pieren«, sagt Vorstandschef Armin Papperger, »denn
der Aufbau lokaler Infrastrukturen wird bei den internationalen Kun-den gegenüber dem klassischen Import von Rüstungsgütern künf-tig weiter an Bedeutung gewin-nen«. Rohstoffreiche Staaten wie Algerien, Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate kaufen ihre Waffensysteme nicht mehr einfach nur im Ausland. Sie wollen Panzer, Sturmgewehre und Kriegsschiffe selbst herstellen – und investieren Milliarden in den Aufbau ihrer Rüstungsindustrien.
In Algerien arbeiten Ferrostaal und Rheinmetall bereits zusam-men. Dort haben im März 2011 Ferrostaal, das algerische Verteidi-gungsministerium, der staatliche Baumaschinenher-steller Sofame und der Staatsfonds Aabar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Rheinmetall Algerie SPA gegründet. »Rheinmetall ist Technologie-partner dieser Gesellschaft und nicht Anteilseigner«, sagte Ernst Burgbacher, Staatssekretär im Bundes-wirtschaftsministerium, im Bundestag. »Ziel des Unternehmens ist es, eine Produktionsstätte für die Herstellung von Transportpanzern vom Typ Fuchs entstehen zu lassen.«
Nach Angaben der Bundesregierung plant Alge-rien, bis zu 1200 Fuchs-Panzer zu bauen, um Terro-risten zu bekämpfen und die Grenzen zu sichern. Der Panzer kann mit einem Räumschild ausgestattet werden, um Barrikaden – und auch Demonstranten
– aus dem Weg zu schieben. Auf der Hauptversammlung im Mai 2012 präsentierte Rheinmetall das »industrielle Kooperationsprojekt« mit Algerien. Für 2013 wurde die Lieferung von 54 in Deutschland produzierten Fahrzeugen für 150 Millionen Euro vereinbart. Bald sollen die ersten in Algerien her-gestellten Transportpanzer vom Band rollen. Dafür schlossen Rheinmetall und die Partner einen Ausbildungs- und Lizenzvertrag.
Der Aufbau von Rüstungsfabri-ken im Ausland wird von Friedens-forschern kritisiert. Als Sündenfall gilt das Sturmgewehr G3. Es wur-de in bis zu 18 Staaten nachgebaut,
in Iran, Pakistan, Saudi-Arabien und Myanmar soll die Produktion bis heute laufen. Das G3 zählt zu den am meisten verbreiteten Waffen der Welt. Aufgebaut wurden die meisten G3-Fabriken von der Ferro-staal-Tochter Fritz Werner, die ihre Zentrale in Gei-senheim/Hessen hat. Dort soll auch das Joint Ventu-re von Ferrostaal und Rheinmetall sitzen.
Ferrostaal bringt auch die Sparte Oil & Gas in die Gemeinschaftsfirma ein, die Förderanlagen, Pipelines und Pumpstationen errichtet und exzellente Kon-takte in den Maghreb und in die Golfregion pflegt. Öl und Waffen, das passt zusammen. Denn wo im Nahen Osten und in Nordafrika Öl und Gas geför-dert werden, da wird auch aufgerüstet.
AANALYSE
RHEINMETALL AG:
Sitz: Düsseldorf
Umsatz 2012: 4,7 Mrd. Euro
davon Wehrtechnik: 2,3 Mrd. Euro
FERROSTAAL GMBH:
Sitz: Essen
Umsatz 2010: 1,8 Mrd. Euro
(keine aktuellen Angaben)
Die Partner
ZEIT-GRAFIK/Quelle: Firmenangaben
Foto
: Is
old
e O
hlb
aum
WüstenfüchseRheinmetall und Ferrostaal planen, Rohstoffländern beim Aufbau von Rüstungsproduktionen zu helfen VON HAUKE FRIEDERICHS

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Es ist ein guter Tag, um Frank As-beck zu treffen; die Sonne ergießt sich in ein riesiges, rundum ver-glastes Rondell, von dem aus er seine Solarworld regiert. Frank Asbeck ist eine mächtige Erschei-nung, aber es ist eine gesunde
Dicke, den Körper trägt Asbeck aufrecht, er drängt nach vorn. Asbeck läuft auf und ab, das Handy am Ohr, ein Arm rudert durch die Luft. Er demons-triert Machertum, das in Mackertum umschlägt, sobald er zur Begrüßung den Mund aufmacht: »Wichtige Männer telefonieren halt gern.«
Sein Unternehmen ist deutscher Marktführer einer Industrie, die zu ihren besten Zeiten die Ener-giewende vorantreiben sollte und Deutschland gleich dazu. Die Kanzlerin versprach sich »Chancen für Exporte, Entwicklungen, Technologien und Arbeits-plätze«, vor allem im Osten. Es gab eine Zeit, da war Asbecks Solarworld – sie produziert Zellen und Systeme, mit denen Hausbesitzer Energie aus der Sonne gewinnen und speichern können – mehr als fünf Milliarden Euro wert, in den Zeitungen schrie-ben sie vom »Solarworld-Wunder«. Doch dann kam die billige Konkurrenz aus Asien. Chinesische Un-ternehmen machen nun das Geschäft mit der Sonne. Als Einziger auf dem deutschen Markt ist Asbeck übrig geblieben. Er will sich nicht geschlagen geben, auch wenn sein Unternehmen nur noch einen Bruch-teil wert ist und in den Zeitungen nun von einem »Desaster« die Rede ist. Es ist nur nicht immer ganz klar, wofür Asbeck nun kämpft – die Energiewende, die Branche, sein Unternehmen oder sich selbst. Doch so ist es eigentlich immer schon gewesen.
Seine Kritiker treibt Asbeck zur Weißglut. Er sei »einer, der immer im Sonnenlicht stehen muss«; und auch – das ist im Ökomilieu mindestens genauso schlimm – »kein Klimaschützer«, einer, der für die Umwelt nichts übrig habe. Offen mag ihn keiner kritisieren, aber wer sich umtut bei denen, die im Solargeschäft tätig sind und Asbeck kennen, hört viele Klagen. Das ist kein Wunder. Sie haben sich als Vorturner einen von ihnen gewünscht, einen Um-weltschützer, der bescheidener auftritt, vielleicht zu-mindest in einem Ökoprojekt wohnt, der das Woll-sockige wenigstens ein bisschen verströmt.
Stattdessen haben sie Frank Asbeck bekommen, den Rabauken. Den Jäger in Lodenjacke. Den Ma-serati-Fahrer. Schlossbesitzer. Der großkotzig anbot, Opel zu retten, 2008 war das, als es Opel dreckig, der Solarworld hingegen noch fantastisch ging. Eine Milliarde Euro wollte Asbeck bereitstellen, nachdem er dem Papst schon eine Solaranlage für das Dach der päpstlichen Audienzhalle geschenkt hatte.
Die einzige unverglaste Fläche in Asbecks Büro ist die Wand hinter seinem Schreibtisch, an der 99 tote Füchse hängen, einige hat er selbst geschossen, »und die kann ich auch anmachen«, ruft Asbeck, und schon leuchtet es aus den Fuchshöhlenaugen rot und grün. »Da hab ich sogar ’ne TÜV-Prüfung für«, sagt er, »das ist ein kompliziertes elektrotechnisches Sys-tem.« Asbeck bewegt sich in einem umweltbewussten, auf Korrektheit bedachten Milieu und gibt sich nicht die geringste Mühe, sich umweltbewusst oder korrekt zu verhalten. »Der schönste Moment bei der Jagd ist, wenn nichts passiert. Ich kann nie so gut nachdenken wie auf dem Hochsitz«, sagt er. »Es ist der originäre Trieb des Menschen, Beute zu machen. Das finde ich sehr archaisch. Da komme ich dem ursprünglichen Homo erectus mal ein bisschen nahe.« Dabei soll Asbeck doch Homo faber sein, Werkzeugmensch, der daran tüftelt, die Welt zu verbessern.
Nach der Frage, ob es ihm darum gehe, Deutsch-land insgesamt grüner zu machen, spricht er lange darüber, welches Geschenk es sei, ein Unternehmen zu führen. Dann fragt er, was noch mal die Frage war. Dass er einst die Grünen – also die Partei – mitgegrün-det hat in Nordrhein-Westfalen, scheint für ihn so weit weg, dass er sich auch sprachlich distanziert: »Man hat prinzipiell grünes Gedankengut.« Nun habe er sich entfernt von diesen »romantisierenden Vorstellungen«, das passiere, wenn man mit Betriebsräten über Ge-hälter diskutieren müsse. »Ich bin an gekommen in der Realität eines Produktionsbetriebes.«
Als Junge ließ Asbeck Schreibarbeiten von Mitschülerinnen erledigen
Asbeck hat früh gelernt, unliebsame Aufgaben an andere zu delegieren. Er ist Legastheniker, »beken-nender«, ruft er, »bekennender Legastheniker!«. Es gebe ja so viele, die die Entwicklungsstörung ver-bergen wollten. »Ich hatte immer eine Mitschülerin neben mir sitzen, die den Schreibkram für mich er-ledigt hat«, sagt er. Er habe ihr dafür die Aufsätze diktiert. »Neulich habe ich beim Klassentreffen er-fahren, dass meine Lieblingsassistentin jetzt Vor-standsassistentin bei einem Dax-Konzern geworden ist. Die hat ihre Position im Prinzip nach wie vor beibehalten. Sie hat sie nur verfeinert.«
Auf dem Dachboden der Mutter hat Asbeck neulich ein Organigramm gefunden, das er mit neun Jahren entworfen hat. Es war die Struktur seiner Jugendbande. 32 Mitglieder hatte die Clique, »Frank« steht an der Spitze. Die Bereichsleiter müssen von zu Hause etwas zu essen mitbringen, die Gruppe nach außen verteidigen oder Baumhäuser bauen. Auffällig ist, dass leitende Positionen doppelt besetzt sind.
Asbeck ist aufgefallen, dass das Organigramm der Struktur von Solarworld entspricht. Die große Zahl von Redundanzen nennt er »das große Geheimnis« seiner Führung: »Ich versuche, möglichst unter-schiedliche Menschen auf ähnliche Positionen zu setzen.« Damit sie sich ergänzen. Und damit sie sich bekämpfen. Das ist sein Führungsprinzip, es ist ein agonales. Es hat wenig gemein mit dem Kommuni-zieren, dem respektvollen Aushandeln, wie es heute von den modernen Chefs erwartet wird.
Sein Unternehmen hat Asbeck zur rechten Zeit gegründet: Die rot-grüne Regierung führte im Jahr 2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz ein und half dem Ausbau der Erneuerbaren mit Fördergeldern kräftig nach. Auch die extrem teure Fotovoltaik wurde in Deutschland gefördert: Wer hierzulande Solarstrom produziert, bekommt dafür 20 Jahre lang eine garantierte Einspeisevergütung, für die die Stromverbraucher aufkommen; sie lag am Anfang bei 51 Cent pro Kilowattstunde. Deswegen ließen sich so viele Leute Solarzellen aufs Dach bauen.
Bald aber war klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Die schwarz-gelbe Regierung kritisierte die Solar-Förderung. Asbeck nutzte seine guten Kon-takte, vor allem zur FDP. Auch das stößt in der Öko-szene, in der viele die Liberalen als Verhinderer der Energiewende beschimpfen, bitter auf. Asbeck rich-tete der FDP ein Spendendinner aus, lud Guido Wes-terwelle, Otto Graf Lambsdorff und 280 weitere Gäste zu Wein und Wildschwein nach Bonn. Be-sonders mit Westerwelle ist Asbeck gut befreundet. Die FDP wetterte öffentlich gegen die Förderung des Ökostroms. Aber der umweltpolitische Sprecher der Partei, Michael Kauch, sagte noch 2011 vor Solar-lobbyisten: »Ohne die FDP-Bundestagsfraktion hätten Sie längst einen festen Deckel im EEG.« In der Szene raunt man, dass man das vor allem Asbeck zu verdanken habe. Das mit der FDP ist jetzt vorbei, und Asbeck hofft auf Schwarz-Grün. »Ich mag Peter Altmaier«, sagt er.
Asbeck muss jetzt sein Unternehmen nach außen verteidigen. Denn das deutsche Förderprogramm nutzte Herstellern überall. Vor allem in Asien pro-duzierte man wie verrückt Solarzellen. Es gab eine Solarblase. Die Preise brachen so stark ein wie in kaum einer anderen Industrie, 50 Prozent in nicht einmal zwei Jahren. Es gibt nun auf der Welt doppelt so viele Solarfabriken wie nötig wären, um den Bedarf zu decken. Fast alle stehen in China. Ein deutscher Hersteller nach dem anderen meldete Insolvenz an.
Auch der Solarworld geht es so schlecht, dass sie im Sommer fast pleitegegangen wäre. Nur weil Gläu-biger, Aktionäre und Asbeck selbst auf Hunderte Millionen Euro verzichteten, konnten die Schulden
Frank Asbeck in seinem Büro, von dem aus er seine Solarworld führt
von 900 auf 426 Millionen Euro gedrückt werden. Das Emirat Katar hat einen Großkredit versprochen.
Wenige Tage nach dem Schuldenschnitt feierte Asbeck seinen 54. Geburtstag auf einem Schloss, das er dem Entertainer Thomas Gottschalk für fünf Millionen abgekauft haben soll – Asbeck kommen-tiert die Summe nicht. Das Fest war ausgelassen, Nachbarn riefen am frühen Morgen die Polizei. Man erzählt sich das unter Asbeck-Kritikern als weiteren Beweis für dessen moralische Unzulänglichkeit. »Kurz zuvor haben beim Kapitalschnitt manche ihre ganze Altersvorsorge verloren«, sagt eine Solarexpertin.
Jetzt kämpft Asbeck gegen China. Er vermutet, dass seine Konkurrenz nur mithilfe der chinesischen Regierung so mächtig werden konnte; sie versorge die Solarfirmen mit verbilligten Krediten. Aber ob er sein Geschäftsmodell diversifizieren sollte, weil es so leicht geworden ist, ein Solarmodul herzustellen, ob es Zeit wäre für eine Innovation, fragt Asbeck sich nicht. Schließlich habe er von Anfang an Solarmo-dule gemacht. »Ich kann nur Fotovoltaik«, sagt er, »wir müssen das machen, was wir am besten können.«
Jetzt verteidigt Asbeck sein Unternehmen gegen China
Asbeck rief eine Initiative ins Leben, ProSun, und stellte als Präsidenten seinen Konzernsprecher ab. Pro-Sun beantragte bei der EU-Kommission ein Antidum-pingverfahren gegen chinesische Modulhersteller, die Kommission schlug Strafzölle vor, China drohte mit einem Handelskrieg, Merkel musste sich rechtfertigen. Man einigte sich schließlich auf Mindestpreise für Importe chinesischer Solarprodukte in die EU.
Aber Asbeck hält den Kompromiss für faul, auf der Hauptversammlung seines Unternehmens sagte er: »Wir haben da Panda-Kissing gemacht.« Und auch jetzt ist Asbeck noch wütend: »China beobachtet uns und will uns kopieren. In China ist Fälschung die höchste Form der Anerkennung, weil man damit den Erfinder ehrt. Trotzdem bleibt das der Diebstahl geistigen Eigentums.«
In der Solarbranche ärgern sich viele über Asbecks Allianz mit der FDP und seinen Kampf gegen China. Sie nennen ihn egoistisch. Denn die Branche ist ja viel größer: Die Installateure bringen alle Module an, auch die aus China. Ihre Jobs sind nicht bedroht. Asbecks Systeme sind vor allem Erzeugnisse für wohl-situierte Hausbesitzer. Zu ProSun hat sich ein Gegen-verein gebildet, Afase, kurz für: Allianz für bezahl-bare Solarenergie. Und Frank Asbeck, Homo erectus, stellt weiter Solarmodule her.
www.zeit.de/audio
Teurer Strom? Ihm hat’s geholfen!Jetzt allerdings könnte es auch für Frank Asbeck bald aus sein: Seine einst berühmte Solarfirma steckt in der Krise VON ANNE KUNZE
Der ChefFrank Asbeck, 54, führt die von ihm gegründete Solarworld AG seit 1998. Er hielt stets knapp 30 Prozent der Anteile am Konzern, dessen Börsenwert 2007 bei mehr als fünf Milliarden Euro lag. Derzeit beträgt er nur noch 55 Millionen Euro. Nach der Restrukturierung will Asbeck einen Anteil von rund 20 Prozent halten. Sein Vertrag als Vorstandschef wurde bis 2019 verlängert.
SolarworldAls eines der wenigen Unternehmen der Branche produziert Solarworld alles vom Silizium bis zum Solarmodul. Der Konzern mit einst 3300 und heute noch rund 2500 Mitarbeitern produziert im sächsischen Freiberg und in Oregon, USA. Zurzeit ist die Solarworld wegen der Übernahme der Solarsparte in Gesprächen mit Bosch.
EEGAm 1. April 2000 trat das Erneuer-bare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft. Es regelt unter anderem die Subventionierung von grünem Strom, dessen Anteil am inländischen Verbrauch in zehn Jahren von 8 Prozent auf 23 Prozent im Jahr 2012 gestiegen ist.
Zur Sonne
32 WIRTSCHAFT Was bewegt Frank Asbeck
Foto
s: S
tep
han
Pic
k/
Ro
ba
Pre
ss;
die
go1
01
2/
Foto
lia (
u.)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
33
Vielleicht muss man sich Teilchenphysiker als Teil-nehmer einer Polarexpe-dition vorstellen. Einer sehr langen, sehr mühsa-men Reise zum Südpol. Der Weg ist weit, Schnee-stürme erschweren die Sicht, der Wind weht rau. Die Sonne haben die
Männer und Frauen schon seit Längerem nicht mehr gesehen. Aber ihr Ziel ist klar, trotz der ant-arktischen Finsternis: Sie wollen erforschen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie es seit Faust so schön heißt. Und das bedeutet im Mo-ment: den Urknall entschlüsseln, in dem vor 13,8 Milliarden Jahren unser Universum entstand.
Im Verlauf der Expedition sind einige der Na-turforscher zu Legenden geworden. Nächste Wo-che könnte das einem weiteren passieren: Der Schotte Peter Higgs ist der Favorit für den Phy-siknobelpreis 2013, der am kommenden Diens-tag verkündet wird. Higgs hat im Jahr 1964 ein Elementarteilchen vorhergesagt, das im vergange-nen Jahr nach mühsamer Suche am Genfer Rie-senbeschleuniger LHC nachgewiesen wurde.
Aber das Higgs-Boson, populärwissenschaftlich fehlgedeutet als »Gottesteilchen«, ist nicht das Ende der Reise. Bis zum Südpol ist es noch ein weiter Weg. Seit 350 Jahren sind die Physiker schon unterwegs. Anfangs eilten sie ihrem Ziel mit Riesenschritten entgegen. Doch je näher sie dem Ziel kommen, desto mühsamer wird die Reise. Es ist gar nicht mehr so klar, ob das ganze Unterneh-men überhaupt zum Ziel führen kann.
Die Kompassnadel dreht sich wild im Kreis. Die Zweifler unter den Forschern tuscheln so laut wie lange nicht mehr: Müssen wir das waghalsigste Abenteuer der modernen Wissenschaft unvollen-det abbrechen? Existiert das Ziel, von dem wir träumen, vielleicht überhaupt nicht?
Der Entdecker des Kompasses kann nichts für den Schlamassel. Er saß im Garten eines briti-schen Weilers namens Woolsthorpe-by-Colster-worth, es war im Jahr 1664 oder 1665, so genau ist das nicht überliefert. Jedenfalls kam ihm dort die entscheidende Idee. Angeblich fiel ein Apfel vom Baum. Isaac Newton jedenfalls erkannte: Die Schwerkraft lässt nicht nur Äpfel auf den Boden fallen – alle Massen ziehen einander an, und das lässt sich mit einer einzigen, einfachen Formel beschreiben.
Seither diente die Mathematik Generationen von Gelehrten als Orientierungshilfe auf dem Weg zur Wahrheit. Die Formelsprache leitet sie beim Verständnis der Naturerscheinungen, sie ist ihr Kompass und Wegweiser bei dem Versuch, das Chaos der Realität zu bändigen.
Eines der ersten Expeditionsmitglieder, das auf dem Weg zum Pol den Wert dieses Kompasses er-kannte, war James Clerk Maxwell, im polaren Schneesturm erkennbar an seinem mächtigen Zausebart. Maxwell sah sich im 19. Jahrhundert mit einer verwirrenden Vielfalt elektrischer und magnetischer Phänomene konfrontiert. Doch mit-hilfe der Mathematik verwandelte er das Chaos in Schönheit; er formulierte vier elegante Gleichun-gen, die eine profunde Wahrheit offenbarten: Magnetische und elektrische Kräfte sind zwei Fa-cetten desselben Naturphänomens. Die »Elektro-dynamik« war geboren, sie ermöglichte Stromlei-tungen, Glühbirnen und Radios.
Doch schon kurz nach Maxwells Entdeckung stand die Polarexpedition plötzlich an einem Scheideweg. Eine Gruppe von Männern wollte ein geheimnisvolles Fluidum ausgemacht haben – den »Äther«, eine hypothetische Trägersubstanz für die elektromagnetischen Erscheinungen. Ohne Äther kein Licht. Die anderen glaubten fest, auch ohne solch eine Hilfskonstruktion auszukommen, die Wellen würden sich auch im völlig leeren Raum ausbreiten. Ende des 19. Jahrhunderts wi-derlegten mehrere Experiment die Äther-Hypothese. Die Ex-pedition war kurz davor, kehrt zu machen.
Doch zwei große Durch-brüche zu Beginn des 20. Jahr-hunderts brachten die Physiker wieder auf die richtige Fährte. Die Quantenphysik und die Allgemeine Relativitätstheorie offenbarten die wahre Natur von Licht, Raum und Zeit. Erstere beschreibt das Innerste der Materie als Wechsel-spiel von Elementarteilchen und Feldern. Letztere macht die Schwerkraft zu einer Eigenschaft des Weltraums: Jede Masse verbeult ihn, wie eine Perle ein gespanntes Seidentuch. Die geistigen Väter der beiden großen Theorien, Albert Einstein sowie Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger und Paul Dirac, ließen sich erneut von der Mathematik lei-ten – dass ihre Theorien die Wirklichkeit beschrei-ben, zeigte sich erst Jahre später.
Mit neuem Selbstvertrauen setzten die Physiker ihre Reise fort. Es begann das Zeitalter der Teil-chenphysik und der schwungvollen Theorien. Den Kompass schnappte sich ein Amerikaner. Steven Weinberg ließ sich ganz von mathemati-scher Ästhetik leiten. 1967 sah er in seinen For-meln glasklar die weitere Route zum Pol: Es müsse, so postulierte er, eine weitere Vereinheitlichung der Wechselwirkungen geben.
So, wie es Maxwell einst mit Magnetismus und Elektrostatik vorgemacht hatte, vereinigte nun Weinberg (unterstützt von Abdus Salam und Shel-
don Glashow) mit der Macht der Mathematik die sogenannte schwache Kernkraft (die Atomkerne zerfallen lässt) mit dem Elektromagnetismus zur »elektroschwachen« Kraft. Die soll in der Glut des Urknalls über das junge Universum geherrscht ha-ben. Und als die unvorstellbar heiße Ursuppe in den ersten Sekundenbruchteilen allen Seins ab-kühlte, trennten sich die Kräfte in die uns bekann-ten Phänomene.
Möglich war diese Vorhersage dank einer ver-blüffenden Erkenntnis, die Physiker in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erlangt hatten: Das Chaos zähmt man nicht, indem man über die ständigen Veränderungen Buch führt – sondern indem man das festhält, was unverändert bleibt. Haut man ein paar Pfeiler in den Boden, während der Schnee-sturm tobt, kann man sie als Orientierungspunkte nehmen, um ein Modell für den scheinbar chaoti-schen Tanz der Schneeflocken zu konstruieren.
Seitdem suchen Physiker nach »Symmetrien« – mathematischer Jargon für physikalische Grö-ßen, die stets gleich bleiben, wenn sich die Umge-
bung verändert. Mit ihnen als Ausgangspunkt können sie elegante »Eichtheorien« entwi-ckeln, die bestimmte Felder und Elementarteilchen enthal-ten müssen. Um im Bild zu bleiben: Die Eigenschaften des Sturms werden so definiert, dass er die Pfeiler nicht ausrei-ßen darf.
Auf Symmetrien hatten sich Weinberg, Salam und Gla-
show bei der Konstruktion ihrer elektroschwachen Theorie gestützt. Danach nutzten ihre Kollegen sie, um auch die »starke Kernkraft«, die Atomker-ne zusammenhält, in ein elegantes Modell zu pres-sen. Zusammen ergaben sie das sogenannte Stan-dardmodell der Elementarteilchen, das drei Grundkräfte und 61 elementare Partikel zusam-menfasst. Das Modell könne so gut wie alles be-schreiben, schwärmen Physiker: von den Reaktio-nen, die das Sonnenfeuer brennen lassen, bis zu den Kräften, die eine Schneeflocke zusammenhal-ten. Endlich schien der Weg, den der mathemati-sche Kompass wies, klar zu sein.
In der Praxis aber türmten sich gewaltige Hin-dernisse wie Schneewehen vor den Physikern auf. So sagte die elektroschwache Vereinheitlichung die Existenz von drei neuen Elementarteilchen voraus, und ein viertes war nötig, um sie mit der restlichen Teilchenphysik zu versöhnen. Um in der Polar-nacht weiter voranzukommen, wurde schweres Gerät notwendig. Zum Glück tobte in den Hei-matländern der Expeditionsteilnehmer gerade ein Kalter Krieg, und die Gesellschaft war gern bereit, in Technologie zu investieren. Die Teilchenphysi-
ker bekamen riesige, ringförmige Beschleuniger, in denen lichtschnelle Protonen mit Antiprotonen kollidierten. So wurden Bedingungen erzeugt, wie sie kurz nach dem Urknall geherrscht haben sollen.
Und tatsächlich: 1983 zeigten sich in einem knapp sieben Kilometer langen Teilchenbeschleu-niger am europäischen Kernforschungszentrum Cern bei Genf die drei Elementarteilchen der elektro schwa chen Theorie. Die Entdeckung dieser W- und Z-Bosonen wurde prompt 1984 mit dem Nobelpreis belohnt – die Physiker waren auf dem richtigen Weg. Für das vierte Teilchen benötigten sie allerdings eine noch größere Maschine, größer als alles, was Menschen bisher gebaut hatten – den Large Hadron Collider (LHC), der 2009 am Cern fertiggestellt wurde. 27 Kilometer ist er lang, drei Milliarden Euro hat er gekostet, und er verbraucht ein Zehntel des gesamten Stroms im Kanton Genf.
Im vergangenen Jahr war es dann so weit, das Higgs-Boson wurde nachgewiesen. Seitdem wissen die Forscher: Ihr ambitioniertes Modell für den Mikrokosmos beschreibt tatsächlich die Natur. Ist das Ziel damit in Reichweite? Leider nein. Die erste Billionstel Billionstel Billionstel Sekunde des Universums stellt die Physiker vor große Rätsel. Damals, noch bevor sich erste Elementarteilchen bilden konnten, soll der Kosmos von einer einzi-gen Urkraft beherrscht worden sein – aus der bald darauf die heute bekannten Grundkräfte hervor-gingen, Schwerkraft, starke Kernkraft und elek-troschwache Kraft.
Beschreiben soll diesen Urzustand des Kosmos eine »Weltformel« – eine große Vereinheitlichung der gesamten Physik, die sowohl das Standard-modell der Teilchenphysik als auch Einsteins All-gemeine Relativitätstheorie enthält. Gelänge es, die zwei Säulen der modernen Physik in einem ele-ganten Modell zusammenzufassen, wäre die Arbeit der Teilchenphysiker abgeschlossen.
Bislang aber widersetzt sich die Gravitations-kraft jeder Vereinheitlichung; in das bisherige Schema der drei anderen Grundkräfte will sie sich partout nicht einfügen. Und auch etwas anderes hat die Expedition ausgebremst: Die Astronomen haben in letzter Zeit einige Entdeckungen ge-macht, die den Physikern neue Rätsel aufgaben. Im All verhielten sich die Gestirne ganz sonderbar, kein Modell konnte das beschreiben. Neben den bekannten Elementarteilchen müssten dort noch »Dunkle Materie« und »Dunkle Energie« am Wer-ke sein, sagten die Astronomen; jedenfalls seien mehr als 95 Prozent des Universums unverstanden.
Auch die Teilchenphysiker waren nicht mehr recht zufrieden. Je länger sie darüber nachdachten, desto weniger gefiel ihnen ihr Standardmodell. Denn wichtige Fragen lassen sich damit nicht auf
KinderZEIT Im Fernsehen: Ein Besuch auf Schloss Einstein S. 41
Nicht essen! Diese Pilze sollten Sie im Wald besser stehen lassen – sie sind giftig. Eine Infografik S. 37WISSEN
Immer noch
nicht widerlegtAuch beim Klima: Gewissheit gibt es nicht – das ist keine Ausrede
Sir Karl Popper schaute weniger auf den In-halt als auf die Gestalt. Für alle, die ihn nicht kennen: Popper war kein Designer, sondern Philosoph. Aber er dachte über das Design von Wissenschaft nach, über Forschungsfra-gen und Erkenntnisgewinn. Und damit sind wir beim Klimawandel.
Popper hat das wichtigste Kriterium für die empirische Naturwissenschaft formuliert, Falsifizierbarkeit: »Eine wissenschaftliche Hy-pothese (lässt sich) zwar niemals erweisen, wohl aber, wenn sie falsch ist, widerlegen« – nur was so formuliert wird, dass es als falsch entlarvt werden kann, ist wissenschaftlich von Wert. Für Forscher bedeutet das: Sie müssen stets danach streben, vorherige Ergebnisse zu widerlegen, also zu falsifizieren. Für uns alle heißt es: Auch wenn eine Hypothese nie bewiesen werden kann, nie als letztend-lich wahr gelten wird, kann man sich ihrer doch unsicherer oder sicherer sein. Umso mehr, je hartnäckiger sie Falsifikations versu-chen trotzt. Und da-mit sind wir beim jüngsten Bericht des Weltklimarats.
Der enthält bei allen neuen Details keine grundlegenden Ver-änderungen im Vergleich zu seinem sechs Jahre alten Vorläufer (welcher wiederum auf drei noch älteren Fassungen fußt).
Nachrichtentechnisch mag das eine Ent-täuschung gewesen sein. Wissenschaftstheo-retisch betrachtet, ist es ein gutes Zeichen.
Und was ist mit jenen Aussagen, die sich im Detail verändert haben? Etwa der Progno-se für den Meeresspiegelanstieg, die nach oben, oder dem Korridor für die Klimasensitivität, der nach unten korrigiert wurde? Sie erinnern uns daran, dass der Erkenntnisgewinn keinen Endpunkt hat. Weder im praktischen noch im popperschen Sinne.
Wenn nun selbst in der – verdichteten und vereinfachten – Zusammenfassung des Berichts keine Gewissheiten verkündet wer-den, sondern stattdessen da steht: »Es ist extrem wahrscheinlich, dass menschlicher Einfluss der dominante Grund für die im 20. Jahrhundert beobachtete Erwärmung ist«, ist das eine Referenz an die grundsätz-liche Möglichkeit, dass es sich noch als an-ders herausstellen könnte.
Aber ist das auch eine Ausrede für das Kernpublikum des Klimaberichts, also für die Regierungen der Welt?
Politische Entscheidungen fallen in einer anderen Sphäre. Politik basiert selten auf Gewissheit, dafür häufig auf Überzeugung. Kriege wurden schon auf Basis handfester Lügen (Irak-Invasion) begonnen, staatliche Fürsorgeprogramme wider jedes bessere Wissen (Betreuungsgeld) eingerichtet.
In diesem Fall aber sind die Gründe gut. Beim Stand des Wissens über die drastischen Eingriffe, die wir ins Erdklimasystem vor-nehmen, kann es politisch nur eine Konse-quenz geben: handeln. Durch Klimaschutz und Vorbereitung auf die wohl nicht mehr abwendbaren Folgen des Treibhauseffekts. Wer vorher alle zugrunde liegenden Hypothesen bewiesen haben wollte, hätte die Unmöglich-keit nicht verstanden – und erst recht nicht die Dringlichkeit. STEFAN SCHMITT
Der Meeres-spiegel soll noch weiter steigen
Ein Herz für FliegenHans-Dietrich Reckhaus aus Bielefeld arbei-tet hauptamtlich als Insektenschutzmittel-hersteller. Nebenamtlich ist er Insekten schüt-zer. Geisterte neulich durch die Medien, weil er einer Fliege aus der Ortschaft Dep-pendorf ein Flugticket kaufte und ihr vier Tage Wellnesshotel bezahlte. Als Bock macht er Gift, als Gärtner verleiht er seinen Produkten das Gütesiegel »Insect Respect«. Das besagt: Man darf Fliegen vergiften, aber man muss für Ausgleichsmaßnahmen sor-gen. Etwa für Gärten auf Reckhaus’ Hallen-dächern, wo Insekten sich mehren können.
Jetzt kümmert sich der Mann auch um andere Fliegenkiller. Er ließ einen VW Käfer (!) mit Klebestreifen an der Frontscheibe rumfahren. Ergebnis: Autofahrer erledigen auf 100 Kilometer 500 Insekten. Was man gegen Geld bei Reckhaus kompensiert. Wo-mit dieser in Deppendorf das erste Drei-Sterne-Insektenhotel bauen kann. BUS
WISSENHALB
Fortsetzung auf S. 34
Expedition zum UrknallSeit 350 Jahren versuchen Physiker, die Naturgesetze zu vereinheitlichen.
Doch im Moment stecken sie fest und streiten über die richtige Orientierung
VON ROBERT GAST
Die Mathematik war stets der Kompass der Physiker – aber im Moment dreht sich die Kompassnadel wild im Kreis
Illu
stra
tio
n:
Uli
Kn
örz
er
für
DIE
ZE
IT/
ww
w.u
likn
oe
rze
r.co
m;
Foto
(r.
): R
ob
ert
Se
eb
erg
/C
aro
Schneestürme, tiefe Gräben, tanzende
Kompassnadeln: Die Suche nach dem Kern
der Physik gleicht einer gefährlichen Polarerforschung

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Schluss. Aus. Vorbei. Keine geistreichen Kom-mentare mehr, keine angeregten Diskussionen – aber auch keine Pöbeleien: Vergangenene
Woche hat das ehrwürdige amerikanische Magazin Popular Science kurzerhand die Kommentarfunktion auf seiner Website abgeschaltet.
Moment mal: Keine Kommentare mehr? Das, was viele Menschen am Internet so schätzen – dass jeder mitreden, seine Meinung sagen darf. Dass De-batten entstehen und daraus neue Sichtweisen und Ideen – das alles soll es bei Popular Science nicht mehr geben? Genau. Denn: »Kommentare können schlecht für die Wissenschaft sein.«
So beginnt die Online-Redakteurin Suzanne La-Barre ihre Begründung für das Vorgehen. Nach dem üblichen »Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht« kommt sie zum Punkt: Es gebe wis-senschaftliche Belege dafür, dass eine aufgebrachte Minderheit durch ihre Meinungsäußerungen Macht über die Wahrnehmung einer Geschichte gewinne. Eine amerikanische Studie habe den Zusammen-hang gezeigt. Und der habe drastische Konsequen-zen: Die Kommentare beeinflussten die öffentliche Meinung, die wiederum die Politik. Und die be-stimme, welche Forschung gefördert werde, schreibt LaBarre. Ist die Entscheidung von Popular Science nicht fast unausweichlich?
»Es ist schon ein wenig tragisch, dass man das Web 2.0 zum Web 1.5 zurückdreht«, sagt Dietram Scheufele, aber er könne den Schritt verstehen. Scheufele ist quasi mitverantwortlich für die Ent-scheidung von Popular Science. Der Professor für Wissenschaftskommunikation an der Universität von Wisconsin ist einer der Autoren der von La-Barre angeführten Studie.
»Ein Gefühl wie bei einer Party, zu der auch ungeladene Gäste kommen«
Schaut man sich seine Untersuchung aus diesem Frühjahr (veröffentlicht im Journal of Computer-Mediated Communication) an, dann ist der Schritt von Popular Science nur konsequent. Er und vier Mitautoren baten mehr als 2300 Probanden, sich einen Artikel sowie die zugehörigen Kommentare in einem Blog einer kanadischen Zeitung anzuschau-en. Das Stück beschrieb die Vor- und Nachteile von Silber-Nanopartikeln – detailliert, ausgewogen und korrekt. Die Kommentare allerdings hatten die For-scher manipuliert: Die eine Hälfte der Probanden bekam sachliche Beiträge zu lesen, die andere un-höfliche wie »Wer nicht die Risiken für Fische und andere Tiere und Pflanzen erkennt, die im mit Sil-ber verschmutzten Wasser leben, der ist dumm«.
Diese Art der Kommentare beeinflusste die Leser derart, dass sie das Thema nicht mehr ausgewogen
betrachteten (im Gegensatz zu den Probanden, die die sachlichen Kommentare gelesen hatten), sondern in ihrer Meinung radikalisiert wurden. Kritiker wur-den deutlich kritischer und weniger zugänglich für die Meinung der anderen Seite. Die guten Argumen-te im Artikel hatten ihre Kraft verloren – durch ein paar irrlichternde Aussagen. »Es hat uns schon über-rascht, wie stark die Reaktionen auf die Kommentare waren – und das bei einem Spezialthema wie Nano-technologie, über das die Leute nicht so viel wissen. Bei einem Thema wie Impfen wären die Reaktionen wohl noch stärker gewesen«, sagt Scheufele.
Aber soll man Diskussionen gar nicht erst zulassen, nur weil sie entgleiten und ihre Leser manipulieren könnten? Sind sie nicht auch wichtig, um wissenschaft-liche Entwicklungen gesellschaftlich einzuordnen? Ja, schon, sagt Scheufele. Doch er frage sich, ob das In-ternet das beste Forum dafür sei. Und wenn ja: Seien Online-Kommentare als gesellschaftliche Debatten-form geeignet? Es sei ein bisschen so, »als läse ich auf dem Marktplatz eine Zeitung, und wildfremde Men-schen um mich herum schrien mir zu, was ich glauben solle«. Auch der Soziologe Stephan Humer, For-schungsleiter und Gründer des Arbeitsbereichs Inter-netsoziologie an der Universität der Künste Berlin, hat bei vielen Online-Debatten »ein Gefühl wie bei einer Party, zu der auch ungeladene Gäste kommen«.
Doch man muss ehrlich sein: Der Datenbestand ist dünn; über die Thematik wurde wenig geforscht, das gibt auch Scheufele zu. Deswegen bezeichnet er den Schritt von Popular Science als »Ausdruck einer Phase, in der wir über das richtige Vorgehen dis-
kutieren«. Viele Online-Medien kümmern sich be-reits mit viel Aufwand um das Problem, indem sie die Diskussionen unter den Artikeln moderieren (wie auch ZEITonline).
Scheufele schlägt etwas anderes vor: Man sollte die Kommentare von Lesern bewerten lassen und die nach oben stellen, die besonders gute Noten be-kommen. »Dann hat man eine demokratische Ent-scheidung darüber, was gute Kommentare sind.«
Auch Popular Science kann sich offensichtlich nicht so ganz von der alten Tradition trennen: Die Leserstimmen zu der Kommentar-Entscheidung, die die Online-Redaktion zusammengestellt hatte, konnten kommentiert werden.
Kein KommentarEine amerikanische Wissens-Website lässt unter ihren Artikeln keine Debatte mehr zu. Der Grund: Die Äußerungen beeinflussen die Leser VON JAN SCHWEITZER
nicht ausreiche, brauche man eben ein noch größe-res Gerät!
Aber wie viele Milliarden ist der Gesellschaft die Neugier der Physiker wert? Haben sich die Expedi-tionsteilnehmer mittlerweile nicht schon so weit von zu Hause entfernt, dass ohnehin kaum noch je-mand versteht, wonach sie suchen? Für 99,9 Prozent der Menschen sei schon das Higgs-Teilchen nicht mehr nachvollziehbar, sagte etwa der Physiker und Fernsehmoderator Harald Lesch im vergangenen Jahr in einem Interview. Wen interessiert da noch die große Vereinigung der Kräfte, die – wenn über-haupt – nur für einen unvorstellbar kurzen Bruch-teil einer Sekunde Realität war, damals, vor 13,8 Milliarden Jahren – und deren Physik auf der Erde vermutlich nie eine Rolle spielen würde?
Auch der alte Weise der Polarreisenden, Steven Weinberg, ist pessimistisch. Im vergangenen Jahr hat er eine Klageschrift verfasst, The Crisis of Big Science. Über die Hoffnung auf einen noch größe-ren Teilchenbeschleuniger schreibt er: »Es wird sehr schwer werden, das zu verkaufen.« Weinberg erin-nert an den in jeder Hinsicht vor Superlativen strot-zenden »Superconducting Super Collider«, der An-fang der 1990er Jahre in Texas entstehen sollte – und dem kurz nach Baubeginn vom US-Repräsentan-tenhaus die Gelder gestrichen wurden.
Vielleicht braucht die Expedition auch nur eine Besinnungspause? Schließlich hat kaum noch je-mand Zeit, sich einen Überblick über all die vie-len Einzelergebnisse zu verschaffen und dann – ähnlich wie Einstein seinerzeit mit der Relativi-tätstheorie – einen Befreiungsschlag zu landen, der viele Fragen mit einem Mal in anderem Licht erscheinen lässt.
Heute versinken Professoren in Verwaltungs-tätigkeiten, und selbst Doktoranden klagen, ihnen
fehle die Zeit, Arbeiten außerhalb ihres Nischen-themas zu lesen. Denn die Forschungsliteratur wächst und wächst. Im wichtigsten Physikerjournal Physical Review erschienen im Jahr 1893 gerade ein-mal 24 Aufsätze. Im Jahr 2013 werden es 4050 Ar-beiten in der mittlerweile zu Physical Review Lettersexpandierten Zeitschriftenfamilie sein, zusammen umfassen sie schwindelerregende 20 000 Seiten. Wer soll da noch den Durchblick haben? »Die Phy-sik ist sehr viel fragmentierter als früher«, sagt Jür-gen Renn vom Max-Planck-Institut für Wissen-schaftsgeschichte. Ob da noch einmal eine ähnliche Synthese gelinge wie zu Zeiten Einsteins, sei »die große Frage«.
Bleibt die Physik-Expedition also erneut stecken, so wie damals beim Äther? Auch das Gegenteil ist denkbar: Vielleicht funktioniert der Kompass der Mathematik nach wie vor tadellos – nur wissen wir sein scheinbar erratisches Verhalten nicht zu deuten.
Zu dieser These neigen vor allem die Verfechter der Stringtheorie. Ihr zufolge sind Elementarteil-chen und Kräfte nichts anderes als einander überla-gernde winzige Schwingungen in der kosmischen Landschaft. Um die zu beschreiben, brauchen sie nicht nur komplexe Eichtheorien und Supersym-metrie, sondern auch einen Raum mit elf Dimen-sionen. Die mathematischen Gleichungen dafür sind hochelegant. Allerdings erlauben sie eine schier unendliche Vielzahl von Lösungen, genauer: 10 500
»kosmische Landschaften«. Welche davon ist die, in der wir leben? Bisher wissen die String-Theoriker noch nicht einmal, ob eine der Lösungen überhaupt unser Universum korrekt beschreibt. Einige haben sich daher zu einer optimistischen Interpretation durchgerungen – für sie entspricht jede Lösung ei-nem Universum mit jeweils eigenen Naturgesetzen. Allerdings werden wir nie eine dieser Myriaden von anderen Welten besuchen oder auch nur beobach-ten können.
Die Forschungsreise könnte ein tragikomisches Ende nehmen
Ist das noch Physik oder schon Philosophie? Kann man die Stringtheorie jemals falsifizieren? Darüber streiten die Forscher seit Jahren. Immerhin: Die Hy-pothese der »Multiversen« würde mit einem Schlag die Willkür beseitigen, die Physiker am Standard-modell stört. Die »freien Parameter« hätten dann einfach den Wert, den sie haben, weil es uns sonst nicht geben würde. Selbst die Dunkle Energie könn-te man so erklären.
Es wäre ein tragikomisches Ende der großen Rei-se zum Südpol. Die einen würden die sich drehende Kompassnadel als Beweis dafür sehen, dass man am Ziel war. Andere würden bis an ihr Lebensende be-haupten, bloß auf einer rotierenden Eisscholle auf einem eiskalten See gestanden zu haben. Für sie wäre das Multiversum die ultimative Niederlage ih-rer Zunft, die Absage an einen höheren Sinn unserer Existenz. Dass unser ganzes Universum letztlich nichts anderes sein könnte als eines von vielen, eine munter dahinwirbelnde Flocke in einem kosmischen Schneesturm – das wäre nicht nur für Physiker eine ziemlich ernüchternde Erkenntnis.
34 WISSEN
Expedition zum Urknall
Fortsetzung von S. 33
übergeordnete mathematische Prinzipien zurück-führen: Wieso haben die Elementarteilchen gerade jene Massen, die sie haben? Und wieso sind die drei im Standardmodell enthaltenen Kräfte so unter-schiedlich stark? In ihre eleganten Gleichungen müssen die Physiker über 20 sogenannte »freie Pa-rameter« per Hand einsetzen. Wirklich überzeu-gend ist das nicht.
So sieht es derzeit so aus, als stünde die Expedi-tion vor einem Labyrinth aus messerscharfen Eis-schollen, in dem jegliche Orientierung verloren geht. In welcher Richtung geht es zu den tieferen Prinzipien, die die freien Parameter festlegen? Dort müsste man auch auf die Weltformel stoßen, hoffen die Physiker. Ausgerechnet jetzt scheint der Kom-pass der Mathematik die Forscher im Stich zu lassen – ganz so, wie auch im richtigen Leben die Nadel zu rotieren beginnt, wenn man sich dem Pol nähert. Eine elegante Eichtheorie, die starke Kernkraft und elektroschwache Kraft vereinigt hätte, erwies sich als Irrweg. Ihr zufolge wäre das Proton instabil, worauf Physiker bis heute keinen Hinweis gefunden haben.
Wie viele Milliarden ist uns die Neugier der Physiker wert?
Nun setzen die Physiker auf die »Supersymmetrie«: Kurz nach dem Urknall soll jedes der bekannten Ele-mentarteilchen einen (bislang noch unbekannten) Partner gehabt haben. Mit diesen zusätzlichen super-symmetrischen Teilchen ließen sich nicht nur elek-troschwache Kraft und starke Kernkraft auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt zurückführen; man könnte aus ihnen auch die Masse des Higgs-Teil-chens elegant herleiten – einer der »freien Parame-ter«, der besonders am Stolz der Physiker nagt. Even-tuell könnte eines der postulierten neuen Teilchen sogar die Existenz der Dunklen Materie erklären.
Aber die Mathematik der Supersymmetrie ist al-les andere als eindeutig. Mit ihr lassen sich zahlrei-che Welten mit ganz unterschiedlichen Eigenschaf-ten konstruieren. Ob eine von ihnen tatsächlich die Natur beschreibt, weiß niemand. Zudem fanden sich in den Teilchenbeschleunigern trotz intensiver Suche bislang keine Hinweise auf Supersymmetrie. Ist der Kompass der Mathematik kaputt?
In ihrer Not üben sich viele in Durchhalteparo-len. Man müsse nur mit den Beschleunigern wei-tersuchen, sagen sie, irgendwann werde man schon supersymmetrische Teilchen finden – oder etwas anderes Spannendes. Und wenn der LHC dafür Il
lust
rati
on
: U
li K
nö
rze
r fü
r D
IE Z
EIT
/w
ww
.ulik
no
erz
er.
com

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 WISSEN 35
Am Hügel von Pachacámac droht der Archäologie die nächste Niederlage. Der Geg-ner scheint übermächtig, ein gefräßiger Moloch, der sich Meter um Meter vorarbeitet. Er nähert sich von mehreren
Seiten. Sein Name: Lima. Die 10-Millionen-Metropole Perus wächst in
horrendem Tempo. Ihre Quartiere, die 40 Kilo-meter südlich des Zentrums auf dem Wüstensand weiter wuchern, drohen die antiken Ruinen unter sich zu begraben. Damit Pachacámac nicht das-selbe Schicksal ereilt wie unzählige andere Zeug-nisse der Vergangenheit, haben die Behörden eine kilometerlange Mauer errichtet. Ein etwas fragiles Bauwerk zwar, aber eines, das bislang standhält, dank Polizeischutz.
Und so könnte es sein, dass diese Inkastätte überdauert, dass die Moderne sich nicht auf den Überresten der einstigen Weltenherrscher breit-macht – wie es andernorts geschah.
Ein Jahrhundert lang, von 1438 bis 1532, hatten die Inka den größten Staatsapparat der Neuen Welt aufgebaut und regiert, ein multiethnisches Gebilde aus 200 Volksgruppen, mit Cusco als Hauptstadt und dem sagenumwobenen Herrschersitz Machu Picchu im unzugänglichen Gebirge. In diesem Reich stießen die spanischen Eroberer auf sagen-hafte Goldschätze. Und noch heute findet man auf Andengipfeln Überreste junger Menschen: mumi-fizierte Opfer, Göttern dargebracht.
Das meiste, was die Nachwelt über das Wir-ken der Andenkönige erfahren hat, stammt aus den Quellen ihrer Feinde, der Eroberer. Schrift-stücke im geläufigen Sinn haben die Inka nicht hinterlassen, einzig Quipus, das sind Dokumente einer Knotenschrift, die buchhalterischen Zwe-cken diente, und ein paar Stoffe mit geheimnis-vollen Zeichen, aus denen die Gelehrten irgend-wann einen Code herauszulesen hoffen.
Neue Erkenntnisse über die Funktionsweise des Inkastaats erwartet die Fachwelt von der Ar-chäologie. Doch die gestaltet sich schwierig. Schon die Konquistadoren stellten, als sie im 16. Jahrhundert das Inkareich unterwarfen, ihre Pa-läste und Kirchen auf das Repräsentations-gemäuer der Exregenten – so wollten sie die Ge-schichten von Pachacuti, Tupac Yupanqui, Huay-na Cápac und den übrigen Herrschern der Inka-Dynastie vergessen machen.
Was von Siedlungen und Tempeln an der Oberfläche blieb, frisst seither die Erosion weg oder wird von heutigen Bauherren überbaut, weggekarrt, recycelt. Auch Pachacámac am Stadt-rand von Lima, Tempelstadt der Vorgängerkultur Ichma und danach Verwaltungszentrum der Inka, hat viel Gemäuer verloren. Aber Restauratoren versuchen zu retten, was zu retten ist: den Mond-tempel, den Urpi-Wachaq-Tempel, den Pilger-platz und den Sonnentempel am höchsten Punkt der natürlichen Erhebung. Vor 500 Jahren be-fragten die Inka hier das Orakel. Heute noch su-chen Peruaner, wenn die Erde bebt, Pachacámac auf und bitten den Schöpfergott Pachakamaq um Ruhe in tektonischen Tiefen.
Hält die Mauer der Behörden, wird Pachacá-mac noch mehr erzählen von dem, was früher war. Der Ort ist einer von wenigen, um den sich die Wissenschaftler in Peru überhaupt kümmern können. Allein Lima zählt 500 archäologische Stätten, von denen nur die wenigsten ausgegra-ben oder restauriert werden. Es fehlt das Geld. Und manchmal der politische Wille.
»Früher konnten wir vor allem Quellen stu-dieren, seit 10 Jahren kommt immer mehr Ar-chäologie dazu«, sagt Inés de Castro, Direktorin des Stuttgarter Linden-Museums, im Rahmen einer Pressereise nach Peru (auf der die ZEIT sie begleitet hat). Funde haben das bisherige Wissen
über die Inka zu differenzierteren Bildern ergänzt. »Viele sehen in den Schöpfern des Inkareichs noch immer Opfer und in den Spaniern die An-greifer«, sagt sie. Vergessen werde, dass auch Inka von der Machtorganisation der Kolonialherren profitierten. Das verklärte, stereotype Bild: 1532 landeten Francisco Pizarro und Konsorten in Peru und zerstörten die blühende Hochkultur.
Warum waren die Inka in der Lage, ein Reich zu schaffen, das sich 4100 Kilometer weit von Kolumbien bis Chile erstreckte, in der Breite von Perus Wüsten an der Pazifikküste über das An-dengebirge bis ins regenfeuchte amazonische Tiefland reichte? Die Forschung der letzten Jahre hat die Erkenntnisse darüber erweitert. Es war ein Diktatorenregime, das sich auf militärische Ge-walt verließ und auf ein ausgeklügeltes System politischer Machterhaltung.
De Castro hat mit ihrer Kuratorin Doris Ku-rella die erste große europäische Inka-Ausstellung organisiert. Ab nächster Woche zeigt die Schau, neben Kunstschaffen, Ar-chitektur und Mythologie, mit welch raffinierten Methoden die Despoten die Völker der Anden unter ihre Knute brachten und ihr hochkom-plexes Staatengebilde regierten: mit Planwirtschaft, mit Terror, Spitzeln und riesigem Beamtenapparat.
Die Ursprungsmythen der Inka, vom Geschichtsschreiber Francisco de Toledo 1572 gebündelt, zeugen von elitärer Grundhaltung und Arroganz. Die Legende erzählt von einem Berg mit drei Fenstern. Das mittlere, das »reiche Fenster«, entließ vier Männer und vier Frauen, allesamt Brüder und Schwestern ohne Vater und Mutter – ergo: göttlich. Sie nannten sich »Inka«, was »Herrscher« bedeutete.
Als erste Amtshandlung teilten sie die Men-schen, die um den Berg herum lebten, in Grup-pen ein, ayllus, um diese zu befehligen. Dann marschierte man los, um fruchtbares Land zu an-nektieren. Im Rückblick lässt sich feststellen, dass die Herrscherclique nie anders mit Menschen ver-fuhr, als sie nach Belieben gruppenweise in ihre militärische und wirtschaftliche Hierarchie ein-zubauen. Eigener Wille war nicht vorgesehen: Kinder wurden als Neugeborene registriert, Er-wachsene den Arbeitsbrigaden zugeteilt, schöne Jungfrauen als Dienerinnen in Dienst genommen – oder vorgemerkt als Opfer im ewigen Frost. In weiten Teilen funktionierte der Inkastaat wie eine sozialistische Diktatur – die Fäden in den Händen von Kontrollfreaks, und über allem: die Partei.
Ins Tal von Cusco waren die Inka um 1000 nach Christus als überschaubare ethnische Gruppe eingewandert. Bei der Akquise neuer Ländereien und dem Unterwerfen darauf hausender Bevölke-rungen legten die Inka-Adligen Raffinesse an den Tag. Das übliche Angebot: Inkaherrscher ehelicht Cheftochter. Eine solche Heiratsallianz mit der Al-phasippe vor Ort nutzte beiden Seiten. Die Inka konnten von den neuen Untertanen Arbeitsleis-tung als Steuern einfordern. Die alteingesessenen Lokalfürsten hatten zwar nicht mehr das alleinige Sagen, aber als Schwiegerväter von Adligen posi-tionierten sie sich auf hohem Niveau. Sie über-wachten weiterhin Untertanen und wurden als Kaderangestellte mit Geschenken belohnt, mit Delikatessen, Coca, edlen Vogelfedern.
Was mit denen geschah, die eine freundliche Übernahme ausschlugen, weiß die Kuratorin Ku-rella. Die Cuvo zum Beispiel wünschten keine Allianz – worauf die Inka zuschlugen. Das Mus-ter wiederholte sich, die jeweilige Konsequenz: Hochzeit oder Massaker.
Nach der Übernahme wurden meist Teile der Bevölkerung zwangsumgesiedelt. Das senkte die
Wahrscheinlichkeit von Aufständen und gereichte den Inka zu direktem Vorteil: Den Chimu etwa, Meistern der Goldschmiedekunst, wurden sämt-liche Fachkräfte entrissen. Das berühmte Gold der Anden ist ihr Werk. Sie mussten das Edelmetall fortan für die Herrscher in Cusco dengeln.
Der Aufstieg der Inka hatte um 1100 begonnen. Als Starthelfer – dies schlossen Bioarchäologen aus der Analyse von Bohrkernen – diente das Klima. Kälteperioden ebneten den künftigen Potentaten den Weg. Tiahuanaco etwa, eine Vor-Inka-Metro-pole auf der kargen Andenhochebene Altiplano, hatten die Bewohner längst verlassen müssen, als die Inka auftauchten. Entlang der Pazifikküste und in Teilen des Hochlandes war kaum mehr Regen gefallen. Andernorts hatten Fröste die Ernten ver-nichtet oder Regengüsse die Pflanzen von den Fel-dern gespült. In der Folge zerbröselten die Zentren, die Bevölkerung flüchtete in klimatisch mildere Gegenden. »Diese Epoche wird in den Mythen und
Erzählungen der Andenbewohner als Zeit der Unordnung, des Chaos und der Kriege überliefert«, berichtet die Kuratorin Kuralla.
Die Inka, laut Selbsteinschätzung dafür vorgesehen, »Ordnung in die Welt zu bringen«, nutzten das Chaos. Aus einer Idee formten sie einen langfristigen Plan: radikale Agrar-reform, Zähmung der Natur.
Noch heute sieht man die Spuren. Wer von Cusco ins Urumbatal fährt, auf dem Weg nach Machu Picchu, kommt an Tausenden Terrassen vor-bei. Wie ein Relief aus Pappe muten die Steilhänge hoch über dem Tal-grund an: Sie sind durchzogen von feinen horizontalen Strukturen, er-schaffen vor einem halben Jahrtau-send mit ungeheurem Arbeitseinsatz.
Die Inka bauten Bewässerungsanlagen, verlegten Flussläufe. Für dieses Geoengineering brauchten sie Manpower. Sie fanden sie, indem sie die Zahl der Untertanen vergrößerten.
Der Anbau war nicht nur monströs. Er war auch klug – und erfolgreich. Die Überschüsse sorgten für Spielraum, um Wetterkapriolen zu kontern. Erfror in der Höhe die Frucht, blieb den Menschen die Ernte aus dem Tal. Wenn im Tal die Felder über-schwemmten, gab es Essen vom trockenen Berg.
Die Inka verhinderten Hungersnöte, nicht zu-letzt, weil sie die Produktepaletten der Kolchosen überarbeiteten. Quinoa, auch Inkareis oder An-denhirse genannt, gewann an Stellenwert. Primär jene Maissorten wurden in Monokultur angebaut, die am lagerfähigsten waren und viel Zucker ent-hielten – idealer Rohstoff für die Chicha, das beliebte Maisbier. Und aus Tausenden Kartoffel-arten suchten sie die heraus, die sich leicht ge-friertrocknen lassen. Noch nach sieben Jahren lässt sich die Knolle – im frostigen Hochland de-hydriert – zur Köstlichkeit wiedererwecken.
Sie hatten auch Glück, die Inka. Das Klima kam ihnen nämlich zwei Mal zu Hilfe. Wie es zu-vor mit Kälte für Destabilisierung gesorgt hatte, unterstützte es danach die Masterpläne der Inka mit Wärme. Die Sedimente verraten den For-schern heute, dass auf die Periode anhaltender Trockenheit vom Jahr 1100 an wärmere Bedin-gungen folgten. Sie erlaubten den Anbau der Nutzpflanzen in höchsten Lagen und die konti-nuierliche Bewässerung aus Gletscherbächen.
Die Erfolge sicherten den Inka die Mittel zur Expansion. In Speichertürmen mit Grasdächern, den damals größten Kühlschränken der Welt, horteten die Andenkönige ihre Vorräte. Um den Warentausch in Fahrt zu bringen, bauten sie die Straßen aus. 40 000 Kilometer umfasste das Ver-kehrsnetz im Reich – einmal um die Erde. Darauf bewegten sich die Spediteure mit Kartoffeln und
Alpakawolle in Richtung Küste, auf dem Rückweg lieferten sie Muscheln und Meeresfische.
Die Straßen dienten nicht nur dem Gütertrans-port, sondern ebenso der Kontrolle und Verwal-tung. Auf den ausgebauten Routen bewegten sich die Beamten durch die Reviere, und die Meldeläu-fer rannten von einem Etappenpunkt zum nächs-ten, je dreißig Kilometer am Stück. Mit Muschel-hörnern kündigten sie ihr Kommen dem nächsten Posten an, damit sie ihre Expressfracht – Knoten-schnüre, in denen Ernteerträge, Umsatzzahlen und Vorratsmengen minutiös verzeichnet waren – ohne Verzögerung übergeben konnten. Verpasste ein Läufer das Zeitlimit oder verlor er Dokumente, bestraften ihn die Ordnungshüter mit dem Tod.
Was die fast perfekte Despotie der Inka lang-fristig der Nachwelt hinterlassen hat, sind Zeugnis-se unglaublicher Leistungsfähigkeit. Unzerstörbares Mauerwerk ist in und um Cusco zu bestaunen. Wann immer Erdbeben Peru erschütterten – die Bollwerke der Vorfahren blieben stehen. Die Stein-metze der Inka beherrschten die Technik, unter-schiedlich große Blöcke millimetergenau zuzuhauen und aneinanderzufügen, sodass keine Rasierklinge dazwischenpasste. Der berühmteste Klotz befindet sich in der Calle Hatunrumiyoc in Cusco: der 12-eckige Stein. Der größte oberhalb von Cusco in der Festung Sacsayhuamán. 200 Tonnen wiegt der Brocken, so viel wie ein Airbus A330. Hergeschafft wurden die Felsen für die Protzburg aus Steinbrü-chen, die teils 20 Kilometer entfernt lagen – 70 Jahre Bauzeit, 20 000 Beschäftigte.
Am Ende ihres goldenen Jahrhunderts läutete die Machtbesessenheit der Inka auch die Implosion ihres Regimes ein. Zwei Brüder, Atahualpa und Huáscar, wollten nicht teilen. Einer meuchelte den andern. Die brutale Anden-Diktatur war am Ende. Pizarro reichte 1533 eine Handvoll Haudegen, um die Inka-hauptstadt Cusco zu erobern.
Inka – Könige der Anden: vom 12. Oktober 2013 bis zum 16. März 2014 im Linden-Museum Stuttgart
www.zeit.de/audio
Fundstücke aus dem Inkareich
Meeresschnecken zu Trompeten: Das Signalhorn eines Meldeläufers
Zwölfeckiger Stein: Meisterliches Zeugnis der Baukunst in Cusco
Vielfältige Nahrungsgrundlage: Kartoffelsorten der Anden
Die Schule der DiktatorenEine Ausstellung in Stuttgart zeigt die Pracht des Inkastaats – und wie die Despoten ihr Reich regierten VON URS WILLMANN
Loch im Ohr: Daran erkannte man Inka-Adlige
Fotos: Christine Wawra; kl., v. o.: Staatliche Museen zu Berlin/Stiftung Preußischer Kulturbesitz/Ethnologi-sches Museum, Urs Willmann, Interna-tional Potato Center; Anatol Dreyer/Linden-Museum (m.)
ZEIT-GRAFIK
1000 km
CUSCO
MachuPic chu
PERU
CHILE
Lima
ECUADOR
KOLUMBIEN
Ausbreitungder Inka
(um 1532 n. Chr.)
BOLIVIEN
BRASILIEN
ARGENTINIEN
Machu Picchu im Hochgebirge Perus

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Die Besucher aus Deutschland besichtigen den Raum wie ein Ikea-Musterzimmer – ein Ikea-Zimmer für Menschen mit Demenz. Die rote Ein-gangstür ähnelt der eines Landhauses. »Schlafzimmer«
steht auf einem Schild, daneben das tellergroße Symbol eines Betts. Drinnen steht ein gemütlicher Opasessel in der Ecke, Nachttischlampen wie vom Flohmarkt, zwei eiserne Bettgestelle. Der Raum wirkt wie aus der Zeit gefallen.
Die deutschen Gäste machen Fotos. Sie stehen im Vorzeigeraum des Dementia Services Develop-ment Center (DSDC) an der schottischen Uni-versität Stirling, 60 Kilometer nordwestlich von Edinburgh. Hier wird gezeigt, wie demenzfreund-liche Pflegeheime aussehen sollten. Dass es dabei nicht nur um Wohnlichkeit geht, sieht man auf den zweiten Blick: Der Opasessel ist mit antibak-teriellem Stoff bezogen, die Nachttischlampen sind aus Plastik, die Bettgestelle ebenso. Und in allen Ecken steckt Technik: Die Matratzen sind mit Drucksensoren ausgerüstet, Bewegungsmel-der piepen, sobald jemand die Tür öffnet. So wer-den Pflegekräfte alarmiert, sollte ein Patient aus dem Bett fallen oder unbeaufsichtigt den Raumverlassen. Mit GPS-Armbändern lassen sich um-herirrende Patienten auf einem Computer sogar ständig orten. Das angrenzende Badezimmer ist behindertengerecht ausgebaut, die Spezialtoilette hat einen roten Sitz.
Das Zimmer ist so gestaltet, dass Menschen mit Demenz dort besser zurechtkommen. Es in-szeniert eine Wirklichkeit, in der sich die Betroffe-ne am besten zurechtfinden – und in der Pflege-kräfte auf subtile Art stets die Kontrolle behalten. An dem Raum lässt sich ganz konkret betrachten, was das DSDC seit über zwei Jahrzehnten als weltweit führendes Zentrum erforscht und lehrt: wie sich das Lebensumfeld von Betroffenen mög-lichst demenzfreundlich gestalten lässt – zu Hau-se, im Pflegeheim und im Krankenhaus. In diesen Tagen präsentiert das DSDC eine neue Online-plattform mit virtuellen demenzfreundlichen Räu-men. So werden die Forschungsergebnisse noch zugänglicher.
Um vom DSDC zu lernen, ist die etwa 25-köp-fige Delegation aus Deutschland im Juni nach Stirling gereist, für drei Tage voller Vorträge und Krankenhausbesuche. Mit dabei sind Pflegedirek-toren, Chefärzte und Geschäftsführer von insge-samt zehn Krankenhäusern. Sie alle beschäftigt die Frage: Wie stellen wir uns auf die steigende Zahl von Patienten ein, die nicht nur unter einer akuten Erkrankung leiden, sondern auch an einer Demenz?
Die zehn Krankenhäuser, die an dieser Studien-reise teilnehmen, sind in der Vorauswahl des För-derprogramms »Menschen mit Demenz im Kran-kenhaus« der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart. Sie alle entwickeln eigene Demenzprojekte für ihre Häuser. Die Reise liefert dafür die letzten neuen Ideen und Inputs. Zwar gibt es in Deutschland be-reits einige Modelle in Akutkrankenhäusern, doch sind das bisher bloß Insellösungen. Die Robert-Bosch-Stiftung ziele mit ihrem Förderprogramm auf eine Breitenwirkung, sagt die mitreisende Ber-nadette Klapper, dort Gruppenleiterin im Bereich Gesundheit und Wissenschaft. »Daraus sollen konkrete Maßnahmen entstehen. Wir wollen, dass sich die Krankenhäuser vernetzen und viele andere Häuser diese Modelle nachahmen.« Inzwischen hat die Stiftung die fünf überzeugendsten Projekte ausgewählt, die mit bis zu 100 000 Euro gefördert werden. Es sind das Albertinen-Krankenhaus Hamburg, das Evangelische Krankenhaus Alster-dorf, das Evangelische Krankenhaus Bielefeld, das
Diakonissenkrankenhaus Dresden und das Ro-bert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart.
Beworben hätten sich rund 230 deutsche Klini-ken, sagt Klapper, etwa jedes zehnte Krankenhaus. Die große Resonanz macht deutlich: Deutsche Krankenhäuser stehen vor einem Demenzpro-blem. Über die Hälfte aller Patienten in einem All-gemeinkrankenhaus ist heute älter als 60 Jahre. Etwa zwölf Prozent sind laut der Deutschen Alz-heimer-Gesellschaft von einer Demenzerkrankung betroffen. Andere Schätzungen gehen von einem noch höheren Wert aus. Genaue Zahlen aus den Krankenhäusern gibt es jedoch nicht. Klar ist: Ihr Anteil wird künftig stark steigen. Bis 2050 soll sich die Zahl der Menschen mit Demenz in Deutsch-land verdoppeln, von derzeit 1,3 auf 2,6 Millionen
Menschen, prognostiziert das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
Doch schon jetzt sprengen Patienten mit De-menz den Betrieb in den auf Effizienz getrimmten Krankenhäusern. Wer sich bei den Teilnehmern der Studienreise umhört, bekommt Sätze zu hören wie: »Demenz – das wird uns die Abteilungen zer-legen.« Oder: »Für die Krankenhäuser gibt es keine finanziellen Anreize bei solchen Fällen, das ist das Problem.« Und: »Wir sind schon jetzt an der Gren-ze der Belastbarkeit.«
Ein Krankenhausaufenthalt ist für Demenz-kranke eine Krisensituation: Wieso soll ich in die-sem komischen Bett bleiben? Warum will dieser fremde Mensch mir diese Spritze geben? Woher kommt all der Lärm, was machen die vielen unbe-kannten Menschen? Wieso bin ich hier? Das ver-stehen Patienten mit Demenz oft nicht. Sie finden sich in der fremden und hektischen Umgebung
eines Krankenhauses nicht zurecht. Sie reagieren verwirrt oder verängstigt und sind darüber nicht selten so verzweifelt, dass sie versuchen, die Klinik auf eigene Faust zu verlassen. Sie erleiden häufiger Delirien, sie können weder ihre Schmerzen noch ihre Wünsche artikulieren und haben Probleme beim Essen und Trinken.
Oft wird eine Demenz bei der Einlieferung noch nicht einmal erkannt. Wer leicht dement mit einem Knochenbruch oder sogar nur einer Blasen-entzündung in einem Krankenhaus landet, kann innerhalb weniger Tage geistig massiv abbauen. Bleibt etwa das Essen unberührt, weil der Patient nicht weiß, wie er die Portionspackung öffnen soll, wird es in der Hektik manchmal einfach wieder abgeräumt. Ein großes Problem ist der chronische
Mangel an Pflegekräften: Für intensive Betreuung, Gespräche oder gar Spazierengehen bleibt in Kran-kenhäusern schlichtweg keine Zeit.
Reagieren Betroffene auf die fremde Situation handgreiflich, kann es vorkommen, dass sie sediert oder sogar fixiert werden, damit der Stationsalltag nicht durcheinandergebracht wird. Dadurch ver-schlechtert sich ihr Zustand drastisch. Einer Studie in deutschen Krankenhäusern zufolge bleiben de-menzkranke Patienten durchschnittlich mehr als doppelt so lange im Krankenhaus wie Patienten ohne Demenz, sie werden nach dem Aufenthalt öfter in Pflegeheime oder Psychiatrien eingewie-sen, anstatt nach Hause geschickt zu werden.
Was können Krankenhäuser dagegen tun? Der erste, wichtigste Schritt, sagt Bernadette Klapper, sei es, die Haltung gegenüber Patienten mit De-menz zu ändern. »In Deutschland hat man sich lange nicht der Bedürfnisse dieser Patienten ange-
nommen. Sie galten einfach als alt und verwirrt. Als Problem.« Doch in vielen Krankenhäusern ändere sich diese Haltung mittlerweile: »Sie arbei-ten inzwischen aktiv daran, auch diese Patienten angemessen zu versorgen.«
Einige der Probleme, das lernten die Gäste in Stirling in einem Vortrag von Mary Marshall, las-sen sich mit verschiedenen, oft kleinteiligen De-signanpassungen lösen – am besten in einer eigens dafür eingerichteten Demenzstation. Mary Mar-shall war Initiatorin und bis zu ihrer Pensionierung langjährige Direktorin des DSDC. Sie gilt als Ko-ryphäe auf dem Gebiet der Demenzpflege.
Für Menschen mit Demenz ist die Welt wegen Schädigungen in Hirn und Auge oft dunkel und vernebelt. Helleres Licht in den Räumen beruhige
Demenzkranke oft mehr als Medikamente, sagt Marshall. Weil Menschen mit Demenz sich in ei-ner fremden Umgebung schlecht orientieren kön-nen, sollen starke Kontraste sie führen: Knallrot sind die Tür zum WC, die Kloschüssel und die Handläufe. Die Wahrnehmung roter Farbe verlie-ren Demenzkranke als letzte. Dafür sind Türen, die nicht benutzt werden sollen, farblich möglichst unauffällig.
Auch der Bodenbelag sollte einheitlich sein, da-mit Patienten mit geschwächter Tiefenwahrneh-mung die Kontraste nicht als Treppenstufen miss-verstehen – und so womöglich stürzen. Familiäre Objekte wie Fotos von Angehörigen schaffen Ver-trautheit in einer Umgebung, die für Demenzkran-ke oft keinen Sinn ergibt. Das beruhige, vermin-dere Stress. Am schlimmsten, sagt Mary Marshall, sei in den Krankenhäusern jedoch der ständige Lärm: »Für einen Menschen mit Demenz ist Lärm
so schlimm wie Treppen für einen Menschen im Rollstuhl.« Da würde es bereits helfen, die Pager-Alarme vom Piepton auf Vibration umzustellen. Dass viele dieser Maßnahmen wirken, zeigen ver-schiedene Studien des DSDC: Patienten stürzen weniger und werden seltener handgreiflich.
Design allein reicht jedoch nicht: Abläufe müs-sen sich verändern, Angehörige sollten zur Unter-stützung mit einbezogen werden und vor allem: Das Leitungs- und Pflegepersonal muss zusätzlich geschult werden für den Umgang mit demenz-kranken Patienten. Denn laut einer aktuellen Be-fragung von Pflegekräften in Allgemeinkranken-häusern durch das Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft in Saarbrücken fühlen sich nur 30 Prozent ausreichend dafür qualifiziert. Sie sollten beispielsweise lernen, eine mögliche Demenz bei eingelieferten Patienten zu erkennen, Betroffene richtig zu ernähren und auf aggressives Verhalten zu reagieren, ohne dass gleich Beruhigungsmittel eingesetzt werden.
Wie bereits mit wenigen Mitteln viel geändert werden kann, zeigt der Besuch des Monklands-Bezirkskrankenhauses in Airdrie, einer Kleinstadt östlich von Glasgow. Das vom staatlichen Gesund-heitsdienst NHS betriebene Haus mit seinen über 500 Betten ist ein dunkler Betonkasten aus den siebziger Jahren, der nach und nach saniert wird. In den verwinkelten, muffigen Gängen kann man sich schnell verirren. Doch das Krankenhaus hat es vor zwei Jahren durch überraschend simple An-passungen geschafft, eine demenzfreundliche Sta-tion mit 24 Betten einzurichten. Als die alte Sta-tion renoviert werden sollte, entschloss man sich, Böden, Wände, Türen und die Beschilderung de-menzsensibel zu gestalten und einen Aufenthalts-raum für Patienten einzurichten, ganz nach dem Vorbild des DSDC. Das soll nun schrittweise auch auf anderen Stationen geschehen.
Auch die Abläufe wurden geändert. So wird bei-spielsweise bei der Einlieferung von älteren Patien-ten automatisch ein einfacher Fragebogen genutzt, um eine Demenz schnell zu erkennen. Und damit Pflegende und Ärzte später stets wissen, welcher Patient an Demenz leidet, entwickelte das Kran-kenhaus mit dem NHS ein Green-Box-System: Auf einer Tafel neben dem Krankenbett zeichnet das Personal in grünen Kästchen ein, ob der Patient ein vermindertes Auffassungsvermögen hat oder nicht. Ein ausgefülltes Kästchen bedeutet: Diese Person ist nicht mehr fähig, eigenständig zu ent-scheiden, und bedarf besonderer Betreuung.
Am wichtigsten war jedoch die Weiterbildung des Pflegepersonals. Im Monklands-Krankenhaus, wie auch in ganz Schottland, gibt es seit zwei Jah-ren sogenannte Demenz-Champions: Kranken-schwestern, die durch spezielle Schulung den Wandel hin zu demenzfreundlicher Pflege in ihren Krankenhäusern vorantreiben, mitreden und ent-scheiden – und stolz auf ihren Titel sind. Dabei entstand eine völlig neue Pflegekultur: Der Wan-del in den Köpfen begann auf den unteren Hie-rarchiestufen und wurde nicht von oben delegiert. Für die Teilnehmer der Studienreise eine überra-schende, bisher unvorstellbare Herangehensweise.
Und gleichzeitig eine ernüchternde: Die Ver-treter der deutschen Krankenhäuser zeigten sich erstaunt darüber, wie viele Pflegende im englischen Gesundheitssystem auf den Stationen arbeiten. Davon könne man in Deutschland nur träumen. »Klar ist der Fachkräftemangel ein Problem«, sagt Bernadette Klapper von der Bosch Stiftung, »mehr Personal ist aber nicht die einzige Lösung. Wichtig ist es vor allem, die Art zu ändern, wie wir mit de-menzkranken Patienten umgehen.« Da habe Deutschland noch einiges nachzuholen.
www.zeit.de/audio
Wo bin ich hier?Ein Klinikaufenthalt kann für Demenzkranke eine echte Krise bedeuten. Wie man mit ihnen umgeht, zeigen schottische Modelle VON ADRIAN MEYER
Die fremde Umgebung verwirrt Demenzkranke zusätzlich
36 WISSEN
Foto
(A
uss
chn
itt)
: M
arco
War
mu
th »
Das
Ve
rge
sse
n v
erg
ess
en
«/
ww
w.e
xp
losu
re.d
e

10–20 cm
10–25 cm
5-12cm
5-10cm
10–25 cm
5–15 cm
4–8 cm
4–12 cm
4–7 cm
8–20 cm
4–8 cm
6–12 cm
7–15 cm
6–12 cm
6–12 cm
0,5–2 cm
5–15 cm
10–18 cm
2–7 cm
4–8 cm
2 bis 21 Tage
ein Pilz
Pfifferling
5 bis 12 Stunden
eine Handvoll Pilze
drei bis vier Pilze
Kaiserling
wenige Pilze
Spitzgebuckelter
Raukopf
Stock-
schwämmchen
8 bis 24 Stunden
weniger als ein Pilz
Champignon,
Täubling
12 Stunden
schwer einzuschätzen
Speisemorchel und
Böhmische Verpel
15 Minuten bis 2 Stunden
eine Handvoll Pilze
Perlpilz,
grauer Wulstling
15 Minuten bis 2 Stunden15 Minuten bis 3 Stunden
wenige Minuten nach
Alkoholgenuss
Schopftintling
15 Minuten bis 4 Stunden
Trüffel Flockenstieliger und Netz-
stieliger Hexenröhrling
15 Minuten bis 4 Stunden
Zeit bis zum Eintritt
der Wirkung*tödliche Dosis* Verwechslungsgefahrberauschende Dosis*
*variiert je nach Giftmenge im Pilz, Körpergewicht und Konstitution der Konsumenten
2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Illustration und Recherche: Marie Seeberger
Quellen: Kothe, Erika und Hans W.: »Eine unterhaltsame Einführung in die Mykologie«; Lüder, Rita: »Grundkurs Pilzbestimmung«; eigene Recherche
GRAFIK 37Thema: Giftpilze
Die Themen der letzten Grafiken:
223 Ärztemangel
222Flüssigkeiten
221Klimaschutz
Weitere Grafiken im Internet:
www.zeit.de/grafik
224No
Nicht essen!Von diesen Pilzen sollten Sie im Wald die Finger lassen: Sie enthalten Gifte, die gefährlich sein
können. Von einigen der Pilze sind bereits wenige Bissen tödlich, von anderen bekommt man nur
Bauchkrämpfe. Insgesamt gelten 180 von 6000 Großpilzarten in Europa als giftig
Spitzgebuckelter Raukopf
Gifthäubling
Spitzkegeliger Kahlkopf
Grauer Faltentintling Kartoffelbovist
Frühjahrslorchel
Satansröhrling
Fliegenpilz
Pantherpilz
Grüner Knollenblätterpilz
Gehört zu den giftigsten Pilzen in Mitteleuropa. Sein Gift Orellanin kann zu Nierenversagen führen. Symptome: Durst und Schmerzen in der Nierengegend.
Enthält Amatoxine, den Giften des Knollenblätterpilzes ähnlich. Brechdurchfall und Schüttelfrost sind die ersten Anzeichen der Vergiftung.
Gilt wegen seines hohen Psilocybingehalts als einer der stärksten »magic mushrooms« mit LSD-ähnlicher Wirkung. Löst je nach Dosis Rausch, Halluzinationen oder Wahrnehmungsstörungen aus.
Eigentlich essbar – solange man keinen Alkohol dazu trinkt. Denn der wird wegen des enthaltenen Gifts Coprin nicht mehr richtig abgebaut.
Verursacht Übelkeit und Verdauungsstörungen. Wenn er in großen Mengen gegessen wird, auch Ohnmachtsanfälle.
Gilt in einigen Ländern noch als Speisepilz. Das Gift Gyromitrin ist sehr flüchtig und in seiner Wirkung Amanitinen ähnlich. Kann auch zu Nierenschäden führen.
Nicht tödlich, sein Gift-cocktail kann aber schwere Magen-Darm- Beschwerden verursachen.
Die in ihm enthaltene Ibotensäure ruft zusammen mit Muscimol (das bei der Trocknung aus der Säure entsteht) Symptome hervor, die einem Alkoholrausch ähneln. Je nach Stimmung kommt es zu Glücksgefühlen oder Angstzuständen.
Wirkt wie der Fliegenpilz. Schon 100 Gramm frische Pilze enthalten eine tödliche Menge Gift. Verantwortlich für etwa 6 Prozent der Pilzvergiftungen.
Schuld an 90 Prozent der tödlichen Pilzvergiftungen. Seine Amanitine gehören zu den gefährlichsten Natur- giften. Sie zerstören die Leber.

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4138 WISSEN
Wenn sich zwei Isländer kennenlernen, können sie über ihre Hobbys reden, über ihre Jobs und das Wetter. Sie können aber auch nach-
sehen, wer ihr letzter gemeinsamer Vorfahre war und wann dieser gestorben ist. Dafür brauchen sie nichts weiter zu tun, als ihre Smartphones aneinander zu stupsen. Eine kürzlich veröffentlichte Telefon-App liefert ihnen diese Ahnenforschung für die Jacken-tasche. Integriert ist sogar ein Inzest-Alarm: Sollten sich zwei Isländer besonders nett fin-den, aber sehr nah miteinander verwandt sein, warnt sie das Gerät diskret.
Hinter der App steht das isländische Un-ternehmen deCode Genetics, das von dem Genforscher Kari Stefansson geleitet wird und sich auf die Erforschung des menschlichen Genoms spezialisiert hat. Privatpersonen kön-nen bei der Firma etwa einen Scan ihres Erb-gutes in Auftrag geben. Aufsehen erregte deCode 1998, als es vom Parlament die Er-laubnis erhielt, alle Gesundheitsdaten der is-ländischen Bevölkerung für seine Genomfor-schung zu speichern und auszuwerten.
Populärer ist inzwischen aber das Islendinga-bok, eine Online-Datenbank, mit der Isländer ihren Stammbaum recherchieren können. 4000 Klicks hat die Webseite jeden Tag – eine beacht-liche Zahl angesichts der Tatsache, dass die Da-tenbank nur Isländern zugänglich ist, von denen es nur 300 000 gibt. Die gleichnamige Telefon-App soll dieser Beliebtheit nun Rechnung tragen. Mit 12 000 Downloads seit April ist sie selbst schon ein kleiner Hit geworden.
Die Isländer sind leidenschaftliche Ahnen-forscher. In ihren alten Sagen werden Seite für Seite Verwandtschaftsbeziehungen aufgelistet, ehe die eigentliche Geschichte beginnt. Die Beschäftigung mit den eigenen Wurzeln hatte früher martialische Gründe: »In den Zeiten der Stämme musstest du deine Familie rächen, wenn einer deiner entfernten Verwandten ge-tötet worden ist«, sagt der deCode-Chef Kari
Stefansson. »Dafür musstest du wissen, mit wem du überhaupt verwandt bist.« Alte Islän-der grüßen sich traditionell noch heute mit der Frage: »Zu welchem Volk gehörst du?«
Im Islendingabok sind mehr als die Hälfte aller Isländer erfasst, die jemals auf der Insel gelebt haben. Bis ins Jahr 900 reichen die Daten zurück, 700 000 Menschen sind mit Geburtsdaten und Familienbeziehungen verzeichnet.
Zunächst war die Datenbank ein Hobby-projekt des Programmierers Fridrik Skulason, bevor sich Stefansson mit seiner Firma de-Code Genetics 1997 daran beteiligte und sie professionalisierte. Per Hand tippten die Mit-arbeiter Daten aus alten Kirchenbüchern, Volkszählungen und aus dem Einwohnerre-gister ab, um die Verwandtschaftsbeziehungen der Isländer zu enträtseln. Keine der Quellen konnte einfach eingescannt und von einem Computer ausgelesen werden, weil alle hand-schriftlich waren.
Das versehentliche Anbandeln mit Verwandten ist ein Running Gag
Eigentlich sollte die Ahnendatenbank mit de-Codes Gesundheits- und Gendatenbank der isländischen Bevölkerung verknüpft werden. Für die Erforschung von Erbkrankheiten ist präzises Wissen um Stammbäume sehr wich-tig. Durch die Verknüpfung beider Daten-mengen wollten die Forscher diejenigen Gene ausfindig machen, die Krankheiten wie Schi-zophrenie oder Rheuma wahrscheinlicher machen. Dieses Unterfangen scheiterte aber selbst in dem für seine Offenheit bekannten Island. Im Jahre 2003 kippte das höchste Ge-richt das Gesetz von 1998, das deCode den Zugriff auf die Gesundheitsdaten der Bürger verschafft hatte. Es sei nicht verfassungskon-form, weil es die Privatsphäre der Isländer nicht ausreichend schütze.
Unter der Bedingung, dass die Daten nicht öffentlich zugänglich sind und anonymisiert werden, gaben trotzdem 100 000 Isländer
freiwillig Genproben ab. Die Firma DeCode anonymisierte alle Daten, verknüpfte die Ah-nen- und die Gendatenbank miteinander und wertet diese Daten seitdem unter anderem ge-meinsam mit dem Schweizer Phamakonzern Roche aus.
Den beiden Firmen ist es so schon mehr-mals gelungen, Gene zu isolieren, die für be-stimmte Krankheiten wie Krebs oder Schizo-phrenie verantwortlich gemacht werden. Aber für den DeCode-Chef Stefansson hat das Pro-jekt auch einen soziokulturellen Wert: »Die Datenbank ist der deutlichste Beweis dafür, dass wir ein Volk, eine Familie sind«, sagt Ste-fansson.
In Deutschland ließe sich eine solche Da-tenbank in dieser Präzision wahrscheinlich nicht anlegen. »Durch seine isolierte Lage ist Island, genetisch gesehen, das homogenste Land der Welt«, sagt Stefansson. »Deutsch-land hingegen ist deutlich heterogener. Das Land ist eine Autobahn, auf der schon viele Völker von Norden nach Süden, von Westen nach Osten gezogen sind.« Hinzu kommen seine Größe und seine starke politische Zer-gliederung. Auch Klaus-Peter Wessel vom Verein für Computergenealogie hält es zu-mindest für deutlich aufwendiger, eine derart umfassende Ahnendatenbank zu erstellen. Aber immerhin, mithilfe von Kirchenbü-chern, Ortsfamilienbüchern und den Auf-zeichnungen in Standesämtern könne man heute ganz passable Ergebnisse erzielen.
Eine Präzision, die einen Inzest-Alarm er-möglicht, brauchte man hierzulande ohnehin nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zufällig und unbekannterweise mit einem na-hen Verwandten anbandelt, ist in Deutsch-land mit seinen 80 Millionen Einwohnern doch sehr gering. In Island hingegen sei es ein Running Gag, aus Versehen mit einem Ver-wandten geschlafen zu haben, sagt Alexander Annas Helgason, der gemeinsam mit zwei Kollegen die App programmiert hat. Aller-dings habe er selbst noch nie jemanden ken-nengelernt, dem das tatsächlich passiert sei.
Werden Schimmelpilze auf Gefäßen und Lebensmitteln in der Mikrowelle abgetötet?
... fragt Barbara Masmeier aus Untermallebarn (Österreich)
Die Mikrowelle wird gern als Bazillen-Killer angepriesen. So wirkt sie sehr gut gegen Bakterien, die sich in Spüllappen oder Küchenschwäm-men eingenistet haben. Wenn man
die feucht in die Mikrowelle legt, dann sind tatsäch-lich nach ein bis zwei Minuten alle Erreger tot, der Schwamm wirkt nicht mehr als Keimschleuder. Die Bakterien sterben dabei nicht durch die Strahlen, sondern durch hohe Temperaturen. Weil Mikro-wellen vor allem Wasser erhitzen, muss der Schwamm feucht sein, damit das funktioniert.
Zwar fallen auch Schimmelpilze und ihre Spo-ren bei hohen Temperaturen dem Hitzetod zum Opfer. Aber während es bei Bakterien in erster Li-nie darum geht, dass sie nicht lebendig in unseren Körper gelangen und sich dort weiter vermehren, fürchten wir beim Schimmel vor allem seine gifti-gen Stoffwechselprodukte, die Mykotoxine. Und in Lebensmitteln, die von Schimmelpilzen befal-len sind, stecken diese Gifte, die schon in kleinsten Mengen gefährlich werden können, bereits drin. Selbst wenn eine Mikrowellenkur die Pilze töten würde, wären das angeschimmelte Brot, der an-geschimmelte Käse also weiterhin gefährlich. Das gilt bei den meisten Lebensmitteln auch dann, wenn man die sichtbaren Schimmelstellen besei-tigt. Bei Gefäßen und Behältern kommt die schon erwähnte Einschränkung dazu, dass die Abtötung nur in feuchtem Milieu funktioniert.
Allerdings kann eine Bestrahlung mit Mikro-wellen dazu dienen, Pilzsporen, die in harmlosen Mengen vorhanden sind, am Wachstum zu hin-dern. Eine Firma in Texas hat eine Bestrahlungs-methode entwickelt, mit der Brot angeblich 60 Tage lang schimmelfrei bleibt. Wie dieses Brot nach zwei Monaten schmeckt, möchte man sich allerdings nicht vorstellen. CHRISTOPH DRÖSSER
Stimmt’s?Medizin:Heiraten gegen KrebsKrebspatienten haben eine höhere Lebenserwar-tung, wenn sie verheiratet sind. Zu diesem Ergeb-nis kommen Forscher um den Mediziner Ayal Ai-zer vom US-amerikanischen Dana-Farber Cancer Institute, die knapp 750 000 Patientendaten aus-gewertet haben (Journal of Clinical Oncology, on-line). Bei einigen Krebsarten – unter anderem Prostata- und Brustkrebs – profitieren die Patien-ten von einer Partnerschaft sogar mehr als von einer Chemotherapie. Den Hauptgrund für die besseren Überlebenschancen sehen die Forscher darin, dass verheiratete Personen früher ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und sich Behandlun-gen konsequenter unterziehen.
Hirnforschung:Gezielter GedächtnisverlustIn der Konfrontationstherapie lassen Psychothera-peuten ihre Patienten traumatische Situationen noch einmal in sicherer Umgebung durchleben. Ginge das nicht auch weniger belastend: im Schlaf? Daran arbeiten Forscher der Stanford University, wenngleich bislang mit Mäusen (Molecular Psy-chiatry, online). Sie konditionierten die Tiere da-rauf, einen Schmerzreiz mit einem bestimmten Geruch zu assoziieren. Wurden die Tiere im Schlaf dem Geruch ausgesetzt, zeigten sie anschließend erhöhte Furcht. Wurde den Mäusen jedoch die Substanz Anisomycin ins Gehirn gespritzt, die das Festigen einer Erinnerung im Schlaf behindert, fürchteten sie sich deutlich weniger. Wie die Sub-stanz genau wirkt und ob sie nur bei der Angst vor Gerüchen funktioniert, ist noch unklar.
Biologie:Zeit zu blühenFür Pflanzen ist gutes Timing überlebenswichtig: Nur wenn sie zum richtigen Zeitpunkt blühen, sind auch genug bestäubende Insekten unterwegs. Forscher des Max-Planck-Instituts für Entwick-lungsbiologie in Tübingen haben nun anhand der gemeinen Acker-Schmalwand, einem Kreuzblüt-ler, den genetischen Mechanismus dahinter aufge-deckt (Nature, online): Aus ein und derselben Erb-information wird je nach Temperatur verschiedene Boten-RNA hergestellt. Ist es noch zu kalt, bildet sich ein Proteinkomplex, der bestimmte Genberei-che blockiert. So wird der Blühbeginn unter-drückt. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieser Mechanismus Pflanzen auch bei der Anpas-sung an steigende Temperaturen im Zuge des Klimawandels helfen könnte.
ERFORSCHT UND ERFUNDEN
www.zeit.de/audio
Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen: DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg, oder [email protected]. Das »Stimmt’s?«-Archiv: www.zeit.de/stimmts
Kompakt
Im Netz: Ein Fotograf zeigt die grüne Seite New Yorks www.zeit.de/umwelt
Die totale Überwachung ist längst Realität. Zeit, das Internet zurückzuerobern
Das neue ZEIT Wissen: am Kiosk oder unter www.zeitabo.de
Mehr Wissen
Lukrative Forschung Der Else Kröner Fresenius Awardprämiert Fortschritte in der medizinischen Forschung. Eine halbe Million davon darf der Preisträger persönlich behalten.
Der Nobelpreis ist mit fürstlichen 900 000 Euro dotiert. Seit diesem Jahr gibt es einige Wissen-schaftspreise, die noch mehr Geld einbringen.
Der Breakthrough Prize in Life Sciences wird unter anderem von Sergej Brin (Google) und Mark Zuckerberg (Facebook) finanziert.
Mio. €Der Queen Elizabeth Prize for Engineering belohnt technische Innovationen, die die Menschheit voranbringen.
1,2 Mio. € 1 Mio. €2,2 Mio. €Der Tang Prize, gestiftet von dem taiwanesischen Tycoon Samuel Yin, wird ab 2014 der »asiatische Nobelpreis« sein.
Drum prüfe, wer sich ...Kleines Land, kleiner Genpool: Wie können Isländer sichergehen, dass sie sich nicht in
einen Verwandten verlieben? Ein Forscher hat da eine Idee fürs Handy VON RICO GRIMM
Tanz auf dem Vulkan? Nein, diese beiden plantschen nur im heißen Quellwasser
Foto
s: R
aph
ael
He
lle/
Sig
nat
ure
s/la
if;
J. W
en
dle
r/Fo
tolia
(o
.)
4

41
Los geht’s, Herrschaf-ten, die Kamera läuft!«, ruft ein Mann mit Kopfhörern in ein Mi krofon. Er ist der Regisseur der Serie Schloss Einstein, also
derjenige, der beim Dreh der Chef ist. In einer riesigen Halle am Rand von Erfurt werden Szenen für die Serie ge-dreht – und wenn der Regisseur ruft, geht’s los. Die etwa 20 Kinder, die ge-rade noch ganz leise im Flur auf ihren Einsatz gewartet haben, laufen hin und her, umarmen sich und tanzen. Die Zuschauer werden später im Fernsehen sehen, wie die Schüler eine Party zum Schulbeginn in der Cafeteria feiern. Doch so weit ist es noch lange nicht. Der Regisseur bricht ab. »Noch mal«, ruft er. Irgendetwas hat ihm nicht ge-fallen. So geht das noch oft an diesem Nachmittag, bis alles stimmt.
Es ist Folge 793, die heute gedreht wird, denn die Serie rund um das In-ternat läuft schon seit 15 Jahren im Fernsehen. Damit ist sie wahrscheinlich älter als Du.
Wie geht das, dass eine Serie einfach nicht zu Ende geht?
Zum einen liegt das an ihrem Er-folg. Und Erfolg heißt bei Fern seh-serien, dass viele Menschen sie gucken. In Deutschland schaltet heute fast je-des fünfte Kind zwischen 10 und 13 Jahren Schloss Einstein ein. Und nicht nur in Deutschland ist die Serie be-liebt, sie wird in zehn anderen Ländern gezeigt. In den Niederlanden lernen die Kinder mit Schloss Einstein sogar Deutsch.
Und warum ist eine Serie erfolgreich und beliebt? Die Macher denken, dass es auch an den Geschichten liegt, die sie erzählen. In der Serie geht es um das, was Schüler der siebten bis zehnten Klasse erleben: Ein Junge bekommt Ärger, weil er die Hausaufgaben aus dem Internet abgeschrieben hat. Ein Mädchen ist sauer auf ihren Bruder, weil er beim Pokern Geld verspielt hat. Zwei Brüder geraten aneinander, weil sie dasselbe Mädchen mögen. Das sind ganz alltägliche Sorgen, die viele ken-nen. Deshalb kann man als Zuschauer mit den Schauspielern mitfühlen. Man hat das Gefühl, es hat etwas mit dem eigenen Leben zu tun. Die Autoren, die die Drehbücher für Schloss Einstein schreiben, fragen dafür Kinder, was die in der Klasse so erleben.
Wenn die Schauspieler älter werden, müssen natürlich auch die Figuren, die sie spielen, älter werden. Aber irgend-wann ist Schluss, und sie verlassen das Internat. Und dann rücken neue Schü-ler, also Schauspieler, nach: Mehr als 300 Hauptrollen gab es schon.
Hugo Gießler und Marie Borchardt spielen zurzeit Hubertus und Pippi, zwei Schüler, die sich ineinander ver-lieben. Vor ein paar Jahren haben die beiden die Serie noch selbst geschaut, nun spielen sie mit. »Das ist schon ko-
misch«, sagt der 16-jährige Hugo. »Als Kind hätte ich mir nie vorstellen kön-nen, dass ich mal in der Serie mitspie-le.« Vormittags besuchen Hugo und Maria eine normale Schule, an einigen Nachmittagen in der Woche stehen sie für Schloss Einstein vor der Kamera. Bei der Partyszene spielen sie nicht mit, sie ziehen sich in der Zeit ihre Kostüme an: Hugo ein blaues Hemd, Marie eine Blümchenbluse. Danach werden die beiden geschminkt und gehen noch mal gemeinsam ihren Text durch.
Robert Schupp, der den Internats-direktor spielt, ist schon seit 2006 da-bei. In den sieben Jahren hat er viel Lustiges erlebt, aber ein Erlebnis ist ihm besonders im Gedächtnis ge-blieben: »In einer Szene sollte ich eine Rakete abschießen. Es
war sehr kalt, und ich hatte richtig di-cke Unterwäsche an. Als ich mich ge-bückt habe, um die Rakete abzufeuern, ist mir tatsächlich die Hose geplatzt!«
Solche Pannen sind harmlos, schwieriger wird es, wenn ein Schau-spieler krank wird. Im März fiel erst eine Hauptdarstellerin aus, dann be-kam auch noch der Regisseur Schüttel-frost. Am Ende musste die Handlung der Serie geändert werden. Schloss Ein-stein muss ja weitergehen.
In den 15 Jahren hat sich einiges verändert: Es sind nicht nur neue Schüler auf das Internat gekommen, die ganze Schule ist umgezogen: Bis 2008 spielte die Serie in dem aus-gedachten Ort Seelitz in Brandenburg, heute in Erfurt. Am Anfang mussten die Schüler noch in eine Telefonzelle gehen, um ihre Eltern anzurufen. Heu-te haben sie Handys. Und während früher Computer kaum eine Rolle spielten, besitzen die Schüler heute alle Laptops. Damit kommen auch neue Themen dazu, zum Beispiel Mobbing bei Facebook. Einiges ist seit der ersten Folge, die am 4. September 1998 aus-gestrahlt wurde, aber auch geblieben: Das Titellied Alles ist relativ gab es von Anfang an, Hausmeister Pasulke taucht immer auf.
Viele der Darsteller von früher sind übrigens heute keine Schauspieler mehr. Sie haben sich nach der Schule für einen anderen Beruf entschieden, sind Ärzte oder Polizisten geworden.
Und viele haben inzwischen selbst Kinder. Mit denen können sie heute die Serie schauen, in der sie früher mitgespielt haben.
P O L I T I K , W I S S E N , K U LT U R U N D A N D E R E R Ä T S E L F Ü R J U N G E L E S E R I N N E N U N D L E S E R
Mehr für Kinder: Die neue Ausgabe von ZEIT LEO, dem Magazin für Kinder, jetzt am Kiosk!
Weitere Infos: www.zeitleo.de2. OKTOBER 2013
DIE ZEIT No 41
BLEEKER
DER ELEKTRONISCHE HUND
RÄTSELECKE
Lösung aus der Nr. 40:
HIE
R A
USR
EIS
SE
N!
Mein Vorname und Alter:
Wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich:
Glücklich macht mich:
Dieses Ereignis in der Welt hat mich beschäftigt:
Das würde ich meinen Eltern gerne beibringen:
Ich ärgere mich über:
Jede Woche stellt sich hier ein Kind vor. Willst Du auch mitmachen? Dann guck mal unter www.zeit.de/fragebogen
Ich wohne in:
UND WER BIST DU?
2004 Nach 300 Folgen: Neue Schüler für »Schloss Einstein«
Das Sandmännchen ... ist schon 54 Jahre alt. Es lief 1959
zum ersten Mal im Fernsehen und kommt immer noch jeden Abend zum Gute-Nacht-Sagen. Lange gab es in den verschiedenen Teilen Deutschlands unterschiedliche Sandmännchen, weil der Traum-sandstreuer so beliebt war.
Die Sesamstraße... ist genau zehn Jahre jünger als das Sandmännchen, also 44 Jahre alt. Die erste Folge lief 1969 in den USA. Vier Jahre später kam die Sesamstraße nach Deutschland. Es wurden sogar eigene Figuren für die deutsche Sesamstraße erfunden, so wie Samson. Ernie und Bert gehören auch in den USA dazu.
Die Maus... ist wahrscheinlich das dienstälteste Tier im deutschen Fernsehen, und sie sieht genauso jung aus wie bei den ers-ten Folgen der Sendung mit der Maus vor 42 Jahren. Der Maulwurf und der Elefant sind übrigens nur ein klein we-nig jünger als die Maus. Eine alte Ban-de, die da sonntags die Welt erklärt!
1998 So fängt alles an: Die ersten Kinder ziehen ins Internat
10 11 12
16
2
14
4
57
1
815
Z I EE
A WE N N ZW K E
IN,D T SHE R
R D EK LÜGS T A
UF
T TE, D SE RU Z T
H ÖR
ISE
I NRWU
I E G
U
A UBELT T
FD R
I
NEGL, M Ä N
EL
L E
A ABAUSS E N
K
Unendliche GeschichteSeit 15 Jahren läuft die Serie »Schloss Einstein« im Fernsehen. Warum wird sie
nicht langweilig? Ein Besuch am Filmset VON ANIKA KRELLER
2013 Im Fernseh- Internat: Pippi (rechts) und Hubertus (Mitte)
Alte-neue Lieblingsserien
Wandere von Feld zu Feld über das Spruchlabyrinth, egal, in welche Richtung. Es muss nur die farbliche Reihenfolge stimmen: Rot-Blau-Gelb-Grün-Rot-Blau-Gelb-Grün ... Dabei sollen sich passende Wör-ter ergeben, bis ein Sprichwort entsteht.
Fo
tos:
Sim
me
t/M
DR
; C
ove
rpic
ture
; R
. B
au
mgart
ne
r/W
DR
; F
ote
x;
pic
ture
-all
ian
ce/d
pa;
Inte
rfo
to (
2);
ull
ste
in,
We
nn
; Il
lust
rati
on
en
: Jo
n F
rick
ey
für
DIE
ZE
IT (
Wap
pe
n;
Le
o)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4142 KINDER- & JUGENDBUCH42 KINDER- & JUGENDBUCH
Als der Krieg zu Ende war und Berlin in Trümmern lag, saß mittendrin ein Junge in der Kneipe seiner Mutter und be-obachtete die Menschen um sich herum sehr genau. Der Junge hieß Klaus Kordon, und
er sollte die Geschichten der Kriegswitwen und heimgekehrten Soldaten, die er hörte, nicht ver-gessen. Viele Jahre später tauchten sie in seinen Romanen wieder auf. Die Nachkriegszeit, bei ihm klingt sie immer ganz nah. Wie kein anderer hat Klaus Kordon in seinen Kinder- und Jugendbü-chern von dieser Epoche erzählt.
Mehr als ein halbes Jahrhundert später steht der Autor bei einem Spaziergang durch Berlin vor dem Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park. Vor ihm erstreckt sich die weitläufige An-lage aus Marmor und Bronze, die mit stalinis-tischem Pathos an die gefallenen russischen Helden erinnert. Kordon schaut hinauf zum Sol-daten auf dem zwölf Meter hohen Sockel, der mit Befreier-Geste ein Kind im Arm und in der Hand ein Schwert hält. Zu Füßen der Statue liegt ein zerbrochenes Hakenkreuz.
Auch Kordon hat in seinen Büchern viele Male das Ende des Zweiten Weltkriegs gefeiert, aber mit dem Prunk dieses Denkmals haben seine Ge-schichten wenig gemein. Überhaupt kann Kor-don mit Denkmälern wenig anfangen. »Solche Orte sind dazu gemacht, Legenden in die Welt zu setzen«, sagt er. Er selbst hinterfragt diese Legen-den lieber in seinen Büchern. Kriegsheimkehrer, russische Besatzer oder KZ-Überlebende – nie-mand in Kordons Geschichten ist ohne Fehler. Der Alltag im zerbombten Berlin ist für alle hart, für die Vertriebenen wie für die Sieger. Zwischen Hamsterfahrten und Vermisstenanzeigen gelingt es den Kindern noch am besten, sich einzurich-ten. Diese Welt aus Schutt und Asche ist für sie trotz allem eine spannende Welt. Und sie macht erfinderisch, etwa Pit und Eule, die beiden Freun-de in Ein Trümmersommer (1982). Oder Frank
und Burkhard, die Geschwister in Brüder wie Freunde (1978). Kordons junge Protagonisten werden zwischen den Ruinen erwachsen. Und auch wenn er keine Denkmäler mag, dieser Gene-ration hat er selbst das größtmögliche von allen gesetzt: das literarische.
Viele junge Leser haben durch Kordons Bü-cher einen Zugang zur deutschen Vergangenheit gefunden, der eindringlicher ist als Geschichts-unterricht. Beispielsweise durch den Roman Die roten Matrosen (1984), der im Jahr 1918 spielt. Der Erste Weltkrieg ist gerade zu Ende, Rosa Lu-xemburg und Kaiser Wilhelm II. tauchen im Buch auf. Im Mittelpunkt aber steht die fiktive Familie Gebhardt. Und deren Alltag macht die revolutionäre Stimmung der Zeit viel deutlicher, als es reine Fakten je könnten.
Die Familiengeschichten, die Kordon erzählt, erstrecken sich oft über mehrere Bände. 1848 – Die Geschichte von Jette und Frieder (1997) bildet den Auftakt einer Trilogie über das 19. Jahrhun-dert, es folgen Fünf Finger hat die Hand (2006) über den Deutsch-Französischen Krieg und Im Spinnennetz (2010) über das deutsche Kaiserreich. Häufig nutzt Kordon dabei Stoff, den seine eigene Familiengeschichte ihm bietet. In seinem preisge-krönten autobiografischen Roman Krokodil im Nacken (2002) blickt Kordon – ohne Verbitterung – zurück auf die Geschichte der DDR. Die ver-ließ er in den 1970er Jahren gemeinsam mit seiner Frau und den Kindern, nachdem er zuvor ein Jahr lang im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen ge-sessen hatte. Sein jüngstes Buch Das Karussell(2012) schildert die Liebesgeschichte zwischen seiner Mutter und dem Vater, der im Krieg blieb.
Kordons wichtigster Assistent in seiner schrift-stellerischen Arbeit ist die Stadt Berlin. Ohne Berlin, davon ist er überzeugt, wäre er ein anderer Autor geworden. »Ich hätte mich wohl auch dem literarischen Realismus gewidmet, aber vermut-lich nicht so intensiv der deutschen Geschichte«, sagt er. »Die drängt einem Berlin geradezu auf.« Kordon ist hier 1943 geboren. Auf den Straßen
zwischen Prenzlauer Berg und dem Wedding hat er als Kind gespielt. Nach der Schule las er, wäh-rend seine Mutter Gäste bewirtete – erst das Neue Deutschland, später geliehene Weltliteratur: Di-ckens, Tolstoi, Dostojewski. Die Topografie seiner Kindheit findet sich in vielen seiner Romane wieder – die Arbeiterviertel, Hinterhöfe, hellhöri-gen Wohnungen. An irgendeiner Teppichstange scheint in seinen Büchern immer der kleine Klaus zu klettern, auch wenn der kürzlich seinen 70. Geburtstag gefeiert hat.
Bei seinem Spaziergang hat Kordon das Gelän-de des Ehrenmals verlassen. Er schlendert am Ufer der Spree entlang zur »Insel der Jugend«. Auch dies ist ein persönlicher Ort für ihn. Als seine Mutter starb, kam er mit 13 Jahren in das Jugend-
heim, das noch heute auf der Insel steht. Kordon zeigt, wo früher Bolzplatz und Badestelle waren, erzählt von dem selbst gebauten Boot, mit dem er und seine Freunde auf der Spree schipperten. Er erinnert sich an den Heimleiter, einen ehemaligen Polizeimajor, der sich nicht scheute, Jugendliche von anderen verprügeln und demütigen zu lassen. Kordon war einer von knapp 30 Jungen, allesamt Kriegskinder, die zurückgeblieben waren – schu-
lisch, körperlich, seelisch. »Fast ohne Hoffnung«, sagt Kordon. Er selbst war »immer ein wenig privilegiert«, weil er den anderen bei den Haus-aufgaben half. »Der liest dicke Bücher!«, hieß es.
Später hat Kordon selbst dicke Bücher ge-schrieben. Auch die Heimjahre tauchen darin auf. Vom »kleinen Eiland mitten in der Spree« schreibt er in Krokodil im Nacken. Ein Kapitel spielt im Berlin vor dem Mauerbau. Kordons Alter Ego, Manfred Lenz, geht mit seinem Freund so oft wie möglich zum Schlesischen Tor in Kreuzberg, in den Westsektor also. Da gibt es Arbeit. Für einen entladenen Kohlewaggon erhalten die beiden 40 Westmark. Sie schaffen das Pensum in einer Nacht. Kommen kohlrabenschwarz zurück ins Heim, der Leiter tobt, verhängt Strafen. Und
doch ist es die Mühe wert. Es gibt neue Jeans und diverse Kinobesuche: Western im Westen.
Kordon erzählt die Szene beim Laufen noch einmal, und es scheint, als sei sie eben erst passiert. »Wir zogen los, wann immer es ging, lernten bei-de Seiten kennen, den Osten und den Westen«, erinnert er sich. »Konnte uns ja keiner verbieten, in den Westen zu gehen.« Für den jugendlichen Kordon war ganz Berlin ein Erlebnis, auf Lehrer
und Heimleiter hörte er längst nicht mehr. »Das waren Jahre, die mich geprägt haben.« Als im Au-gust 1961 die ersten Stacheldrahtrollen ausgelegt und die ersten Mauersteine gesetzt wurden, guck-te der junge Kordon zu und machte sich lustig. »Das schaffen die nie, dachten wir da noch.«
Erinnerung und Erfindung fließen in Kordons Texten zusammen. Mehr als 90 Bücher hat er ge-schrieben, viele davon haben einen Umfang von 400 Seiten und mehr; und die erste Fassung ist meist erheblich länger als das Buch, das der Leser letztlich in Händen hält. Weil seine Leser jung sind, ist es ihm wichtig, so viel wie möglich zu er-klären. Die Bücher sollen sich auch ohne Vorwis-sen öffnen: »Ich setze nichts voraus, sondern er-zähle alles im Laufe der Handlung.«
Ob historische Romane auch in Zukunft jun-ge Leser finden werden? Kordon zögert nicht bei seiner Antwort. »Da bin ich optimistisch.« Natür-lich schreibe er für die, die ohnehin lesen. »Für Nicht-Leser kann ich ja nicht schreiben.« Er macht es sich nicht einfach mit seiner Arbeit. Er liest viel, weil erst die Details das Vergangene nä-herbringen: »Wenn es gelingt, dann wird Ge-schichte wieder erlebbar.«
Er schreibt, wie es warDer Jugendbuchautor Klaus Kordon macht die Vergangenheit
für junge Leser erlebbar VON REINHARD OSTEROTH UND SARAH SCHASCHEK
Lesestoff für den Herbst
1918Die roten Matrosen oder ein vergessener Winter Beltz und Gelberg, Taschenbuch 2012, 480 Seiten, 9,95 €, ab 14 Jahre
Erster Teil der »Trilogie der Wendezeiten«
Durchs 20. Jahrhundert mit Klaus Kordon
1973Krokodil im Nacken,Beltz und Gelberg, Taschenbuch 2012, 800 Seiten, 9,95 €, ab 14 Jahre
Autobiografischer Roman, ausgezeichnet mit dem Deut-schen Jugendliteraturpreis
1947Ein Trümmersommer Beltz und Gelberg, Taschenbuch 2013, 280 Seiten, 6,95 €, ab 12 Jahre
Nachkriegsroman und Schulpflichtlektüre
Klaus Kordon am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin
Drei Seiten voller Bücher für junge Leser: Wir spazieren mit Klaus Kordon, dem großen Erzähler der Nachkriegszeit, durch Berlin (diese Seite),stellen zwölf empfehlenswerte Neuerscheinungen vor (Seite 43) und zeichnen Kirsten Boies neues Werk mit unserem Kinder- und Jugendbuch-Preis, dem LUCHS, aus (Seite 44)
Foto
: Ja
nn
is C
hava
kis
fü
r D
IE Z
EIT
/w
ww
.ch
ava
kis
.de

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 KINDER- & JUGENDBUCH 43
Ganz unten steht der Igel. Auf ihm schwitzt der Hase unter dem Gewicht des Schafes und des Zebras. Die Tiere stapeln sich bis in luftige Höhen. Am Ende wird ein Pinguin sehr glücklich sein. Sein Dilemma ist be-kannt: Er kann nicht fliegen. Der Pinguin versucht es zunächst mit Luftballons und auf dem Rücken einer Gans – vergebens. Er bleibt stets am Boden. Wie der Titel verspricht, kommen schließlich eine Menge Freun-de zum Einsatz. Wie sie ihm helfen, das soll hier nicht genauer verraten werden, denn das ist der wahre Spaß an diesem Buch. Nur so viel: Junge Leser können die Ge-schichte höchstselbst zum Guten wenden. Das alles wird in liebevoller Optik dargeboten – so schön, dass die Handlung dahinter ruhig ein wenig zurückbleiben darf. SCHK
Kerstin Schoene: Ein Haufen FreundeThienemann Verlag 2013; 32 S.; 12,95 €
Alfonso ist ein Oberganove: Er klaut berühmten Sängerin-nen die Perlenkette aus dem Schlafzimmer und kleinen Jungen das Eis aus der Hand. Diamanten reißt er sich genauso unbemerkt unter den Nagel wie eine Azteken-statue. Wie nur gelingt es dem Schnurrbart-Dieb, stets unbemerkt zu entwischen? Find’s selbst heraus!, dazu fordert dieses Bilderbuch uns Leser auf. Auf je einer Dop-pelseite zeigt es einen Coup des Gauners, und wer die hingekritzelten Beschriftungen und das detailreiche Bild in den richtigen Zusammenhang bringt, kommt Alfonso auf die Schliche. Braucht man Tipps, einfach nach hinten blättern. Thies Schwarz überzeugt mit starken Bildern, die (fast) ohne Text er-zählen. Ein interaktives Buch und ein großer Detektivspaß! KAT
Thies Schwarz: Alfonso, der Meisterdieb. 9 geniale Gaunereien und ein fataler Fehlermixtvision Verlag 2013; 40 S.; 11,90 €
Angler, die keine Fische fangen, gibt es oft. Angler, die keine Fische fangen wollen, sind deutlich seltener an-zutreffen. Bis nach Istanbul reist die Illustratorin Anne Hofmann, um einen solchen zu finden. Glücklicher-weise nimmt sie die Betrachter dieses Bilderbuchs mit. Denn am Bosporus schiebt Osman, der Angler, seinen rot leuchtenden leeren Fischverkaufswagen durch eine menschenleere, geisterhaft und zauberhaft schimmern-de Stadt. Man sieht ihn mal auf Dächern hoch über den Straßen angeln, mal auf einem Schiff, mal auf der Brücke. Immer wird er verfolgt von zwei hungrigen Möwen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dass Osman end-lich einen Fisch fängt. Doch der denkt nicht daran. Wenn Osman angelt, dann Dinge, die die Welt bedeuten ... JUS
Anne Hofmann: Osman, der Angler Aladin Verlag 2013; 32 S.; 12,90 €
An Tristans Schule wird ganz schön viel unterteilt. Es gibt drei Banden, zu denen man gehören kann: die Jupp-Jupp-Bande, die Patrick-Bande und die Olivier-Bande. Tristan gehört zu keiner. Es gibt zwei Gruppen, in die Lehrer ei-nen einteilen: die Starken und die Mittelmäßigen. Tristan gehört zu den Mittelmäßigen. Und es gibt zwei Kategorien von Kindern: die Großen und die Kleinen. Tristan ist ein Kleiner, »aber nur von der Größe her«. Dann beschließt er, selbst eine Bande zu gründen, für Jungs wie ihn und – oho! – für Mädchen. Marie-Aude Murail hat eine klei-ne Geschichte über einen großen Revolutionär geschrieben. Denn Tristan wirft mit Witz, Schläue und Mut mal eben die alte Ordnung über den Haufen. JUS
Marie-Aude Murail: Tristan gründet eine Bande Deutsch von Tobias Scheffel Bilder von Susanne GöhlichFischer KJB 2013; 93 S.; 10,99 €
Wenn sie in ihrer Schulklasse eine Geschichte erzählen soll, die wirklich wahr ist, fällt Pym zum Beispiel diese ein: Ihr Urgroßvater war der dritte Mann auf dem Mond (unter anderem, weil er sein Pipi drei Tage lang im Kör-per behalten konnte), und Jackie Kennedy hat ihm zur Belohnung eine Diamantkette geschenkt. Oder diese hier: Pyms große Schwester ist eigentlich Chinesin. Sie wurde adoptiert und hat sich im Lauf der Jahre so gut an die Umgebung angepasst, dass sie inzwischen blond ist. Seltsamerweise ist die Lehrerin mit Pyms echt wahren Geschichten einfach nicht zufrie-den. Also muss Pym weitersuchen. Eine Geschichte rund um die Fra-ge, was eigentlich wahr ist – und was gelogen. JUS
Heidi Linde: Glatt gelogen. Die schrägste Familie der Welt Deutsch von Heike Dörries Bilder von Stefanie Jeschke Dressler Verlag 2013; 224 S.; 12,95 €
Stellas Urururoma hatte einst in Russland ein Stück feins-ten glänzend blauen Seidensatin mit Silberbrokat bestickt und mit Goldfaden vernäht. Fortan wandert der Stoff von Generation zu Generation und ändert mit jedem Besitzer seine Form: Aus Wandbild wird Vorhang, Tischdecke, Kla-vierschal und schließlich eine Kinderdecke für Stella. Das Mädchen liebt den Stoff, aber immer wieder nimmt er Schaden: »...das passiert eben, wenn man einem Kind ein Erbstück aus Seidensatin schenkt«, sagt Stellas Mutter bei jedem Missgeschick. Doch je mehr das blaue Tuch schrumpft (aus der Decke wird Kleid, Bluse, Weste, Beutel, Schlei-fenband für einen Hut ), desto stär-ker wird der Faden, der Stella mit ihren Wurzeln verbindet. Ein poeti-sches Familienporträt. KAT
Holly-Jane Rahlens: Stella Menzel und der goldene FadenDeutsch von Brigitte Jakobeit Rowohlt Verlag 2013; 160 S.; 16,99 €
»Er war ein Arschloch. Mein Vater war ein vollkommenes Arschloch.« Das sind die letzten Sätze des ersten Kapitels, und – wumm – ist man hellwach, erstarrt, verwirrt und absorbiert von der Erzählung. Denn ausgesprochen wird das Arschloch-Urteil vom Protagonisten, dem sechzehn-jährigen Herc, ausgerechnet bei der Beerdigung des Vaters. Vom Podium aus schleudert Herc den Trauernden die Sätze entgegen. Danach schickt ihn die Mutter für den Rest des Sommers zum Onkel, dem Bruder des Vaters, der ihm zwölf absurd wirkende Aufgaben stellt. Zwölf Aufgaben für zwölf Tage, nach de-nen Hercs Welt eine andere sein wird. Direkt, knapp und kraftvoll erzählt James Proimos vom Verlo-rensein und Scheitern, vom Verste-hen und Neuzusammensetzen. KAT
James Proimos: 12 Things to Do Before You Crash and Burn Deutsch von U.-M. GutzschhahnGerstenberg 2013; 128 S.; 12,95 €
Nicht mehr als 15 Zeichnungen umfasst diese Ge-schichte über ein Attentat im Gazastreifen, und doch ist sie so komplex wie eine Folge der amerikanischen Serie Homeland. Ein Schulbus mit palästinensischen Jugendlichen ist beschossen worden, ein Fotojourna-list wird zu den Verletzten in die Klinik gerufen. Am Bett eines Jungen harrt er aus, baut plötzlich eine per-sönliche Verbindung zu dem fremden Kind auf – und glaubt einen Moment lang an ein Wunder. Die Figu-ren sind so stark (der nachdenkliche Reporter, die Ärzte des Roten Halbmondes), der Strich hat so viel Kraft, dass die Bilder jenseits des Textes ihre eigene Geschichte entwickeln. Allein der Blick des Journalisten er-zählt mehr vom Krieg im Na-hen Osten als mancher Ro-man. SCHK
Karin Gruß/ Tobias Krejtschi (Ill.): Ein roter SchuhBoje Verlag 2013; 32 S.; 12,99 €
Schon Evies Mutter wurde von ihren Eltern als Kind miss-handelt. Und als diese, vom Krebs geschwächt, zurück zu den Eltern zieht, ist es ihre Tochter, die geprügelt, geschubst, gestoßen wird. Erst nach dem Tod der Mutter bei ihren Adoptiveltern findet Evie Geborgenheit und Liebe – und öffnet sich. Sie erzählt von der gebrochenen Rippe und wird endlich operiert. Aus dem Knochen schnitzt das Mädchen einen Drachen, der ihr Glück bringen soll. Das Tier erwacht in den Nächten und begleitet Evie hinaus – zum Friedhof, zum Haus der Großeltern. Und dann brennt es plötzlich... Warum aus Gewalt so häufig neue Gewalt erwächst, selbst dann, wenn man noch das beste hofft, davon er-zählt Alexia Casale eindringlich in ihrem Romandebüt: spannend, fan-tastisch und vielschichtig. KAT
Alexia Casale: Die Nacht gehört den DrachenDeutsch von Henning AhrensCarlsen Verlag 2013; 320 S.; 14,90 €
Im Nachlass seiner Großmutter fand der Journalist Nikolaus Nützel ein Notizbüchlein. Darin standen Zeilen von Goethe neben Kriegsgedichten aus dem Jahr 1914: »Zu den Waffen, zu den Fahnen! Deutsche Män-ner, auf zum Krieg!« Worte, die deutlich machen, wie fern uns diese Welt heute ist. Aber ist diese Zeit wirklich so weit weg? Nützel macht sich in diesem beeindrucken-den Buch auf die Suche nach dem, was uns der Erste Weltkrieg noch zu sagen hat. Könnte es nicht sein, dass sein Sohn in einigen Jahren zufällig die Urenkelin des Soldaten kennenlernt, dem sein Großvater einst in Frankreich gegenüberstand? Beide wüssten nicht, was sie verbindet – Nützel erzählt genau das: die Ge-schichte eines grausamen Krieges, der das Europa schuf, in dem wir heute leben. JUS
Nikolaus Nützel: Mein Opa, sein Holzbein und der Große Krieg Ars Edition 2013; 144 S.; 14,99 €
Ein Krokodil ist kein Haustier! Einverstanden. Aber was, wenn man ein Krokodil ins Haus holt, damit es nicht zu einem Uhrenarmband gemacht wird? So war es bei Willi (Mensch) und Jakob (Krokodil). Willi meinte es gut, und Jakob hatte es gut: Er bekam ein eigenes Zimmer mit Pool und Palmen, er durfte dösen, so viel er wollte, und alle zwei Wochen ein Hühnchen verspeisen. 42 Jahre ging das so, dann hörte Jakobs altes Kroko-Herz auf zu schlagen. Eine wahre Geschichte wie aus dem Bilderbuch, die nun in diesem Sachbilder-buch erzählt wird. Es verhehlt nicht, welche gravieren-den Probleme so ein Krokodil ma-chen kann (es wird immer größer, es hat Zähne, es wird verdammt alt), aber es zeigt auch, wie lieb man es haben kann, wenn es schon mal da ist. Im Haus. MAHA
Claudia de Weck/Georg Kohler: Jakob, das KrokodilAltlantis Verlag 2013; 40 S.; 14,95 €
Wie viele Berge hatte die Insel noch gleich? Welches Tier trug Hut? Und wer brachte dem Urmel das Spre-chen bei? Seit 65 Jahren lässt die Puppenkiste aus Augs-burg die Marionetten tanzen. Wer, wann, was, wie und warum – all das ist in diesem dicken Jubiläumsbuch nachzulesen. Dazu kann man die Puppen-Hits (im Original oder in neuer Version) anhören und selbst an den Fäden ziehen: bei der Marionette des Lokomotiv-führer-Nachwuchsjungen Jim Knopf. Gefertigt übri-gens nicht in China, sondern in Tschechien. Mit knapp hundert Euro hat diese Box einen stolzen Preis. Dafür wünscht man sich, dass die wertvolle Ladung in einer angemessenen Hülle ins Wohn-zimmer kommt: in einer Puppen-kiste, nicht bloß in einem Papp-karton. KAT
Fred Steinbach: Die große Box der Augsburger PuppenkisteBoje Verlag 2013; 192 S.; 99 €
Wackliger BergWie viele Tiere einem Pinguin den Traum vom Fliegen erfüllen
Genialer GaunerNeun Fälle und ein gewiefter Dieb: Ein Bilderbuch zum Mitermitteln
Am HakenEin Bilderbuch von einem Angler, der nicht fischt, was er soll
Gegen-BandeEine kleine Geschichte über einen großen Revolutionär
VerflunkertVon einer Geschichtenerfinderin, die sich die Welt macht, wie sie ihr gefällt
ZauberstoffVon einem edlen Tuch, das Generationen einer Familie verbindet
Packende WutEin Junge verliert seinen Vater und gewinnt eine neue Welt
Konflikt-BilderEine Graphic Novel über die tägliche Gewalt im Nahen Osten
Drachen im KopfEin misshandeltes Mädchen und eine große Hoffnung: Gerechtigkeit
Alte WundenEin beeindruckendes Buch zur Aktualität des Ersten Weltkriegs
Schnappi zu HausSchlafen, fressen, planschen: Wie man ein Krokodil in der Wohnung hält
Jim in der BoxZum 40. Geburtstag der Augsburger Puppenkiste: Buch, CDs & Marionette
ab 4 Jahren
ab 6 Jahren
ab 3 Jahren
ab 6 Jahren
ab 9 Jahren
ab 10 Jahren
ab14 Jahren
ab 12 Jahren
ab 14 Jahren
ab 12 Jahren
ab 5 Jahren
ab 5 Jahren
KinderbücherBilderbücher Jugendbücher Sachbücher
Von schrägen Familien, akrobatischen Tieren, magischen Knochen und Opas mit Holzbeinen:
Zwölf empfehlenswerte Neuerscheinungen für junge Leser
L L Le esen, E E enS sN, !

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4144 KINDER- & JUGENDBUCH
Da ist Thulani, er ist elf Jahre alt und lebt dort, »wo es schöner ist als irgendwo sonst auf der Welt«. Er liebt es, Fußball zu spielen, und hofft, eines Tages entdeckt und berühmt zu werden. Da ist Sonto, die einen großen Schatz
besitzt: eine Blechdose mit einem Buch, das ihre Mutter für sie geschrieben hat. Ist das zu glauben? Ein Buch, extra für sie! Da ist die tapfere Lungile, die sich von ihrem Zuhause in den Bergen auf den Weg in die Stadt Manzini macht. Ein weiter Weg ist es, und mutig muss sie sein. Aber sie ist die Einzige, die eine wichtige Be-sorgung machen kann. Und da ist Sipho, der ein so guter großer Bruder ist und ein Beschützer und einer, der die Eier der Hühner findet, auch wenn die sie im Sand verstecken.
Vier Kinder mit fremd klingenden Namen in vier Erzählungen. Vier Kinder, die in einem kleinen Land in Afrika leben. Vier Kinder, die eines verbindet: Alle wachsen ohne Eltern auf. Es sind Kinder, die ihren Vätern und Müt-tern dabei zusahen, wie sie immer dünner wurden, wie sie husteten, Kraft verloren und schließlich starben. Kinder, die nicht wissen, ob das tödliche Virus auch in ihnen schlummert. Kinder, die jüngere Geschwister haben, für die sie plötzlich erwach-sen sein müssen.
Thulani sollte eigentlich zur Schule gehen, Waisen wie ihm wird das Schulgeld erlassen. Doch dass die El-tern nicht mehr leben, das müsste Thulani mit einem Totenschein beweisen. Und wie soll ein Junge aus den Hügeln an so einen Schein kommen? Ohnehin hat er genug damit zu tun, sich um seine kleine Schwester Nom-philo zu kümmern und der Gugu, seiner Großmutter, zu helfen. Die kann nur noch die Arme bewegen – da hilft auch der Rollstuhl, den eine Hilfsorganisation her-beigeschoben hat, nicht.
Dass alles gut sei, wie es ist, versucht Thulani sich einzureden. Doch wenn er beim Fußballspiel davon träumt, berühmt zu werden, ist es auch der Wunsch nach einem anderen Leben, der sich Bahn bricht. Und als Thulani eines Tages an der Wasser-stelle von einem Dorf für Kinder erfährt, in dem es dreimal am Tag etwas zu essen gibt, macht er sich auf den Weg. Doch das Dorf ist mit Stacheldraht geschützt. Eine Frau erklärt ihm: »Weißt du, wie viele wie dich es gibt im Land? Da müssten sie ja tausend Dörfer bauen, ach, mehr noch!, um für jedes einen Platz zu schaffen. Tausend solcher Dörfer! Du verstehst wohl, dass das nicht geht ...«
Kinder, so sagt man, sind die Zukunft eines Landes. Aber was, wenn es in einem Land zwar viele Kinder, aber keine Eltern mehr gibt? Was geschieht, wenn Kinder sich selbst überlassen sind? Werden sie überhaupt über-leben, bis die Zukunft angebrochen ist? Die vier Ge-schichten in Kirsten Boies Erzählband Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen spielen in Swasiland, einem winzigen afrikanischen Staat, in dem den Kindern die Eltern wegsterben. Denn Swasiland hat die höchste HIV-Rate der Welt. Jeder Vierte trägt das Virus in sich, und 45 Prozent der Kinder sind Waisen. Von ihren Leben, ihren Nöten, aber auch ihrem Lebensmut han-deln die vier Geschichten.
»Ich kenne einen Jungen in Afrika«, so eröffnet Kirs-ten Boie den Erzählband. Und ja, sie kennt Thulani, Sonto, Lungile und Sipho wirklich, wenngleich sie anders heißen. Seit sechs Jahren unterstützt die Hamburger Autorin Hilfsprojekte in Swasiland und reist regelmäßig hin. Sie saß in den Hütten, die sie beschreibt. Sie hat die Kinder und ihre Gugus getroffen und mit ihnen gespro-chen. Sie hat beobachtet, wie Mütter lernen, Memory Books zu fertigen und zu schreiben: Bücher mit persön-lichen Geschichten, die den Kindern bleiben, wenn die Eltern gestorben sind.
So ein Buch trägt Sonto bei sich, als sie sich mit ihrer kleinen Schwester Pholile auf einen langen Marsch be-gibt. Vater, Mutter und auch der älteste Bruder sind ge-storben, an der »Krankheit«. Nun ist Sonto das Familien-oberhaupt und will Gewissheit: Mit Pholile wandert sie zur Krankenstation, damit beide getestet werden können. Das Buch, das sie in einer alten Dose dabei haben, gibt
den Mädchen Kraft – und das Gefühl, nicht allein zu sein. »Ich bin Mamas wunderbare Tochter!«, sagt
die kleine Pholile und zeigt der Krankenschwester die Dose. »Das steht da drin.«
Die erste Geschichte, die von Thulani, schrieb Kirsten Boie 2010 nach ihrem
ersten Besuch in Swasiland, noch auf dem Flughafen. Es sei der Versuch gewesen, das Erleb-te zu verarbeiten. »Es gibt Din-ge, die weiß man, die sieht man sogar mit eigenen Augen«, er-zählt Kirsten Boie, »aber sie sind so ganz und gar unerträg-lich, dass man sie doch nicht glauben kann.«
Mit einer ungeheuren Inten-sität schreibt Boie ihre Erlebnisse und Eindrücke in die Geschich-ten hinein. Es sind vier Geschich-ten, die für die Schicksale Zehn-tausender Kinder stehen, aber allein diese nur zu lesen ist kaum auszuhalten. Nach jeder Ge-schichte wünscht man sich eine Pause, um zu verarbeiten, was da gerade über einen hereingebro-chen ist.
Wie das Mädchen Lungile einen kleinen Stock umklam-mert, egal, welches Leid ihr wi-derfährt. Der Stock ist so lang wie die Füße der kleinen Schwester Jabu, und für die muss Lungile Schuhe besorgen. Denn kleine
Kinder dürfen zwar umsonst zum Unterricht, aber nur mit Schuhen. Für die braucht Lungile allerdings Geld, und in ihrer Not – Arbeit für Kinder ist offiziell verboten, ihre Bastmatten will keiner kaufen – klettert sie schließ-lich in die Kabinen von Lkw-Fahrern. Vom Inhalt der Tütchen, auf denen Love Safely steht, will keiner der Männer etwas wissen.
Der wahren Lungile konnte Kirsten Boie rechtzeitig helfen. Sie traf das Mädchen mit dem Stöckchen in der Hand auf dem Markt – und besorgte die Schuhe für sie. »Die große Schwester hat, das hoffe ich, nicht getan, was Lungile tut«, schreibt Boie im Nachwort des Buches.
Natürlich habe sie sich die Frage gestellt, ob sie solche Geschichten einfach »in die Welt werfen« könne. Ob sie sich als Autorin erklären müsse. »Ich habe mich immer wieder auch gefragt, ob ich nicht literarisch kolonialisie-re, weil ich als erwachsene und weiße Europäerin aus der Perspektive afrikanischer Kinder schreibe«, sagt Boie. Deshalb betont sie im Nachwort noch einmal, dass sie natürlich nicht wissen kann, was in den Köpfen von Thulani und den anderen vor sich geht.
Die Gedankenwelt der Kinder ist erfunden, aber Boie gelingt es, für uns glaubhaft und überzeugend aus deren Perspektive zu schreiben. Dramaturgisch geschickt,
schleicht sich die Autorin in die Köpfe der Kinder: In der ersten Geschichte ist sie anfangs noch ganz Erzählerin, die von dem Jungen schreibt, den sie in Afrika kennt; die, von außen auf ihn blickend, von ihm berichtet. Doch nach und nach verwandelt sich die Perspektive, wird zur Stim-me des Kindes, schildert seine Gefühle und Gedanken.
Am stärksten ist dies in der letzten Geschichte: Sipho glaubt, er habe Schuld, dass seine Gugu ins Feuer geriet und nun schwer verstümmelt ist. In tiefer Verzweiflung wiederholt er in Zwiesprache mit sich selbst immer wieder, dass auch andere Schuld haben – und scheint es sich doch nicht abzunehmen. Denn ihn hatte die Gugu ge-beten, Wasser zu holen, und er hatte es nicht getan. So war nichts zum Löschen da, als die Röcke Feuer fingen. »Lass es vorbei sein, lass es wieder sein wie frü-her, lass es nie geschehen sein.« So fleht Sipho den »Herrn Jesus« an. Es sind die letzten Worte der letzten Erzäh-lung – und es sind Worte, die alle Kinder aus allen vier Geschichten in die Welt hinausschreien könnten.
Boie schreibt, in einfacher und mündlicher Sprache, was zur afri-kanischen Erzähltradition passt, aber auch zu den Kindern, deren Perspektive sie ein-nimmt. Bei aller sprachli-chen Schlichtheit webt Boie kunstvoll und poe-tisch Wörter und Sätze ineinander und erzeugt so einen Rhythmus, dass man die Geschichten laut lesen und mitspre-chen will.
Der Titel Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen ist ein Zitat aus einer der Geschich-ten. Aber sie erzählt ja doch, hat diese »Dinge« schließlich aufgeschrie-ben, könnte man Kirsten Boie vorhalten. Ja, sie erzählt – aber mit Leerstellen. Das Grauen liegt zwischen den Zeilen. Die Prostitution wird nicht benannt, auch Aids findet nur als »die Krankheit« ins Buch. Erwachsene Leser werden die Leerstellen zu füllen wissen, Kinder sollten die Geschichten frühestens mit zwölf Jahren lesen – und nicht allein. Gut möglich allerdings, dass Kinder die Geschichten besser wegstecken als Erwachsene. Boi-es Erzählkunst zeigt sich darin, dass sie erzählt, ohne zu benennen. Etwa wenn sie Thulani denken lässt, dass zum Ausheben der Gräber für die Mütter »zum Glück« noch die Kinder da sind. Dann ist sein »zum Glück« in ganz naiver Weise genau so gemeint, und für das Kind eine Erleichterung: Zum Glück sind wir Kinder noch da! Wer sollte sonst die Mütter begraben? Dass Kinder überhaupt keine Gräber ausheben sollten, das kommt in seiner Weltsicht nicht vor. Der Schrecken, der entsteht in un-seren Erwachsenenköpfen.
»Ich könnte noch viel mehr Geschichten erzählen, und all diese Geschichten sind wahr. (...) Wenn die Ge-schichten traurig sind, kann ich es darum nicht ändern. Trauriger als die Wirklichkeit sind sie nicht.« So schließt Boie ihr Nachwort. Aber warum erzählt sie sie über-haupt? Und warum auch noch für junge Leser? Solida-rität mit dem Leid anderswo zu wecken, das sei ihr wichtig, sagt sie. Auch wenn sich Hilfe anfühle wie ein Tropfen auf den heißen Stein, es sei doch ein Tropfen. »Kinder denken nie ›Was geht mich das an?‹«, sagt Kirs-ten Boie, »genau umgekehrt. Kinder denken: ›Mich geht alles an!‹«
Kirsten Boie:Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählenIllustrationen von Regina KehnOetinger Verlag 2013; 112 Seiten; 12,95 Euro
Ein Totenschein für MamaKirsten Boie erzählt von Aids-Waisen in Swasiland. Es sind Geschichten voller Leid und Grauen,
die gleichzeitig den beeindruckenden Lebensmut der Kinder zeigen VON KATRIN HÖRNLEIN
ab 12Jahren
Luchs Nº321
Jeden Monat vergeben DIE ZEIT und Radio
Bremen den LUCHS-Preis für Kinder- und Jugendliteratur.
Am 3. Oktober, 15.20 Uhr, stellt Radio Bremen das
Buch vor. Das Gespräch zum Buch ist abrufbar unter www.radiobremen.de/
funkhauseuropa
Das kleine Königreich Swasiland liegt im Süden Afrikas
Illu
stra
tio
ne
n:
Re
gin
a K
eh
n

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
45
Rückkehr eines HeiligenPapst Franziskus besucht den Geburtsort des Franz vonAssisi, der seine Kirche zurArmut bekehren wollte S. 60
Netzverkäufer Warum der Ruf der Internet-Intellektuellen so schlecht ist – sie kritisieren viel, aber niemals die IT-Konzerne S. 50FEUILLETON
Was sagt Gerhard
Schröder dazu?Ein Pussy-Riot-Mitglied klagt gegen die Haftbedingungen
»Wir werden wie Sklaven behandelt.« Stunden-lang muss die Brigade vor der Baracke »Strafe stehen«. Der Arbeitstag dauert 16 Stunden, sechs Tage in der Woche müssen Polizeiuni-formen genäht werden. Zum Schlafen bleiben vier Stunden. 800 Frauen teilen sich einen kleinen Waschraum. Die Nahrung besteht aus fauligen Kartoffeln, aus bretthartem Brot und verdünnter Milch. Es gibt noch ein anderes täglich Brot: Schläge und Isolation.
Diese Beschreibungen stammen nicht aus Solschenizyns Archipel Gulag, sie stammen aus einem offenen Brief von Nadeschda Tolokon-nikowa, dem intellektuellen Kopf der Punkband Pussy Riot. Die 23-Jährige ist in der berüchtig-ten »Besserungskolonie IK-14« in der Republik Mordwinien in den Hungerstreit getreten (ZEITNr. 40/13), nachdem sie wegen »Rowdytums« zu zwei Jahren Arbeitslager verurteilt worden war. Ihr Vergehen: Tolokonnikowa hatte in der Moskauer Christ-Erlöser- Kathedrale ein Anti-Putin-Gebet gesungen. »Jungfrau Mutter Got-tes, vertreibe Putin!«
Wie nicht anders zu erwarten, bezeich-nen die Behörden ihre Vorwürfe als »Lüge«; nur der Sprecher der russisch-orthodoxen Kirche hat sie indirekt bestätigt. Ein Gefäng-nis sei nun einmal kein Kurort. »Wenn Gott einen Menschen bestraft, dann ist die-ser nicht zu beneiden, er verliert seine Ge-sundheit und manchmal das Leben.«
Angenommen, die Beschreibungen ent-sprechen der Wahrheit, dann benutzt Putin eine Technik der Menschenzerstörung, die bereits in den Zeiten des Gulag erprobt wurde. Die Perfidie dieser Technik, so hat Hannah Arendt gezeigt, besteht nicht allein aus eiserner Disziplin und brutalen »Maßnahmen«; sie be-steht aus kalkuliertem Chaos. Mit Absicht er-zeugt die strafende Macht eine Zone der Anar-chie, in der sich die Arbeitssklaven das Leben zur Hölle machen.
Genauso ist es in der IK-14. Weil alle dafür büßen müssen, wenn sich jemand be-schwert, riskieren »Aufsässige« Schläge und Ausstoßung durch die Mitgefangenen. Eine Roma, schreibt Tolokonnikowa, sei bereits zu Tode geprügelt worden. Deshalb hält man lieber den Mund, erst recht nach der Haft. Wer hier rauskommt, ist ein Wrack, er geht durchs Leben wie ein Toter.
Warum Pussy Riot für Putin gefährlich ist, kann man in Mischa Gabowitschs Buch über die russische Protestkultur nachlesen (Putin kaputt!?, Suhrkamp Verlag 2013): Die Band attackiert ein machtpolitisches Tabu, nämlich die Kollaboration von Staat und Kirche. Wäh-rend Putin die Bürger politisch an die Kandare nimmt, vertrösten die Priester sie auf das Him-melreich. »Im Namen des Vaters«. Für Pussy Riot ist das Gotteslästerung; die Kirche tanze um das Goldene Kalb der Macht. »Der Patri-arch glaubt an Putin / Besser sollte der Schwei-nehund an Gott glauben.«
Man wüsste natürlich gern, was ein welt-berühmter deutscher Sozialdemokrat über die russische Lagerhaltung denkt. Es könnte nicht schaden, wenn Gerhard »Gazprom« Schröder sich bei seinem Busenfreund Putin, dem an-geblich »lupenreinen Demokraten«, nach der Besserungskolonie IK-14 erkundigen würde. Zum Beispiel bei einer Bärenjagd an der herr-lichen mordwinischen Seenplatte, zwei lupen-reine Männerfreunde unter sich, bewacht von Staatspolizisten, deren Uniformen in 16-Stun-den-Schichten von blutigen Fingern zusam-mengenäht wurden. THOMAS ASSHEUER
Es geht im tiefen Osten los, auf der Karl-Marx-Allee, zwischen Plattenbauten und den Stalin-Arbeiterpalästen von 1953: Nieselregen. Der Sänger der deutschen Band Rammstein, der gerade im zehnten Stock
eines der Türme am Frankfurter Tor seinen Gedichtband In stillen Nächten vorgestellt hat, versucht, ein Taxi von der Straße herbeizuwin-ken. Wir stellen uns im Wartehäuschen des Nachtlinienbusses unter, und Till Lindemann, bekannt dafür, bei Interviews ein wortkarger und schlecht gelaunter Mensch zu sein, erzählt, dass es heute vergleichsweise gut gelaufen sei: »Wir hatten ausgemacht, dass keine Fragen zu Rammstein kommen, nur zum Gedichtband. Das war gut.« Jetzt, nach den Interviews, soll es für Till in den angenehmen Teil des Abends übergehen, also gerne Fragen stellen, aber bitte nicht so anstrengende Fragen. Später möchte er noch auf ein Abendessen ins Steakhaus Grill Royal, dann zu einer Ausstellungseröffnung. Angesichts der Tatsache, dass es regnet und we-gen des bisschen Regens kein Taxi kommt, sagt Till den ernsten, dabei ziemlich lustigen Satz: »Irgendwie bin ich nicht zufrieden.«
Unvermittelte Frage an den Rocksänger, der die letzten vier Jahre fast durchgehend auf Welt-tournee verbracht hat und dessen Liedtexte in amerikanischen Stadien von 30 000 Menschen mitgebrüllt werden: Ist er ein Ostmensch? »Durch und durch.« Und der Ostmensch erklärt: »Wenn ich in den Apple-Laden auf dem Ku’damm muss, dann sage ich: Ich fahre mal in den Westen.« Till Lindemann zeigt auf das blau leuchtende Schild vom Frankfurter Tor: »Komm, lass uns die U-Bahn nehmen.« Echt? Das geht? Mit dem Sänger der Band Rammstein kann man in Berlin so einfach U-Bahn fahren? Wir laufen schon in den Schacht hinunter, und er lächelt, weil er natürlich weiß, dass er dem Reporter hier eine dolle Geschichte bietet: Der Rockstar be-steht darauf, dass wir ohne Fahrschein fahren.
Oben, in der Interview-Lounge des zehnten Stocks, war es noch ziemlich verklemmt los-gegangen: wunderbar weite Blicke auf Platten-bauten. Wie spricht man über einen Gedicht-band, der 2013 erscheint? Wann war das zuletzt so, dass Gedichte in Deutschland Bedeutung und eine breite Leserschaft hatten? Bei Bertolt Brecht? Ach so, bei Enzensberger und Robert Gernhardt?
Der Körper sendet ja, unabhängig davon, was gesprochen wird, immer seinen ganz eigenen Text, und über den kann man bei Till Linde-mann, 50 Jahre alt, schon erschrecken: eine sehr kräftige, gewaltig breite Erscheinung. Er sieht wie ein Rockstar aus, der mit Hinkelsteinen werfen kann. Weiß gefärbte Haare, Augenbrau-en-Piercings. Schon auf den zweiten Blick geht vom Körper des Till Lindemann dann aber eine vertrauenerweckende Balu-der-Bär-Freundlich-keit aus. Und jetzt setzt der Stimmschock ein: Er spricht nicht im gepresst düsteren Ton, den die Fans von der Bühne kennen, sondern mit un-gemein sanfter, offener Stimme. Die böseste Stimme im Rock ’n’ Roll könnte in Wahrheit gut Kinderhörspiele einlesen. Ist ihm das klar, dass ihm da zwei vollkommen verschiedene Stimmen zur Verfügung stehen? Geduldiger Interview-partner Till Lindemann: »Es gibt den Berufsbass. Und das hier ist mein normaler Lebensbariton.«
Interview mit Till Lindemann. Warum ist es eine eher unentspannte Sache, diesen Rockstar zu sprechen? Die naheliegende Erklärung: Die Band Rammstein hat in den vergangenen zwan-zig Jahren so grandios erfolgreich und effizient eine künstliche Bühnenshow erschaffen – da ist es schlicht nicht einfach, hinter dem ganzen Pomp aus Feuer und Rauch und den wummern-den Gitarrenwänden den Menschen Till Linde-mann zu entdecken. Er ist der Rockstar mit dem rollenden R. Er ist der Rockstar mit den bren-nenden Engelsflügeln. Er ist der Rockstar, der eine antike Arena in Südfrankreich im Stech-schritt, mit Kniebundhosen und zurückgegelten Haaren betritt. Das Travestie-Theater der Band Rammstein – für Bürgerkinder, die in westdeut-schen Großstädten aufwuchsen, bleibt es die maximale ästhetische Herausforderung. Der ganze Düster-Grufti-Gothic-Brennende-Kreuze-
SM-Lack-und-Leder-Scheiß, auf den sie in Moskau, in Tokio und Buenos Aires so abstürzen – du liebes bisschen. Der fahrlässige Vorwurf, bei Rammstein handele es sich vielleicht doch um eine rechtsradikale Band, er hat sich in den letz-ten Jahren erübrigt: Nazis mögen keine Rock-stars, die rosafarbene Fellwesten tragen (Zitat des Philosophen Slavoj Žižek: »Rammstein sabotie-ren auf obszöne Weise die faschistische Utopie«).
Darf ich hier kurz erzählen, wie ich die Musik von Rammstein kennenlernte? Es war 1997 in Santa Barbara, einem Reichenghetto bei Los Angeles, wo ich das damals sehr berühmte Foto-model Guinevere Van Seenus interviewte. Das Model war auf Spritztour in einem Ford Mus-tang, als es den Song Rammstein, der gerade auf dem Soundtrack von David Lynchs Lost Highwayerschienen war, in den Kassettenrekorder schob. »Was? Das kennst du nicht?«, fragte das Model. »Das ist Rammstein – großer, großer Rock aus Deutschland.« Model, Ford Mustang, Kalifor-nien, Rockmusik aus Ostdeutschland: kann ja so schlecht alles nicht sein.
Und nun also der kleine, schwarze Gedicht-band In stillen Nächten (Verlag Kiepenheuer & Witsch). Es sind knapp hundert Gedichte, die Titel wie Sinn, Angst, Die Hure, Zur See und Nachtigall tragen. Bei Rammstein ist bekann-termaßen allein Lindemann für die Dichtung der Liedtexte zuständig. Wer also mit Ramm-stein-Texten vertraut ist, wird wenig überrascht sein. Da finden sich einige der Obsessionen aus den großen Hits wieder: die Lust, die es ohne Schmerz nicht gibt. Man kann sagen: Der Dichter Till Lindemann hat dauernd mit seinem Körper zu tun, der eklige oder sehr eklige oder gleich voll perverse Dinge tun will. Ein bisschen Ge-schlechtsumwandlung (Größer Schöner Härter) und Nekrophilie (Tierfreund) sind auch dabei. Natürlich, ein guter Songtext ist nicht gleich ein gutes Gedicht. Manchmal ist Lindemann zu sehr dem Rock-’n’-Roll-Prinzip des Schockierens verpflichtet – der Dichter möchte ein böser Junge sein. Im Gedicht Elegie für Marie Antoinette – ach, du liebes bisschen – wird nach Oralsex mit einem geköpften Schädel verlangt. Und natürlich, die Liebe: Wie in den Rammstein-Songs gibt es auch in den Linde-mann-Gedichten viel Schwermut.
Wenn moderne Lyrik immer den Sprach-zweifel, ja ein Problemverhältnis zur Sprache zum Inhalt hat, dann geht diesen Gedichten alles Zeitgenössische oder gar Avantgardistische ab. Da spricht einer, als wäre nichts, den klassi-schen Ton. (Oder, Moment: Täuschen wir uns? Blitzt da Ironie auf? Ist dieses merkwürdig aus der Zeit gefallene Deutsch vielleicht nicht immer ganz ernst gemeint?) Eine Lieblingsvokabel Lindemanns ist das »Herz«, es kommt in jedem zweiten Gedicht vor (weitere Lieblingswörter: Schmerz, Blut, Seele, Messer, Liebe, Kind, Trä-nen). Vor Brüder-Grimm-Vokabeln wie »Stern-lein« oder »Ränzlein« schreckt der Dichter auch nicht zurück. Wenn er mit »Ich bin ein trefflich Schusterjung« ein Gedicht eröffnet, dann ist der Leser mit einer Zeile bei Brentano, Eichendorff und der Romantik. Und wenn Lindemann Körper seziert oder einer unbestimmten Einsam-keit Ausdruck gibt, dann kann man, natürlich, auch an Gottfried Benn denken. Vielleicht ist der Dichter Lindemann in seinen drei oder vier Zeilen langen Epigrammen am stärksten. Da heißt es: »In stillen Nächten weint ein Mann / Weil er sich nicht erinnern kann«. Ist das – wie es sich für einen dichtenden Rocksänger gehört – nicht rührend einfach und einfach gut?
Im Grill Royal gibt er jetzt die schöne Be-stellung Tatar als Vorspeise und Steak ohne Beilage als Hauptgang auf. Merkwürdig: An der Art, wie der Gast Lindemann mit den Kell-nern umgeht – normal freundlich, eben nicht dumm kumpelhaft, wie Stars das gerne tun – kann man erkennen, dass ihn der Rockstar-Beruf nicht verblödet hat. Er hat sich eine schöne Bescheidenheit bewahrt. Sieht er sich selbst als Dichter? Erst spät, mit dreißig, habe er mit dem Notieren kleiner Spracheinfälle an-
gefangen. Der Dichter denkt nun darüber nach, ob man als gelernter Korbmacher überhaupt so etwas wie ein Mann der Sprache sein könne.
Lindemann, Sohn eines Kinderbuchautors und einer Kulturjournalistin, hat auf dem Dorf bei Schwerin eine Bücher-Kindheit gehabt (»Fernsehen spielte im Osten keine Rolle«). Als Literatur seiner Jugend nennt er Hemingway, Salinger und die ostdeutschen Provokateure Stefan Heym, Joachim Seyppel, Christa Wolf. Bei Lindemanns gingen die Maler, Bildhauer, Schriftsteller aus und ein. Ist ihm der Begriff Bildungsbürger angenehm? »Weiß gar nicht. Ich bin ein ziemlich einfacher Typ, der aus einem Bildungshaushalt stammt.« Hatte die Lyrik in der DDR nicht eine vergleichsweise große gesell-schaftliche Bedeutung? Tatsächlich, Tills Vater leitete in der DDR den Zirkel Schreibende Ar-beiter. »Da trafen sich Leute aus allen Schichten, Angestellte und Arbeiter, und haben unter An-leitung meines Vaters Gedichte geschrieben.« Als Liedtexter und als Dichter sieht Lindemann sich bis heute von der DDR beeinflusst: »Man durf-te sich nicht offen gegen den Staat äußern, also haben sich Literatur und Lyrik verschiedener Codes bedient. Die Prägung, dass Sprache die Dinge nur andeuten, niemals aussprechen darf, die bleibt – ein Leben lang.«
Was unterscheidet Rammstein-Texte von Lindemann-Gedichten? »Dichten macht Spaß, da ich das für mich tue. Liedtexte schreiben ist ein Albtraum.« Und Lindemann erzählt vom Vor-
gang des Liedtexte-Dichtens: Er schreibt über Instrumentalpha-sen drüber, die ihm die Band vorlegt, so lange, bis jedes der sechs Bandmitglieder zufrie-den ist: was dauern kann. Dagegen die Gedichte: Sie seien ihm über die Jahre nur so zugeflogen, auf Flughä-
fen, in Tourbussen und Hotelzimmern. »Um Gedichte schreiben zu können, muss ich unter-wegs sein. Ich habe in Berlin komischerweise keinen Zugang zur Muse.« Ist es vorstellbar, dass eines der Gedichte in dem schwarzen Band noch in einen Rammstein-Song verwandelt wird? »Das ist sehr gut vorstellbar. Einige der Gedichte hin-gen schon an der Wand im Band-Proberaum.« Als idealen Ort zum Runterkommen und Rich-tige-Worte-Finden bezeichnet Lindemann sein Landhaus in Mecklenburg-Vorpommern, zwei Stunden nördlich von Berlin. Noch zwei Gläser Rotwein und die Frage nach dem lyrischen Ich: Ist er das, der in seinen Gedichten spricht? Oder ist der Dichter wie der Rockstar eine Kunstfigur? Zögern. »Einige Gedichte sind autobiografisch, andere nicht.« Hilfe, was soll der Dichter auch sagen? Der Dichter spricht: »Ich schreibe etwas auf, lasse es liegen, setze mich immer wieder dran, bis es sitzt, und dann erschrecke ich oft furchtbar: Hilfe, das bin ja ich!« Es findet nun – auch das ist möglich – ein wortreiches Schwärmen über Lindemanns Lieblingsgedicht Unruhige Nachtvon Conrad Ferdinand Meyer statt. Schön.
Bei der Ausstellungseröffnung in der Au-guststraße. Großes Hallo, Umarmungen, Zu-prosten. Hier treffen sich alte Freunde. Die Galerie leitet ein Uraltkumpel, mit dem Till zu Schweriner Zeiten in einer Punkband ge-spielt hat. Das Konzept der Ausstellung be-steht darin, dass Freunde ihren Freunden zei-gen, was bei ihnen zu Hause hängt (Till hat Werke von Gottfried Helnwein und Markus Lüpertz beigesteuert). Raufasertapete. Ein Gaukler mit Wandergitarre singt Neil-Young-Lieder. Seltsam, die Stimmung in den Gale-rieräumen erinnert an 1990, als in Mitte eine einmalige Aufbruchstimmung umging: Wie kriegen wir das hin, den utopischen Geist der DDR zu bewahren, ohne dass das böse Geld des Westens uns alles kaputt macht? Till Lin-demanns Freundin, die Schauspielerin Sophia Thomalla, ist auch schon da. Der Galerist er-zählt, was Till im Jahr 1983 für ein beinharter Hund war, als vom dichtenden Sänger eine SMS eintrifft: »Bin auf dem Weg in den schö-nen Norden. Hau die Hühner.« Gut getextet.
Die Gefangene Nadeschda Tolokonnikowa
Noch zwei Gläser Rotwein und die Frage nach dem lyrischen Ich: Ist er das, der in seinen Gedichten spricht?
Der Verkleidungskünstler Till Lindemann auf der Bühne
Foto
s (A
uss
chn
itte
): R
yum
in A
lex
and
er/
ITA
R-T
ASS P
ho
to/
Co
rbis
; im
ago
Ein Lyriker?Der Sänger der deutschen Band
Rammstein Till Lindemann hat
einen Gedichtband veröffentlicht.
Ein Spaziergang mit dem Weltstar
VON MORITZ VON USLAR

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
»Besondere Leistungen« ist eine von 16 Katego-rien des soeben verliehenen Deutschen Fernseh-preises. Schon der mausgraue Titel beweist, wie schwer es der Eigensinn bei den Programmma-chern hat – und dass er dann doch immer wieder durchkommt. In diesem Jahr wurden der Doku-mentarfilm George und die Philosophiesendung Precht gelobt. Doch am genauesten passt die Aus-zeichnung auf den dritten Gewinner: Berlin – Ecke Bundesplatz. Die beiden Filmautoren Det-lef Gumm und Hans-Georg Ullrich verdienen den Preis allein schon für ihre Ausdauer. Dabei klingt »Langzeitbeobachtung« viel zu hölzern für ihre Serie lebenspraller Dokumentationen über die Schicksale ihrer Wilmersdorfer Nachbarn. Von 1986 bis 2012 haben die beiden Berliner in 62 Filmen 30 Lebensläufe zu einem einzigartigen Historienbild dieses wechselvollen Vierteljahr-hunderts zusammengefügt.
Bei Drehbeginn konnten weder Gumm und Ullrich noch ihr erster Förderer, Martin Wiebel vom Westdeutschen Rundfunk, ahnen, wie die Wucht der Geschichte ihre Versuchsanordnung vier Jahre später mit dem Fall der Mauer aufla-den und aufwerten würde. Nach mehreren Ver-längerungen haben sie schließlich auch mit Un-terstützung von RBB und Arte das Ende der Kohl-Ära, die deutsche Wende, die geldigen Neunziger und die Finanzkrise in den Biogra-fien ihrer Protagonisten gespiegelt. Ein Promi-nentenanwalt und der Schornsteinfeger, ein schwules Paar und die betagte Kriegerwitwe, der türkische Aufsteiger und die Berliner Familie,
46 FEUILLETON
Salzburg/Bayreuth:Alte und neue Besen
Salzburg wird nicht Bayreuth, titelte die Süd-deutsche Zeitung in der vergangenen Woche, als wäre es eine ernsthafte Option: den ganzen Wagner-Zirkus einzupacken und knapp 400 Kilometer gen Süden zu karren, wo sich dann Hummerbratwürste mit Mozartkugeln vermählen. Wie schlecht die Chancen für ei-ne solche Elefantenhochzeit stehen (vom Geschmacklichen ab-gesehen), zeigen die Per-sonalien dieser Tage.Während in Bayreuth die Vertragsverlängerungs-gespräche mit den am-tierenden Festspielleite-rinnen Eva Wagner-Pasquier und KatharinaWagner gerade ins Lau-fen kommen, hat sich in Salzburg eine glückliche Sturzgeburt ereignet: Markus Hinterhäuser, Jahrgang 1959, der sich schon 2009 zur Wahl gestellt hatte und aus nach wie vor unerfindlichen Gründen hinter Alexan-der Pereira zurückstecken musste, wird von 2017 an Intendant der Salzburger Festspiele. Der Wiener Pereira, der an der Salzach kein gutes Händchen bewies, zieht 2014 an die Mailänder Scala, sein Schauspielchef Sven-Eric Bechtolf und Helga Rabl-Stadler, die Festspiel-Präsiden-tin, übernehmen interimistisch die Geschäfte, Hinterhäuser dreht derweil eine dreijährige Ehrenrunde als Chef der Wiener Festwochen – und dann wird alles gut.
Einstimmig sei die Entscheidung für den 54-jährigen Pianisten und Kulturmanager ge-fallen, heißt es, und selbst unter die Reaktio-nen mischt sich nicht die leiseste Kritik. Ist die Branche so erleichtert, endlich wieder einen Künstler an der Spitze des glamourösen Festi-vals zu wissen, oder passte Hinterhäuser (dank unterschiedlichster Salzburg-Erfahrungen und Einheirat in die »richtigen« Kreise) so konkur-renzlos ins gesuchte Profil, dass die anderen 14 Kandidaten nur Staffage waren? Wie auch im-mer: Der Mann dürfte Ideen haben, das hat er mehrfach bewiesen. Und das ist bis 2022 schon einmal extrem beruhigend.
Weniger beruhigend fühlt sich die Tatsa-che an, dass man in Bayreuth gar keine groß-artigen Ideen braucht. Der Spielplan der zehn Wagner-Opern ist traditionell in Stein gemeißelt, die Agenda des Notwendigen reicht von der Baufälligkeit des Hauses über künstlerische Besetzungsfragen bis zur po-tenziellen Neujustierung der Stiftungssat-zung. Eile scheint geboten. Die Verträge der Schwestern laufen 2015 aus. Man hört so nichts aus Franken. Nicht dass da doch etwas im Busch ist. CHRISTINE LEMKE-MATWEY
Niki Lauda im Film:Brühl braust los
Ja, ja, er sieht aus wie der sympathische Stu-dent, mit dem sich jeder gern die WG teilen würde, aber auf der Leinwand hat Daniel Brühl immer wieder Abgründe gezeigt. Schon in sei-nem Auftritt als Schizophrener in Hans Wein-gartners Regiedebüt Das weiße Rauschen konn-te man sehen, wie sich sein Gesicht zu einer schmallippigen Fratze verzerrte, getrieben von den inneren Stimmen, die ihn peinigten. Die-ses aggressive und obsessive Potenzial muss der Regisseur Ron Howard erkannt haben, als er Brühl die Rolle von Niki Lauda in seinem Rennfahrerfilm Rush gab. Lauda auf der Lein-wand? Das kann bestenfalls Karneval und schlimmstenfalls eine Karikatur werden, könn-te man meinen. Aber Brühl zieht sich die Rolle an wie einen Rennfahreranzug – und braust los. Er ließ sich jeden Tag sieben Stunden in der Maske seinen Schädel modellieren, spricht Laudas typisch abgehacktes Österreichisch, lernte wie Lauda zu gehen, zu blicken, die Rei-fen zu wechseln und zu fluchen – und wirkt dabei doch nie wie eine Imitation, sondern wie die Inkarnation des Österreichers.
Rush erzählt von der Formel-1-Saison 1976, die geprägt war vom dramatischen Duell zwi-schen Lauda (auf Ferrari) und James Hunt (auf McLaren). Der Film des Regie-Routiniers Howard ist solide inszeniert und wird strecken-weise von Musikbombast ertränkt. Aber wenn Daniel Brühl ins Bild kommt, zuckt man auf der Tribüne, pardon, im Kinosaal zusammen. Für die Rolle des so besesse-nen wie perfektionisti-schen Rennfahrers wird Daniel Brühl bereits als Oscar-Kandidat gehandelt. Klar, die Academy liebt Geschichten von Helden, die alles geben und gegen alle Widerstände zum Ziel kommen. Aber in diesem Fall würde sie auch einen wunderbaren Schauspieler auszeich-nen, der zu einer großen Rolle gefunden hat. And the Oscar goes to: Wrrrrrrrooooaammmm!KATJA NICODEMUS
Deutscher Fernsehpreis: Comédie humaine
DerErregteZum Tode des Schauspielers
Walter Schmidinger, der seine
überwältigende Kunst aus dem
Geist der Nervosität schöpfte
Wie gut, dass es all die zu-verlässigen Theaterspie-ler gibt, die montags den Kapitalisten spielen, dienstags einen einge-bildeten Kranken – und am Donnerstag gehen
sie zum Segeln. Und wie wundervoll, dass wir daneben die Verrückten und Besessenen haben, die Unwägbaren, diese Schrecken der Spielplan-disponenten: jenen kleinen Trupp von Kipp-figuren, die auf der Horizontlinie ihrer Existenz balancieren, wie hellwache Schlafwandler – je-derzeit gefährdet durch einen Anruf aus der All-
tagsbanalität; denn dann zersplittert ihr hoch-gespanntes Nervengerüst, sie zerbröckeln und stürzen. Doch erst mit solchen Schauspielern ist Theater wirklich »live«, ihretwegen vor allem gehen wir (unsererseits vorfreudig, vorängstlich bebend) in eine Vorstellung, bei der wir zu er-
regten Zeugen werden beim mysteriösen Ge-bärvorgang von »Kunst«.
Das klingt scheußlich pathetisch – aber erstens kommen wir beim Nach-Denken über Walter Schmidinger ohne den Begriff des Pathetischen nicht aus, zum andern trifft es einfach zu: Dieser wundersame Theatermensch litt, was jeder wuss-te, unter manischen Depressionen, brach zusam-men, fuhr aus der Haut, zitterte hocherregt und tief verletzt, ein aufgestörter Geist, rollengierig und zerrissen von Ängsten – und so war es stets ein Drahtseilakt, wenn er auftrat, vibrierend bis in die Stimmbänder hinein, mit schleudernden Schlaksbewegungen und einer Mimik wie eine Geisterbahn: Eben noch aus fahlem Gesicht sar-kastisch die Silben spuckend über seine runter-hängende Lippe, schoss ihm die Zornesröte ein, und er schraubte sich in einen bebenden Diskant. Ja freilich, das war das österreichische Mimenwe-sen, gefährdet durch Pathos und Schmiere, bei ihm aber beglaubigt durch den lodernden Fla-ckerblick, seine den Wahnsinn streifende Erre-gung, das spürbar Durchlittene der Höhen wie der Tiefen. Wir zitterten mit ihm und um ihn, wussten manchmal, dass der Arzt in den Kulissen stand, »für alle Fälle«. Und doch war es nicht Skandallust, die im Zuschauerraum lauerte (ich rede hier von seinen erfolgreichsten, den frühen Jahren in München zwischen 1969 und 1982, wo er drei Jahre an den Kammerspielen, dann zehn
am Residenztheater war); es war das Zittern mit ihm, so wie man bei Sängern ums hohe C bangt, wie man als Zuschauer Angst vor einem Hänger hat und desto glücklicher wird, wenn der Spieler dort droben es packt; denn jeder weiß: Der da lügt uns nicht an, selbst wenn er lustvoll in die Mimen-Trickkiste greift. Er zeigt seine Wunden, theatralisch, aber mit wahrer Leidenschaft.
Als er (der in Linz zum Tuchhändler ausgebil-det worden war) in Luc Bondys Inszenierung des Edward-Bond-Dramas See einen von einer Kun-din (Lola Müthel) geschurigelten Tuchhändler spielte, war sein Körper so gestrafft, das Vokabu-lar der Beflissenheit derart atemlos ins Beben vorgetrieben, dass man um ihn nicht weniger als um die Kundin zitterte: Hinter der langen The-ke, vor den Tuchballenregalen tanzte er, von Er-niedrigung gebeutelt, ein mechanisches Ballett mit Stoffen, Scheren, Verbeugungen. Man sah, wie aus Demütigung Mordlust brodelt.
Natürlich waren seine tollsten (ja, seine toll-sten) Rollen die der Zerrissenen, der eingebildet Kranken, der Schwierigen – die österreichischen Zwielichter bei Horváth, Bernhard, Nestroy. Gut gewählt der Titel für seine Lebenserinnerungen, Angst vor dem Glück, die so beginnen: »Wenn ich ins Theater gehe, hoffe ich immer, dass ich etwas sehe, was ich noch nie gesehen habe.« Uns hat er die Augen für viel Unerhörtes und nie Gesehenes geöffnet. MICHAEL SKASA
die aus der Abhängigkeit von den Ämtern nicht herauskommt: Die Milieus könnten bei aller räumlichen Nähe kaum weiter voneinander ent-fernt sein. Hautnah, mitlachend und -leidend, erlebt man, wie Kinder aufwachsen, Ehen ent-gleisen, Wünsche scheitern, Hoffnungen über-dauern; wie unterschiedlich die Menschen Ent-scheidungen fällen und wie oft sie die Signale ihrer Krankheiten übersehen. Sichtbar wird aber auch ein West-Kiez, der sich nach der Wende zum Hauptstadtquartier aufmotzt; sichtbar wird, wie Arbeitsweisen nach und nach verschwinden. Fasziniert schaut man zum Beispiel dem Bäcker Gerd Dahm beim Kneten, Rollen, Blecheschie-ben zu – bis er aufgibt. Auch sonst scheint sein Leben (wie das aller anderen) im Korsett der Fa-milie, der sozialen Prägungen und politischen Einflüsse nur »in Maßen gestaltbar« zu sein, wie es Claudia Lenssen im Begleitbuch formuliert.
Gumm und Ullrich: Seit vier Jahrzehnten arbeiten der Regis-seur und der Kameramann zu-sammen. Ihre größte Fähigkeit ist es, Vertrauen zu gewinnen. Doch bei aller Nähe bleiben die Preis-träger stets distanziert genug, um ihren Figuren gegenüber Respekt zu wahren und deren Selbstbetrü-gereien nicht auf den Leim zu ge-hen. Ohne Wackelkamera und schnelle Schnitte konzentrieren sich die Filmemacher ganz darauf, zu fragen und zu beobachten.
So konnte im Kleinen eine gro-ße Comédie humaine entstehen. Ihre Arbeit gleicht der von Honoré de Balzac, der auch schon den »ständigen, täglichen, geheimen
oder offen zutage liegenden Tatsachen, den Handlungen des individuellen Lebens, ihren Ursachen und ihren Prinzipien« die gleiche Bedeutung beimessen wollte wie »die Histori-ker den Ereignissen des öffentlichen Lebens der Nationen«.
In der Geschichte des Fernsehens ist diese Anstrengung nur mit der Langzeitdokumenta-tion Die Kinder von Golzow aus der DDR ver-gleichbar. Neun Filme gibt es auf DVD, das ganze Material haben Gumm und Ullrich der Deutschen Kinemathek übergeben. Auch die Studenten künftiger Jahrzehnte werden es ih-nen danken. CHRISTIANE GREFE
Walter Schmidinger (* 28. 4. 1933 – † 28. 9. 2013)
Noch unvernarbt: Daniel Brühl als Niki Lauda in dem Film »Rush«
Darf sich endlich freuen: Markus Hinterhäuser
Jahrhundert-Beobachter: Die Dokumentarf ilmer Hans-Georg Ullrich (links) und Detlef Gumm
Foto
s: F
ran
ke/
pic
ture
-alli
ance
/d
pa
(o.)
; N
eu
may
r/p
ictu
re-a
llian
ce/
dp
a (r
.);
Stu
dio
Can
al/
Cin
ete
xt/
Alls
tar/
Un
ive
rsu
m F
ilm [
M];
Ullr
ich
/W
DR
/p
ictu
re-a
llian
ce/
dp
a (u
.)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 FEUILLETON 47
Botin der ZukunftDas Medienbild der jungen Frau steht nicht für Weiblichkeit,
sondern für Jugend. Sie ist die Expertin für alles, was die Alten
fürchten oder nicht mehr verstehen wollen VON NINA PAUER
Facebook ist so ein Beispiel. Davon soll sie, die junge Frau, immer wieder erzählen. Klicken, chatten, liken – aus einem solchen Kosmos komme sie doch schließlich, von dort könne sie berichten, dafür ist sie da, hierzu lädt man sie ein. Die
Rolle des digital native wird der jungen Frau in Talkshows besonders gerne überlassen; hier kommt ihr exotisches Expertentum am schönsten zur Geltung.
Natürlich kann sie auch jedes andere Thema, Hauptsache nur, sie erzählt darüber, wie es sich lebt dort drüben, im Anderswo, diesem span-nenden, immer auch etwas bedrohlichen Land nach unserer Zeit, das für die junge Frau schon lange Gegenwart und Heimat, fürs ältere Publi-kum aber noch Zukunft ist, eine unbekannte Fremde, die allerdings so rasend auf die Gesell-schaft zusteuert, dass man auf Ortskundige drin-gend angewiesen ist. Wer könnte es besser ver-mitteln als die junge Frau?
Keine Frage: Sie ist die mediale Leitfigur unserer Tage. Doch das, worum man sich schart, wenn man ihr in Sendungen, Diskus-sionsrunden, Konferenzen und Bürofluren das Wort erteilt, ist nicht die Stimme ihrer Weib-lichkeit. Es ist die Stimme ihrer Jugend. Die junge Frau ist eine Repräsentantin, nicht für sich allein spricht sie, sondern für alle: die jun-gen Menschen.
Der Jungmensch, nicht das Mädchen, ist der edle Wilde unserer Tage. Von der Öffentlichkeit herbeigesehnt und eifrig herangezerrt, tritt er zwar häufig weiblich auf. Wirft man aber einmal nicht alle Frauen des öffentlichen Lebens zwi-schen Abitur und Rente zusammen, ist das ei-gentlich Exotische an der jungen Frau das Junge. Ihm gilt das zoologische Interesse, medial tra-diert ist es nichts als der immer gestresstere Im-perativ »Wir müssen uns verjüngen«, der durch alle Teilsysteme der Gesellschaft gellt und zu ei-nem blinden Jugendfetisch mutiert ist. Überall, nicht nur in den Medien, auch in den Institutio-nen, wird nach dem selbstbewussten jungen Er-wachsenen gesucht, anders als früher drängelt er sich ja nicht selbst vor, sondern muss mühsam herangeholt werden.
Aber wenn er dann einmal da ist? Dann soll er nicht einfach mitmachen, er soll sich perma-nent erklären, sich und seinesgleichen – und da-mit die ganze Welt. »Wie lebt es sich bei euch, in der postpolitischen, postmodernden, postpost-modernen Gesellschaft? Wie kommt ihr eigent-
lich klar, da drüben, in eurem neuen Zeit-alter, in dem kein Stein mehr auf dem
anderen liegt? Und wo steuert der ganze Laden hin?«
Fragen, die sich die Wissbe-gierigen genauso gut selbst stel-len könnten. Schließlich leben
die 40-, 50-, 60-jährigen Mode-ratoren, Vorgesetzten und Politiker
ebenso mittendrin wie die 30- oder 20-Jähri-gen, die sie nun als Experten auf die Bühne rufen. In einer Gesellschaft, in der die Men-schen bis ins Rentneralter mit Chucks an den Füßen, Ray-Bans auf der Nase und iPhones in den Händen herumlaufen und damit jeder
zwischen Stimmbruch und Hörgerät als ju-gendlich gelten kann, gibt es anscheinend den umso größeren Wunsch, die Grenzen einmal klarzustellen. Mit einer Geste der aufrichtigen Annäherung hat es jedenfalls nicht viel zu tun, wenn man laufend an die Fremdheit zwischen den Generationen erinnert – »Was sagen denn unsere jungen Leute dazu?«. Es ist eine feindli-che Umarmung, in die sich der junge Mensch gedrängelt sieht, und er lässt es oft genug mit sich machen. Manche erfüllen die Rolle schließlich auch gerne, immerhin dient sie als willkommenes Selbstvermarktungstool.
Ein merkwürdiger intergenerationeller Scheindialog entsteht dabei. Es wird viel gere-det, aufmunternd genickt und die Stirn gerun-zelt – am Ende lachen die Älteren, »Kinder, das ist wirklich nicht mehr meine Welt«, und zie-hen sich auf ihre privilegierten Posten zurück, denn es ist eben doch noch ihre Welt. Und sie wird es noch lange bleiben.
Ist er nun vegan oder nicht? Der junge Mensch soll eine Einheit bilden
Wie wenig der junge Mensch aus der ihm zu-gewiesenen Rolle herauskommt und auch, wie wenig er aus ihr herausdrängt, zeigte jüngst die Bundestagswahl. Die Inszenierung im Fernsehen war die klassische: Vorab durfte eine junge Frau erklären, dass ihre Lebenswelt mit den politischen Parteien in Deutschland rein gar nichts mehr zu tun habe; wie im Klischee festgefroren wurde nach Urnenschluss ihr männliches Pendant zu-geschaltet, mit Bart, Brille, Baumwolljacke durfte dieser offensichtliche Jugendexperte aus einem geschäftig-futuristisch wirkenden »Newsroom« sinnfreie Häppchen aus den Weiten der »Online-aktivität« von Millionen »Usern« aus dem »Kurz-nachrichtendienst« Twitter verlesen. Dann wurde weitergeschaltet.
Mediale Gastauftritte, kurz und möglichst immer allein, nicht als Gruppe, da sich reale Heterogenität schlecht mit dem Klischee ver-trägt. Nur kurz kam Überraschung auf: Hatte der junge Mensch nicht gerade gesagt, er gehe nicht mehr wählen? Hatte er nicht verkündet, Politik interessiere ihn und seine Gleichaltrigen schon lange nicht mehr? Wieso in Gottes Na-men hatte er jetzt nun doch wieder nicht die Piraten gewählt, die für seine verrückten Ge-danken von Netzwerken, Co-Working, Car-sharing, Post-Gender, polyamouröser Identität und Nerd-Haltung doch so gut zu ihm passten?
Erkenntnisse wie die, dass »der« junge Mensch nicht eine Einheit, sondern sowohl vegan als auch fleischessend, sowohl kinderlos als auch Fa-milienplaner, sowohl Wähler als auch Nichtwäh-ler sein kann, sind Gift für diejenigen, die ihn nur als Quotenkasper und Stellvertreter des Neu-en inszenieren, vor dem man sich gruseln, das man empathisch benicken kann, aber am Ende doch nicht an sich heranlassen muss. Als Leit-ideal soll der Jungmensch gerade nicht identifi-kationsfähig werden, als prophetisches Orakel und mediales Maskottchen funktioniert er dann nicht mehr.
Sonst wäre er ja ein normaler erwachsener Mensch, und mit dem müsste man normal reden.
In der vergangenen Woche haben sich zwei noch halbwegs junge Männer in einem Fernsehstudio mit allen An-zeichen größter gegenseitiger Wohl-gefälligkeit in das Spektakel eines Meinungsdisputs hineingesteigert. Das Gespräch drehte sich um die
Mühen der Koalitionsbildung. Im Studiohin-tergrund hing ein Plakat, auf dem man lesen konnte, worüber gestritten wurde: »Keiner will mit Mutti«. Mutti hat die Wahlen überlegen gewonnen. Und jetzt sitzt Mutti allein da, und keiner will ihren selbst gebackenen Apfelku-chen essen. Eine verrückte Geschichte, über die sich die beiden straff gescheitelten Journa-listen an der Studiotheke sehr erheiterten.
In einem Land, in dem ein Mann schon nach ein paar Fußballtoren oder ein paar einprägsa-men Literaturkritiken zum Kaiser oder Papst ausgerufen werden kann, ist die mächtigste Frau der europäischen Nachkriegsgeschichte über Nacht zur Mutti geworden. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die Mutti-Szene Teil des Unterhaltungsjournalismus ist, den Jakob Aug-stein und Nikolaus Blome im Fernsehen be-treiben, kann man auf die Idee kommen, dass die medialen und politischen Frauenbilder, die in Deutschland im Umlauf sind, erstens noch immer unfassbar altbacken und zweitens von Männern gemacht sind.
Das Repertoire klemmt fest zwischen Fräulein und Matrone
Keine Frau – und sei sie so mächtig wie die deutsche Bundeskanzlerin – entkommt der männlichen Kommentarmaschine, in der ihr öffentliches Bild entsteht. Es war ja nicht die Kanzlerin selbst, die sich als Mutti in Szene setzte. Es sind auch nicht die jungen Frauen selbst, die – wie Thomas E. Schmidt hier vor einer Woche schrieb – sich einer ihrer selbst überdrüssigen Herrenwelt als Sym-bolfiguren einer »wohlgefälligen Rebellion« (ZEIT Nr. 40) angedient haben. All dies sind männliche Zuschreibungen, es sind Bilder ei-ner von Männern »imaginierten Weiblich-keit«, wie ein berühmter Buchtitel aus alten frauenbewegten Zeiten einmal hieß.
Wir müssen also feststellen: Das Repertoire der umlaufenden Weiblichkeitsbilder ist auch nach dem Zeitalter von Queer, Pop, Madonna, Valie Export und Charlotte Roche merkwürdig zwangsjackenhaft. Zwischen Fräulein und Ma-trone lässt die männliche Blickordnung noch immer keinen großen Verhandlungsspielraum, die Mädels von heute müssen damit rechnen, übergangslos zur Mutti von morgen zu mutieren.
Beide Zuschreibungen stammen aus der Mottenkiste deutscher Kulturgeschichte. Spricht die junge Frau, so spricht die Repräsentantin einer Seinsweise, die der deutsche Idealismus wahlweise für die alten Griechen oder die jungen Weibsbilder reserviert hatte: die edle Einfalt. Schillers Lob der jungen Frauen mag in seiner Wortwahl ein wenig in die Jahre gekommen sein – »Aber in kindlich unschuldiger Hülle / Birgt sich der hohe geläuterte Wille / In des Weibes verklärter Gestalt. / Aus der bezaubernden Ein-falt der Züge / Leuchtet der Menschheit Voll-endung und Wiege, / Herrschet des Kindes, des Engels Gewalt« –, doch noch immer entkommen die wenigsten jungen Frauen, die sich in den klassischen Berufsfeldern holder Weiblichkeit wie Schauspiel, Gesang, Salon (heute Talkshow) her-vortun, solch männlicher Verklärungsbereit-schaft. Und die wenigsten schaffen es überhaupt vom Mädel zur Mutti – noch sind die deutschen Talkshow-Königinnen alle unter 50, und die, die es nicht mehr sind, haben ihre Plätze räumen müssen oder sind wie Amelie Fried, 55, Elke Heidenreich, 70, und Sabine Christiansen, 56, anderweitig unabkömmlich.
»Die Welt wird enger mit jedem Tag«, sagt die Maus bei Kafka. Für das öffentliche Typen-repertoire des Weiblichen gilt das noch mehr als für die Mäuse. Was wäre heute ein weibliches Rollenvorbild? Im Augenblick ist es in etwa bei
Kati Witt stehen geblieben, deren phänotypische Wiederkehr auf der politischen Eisfläche von Katrin Göring-Eckardt, 46, und Sarah Wagen-knecht, 44, besorgt wird. Figuren ambivalenter bis kraftvoller Weiblichkeit wie Greta Garbo, Marlene Dietrich oder auch nur Hildegard Knef (als Berliner Lokalausgabe der Garbo) sind im gegenwärtigen Mädel-und-Mutti-Deutschland kaum durchsetzbar.
Dennoch gibt es neben den klassischen weib-lichen Rollenfächern des jungen Mädchens und der reiferen Mutter auch Bilder selbst imaginier-ter Weiblichkeit. Sie haben sich seit den frühen lila Latzhosenzeiten, an die sich Ältere noch er-innern mögen, deutlich verändert. Ihr Spektrum reicht von der geschlechtsneutralisierten Anzug-trägerin bis zu den barbusigen Femen und den Porno-Parodistinnen der Schlampenmärsche.
Beide Extremtypologien des weiblichen Selbstentwurfs sind seit einiger Zeit sehr erfolg-reich: die Nackte und die Vermännlichte. Doch beide entkommen der vom Mann imaginierten Weiblichkeit nur durch rabiate Manöver. Die eine durch folgsame Überassimilation, die an-dere durch parodistische Übererfüllung. Die eine, indem sie sich in Kleidung, Auftreten und Körpersprache selbst als Mann zweiter Wahl entwirft. Die andere, indem sie sich freiwillig nackt und blumenumkränzt zum karnevalesken Sexobjekt des Mannes stilisiert. Die erste Va-riante wird im Wirtschaftspatriarchat besonders belohnt und bevölkert jeden Morgen die Ab-flughallen der Flughäfen und die Erste-Klasse-Abteile der ICEs. Die zweite Variante schafft es immerhin auf die Titelseite der Magazine. Beiden Varianten ist gemeinsam, dass sie die Frau als latent kinderloses, zu subtiler Erotik und eigenständiger Weiblichkeit unbegabtes Wesen in Szene setzt – als blondgefärbte, fit-nessgestählte Amazone oder als Mann mit Hals-kette und Föhnfrisur.
Die Femen, zurzeit so ziemlich die Avantgar-de des europäischen Feminismus, protestieren überall auf der Welt, vor Wladimir Putin wie vor Heidi Klum, gegen Sexismus, Frauenunterdrü-ckung und Diktatoren. Sie setzen sich ein für die jungen russischen Frauen von Pussy Riot, die man wegen einer Performance wie zu Stalins Zeiten in sibirischen Zwangslagern weg-schließt. Sie protestieren gegen die Barbie-Industrie, gegen Pros titution und Mäd-chenhandel. Sie sind die radikalste Frau-enbewegung seit Langem, und das Gerücht, dass die Femen nichts als die Erfindung ei-nes einzigen Mannes gewe-sen sein sollen, gehört zu den reflex-artigen Reaktionen, die eine derartig erfolgreiche Frauenbewegung hervorruft. Alice Schwarzer hat – nachdem der deutsche akademi-sche Gender-Feminismus sich in ihren Augen in ohnmächtige Unverständlichkeit verabschiedet hat – die jungen gepiercten, superschlanken Frauen aus Osteuropa als Erbinnen ihres Lebens-werks begrüßt, in deren Geradlinigkeit und Klarheit sie sich selbst als junge Feministin und Agitatorin offenbar wiedererkennt.
Doch haben das laute Schreien, die nackte Haut, mit der die Femen gegen das junge Frauen verschlingende Patriarchat kämpfen, auch ver-zweifelte Züge. »Als Frau, als junge Frau, als in-telligente Frau werde ich nicht gehört«, sagt die Femen-Frau Anna Schmidt aus Berlin-Pankow. Erst wenn sie sich auszieht, wird man auf die Frau aufmerksam, die sie gern sein will – die Wütende, Schrille, Aggressive. Dann ist sie nicht länger die junge Frau, wie die Männer sie mögen – die Sanfte, Schöne, bezaubernd Einfältige.
Gegen das Mädel-und-Mutti-Frauenbild werden die nackten Busen der jungen Femen allein noch wenig ausrichten. Das Drehbuch für einen zeitgemäßen Feminismus muss noch ge-schrieben werden. Ein paar ganz neue Rollen für Frauen wären dabei vielleicht nicht schlecht.
Mädel oder Mutti
Die Rollenbilder für Frauen in Medien und Politik
sind so eng wie schon lange nicht mehr. Wirklich aufregende
Entwürfe einer neuen Weiblichkeit fehlen noch VON IRIS RADISCH
Die
Frauendebatte
Die junge Frau ist im Augenblick unser gesellschaftliches
Leitbild. Sie symbolisiert die Zukunft, als einen »Ort des Ehrlichen,
Gradsinnigen, noch nicht Vordefinierten« –
das schrieb Thomas E. Schmidt, 54, in der
ZEIT vom 26. September. Aber die
junge Frau ist noch viel mehr.
Für Nina Pauer, 31, ist sie die Abgesandte aus
dem unbekannten Land des Digitalen – genau wie
der junge Mann.
Iris Radisch, 54, vermisst den furchtlosen
weiblichen Selbstentwurf – bei der jungen und der
alten Frau.
»Aus der bezaubernden Einfalt der Züge leuchtet der Menschheit
Vollendung und Wiege« dichtete der Frauenverklärer Schiller – natürlich
nicht über die junge Anne Will
Foto
[M
]: a
do
lph
pre
ss (
u.)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4148 FEUILLETON
»Es geht an unsere Substanz«
Für die Filmförderung müssen auch die Kinos zahlen. Jetzt wehrt sich ein
Betreiber mit einer Verfassungsklage. Was steht auf dem Spiel?
Ein Gespräch mit Iris Berben über den deutschen Film
DIE ZEIT: Frau Berben, am 8. Oktober werden Sie als Präsidentin der Deutschen Filmakademie in Karlsruhe dabei sein,
wenn die Entscheidung des Bundesverfassungs-gerichts über die Zukunft des Filmförderungs-gesetzes fällt. Haben Sie Angst vor diesem Tag? Iris Berben: Natürlich macht mich dieses Datum unruhig. Die ganze Branche ist extrem verunsi-chert. Wenn eine der wichtigsten Säulen der Film-förderung wegbricht, hätte das für uns einschnei-dende Konsequenzen. Es geht an unsere Substanz – sowohl an die der Produktionen als auch an die der Kinos. ZEIT: Was hieße das konkret?Berben: Das Ende der Vielfalt. Vor 45 Jahren ha-ben sich in diesem Land ein paar Leute zusam-mengeschlossen, die sich gesagt haben: So geht es nicht weiter, der deutsche Film, das muss mehr sein als der Schulmädchen-Re-port. Daraus ist das erste Ge-setz zur Filmförderung ent-standen. Sollte der 8. Oktober für uns wirklich ein schwarzer Tag werden, könnte man überspitzt sagen, dass wir wie-der bei der Einseitigkeit lan-den, die in Schulmädchen-Re-port-Zeiten herrschte. Viele kleinere Kinos müssten schlie-ßen, da sie etwa beim Umrüsten auf technische Neuerungen auf Fördergelder des Fonds mit an-gewiesen sind. Und vor allem gäbe es weniger Fil-me. Ohne eine Wertung vornehmen zu wollen: Es blieben immerhin die von Til Schweiger, Matthias Schweighöfer und Bully Herbig übrig. ZEIT: Sind Sie nicht auch unruhig, weil die Argu-mente der Gegenseite nachvollziehbar sind? Es klingt doch nur fair: Warum sollen internationale Kinobetreiber den deutschen Film unterstützen, wenn sie fast nur amerikanische Filme zeigen?Berben: Klar, ich kann diese Argumentation ver-stehen. Bei multinationalen Konzernen kommt man wohl mit unseren Gedanken des Einstehens füreinander nicht so weit. Aus einer rein neolibe-ralen Sichtweise wäre die Einstellung der Abgabe vielleicht eine zu begrüßende Marktbereinigung. Allerdings eine, die eine Riesensauerei hinterlassen würde. Das Kino hat doch eine gesellschaftliche Aufgabe: Es ist genau wie das Fußballstadion ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um Gemeinschaft zu erleben, um miteinander zu dis-kutieren und zu streiten. Das ist ein wertvoller Teil von uns. Und: Auch die internationalen Kinobe-treiber kommen für ihre Kinos in Deutschland in den Genuss der Förderung.ZEIT: Bei der anstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geht es auch darum, dass die Pflichtabgaben an die Filmförderungsan-stalt rechtlich als Wirtschaftsförderung gelten – nicht als Kulturförderung, mit der Sie argumen-tieren. Und Kultur ist Ländersache – und kann nicht durch Bundesgesetze gefördert werden. Berben: Das Gesetz besagt: Die Aufgabe der Film-förderungsanstalt ist es, Wirtschaftlichkeit und Qualität des deutschen Films zu unterstützen. Im Jahr werden zehn Milliarden Euro durch die Pro-duktion von deutschen Kinofilmen umgesetzt. Damit wird ja nicht nur der Film, sondern eine gesamte Infrastruktur gestärkt: Arbeitsplätze wer-den geschaffen, Produktionsfirmen, Verleihe, Vi-deobuden und die Kinos profitieren. Reine Wirt-schaftlichkeit – generiert über ein Produkt mit kultureller Substanz. Kino ist immer Wirtschaft und Kultur zugleich.ZEIT: Wäre das Ihre Botschaft an die Kläger: eine gemeinsame Kulturindustrie, die sich gegenseitig unter die Arme greifen muss?Berben: Natürlich können wir Solidarität nicht er-zwingen. Wir können sie von Leuten, die auf ab-gesicherten Positionen sitzen, nicht einfordern. Es ist ihr gutes Recht zu sagen: Mit dem deutschen Film haben wir nichts am Hut, dafür wollen wir nicht bezahlen. Es hätte wohl vielmehr etwas mit Anstand zu tun. Aber ehrlich gesagt: Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kinos bei einem kon-stanten deutschen Marktanteil von 20 Prozent und mehr ganz ohne die geförderten deutschen Filme auskommen. All das werden hoffentlich auch die obersten Richter in Karlsruhe sehen und in ihre Entscheidung einfließen lassen.ZEIT: Idealisieren Sie die Filmförderung nicht? Es gibt ja auch Missstände: Vor allem die Abhängig-
keit des deutschen Kinos vom öffentlich-rechtli-chen Fernsehen. Kaum ein Film kann ohne einen Sendeplatz realisiert werden, und die Gesichter im Kino sind die, die wir aus dem Fernsehen kennen. Berben: Die Kinobranche braucht das Fernsehen, aber das Fernsehen braucht auch uns. Als ich Ende der Sechziger eine Fernsehrolle übernahm, bedeu-tete das damals das Ende meiner Kinokarriere. Ich wurde einfach nicht mehr besetzt. Heute ist es genau andersrum. Für Kinofilme werden am liebsten Schauspieler aus dem Fernsehen genom-men, weil sie schon populär sind. Das deutsche Kino muss wieder selbstbewusster werden: Mehr Filme müssen in die Primetime. Und zwar nicht nur diejenigen, die schon an der Kasse gut gelau-fen sind. Sondern auch die sperrigen, die dem Zu-schauer etwas anderes geben als der Mainstream. ZEIT: Gibt es eine schützenswerte Identität des
deutschen Filmes jenseits des Mainstreams? Und warum hat er es so schwer?Berben: Rein wirtschaftlich, weil der heimische und der internationale Markt deutlich begrenzt sind. Außerdem ha-ben wir in Deutschland ein enges Überprüfungssystem, bei dem jeder, der einen Film dreht, sich in zwanzig Talk-
shows erklären und rechtfertigen muss. In Frank-reich, dem großen Kinoland, wird der Filmmarkt viel stärker gesteuert und geschützt. Es gibt eine Quote für einheimische und europäische Produk-tionen, und am Mittwoch, Freitag und Samstag zeigen die staatlichen Sender keine Kinofilme, um Zuschauer vom Sofa in die Kinos zu locken. ZEIT: Ein Vorbild?Berben: Eine Anregung. Wir Deutschen reagieren bei Reglementierungen erst mal ablehnend. Eine Quote könnte der Einzigartigkeit des Kinos hel-fen. Insbesondere in Zeiten, in denen das Kino mit Laptops, Tablets und Smartphones noch eine ganz neue Konkurrenz erlebt. ZEIT: Wie kann man dem begegnen?Berben: Wir werden uns dafür einsetzen, dass die großen Internetunternehmen wie die Deutsche Telekom kräftig in die Fördertöpfe einzahlen. Es kann doch nicht sein, dass sie nur von unserem Kulturgut, von unseren Inhalten profitieren, aber nichts für dessen Voraussetzungen tun. Doch wir müssen einen Schritt nach dem anderen gehen. Erst mal kommt der 8. Oktober. Und dann müs-sen wir selbstkritisch über – durchaus auch neue – Wege nachdenken, die Zukunft zu gestalten. ZEIT: Pro Jahr starten im Schnitt 150 deutsche Filme im Kino, eine Masse, die viel Mittelmaß enthält und von der nur wenige Filme, meist ro-mantische Komödien, erfolgreich sind.Berben: Aber genau diese Vielfalt müssen wir er-halten, die brauchen wir, denn aus ihr entstehen die Perlen, die es gilt, herauszupicken. Das Weiße Band, Vincent will Meer, Die Kriegerin, Oh Boy– das sind alles außergewöhnliche deutsche Fil-me, die ohne die Filmförderung nicht realisiert worden wären. ZEIT: Das sind Ausnahmen, nicht die Regel. Berben: Ausnahmen bestätigen doch die Regel. Keine Frage, es ist zu oft zu langweilig im deut-schen Film. Das liegt aber nicht am Förderungs-system, sondern letztlich auch am Zeitgeist. Neh-men Sie die Bundestagswahl: Dieses Land hat sich in seiner Bequemlichkeit behaglich eingerichtet. ZEIT: Ein gesellschaftlicher Zustand, den der Film doch künstlerisch konterkarieren müsste?Berben: Sicher. Aber es gibt nun einmal nicht jedes Jahr den großen neuen Filmemacher. Nicht jedes Jahr entdecken wir einen neuen Klaus Lemke, einen neuen Christian Petzold. Aber umso stärker muss Ausschau gehalten wer-den nach ihnen. Doch allein im letzten Jahr haben junge kreative Filmemacher wie David Wnendt und Jan-Ole Gerster auf sich aufmerk-sam gemacht. Auch das Publikum kennt sie jetzt. Aber wir brauchen noch mehr Mut. Wir brauchen wache Verleiher, Förderer, Filmema-cher, Schauspieler. Sie sind die Hoffnung des deutschen Kinos. Genau für das, was von ihnen erdacht und produziert wird, ist die Filmförde-rung da.
Das Interview führten NINA PAUER und KILIAN TROTIER
FilmförderungsgesetzWorum es in der Verfassungsbeschwerde des Kinobetreibers UCI geht
E s ist ein Schicksalstag für den deutschen Film, auch wenn sich die Mitteilung im Juristendeutsch des Bundesverfassungs-
gerichts nicht besonders alamierend liest: »Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts ver-handelt am Dienstag, 8. Oktober 2013, 10:00 im Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts, Amts-sitz ›Waldstadt‹, Rintheimer Querallee 11, 76131 Karlsruhe über vier Verfassungsbeschwerden, die sich gegen die Heranziehung zur Filmabgabe nach §66 Filmförderungsgesetz (FFG) richten.«
Die Deutsche Filmförderungsanstalt (FFA) ver-teilt, dem Gesetz folgend, jährlich 76 Millionen Euro an die hiesige Filmwirtschaft. Das Geld kommt aus Abgaben auf die Filmverwertung: von Kino-betreibern, Fernsehanstalten, DVD- und Online-anbietern. Es gelangt über zwei Wege an die Film-schaffenden: zum einen durch das Referenzprinzip, das den Zuschauererfolg belohnt, aber auch die Festivalteilnahmen und andere Auszeichnungen. Und zum anderen durch das Projektprinzip, nach dem eine Produktion vorab gefördert wird.
Doch nun stellt einer der Abgabenzahler das Gesetz infrage: Ein Kinobetreiber, die einer Londo-ner Investmentgesellschaft gehörende UCI-Gruppe und drei ihrer Schwestergesellschaften haben Ver-fassungsbeschwerde eingereicht. Zum einen geht es um ihren Beitrag als Kinokette: Zwischen 1,8 und 3 Prozent des Jahresnettoumsatzes muss jeder Kino-saal ab einer bestimmten Auslastung als Filmabgabe zahlen. Das wichtigste Argument der UCI: Man zeige überwiegend ausländische Filme, vor allem aus den USA, wodurch eine Förderung des deutschen Films nicht gerechtfertigt sei. Darüber hinaus stellt die UCI aber die demokratische Legitimation der Filmförderung insgesamt infrage: Der Bund habe sich vor 45 Jahren geirrt, als er das Gesetz auf den Weg brachte Film sei Kultur- und nicht Wirt-schaftsgut, daher Filmförderung auch Kulturför-derung und somit Ländersache. Das Verfassungs-gericht wird sich am 8. Oktober auch mit der grund-sätzlichen Frage beschäftigen müssen, ob die kultu-rellen und die wirtschaftlichen Anteile des deut-schen Films zu trennen sind. KATJA NICODEMUS
»Das Kino hat doch eine gesellschaftliche Aufgabe. Kino ist immer Wirtschaft und Kultur zugleich«
Die Schauspielerin Iris Berben istPräsidentin der DeutschenFilmakademie
Foto
: Jim
Rak
ete
fü
r D
IE Z
EIT
/P
ho
tose
lect
ion

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 FEUILLETON 49
Immer wieder haben Theaterleute sich an Stücke von Shakespeare gewagt und ne-benbei zugegeben, sie begriffen Shake-speare gar nicht. Als Jan Lauwers vor ei-nigen Jahren den Sturm am Hamburger Schauspielhaus inszenierte, sagte er vor-ab: »Das Erste, was mich beim Lesen
überfällt, ist die Erkenntnis: Ich verstehe kein Wort.« Lauwers ließ sich von diesem Mangel nicht abschrecken, sein Ehrgeiz ging nun dahin, heraus-zufinden, was von Shakespeare bleibt, »wenn man die wundervolle Sprache wegschmeißt«. Was blieb, war: Shakespeare-Gebrabbel.
Beispielhaft für den »Zugriff« auf Shakespeare war auch Michael Thal-heimers Hamlet am Thalia Thea-ter Hamburg (2008): Text war in diesem Spiel kein Trä- ger von Bedeutung, sondern bloß ein Garn, das um die Figuren gespult war und das man loswerden musste, um an die nackten rotie-ren- den Charakterspindeln he-
ranzukommen. Sprechen bedeu-tete: Textentledigung; die Spieler
waren Ventile, durch die er davonzisch-te. Thalheimer verhöhnte die (vergebliche?)
Überbrückungsleistung, die darin besteht, sich spielend zu Shakespeare durchschlagen zu wollen.
Schaut, wie überfrachtet ist dieser alte Text, sagte er, und seine Spieler schüttelten die Wörter mit wütenden Zuckungen ab – so, wie Hunde sich die Flöhe aus dem Fell schütteln. Schaut, wie blöd ist dieses komplizier-te Ende mit den vielen Toten, sagte Thalheimer und zeigte einen mechanischen Klamauk: Der Kampf zwischen Hamlet und Laertes war bloß ein Tanz der Todeshampelmänner.
Ganz anders, ja das völlige Gegenteil, ist nun, fünf Jahre später, der Hamlet, den Andrea Breth am Wiener
Burgtheater inszeniert. Er wird fast ungekürzt gespielt, er dauert sechs Stunden. Der Überbrückungsversuch zurück (hinauf) zu Shake- speare hat das Format eines Staatsbesuchs: Die erste Regis- seurin des deutschen Thea- ters macht sich auf, das be- deutendste Stück des Welt-
theaters zu inszenieren. Breths Ehrgeiz zeigt sich exemplarisch in der
Fechtszene am Ende: Sie nimmt den Kampf so ernst, als entscheide sich in ihm das
Glück der Inszenierung, es fliegen Funken, im Zorn befreunden die Feinde Hamlet und Laertes, die mal Vertraute waren, sich erneut: Sie erkennen sich, während sie einander vernichten. So wird in Wien um jeden Theatermoment gerungen: als hänge an ihm der Fortbestand einer Welt.
Auch hier dient Thalheimers Hamlet als Gegen-beispiel: Bei ihm gab es keine Kämpfe ums Ganze, denn es war schon alles verloren. Thalheimer erweck-te nie den Eindruck, auf der Bühne finde »Gegenwart« statt, man sah nur seinen Kommentar zur Theater-geschichte: In jeder Sekunde verhielt sich seine Auf-führung ironisch-ratlos zu allen früheren Hamlet-Auf-führungen. Breth liefert keinen Kommentar zur Auf-führungstradition, sie will diese Tradition durch die pure Brillanz der Bühnengegenwart löschen.
Jedoch, nach vier Stunden begann in mir das Theaterstundenzählwerk zu ticken, und ich über-legte, wer von den Figuren auf der Bühne noch lebte und aus dem Weg geräumt werden musste, ehe das Ende kommen würde: Ophelia, Rosenkranz und Güldenstern, alle die künftigen Toten an Hamlets Wegrand, waren noch quicklebendig, ganz abgesehen von jenen, die einander erst am Ende ums Leben bringen. Da wurde mir mulmig, und ich fühlte mich Hamlet plötzlich nahe. »Ganz Dänemark ist ein
Gefängnis«, hatte der vorhin gesagt. Auch das Burg-theater kann einem zum Gefängnis werden.
Woran liegt das? Unter anderem am Ensemble. Eine gewisse fade Glätte charakterisiert die Neben-darsteller, ja das Komparsenhafte beginnt schon mit den größeren Rollen. Um nur zwei zu nennen: Ham-lets Mutter Gertrud, die Königin, die den Mörder ihres Mannes heiratet, ist bei Andrea Clausen eine großäugige Regentin, deren Spiel sich in den Blicken erschöpft, mit denen sie ihren Sohn liebend-fragend auffrisst. Und Claudius, Mörder seines Bruders und neuer König Dänemarks, hat bei Roland Koch die Abgründigkeit eines Derrick-Finstermannes aus guter Familie – er ist der Filialleiter mit Doppelleben, das klassische Erpressungsopfer für einen Serienkrimi. Meistens steht Claudius klamm in der Szene, bedenkt, was er angerichtet hat, und ein mulmiges »au Backe!« ist seinem Gesicht abzulesen.
Von hoher Austauschbarkeit sind auch die Büh-nenräume. Wenn heute ein Königshof und höfisches Leben dargestellt werden, dann fällt dem Durch-schnittsregisseur dazu ein: Heute wäre der Hof ein Weltkonzern und der König ein Topmanager. Und schon wissen Kostüm- und Bühnenbildner, was sie zu tun haben. Aus dem Hof wird eine Konzernzentrale, aus den Zugbrücken werden runtergelassene Jalousien, aus Hofschranzen werden Spin-Doctors mit Horn-brillen. So spielt man Schiller, Shakespeare, Goethe überall. So wird, denkt man, Andrea Breth es also nicht machen. Aber siehe: Sie macht es genau so.
Der dänische Königshof ist in Martin Zehetgru-bers Bühnenbau das vermutlich oberste Geschoss eines Hochhauses. Man geht nicht ab, man reist nicht aus, man wechselt nur die Konferenzräume. Es gibt in dieser Welt kein »Draußen«, und Natur ist allenfalls der von Nebel umwölkte Dachgarten im Inneren der Drehbühne, in welchem sich der Geist von Hamlets Vater zeigt. Man kennt diese Stimmung – etwa aus Michael Almereydas Hamlet-Film von 2000, dem
diese Inszenierung manches verdankt. Vieles ist over-done: Einige Mittel der Aufwallung, zu denen Andrea Breth greift, erweisen sich als pure Geschmacks-verstärker. Die einzelnen Szenen werden mit aus Wagner-Fanfaren geschmiedeten Schwertdonner-schlägen klanglich voneinander geschieden. Ent-scheidende Momente werden mit Dolby-Blockbuster-Sound akzentuiert – das klingt immer so, wie wenn in einer BMW-Werbung die Fahrertür ins Schloss fällt.
Dass man der keuschen Ophelia, die sich später ertränkt, ein Aquarium ins Zimmer stellt – ist das ein hübscher oder ein blöder Einfall? Dass eine intime Unterredung zwischen Hamlet und seiner Mutter im Badezimmer stattfindet und dass Hamlets Vater, der Geist, im Bademantel ins überhitzte Zimmer schneit – was bedeutet das? Vermutlich hat man dem Geist, der nur für ein paar Momente aus dem Fegefeuer herausdurfte, in dem er schmort, an der Tür gesagt: Ohne Bademantel dürfen Sie vielleicht in die Hölle, aber nicht in eine Breth-Inszenierung!
Doch nun zum Titelhelden. Der Literaturwissen-schaftler Harold Bloom sagt, Hamlet sei wie eine Fi-gur, die über das Stück, aus dem sie stammt, hinaus-gewachsen ist. Für den Wiener Hamlet gilt das ganz bestimmt. August Diehl spielt ihn.
Diehl, auf seinem Stuhl hängend, das verfilzte Haar als Gesichtsverhüllung benutzend, die Augen geschlossen, wirkt zu Beginn wie ein Junkie; sein schwarzer Anzug umhüllt ihn wie ein lebenslanger Spiel- und Schlafanzug. Seine grimmige Trance ist schon Teil der Ermittlung: Dieser Mann weiß traum-sicher, was er erst später erfahren wird, dass nämlich sein Vater vom eigenen Bruder, Hamlets Onkel, er-mordet wurde. Nun muss er Indizien sammeln und Rache üben. Diehl hat das Tänzerische, Fallsüchtige einer Marionette – er wird geführt vom Rachebefehl seines Vaters. Bisweilen bewegen seine Lippen sich, als äfften sie nach, was am Hof gesprochen wird. So gibt Hamlet den Irren. Er durchschaut alle Menschen,
indem er sich selbst verstellt und sie zum Mitspielen zwingt, und er erwischt sie, wenn sie in ihr wahres Wesen zurückfallen – er verstellt sie und begreift, wie sie funktionieren. Seine Ermittlungen ergeben: Sie sind Hüllenhöflinge, Masken, hinter denen kein Gesicht ist.
Hamlet ist bei Diehl vor allem ein großer, ver-zweifelter Kommunikationsforscher. Als eine Schau-spieltruppe am Hof auftaucht, gewinnt er Lust an seiner Lage: Das pure Spiel wird ihn retten. Aber: Er ist in diesem Spiel allein.
Es gibt in Andrea Breths Inszenierung keine Pan-nen, Hänger, Versprecher, das handwerkliche Niveau ist über sechs Stunden hin beängstigend hoch, und doch: Welche Starre geht von der Bühne aus! Und wie viel entspannter und wacher habe ich am Abend zuvor am Wiener Akademietheater das neue Stück von René Pollesch gesehen, Cavalcade or Being a holy motor. In dieser hochstaplerisch und mit schiefem Grinsen zur Show aufgemöbelten Bagatelle könnte August Diehls Hamlet heimisch werden, im Pollesch-Land fände er Rettung, dort werden lauter Hamlet-Fragen im Witz-gewand gestellt, es geht um die Fragwürdigkeit des menschlichen Innenlebens, der Liebe, der Sprache. Es fallen Sätze wie diese: »Theater denken ja gerne, sie wären ein Tempel, in dem der Ernst schon vorinstal-liert ist. Und so sehen die dann auch aus, die Schau-spieler, die vergessen haben, woher der Ernst kommen könnte: aus dem Spiel eben. Daraus, dass hier ein paar Leute so tun als ob. In einem Raum, in dem es eben ausgerechnet um nichts geht. Jedenfalls nicht um Leben und Tod. Es geht im Theater nicht um das Leben oder den Tod. Es geht um die gespielten Leben und den gespielten Tod.«
Der Einzige in Breths Inszenierung, der weiß, wovon hier die Rede ist, ist Hamlet. Er wächst hi-naus über sein Spiel, das er nicht überleben kann.
www.zeit.de/audio
Der Spieler ist ganz alleinAndrea Breth inszeniert Shakespeares »Hamlet«
am Wiener Burgtheater – und scheitert.
Ihr Hauptdarsteller August Diehl
triumphiert dennoch VON PETER KÜMMEL
Freunde im
Endkam
pf: Ham
let (Augu
st D
iehl, m
it D
egen) u
nd Lae
rtes (
Albre
cht A
braham
Sch
uch)
Foto
: B
ern
d U
hlig

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4150 FEUILLETON
Gründungsverleger 1946–1995: Gerd Bucerius †
Herausgeber: Dr. Marion Gräf in Dönhoff (1909–2002) Helmut Schmidt Dr. Josef Joffe
Chefredakteur: Giovanni di LorenzoStellvertretende Chefredakteure: Moritz Müller-Wirth Sabine Rückert Bernd UlrichChef vom Dienst: Iris Mainka (verantwortlich), Mark Spörrle
Textchefin: Anna von Münchhausen (Leserbriefe)
Internationaler Korrespondent: Matthias Naß
Leitender Redakteur: Hanns-Bruno Kammertöns
Parlamentarischer Korrespondent: Matthias Geis
Redakteur für besondere Aufgaben: Patrik Schwarz
Politik: Bernd Ulrich (verantwortlich), Dr. Jochen Bittner, Andrea Böhm, Alice Bota, Frank Drieschner, Cathrin Gilbert, Ulrich Ladurner, Khuê Pham, Gero von Randow, Jan Roß (Außen politik), Özlem Topçu, Dr. Heinrich Wefing
Dossier: Tanja Stelzer/Wolfgang Uchatius (verantwortlich), Anita Blasberg, Roland Kirbach, Henning Sußebach
Geschichte: Benedikt Erenz (verantwortlich), Christian Staas
Fußball: Cathrin Gilbert, Moritz Müller-Wirth
Wirtschaft: Dr. Uwe J. Heuser (verantwortlich), Götz Hamann (Koordination Unternehmen), Kerstin Bund, Alina Fichter, Marie- Luise Hauch-Fleck, Rüdiger Jungbluth, Anne Kunze, Dietmar H. Lamparter, Gunhild Lütge, Marcus Rohwetter, Dr. Kolja Rudzio, Christian Tenbrock
Wissen: Andreas Sentker (verantwortlich), Dr. Harro Albrecht, Dr. Ulrich Bahnsen, Christoph Drösser (Computer), Inge Kutter, Stefan Schmitt, Ulrich Schnabel, Jan Schweitzer, Martin Spiewak, Urs Willmann
Junge Leser: Katrin Hörnlein (verantwortlich)
Feuilleton: Iris Radisch/Dr. Adam Sobo czynski (verantwort-lich), Thomas Ass heuer, Jens Jessen, Peter Kümmel, Christine Lemke-Matwey, Ijoma Mangold (Literatur; verantwortlich), Katja Nico de mus, Nina Pauer, Dr. Hanno Rauterberg, Dr. Elisabeth von Thadden (Politisches Buch), Kilian Trotier
Kulturreporter: Dr. Susanne Mayer (Sachbuch), Dr. Christof Siemes, Moritz von UslarGlauben & Zweifeln: Evelyn Finger (verantwortlich)Reisen: Dorothée Stöbener (verantwortlich), Michael Allmaier, Karin Ceballos Betancur, Stefanie Flamm, Merten WorthmannChancen: Thomas Kerstan (verantwortlich), Jeannette Otto, Arnfrid Schenk, Marion Schmidt, Johanna Schoener, Linda TutmannDie ZEIT der Leser: Dr. Wolfgang Lechner (verantwortlich), Jutta HoffritzZEITmagazin: Christoph Amend (Chefredakteur), Matthias Kalle (Stellv. Chefredakteur), Christine Meffert (Textchef in), Jörg Burger, Heike Faller, Ilka Piepgras, Tillmann Prüfer (Style Director), Elisabeth Raether, Jürgen von Ruten berg, Matthias Stolz Art-Direktorin: Katja Kollmann Gestaltung: Nina Bengtson, Jasmin Müller-Stoy Fotoredaktion: Milena Carstens (verantwortlich i. V.), Michael BiedowiczRedaktion ZEITmagazin: Dorotheenstraße 33, 10117 Berlin, Tel.: 030/59 00 48-7, Fax: 030/59 00 00 39; E-Mail: zeitmagazin@ zeit.deDie ZEIT-App: Redaktionsleitung: Dr. Christof Siemes, Jürgen von Rutenberg (ZEITmagazin) Art-Direktion: Haika Hinze, Katja Kollmann (ZEITmagazin) Betreiber: ZEIT Online GmbHVerantwortlicher Redakteur Reportage: Wolfgang Ucha tiusReporter: Wolfgang Bauer, Marian Blasberg, Dr. Carolin Emcke, Dr. Wolfgang Gehrmann, Christiane Grefe, Jana Simon, Ulrich Stock, Annabel WahbaPolitischer Korrespondent: Prof. Dr. h. c. Robert LeichtAutoren: Dr. Theo Sommer (Editor-at-Large), Stefan Aust, Dr. Dieter Buhl, Ulrich Greiner, Dr. Thomas Groß, Nina Grunen berg, Dr. Ingeborg Harms, Klaus Harpprecht, Wilfried Herz, Dr. Gunter Hofmann, Dr. Petra Kipphoff, Erwin Koch, Dr. Werner A. Perger, Roberto Saviano, Chris tian Schmidt- Häuer, Dr. Hans Schuh-Tschan, Burk hard Straßmann, Tobias Timm, Dr. Volker Ullrich
Berater der Art-Direktion: Mirko Borsche
Art-Direktion: Haika Hinze (verantwortlich), Jan Kny, Malin SchulzGestaltung: Klaus Sieling (Koordination), Mirko Bosse, Martin Burgdorff, Mechthild Fortmann, Sina Giesecke, Katrin Guddat, Philipp Schultz, Delia Wilms, Julika Altmann (Redaktionelle Beilagen) Infografik: Gisela Breuer, Nora Coenenberg, Anne Gerdes, Jelka LercheBildredaktion: Ellen Dietrich (verantwortlich), Melanie Böge, Florian Fritzsche, Jutta Schein, Gabriele Vorwerg Dokumentation: Mirjam Zimmer (verantwortlich), Davina Domanski, Melanie Moenig, Dorothee Schöndorf, Dr. Kerstin WilhelmsKorrektorat: Mechthild Warmbier (verantwortlich)Hauptstadtredaktion: Marc Brost/Tina Hildebrandt (verantwortlich), Peter Dausend, Christoph Dieckmann, Jörg Lau, Mariam Lau, Petra Pinzler, Dr. Thomas E. Schmidt (Kultur korres pondent), Dr. Fritz Vorholz Reporterin: Elisabeth Niejahr Wirtschaftspolitischer Korrespondent: Mark SchieritzDorotheenstraße 33, 10117 Berlin, Tel.: 030/59 00 48-0, Fax: 030/59 00 00 40Investigative Recherche: Stephan Lebert (verantwortlich), Hans Werner Kilz, Kerstin Kohlenberg, Martin Kotynek, Yassin Musharbash, Daniel Müller (Autor)Frankfurter Redaktion: Arne Storn, Eschersheimer Landstraße 50, 60322 Frankfurt a. M., Tel.: 069/24 24 49 62, Fax: 069/24 24 49 63, E-Mail: [email protected] Redaktion: Stefan Schirmer, Martin Machowecz, Ostra-Allee 18, 01067 Dresden, Tel.: 0351/48 64 24 05, E-Mail: [email protected] Europa-Redaktion: Matthias Krupa, Residence Palace, Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel, Tel.: 0032-2/230 30 82, Fax: 0032-2/230 64 98, E-Mail: [email protected] Redaktion: Georg Blume, 17, rue Bleue, 75009 Paris, Tel.: 0033-610 23 26 75, E-Mail: [email protected]: Michael Thumann, Posta kutusu 2, Arnavutköy 34345, Istanbul, E-Mail: [email protected] Redaktion: Martin Klingst, 4701 Willard Ave., 1214 Chevy-Chase, MD 20815; E-Mail: [email protected] Yorker Redaktion: Heike Buchter, 11, Broadway, Suite 851, New York NY 10004, Tel.: 001-212/ 269 34 38, E-Mail: [email protected]
Südamerika-Redaktion: Thomas Fischermann, Rua Visconde de Pirajá, 03/803, RJ 22410-001, Rio de Janeiro, Brasilien; Tel.: 0055-21/40 42 83 98, E-Mail: [email protected] Redaktion: Angela Köckritz, No 6 Zhongku Hutong Dongcheng District, 100009 Beijing; E-Mail: [email protected];
Moskauer Redaktion: Srednjaja Perejaslawskaja 14, Kw. 19, 129110 Moskau
Österreich-Seiten: Joachim Riedl, Alserstraße 26/6a, A-1090 Wien, Tel.: 0043-664/426 93 79, E-Mail: [email protected]
Schweiz-Seiten: Peer Teuwsen, Matthias Daum, Kronengasse 10, CH-5400 Baden, Tel.: 0041-562 104 950, E-Mail: [email protected] Auslandskorrespondenten: Gisela Dachs, Tel Aviv, Fax: 00972-3/525 03 49; Dr. John F. Jungclaussen, Lon don, Tel.: 0044-2073/51 63 23, E-Mail: johnf.jungclaussen @ zeit.de; Reiner Luyken, Achiltibuie by Ullapool, Tel.: 0044-7802/50 04 97, E-Mail: [email protected]; Birgit Schönau, Rom, Tel.: 0039-339-229 60 79 ZEIT Online GmbH: Chefredaktion: Jochen Wegner (Chefredakteur), Domenika Ahlrichs (Stellv. Chef redakteurin), Karsten Polke-Majewski (Stellv. Chef redakteur), Christoph Dowe (Geschäftsf. Red.), Fabian Mohr (Entwicklung, Multimedia-Formate, Video); Textchef in: Meike Dülffer; Leiterin Newsdesk: Kirsten Haake; Chef/-in vom Dienst: Christian Bangel, Sybille Klormann, Alexander Schwabe; Nachrichten: Karin Geil, Steff i Dobmeier, Monika Pilath, Tilman Steffen, Till Schwarze, Zacharias Zacharakis; Politik, Meinung, Gesellschaft: Markus Horeld (Leitung), Lisa Caspari, Ludwig Greven, Carsten Luther, Steffen Richter, Parvin Sadigh, Michael Schlieben, Katharina Schuler; Wirtschaft, Karriere, Mobilität: Marcus Gatzke (Leitung), Matthias Breitinger, Alexandra Endres, Philip Faigle, Tina Groll, Marlies Uken; Kultur, Lebensart, Reisen: Carolin Ströbele (Leitung), Jessica Braun, Maria Exner, David Hugendick, Wenke Husmann, Frida Thurm, Rabea Weihser; Digital, Wissen, Studium: Dagny Lüdemann (Leitung), Patrick Beuth, Kai Biermann, Ruben Karsch nik, Sven Stock rahm; Sport: Steffen Dobbert (verantwortl. Red.), Oliver Fritsch, Christian Spiller; Video: Ute Brandenburger (Video-CvD),
René Dettmann, Adrian Pohr; Social Media: Juliane Leopold; Community: Annika von Taube, David Schmidt (ZEIT für die Schule), E-Mail: [email protected]; Bildredaktion, Grafik und Layout: Tibor Bogun (Art-Direktor), Sabine Bergmann, Paul Blickle, Reinhold Hügerich, Sonja Mohr, Martina Schories; Entwicklungsredaktion: Thomas Jöchler (Leitung), Michael Schultheiß, Sascha Venohr
Geschäftsführer: Dr. Rainer Esser, Christian Röpke
Verlag und Redaktion:
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg Telefon: 040/32 80-0 Fax: 040/32 71 11 E-Mail: [email protected]
ZEIT Online GmbH: www.zeit.de © Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg
Geschäftsführer: Dr. Rainer Esser
Verlagsleitung: Stefanie Hauer
Vertrieb: Jürgen Jacobs
Marketing: Nils von der Kall
Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen: Silvie Rundel
Herstellung/Schlussgrafik: Torsten Bastian (verantwortlich), Helga Ernst, Nicole Hausmann, Oliver Nagel, Hartmut Neitzel, Frank Siemienski, Pascal Struckmann, Birgit Vester, Lisa Wolk; Bildbearbeitung: Anke Brinks, Hanno Hammacher, Martin Hinz
Druck: Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH, Kurhessenstr. 4 –6, 64546 Mörfelden-Walldorf Axel Springer AG, Kornkamp 11, 22926 Ahrensburg
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder übernimmt der Verlag keine Haftung.
Anzeigen: DIE ZEIT, Matthias Weidling; Empfehlungs-anzeigen: iq media marketing, Michael Zehentmeier
Anzeigenstruktur: Ulf Askamp Anzeigen-Preisliste Nr. 58 vom 1. Januar 2013
Magazine und Neue Geschäftsfelder: Sandra Kreft
Projektreisen: Christopher Alexander
Bankverbindungen: Commerzbank Stuttgart, Konto-Nr. 525 52 52, BLZ 600 400 71; Postbank Hamburg, Konto-Nr. 129 00 02 07, BLZ 200 100 20
Börsenpflichtblatt: An allen acht deutschen Wertpapierbörsen
Leserbriefe Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, 20079 Hamburg, Fax: 040/32 80-404; E-Mail: [email protected]
Artikelabfrage aus dem Archiv Fax: 040/32 80-404; E-Mail: [email protected]
Abonnement Jahresabonnement € 207,48; für Studenten € 132,60 (inkl. ZEIT Campus); Lieferung frei Haus; Digitales Abo € 3,49 pro Ausgabe; Digitales Abo für ZEIT-Abonnenten € 0,50 pro Ausgabe
Schriftlicher Bestellservice: DIE ZEIT, 20080 Hamburg
Abonnentenservice: Telefon: 040/42 23 70 70 Fax: 040/42 23 70 90 E-Mail: [email protected]
Abonnement für Österreich, Schweiz und restliches Ausland DIE ZEIT Leserservice 20080 Hamburg Deutschland Telefon: +49-40/42 23 70 70 Fax: +49-40/42 23 70 90 E-Mail: [email protected]
Abonnement Kanada Anschrift: German Canadian News 25–29 Coldwater Road Toronto, Ontario, M3B 1Y8 Telefon: 001-416/391 41 92 Fax: 001-416/391 41 94 E-Mail: [email protected]
ZEIT-LESERSERVICE
Abonnement USA DIE ZEIT (USPS No. 0014259) is published weekly by Zeitverlag. Subscription price for the USA is $ 290.00 per annum. K.O.P.: German Language Pub., 153 S Dean St., Englewood NJ 7631. Periodicals postage is paid at Paramus NJ 07652 and additional mailing off ices. Postmaster: Send address changes to: DIE ZEIT, GLP, PO Box 9868, Englewood NJ 07631 Telefon: 001-201/871 10 10 Fax: 001-201/871 08 70 E-Mail: [email protected]
Einzelverkaufspreis Deutschland: € 4,50
Ausland: Belgien € 4,80; Dänemark DKR 45,00; Finnland € 7,00; Frank reich € 5,50; Griechenland € 6,00; Großbritannien GBP 5,10; Italien € 5,50; Luxemburg € 4,80; Nieder lande € 4,80; Norwegen NOK 65,00; Österreich € 4,60; Portugal € 5,50; Schweden SEK 64,00; Schweiz CHF 7,30; Slowakei € 6,20; Slowenien € 5,50; Spanien € 5,50; Kanarische Inseln € 5,70; Tschechische Republik CZK 185,00; Ungarn HUF 1960,00
ISSN: 0044-2070
er sich für Amerikas kul-turelle Exportgüter inte-ressiert, kommt in die-sem Jahr nicht am Film Sharknado vorbei. Der Titel ist haarsträubend: »Sharknado« steht für ei-
nen Haifisch-Wirbelsturm (shark + tornado). Noch lächerlicher ist die Handlung: Ein Tornado peitscht Tausende von Haien aus dem Meer und lässt sie auf Los Angeles regnen. Das Ganze ist niveaulose Unterhaltung, taugt aber für Gedankenspiele. Man stelle sich vor, man wacht in L.A. auf und schaltet den Fernseher an: In den Nachrichten wird vor einem herannahenden Sharknado gewarnt. Zwei Experten diskutieren, ob Sharknados gut oder schlecht für die Menschheit, die Wirtschaft und unsere Gehirne sind. Einer fürchtet um unsere Kultur, der andere erwidert, dass Sharknados die ohnehin sterbenden Industrien hinwegfegen und Raum für neue Ideen schaffen könnten. Dann klopft es an der Tür. Ein gut gekleideter Mann steht draußen und behauptet, er arbeite für die »Sharknado Evakuierungs-GmbH«, ein Start up-Unternehmen, das einen für wenig Geld in Sicher-heit bringt. Entscheiden müsse man sich allerdings sofort. Verwirrt bezahlt man ihn.
Willkommen in der Internet-Debatte. Intellek-tuelle können darin zwischen zwei Rollen wählen: die des Fernsehexperten und die des Vertreters. Als Experten applaudieren sie entweder jeder neuen Ent-wicklung, oder sie verurteilen alles, was nach Elek-trizität riecht. Oder: Morgens machen sie eine Pro-phezeiung, nachmittags beraten sie uns, und abends verwirren sie uns per Twitter. Für viele erschöpft sich darin das Potenzial des Internet-Intellektuellen. Kürzlich erschien im Democracy Journal ein Essay über den traurigen Zustand dieser Intellektuellen in Amerika. Dort heißt es: »Die Aufgabe eines Intellek-tuellen ist es, der Öffentlichkeit Ideen und Argumen-te zu erklären.« Nach dieser Lesart sollen Intellektu-elle erst erklären und später hinterfragen.
Natürlich können Internet-Intellektuelle ihre Weisheiten leicht verdaulich aufbereiten. Das tun sie zum Beispiel bei TED, der Online-Konferenz, die ganz in der Tradition der für jeden verständlichen Wissenschaft steht. Große Naturwissenschaftler wie Stephen Hawking oder Neil deGrasse Tyson machen Laien auf diese Weise ihr Wissen zugänglich. Viele Internet-Intellektuelle wollen genau das erreichen. Sie versuchen, bestimmte Aspekte »des« Internets zu erklären, etwa die Funktion kostenloser Software oder von Wikipedia oder den Sturz eines Diktators mit-hilfe Sozialer Netzwerke. Wer Geschäftssinn besitzt, wird diese Erklärungen später in lukrative Beratungs-dienste verwandeln.
ch glaube, dass Internet-Intellektuelle mehr können. Ob man meine Argumen-tation überzeugend findet, hängt aller-dings davon ab, ob man »das« Internet für einen Asteroiden hält, den ein Astrophy-siker erklärt, oder für einen Sharknado, also einen Gegenstand, den man zwar
erklären kann, aber nur zu dem Preis, dass man ihn dadurch glaubhafter macht, als er sein sollte.
Was das Democracy Journal ignoriert, ist die Ge-schichte des öffentlichen Intellektuellen. Diese Geschichte braucht hier nicht wiederholt zu wer-den, sie beginnt mit der Dreyfus-Affäre in Frank-reich und mit der Einmischung des Schriftstellers Émile Zola. Wichtig ist dabei, dass Zolas berühm-tes J’accuse kein Tweet und keine PowerPoint-Folie bei der TED-Konferenz war. Zola hatte keine »Ideen und Argumente erklärt«, sondern das Urteil eines Militärgerichts hinterfragt.
Später schlugen Noam Chomsky und Michel Foucault zwei weitere Modelle politischer Einmi-schung vor. Nach Chomsky müssen Intellektuelle den Mächtigen die Wahrheit sagen. Nach Foucault müssen sie Wahrheit als Macht entlarven. Chomsky warf in seinem Essay Die Verantwortung der Intellek-tuellen von 1967 zeitgenössischen Denkern vor, die Regierung während des Vietnamkrieges zu beraten und die Öffentlichkeit zu belügen, statt »den Mäch-tigen die Meinung zu sagen und ihre Lügen aufzude-cken«. Foucault hingegen unterschied zwischen »uni-versellen Intellektuellen« wie Jean-Paul Sartre und einer neuen Gattung von »spezifischen Intellektuel-len«, deren Expertise sich auf Spezialbereiche wie Physik oder Biologie bezog. Robert Oppenheimer,
meinte Foucault, sei »nicht mehr Sänger der Ewigkeit, sondern Stratege des Lebens und des Todes«.
Was die Physik und die Biologie für das 20. Jahr-hundert waren, ist die Informatik für das 21. Es geht dabei nicht nur um unsere Privatsphäre und die NSA. Wir sprechen buchstäblich über Leben und Tod. Jetzt, da Google eine Firma gegründet hat, die Fragen des Alterns klären will – unter der Leitung des ehe-maligen Vorsitzenden der Firma Genentech –, greift der Suchmaschinen-Gigant in Leben und Tod ein.
Was erwartet Foucault von den »spezifischen In-tellektuellen«? Er drückt es wie folgt aus: »Das fun-damentale politische Problem der Intellektuellen heutzutage ist nicht die Kritik möglicher ideologi-scher Inhalte der Wissenschaft, liegt nicht darin, seine wissenschaftliche Praxis mit der richtigen Ideo-logie zu verbinden. Es besteht darin, herauszufinden, ob es möglich ist, eine neue Politik der Wahrheit zu konstituieren. Nicht die Veränderung des ›Bewusst-seins‹ der Menschen oder dessen, was in ihren Köpfen
steckt, ist das Problem, sondern die Veränderung des politischen, ökonomischen und institutionellen Systems der Produktion von Wahrheit.«
Das Sharknado-Beispiel bringt trotz seiner In-haltsleere den Unterschied zwischen den beiden Denkern zum Ausdruck. Chomsky würde wohl die fehlerhafte Darstellung der Fernsehexperten und des Geschäftsmannes herausstellen. Foucault hingegen würde andere Fragen stellen: Könnte ein Sharknado eine Ausrede dafür sein, Haie, Menschen und das Klima so zu behandeln, dass unsere Angst wächst? Könnte man über sie sprechen, ohne überall den Tod zu sehen? Was macht Haie und Tornados für For-schung und nationale Sicherheit so interessant, dass ein Sharknado vorstellbar wird?
Chomskys Kritik ist leichter nachvollziehbar, doch die elektronischen Medien markieren auch die Gren-zen seiner Methode. Wäre »Wahrheit« mit dem Auf-zeigen von »Fakten« gleichzusetzen, wäre die Öffent-lichkeit bereits informiert: Die Fakten sind ja nur einen Klick entfernt. Also muss uns etwas anderes von der Wahrheit trennen. Für Chomsky heißt dieses Etwas »Ideologie«. Das Problem ist: Um sich aus einer falschen Ideologie zu befreien, brauchte man weitere Fakten. Das Modell dreht sich im Kreis.
Foucault kümmert sich wenig um Ideologie. Vielmehr will er verstehen, warum etwas innerhalb
eines bestimmten Wissenssystems als »wahr« oder als »falsch« gilt. Das bedeutet nicht, dass alles relativ wäre: Foucault glaubt nicht, dass Haie L.A. zerstören können, das ist kein Thema für ihn. Die Heraus-forderung besteht darin zu verstehen, wie ein Shark-nado zu einer Idee werden kann, um die herum eine Fernsehsendung und ein Evakuierungsunternehmen aufblühen. Die emanzipatorische Aufgabe des In-tellektuellen wäre es, aufzuzeigen, dass es auch ande-re Bezugsmöglichkeiten zwischen Haien, Wasser und Wetter gibt als diejenigen, die wir Sharknado nennen.
Wer behauptet, dass »das« Internet unser Shark-nado sei, akzeptiert, dass die gegenwärtigen Praktiken, Dienste und Diskussionen – kurz: der Internet-Dis-kurs – schon jetzt vorgeben, wie wir reden, was wir sagen und was wir tun. Es ist nicht so, dass die In-ternet-Intellektuellen unrecht hätten oder von fal-schen Ideologien verblendet wären. Doch indem sie sich mühen, »das« Internet zu erklären, stabilisieren sie einen Diskurs, der selbst dringend hinterfragt
werden müsste. Einfacher: Dieser Internet-Diskurs hat sich selbst überlebt. Er hat zu drei Fehlschlüssen geführt: dem Kohärenzirrtum, dem Ursprungsirrtum und dem Objektivitätsirrtum. Jeder dieser Fehl-schlüsse beeinträchtigt unser Denken und unsere Handlungsfähigkeit.
Nehmen wir den Kohärenzirrtum. Dahinter steckt die Vermutung, dass eine bestimmte Logik sämtliche Entwicklungen auf dem Internet-Markt verbindet und die Phänomene eines Bereichs daher problemlos auf einen anderen übertragen werden können. Sie wissen etwas über Wikipedia? Toll! Im Internet-Zeitalter heißt das, Sie wissen auch, wie man politische Parteien rettet. Denn – zur Erinnerung – der Kohärenzirrtum macht uns glauben, dass »das« Internet Wissen auf dieselbe Weise zerstört, wie es die Politik zerstört.
Hören wir dazu Steven Johnson, einen Internet-Intellektuellen par excellence: »Wikipedia ist nur der Anfang ... Vom Erfolg der Enzyklopädie kön-nen wir lernen, neue Systeme zu bauen, die Pro-bleme in Bildung, Verwaltung, Gesundheit, Ge-meindearbeit und zahllosen anderen menschlichen Bereichen lösen.« Der Fehler dieser Logik zeigt sich in der aktuellen Niederlage der Piratenpartei.
Oder nehmen wir Clay Shirky: Man müsse nur annehmen, »das« Internet habe überall ähnliche
Effekte. Dann könne man mithilfe »des« Internets alle Bereiche erklären, die es vermeintlich erschüt-tert. Der Mythos der Erschütterung – in Shirkys Fall kommt er in Gestalt von Napster – erledigt den Rest. Shirkys Job als beratender Intellektueller ist es, vor dem überall drohenden »Napster-Mo-ment« zu warnen, vor digitalen Sharknados in Journalismus, Demokratie oder Bildung. Shirky ist der Experte, der im Fernsehen auftaucht, um zu warnen, dass Napster alles zerstören wird, nur um im nächsten Moment an unserer Tür zu klopfen.
Der Ursprungsirrtum verwechselt dagegen Ur-sache und Wirkung. Er geht davon aus, dass die ak-tuelle digitale Infrastruktur – »das« Internet – unsere Praktiken und Verhaltensweisen hervorgebracht hat und nicht umgekehrt. Damit wird jeder Einzelaspekt des Internets immer wieder durch die Geschichte des Internets selbst erklärt. Zu sehen ist das an Googles Suchmaschine. Man vergisst leicht, dass es Klassifi-zierung und systematische Informationssuche lange
vor der Netzwerk-Informatik gab. Wer in der Infor-mations- und Bibliothekswissenschaft arbeitete, sprach über Automatisierung und Digitalisierung, bevor die Gründer von Google geboren wurden. Diese Debatten haben Google weit mehr geprägt als die Tatsache, dass man die Suchmaschine über ein digitales Netzwerk erreicht. Doch ist eine Entwick-lung erst einmal in die heldenhafte Geschichte »des« Internets eingeschrieben, geraten die Vorgänger aus den Augen. Es ist, als würde man die Entwicklung des Klapptischs mit der Geschichte des Flugzeuges erklären, ohne über Essgewohnheiten oder frühere Tischkonstruktionen zu reden.
Schließlich ist da noch der Objektivitätsirrtum, der gefährlichste von allen. Ihm liegt das Problem zugrunde, dass Internet-Intellektuelle »das« Internet nicht mit dem Internet selbst erklären können. Sie brauchen einen weiteren Theorierahmen. Larry Lessig, der Vater der Internet-Intellektuellen, be-hauptet zum Beispiel, der »Code ist Gesetz«. Er geht davon aus, dass es vier Kräfte gibt: Märkte, Normen, Gesetze und Codes.
Will man sein Modell verstehen, muss man wissen, aus welcher theoretischen Ecke Lessig kommt – nämlich aus der politischen Ökonomie. Sein Code-Modell hat ein rechtswissenschaftliches Vorbild, zudem ein neoliberalismusfreundliches.
Denn genauso wie es keinen »natürlichen« juristi-schen oder ökonomischen Diskurs gibt, gibt es keinen »natürlichen« Diskurs des Cyberspace. Die Erklärungen »des« Internets, die Internet-Intellek-tuelle anbieten, sind daher häufig keine wirklichen Erklärungen. Vielmehr sind sie Versuche, den lee-ren theoretischen Raum »des« Internets zu füllen – und zwar mit den von ihnen bevorzugten öko-nomischen und politischen Theorien, die dann in einen »Internet-Diskurs« eingebettet werden.
o gesehen, nutzt Clay Shirky die Theorie der rationalen Entschei-dung, um zu erklären, wie »das« Internet die Revolution im Iran vorantrieb. Tim Wu erzählt die »Geschichte des Internets« mithilfe des Wirtschaftsrechts. Yochai
Benkler begründet das »Netzwerk der Öffentlich-keit« mit einer Mischung aus anarchistischem Denken und neuester Evolutionssoziologie. Ste-ven Johnson erklärt Online Communities mit Soziobiologie.
Die Verdienste all dieser Theorien mögen groß sein, doch es ist klar, dass die Soziobiologie kein objektiver Rahmen für eine Theorie von Computernetzwerken oder digitalen Medien ist. Redet E. O. Wilson über Digitales, wissen wir, dass er als Soziobiologe eine bestimmte Perspek-tive hat und wir skeptisch sein müssen. Redet hingegen Steven Johnson über Digitales, trauen wir ihm, denn schließlich ist er ja ein Internet-Experte.
Der Objektivitätsirrtum gaukelt Internet-Intel-lektuellen moralische Überlegenheit vor. Sie betrach-ten es als ihre Aufgabe, jedem das Internet zu erklären, der es hören will. Um festzustellen, wie rein ihr Ge-wissen wirklich ist, müssten wir ihnen drei Fragen stellen. Erstens: Haben sie einen Vertrag als Redner unterschrieben und das »Erklären des Internets« zu einem Geschäft gemacht? Zweitens: Haben sie schon einmal der Regierung »das« Internet erklärt? Drittens: Haben sie schon einmal einem Vertreter der Waffen-industrie »das« Internet erklärt?
Wahrscheinlich würde eine große Zahl von In-ternet-Intellektuellen alle drei Fragen mit Ja beant-worten. Ihre eigenen Tweets und Blogeinträge deuten zumindest darauf hin. Doch was ist so schlimm daran, eine Redneragentur um Hilfe zu bitten? Nicht viel, wenn man über einen Asteroi-den spricht, aber es ist fatal, wenn es um Sharkna-dos geht. Denn es ist schwer vorstellbar, dass je-mand das Wahrheitssystem »des« Internets infrage stellt, wenn seine wirtschaftliche Existenz von die-sem Wahrheitssystem abhängt.
Was ist so schlimm daran, der Regierung »das Internet zu erklären«? Noch einmal: grundsätz-lich nichts. Aber wie schnell kann ein unscharfes Konzept wie »das« Internet ein noch unschärferes Konzept wie »Internet-Freiheit« hervorbringen? Das wiederum kann in den Händen des US-Au-ßenministeriums so ziemlich alles heißen. Aus-ländischen Regierungen »das Internet zu erklä-ren« ist noch komplizierter. Als ich Clay Shirky fragte, warum er die Regierung Gaddafis beraten hatte, antwortete er, er habe daran geglaubt, »das« Internet könne die Wirtschaft des Landes in Gang bringen. Während sich Internet-Intellektu-elle jetzt zu ihren Beratungsdiensten bei der NSA ausschweigen, hatten die meisten in der Zeit vor Snowden gerne damit angegeben.
Wenn sich Intellektuelle von diesen drei Irrtümern nicht befreien, werden sie für das Silicon Valley und die NSA höchstens nützliche Idioten sein. Unter den aktuellen Gegebenheiten wäre es keine Sünde, sich zu verweigern – es wäre sogar eine Pflicht.
Das Problem des heutigen Internet-Diskurses ist, dass er nicht mehr problematisch, schwierig und gefährlich ist. Im Gegenteil, er ist eindimen-sional, schematisch und zahnlos. Das Mindeste, das unsere Internet-Intellektuellen tun können, ist, uns zu warnen, wenn wir dabei sind, Sharkna-dos mit Asteroiden zu verwechseln.
Aus dem Englischen von Sarah Schaschek
Warum der Ruf der Internet-Intellektuellen
zu Recht schlecht ist – und welche Kritik wir wirklich von ihnen brauchen
VON EVGENY MOROZOV
Evgeny Morozov, Jahrgang 1984, gehört zu den schärfsten Kritikern des Internet-Diskurses in den USA. Anfang Oktober erscheint sein Buch »Digitale Technik und die Freiheit des Menschen« im Blessing Verlag
Ab
b.
[M]:
PM
Im
age
s/C
oll.
: P
ho
tod
isc/
Ge
tty
Imag
es;
Fo
to:
Ro
ran
de
lli/
Te
rraP
roje
ct/
Pic
ture
tan
k/
Age
ntu
r Fo
cus

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 FEUILLETON 51
Die Utopie des OhrwurmsEr ist der bedeutendste Opernkomponist des 19. Jahrhunderts. Er hat eine Moral und ist niemals moralisch.
Und er erfindet sein Leben, als spielte es auf der Bühne. Giuseppe Verdi zum 200. Geburtstag VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY
Ambivalent fängt es an, dieses Künstlerleben zwi-schen Europa und der Emilia-Romagna, zwi-schen der Oper als idealis-tischer Anstalt und dem Lob und der Lust des
Landlebens, zwischen politischen Revolutio-nen und persönlichen Katastrophen, Wach-teljagden und Welterfolgen: Bis heute rätselt die Forschung, ob Giuseppe Fortunino Fran-cesco Verdi ein Samstags- oder ein Sonntags-kind war. Wurde er am 9. oder am 10. Ok-tober 1813 im Dörfchen Le Roncole in der Nähe von Busseto geboren?
Seine Taufe, so viel ist gewiss, erfolgte am Montag, die hohe Kindersterblichkeit der Zeit legte dies nahe, und da im italienischen Königreich bis 1814 das verhasste Franzö-sisch Amtssprache war, wird das künftige Genie im Geburtenregister als Joseph Fortu-nin François geführt. Auch das kommt ei-nem Orakel gleich. Rechnet man alles zu-sammen, verbringt Verdi insgesamt sieben Jahre seines langen, arbeitssamen Lebens in Paris, der damaligen Opernhauptstadt, ge-gen deren Boulevards er zwar »eine tödliche Antipathie« hegt, in der er sich andererseits aber so frei fühlt wie in der »Wüste« und nirgends sonst. Was für eine Dialektik.
Wer ist Verdi? Bis heute, neben seinem Dauer-Antipoden Richard Wagner, der be-deutendste Opernkomponist des 19. Jahr-hunderts. »Va, pensiero«, der Gefangenen-chor aus Nabucco, »La donna è mobile« aus Rigoletto, der Triumphmarsch aus Aida (mit und ohne echte Elefanten) und ein halbes oder ganzes Dutzend Ohrwürmer mehr ge-hen auf sein Konto, zum Mitsingen, für jede Caféhaus-Kapelle geeignet. Doch genau die-se Zugänglichkeit und Popularität ist sein Fluch. Man nimmt Verdis Kunstwillen nicht ernst, man sieht und hört nicht, lange nicht, welche vulkanischen, subversiven Kräfte jen-seits des Theatralischen darin stecken. Auch weil er, anders als Wagner, so gar nicht zum Theoretisieren über die Musik und sich selbst neigt. Er ist kein Mann der vielen Worte, vor allem im Alltag nicht (was seine zweite Frau, die Primadonna Giuseppina Strepponi, mit der er zunächst in wilder Ehe lebt, etwas grämlich berichtet).
Der Gefangenenchor hat auch etwas Ikarushaftes
»Leierkastenmusiker« schimpfen ihn die Zeit-genossen nördlich der Alpen, des Hm-ta-tas wegen, jener so sehr ins Ostinato verliebten und oft etwas fahrlässig instrumentierten Begleitung seiner Melodien. Zu Hause in Italien triezt ihn derweil die Zensur, außerdem reibt man ihm die Belcantisten unter die Nase: Rossini! Do-nizetti! Bellini! Cherubini! Die schrieben wah-re italienische Musik und nichts Vulgäres! Ver-di ächzt unter diesem Zweifrontenkrieg, der in Wahrheit ein Dreifrontenkrieg ist und sich gegen Ende seines Lebens zum Vierfronten-krieg auswachsen soll: Die dritte Front heißt Giacomo Meyerbeer und feiert in Paris astrono-mische Erfolge. Und ist es, vierte Front, nicht eine Schande, wie die Jungen, die Boitos und Puccinis, sein Erbe Ende des Jahrhunderts mit Füßen treten?
Am schlimmsten aber fühlt sich für ihn il wagnerismo an, jene Bewegung, nein: jene Erhebung nach der triumphalen italieni-
schen Erstaufführung des Lohengrin 1871 in Bologna. Verdi ist Zeuge der Aufführung und findet Wagners Musik »laut, unverständ-lich, schön, doch schwer erträglich wegen der ständigen hohen Noten der Violinen, ohne Poesie und Feinheit«. Die Bologneser aber sind wie von Sinnen, backen Lohengrin-Kuchen und Gralsbrote, schlagen sich um limitierte Parfümflacons mit Schwan, und der letzte Schrei sind Hüte, die statt einer Feder Lohengrins Horn tragen. Verdi kann diesen Wankelmut nicht fassen: Stets hatte es unter Italienern doch geheißen, Wagners Musik sei böse und mache krank, verursache Pocken, Gelbsucht und andere Leiden. Wo ist der Stolz geblieben?, fragt sich der Maes-tro zehn Jahre nach der so heiß erkämpften italienischen Einheit. »Va, pensiero«, der Chor der Juden in babylonischer Gefangen-schaft, galt noch als heimliche italienische Nationalhymne, und bei der Uraufführung des Maskenballs 1859 in Rom skandierte das Publikum so lange »Viva Verdi!«, bis sein Name emphatisch und für alle Zeiten mit V.E.R.D.I. verschmolz, dem Kürzel für Vit-torio Emanuele Re d’Italia, den ersten König aller Italiener. Die Oper im 19. Jahrhundert ist eben immer auch eine nationale Angele-genheit, das gibt den ästhetischen Empfind-lichkeiten ihre Würze.
Verdi hat es nicht leicht. Und er macht es sich nicht leicht, das ist ihm anzusehen. Früh graben sich Furchen in sein Gesicht, die Stirn wirkt oft beladen, der Blick düster, und spätestens seit er mit Mitte 20 innerhalb von zwei Jahren seine gesamte junge Familie ver-liert, zunächst die Tochter Virginia, dann den Sohn Icilio Romano und schließlich seine erste Frau Margherita, stellt sich um seinen Mund ein bitterer, bisweilen maliziö-ser und erst im Alter verschmitzt zu nennen-der Zug ein. Gesprochen hat Verdi über diese Tragödie nie. Aber sie hat ihn wohl be-stätigt: im Glauben, dass das Leben »etwas ganz und gar Dummes und, noch schlim-mer, Nutzloses« sei, in seiner tiefen Über-zeugung, dass Schmerzen nichts anderen bedürfen als »des Schweigens, der Isolierung und der Qual des Gedankens«.
Es gibt Musik, die kündet von diesen see-lischen Abgründen, von solcher Schwärze: die Arie des Jacopo Fiesco aus dem Prolog des Simon Boccanegra (»Il lacerato spirito«), der Chor »Patria oppressa« aus Macbeth oder auch Stellen aus den späten Quatro pezzi sa-cri. Und auch die trügerisch sich wiegenden Triolen und Sextolen des »Va pensiero«-Chors erzählen davon, seine entrückten, für damalige Ohren gänzlich unerhörten Har-monien und Modulationen (von Fis nach Cis!), die jähen Ausbrüche ins Fortissimo. Dem Sog, den musikalische Kontraste wie diese erzeugen, kann und will sich das Publi-kum bis heute nicht entziehen. Es fragt sich nur, ob es einen mehr nach oben oder mehr nach unten zieht. »Flieg’, Gedanke auf gol-denen Flügeln« – dieser Vers hat bei allem Utopischen auch etwas Ikarushaftes.
Verdi zahlt dafür einen hohen Preis, seine Krankenakte jedenfalls liest sich bisweilen besorgniserregend: ein leptosomer Typ, gelb-gesichtig, hager, leicht reizbar. Er hat einen nervösen Magen und ein schwaches Immun-system, es plagen ihn rheumatische Be-schwerden und Infekte, und seit er es sich leisten kann, fährt er zur Kur (wo er sich re-gelmäßig zu Tode langweilt). Im hohen Alter
von 88 Jahren erliegt Verdi schließlich zwei Schlaganfällen. Reich ist er geworden dank sei-ner 28 Opern und berühmt, im Testament werden zahlreiche karitative Einrichtungen be-dacht, auf Sant’ Agata, seinem Landgut, darf fortan nichts mehr verändert werden, und sein Begräbnis wünscht er sich strikt »ohne Gesang und Musik«. 300 000 Menschen folgen dem Sarg des Komponisten und dem Giuseppinas, als beide am 26. Februar 1901 in Mailand in die Kapelle des von Verdi gestifteten Alters-heims Casa di Riposo überführt werden.
1901 ist das Jahr, in dem Puccinis Tosca Fu-rore macht und Sigmund Freuds Traumdeutungdie Welt erobert. Hat Verdi mit seinem Œuvre diese Schwelle zur Moderne noch genommen, oder gehört er trotz aller Tatkraft und prakti-scher Visionen (er etabliert mit seiner engen Beziehung zum Verlagshaus Ricordi ein ganz neues Geschäftsmodell und »erfindet« das Ur-heberrecht für Komponisten) eher einem ver-sinkenden Zeitalter an? Einem Zeitalter der Oper, wie es gegenwärtiger, praller und politi-scher nie wieder sein würde?
Je tiefer das Genie stapelt, umso heller strahlt sein Licht
Eine der wenigen umstürzlerischen Erkenntnis-se der neueren Biografieforschung besagt, dass Verdi – und darin vor allem war er wohl mo-dern – sein »Image« in der Öffentlichkeit von Anfang an stark stilisiert, ja manipuliert hat. Der Musikwissenschaftler Anselm Gerhard, Mitherausgeber des höchst empfehlenswerten Verdi-Handbuchs (Bärenreiter), skizziert das Selbstbildnis des Komponisten als das eines »ungehobelten Landmanns aus dem gottverlas-senen Flecken Le Roncole in der Po-Ebene, der sich unter widrigsten Bedingungen aus ärmli-chen Verhältnissen so weit hochgearbeitet hat, dass er einen Studienaufenthalt in Mailand fi-nanzieren konnte, dort vom Konservatorium schmählich zurückgewiesen wurde, dann aber – unbeirrt von Schicksalsschlägen – doch zu ersten Erfolgen kam und sich schließlich in langen, langen ›Galeerenjahren‹ einen beschei-denen Wohlstand erarbeiten konnte.«
In Wahrheit handelt es sich bei Verdis »be-scheidenem Wohlstand« um ein erkleckliches Vermögen (von 1750 Franken Gage für seinen Erstling Oberto bis zu 150 000 Franken – rund vier Millionen Euro – für Aida), die »Galeeren-jahre« verdanken sich nicht zuletzt einer gewis-sen Raffgier, am Mailänder Konservatorium scheitert er aus handfesten Gründen (er ist nämlich zu alt), das Studium bezahlt sein Gön-ner und späterer Schwiegervater Antonio Ba-rezzi, und die Verhältnisse schließlich, aus de-nen Verdi stammte – der Vater betrieb eine Gastwirtschaft und investierte früh in die Bil-dung des Sohnes –, waren so ärmlich nicht. Der typische Künstlermythos des 19. Jahrhunderts: Je tiefer das Genie stapelt, umso heller strahlt sein Licht. Auch Wagner wurde nicht müde zu betonen, wie hundsmiserabel er Klavier spielte.
Das Sphinxhafte bei Verdi aber kennt noch eine andere Dimension, und die katapultiert den uomo di teatro und Realisten endgültig ins Weltanschauliche, immer Heutige. Indem er seine Lebensspuren bis zur Unkenntlichkeit ver-wischt, sagt Verdi: Wahrhaftig ist ohnehin nur die Kunst. Und sei es, um aus ihr heraus das ei-gene Leben zu verändern. Er sagt es, wie immer, ohne den Zeigefinger zu erheben.
www.zeit.de/audio
Verdi, opulent: Eine Szene aus »Aida« in der
Inszenierung von Franco Zeff irelli an der Mailänder Scala 2006.
Unten das letzte Foto des Maestro, um 1900
Foto
s (A
uss
chn
itte
): e
pa
ansa
/p
ictu
re-a
llian
ce/
dp
a (o
.);
Mar
y E
van
s P
ictu
re L
ibra
ry

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4154 FEUILLETON Kino
In die Ferne, immer nach HauseDieser Film ist ein krönendes Alterswerk. Edgar Reitz erweitert seine Trilogie um die »Andere Heimat«. Es ist eine Rückkehr zum ganz großen Kino VON THOMAS E. SCHMIDT
Was für ein gewaltiger, die Augen bezaubernder, zu Herzen gehender Film, was für eine große, ein-fache Geschichte von ei-nem jungen Menschen, der ausziehen will, das
Leben zu lernen, den die Sehnsucht in die Ferne treibt, die Liebe berührt, die Pflicht plagt, der re-belliert und resigniert und dennoch seine Würde nicht verliert, selbst wenn sein Krähwinkel an ihm hängt wie Blei. Was für eine selbstbewusste, un-zeitgemäße Kino-Suche nach der Ernst Blochschen Heimat: »was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war« – und wohin in Wirk-lichkeit niemand je gelangen wird. Was für ein künstlerischer Gipfel der Schabbach-Mythologie dieses Regisseurs, der noch einmal tief hinabsteigt in die Vergangenheit des fiktiven Welt-Dorfes im Hunsrück, den Grund nachlegt für seine film-epische Trilogie Heimat. Und es ist keine Geschich-te von Auszug und Rückkehr, die er erzählt, son-dern eine des Dableibens und der Sehnsucht.
In drei zwischen 1982 und 2003 entstandenen Staffeln hatte Edgar Reitz das späte 19. und 20. Jahr-hundert bis zum Fall der Mauer sondiert. Mit mehr als 50 Stunden Film ist seine Heimat ein gewaltiges Epos und ein nicht minder gewaltiges Projekt sub-jektiver Geschichtsschreibung. Nun kehrte er nach Schabbach zurück, vielleicht ein letztes Mal, nach Schabbach um die Mitte des 19. Jahrhunderts, zu Zeiten der Hungersnöte und der großen Auswan-derungsbewegungen. Arm ist der Schmied Simon, arm wie alle in der Gegend, und sein jüngerer Sohn
Jakob, der im Zentrum der Geschichte steht, ist ein Nichtsnutz, weil er Bücher liest. Von Brasilien träumt Jakob (Jan Dieter Schneider), sogar von den Urwald-indianern. Ihre Sprache hat er sich selbst beigebracht aus den Schwarten, die sein Onkel für ihn vorm zürnenden Vater versteckt. Da ist ein fruchtloser Funken Geist, Fantasie, Persönlichkeit, etwas Ver-dächtiges, was vom Überlebenskampf ablenkt. Jakob kassiert Prügel. Trotzdem scheint da einer schlafwand-lerisch durchs Leben zu gleiten. Er lernt sein Jettchen (Antonia Bill) kennen, die Tochter eines Steinschlei-fers, es wird die Liebe seines Lebens bleiben, aber das Leben hat nicht dieses Glück für Jakob vorgesehen.
Jettchen nämlich begeht auf einer Kirmes einen Fehltritt, nur so. Das Weitere regelt das Dorf: Sie heiratet erwartungsgemäß Jakobs Bruder Gustav (Maximilian Scheidt). Schon schwanger, zieht sie in den kargen Haushalts der Simons, und es ist nicht die reine Freude. Werber ziehen durchs Land, die Brasilien als das neue Paradies anpreisen. Ihre Lockungen bleiben in diesem verlorenen Teil Preußens nicht ungehört. Nur Jakob, ein gedulde-ter Störenfried, vor Aufbruchsdrang berstend, kommt nicht fort. Mal ist es Freundschaft, mal die kranke Mutter, mal die reine Not: Immer gibt es einen Grund zu bleiben. Als dann das Kind stirbt, entschließen sich Jettchen und Gustav zum Aus-wandern. Da begreift auch Jakob, dass er bei den Eltern bleiben muss. Die Hoffnung stirbt, und die Sehnsucht überlebt sie noch lange.
Es ist nicht die Geschichte, also die Handlung als solche, die den Film so besonders macht. Die Hand-lung ist vielschichtig und mäandernd wie das Leben selbst, ein klassischer Plot wird jedenfalls nicht daraus.
Reitz hat auch keine historisch korrekte Kulisse er-richtet, um darin ein zeittypisches Drama ablaufen zu lassen. Dennoch haben sein Team und er große Sorgfalt darauf verwendet, Stimmigkeit herzustellen, mit Gerätschaften, Materialien, Gesten, Kostümen, Gesichtern, Proportionen.
Sehr genau ist diese Welt gear-beitet, aber der erste Eindruck ist doch eine Verfremdung: Das Hunsrücker Platt quält, die Armut fällt gar nicht pittoresk aus, die Debütanten und Laienschauspie-ler, die Reitz engagierte, überspie-len gelegentlich, und eine weltan-schauliche Tröstung hält der Film auch nicht parat. Das Ganze rückt fern. Manchen wird das verunsi-chern. Der Zuschauer muss selbst dafür sorgen, dass es wieder heran-kommt, vielleicht tätiger hinsehen als in anderen Filmen.
Dann jedoch wird er möglicherweise auf ein Geheimnis stoßen. Wie es diesem Regisseur ge-lingt, die Dinge und die Menschen und die Zeit – sowohl die vier Stunden des Films als auch die er-zählte Zeit von Jakob Simons Jugend – miteinan-der in Beziehung zu setzen. Daraus wird ein sinn-lich wahrnehmbarer Kosmos, eine echte Eigen-welt. Nichts drängt sich in den Vordergrund, nicht der Protagonist, nicht die Requisiten, auch nicht die Schauspieler, denn hier gibt es keine Stars zu bewundern, die in künstlich schlichten Rollen brillieren. Vielmehr Gesichter, oft in Großaufnah-men, in denen sich Überwältigung, Angst, Zuver-
sicht oder Trauer spiegeln, Menschen mit einem Schicksal. Das ist die Gemütserregungskunst des Kinos, die gute, alte, ursprüngliche, der atemlose Augenblick, wenn der Saal sich verdunkelt und die Bilder sich zu bewegen beginnen.
Der über leere Felder pfeifende Wind spielt eine Rolle, eine gehetzte Wolke über der Eifel, die dürren Rippen einer alten Mähre oder das Quiet-schen des Webstuhls. Reitz verzau-bert diese Welt, aber nicht im Sin-ne eines idealisierten Zurück. Ja-kobs Dasein ist kein Idyll und wird kein solches. Natur- oder Sozialro-mantik fallen aus. Auch die andere Heimat ist ein Konstrukt, vermut-lich ein noch stärker künstlerisch durchgebildetes, noch skrupulöse-res als alle vorausgehenden Hei-maten von Edgar Reitz.
Das Cinemascope-Format erzeugt Raum-empfinden. Durch extreme Weitwinkel bei In-nenaufnahmen vermeidet er die Banalisierungen der TV-Ästhetik. Im Schwarz-Weiß mit seinen Tönungen und Kontrasten setzt Reitz hin und wieder einen Farbakzent. Manchmal leuchtet ein glühendes Hufeisen auf oder der Anstrich einer Wand, ein Blumenstrauß oder der Blick durch eine geschliffene Steinscheibe. Dann ist es wie die Vision einer besseren Welt, als wenn das Unbewusste der Figuren den Dingen plötzlich ein Leben einhauchte. Eine äußert lichtemp-findliche Kamera (Gernot Roll) verleiht den Einstellungen Tiefe, den Landschaftsaufnahmen
besonders. Sie erinnern an Walker Evans, Alfred Stieglitz oder Ansel Adams.
Der Held muss also am Orte bleiben. Die ande-re Heimat ist eine Art Rückbiegung auf sich selbst, ohne die Lust des Auszugs und ohne das Sichver-lieren in der Ferne. Das ist kein Scheitern, aber auch kein Triumph über die Malaisen der Zeit. Am Ende heiratet Jakob Jettchens Freundin, das Florinchen (Philine Lembeck), er repariert dem Vater die Dampfmaschine und korrespondiert mit berühmten Gelehrten in Sachen Indianersprachen. Und dann kommt der berühmteste von ihnen im Dorfe vorbei: Alexander von Humboldt auf der Durchreise nach Paris. Er möchte dem Kollegen seine Reverenz erweisen und Jakob an die Akade-mie nach Berlin holen. Der aber flieht vor dem Vornehmen ins Feld, verstört, aber auf seine Weise auch mit sich und den Umständen versöhnt.
Den Humboldt spielt Werner Herzog. Am We-gesrain sitzt Edgar Reitz und weist ihm den Weg nach Schabbach hinein. Das ist nur eine kurze Episode, und sie wirkt wie die Signatur auf einem Gemälde. Auch dieser Film ist eine Art Rückkehr in die cineastische Heimat, eine Rückbiegung ins eigene Werk. Reitz knüpft am Autoren- und Er-zählkino des Neuen Deutschen Films an: zurück zu den versponnenen, ambivalenten Geschichten, die damals mit ihm Werner Herzog, Wim Wen-ders oder Werner Schroeter erzählt haben. Was diesen Film auszeichnet, ist Intensität. Man muss das aushalten können. Die meisten Filme nötigen einem heute eine geringere innere Beteiligung ab. Die Andere Heimat ist ein großes Alterswerk, eine Selbstvergewisserung, eine Summe.
Der Regisseur Edgar Reitz, 80: Landvermesser zweier Jahrhunderte
Jakob mit Mutter ( Jan D. Schneider und Marita Breuer) sowie Maximilian Scheidt als Bruder
Foto
s: C
hri
stia
n L
üd
eke
/C
on
cord
e F
ilve
rle
ih 2
01
3 (
2);
Je
ff V
esp
a/W
ire
Imag
e/
Ge
tty
Imag
es
(u.)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 FEUILLETON 55
Schwul in Las VegasSteven Soderberghs warmherziger Film über den Kitschpianisten Liberace VON JÖRG LAU
D as Paradox des öffentlichen Lebens von Władziu Valentino Liberace: Kein an-derer Künstler kultivierte schwule Selbstinszenierung so offen wie Libera-
ce auf den größten Bühnen – und doch hat er bis zu seinem Tod durch Aids im Jahr 1987 mit allen Mitteln sein Outing verhindert. Er hat den Life-style einer unmissverständlichen »Queen« kulti-viert und doch zig Prozesse gegen die Nachrede geführt, er sei homosexuell. Mitten in der schrills-ten Inszenierung seiner grenzgängerischen Homo-sexualität hat er das private Leben mit Zähnen und Klauen verteidigt.
Er wollte irgendwie erkannt werden und hat doch die Entdeckung gefürchtet. Das war seine tragische Ambivalenz, nicht ungewöhnlich für schwules Leben vor der Befreiung, aber von Libe-race auf der größtmöglichen Bühne überlebens-groß exzentrisch vorgeführt. Steven Soderberghs großartiger Film Liberace – zu viel des Guten ist wunderbar kreist darum. Er blickt zurück auf Li-berace nicht mit dem Hochmut vermeintlich freie-rer Spätgeborener. Soderbergh zeigt den Pianisten und Performancekünstler (Michael Douglas in der Rolle seines Lebens) als Pionier. Eine frühe Szene bringt es auf den Punkt: Der junge und sehr blon-de Scott Thorson (Matt Damon mit süßer Siebzi-ger-Topffrisur) wird von einem Lover in Liberaces
Las-Vegas-Show mitgenommen. Hunderte älterer Damen mit blaustichig gefärbten Haaren liegen dem großen Entertainer zu Füßen, der in einem Glitzerkostüm auf der Bühne auf und ab schreitet und anzügliche Witze macht. Scott fragt verblüfft, wie die konservativen Damen »etwas so Schwules so gut finden können«. Sein Begleiter kontert: »Sie haben keine Ahnung, dass er schwul ist.« Die Da-men träumen vielleicht davon, dass ihre Männer so extravagant, witzig, nett und charmant wären wie dieser effeminierte Mann mit den Riesenklun-kern. Warum sie aufschrecken?
Liberace – das zeigt Soderberghs Film – wollte Souverän über die Definition seiner sexuellen Identität bleiben. Und das bedeutete für den frommen Katholiken, den Sohn einer Polin und eines italienischen Einwanderers aus Wisconsin: lieber nicht »out of the closet« kommen. Denn dann würden die anderen, die vermeintlich Nor-malen mit ihren dumpfen Begriffen vom Schwul-sein, bestimmen, wer du bist und wen du lieben darfst. Allerdings: Wenn man schon im »Schrank« bleiben musste, dann konnte man diesen doch wenigstens mit allem Pomp ausstatten. Auf der Höhe seines Ruhms besaß Liberace 13 Villen in einem Stil, den er selbst »Palast-Kitsch« nannte. Lauter kleine Neuschwansteins, darin das Künst-ler-Ich als absoluter Herrscher im seidenen Neg-
ligé umherschritt, einen seiner 17 Pudel auf dem Arm. Soderbergh feiert diese Welt mit viel Wär-me und historischer Akribie.
Im Kern steht eine Liebesgeschichte. Älterer Künstler trifft junge Blonde, charmiert sie und überhäuft sie mit Geschenken. Die Blonde kommt aus schwierigen Verhältnissen und sucht eine Vaterfigur, er gibt ihr ein Zuhause und be-kommt dafür fleischliche Freuden. Sie hofft auf Ruhm und Reichtum und Karriere, er überwin-det Einsamkeit und Zweifel der mittleren Jahre. Dann kommt es zu Trennung und hässlichem Prozess um viel Geld. Das ist nichts Ungewöhnli-ches, nur dass sich das hier zwischen zwei Män-nern abspielt.
Damon und Douglas spielen die ungleichen Liebenden so brillant, dass man kaum je darüber nachdenkt, dass hier zwei Heteros durch die Bet-ten rollen. Die Lust der beiden aneinander ist glaubwürdig: »Oh mein Gott, war das gut«, sagt Douglas einmal voller Befriedigung im Bett, »lass uns Shoppen gehen!« Das Script ist so freizügig, dass kein Studio sich bereitfand, den Film zu fi-nanzieren. Nur der Bezahlsender HBO hatte ge-nug Mumm – und wurde zu Recht mit drei Em-mys belohnt. Liberace ist unsentimental und doch warmherzig, unkorrekt und witzig und auf erfri-schend natürliche, liebevolle Weise obszön. Michael Douglas (links, als Liberace) und Matt Damon (als sein Liebhaber Scott)
KinoFo
to:
© d
cm 2
01
3

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4156 KUNSTMARKT
Wenn sich Wertschätzung in Zah-len ausdrückt, dann sieht es der-zeit nicht gut aus für die Alten Meister. Vor ein paar Tagen hat das Auktionshaus Christie’s in
London seine Bilanz für das erste halbe Jahr 2013 veröffentlicht. Mit Kunst, die nach 1945 entstan-den ist, hat das umsatzstärkste Unternehmen der Branche von Januar bis Juni 665,4 Millionen Pfund erlöst. Bei den Alten Meistern betrug der Umsatz dagegen nur etwas mehr als ein Zehntel. Aber das bedeutet weder, dass sie keine Liebhaber finden, noch dass die aktuelle Kunst heillos über-bewertet ist. Tatsächlich war es noch nie anders. Auch in früheren Jahrhunderten wurden Zeitge-nossen immer teurer gehandelt als die Kunst ver-gangener Epochen.
Und betrachtet man die Zahlen etwas genauer, so ist der Altmeister-Markt im Moment sogar ge-rade dabei, ganz ordentlich zuzulegen. Die 78 Millionen Pfund, die Christie’s in diesem ersten Halbjahr damit erzielt hat, bedeuten gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von immerhin neun Prozent. Und auch die Zuschläge der jüngsten Auktionen bei den kleineren Auktionshäusern, bei Koller in Zürich, Lempertz in Köln und Hampel in München, können sich sehen lassen – selbst wenn manche Kaufentscheidungen so selektiv er-scheinen, dass sie die Grenze zum Irrationalen streifen. »Die Preise für Spitzenwerke, das heißt für Gemälde mit einem vergleichsweise bekannten Urheber, in gutem Erhaltungszustand und mit nachvollziehbarer Herkunft, haben im letzten Jahrzehnt deutlich angezogen«, sagt Mark MacDonald, Experte für die Alten Meister beim Wiener Auktionshaus Dorotheum und seit 25 Jahren im Geschäft. Allerdings gibt es längst nicht so viele Bieter wie bei den Zeitgenossen. Wenn dort zwanzig um ein Werk konkurrieren, sind es bei den Alten Meistern zwei. Das hat zur Folge, dass die eher durchschnittlichen Arbeiten, mit de-
nen man (noch) keinen Künstlernamen verbinden kann, mit denen nicht so pfleglich umgegangen worden ist, stagnieren – und das teilweise auf ei-nem unanständig niedrigen Niveau.
Man denkt global,kauft aber lokal
Letzten Mittwoch bot das Kölner Auktionshaus Lempertz ein reizendes kleines Gemälde eines un-bekannten flämischen Malers des 18. Jahrhunderts an. Der hatte sich zwar nicht entscheiden können, ob er die Bauern, den Pferdekarren und die Kühe lieber in seine belgische Heimat oder nach Italien verlegt, und dann einfach beides in einem Bild ver-eint. Aber es ist gekonnt ausgeführt, das Kolorit kräftig und ansprechend, die Komposition ausge-wogen, das italienische Licht auf Reisen offenkun-dig selbst erlebt – und das soll nur 1000 Euro kosten? Und selbst für diesen Betrag hat es keinen Käufer gefunden? Ein anderes, vielleicht noch schlagenderes Beispiel: Hampel in München hatte vorvorige Woche unter anderem einen aufziehen-den Gewittersturm am Meer von Allart van Ever-dingen (1621 bis 1675) im Angebot. Nun gehören Seestücke nicht zu den Werken, mit denen der später zeitweilig nach Skandinavien ausgewanderte Everdingen zu einem der herausragendsten Land-schaftsmaler des 17. Jahrhunderts wurde. Und rei-nigen müsste man es auch einmal. Aber dass sich überhaupt niemand dafür erwärmt hat, zum Preis von 12 000 Euro, dem Gegenwert eines fünf Jahre alten VW Golf? Das kann eigentlich nicht sein.
Uneigentlich aber eben doch. Und Lempertz hat bei dieser – intern nur »klein« genannten – Altmeis-ter-Auktion der vergangenen Woche (die »große« folgt am 16. November) natürlich auch einige erheb-lich bessere Ergebnisse eingespielt. Ein Gemälde, das einen Festakt auf der Piazzetta von San Marco in Venedig zeigt und von dem man nicht weiß, ob es von Antonio Canal (dem bekanntesten der verschie-
denen »Canalettos«) oder bloß von einem Gehilfen aus dessen Atelier stammt, war auf 8000 bis 10 000 Euro geschätzt. Es brachte inklusive Aufgeld 53 000 Euro. Ähnlich verhielt es sich mit Franz Alekseje-witsch Roubauds dezent realistischen, dezent sozial-kritischen Fischern am Schwarzen Meer in sanfter Abendsonne. Auf der vorangegangenen Auktion war es mit 10 000 bis 15 000 Euro noch durchgefallen. Jetzt legte ein Russe dafür 34 000 Euro auf den Tisch.
An dem Roubaud lassen sich zwei Entwicklun-gen ablesen. Zum einen zählt allgemein alles, was aus dem 19. Jahrhundert kommt und nicht im-pressionistisch ist, inzwischen zu den Alten Meis-tern. Und zweitens ist der Altmeister-Markt der-zeit anscheinend relativ regional strukturiert. Man denkt global, kauft aber lokal. Will heißen: »Rus-sen ersteigern russische Kunst, Österreicher öster-reichische. Niederländische Stillleben des 17. Jahr-hunderts gehen häufig nach Holland, und Italiener interessieren sich meistens für italienische Gemäl-de« hat Mark MacDonald beobachtet, der mo-mentan durch Europa fährt, um die kommende, sicher lohnenswerte Auktion im Palais Dorotheum am 15. Oktober vorzubereiten. Doch das führt nicht dazu, dass einzelne Künstler oder Kunstland-schaften besonders gefragt wären. »Einen eindeuti-gen Markttrend gibt es gegenwärtig nicht«, sagt auch Mariana Hanstein vom Auktionshaus Lem-pertz. Gekauft wird potenziell alles, und das quer-beet: jede Epoche, jedes Genre, jedes Format.
Seit Jahren auffallend gut aufgestellt, wenn es um Alte Meister geht, ist das Auktionshaus Kol-ler in Zürich, mittlerweile eines der führenden Häuser in Europa. Kollers Auktion fand am 20. September statt, und es gab dort große Namen und hinreißend schöne Bilder. Etwa ein pracht-volles, unvergleichlich delikat gemaltes Stillleben mit grünen Trauben, gelben Zitronen und leuchtend rotem Hummer vor einem matt schimmernden Silberpokal von Jan Davidsz de Heem. Solche Gemälde haben ihren Preis, auch
wenn er in Relation zu den Richters und War-hols von heute bescheiden erscheint: 940 000 Franken. Auch Lucas Cranach der Ältere geht offenbar immer, gerade wenn es sich um eine ei-genhändige Arbeit handelt, an der die Werkstatt nicht viel herumgepinselt hat. Die Anbetung Christi war mit einer Schätzung von 400 000 bis 600 000 Franken angekündigt und brachte den höchsten Zuschlag: mehr als eine Million.
Eine Madonna des 16. Jahrhundertsblieb ohne Bieter
Geradezu als Schnäppchen erwies sich das nächste wundervolle Stillleben, das, verglichen mit de Heems Bild, fast monochrome, in Braun- und Grautönen gehaltene, aber nicht minder delikate Gemälde mit verschiedenen Gefäßen und einem Schinken von Pieter Claesz Heda: Anfänglich auf-gerufen bei schlappen 50 000, holte es 84 000 Franken. Auch dieser Preis erscheint einem irgend-wie zu niedrig. Einem anderen Gemälde in Muse-umsqualität, der ebenfalls in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstandenen Madonna des »Meisters von Frankfurt« war da weniger Glück beschieden. Das Werk des Malers, dessen Namen man nicht kennt, der aber Alt-Niederländern wie Jan van Eyck und Rogier van der Weyden nahege-standen haben muss, war auf 100 000 bis 150 000 Schweizer Franken angesetzt – und blieb liegen.
Mit 66 000 Franken knapp über dem untersten Gebot ging das Interieur eines Sammlers des Ant-werpener Malers Hieronymus Francken d. J. weg. Es ist eine Art frühes Suchbild. An den Wänden lehnen und hängen diverse Gemälde. Auf dem Tisch steht ein garantiert nicht italienischer, etwas verweichlicht wirkender Herkules aus Marmor. Und im Hinterzimmer sitzen gut gekleidete Kunst-sammler des frühen 17. Jahrhunderts um einen Globus und führen offenbar eine rege Diskussion – womöglich über Preise.
Große Kunst für kleines GeldAlte Meister sind eigentlich viel zu günstig. Das zeigt sich etwa bei den Herbstauktionen von Hampel in München, Koller in Zürich
und im Wiener Dorotheum VON ULRICH CLEWING
Feuilleton
Reichsadlerin StuttgartDie sogenannten Reichsadlerhumpen waren um 1600 ein beliebtes Produkt der Glasmaler etwa in Böhmen, Schle-sien und Sachsen. Die Wappengläser wurden massenhaft hergestellt und zeug-ten von der Sehnsucht nach der Reichs-einheit. Beim Auktionshaus Nagel in Stuttgart wird nun in der Versteigerung am 9./10. Oktober ein besonderer Hum-pen angeboten, er trägt neben dem dop-pelköpfigen und mit dem Reichsapfel geschmückten Adler des Heiligen Römi-schen Reichs sowie den 56 Wappen von »Trier« bis »Coln« auch die Jahreszahl 1591. Bisher waren nur zehn vergleich-bare Exemplare aus der letzten Dekade des 16. Jahrhundert bekannt. Das aus Böhmen stammende elfte Stück wird auf 10 000 Euro geschätzt. JAN BYKOWSKI
Christie’s in Shanghai
An den wachsenden Auktionserlösen in Europa und Amerika haben chinesische Käufer schon seit Längerem ihren An-teil, nun kommt der Markt zu ihnen. Christie’s konnte seine erste Auktion in Shanghai mit einem Gesamterlös von 25 Millionen US-Dollar abschließen. Be-feuert wurde das gute Ergebnis auch durch das Bild Homeland des einheimi-schen Malers Cai Guo-Quiang, in seiner speziellen Technik unter Einsatz von Schießpulver entstanden und zur Unter-stützung der Neueröffnung des Quan-zhou Museum of Contemporary Art für 15 Millionen RMB (2,4 Millionen US-Dollar) versteigert. SEBASTIAN PREUSS
Wiener Werkstätte in Heidelberg
Eine silbergetriebene, mit Elfenbein ver-zierte Schmuckdose aus dem Jahr 1912 hat im Heidelberger Auktionshaus Kunst & Kuriosa zu einem erstaunlichen Bietergefecht geführt, das den Hammer-preis von 12 000 auf 110 000 Euro trieb. Das ist ein Rekordergebnis für den Künstler, Innenarchitekten und Mode-schöpfer Josef Eduard Wimmer-Wisgrill (1882 bis 1961). Er war als Schüler von Koloman Moser zur Wiener Werkstätte gekommen und leitete dort die Mode-abteilung. LISA ZEITZ
»Neues vom Markt« wird erstellt in den Redaktionen von WELTKUNST und KUNST UND AUKTIONEN. Beide erscheinen im ZEIT Kunstverlag
59,6Karat hat der lupenreine pinkfarbene Diamant, den Sotheby’s am 13. No-vember in Genf versteigern wird. 1999 von De Beers in einer südafri-kanischen Mine gefunden und zwei Jahre lang geschliffen, ist der Pink Star der teuerste Diamant, der jemals zur Auktion kommt: Er wird auf über 60 Millionen Dollar geschätzt.
ZAHL DER WOCHE
NEUES VOM MARKT
»Interieur eines Sammlers« vonHieronymus Francken d. J., für 55 000 Franken versteigert beimAuktionshausKoller in Zürich
Ab
b.:
Ko
ller
Au
kti
on
en
Zü
rich

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Nur keine Angst, man darf es in die Hand nehmen, das gute Stück ist schwerer als vermutet. Wegen des
massiven Sockels, wegen der vergoldeten Bronzeapplikationen. Jetzt mal bitte die Vase so halten, dass Licht durchschimmert – hat man so etwas Pures, Reinweißes schon gese-hen? So seidig-opak wirkt das Glas, als habe jemand in einer Sommernacht eine Stück vom Mond abgetrennt, daraus eine geome-trisch halbkreisförmige Schale geformt und sie mit zwei schwungvoll-filigranen Henkeln stabilisiert. Sehr raffiniert, dieser Kontrast von Linie und Kontur, von hell und dunkel, matt und glänzend. Ein Stück mit Geschich-te. Die Berliner Bronzegießerei Werner & Mieth, eigentlich eher bekannt für außerge-wöhnliche Kronleuchter, schuf solche deko-rativen Gefäße aus Flussglas um 1800 he-rum. Die gläserne Rohware dafür lieferten zunächst schlesische Manufakturen. Bald war der Berliner Produzent aber mit der Qualität des schlesischen Glases nicht mehr zufrieden: Böhmen lieferte Besseres.Der sei-dige Schimmer des Materials war einer be-sonderen Zutat zu verdanken.
Der Hamburger Kunsthändler Frank C. Möller hat sich regelrecht vergraben in die Geschichte dieser Schmuckvasen – und Er-staunliches zutage gefördert: Etwa, dass ein Zusammenhang besteht mit einer Rezeptur für Glasmischungen aus dem Jahr 1796. Darin wird unter anderem eine Beimischung von etwa 3 Prozent Flussspat (Kalziumfluo-rid) erwähnt, die »sowohl die Färbung als auch die Leuchtkraft beeinflusst haben dürf-te«. Oder dass diese in Berlin hergestellten
Objekte ausschließlich für den Export be-stimmt waren – um für den inländischen Markt arbeitende schlesische Glasmacher vor Konkurrenz zu bewahren. Der preußische Hof kaufte dennoch ordentlich ein bei Wer-ner & Mieth. In einem Inventar für das Pa-lais in Berlin werden zwei Tafelaufsätze der Firma beschrieben. Darin heißt es: »4 große Vasen in länglicher Proportion, ebenfalls von matt weißem Glase und mit Blumen bemalt, in einem bronzenen Gefäß mit drei Füßen hängend ...« Für Werner & Mieth arbeiteten übrigens auch der Architekt Hans Christian Genelli und Karl Friedrich Schinkel.
Nach und nach hat Möller mehr als ein Dutzend solcher Flussglasvasen aufgespürt – Deckelvasen, Leuchtervasen, manche da-runter bemalt mit allegorischen Figuren und mit dekorativsten Bronzeapplikationen ver-sehen. Eine hat das New Yorker Metropoli-tan Museum gekauft. Unser schlichtes Traumstück soll 12 000 Euro kosten (www.frankmoeller.eu).
Schlicht opakSelten und elegant: Eine Vase aus Flussglas VON ANNA VON MÜNCHHAUSEN
Ganz klar klassizistisch: Flussglas aus Berliner Produktion, um 1800
TRAUMSTÜCK
Wenn der letzte Pinselstrich ge-setzt ist, der Feinschliff stattge-funden hat, das Werk signiert ist, dann ist die Arbeit für einen Künstler noch nicht unbedingt
getan. Gerade in Zeiten, in denen der Kunstmarkt mehr als alles andere über Wohl und Wehe eines Künstlers entscheidet, sind nach der Fertigstel-lung eines Werkes noch andere Talente gefragt. Nun geht es, in der Sprache des Marktes gespro-chen, um Product-Placement, darum, die eigenen Werke so in der Öffentlichkeit zu platzieren, dass sie letztlich einen guten, gar einen sensationellen Preis erzielen.
Die erfolgreichsten Künstler der letzten Jahre haben eine enorme Fähigkeit darin, die besten Orte und Anlässe für die Präsentation ihrer Wer-ke zu finden. Damien Hirst, Takashi Murakami oder Jeff Koons haben die Produktion selbst an Spezialkräfte delegiert; der Künstler kommt, nachdem er die Konzepte und Pläne geliefert hat, erst zur Endabnahme – und beginnt dann damit, für das Werk eine Marktkarriere zu entwickeln. Oft in Zusammenarbeit mit einem Galeristen wird entschieden, wo man es zeigt und welcher Käufer ihm am meisten Reputation geben kann.
Aber selbst wenn es in einer noblen Privat-sammlung untergekommen ist, gilt es, sich weiter um die Steigerung des Marktwerts zu bemühen. Denn zum wichtigsten Indikator für den Rang eines Künstlers sind Auktionsergebnisse gewor-den. Innerhalb des letzten Jahrzehnts haben sich die großen Abendauktionen der wichtigen Aukti-onshäuser zu einer Art von Weltmeisterschaft für Künstler entwickelt. Hier gut abzuschneiden be-deutet nicht nur, die Preise für neue Werke erhö-hen zu können, sondern heißt auch, in den Feuil-letons vorzukommen, vor allem aber Einzug in die Kunstgeschichte zu halten. Waren es früher Museen, die einem Künstler ein Gütesiegel ver-
passten, sind es heute die bei einer Auktion erziel-ten Millionensummen.
Ein Künstler muss also gut vorgearbeitet ha-ben, wenn der Fall eintritt, dass einer seiner Sammler ein Werk versteigern lassen will. Klar hat auch das Auktionshaus ein Interesse an einem guten Ergebnis, wird also seinerseits den Markt vorab genau abschätzen. Ist zu wenig Nachfrage erkennbar oder fanden Versteigerungen von Wer-ken desselben Künstlers zuletzt zu häufig statt, wird lieber ein, zwei Jahre gewartet. Aber noch so viel Marktsensibilität nützt wenig, wenn die Wer-ke dem Käufer nicht genügend Statusgewinn ver-sprechen, das Image des Künstlers also nicht inte-ressant genug ist. Und dafür ist dieser primär selbst verantwortlich.
Misslingt die Preisspekulation, wäre Jeff Koons auf Jahre hinaus verbrannt
Diesen Herbst wird es wieder spannend. Deutlicher als bisher wagt sich Christie’s mit der Ankündigung hervor, einen neuen Preisrekord für das Werk eines zeitgenössischen Künstlers anzustreben. Am 12. November soll in New York Balloon Dog (Orange) von Jeff Koons versteigert werden: zu einem Preis zwischen 35 und 55 Millionen US-Dollar. Offenbar ist man sich ziemlich sicher, ein entsprechendes Auktionsergebnis erzielen zu können, denn andern-falls wäre der Schaden für das Auktionshaus, vor allem aber für den Künstler gewaltig. Auf Jahre hi-naus wäre er verbrannt, ja könnte sich vielleicht nie mehr erholen von einem Misserfolg bei einer so groß lancierten Versteigerung.
Aber wenn jemand in den letzten Jahren alles getan hat, um den Wert seiner Werke zu steigern, dann Koons! Dabei hat er sogar eine eigene Me-thode entwickelt, seine Arbeiten nach und nach mit so viel Bedeutung aufzuladen, dass sie schließlich nahezu alles in sich versammeln, was die Kulturge-
schichte an Werten zu bieten hat. Statt nur in re-nommierten Häusern auszustellen, achtet er darauf, seine Werke auch an ungewöhnlichen und status-trächtigen Orten, in immer wieder anderem Am-biente zu zeigen: Er hat im Schloss Versailles aus-gestellt, inmitten der barocken Hofkunst des 17. Jahrhunderts, er konnte seine Werke am Canale Grande in Venedig präsentieren, sie waren im Liebig-Haus in Frankfurt zu sehen und dort, je nach Sujet, zwischen Skulpturen ägyptischer, mittelalterlicher oder klassizistischer Kunst angeordnet. Dabei geht jeweils etwas vom Flair der Umgebung auf Koons’ Arbeiten über: Sie geben sich auf einmal genauso prunkvoll wie Lifestyle-Accessoires des Sonnenkö-nigs oder wirken altehrwürdig und ernsthaft wie ein Sakralwerk aus Antike oder Mittelalter. Mit jedem Ausstellungsort haben die Werke von Koons also gleichsam eine zusätzliche Schicht Firnis erhalten, die sie noch bedeutsamer erscheinen lässt.
Balloon Dog (Orange) war auch in Versailles und Venedig, zudem sogar auf dem Dach des New Yor-ker Metropolitan Museum of Art platziert. Das alles ist im Auktionskatalog von Christie’s natürlich er-wähnt, ja es wird suggeriert, das Werk sei nun, wie ein Superstar nach einer spektakulären Welttournee, am Ziel angelangt. Als beliebteste Skulptur zeitge-nössischer Kunst wird es gepriesen; es gehöre bereits in den Kanon der Kunstgeschichte. Und es ist – wohlgemerkt bezogen auf einen Hund! – von Kind-heit, Hoffnung, Unschuld die Rede. Das sind alles Worte, die Koons selbst gerne verwendet. In Inter-views und Vorträgen gelingt es ihm oft höchst ein-nehmend, seine Werke dank solch starker emotio-naler Begriffe umso gewichtiger erscheinen zu lassen. Dabei achtet er darauf, wie die Kunstwissenschaft-lerin Anne Breucha in ihrer Dissertation über die Interviews von Koons gezeigt hat, dass die Arbeiten jeweils mit Begriffen assoziiert werden, an die man zuerst gar nicht denkt: Wie im Fall der Ausstellungen geht es auch hier darum, durch überraschende Ver-
knüpfungen ein Maximum an Bedeutung zu er-zeugen, ja dieselben Werke immer wieder anderen semantischen Zusammenhängen auszusetzen, um sie nach und nach interessanter zu machen.
Vorbesitzer, Ausstellungen, Auktionen machen Kunst zum Statussymbol
Ausführlich ist im Auktionskatalog aber auch vom Sammler die Rede, der das Werk versteigern lässt. Dass Peter Brant viele Andy Warhols besitzt, ferner zahlreiche Werke von Jean-Michel Bas-quiat, Richard Prince oder Cindy Sherman, soll nochmals extra Eindruck machen – und belegt, wie geschickt Koons schon im ersten Schritt war, als er das Werk einem Sammler verkaufte, der seinerseits ein wertsteigerndes Ambiente bot.
Jenseits des Katalogs, in Pressetexten zur Auk-tion, wird auch kundgetan, dass vier Varianten von Balloon Dog, jeweils in anderer Farbe lackiert, schon im Besitz der größten Sammler, darunter Eli Broad und François Pinault, seien. Wer also in die Champions League des Kunstsammelns auf-steigen will, weiß, was er zu tun hat: Er muss am 12. November mitbieten. Damit aber ist auch klar, dass die Summe, zu der Balloon Dog (Oran-ge) versteigert werden wird, vor allem etwas darü-ber aussagt, wie ein Product-Placement, bei dem der Wert anderer Statussymbole abgeschöpft wird, selbst ein herausragendes Statussymbol schaffen kann. Ein Preisrekord aber wäre die Krö-nung: Mit seinem Geld würde der siegreiche Bie-ter nicht etwa den Wert des Werkes anzeigen, sondern dessen Rang als Statussymbol nur noch weiter steigern.
Wolfgang Ullrich ist Professor für Kunstwissenschaft an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Zuletzt von ihm erschienen: »Alles nur Konsum. Kritik der warenästhetischen Erziehung« (Verlag Wagenbach)
Kleine Kunst zum großen PreisWarum ein orangefarbener Pudel von Jeff Koons bald zu den teuersten Werken der Moderne zählen wird VON WOLFGANG ULLRICH
»Balloon Dog (Orange)« von Jeff Koons, bei Christie’s in New York für 35 bis 55 Millionen Dollar im Angebot am 12. November
KUNSTMARKT 57Feuilleton
Ab
b.:
To
m P
ow
el
Imag
ing/
Ch
rist
ie`s
Im
age
s LT
D 2
01
3 (
o.)
; W
ern
er
& M
ieth
, B
erl
in,
Foto
: M
ich
ael
Ho
lz S
tud
io/
Fra
nk C
. M
ölle
r

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4158 FEUILLETON
Die Französische Revolution Der Schriftsteller Claude Simon, vor hundert Jahren geboren,
hat in der europäischen Romankunst keinen
Stein auf dem anderen gelassen VON ANDREAS ISENSCHMID
Am Anfang war der Tod, immer nur der Tod, noch vor dem Le-ben. Bevor Claude Simon zur Welt kam, am 10. Oktober 1913, war Claude Simon schon gestorben, sein älterer Bruder gleichen Namens. »Er trägt bei
seiner Geburt den Namen eines Toten. Identitäts-anmaßung«, notiert Simon 1981 in persönlichen Aufzeichnungen, aus denen die Biografin Mireille Calle-Gruber zitiert. »Lange«, schreibt er, habe »ihn der Gedanke an diesen Bruder« verfolgt.
Der Tod kam zurück, als Claude Simon noch kein Jahr alt war. Am 27. August 1914, drei Wo-chen nach der Mobilmachung, fiel Simons Vater, Hauptmann Louis Simon, sein Regiment hatte in einem Monat 2900 Mann verloren, genauso viel, wie aufgebrochen waren.
Claude Simon war fünf Jahre alt, als er »auf der Suche nach einem unauffindbaren Skelett durch eine apokalyptische Landschaft geschleppt« wurde – so steht es im autobiografischen Roman Die Akazie (1989). Zwölf desolate Tage lang suchten im Spätsommer 1919 die Mutter, zwei Tanten und das Kind auf den schlammigen Schlachtfeldern Frankreichs nach dem Grab des Vaters.
Er war elf Jahre alt, als seine Mutter an Krebs starb. Er hatte mitansehen müssen, »wie die stets schwarz gekleidete Frau nach und nach zusammen-schmolz, eintrocknete, ihr bourbonisches Gesicht gegen das eines Stelzvogels, dann einer Mumie ver-tauschte«.
Simon war 25, als er – auf den Tag ein Viertel-jahrhundert nach dem Tod seines Vaters – am 27. August 1939 als Kavallerist eingezogen wurde. »Jetzt würde er sterben«, wie der Vater fortgegangen war, um »zu sterben«, dachte er auf der Eisenbahnfahrt zur Front.
Und er ist 26, als ihn am 17. Mai 1940 das väter-liche Schicksal um ein Haar ereilt. Seine Einheit wird in einem Hinterhalt bis auf zwei Mann aufgerieben, wie die väterliche. Simon will »inmitten der Explo-sionen, der Schreie, der Unordnung, des Gewiehers, der Galoppaden, der Flüche« wieder auf seine Stute steigen, da trifft ihn etwas wie der »Schlag eines Knüppels«, er erinnert sich als Letztes, dass sich sein Sattel samt Ausrüstung von oben nach unten dreht, – sens dessus dessous – »dann plötzlich nichts mehr, Dunkelheit, kein Geräusch«.
Der Augenblick, als er an diesem 17. Mai 1940 etwa um 8 Uhr früh aus seiner Bewusstlosigkeit er-wacht, ist die Geburtsstunde des Autors Claude Simon und seiner Kunst. Sie kommt aus der Dunkel-heit, aus Tod, Krieg und Untergang, und ist doch dem Leben, dem Licht und der Schöpfung ganz und gar zugewandt. »Niemals habe ich so sehr leben wollen, niemals habe ich mit solcher Gier, solcher Verzückung den Himmel betrachtet, die Wolken, die Wiesen, die Hecken ...« Simons Kunst findet für diese aus der Todesangst erwachsende Lebenslust Satzkonstruktionen und Erzählformen, die – nach Proust und Joyce – den europäischen Roman ein wei-teres Mal neu erschaffen. 1985 hat er dafür mit sel-tenem Recht den Nobelpreis für Literatur erhalten.
Im Mai 1940 wird Simon als Kriegsgefangener nach Sachsen verbracht. Als es kälter wird, sollen die nordafrikanischen Gefangenen, um ihnen den deut-schen Winter zu ersparen, in französische Lager ver-legt werden. Simon, den man eben noch als Juden denunziert hatte, bringt seinen Geburtsort, Tanana-rive auf Madagaskar, ins Spiel, und es gelingt ihm, als einziger Europäer zusammen mit 39 Arabern die Reise nach Frankreich anzutreten.
Am 27. Oktober 1940, einen Tag nach der An-kunft in einem Lager bei Bordeaux, glückt ihm die Flucht, er schlägt sich durch nach Perpignan, ins Haus der Familie. Er schläft, geht ins Bordell, ins
Kino, malt, liest, Rousseau und den ganzen Balzac, ernährt sich von den Fresspaketen, die ihm ins Lager geschickt wurden und die nun, mitten im Krieg, »mit dem Vermerk: im Lager unbekannt« zurückkommen.
Und als es Frühling wird, setzt er sich »eines Abends an seinen Tisch vor ein weißes Blatt Papier«. Der Tisch steht vor dem Fenster, an dessen im Wind sich bauschenden Vorhang er unwillkürlich in dem Moment gedacht hat, als er glaubte, sterben zu müs-sen, das Fenster geht auf die Akazie, die in seinen Büchern immer wiederkehrt. Sie ist das Bild des wie-dergefundenen Lebens und der künstlerischen Schöp-fung. Sie steht am Anfang des Romans Geschichte und am Ende von Simons schönstem und nach ihr be-nannten Buch Die Akazie. Man darf es als Gleichnis für den Weg Simons zu seiner Kunst lesen, dass er den Blick durchs Fenster auf seine Lebensbäume, auch den späteren im Sommerhaus von Salses, nicht nur mehrfach beschrieben hat, sondern auch gezeich-net und in einer Fotomontage gestaltet hat.
Wie ein Nahtod-Erlebnis im Zweiten Weltkrieg den Satzbau veränderte
Denn so schnell sich die Stunden vor und nach der Bewusstlosigkeit vom 17. Mai 1940 in den Mittel-punkt seiner Kunst geschoben haben, so lange hat es gedauert, bis Simon die künstlerischen Mittel gefun-den hat, ihnen gerecht zu werden. Als Stoff finden sie sich schon im zweiten Roman Das Seil (1947). In Der Wind (1957) und in Das Gras (1958) zeichnet sich dann der lange, alle Konventionen des Satzbaus sprengende Simon-Satz ab. Doch erst in Die Straße in Flandern (1960), seinem siebten, im Alter von 45 Jahren geschriebenen Roman, wird Simon auch die überkommene Romanform auflösen. Er verabschie-det Handlung, Chronologie sowie psychologisch kausale Schlüssigkeit und zwingt seine Leser statt-dessen in einen suggestiven Mahlstrom sich drehen-der und wiederholender Bilder, der in eine Lebens-tiefe führt, wie es sie in der europäischen Literatur vor Simon nicht gegeben hat.
Der beste Kommentar zu Simons künstlerischem Weg sind die Vier Vorträge (Quatre Conférences), die sein Stammverlag Editions de Minuit – ein Kind der Résistance, an der auch Simon 1944 am Rande mittat – letztes Jahr aus dem Nachlass herausgegeben hat. Man darf sie ein revolutionäres Manifest nennen. Sie begründen Simons neue Romankunst. Sie tun es mit Ausdrücken, die allesamt einen aufregenden ästhe-tisch-existenziellen Doppelcharakter haben: Sie dienen Simons Literaturtheorie, und sie kehren zugleich als zentrale Ausdrücke in Simons Schilderungen seines Kriegstraumas wieder. Vor allem aber enthalten die Vier Vorträge eine Abkanzelung der französischen Romankunst von Diderot bis Camus, wie man sie so brutal von einem Franzosen wohl nie gelesen hat.
»Außer für einige Seiten, die Stendhal der Be-schreibung der Schlacht von Waterloo widmet, ist es mir nie gelungen, mich für die Romane der traditio-nell genannten Art zu interessieren, so wichtig man-che von ihnen (wie zum Beispiel die Bovary) für die Geschichte und die Entwicklung der Literatur sein mögen«, erklärte Simon 1982 seinen Zuhörern in der Universität Bologna. Diese Romane würden nur »ein-deutige Personen in Szene setzen, soziale Typen mit einem bis zur Karikatur vereinfachten Seelenleben«. Im Übrigen seien sie alle »mit Blick auf die Entwick-lung einer Moral« geschrieben, »sei sie sozialer, psy-chologischer oder religiöser Art«. Bei Diderots »exem-plarischem« Jacques le fataliste empfinde er »unüber-steigbare Langweile«, die Personen der Bovary seien kausal konditioniert wie Pawlowsche Hunde.
Die echte und lebendige Romanliteratur beginne erst mit Dostojewski, Proust, Joyce, Kafka und Faulk-ner. Am Anfang des 20. Jahrhunderts habe sich in der Romanwelt »auf spektakuläre Weise eine totale Sub-
version« zugetragen, alles sei auf den Kopf gestellt worden, »das Unterste zuoberst« (sens dessus dessous),Text und Stil zählten nun für sich selbst und seien nicht mehr bloße Vehikel einer Handlung. Statt des Kausalitätsprinzips der Handlungsverknüpfung re-giere nun das Qualitätsprinzip sprachlich aufblühen-der Beschreibung.
Sprachbilder, Wortharmonien ersetzen die Kausalität des Erzählens
Und dann kehrt Simon in seinem Vortrag an den Schreibtisch zurück – auch den in Paris, Place Monge, hat er inzwischen samt Blick aus dem Fenster gezeich-net. Auch hier hätten sich im modernen Roman die Verhältnisse revolutionär verkehrt, sens devant derrière.»Während im traditionellen Roman der Sinn schon vor der Arbeit des Schriftstellers existiert«, geht er jetzt erst aus der Arbeit hervor. Es gibt kein Draußen, das man schildert, keinen Plan, den man umsetzt, keine Idee, die man »ausdrücken« will. Statt der »Erzählung eines Abenteuers« gibt es nur noch das »Abenteuer der Erzählung« in der »Gegenwart des Schreibens«.
»Wenn ich vor meinem leeren Blatt sitze, bin ich mit zweierlei konfrontiert: einerseits dem trüben Magma von Gefühlen, Erinnerungen und Bildern in mir, andererseits der Sprache, der Wörter, die ich su-che, der Syntax, die sie ordnen wird und in deren Schoß sie sich gewissermaßen kristallisieren werden.« Dabei zwinge ihn die Sprache zwar in ihre Ordnung, schlage ihm aber auch »bei jedem Wort eine Vielzahl von Perspektiven, von möglichen Wegen, Bildern, Harmonien, von unvorhergesehenen Akkorden« vor.
Das alles hat sich Simon nicht bloß am Schreib-tisch ausgedacht. Es sind Gedanken, die erkennbar direkt aus dem Versuch stammen, die tiefste Wahrheit dessen zu verstehen, was am 17. Mai 1940, im Ge-metzel des Zweiten Weltkriegs, mit ihm geschehen ist, als sich – so beschreibt er es in der Akazie – sein geordnetes Regiment und seine geordnete Indivi-dualität in ein »in alle Richtungen« sich ergießendes und zerstreuendes »Magma« auflösten, als er sens dessus dessous aus dem Steigbügel in die Bewusstlosig-keit fiel und, wieder erwacht, wie ein Tier, das Wör-ter, Sinn und Menschlichkeit erst finden muss, da-vonfloh. Um der Wahrheit dieses Augenblicks willen hat Simon seine über alle Ufer tretenden Sätze und seine Romanformen entwickelt, die abstrakten Ge-mälden und musikalischen Großformen ähnlicher sind als konventionellen Romanen.
Die Wahrheitsintensität seines Schreibens über den 17. Mai prägt Simons ganzes Werk seit der Straße in Flandern. Sie zeigt sich im Kleinen: in den schweben-den Alltagsskizzen, in Simons Fotoarbeiten und in seinem Essay über Fotografie, die ein kleiner feiner Band bei Matthes & Seitz Berlin erstmals fürs deut-sche Publikum versammelt. Und sie zeigt sich im Großen: Jede Seite von Simon ist erregend (und des Öfteren qualvoll komplex) in ihrer Sinnlichkeit und ihrer kühnen Intimität, und alle zusammen bilden ein Großgemälde der europäischen Geschichte. Es reicht von der französischen Revolutionszeit, wie Simons Vorfahren sie durchlebten (Georgica), bis zum Talk-Journalismus der Gegenwart, wie Simon ihn zu erlei-den hatte (Jardin des Plantes). Es umfasst den Spani-schen Bürgerkrieg, an dem Simon am Rand teilge-nommen hat (Der Palast), es handelt vom Sterben der geliebten Tante, die ihm die Mutter vertrat (Das Gras),und es kehrt im letzten Roman zum Tod zurück, der am Anfang stand, zum Sterben der Mutter (Die Tram-bahn). Einen allerletzten Roman über eine das ganze Leben überstrahlende Liebesnacht im Moskau des Jahres 1937 hat der alte Simon weggeworfen. Aber die Reisetagebücher aus dieser Zeit und zahllose auto-biografische und ästhetische Notate ruhen noch im Nachlass. Nach dem Tod kommt das Leben, la litté-rature vivante.
Claude Simon (1905–1913) an seinemberühmten Fensterplatz in Salses
Foto
: R
ola
nd
Alla
rd/
VU
/la
if

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Das LetzteLieber Herr Dr. Rüdiger Grube, Sie sind derzeit unser Bahnchef und haben viel Ärger. Was wir Sie diesmal fragen möchten: Viele Zugführer erzählen uns, dass es beim ICE-T zuweilen Pro-bleme mit den Elektromotoren gibt. Dann schaltet der Zugcomputer wegen »verminderter Antriebsleistung« ungebeten auf Langsamfahrt, er zockelt durch die Landschaft und sammelt Ver-spätungsminuten wie ein Weltmeister. Lieber Herr Grube, haben Sie da ein neues Problem? Wissen Sie von diesen Müdigkeitsanfällen, oder sollen die Kollegen vom Spiegel das einmal für Sie recherchieren? Wir persönlich finden eine ver-minderte Antriebsleistung übrigens ganz mensch-lich. Viele Mitbürger leiden an dieser Krankheit, das ist ein weitverbreiteter Virus, aber wir wussten gar nicht, dass der Erreger auch auf einen ICEüberspringen kann. Gerade stellen wir uns vor, wie wir im Flugzeug sitzen und der Kapitän in unfallfreiem Deutsch sagt: »Leider fliegt unser Airbus 380 mit stark verminderter Antriebs-leistung. Wir erreichen Kuala Lumpur heute neunzig Minuten später. Wir danken für Ihr Ver-ständnis.« Klingt komisch, kommt aber im Luft-verkehr praktisch nie vor, bei der Bahn aber öfter. Vielleicht könnte der Zugführer einmal versu-chen, die ICE-Motoren zu reparieren und das lose Kabel zwischen Gestellmotor und Ritzelwel-le wieder festlöten. In dem Ratgeber Löten leicht gemacht lesen wir, dass der Zugführer dafür unbe-dingt ein Qualitäts-Gerät verwenden sollte, das in den Farben grau oder mausgrau in jedem Baumarkt käuflich zu erwerben ist. Nach dem Erreichen der Betriebstemperatur führt der Zug-führer die Qualitäts-Lötspitze behutsam an das ICE-Kabel heran und fixiert es achsseitig an der von Siemens vorgesehenen Stelle. Hier noch ein Tipp: Bitte Plus und Minus nicht verwechseln, sonst kommt der Zug vor Erreichen des Ziel-bahnhofs auf voller Länge zum Erliegen! Nach jeder Reparatur sollte die Lötspitze auf einer hoffentlich funktionsfähigen Fahrgasttoilette mit einem Schwamm gereinigt werden. Normale Haushaltsschwämme aus dem Bordbistro sind dafür leider nicht geeignet. Lieber Herr Grube, gestatten Sie uns noch eine zarte Wissensfrage: Kann es ungemütlich werden, wenn ein ICE ver-haltensauffällig wird? Hängt sich so ein müder Waggon einfach mal selbst ab und lässt auf of-fener Strecke seine Seele baumeln? Können die nachfolgenden Züge noch rechtzeitig anhalten? Oder haben die zur Abwechslung Probleme mit den Bremsen, die ebenfalls mit dem Lötkolben behandelt werden müssten? Oder tut es in diesem Fall auch ein hochwertiges Klebeband? FINIS
www.zeit.de/audio
Nicht die Konkurrenz, sondern Na-turgewalten hätten dem kleinen unabhängigen Buchladen Bank Square Book aus Mystic in Con-necticut fast den Garaus gemacht.
Im vergangenen Herbst peitschte Wirbelsturm Sandy das Flusswasser durch die schmalen Straßen des malerischen Küstenstädtchens. Es drang durch Türen, Fenster und Wände und umspülte die Bücherregale. In Windeseile räumte die reso-lute Eigentümerin Annie Philbrick mit ihren Mitarbeitern die unteren Bretter leer. Doch dann fiel tagelang der Strom aus, Feuchtig-keit kroch die Wände empor, das Papier well-te sich, die rund 40 000 Bücher schienen dem Untergang geweiht.
So kurz vor dem Weihnachtsgeschäft hätte dies den Ruin bedeutet, wären da nicht die Bürger von Mystic gewesen. Über Facebook sandte Philbrick, die den Laden 2006 mit zwei weiteren Frauen gekauft hatte, einen verzwei-felten Hilferuf aus. »Unsere Stadt ohne den Buchladen? Das geht nicht!«, sagten sich drei Dutzend Menschen und packten mit an. Sie schleppten die Bücher in eine leer stehende Wohnung und in ein Möbellager. Viele Kisten wurden in privaten Garagen gestapelt.
Zwar waren nun die Bücher gerettet, aber kein einziges verkauft. Drei Wochen lang muss-te der Laden geschlossen bleiben, Philbrick konnte ihre Angestellten nicht mehr bezahlen und auch keine neuen Buchbestellungen auf-geben. Bank Square Book stand fast kurz vor dem Ruin. Doch wieder halfen Bürger aus. Sie spendeten rund 8000 Dollar und schwangen den Pinsel, als die Wände endlich wieder tro-cken waren. Und in den Wochen vor Weih-nachten kauften sie massenhaft Bücher. Das Geschäft brummte wie schon lange nicht. »Ohne die Unterstützung meiner Gemeinde«, sagt die 53-jährige Philbrick, »hätte ich es nie geschafft.«
Mystic ist keine Ausnahme. Laut Oren Teicher vom Amerikanischen Buchhändlerverein ABA findet überall im Land »eine kleine Revolution« statt: Die Bürger wollen, dass ihre kleinen unabhängigen Buch-läden überleben. Jahrzehntelang hieß es, sie hätten keine Chance, doch nun schießen die independent bookstores, kurz Indies genannt, vielerorts aus dem Boden und haben durchaus wirtschaftlichen Erfolg.
Während die Buchladenkette Borders dicht-machte und Konkurrent Barnes and Nobles kräftig zurückschrauben muss, steigerten die Indies, so Teicher, ihre Umsätze gegenüber 2011 um acht Pro-zent. Insgesamt gibt es in Amerika wieder weit über
1600 unabhängige Buchläden, Tendenz steigend. »Wir profitieren vom wachsenden Lokalpatriotis-mus, von der Rückbesinnung auf die Nachbar-schaft«, sagt Teicher, »die Gemeinde ist unser Rück-grat.« Und natürlich helfe auch die wiederentdeckte Liebe zum gedruckten Buch.
Vor Kurzem noch hieß es, die Zukunft gehöre dem E-Book und dem Versandhandel Amazon.
Niemand wolle mehr ein schweres Buch mit sich herumschleppen, auf dem handlichen Kindle oder Nook könne man Hunderte von Büchern speichern und als federleichtes Gepäck mit in den Urlaub nehmen. Doch allen Unkenrufen zum Trotz scheint sich das gedruckte Buch zu behaupten. Der Buch-händlerverein ABA hat Untersuchungen in Auftrag gegeben und herausgefunden, dass viele Menschen nach wie vor bedrucktes Papier in der Hand halten wollen und damit eine sinnliche Erfahrung verbin-den. Außerdem schätzten sie die gute Beratung der Indies und liebten es, in den gemütlichen Läden herumzustöbern.
»Wir bieten, was Amazon und das E-Book nicht leisten können«, sagt Bradley Graham, Eigentümer
des berühmten Indie Politics and Prose (P&P) in der Hauptstadt Washington. Wer zu ihm komme, neh-me sich Zeit und lasse sich durch die Bücherwelt treiben. Graham beobachtet in letzter Zeit, dass be-sonders viele Studenten und Eltern mit Kindern sein Geschäft aufsuchen.
P&P hat immer noch den leicht verstaubten Ikea-Charme der Siebziger. Daran soll sich auch nichts
ändern, die Kunden mögen es so. »Die nüchtern-kühle Eleganz europäischer Büchertempel kommt hier nicht an«, sagt Graham. Bei P&P rekeln sich Herren im italienischen Anzug auf zerfledderten Sesseln, und Cappuccino schlürfende Damen geben sich bei der Buchlektüre auch mit einem harten Klappstuhl zufrieden. Doch hinter der Kiefernholz-fassade hat die Moderne längst Einzug gehalten. An der Kasse liegen zwischen Bücherstapeln E-Books der Marke Kobo aus, die ein kanadisches Unterneh-men eigens für die Indies entwickelt hat. Und im Büro arbeiten ein Marketingmanager, ein Web-designer und ein mehrköpfiges Veranstaltungsteam.
»Um uns zu behaupten, müssen wir weit mehr als ein Buchladen sein«, sagt der ehemalige Wa-
shington Post-Journalist Bradley. Den Laden hat er vor zwei Jahren gemeinsam mit seiner Frau Lissa Muscatine gekauft, der ehemaligen Redenschrei-berin von Hillary Clinton. »Wir sind ein Begeg-nungs- und Veranstaltungsort, die Attraktion in der Nachbarschaft«, erklärt Muscatine. P&P biete im Jahr weit mehr als 400 Lesungen, Literaturrei-sen und Autogrammstunden an. Bill Clinton und
Jonathan Franzen waren hier, ebenso Ste-phen King und Romanautorin Ann Pat-chett, die in Nashville, Tennessee, selber erfolgreich einen Indie führt. Kürzlich signierte bei P&P auch Präsidentengattin Michelle Obama ihr Buch über den Kü-chengarten im Weißen Haus. Stundenlang standen die Menschen dafür an.
Mit etwa 50 Angestellten ist P&P in-zwischen ein mittelständisches Unterneh-men. Vorne im Laden steht eine riesige na-gelneue Maschine mit dem Namen Opus. Wer will, kann damit sein eigenes Werk ver-legen oder über ein Datensystem ein Buch ausdrucken lassen, das im Handel nicht mehr erhältlich ist. Doch groß weiterwach-sen will man nicht und hat es darum ab-gelehnt, in jene Washingtoner Stadtteile zu expandieren, aus denen sich die Buchladen-kette Barnes and Nobles zurückgezogen hat. »Wir müssen darauf achten, relativ klein und verwurzelt zu bleiben«, sagt Muscatine. »Die Leute wollen in ihrem Stadtteil kau-fen, der neue Lokalpatriotismus bleibt un-sere treibende Kraft.«
Mit P&P kann Annie Philbrick aus Mystic natürlich nicht mithalten, in ihrer Stadt leben gerade einmal 12 000 Men-schen. Aber auch sie sagt, sie müsse den Kunden mehr bieten als Bücher. »Ich habe nur eine Überlebenschance, wenn die Men-
schen meinen Laden als einen Ort sehen, wo sie sich wohlfühlen, anderen begegnen und Neues erfahren.« Mit ihrem Laden Bank Square Books ist Philbrick allgegenwärtig. Sie stellt in der Stadt-bibliothek aus, in den Schulen, auf den Kultur-festen. Ein Café für ihre Kunden, wie es P&P in Washington führt, lehnt sie jedoch ab. Ebenso den Verkauf von Gesellschaftsspielen. Philbrick will den anderen Geschäften auf der Hauptstraße keine Konkurrenz machen. »Sollte ich sie aus un-serer kleinen Stadt verdrängen«, sagt Philbrick, »würden mir die Bürger schnell ihre Solidarität aufkündigen. Bei der nächsten Flut stünde ich al-lein da.« Für die Renaissance der Indies gelten halt ganz eigene Marktgesetze.
Ohne geht es nichtImmer nur Krise? In den USA gibt es eine Renaissance der unabhängigen Buchläden aus dem Geist des Lokalpatriotismus VON MARTIN KLINGST
FEUILLETON 59
Präsentabel sollte man schon sein, sagte der Visagist im Kryolan-Geschäft am Kurfürstendamm. Diese in den Nachkriegstrümmern Berlins gegründete Institution für Theaterschminke fiel mir ein, als ich am Morgen nach einer Zahn-OP in den Spiegel schaute. Der Visagist war ein gebürtiger New Yorker, der auf zehn Jahre Talkshow mit Sabine Christiansen zurückblicken konnte. Er tupfte schichtenweise Camouflage auf die Blutergüsse und tuschte mir die Augen so schwarz, dass der Blick idealerweise daran hängen blieb.
Bei der Geburtstagsfeier der KaDeWe-»Schuh- und Accessoirewelt« schaute ohnehin alles nur auf die Füße. Im dritten Stock, der sogenannten Loft-Abteilung, waren alle aktuellen Trends präsent, das heißt, die Lage war ziemlich verwirrend. Die Abtei-lungsleiterin konnte das nur bestätigen: »Wir ver-kaufen runde Ballerinas, spitze Ballerinas, Pumps mit rundem Leisten und Blockabsatz, spitze Pumps mit Pfennigabsatz, Langschaftstiefel und Bikerboots
gehen genauso. Bei Stilettos mit mehr als neun Zentimetern Absatzlänge wird es etwas schwieriger. Aber die Italiener bieten von sich aus sieben Zenti-meter an.«
Etageren voller Pralinés wurden herumgereicht, bei Fendi gab es Petits Fours mit Color-Blocking, auf den Sofas diskutierten Damen mit Champagner-kelchen in der Hand Rochas’ staubwedelartige Pu-schen, Pradas Plateauwanderschuhe und die Epi-demie der Legionärssandalen. Nicolas Berggruens Repräsentantin Ute Kiehn ließ ihre beneidenswert zierlichen Füße probeweise in Reitstiefeln versinken und plauderte dabei über die Mutter des Karstadt-Eigentümers, die frühere Schauspielerin Bettina Moissi, die am 15. Oktober in Paris ihren 90. Ge-burtstag feiert. Auch die Gründerin der ersten Ber-liner Personalberatung, Sigrid Rödiger, schaute vorbei. »Wir mussten nie akquirieren, die Leute haben uns aufgesogen. Dank der Förderung war Berlin ja damals eine Industriestadt. Vodafone hieß
da noch Mannesmann Mobilfunk. Die haben Mil-lionen mit uns gemacht. Die ganzen Callcenter, die haben wir bestückt.« Heute versorgt Sigrid Rödiger Luxusmarken mit Mitarbeitern: »Bisher waren es Russen, jetzt vor allem Chinesen. Die sind ganz schön schwierig. Wenn der Konkurrent 50 Euro mehr bietet, dann sind die weg.«
Die chinesischen Schuhkunden steuern mit Vor-liebe die Salvatore-Ferragamo-Ecke an. Das, erklärt man mir, liege nicht nur an den Logoschnallen, sondern auch an den unterschiedlichen Breiten, die von Größe A bis M reichen. Denn asiatische Füße sind zwar nicht lang, aber auch nicht schmal. Die benachbarten Clutches aus gestepptem Kängurule-der gehen weg wie warme Semmeln, so wie Diors Pumps aus Wasserschlangenleder. »Der Vorteil bei der Wasserschlange ist, dass sich die Schuppen nicht nach oben wellen.«
Der Exotismus ist ins Fußzeug gewandert. Selbst bequeme Fellstiefel glitzern wie Discoku-
geln. Man sieht höfische Rokokolatschen, surrealisti-sche Stickereien, elegante Pumps mit metallischer Punkerkappe, andere, deren Sohle sich wie ein Tür-griff in die Hand nehmen lässt oder die im Bug ge-schwollen sind wie eine alte Hansekogge. Das Perso-nal ist bestens informiert und weiß zu jedem Modell Geschichten zu erzählen. Im Nu ist man bei Ferraga-mos orthopädischen Studien, bei Christian Diors Gärten und Malerfreunden oder Tom Fords Regie-arbeiten. Luxus-Shopping ist heute vielsprachig und fühlt sich wie ein Galeriebesuch an.
Die Kultursmartheit der Berliner wird noch weit-gehend unterschätzt. Auf dem Heimweg, endlich im blickdichten Taxi, annonciert der Fahrer dem Sprechfunk: »21.30 Philharmonie, ausverkauftes Haus, sicher ohne Pause.«
Wasserschlange für die Füße
VON INGEBORG HARMS
BERLINER CANAPÉS
Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen »Berliner Canapés« von Ingeborg Harms, »Jessens Tierleben« von Jens Jessen, »Männer!« von Susanne Mayer sowie »Auf ein Frühstücksei mit ...« von Moritz von Uslar
Blick aufs gemütliche Chaos des Bound Together Anarchist Book Collective in San Franscisco
Foto
: G
ett
y Im
age
s; I
llu.:
Pe
ter
Ste
mm
ler/
Qu
ickh
on
ey
für
DIE
ZE
IT

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
60
Die schönste Geschichte über den heiligen Franz ist natür-lich eine Liebesgeschichte. Zu Lebzeiten, als er noch nicht heilig war, aber schon erleuchtet von der Idee, sein Dasein in Armut zu fristen,
also ungefähr im Jahr 1208, verliebte sich ein ad-liges Fräulein namens Klara in ihn. Sie hörte von dem jungen Wanderprediger, der seine reiche Kir-che durch Besitzlosigkeit beschämte, und da sie selber noch ein idealistischer Teenager war, schwärmte sie sogleich für den Sonderling, der ihr sehr revolutionär vorkam. Diese Liebe war selbst-verständlich verboten. Also musste eine Ent-führung des Fräuleins stattfinden. Franz, der ursprüng lich Ritter werden wollte, erledigte das wacker im Stil der Zeit, wodurch aber das Problem nicht gelöst war. Denn er hatte sich bereits dem Herrgott versprochen. Und so nahte der Schreck-moment, da er Klara eröffnete, sie dürften nicht dauernd zusammen sein, die Leute würden schon reden, am besten sie träfen sich erst wieder im Sommer zur Rosenblüte. Dazu muss man wissen, es war Winter. Doch kaum hatte Franz den unsym-pathischen Vorschlag gemacht, da erblühten, oh Wunder, im Schnee die Rosen.
Hach! Es ist eine kitschige Kirchenromanze. Aber sie enthält eine kirchenumstürzlerische Mo-ral: dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen sich nicht ausschließen. Dass das Lie-besgebot alle Gesetze bricht. Dass die Gesetze nicht der Sinn des Christentums sind. Mit den Worten des Papstes Franziskus in seinem jüngsten Interview: »Erst kommt die Verkündigung der Liebe Gottes, dann die religiöse Pflicht.«
Diese Liebe aber ist nicht harmlos. Denn die berühmte Liebe, von der es im Korintherbrief heißt, dass sie langmütig sei und freundlich, dass sie alles ertrage und alles glaube, alles hoffe und alles dulde, hat Konsequenzen. Sie kann das Be-stehende infragestellen. Deshalb fürchten sie sich in Rom auch ein bisschen vor Papst Franziskus, der die Liebe zu den Armen predigt. Er verschmäht nicht nur teure Dienstwagen, wie sie für viele deutsche Bischöfe selbstverständlich sind. Er rät nicht nur den Kardinälen zur Bescheidenheit und räumt diese Woche gemeinsam mit acht externen Beratern die römische Kurie auf. Er hat auch schon einem lateinamerikanischen Bischof wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch die Priester-würde entzogen. Denn so ist die Liebe aus dem Korintherbrief: »Sie freut sich nicht der Ungerech-tigkeit, aber sie freut sich der Wahrheit.«
Nein, die franziskanische Liebe ist nicht harm-los. Deshalb fürchteten sie sich in Rom schon vor 800 Jahren, als Franz von Assisi die Nächstenliebe als zentrales Gebot des Christentums wiederent-deckte. Um den Armen zu dienen, sagte der Sohn
eines reichen Tuchhändlers sich vom Vater los und verkaufte zugunsten der Kirche eigenmächtig des-sen teuerste Stoffe auf dem Markt. Als der Vater ihn deshalb verklagte, schockierte der radikale Franz seine Umwelt mit einer Performance, die selbst heute noch Aufsehen erregen würde und an die häretischen Aktionen der russischen Punkband Pussy Riot erinnert: Mitten in der Gerichts-verhandlung, vor den Augen des Bischofs von As-sisi, riß der wilde Franz sich die Kleider vom Leib. Die Historiker berichten, dass der erschrockene Bischof höchstselbst herbei gerannt sei, um die Blöße des Kirchenrevoluzzers zu verdecken. Der aber triumphierte: Jetzt kann ich mich nackt auf den Weg zum Herrn machen!
Mit seiner Nacktheit wollte er demonstrieren, dass er ohne Besitz und ohne Geld, als ein freier Christ dem Beispiel Jesu zu folgen gedenke. Viele Zeitgenossen hielten ihn deshalb für einen sentimenta-len Spinner. Aber die reiche und mächtige Kirche der dama-ligen Zeit ahnte das subversive Potenzial des Franziskanertums. Zwar hatte Papst Innocenz III. zunächst das Armutsideal des neuen Ordens akzeptiert. Doch Papst Gregor IX. setzte bald nach dem Tod des Ordens-gründers im Jahr 1226 dessen Demutsregeln außer Kraft. Und in dem Jahrhundert nach Franz wurden allein vier Fran-ziskaner als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Kirchenoberen fürchteten zu-recht, eine erstarkende Armuts-bewegung könnte die päpst-liche Macht gefährden. Dass Franz trotzdem heiliggespro-chen wurde, war ein Versuch der Mächtigen, diesen Radikal-christen möglichst unschädlich zu machen durch Einverleiben.
Franz war ja schon allein wegen seiner widersprüchlichen Ordensregeln ein unsicherer Kantonist. Einerseits schwor er dem Papst unbedingten Gehorsam. Andererseits pre-digte er die arme Kirche. Er war sicher, dass die Jünger Jesu weder Gold noch Silber, Geld, Reise-tasche, Wanderstab, Schuhe besaßen. Deshalb ge-stattete er auch sich selbst nichts dergleichen, nur eine gegürtete Kutte und ein paar Hosen. So zog er los, die Christenheit zur Demut zu bekehren. Er war überzeugt, Christus selbst habe ihm den Auf-trag erteilt: »Franz, geh und bau mein Haus wieder auf, das in Verfall gerät.« Verfall aber hieß innerer Verfall. Und Wiederaufbau hieß Umbau. Ganz
ähnlich sagt es jetzt Papst Franziskus: »Die Kirche ist das Haus aller. Wir dürfen sie nicht auf ein Nest unserer Mittelmäßigkeit reduzieren. Wir müssen sie erneuern!«
Ist die Wahl des Franziskus die Rückkehr des heiligen Franz? Ja, davon ist einer der besten Bio-grafen des Franz überzeugt. Der österreichische Theologe und suspendierte Priester Adolf Holl por-traitierte ihn unter dem Titel Der letzte Christ: »Franz war ein zweiter Christus, der durch sein barmherziges Auftreten zeigte, was mit der Menschwerdung Gottes gemeint war.« Holl, bis-her ein notorischer Papstkritiker, glaubt nun wie-der an den Papst. Mit Franziskus könne die Kirche neu anfangen. Neuanfang aber heiße, zurückzugehen in der Kirchengeschichte, wenn schon nicht bis zu
Jesus, dann mindestens bis ins fatale Jahr 1322. Damals ende-te der 100-jährige »Armuts-streit«, den Franz von Assisi ausgelöst hatte, in Feindschaft zwischen den Franziskanern und dem amtierenden Papst: Der Orden erklärte, Jesus und seine Apostel hätten keinen Be-sitz angestrebt, folglich wäre auch der Papst zur Armut ver-pflichtet. Johannes XXII. ver-kündete das Gegenteil.
»Seither segeln wir unter der Fahne des Eigentums«, sagt Holl. Ob Franziskus eine Ethik ohne Eigentum wiederbelebt? Radikale Armut sei zwar für die gesamte Gesellschaft nicht prak-tikabel, aber als Gegenmodell unverzichtbar. Dem durchkapi-talisierten Westen ebenso wie der römischen Kurie könnte ein bisschen Barmherzigkeit guttun. »Die Kirche darf nicht länger mit breitem Hinterteil auf dem Stuhl der Macht sitzen. Dass der Papst sich Franziskus genannt hat, ist ein Gotteswunder.«
Apropos Wunder. Holl er-zählt die kitschige Geschichte von den franziska-nischen Rosen mit Genuß, obwohl er sonst heftig über die Verkitschung des Franz zum Sonnendich-ter, Bäumeumarmer und Vogelprediger schimpft. Es sei gar nicht verbürgt, dass Franz zu den Vögeln gepredigt habe, aber durch diese populäre Legende habe man ihn gründlich entpolitisiert. Umso mehr freut Holl sich nun über den politischen Franzis-kus, der die Flüchtlinge in Schutz nimmt und sich in Syrien einmischt mit der Begründung: »Ein Christ, der kein Revolutionär ist, ist kein Christ.«
Also Katholiken, zurück in die Zukunft! Das franziskanische Programm ist eine Kehrtwende
vorwärts. Franz von Assisi war zwar kein Kirchen-reformer und kein Linkskatholik im heutigen Sin-ne. Aber sein Orden inspirierte jahrhundertelang die katholischen Abweichler – von Wilhelm von Ockham und Michael von Cesena bis hin zu Hans Küng und Leonardo Boff. Das Christentum, wie die Fans des heiligen Franz es verstehen, erweist sich nicht in der Macht, sondern im Macht-verzicht, nicht in der Stärke, sondern in der Liebe.
Liebe ist nunmal das Gegenteil von Eigentum. Und Eigentum ist kein Wert an sich. – Mit dieser Behauptung verärgerte vor 50 Jahren der reforme-risch gesinnte Konzilspapst Paul VI. die Wall Street. Daran knüpfe Franziskus nun an, sagt der katholische Unternehmensberater Edgar Büttner, der die Topmanager der deutschen Wirtschaft be-rät und Mitglied der Kirchenvolksbewegung ist. Büttner will die Armut nicht romantisieren, natür-lich brauche die Kirche Geld, um Gutes zu tun. Aber was tue sie wirklich? Der verschwenderische Limburger Skandalbischof Tebartz Van Elst ist ja in Deutschland keineswegs der einzige Bischof mit einer Prachtresidenz, und dass er jetzt von einem römischen Inspektor besucht wurde, war eine Warnung an alle Kollegen. Wer Barmherzigkeit predigt, muss nicht von gestern sein! Der neue rö-mische Führungsstil, sagt Büttner, sei aus unter-nehmensberaterischer Sicht sehr zeitgemäß. Fran-ziskus führe symbolisch, er entscheide im Team und agiere strategisch im Umgang mit seinem Vor-gänger. Er spreche eine einfache Sprache, werte die Frauen auf und suche bei seinen Gegnern Konsens für Veränderungen, aber vor allem: Er lebe sein Ideal vor, wie Franz von Assisi. Dessen Armut war gelebte Predigt und tatkräftige Liebe.
Diese Liebe ist gefährlich. Kurz vor seiner Wahl zum Papst, während des Konklaves in Rom, las Jorge Mario Bergoglio in einem Buch über das Revolutionäre der christlichen Liebe. Sie sprenge das menschliche Maß, weil sie sich an der Liebe Jesu bemesse. Sie sei ein Korrektiv, nicht nur zur Welt, auch zum selbstgerechten, hochfahrenden, lieblosen Glauben. »Allein die Liebe ist das Unter-scheidungsmerkmal des wahren Christen«, schrieb der Verfasser. Sein Name: Walter Kasper. Der Titel des Buches: Barmherzigkeit. Während des Kon-klaves hatte der deutsche Kardinal Kasper ein Zimmer nicht weit von Bergoglio. Nachdem die-ser zum Papst gewählt worden war, bedankte er sich für die Lektüre, indem er bei seinem ersten öffentlichen Gebet auf dem Petersplatz aus dem Buch zitierte: dass alle Frömmigkeit nichts nütze ohne Barmherzigkeit. Nur wer barmherzig sei, sei auf dem Weg der Liebe. Dieser Weg, schreibt Kas-per, sei alles andere sentimental. »Konkret realis-tisch!« Mit anderen Worten: Eine machbare Uto-pie. Ein menschenmögliches Wunder. Wie die Rosen des Heiligen Franz. Nun muss Franziskus sie nur noch zum Blühen bringen in Rom.
Die Rückkehr des heiligen FranzPapst Franziskus reist nach Assisi und bekennt sich zur Kirche der Armen VON EVELYN FINGER
Franz und Franziskus:Unser Illustrator Wieslaw Smetek montierte den neuen Papst in das Bild von der Vogelpredigt – die populärste Legende des Heiligen aus Assisi
GLAUBEN & ZWEIFELN
DIE ZEIT: Herr Weisner, Sie haben sich mit kirchenkritischen Katholi-ken aus aller Welt zusammengetan
und dem Papst geschrieben. Warum? Christian Weisner: Weil wir die Kirche von innen erneuern wollen, nicht von außen. Weil wir keine Kirchengegner sind. ZEIT: Sie fordern vom Papst ein Mitsprache-recht bei Zukunftsentscheidungen.Weisner: Die Kirchenvolksbewegung »Wir sind Kirche« will an die tiefen Traditionen des Christentums anknüpfen. Wir kritisie-ren eine Amtskirche, die nicht mehr auf dem jesuanischen Weg ist. Darin fühlen wir uns von Franziskus bestätigt. ZEIT: Sie glauben an seinen Reformkurs? Weisner: Aber ja! Vor 18 Jahren, als wir in Deutschland mit 1,8 Millionen Unter-schriften gestartet sind, da konnte sich niemand vorstellen, dass wir so lange durch-halten. Heute sind wir in 20 Ländern mit unseren Forderungen präsent. Die wichtigs-ten lauten: innerkirchliche Mitbestimmung, Gleichberechtigung der Frauen, freiwilli-ges Zölibat, positive Sexualmoral, Frohbot-schaft statt Drohbotschaft. ZEIT: Glauben Sie, dass Franziskus Ihren Brief persönlich lesen wird?Weisner: Ich hoffe es. Er holt sich ja nicht nur Kardinäle als Berater, sondern pflegt ei-nen neuen spirituellen Leitungsstil. Er geht auf einzelne Menschen zu und hört sie an. Er zeigt den Klerikern, was ein guter Hirte ist.ZEIT: Und das reicht schon?Weisner: Nein. Der neue Stil muss theolo-gisch und kirchenpolitisch abgesichert wer-den. Bisher hat Franziskus Zeichen gesetzt. Sie enthalten ein großes Versprechen.ZEIT: Und wenn es gebrochen wird?Weisner: Wird es sehr schlecht für die Kir-che. Franziskus hat 90 Prozent des Kirchen-volkes hinter sich. Aber nun müssen die Bi-schöfe vor Ort es umsetzen. ZEIT: Wieso die Bischöfe? Weisner: Solange die Kirche hierarchisch funktioniert, ist das ihr Job. Aber ich habe den Eindruck, die deutsche Bischofskonfe-renz hat die Glocke aus Rom nicht gehört.ZEIT: Auf ihrer Herbsttagung haben die deutschen Bischöfe angekündigt, man wolle die Möglichkeiten für eine stärkere Beteili-gung der Frauen untersuchen. Immerhin!Weisner: Nein! Das ist die übliche Ankündi-geritis. Der Papst fordert den Dialog, und die deutschen Bischöfe verkünden, es gebe jetzt einen Newsletter. Das genügt nicht.ZEIT: Was wollen Sie tun? Weisner: Den Papst unterstützen. Erst gab es einen Bene-dikt-Effekt der Kon-trolle, jetzt gibt es einen Franziskus-Ef-fekt des Aufatmens. Aber gleichzeitig gibt es den Müller-Effekt der Ein schüch te-rung. Der Präfekt der Glau bens kon-gre ga tion Gerhard Ludwig Müller ver-tritt die dogmati-sche Schule Bene-dikts und stellte sich kürzlich in einem Interview hinter den umstrittenen Limburger Bischof.ZEIT: Aber Müller wurde von Franziskus im Amt bestätigt. Also keine Antipoden! Weisner: Auch der Papst kann nicht alles neu besetzen. Zu lateinamerikanischen Or-densleuten hat Franziskus schon gesagt: Wenn Ihr einen kritischen Brief von der Glaubenskongregation bekommt, erklärt euch, aber macht weiter wie gehabt.ZEIT: Das hat er gesagt? Wirklich?Weisner: Ja. Er erklärt ja, es geht zuerst um den Menschen, dann um das Gesetz.ZEIT: Was wird die Kurienreform bringen?Weisner: Der Vatikan muss vom Kontroll- zum Kommunikationsinstrument werden. Wir brauchen Glauben ohne Unterwerfung.ZEIT: Was erhoffen Sie sich als Nächstes von Franziskus?Weisner: Dass er hilft, die Jahrhundert-aufgabe zu meistern: die Schwelle zu den Frauen zu überschreiten. Dass er klerikale Männerbünde aufbricht und echte Beteili-gung ermöglicht. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx betont ja gern, wie viele Frauen er in Leitungspositionen geholt habe, aber obendrüber hat er einen Bi-schofsrat installiert. Außerdem hoffe ich, dass Franziskus die tiefen Ursachen von Missbrauch und Vertuschung aufdeckt. ZEIT: Sie haben ein Faltblatt mit Zitaten von Franziskus gedruckt. Rom-Werbung?Weisner: Nein, Mutmachworte. Kirchen-volksbewegung heißt nicht nur meckern, sondern sich weiterbewegen.
Die Fragen stellte EVELYN FINGER
»Glauben ohne Unterwerfung!« Was das Kirchenvolk erhofft. Ein Gespräch mit Christian Weisner
Um 1181 wird der Sohn eines reichen Tuchhändlers in der Stadt Assisi geboren. Auf eine verschwenderische Jugend folgt die Vision: Er soll die Kirche retten und die Welt erlösen durch radikalen Verzicht auf allen Besitz. Die Franziskaner provozieren den Klerus durch ihr Armutsideal. Sie sind überzeugt von Gottes Güte. Franz sieht sich als neuer Christus und bringt sich die Stigmata bei. Mit seinem Tod 1226 beginnt ein Streit, der bis heute andauert: Wie reich und wie mächtig darf die Kirche sein? Papst Franziskus reist am Gedenktag des Heiligen, am 4. Oktober, nach Assisi
Franz von Assisi
Christian Weisner ist der deutsche Sprecher der Reformbewegung »Wir sind Kirche«
Ab
b.:
»Fra
nz
von
Ass
isi
un
d P
apst
Fra
nzi
sku
s«,
Ge
mäl
de
vo
n G
iott
o d
i B
on
do
ne
(L
ou
vre
, P
aris
; Fo
to:
Dan
iel
Arn
aud
et/
bp
k);
be
arb
eit
et
von
Sm
ete
k f
ür
DIE
ZE
IT;
pri
vat
(kl. B
ild r
ech
te S
pal
te)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
61»Ich zerstöre aus Liebe«Yasmine Hamdan singt arabische Lieder, aber sie singt sie
mit der Stimme eines Punks. Ein Gespräch über Traditionen,
Aufräumaktionen und die Macht der Schwachen
DIE ZEIT: Der britische Guardian nennt Sie »das moderne Gesicht der arabischen Musik«. Kompliment oder Schublade?
Yasmine Hamdan: Beides. Journalisten haben es gern griffig, sie müssen Botschaften verkaufen. Von ihrem Standpunkt aus ist das auch verständ-lich. Ich bin nicht gegen Etiketten, aber sie sollten mit Inhalt gefüllt werden.ZEIT: Dann werden wir konkreter. Sie haben die erste Independent-Band des Nahen Ostens gegrün-det, man hört Ihre Musik in Beirut, Tunis und Kairo genauso wie in Paris, London oder Berlin. In Only Lovers Left Alive, dem neuen Jim-Jarmusch-Film, spielen Sie eine Barsängerin und werden mit den Worten vorgestellt: »Ihr Name ist Yasmine, sie wird bald berühmt sein.« Sie sind eine Pionierin!Hamdan: (lacht) Das war aber so nie geplant. Ich bin einfach nur meiner inneren Stimme gefolgt, ohne Ermunterung von außen, oft gegen Wider-stände. Es gibt so unendlich viele ungeschriebene Gesetze, die man in der arabischen Welt verletzen kann. Es gibt aber mindestens genauso viele westli-che Klischees darüber. Um beides habe ich mich nie gekümmert. Ich kann sehr starrsinnig sein. Das ist mein Vorzug und zugleich meine größte Schwäche.
ZEIT: Was stört Sie an der Art, wie der Westen auf den Osten blickt?Hamdan: Dass arabische Kultur zu oft als Gegen-satz zur Moderne wahrgenommen wird. Dabei ist sie sehr vielfältig und komplex. In jedem arabi-schen Land gibt es blühende Sub- und Gegenkul-turen. Man muss sich nur die Mühe machen hin-zuschauen. ZEIT: Auf Ihrem jüngsten Album Ya Nass singen Sie eigene Songs, aber auch Bearbeitungen von Liedern aus Kuwait, Ägypten und dem Libanon. Sind Sie der Vergangenheit hinterhergereist?Hamdan: Orientalisch formuliert: Mein Leben war schon immer eine Reise. Als Kind bin ich mit meinen Eltern vor dem Bürgerkrieg aus dem Liba-non nach Griechenland und von dort in verschie-dene arabische Länder geflohen, bevor es wieder zurück nach Beirut ging. Nach westlichen Maßstä-ben bin ich eine Nomadin. Ich bin in beiden Wel-ten zu Hause.ZEIT: Wie hat sich das auf Ihre Musik ausgewirkt?Hamdan: Das dauernde Unterwegssein hat mich oft einsam gemacht, war aber auch eine Kraftquel-le. Wenn du schon als Teenager immer wieder he-rausgerissen wirst und von vorne beginnen musst,
bleibt dir gar nichts anderes übrig, als kommuni-kativ zu werden. Wer kein Zuhause hat, der sucht sich eben eins. Hat man erst einmal akzeptiert, dass man von allem etwas in sich trägt, kann auch das eine Art Zentrum sein. ZEIT: Wie war das, in den Neunzigern in das zerstörte Bei-rut zurückzukehren?Hamdan: Absolut surreal. Beirut war eine Art Geisterstadt, stän-dig Stromausfälle, manchmal zwölf Stunden am Tag, alles sehr düster und klaustropho-bisch. Auf der anderen Seite gab es inmitten der Trümmer eine gespielte Normalität. Die Kin-der der Superreichen wurden von Bodyguards in die Schule und wieder zurück-gebracht. Die allgemeine Haltung war: Schwamm drüber, wir haben überlebt und sind immer noch eine Familie. ZEIT: Gleich mit Ihrer ersten Band Soapkills ha-ben Sie im Libanon für Aufregung gesorgt. Was genau war das Provozierende: der Stil, die Texte, der Umstand, dass eine Frau sang?
Hamdan: Alles zusammen. Sie müssen sich eine Gesellschaft vorstellen, die unfähig ist, mit ihren inneren Widersprüchen umzugehen. Die Energie ist ungeheuer, aber es gibt keine Antwort auf
drängende Fragen. In solch einer Situation haben schon kleine Regelverletzungen gro-ße Wirkungen. Anfangs fiel das noch nicht so auf, weil ich englisch sang, aber sobald ich mich für das Arabische entschieden hatte, eckte ich überall an. Die Leute mögen es nicht, wenn man ihnen vormacht, dass alles auch ganz anders funktionieren kann.
ZEIT: Sie haben den Rock ’n’ Roll nach Beirut ge-tragen.Hamdan: (lacht) Ich gehöre einer Generation an, die nach Antworten suchte, und der beste Weg, Antworten zu finden, war es, Fragen zu stellen. Unsere Konzerte waren wie Happenings: Alle, die auf der Suche waren, kamen an einem Ort zusam-men. Oft war es nicht einmal ein richtiger Ort,
sondern bloß irgendein Loch, in dem wir eine ge-liehene Lautsprecheranlage installiert hatten. Na-türlich spielte auch die politische Situation eine Rolle: Wenn ständig irgendetwas hochgehen kann, möchte man ganz schnell sein Leben leben.ZEIT: Wie kamen Sie dazu, arabisch zu singen?Hamdan: Ich hatte es immer schon in mir. Es gibt Lieder, die im arabischen Raum jeder kennt, sie sind Teil der kulturellen Geografie, wenn man sie nicht sowieso im Radio hört, hat sie einem jemand aus der Verwandtschaft als Kind vorgesungen. Bei mir war es genauso, aber ich brauchte ein Schlüs-selerlebnis. Eines Tages bin ich auf Asmahan ge-stoßen, eine Sängerin aus den vierziger Jahren. Eine schillernde Figur, sie benutzte in ihren Arran-gements westliche Instrumente, manchmal klingt sie nach Cabaret, manchmal indisch, manchmal sogar ein bisschen chinesisch. Da wurde mir klar, dass die Trennung zwischen »westlicher Musik« und der Musik, mit der ich groß geworden bin, gar nicht existiert. ZEIT: Können Sie sich an den Moment erinnern, in dem Sie Asmahan zum ersten Mal hörten?
Fortsetzung auf S. 62
»Was mir an der Kultur, die mich geprägt hat, gefällt: Der Humor, das Verschmitzte und Lebensfrohe«
MUSIK Jazz: Bielefeld und sein Musikbunker S. 66
Elektropop: Karl Bartos ohne Kraftwerk S. 67
Klassik: Vom Boom des Streichquartetts S. 68
Indie-Rock: Der Hype um Palma Violets S. 69
Inhalt:
Yasmine Hamdan, geboren in Beirut, wohnhaft in Paris, versteht sich als Nomadin – auch musikalisch Fo
to:
Nad
im A
sfar

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4162 MUSIK
Hamdan: Es war in Beirut, spät in der Nacht, in dieser einen Bar, der einzigen, die es damals gab. Ich war jede Nacht da, der Musik wegen und um wie verrückt zu tanzen. Als dann zwischen dem ganzen westlichen Pop plötzlich ein Stück von ihr lief, fühlte ich mich wie vom Blitz getroffen. Diese Frau klang so selbstbewusst, so modern, so ... in-tellektuell. Am nächsten Tag bin ich sofort losgezo-gen und habe auf Märkten nach alten Aufnahmen von ihr gesucht. Es gab nur Kassetten, aber von da an ging es Schlag auf Schlag. Ich stieß auf Lieder anderer Sängerinnen, ich beschäftigte mich mit ih-ren Dialekten und Hintergründen. Ich habe noch einmal Arabisch gelernt, indem ich sie sang.ZEIT: Es war eine Wiederaneignung der Tradition.Hamdan: Ja. Aber ich habe die Tradition zugleich infrage gestellt. Es war wie Aufräumen. Da fragt man sich auch: Was mag ich, was nicht? Was will ich behalten, was nicht? Es kam vor, dass ich ein altes Lied nahm und etwas komplett Neues da-raus machte, ohne Rücksicht darauf, ob es nach gängigen Maßstäben schön klingt oder nicht. Auf der anderen Seite wurde mir klar, was mir an der Kultur, die mich geprägt hat, gefällt: der Humor, das Verschmitzte, das Sinnliche und Lebensfrohe, das sich darin ausdrückt und sich zugleich hinter einem Schleier aus Metaphern verbirgt. Etwas sagen und zugleich nicht zu sagen, das ist sehr arabisch! (lacht) So ist es bis heute ge-blieben: Ich zerstöre, aber ich zerstöre aus Liebe.ZEIT: Der arabische Autor Ah-mad Zaatari schreibt in einem Artikel über Sie: »Man könnte ihre Darbietung für desaströs halten aufgrund ihrer Willkür im Umgang mit der Stimme und der vorsätzlichen Abwei-chungen am Anfang und Endeeiner musikalischen Phrase.« Hamdan: Solche Dinge beka-men wir damals ständig zu hö-ren: Sie hat keine Ahnung, sie kann gar nicht singen, sie kommt von außerhalb, sie ge-hört nicht dazu. Man muss wissen: Traditioneller arabi-scher Gesang hat sehr viel mit Technik zu tun, es gibt jede Menge Skalen, die von klein auf trainiert werden. Von einer Sängerin wird erwartet, dass sie ihr Handwerk beherrscht, und aufgrund der Vierteltöne wird alles noch komplizierter. An-fangs habe ich mich noch be-müht, wenigstens ein paar Re-geln zu befolgen, aber dann sagte ich mir: Wenn es nicht geht, mache ich es halt auf meine Weise. Technik interessiert mich nur in zweiter Linie, es geht mir um Emotionalität und Ausdruck. Ich singe ara-bisch wie ein Punk.ZEIT: Es geht um die Stärke, die in vermeintlich schwachen Stimmen steckt.Hamdan: Genau. Man darf keine Angst davor ha-ben, sich zu seiner eigenen Zerbrechlichkeit zu bekennen. Man will keine Fassade sein, sondern ein Mensch. Das ist es, was mir an Neil Young immer gefallen hat, er bewegt sich mit seiner Stim-me an Orte, die sich ziemlich seltsam anfühlen können. Diese hohen, brüchigen Noten! Oder PJ Harvey: Sie hatte von Anfang an diese Wut in ihrer Stimme, aber zugleich war sie sehr gefühlvoll und nuanciert. Solche Stimmen sind wie Sauerstoff, sie geben einem Luft zum Atmen.ZEIT: Leider versteht man als Europäer nicht, wo-von Sie auf Ya Nass singen. Können Sie ein biss-chen Übersetzungshilfe geben?Hamdan: Ya Nass heißt so viel wie »Yo, Leute!«, es ist eine Aufforderung, zusammen etwas zum Lau-
fen zu bringen. Aber im Grunde erzählen die Lieder, die ich singe, keine Geschichte, sie trans-portieren Stimmungen. Ich spiele mit den Bedeu-tungen der Vorlagen und fülle sie so mit neuem Leben. Deshalb finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn man die Sprache nicht beherrscht. Der Weg führt nicht über die Texte, sondern über die Emotion. ZEIT: »Eine Frau versucht, mit dem Geruch Ihres Liebhabers in Kontakt zu kommen«, »Eine Frau beschwert sich bei ihrem Liebhaber darüber, dass er zu impulsiv ist und zu jung«. Den Angaben im Booklet zufolge geht es viel um Sex.Hamdan: (lacht) Wenn, dann nur sehr versteckt. Sagen wir, es geht um Erotik. Ich selbst hätte kein Problem damit, mich explizit auszudrücken, aber an den alten Songs gefällt mir gerade das Indirekte, die Bedeutung hinter der Bedeutung. Ich mag es, wenn man nicht mit der Nase auf etwas gestoßen wird. Das gibt der Fantasie den nötigen Raum. ZEIT: Im Song Beirut beschwören Sie die Atmo-sphäre des Vorkriegs-Beirut herauf: Die Arak-Trin-ker in den Cafés, die Taubenzüchter. Ist das eine Art Heimwehlied?Hamdan: Es ist jedenfalls ein wichtiges Stück auf dem Album. Omar al-Zenni hat es geschrieben, ein Sänger, der heute fast ganz aus der kollektiven Erinnerung verschwunden ist. Das Lied aus der Versenkung zu holen war, als würde man ein ver-lorenes Familienmitglied wiederentdecken. Es handelt von der oberflächlichen, wunderbaren Energie der Stadt, ist voller Wehmut und Zärtlich-
keit, klingt aber zugleich so modern, als wäre es gestern erst entstanden. Genau diese Balance will ich in meinen Lie-dern erzielen.ZEIT: Warum lehnen Sie es ab, mit dem Arabischen Frühling in Verbindung gebracht zu werden?Hamdan: Weil ich mit Etiket-ten nichts anfangen kann. Es erfüllt mich mit Hoffnung, wenn die Jugend endlich be-ginnt, für ihre Rechte einzuste-hen, aber der Begriff war mir von der ersten Sekunde an sus-pekt. Der Arabische Frühling ist eine Erfindung westlicher Medien. Was heute in Ägypten passiert, in Libyen, in Tunesien oder jetzt in Syrien basiert auf sehr unterschiedlichen Ent-wicklungen und hat sehr ver-schiedene Gründe. ZEIT: Trotzdem wird gerade Ihre Stimme gehört. Versteht man Ihre Musik falsch, wenn man sie als Ausdruck einer aufkeimenden Zivilgesellschaft versteht?Hamdan: Zivilgesellschaft, das ist auch so ein großes Wort. Es reicht mir, wenn meine Lieder
die Erinnerung an eine andere arabische Welt wachrufen. Vor wenigen Jahren wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich bei einer Reise nach Tunis um Kleiderfragen zu scheren. Ich habe die Hoff-nung, dass das eines Tages wieder so sein wird.ZEIT: Welche Rolle spielen Frauen bei der Ent-wicklung?Hamdan: Der Islamismus ist eine sehr männliche Angelegenheit. Sie haben sich ausgedacht, wie Frauen sein sollen, und geben das als Stimme Got-tes aus. Entsprechend wichtig ist es, dem etwas entgegenzusetzen. Eine Revolution ohne grund-sätzliche Neuformulierung der Frauenrolle ist kei-ne Revolution. Es ist nicht einmal ein Frühling.
Das Gespräch führte THOMAS GROSS
Tourdaten: 14. 11. Zürich (Bogen F), 15. 11. Wien (Chaya Fuera), 19. 11. Berlin (Privatclub), 20. 11. Köln (Stadtgarten)
Die Spannung gehaltenIrgendwo zwischen Jazz, Ambient, Avantgarde und Club: Die fantastisch unkonventionelle Musik
des Duos Nils Petter Molvaer und Moritz von Oswald VON ULRICH STOCK
Sehen sie nicht aus wie Brüder? Seelenverwandt sind sie, das kann man hören. Nils Petter Molvaer, der Trompeter, der zur Jahrtausendwende den Jazz aus dem Okzident in den Ambient rückte. Und Moritz von Oswald,
der als Schlagzeuger die Neue Deutsche Welle hinter sich ließ, um in Techno, Dub und Reggae bis dahin ungekannte Tiefen auszuloten.
Hier Norwegen statt New Orleans, da Berlin statt Detroit und Kingston. Der eine nennt seine dritte Platte spöttisch NP3, der andere schneidet sich die Tonträger selbst, auf dass der Bass besser aus der Rille kommt.
Nun, im sechsten Lebensjahrzehnt, treten die beiden Klangtüftler erstmals gemeinsam aus dem Dunkel der Clubs, der Nacht, des Vinyls. Ihre Hände strahlen, in den Gesichtern brennt das Licht. 1/1 heißt frech das Album, als wollten sie sagen: Hier sind keine Nullen am Werk.
An Pathos fehlt es ihrer Inszenierung wahr-lich nicht. Aber die Musik hält dem Anspruch stand.
Noise I, das erste Stück, beginnt mit einem einsamen Trompetenton, gebettet in ein zu-nächst kaum vernehmbares Schaben. Ist das der Atem des Trompeters? Ein Oswaldsches Rau-schen? Schwer zu sagen, letztlich auch egal. Denn dann schlurft aus halliger Ferne ein Klang heran, der von einer Maultrommel oder einem Didgeridoo stammen könnte, aber bestimmt nicht stammt.
Der kritische Hörer will schon in seine Schubladen lugen: Wird das jetzt Meditations-musik? Eso-Gebläse? Avantgarde-Kram?
Spätere Stücke haben dann aber richtig Rhythmus, zwischendrin wallt und wabert die Trompete. Traumverloren, melancholisch, ur-weltlich. Farn, Farn, Farn auf der Autobahn …
Nach mehrmaligem Hören schwindet die Skepsis; diese Begegnung zwischen menschli-chem Hauch und elektrischem Grummel hat was. Sie geht ins Ohr. Sie lässt einen nicht los. Und sie gibt ihr Geheimnis nicht preis.
Die Namen der Stücke wirken in ihrer Ab-folge so rätselhaft wie zwingend: Step by Step, Transition, Development, Further, Future. Zur Abrundung gibt es einen Development-Remix des deutsch-chilenischen Techno-DJs Ricardo Villalobos.
Ganz am Schluss steht Noise 2, das die Unbe-stimmtheit des Anfangs aufnimmt und die Ambiguitätstolerenz des Hörers ein zweites Mal testet: Sollte sie unterwegs gewachsen sein?
Nils Petter Molvaer und Moritz von Oswald kennen das Schaffen des jeweils anderen seit Langem. Persönlich begegnet sind sie sich erst im Januar dieses Jahres. Molvaer hatte eigentlich gerade die Arbeit an seinem neuen Soloalbum beginnen wollen, als ihn der Vorschlag erreichte, mit Oswald aufzunehmen. Ein Freund des deut-schen Musikers hatte die Idee dazu gehabt. Mol-vaer stellte das eigene Projekt zurück und fuhr nach Berlin.
»Da wird auf den Knopf gedrückt,und dann gibt es kein Zurück«
Oswald führte ihn in sein Kellerstudio. Molvaer sucht noch im Nachhinein nach Worten: »Das war unglaublich, völlig unglaublich, was da an analogen Schätzen stand.« Die beiden Sound-verrückten begannen gleich mit den Aufnah-men, Moritz von Oswalds Assistent und Neffe Laurens stand ihnen bei.
»Auf meiner Seite ist alles Improvisation«, sagt der Trompeter. »Aber bei Moritz ist es nicht viel anders. Die Art, wie er arbeitet, ist sehr, sehr intuitiv.«
Intuitive Elektronik? Von Oswald hat sich über die Jahre im Live-Mix geübt. Das verbind-liche Abmischen der Musik geschieht im Mo-ment, in dem sie erklingt. »Da wird auf den Knopf gedrückt«, sagt der klassisch ausgebildete Perkussionist, »und dann gibt es kein Zurück. Das ist dann auch so, wie es sein soll.«
Die Musik wird also im Nachhinein nicht weiter bearbeitet. »Konzentration«, lautet Os-walds Credo. »Es kommt eben drauf an. Das Ergebnis ist wie ein Polaroid, das kann man nicht verändern.«
Wie traditionell wirkt diese Herangehens-weise zu einer Zeit, da alle Musik endlos und gewissenlos nachretuschiert wird wie das Bild auf Brüderles Wahlkampfplakat. Aber am Ende mag es diese Haltung sein, die Oswalds Pro-duktionen ihre untergründige Kraft verleiht.
»Respekt, Hochachtung, Konzentration« – von Oswald klingt wie ein Jazzmusiker, wenn er sagt, was ihm im Studio und auf der Bühne wichtig ist. Und seine erste Aufnahme mit Mol-vaer wäre ein First Meeting, wie es im Jazz im-mer üblich war. Aber von Oswald ist kein Jazzer, so wenig wie Molvaer einer sein will.
»Ich denke nicht in Genres«, sagt Molvaer. »Das wäre so, als ob ich immer nur Leute aus Usbekistan treffen wollte. Ich treffe einfach Leu-te, die ich mag, unabhängig von ihrem kulturel-len Hintergrund. Es geht mir mehr darum, wer jemand ist, und weniger darum, woher er kommt.«
Für die Musik findet er noch andere Worte als sein Partner: »Balance ist wichtig. Sich zu-rückzuhalten, zu warten. Die Spannung zu halten.«
Nils Petter Molvaer, Moritz von Oswald: 1/1(Emarcy/Universal)21. 10. Mannheim, Enjoy Jazz Festival25. 10. Hamburg, Überjazz Festival
Ich zerstöre ...
Fortsetzung von S. 61
wurde 1976 in Beirut gebo-ren, ihre Kindheit verbrach-te sie auf der Flucht. Über Abu Dhabi, Griechenland und Kuwait kam sie zurück in ihre zerstörte Heimat und gründete Soapkills, die ers-te Independent-Band desNahen Ostens. Mehrere Al-ben machten sie in der ara-bischen Off-Szene bekannt. Den Westen erschloss sie sich mit Arabology (2009), einem Electropop-Projekt mit dem Madonna-Produ-zenten Mirwaïs. Heute lebt Yasmine Hamdan mit ihrem Mann, dem palästinensi-schen Filmemacher Elia Su-leiman, in Paris. Ihr aktuel-les Album heißt Ya Nass (Crammed Discs/Indigo).
Yasmine Hamdan
Nils Petter Molvaer (ohne Trompete), Moritz von Oswald (mit Halstuch)
Foto
(A
uss
chn
itt)
: M
ario
n B
en
oit

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
An einem sonnigen Tag im Mai will ein junger Musiker ein Versprechen einlösen. Es be-gleitet ihn nun schon fünf Jahre und lautet: Dieser Junge wird einmal einer der größten Pianisten des Jahrhunderts
werden! Der künftige Jahrhundertkünstler sitzt also an einem Flügel in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem. Die Akustik ist eine Wonne, die Tradition der Vorgänger nicht nur Lust, auch Last. Karajan hat hier mit den Berliner Philhar-monikern viele Schallplatten aufgenommen, Musiker wie Anne-Sophie Mutter oder der Pia-nist Swjatoslaw Richter spielten hier. Und jetzt er, Kit Armstrong, 21.
Sonnenstrahlen fallen durch die Glasfenster und tupfen buntes Licht ins schlichte Kirchen-schiff. Kit Armstrong wirkt schmächtig am gro-ßen Flügel, immer noch mehr Jüngling als Mann. Er löst die Hände von den Tasten, legt sie auf die Knie und richtet Fußspitzen und Knie parallel zu-einander aus. Aufgeräumt. »Die zweite Hälfte noch einmal!«, ruft er in die Mikrofone, die im Raum hängen. Der Tonmeister nebenan hat den Regler noch nicht hochgeschoben, da legt er wie-der los. Rasant, aber präzise. Mühelos, aber mit Tiefe. Ein Choralvorspiel von Bach, er hat es selbst für Klavier bearbeitet.
Es ist eine geradezu vibrierende Intensität, die dieser junge Pianist bei der Aufnahme verbreitet – mit Werken von Bach, Ligeti und ihm selbst. Eine Fantasie über B-A-C-H. Wer einen solchen Titel wählt, ist nicht von Selbstzweifeln geplagt. Aber das Erstaunlichste an dieser CD-Einspie-lung ist etwas anderes: Es ist seine erste. Eine Debüt-CD fünf Jahre nach der großen Ankündi-gung – das widerspricht so ziemlich allem, was in der Klassikwelt üblich ist.
Wovor es anderen graust, das treibt er zur Entspannung: Mathematik
Das Versprechen, das Armstrong einlösen will, hat seinerzeit der Meisterpianist Alfred Brendel gegeben, als er sich von der Konzertbühne ver-abschiedete. Das war vor fünf Jahren. Er stellte der Welt den damals 16-Jährigen mit einem ge-wichtigen Wort vor. Wunderkind, sagte er, ob-wohl er, ein Mann der leisen Töne, natürlich weiß, was das anrichten kann.
Nach den Regeln des Musikbetriebs hätte Kit Armstrong gleich danach zum Star werden kön-nen. Denn mit dem Wort Wunderkind springt normalerweise die große Marketingmaschine an, die Zeit der Agenten, Labels und Konzertveran-stalter. Musiker und Maschine machen einen Deal: Das Label zahlt für Tonstudio, Vertrieb und Werbung und schiebt die Karriere an. Im Gegenzug lässt der Musiker sich Programme auf-drücken, erledigt Interviewtermine und Fotoses-sions. Er tritt mit so vielen namhaften Kollegen auf, wie er nur kann, um ebenfalls ein großer Name zu werden. Erfolgreich zu sein bedeutet, bekannt zu sein.
Dann wäre es Kit Armstrong vielleicht so ergan gen wie Yuja Wang, seiner chinesischen Kollegin, einer quirligen und eigentlich fröhlich wirkenden jungen Frau, die spielen kann wie der Teufel. Die beiden kennen sich vom Curtis Institute of Music in Philadelphia. Während Armstrong danach ein Mathematikstudium ab-schloss, komponierte, Kammermusik machte und hier und da einen Klavierabend gab, spielte Yuja Wang in vier Jahren vier CDs ein und jette-te von Konzerthaus zu Konzerthaus.
Es ist sicher nicht so, dass ein junger Künstler das nicht genießen könnte, die Nachfrage, den Beifall, die Reisen. Am Anfang sei ihr das alles vorgekommen wie Ferien. »Aber irgendwann konnte ich nicht mehr«, sagt Yuja Wang in einem seltenen Moment der Stille. Das war in einer Hotellobby in Berlin im vergangenen Herbst, Wang im plastikblauen Kleidchen, die Absätze wie immer hoch. Es sind nur noch ein paar Stun-den bis zum nächsten Auftritt. Während sie am grünen Tee nippt, erzählt sie vom langsamen Ausbrennen.
Innerhalb von vierzehn Tagen habe sie zehn Mal Rachmaninows Drittes Klavierkonzert ge-spielt, eines der berüchtigten Elefanten-Konzerte des Repertoires, fast besser bekannt als »Rach 3«. Beim elften Mal habe sie nicht gewusst, was sie damit eigentlich noch sagen wolle. »Ich brauche mehr Lebenserfahrung. Oder Zeit zum Lesen. Ich würde gerne Philosophie studieren oder berg-steigen. Ich will etwas erleben, das ich in meiner Musik zeigen kann.« Bis 2016 ist Yuja Wangs Terminkalender trotzdem voll.
Hinter den Kulissen des schönen, schnellen Klassikbusiness lauert eine große Gefahr: die des permanenten Zuviels. Gerade die begabtesten Inter-preten verheddern sich leicht in den Verlockungen und Verführungen, die auf sie einprasseln, haben ihre jungen Seelen bald leer gespielt. Dem Publikum fällt das nicht groß auf. Nur selten spricht ein Mu-siker offen darüber, wie es sich anfühlt, wenn der Betrieb einen langsam aushöhlt.
Die Geigerin Midori Goto etwa beschreibt in ihrer Autobiografie, wie sie die Lust an der Musik
verlor und sich vor Schuldgefühlen selbst ver-letzte, Arme und Gesicht verbrannte. Wie sie magersüchtig wurde. Und auch der Stargeiger Gidon Kremer klagt in einem empörten, schma-len Band den Musikmarkt an. Kremer wurde selbst jahrzehntelang bewundert und um-schwärmt. Trotzdem warnt der Alte nun in sei-nen Briefen an eine junge Pianistin davor, sich dem Streben nach Popularität hinzugeben, »der Krankheit unserer Musikwelt«. Als würde ein Musiker damit die Kunst verraten: »Entscheidend für die Karriere, sogar für das Leben«, schreibt Kremer, »wird das Know-how, wie man seine Begabung am besten verkauft. Dass man seine Seele gleich mitverkauft, merken nur wenige.«
Dieser »Krankheit des Musik-betriebs«, den Mechanismen von Ruhm und Vermarktung, hätte auch Kit Armstrong zum Opfer fallen kön-nen. Die Begabung hat er, den nöti-gen Ehrgeiz – und Brendels Wort vom Wunderkind im Nacken.
Wie hat er das fünf Jahre lang überlebt?Kit Armstrong war kaum ein Jahr alt, als er
zu sprechen und zu rechnen begann. Mit fünf hatte er den Mathe-Stoff durch, den Jugendliche in Amerika an der Highschool lernen. Die Mut-ter befürchtete, er würde als Mathematiker eines Tages das Leben eines einsamen Sonderlings führen, weshalb sie Kit ein Klavier kaufte. Das Kind brauche ein Hobby, dachte sie. Schnell war der Kleine von dem Instrument nicht mehr weg-zubekommen. Er spielte, bis sich die Haut von den Fingerkuppen schälte. Heute ist Musik der Beruf und Mathe das Hobby. Er rechnet zur Entspannung.
Immer wieder hat seine Mutter, eine Invest-mentbankerin, diese Geschichte erzählt. Vor wenigen Jahren noch gab sie bei Interviews die Antworten, nicht er. Er saß stumm und eigen-tümlich daneben. Und wenn er doch einmal selbst antworten sollte, dann tat er das nur vom Klavierhocker aus, wo er sich sicher fühlte. Heu-te hat er selbst ein Gespür für das, was er sagt. Und überraschte vor zwei Jahren die Journalistin und auch seine Agentin damit, dass er plötzlich Deutsch sprach. Er hatte es sich selbst bei-gebracht, mit einem Wörterbuch. Und einer deutschen Grammatik. Heute spricht er akzent-
frei und ein wenig, als würde er aus einem ange-gilbten Buch vorlesen.
Kit Armstrong hat ein glänzendes Gedächt-nis. Einige Sätze haben sich darin besonders tief eingegraben. Sie kommen von seinem Mentor Alfred Brendel. Der nannte ihn die »größte Be-gabung, der ich in meinem ganzen Leben begeg-net bin«. Aber was Armstrong nicht vergessen kann, ist das, was er danach sagte: dass ihm die Dinge zu leicht fielen. »Das ist die Gefahr.«
Ein Mentor wie Brendel kann ein schützendes Gegengewicht sein zu den Sogkräften des Marktes und der eigenen Eitelkeit. Er lehrte ihn die Geduld, auf seine Reife zu warten. Und die Demut, sich nicht von sei-ner Begabung hinreißen zu lassen.
Man spürt diese Demut immer wieder, wenn man mit Armstrong über Musik spricht. Am liebsten legt er dabei eine Hand auf die Tasten vor sich, als würden sie ihm Sicher-heit geben. So wie vor einem Jahr, als er an einem Stück von Franz Liszt
arbeitete, etwas Schlichtem, keine große Angebe-rei. »Ich lerne schnell«, sagte er. »Aber das bedeu-tet nicht, dass es leicht ist.« Er sagt so etwas im-mer wieder, als befürchte er, man könne etwas anderes in ihm sehen als einen ernsthaften Musi-ker. So etwas wie eine Sehenswürdigkeit.
Mit Pony und Tweedjackett galt er als nicht »vermarktungsfähig«
Natürlich sind die Plattenlabels damals auf ihn aufmerksam geworden, trotz Demut und Ge-duld. Sie hörten Brendel »Wunderkind« sagen. Sie lauschten Armstrongs lupenreinem Anschlag. Seiner Virtuosität und Leichtigkeit. Aber sie be-merkten auch seinen unentschiedenen Hände-druck. Den Pony, wie kindlich er ihm in die Stirn fiel. Das konservative Tweedjackett, in dem er verschwand.
Der eine Plattenlabel-Vertreter fand ihn »nicht vermarktungsfähig«. Der andere wollte nicht nur an den CD-Verkäufen beteiligt wer-den, sondern auch an den verkauften Konzert-karten. Armstrong lehnte ab, die Deals platzten.
Also keine Platten und Plakate, keine Rezen-sionen, keine Star-Orchester, wenig Aufmerksam-keit. Na und? Das Warten hat nicht geschadet, im
Gegenteil. Kit Armstrong hat in all den Jahren regelmäßig konzertiert, solo und als Kammer-musiker; nicht in den ganz großen Sälen, aber an handverlesenen, feinen Orten. Die Vermark-tungsmaschine hat ihn verschont. Deshalb kann er jetzt mit seiner CD mehr von sich zeigen, als man es je von ihm erwartet hätte.
Das Programm – sicher etwas unbequem für das ganz große Publikum: Bach, Ligeti, Arm-strong. Schon das Cover-Foto zeigt nicht mehr den sich ein wenig aseptisch gebenden jungen Mann im Tweedjackett. Sondern sein Gesicht in Großaufnahme, wie er mit geschlossenen Augen träumt. Ein Schnappschuss, intimer als jedes Pia-nistinnen-Dekolleté.
Und drinnen zunächst zwölf Choralvor-spiele: Armstrong schafft eine Gefühlsland-schaft, abwechslungsreich wie die einer Barock-oper. Dabei lässt er die Serie mit O Mensch, bewein’ dein’ Sünde groß in großer, inniger Ruhe ausschreiten. Es folgt eine etwas sperrige, nicht unspannende Ei gen kom po si tion, Fantasy on B-A-C-H, mit der er sich wahrscheinlich selbst leicht einen Knoten in die Finger spielt. Und schließlich György Ligeti: Die Stimmen von dessen Musica Ricercata lässt Armstrong an manchen Stellen so filigran übereinander, unter-einan der und nebeneinander herlaufen, dass sie sich förmlich in Gänsehaut auflösen.
So weit, so eher ungewohnt. Mitten hinein in dieses Programm stellt Armstrong – akkurat und melodisch – Bachs B-Dur Partita, mit der er sich wird messen lassen müssen. Vielleicht hat er es genau deshalb gemacht. Damit da et-was ist, das die Intensität der Aufnahmesituati-on absorbiert.
Fünf Jahre hat Kit Armstrong gewartet, bis er sich so präsentieren konnte. Er ist reifer gewor-den, braucht jetzt weder seine Mutter noch ein Klavier, um Interviews zu geben. An einem August abend, die CD ist aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht, sitzen wir in wieder in Berlin, ein Restaurant in Prenzlauer Berg, die Abendluft ist lau. Armstrong wirkt entspannt. Zufrieden mit sich und seinem Erfolg im eigenen Tempo. »Ruhm bedarf anderer Menschen«, sagt er und wählt die Worte, »Erfolg nicht.« Er sieht dabei ziemlich gleichmütig aus. Ein bisschen wie aus der Zeit gefallen.
»Bach, Ligeti, Armstrong« (Sony)
Ab Takt 243 gerät die Fuge endgültig aus den Fugen. Es kracht, einige Achtel glü-hen, andere trillern noch, man sieht Ludwig van B.s zusammengebissene
Zähne hinterm Visier, ehe rasch eine Idylle ein-geblendet wird. So hört sich das an, wenn Igor Levit das Finale der Hammerklaviersonate spielt. Beetho-ven schrieb sie mit 47 Jahren, schon Zeitgenosse der Zukunft. Für sein CD-Debüt hat sich Levit, 26, eines der technisch wie intellektuell anspruchs-vollsten Klavierwerke aller Zeiten ausgesucht, nebst vier weiteren späten Beethoven-Sonaten.
Vor drei Jahren bereits wurde er zu einem der »großen Pianisten dieses Jahrhunderts« ausgerufen – bleischwerer Lorbeer. Nicht alles ist Levit seither so aufregend geraten wie der Finalcrash in Opus 106. Im Gegensatz zu den meisten Jungstars aber kann er erklären, warum er was macht. Beethovens Metronomzahlen für die Hammerklaviersonate etwa sind ihm heilig. 138 pro Halbe für den ersten Satz, »das ist ein absurd schnelles Tempo, ich spie-le 126, aber da ist wenigstens die Tendenz klar. In neun von zehn Aufnahmen ist der erste Satz ein Allegro pomposo maestoso. Das Gegenteil hat er komponiert: ein hysterisches Allegro!«
Igor Levit, kantiger Kopf, starkes Kinn, sprudelt über im Gespräch, im astreinen Hochdeutsch sei-ner Wahlheimat Hannover, wohin seine Familie in den neunziger Jahren zog. Hier studierte er beim legendären Klavierschamanen Karl-Heinz Käm-merling, der vor einem Jahr starb. »Er hatte eine so enorme Aura, dass man zehnmal besser spielte, wenn er auf seinem Drehstuhl angerollt kam und neben einem saß.« Als Vierjähriger hatte der Sohn einer Klavierlehrerin im russischen Gorki seinen ersten Auftritt mit einer Ecossaise von Beethoven, mit vierzehn fertigte er von seinem Lieblingswerk, der Missa solemnis, einen Klavierauszug an.
Mittlerweile sind die Quellen des 18. Jahrhun-derts und die Avantgarde des 20. in sein Beetho-ven-Bild eingeflossen. Das kann man hören, wenn ein kleiner Sekundschritt im Bass (im Andante von Opus 109) an die Seufzer einer barocken Pas-sionsmusik gemahnt, die Komplementärrhythmik der zweiten Variation aber etwas Dekonstruktives hat. Im Allegro molto von Opus 110 lässt sein har-ter Zugriff fast an Wolfgang Rihm denken, aus dem repetierten A im Adagio wird eine Material-träumerei. Levit realisiert die »Ich-Verlassenheit«, die Thomas Mann im Dr. Faustus dem späten Beethoven zuschrieb. Bei ihm wirft die Arietta von Opus 111 wirklich jeden »Schein der Kunst« ab. Es gibt Passagen, in denen man bei 100 Grad minus auf dem Mars steht, nur durch »stehen gelassene Konvention« geschützt.
Weniger liegt ihm das Innige des Klangs, der ma-gische Schmelz inmitten klarer Kontur, den man etwa beim jungen Baren-boim erlebt. Der nahm Beethovens Sonaten im selben Alter auf wie Levit, vor knapp 50 Jahren. Den Bruch im Finale der Hammerklaviersonate verschönerte Barenboim, und das Idyll danach wurde berührender Gesang, während Levit es abstrakter spielt, als dramaturgi-sche Funk tion. Und der erste Satz: Natürlich schlägt Barenboim ein eher pompöses Tempo an, aber darin gelingt ihm eine prickelnde Artikulati-on, die nicht physisch, aber psychisch auf ein un-einholbar hohes Tempo kommt. Für Levits Vision eines »hysterischen Allegro« brauchte man wohl doch besser ein leichtgängiges Hammerklavier.
Wer diesen Musiker ganz kennenlernen will, muss ihm ins Konzert folgen und zu einer beson-deren Obsession. Weil Levit Partituren liest wie andere Krimis, erschloss er sich den Bestand der hochschuleigenen Notenbibliothek. Unter »R« stieß er auf Frederic Rzewski. Der Amerikaner, Jahrgang 1938, hat mit seinen 36 Variationen über die Polithymne The People United Will Never Be Defeated eins der durchtriebensten Klavierwerke des 20. Jahrhunderts geschrieben. Fast zehn Jahre brauchte Levit, bis er es beherrschte, und als er es jetzt im Sommer bei den Kunstfestspielen Herren-hausen aufführte, war der Saal ausverkauft.
Das Thema wird zerlegt, verflüssigt und wieder zu Blöcken verdichtet, um die der Schaum von Fortissimi in höchster Lage spritzt. Levit schmeißt sich so hinein in diese Musik, dass in der siebten Variation eine Saite im Diskant reißt. Da Rzewski kurz vor Schluss ohnehin eine Improvisation ver-langt, nutzt Levit die Chance, das geschrottete Gis zum Thema zu machen. Der Schepperton wird Ostinato, geborstenes Glöckchen, der anwesende Komponist, ein zauseliger Maverick wie aus dem Bilderbuch, kichert in der ersten Reihe. Anschlie-ßend spielen die beiden Four Hands von Morton Feldman. Sitzen am Flügel wie Kinder vor einem Wunderding, es vorsichtig ertastend. In Feldmans bescheidener, sparsamer Komposition findet Levit die Innigkeit und Unmittelbarkeit, die ihm sonst mitunter fehlt. Eine Mitte, ohne die man um die-sen überwachen Kopf fast fürchten müsste.
»Beethoven – The late piano sonatas« (Sony)
Geborstene GlöckchenIgor Levit wagt sich an Beethovens späte Sonaten VON VOLKER HAGEDORN
MUSIK 63
Igor Levit, 26, hat russische Wurzeln
Kit Armstrong, Kalifornier, Jahrgang 1992
Schon als Fünf jähriger spielte Kit Armstrong Klavier, bis sich die Haut von den Fingerkuppen schälte
Warten tut gutVor fünf Jahren hätte das »Wunderkind« Kit Armstrong mit großem Getöse
ein Star werden können. Stattdessen übte er sich in Demut und Geduld.
Jetzt ist er wieder da VON CAROLIN PIRICH
Junge Pianisten: Woher sie kommen, was sie versprechen und wie sie denken
Foto
s: O
scar
Le
be
ck/
13
Ph
oto
; Ir
en
e Z
and
el; F
elix
Bro
ed
e (
r.)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4164 MUSIK
Septemberstimmung im nordengli-schen Städtchen Durham. Ein paar müde Sonnenstrahlen fallen zwi-schen den Wolken herab, doch die wirklich guten Tage sind vorbei. Vielleicht ahnt das auch der ältere Herr mit dem Rauschebart und
den langen weißen Haaren, der über die mittelal-terliche Elvet Bridge schlendert, als gäbe es dort keine Touristen, die in kreischbunter Funktions-
kleidung im Weg stehen. Man könnte ihn für einen Literaten halten oder einen exzentrischen Profes-sor. Doch Paddy McAloon ist Popmusiker, der Kopf der Band Prefab Sprout – auch wenn er sich lange von der Welt der Charts verabschiedet hat.
Wie eine Flaschenpost schickt er im Abstand von vielen Jahren immer mal wieder ein Album in den Ozean der Neuerscheinungen. Kritiker feiern den Mann dann regelmäßig wie einen Heiligen, einen Brian Wilson aus Englands grimmigem Norden. Allein die Tatsache, dass vor einigen Wo-chen neue Songs auf YouTube auftauchten, führte zu hysterisch-hymnischen Vorabbesprechungen, die Hoffnung, dass es im Herbst ein neues Album von Prefab Sprout geben könnte, trieb die Eupho-rie auf einsame Spitzen. Aber warum bloß, wer ist dieser Paddy McAloon? Ein Genie oder doch bloß ein begabter Kunsthandwerker des Pop?
Alben wie From Langley Park To Memphis oder Andromeda Heights sind seltene Exemplare einer Gattung, die man Autorenpop nennen könnte – so
literarisch in ihrem Anspielungsreichtum, dass man sich bisweilen Fußnoten wünscht, und musikalisch so kenntnisreich in Szene gesetzt, dass sich Connais-seure behaglich in die Polster ihr Kopfhörer ku-scheln. In den Achtzigern gab es bei Prefab Sprout sogar einen gewissen Willen zur Jugendlichkeit: Das Cover ihres Klassikers Steve McQueen zeigt drei Jungs, ein Mädchen und ein altes Triumph-Motor-rad – die Musikgruppe als romantische Außen-seiterbande. Dahinter die kalten Nebel und kahlen
Äste der nordenglischen Provinz: eine perfekte Schnittmenge aus James Dean, Nouvelle Vague und britischer Working-Class-Attitude. Die Rebellion von Prefab Sprout fand im Programmkino statt.
28 Jahre liegen zwischen Steve McQueen und dem Paddy McAloon, der jetzt vor dem Royal County steht – einer an Britishness nicht zu über-bietenden Häuserzeile, die inzwischen ein Hotel beherbergt. Freundlich strahlen seine Augen – je-denfalls stellt man sie sich freundlich und strah-lend vor, denn unter der riesigen Sonnenbrille, die er noch über seiner normalen Brille trägt, sind sie kaum zu erkennen. Jetzt geht ein Ruck durch sei-ne Figur: Aber natürlich, klar, der Journalist aus Hamburg, der über das neue Prefab-Sprout-Al-bum Crimson/Red reden möchte! »Gehen wir doch rein und suchen uns ein Plätzchen«, sagt er, als wären wir alte Freunde. Kaum in den weichen Polstern einer Sitzecke gelandet, beginnt Paddy McAloon zu erzählen – atemlos ausschweifend, aber immer klug und reflektiert.
Es ging ihm nicht gut in letzter Zeit, vor allem gesundheitlich. Vor etwa zehn Jahren löste sich auf beiden Augen die Netzhaut, was zu einer zeitweili-gen Erblindung führte und bis heute operativ be-handelt wird. 2006 folgte ein schwerer Tinnitus, der zusammen mit einer sogenannten Hyperakusis dafür sorgt, dass McAloon selbst kleine Geräusche als unerträglich laut empfindet. Seitdem ist es ihm unmöglich, mit anderen Musikern in einem Raum zu arbeiten. Ein Flugzeug hat der 56-Jährige schon
lange nicht mehr betreten, Konzerttourneen sind undenkbar. Aus Prefab Sprout, einer Band von vier Freunden aus Durham, wurde das Projekt eines Solokünstlers. »Niemand würde ein Album von Paul McCartney als Werk der Beatles durchgehen lassen«, klagt McAloon. Aber was soll er tun?
Der Name ist eine Bank, und Crimson/Red klingt genau so, wie es sich Prefab-Sprout-Fans er-träumen: hinreißende Melodien, fein verästelte Arrangements, in den Texten die gewohnt brillan-ten Formulierungen. Um Details kümmert sich der langjährige Toningenieur Callum Malcolm, der Einzige, den McAloon noch an seine Musik lässt. 2003 war er kurz davor, alles hinzuwerfen: »Ich fragte mich, ob die Menschheit wirklich noch mehr von mir hören muss.« Damals floppte McAloons bisher einziges Album unter eigenem Namen. ITravel The Megahertz war eine ätherische Klangrei-se zwischen Soundtrack und Neuer Musik. Dass normale Pophörer damit wenig anfangen konnten, enttäuschte ihn: »Inzwischen sehe ich I Travel The
Megahertz eher wie einen Experimentalfilm. Man kann so etwas nicht in einem Multiplexkino zeigen, in dem sonst Filme wie E.T. laufen.«
Dass er tatsächlich E.T. als Referenzgröße nennt und nicht Herr der Ringe oder sonst etwas aus dem zeitgenössischen Mainstreamkino, beschreibt per-fekt, welches Stadium der Weltvergessenheit Mc-Aloon mittlerweile erreicht hat. Allen Einflüssen der Gegenwart entzogen, lebt er mit seiner Familie in einem ländlichen Exil voller Bücher und Musik: »Ich gehöre zu den Menschen, denen die Imagina-tion wichtiger ist als der Ort, an dem sie sich phy-sisch aufhalten.« Man muss sich McAloons Heim-studio wohl wie eine kleine Manufaktur vorstellen: »Ich schreibe. Die ganze Zeit. Das ist alles, was ich den Tag über tue. Einen normalen Job könnte ich nicht machen. In meinem Kopf spielt immer die Melodie des Stücks, an dem ich gerade arbeite«, sagt er und streicht sich dabei über den zotteligen Bart wie ein freundlicher Weihnachtsmann.
Manche Songs kommen so leicht zu ihm wie Fusseln auf einen Mantel. Andere sind störrisch, die legt er erst mal halb fertig in alten Kartons ab. Unter Prefab-Sprout-Fans kursieren Gerüchte über Dutzende unvollendeter Alben, die McAloon in seinem Haus hortet. Auch die zwischen 1997 und 2010 entstandenen Songs von Crimson/Red stam-men aus dem Archiv. Aufgenommen hat McAloon sie im Herbst letzten Jahres, zu Hause. Die Platten-firma ließ ihm keine Ruhe, aber jetzt strahlt er: »Ich habe das Gefühl, dies ist die beste Songkollektion, die ich gemacht habe.«
Mag sein, dass der Mann ein wenig übertreibt, aber die zehn Stücke sind deutlich besser als das Material seines letzten Album Let’s Change The World With Music. Vor allem die Single Best Jewel Thief In The World hat Hitqualitäten. »Maskiert und schwarz gekleidet, kletterst du über Haus-dächer«, singt McAloon zu heulenden Sirenen, syn-thetischen Streichern und einem unwiderstehlichen Uptempo-Beat. Der Song ist eine Vier-Minuten-Version von Alfred Hitchcocks Über den Dächern von Nizza – mit Paddy McAloon in der Rolle von Cary Grant. »Die Arroganz eines Juwelendiebs ist etwas, was auch ein Autor manchmal braucht, um seine Arbeit gut zu machen«, sagt er. »Ich denke mir einfach einen Titel aus und schreibe darüber einen Song. Einzelne Wörter, Bilder, das funktioniert fast wie ein kleines Filmdrehbuch.«
Der Albumtitel Crimson/Red stammt aus dem Song Adolescence, der vom kribbelnden Gefühl handelt, ein Teenager zu sein: »Ich dachte an Feu-erwerk und Purpur, an Blitze im Kopf, an ein Streichholz, das entflammt.« McAloon macht den Song zu einer Meditation über das Altern. Über-haupt durchzieht ein Hauch von Spätsommer das Album: Zu Tautropfen, die auf Spinnennetzen glitzern, erzählt McAloon die Geschichte vom al-ten Zauberer, der sich ein letztes Mal vor seinem Publikum verbeugt und dann desillusioniert die Bühne verlässt. »Death is a lousy disappearing act«.
Vielleicht ist The Old Magician das Stück, das seine Kunst am besten beschreibt: Der alte Zaube-rer Paddy kennt sein Talent, weiß um seine Gren-zen und verzettelt sich nicht mit billigen Tricks. Er erzählt von den großen Themen, indem er sie in lauter kleine Geschichten verpackt. Das ist ihm auch dieses Mal wieder so meisterlich gelungen, dass weiteren Liederkränzen aus der großen Truhe nichts im Weg steht. »Watch your legend grow«,singt McAloon, »the rooftops are for dreamers« –Hausdächer sind etwas für Träumer.
Prefab Sprout: Crimson/Red(Embassy of Music/Warner)
Anfangs ähnelten sie noch einer ech-ten Band: Prefab Sprout, in den frühen Achtzigern in Nordengland gegründet. Neben Paddy McAloonan der Gitarre zupfte Bruder Martin den Bass, es gab einen Schlagzeuger, und Freundin Wendy Smith steuerte zarte Zweitstimmen bei. Doch nach diversen Versuchen, sich in den Top Ten zu etablieren, entwickelte die Gruppe sich mehr und mehr zu einem Solounternehmen. Heute macht McAloon alles allein: schreiben, arrangieren, aufnehmen. Geblieben ist die Hoffnung auf einen Pop für den denkenden Menschen.
Prefab Sprout
Professor PopFrüher wollten Prefab Sprout mit ihrer Musik die Welt verändern. Heute arbeitet ihr Frontsänger Paddy McAloon allein und
begreift sich als Privatgelehrter. Ein Besuch bei dem großen Songwriter in der englischen Provinz VON JÜRGEN ZIEMER
»Als Autor braucht man manchmal die Arroganz eines Juwelendiebs«, sagt Paddy McAloon
Foto
: K
evi
n W
est
en
be
rg

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
So sieht Charisma aus. Ein bisschen unausgeschlafen und mitgenom-men, das zeigt selbst das pixelige Skype-Bild, die Augen noch schwer, die Haare notdürftig ver-staut. Es ist früh in Kalifornien, doch sobald Jana Herzen zu reden
anfängt, geht es mit jedem Satz, jedem Wort ein Stück bergauf, in Richtung Tag. Jana Herzen ist eine Ausnahmepersönlichkeit im Musikgeschäft, eine weiße Singer-Songwriterin mit einer Vorliebe für schwarze Beats, die nun ihr eigenes Jazzlabel leitet, das sich mit Musikern wie Monty Alexander, Randy Weston, Geri Allen oder Gregory Porter stark auf den hymnischen Jazz der sechziger Jahre bezieht. Während die Musikindustrie von einer Krise in die nächste taumelt und musikalische Ni-schen mit ihren immer begrenzteren Umsatzerwar-tungen aus ihren Geschäftsplänen verbannt, um-schifft Jana Herzen mit Motéma, ihrem Label, dank ihrer absolut mitreißenden Energie sämtliche Klippen.
»Die Polyrhythmen des Reggae haben mein Hirn neu eingestellt«
In einer afrikanischen Sprache bedeutet motémaHerz. Das Logo des Labels ist ein gezeichnetes Herz, das aus dem mathematischen Unendlich-keitszeichen aufzusteigen scheint. Seine Gründerin heißt Herzen. Alles klar? Gegründet hat Jana Her-zen ihr Label, weil sie eine Plattform suchte, die ihre eigene Musik zur Geltung bringt. Für ihre Songs, die Einflüsse aus den verschiedensten Re-gionen der Musikwelt, aus Folk und Reggae, Blues und Weltmusik, Rock und Jazz, mit ihrem so prä-zisen wie lässigen Gesang und dem Gestus einer klassischen Singer-Songwriterin verknüpfen.
Zehn Jahre ist das jetzt her, aus den zwei bis drei CDs, die sie ursprünglich pro Jahr veröffent-lichen wollte, sind inzwischen mehr als hundert geworden, von ihr selbst ist im letzten Herbst die zweite Platte erschienen. Passion of a Lonely Heart,die CD, die sie allein mit dem Bassisten Charnett Moffett einspielte, dokumentiert eine beeindru-ckende Entwicklung: Aus der Sängerin, die das Korsett ihrer Songs nicht abstreifen konnte und
wollte, ist eine souveräne Musikerin geworden, die sich mit enormer Sicherheit durch viele musikali-sche Räume bewegt, die Stille aushält und mit lässiger Nonchalance die reichen Facetten ihrer weichen Altstimme ausspielt. Doch die Gewichte haben sich verschoben. Vor ihrer eigenen Musik rangiert nun die Musik anderer, die sie mit der gleichen Leidenschaft vertritt.
MUSIK 65
Moleküle verändernSie hat eine Vorliebe für schwarze Beats und begreift ihr Jazzlabel Motéma nicht als Firma, sondern
als kulturelles Projekt: eine Nahaufnahme der Singer-Songwriterin Jana Herzen VON STEFAN HENTZ
Jana Herzens Eltern, ein erfolgreiches For-scherpaar in Stanford, haben immer ein offenes Haus geführt. Gäste, Gespräche, Debatten. En-gagement gegen den Vietnamkrieg, für Frauen- und Bürgerrechte. Politik, Kunst, Theater. Musik aus vielen Quellen, Jazz, Louis Arm-strong, Ella Fitzgerald, Miles Davis. An der Hochschule gab es Konzerte. Mit fünf Jahren bekommt Jana ihren ersten Klavierunterricht, ihr Lehrer erklärt ihr die Harmonien, die Ter-zen, Quinten, Septimen und wie sie mit den Melodien zusammenhängen. Wenig später sitzt Jana auf dem Schoß des Jazzpianisten Randy Weston, den jemand ins Haus der Herzenbergs (so heißt die Familie richtig) gebracht hatte. Mit 15 nimmt sie am Theater ihrer Highschool einen Job an. Zuständig ist sie für alles: Licht, Produktion, Management.
Später führt sie ein regelrechtes Doppelle-ben: tagsüber Studium der Biologie, nachts Theater. Klappte nicht. Jana Herzen zog nach New York, studierte dort Theater und gründete eine Theatergruppe. Offiziell war sie Drama-turgin und arbeitete mit Autoren an ihren Stü-cken, inoffiziell machte sie alles andere wie ge-habt: Licht, Produktion, Pressearbeit, Regie, Schauspiel. Zehn Jahre ging das so – die Man-hattan Class Company sammelte Preise, aber Jana Herzen fühlt sich immer stärker zur Musik hingezogen. Schließlich geht eine Beziehung in die Brüche, ihre Großmutter stirbt, und Jana Herzen kehrt der Theaterarbeit den Rücken.
»Ich spürte, dass ich eine Platte aufnehmen musste, um mit mir ins Reine zu kommen«, sagt sie. Jana Herzen packt die Gitarre ein und geht auf »Musical Mystery Tour«. Japan, Bali, Australien, in die Weite des Outbacks. Überall trifft sie auf Musiker, und Schritt für Schritt er-schließt sich für sie eine neue Welt. Als sie schließlich nach Kalifornien zurückkehrt, trifft sie sich mit afrikanischen Reggaemusikern. »All diese Polyrhythmen zu hören, das hat mein Ge-hirn neu eingestellt«, so beschreibt sie die Wir-kung dieser neuen musikalischen Erfahrungen: »Zu begreifen, wie die verschiedenen Stimmen ineinandergreifen, der Bass, die Trommeln und die Gitarre – so etwas gab es im Folk nicht.« Plötzlich greifen auch in ihren Songs neue Rä-der ineinander, plötzlich ist sie im Groove und stellt für sich eine Verbindung zu dem rhyth-mischen Wurzelwerk her, das die schwarzen Musikstile von Blues über Jazz bis Soul und Reggae speist.
Sie tritt auf, lernt immer neue Musiker ken-nen, hilft ihnen bei deren Projekten, bei Pro-duktion, Vermarktung, Management. Das kennt sie vom Theater. Umgekehrt helfen die ihr bei ihrem Projekt, und als sie erlebt, wie Jazzmusiker ein Stück einfach live einspielen, statt die technischen Möglichkeiten des Studios zu nutzen und sauber Spur für Spur aufzuneh-men, da ist es um sie geschehen. »Wow, dachte ich, das könnte ich nie«, erzählt sie, »ich hab mich in die Klasse dieser Musiker verliebt.« Sie spielt, lernt, produziert. Und geht hausieren, von einem Label zum nächsten. Ihre Musik trifft zwar auf positive Resonanz, aber sie passt nicht recht in die Ablagesysteme der Musikin-dustrie. Dennoch gibt es viele, die sie ermuti-gen. Irgendwer sagt: »Du solltest ein Label gründen, du würdest das gut machen.«
»Es war nie mein Traum, ein Label zu füh-ren« sagt sie, »aber ich glaube, es ist so, dass ich das Label gar nicht führe, das Label führt mich.« Schließlich wagt sie den Schritt und
engagiert einen erfahrenen Produzenten. Kaum ist die erste Platte auf dem Markt, springt der wieder ab. »So war ich plötzlich zur Alleinerzie-henden geworden und musste alles selbst he-rausfinden. Dabei ist es geblieben.« Aber eins kommt zum anderen, mittlerweile kann sie auf eine beeindruckende Künstlerliste bauen, auf echte Klassiker des modernen Jazz wie die Pia-nisten Randy Weston oder Monty Alexander, auf Meistermusiker aus der nachfolgenden Generation wie die Pianistin Geri Allen, den Saxofonisten David Murray oder den Bassisten Charnett Moffett, auf junge Entdeckungen wie die Saxofonistin Lakecia Benjamin und den Sänger Gregory Porter.
Musik soll die Welt verbessern, nicht mehr und nicht weniger
Durch die Entdeckung Porters, der in den letz-ten drei Jahren aus dem Nichts zu einem der ganz großen männlichen Gesangsstars durch-startete und mittlerweile zu dem Großlabel Blue Note gewechselt ist, hat Motéma Spiel-raum für weitere Projekte gewonnen. Doch es geht nicht nur um Umsatz und Erfolg, Herzen versteht Motéma eher als kulturelles Projekt und eine Art Musiker-Community, wo einer dem anderen hilft. So geben die Musiker dem Label auch außerhalb der Musik Impulse. Der Pianist Marc Cary zum Beispiel, der lange an der Seite der vor drei Jahren gestorbenen Sän-gerin Abbey Lincoln spielte, beschaffte dem Label einen Firmensitz im denkmalgeschütz-ten ehemaligen Wohnhaus von Langston Hughes, dem berühmtesten Dichter der Har-lem Renaissance der zwanziger Jahre.
Mittlerweile ist Motéma einen Block wei-tergezogen, doch der Geist des Viertels weht auch hier. Cary und die anderen Musiker des Labels sorgen für die Vernetzung mit anderen Musikern und übernehmen einen Teil der auf-wendigen Künstlerakquise. Längst weiß Jana Herzen ziemlich genau, was sie von den Musi-kern verlangt, die bei ihr veröffentlichen wol-len: musikalische Meisterschaft und Charisma als Performer, die Fähigkeit, »die Moleküle im Raum zu verändern«. Und die Haltung, mit ihrer Musik »die Welt zum Besseren verändern« zu wollen. Der ungebrochene Glaube daran, dass dies möglich ist, mit der Musik und der Arbeit daran, ist es, der das Phänomen Jana Herzen so überwältigend macht.
Jana Herzen/Charnett Moffett: »Passion of a Lonely Heart«Marc Cary: »For The Love of Abbey«David Murray: »Be My Monster Love«Geri Allen: »Grand River Crossings – Motown & Motor City Inspirations« (Alle bei Motéma/Membran)
»Nicht ich führe das Label, das Label führt mich«, so lautet die
Philosophie von Jana Herzen
Foto
: M
ote
ma
Mu
sic

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4166 MUSIK
Vom Überschießen des GeniesAlle Neune: Mariss Jansons legt mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks einen ergreifend modernen Beethoven-Zyklus vor VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY
Ließe sich dieser Beethoven-Zyklus in seinen unerhörten Einzelheiten mit-stenografieren, in Worte fassen, Beet-hoven hätte sich die Mühe nicht ma-chen müssen, neun Symphonien zu
schreiben, deren Anzahl allein allen nachfolgen-den Komponisten (bis heute) Mythos ist und Magie, Schallgrenze des Möglichen. So einfach aber ist das nicht mit der Musik und der Sprache, und überhaupt wäre Mariss Jansons wohl der letzte Dirigent, der sich als Wirkungsästhetiker begriffe und es auf ein stammelndes Raunen, ein namenloses Ergriffensein abgesehen hätte. Schon die Biografie des Letten beugt jeder romantischen Beethoven-Rezeption vor: 1943 in Riga geboren, wo sich seine Mutter vor den Nazis verstecken musste, frühe Einflüsse durch die russische Schu-le, später Meisterschüler von Hans Swarowsky in Wien und Assistent von Karajan in Berlin.
Und trotzdem ereignet es sich, jenes innere Stammeln vor dieser Musik, das Überwältigtwer-den von ihrer schieren Fülle – denn darin liegt Jansons Kunst: das Herz zum Bluten zu bringen und den Kopf zum Glühen, Gefühlsgewissheiten zu schaffen, an die man längst nicht mehr zu glauben wagte. Eine Kunst, die man vor allem von seinen tiefsinnigen Tschaikowsky- und Schostakowitsch-Interpretationen her kennt, aber auch bei Bruckner, Mahler und Brahms schätzt, mit dem Concertgebouw Orchester wie mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (beide leitet er derzeit). Mit Beetho-ven und den Bayern freilich dringt Jansons nun in neue Dimensionen vor, und das stützt nicht nur die These, dass der Wiener Klassiker das gravitätische Zentrum aller Musik ist, Urgrund und Fluchtpunkt zugleich; es zeigt auch, wie sehr
es sich lohnt, den richtigen Zeitpunkt abwarten zu können. Und sich nicht irritieren zu lassen von der vermeintlichen Übersättigung des Mark-tes mit dem Immergleichen.
Man greife (fast) wahllos zu einer der sechs CDs, aufgenommen im Herbst und Winter 2012 im Münchner Herkulessaal sowie, auf Tournee, in Tokios Suntory Hall. Der Kopfsatz der Siebten Symphonie zum Beispiel, jener so viel beschworenen und so selten eingelösten »Apo-theose des Tanzes«: Da schmaucht es förmlich aus allen Ritzen, ein Kriegslärm wie vom Reiß-brett, und würden die Holzbläser nicht so eifrig ihre Haydnschen Pirouetten drehen und lebte diese Musik nicht auch von einem frühromanti-schen Naturlaut – Siegessuff und Allmachtsdusel gewönnen wohl die Oberhand. Gespenstisch, mit welcher Akribie und Engelsgeduld Jansons hier das Überschießen des Genies freilegt, ohne es je als Potenzgehabe zu denunzieren. Und im-mer reißen die Hörner im Diskant ihre Mäuler am allerweitesten auf, als gäbe es ihn tatsächlich: den Triumph über den Triumph.
Von Furtwängler die Flexibilität, von Norrington das Rhetorische
Wenn dann das Thema im Satzschluss zur Coda hin hinkt, halb linkisch, halb listig, und alle Kraft sich noch einmal sammelt und wie Lava empor-schießt, dann wundert man sich nicht, dass die ersten Bravorufe am Ende der Symphonie, nach drei weiteren Sätzen und einem kantigen, fast unwirschen Allegro-con-brio-Finale, von sehr dünnen Stimmchen getragen werden: Jansons reitet die BR-Symphoniker hier in ein derart ka-tastrophisches Accelerando hinein, als wolle er
einen Crash der Instrumente provozieren. Das schnürt einem schon einmal die Kehle zu. Fabel-haft, mit welcher oszillierenden Farbenpracht und Rhetorik, mit wie viel leibgeistiger Hingabe die Musiker ihrem Chefdirigenten durch den Zy-klus und all seine Fährnisse folgen. Jede Sym-phonie soll übrigens mit einer spezifischen Or-chesterbesetzung einstudiert worden sein, der Unverwechselbarkeit des Tons halber. Bestätigen will Jansons das nicht. Er ist kein Despot, bei al-ler künstlerischen Konsequenz.
Nun ist die Diskografie der Beethoven-Sym-phonien traditionell nicht schmal, und man könnte es sich leicht machen und Mariss Jansons (jenseits der aktuellen Konkurrenz eines Riccar-do Chailly) mal eben ins Koordinatensystem der Großen setzen. Von Toscanini hätte er die Ge-radlinigkeit des Musizierens und die Unsenti-mentalität der langsamen Sätze (die, bei Toscani-ni, bitterböse wirken konnte); von Furtwängler inspiriert wäre die Flexibilität in den Temporela-tionen, der Mut, noch im ausgelatschten Ta-ta-ta-taa der Fünften in den Knien zu wippen, ohne dem Affen zu viel Zucker zu geben; von Karajan wiederum stammte die klangliche Homogenität, die bei Jansons freilich nichts Glattes, Gelecktes hat, sondern eher Assoziationen von dünnem Glas weckt, hinter dem Gräuliches geschieht; und von Kollegen der historisch informierten Aufführungspraxis wie Nikolaus Harnoncourt oder Roger Norrington schließlich scheint der 70-Jährige gelernt zu haben, was Klangrede heißt und dass jede noch so kleine Flötenkantilene, je-des Bratschensolo ein Stachel sein kann im Fleisch der Gewohnheit und des Gewöhnlichen.
Doch was ist mit solchen Etikettierungen ge-wonnen? Wenig. Mariss Jansons hat mehr zu
bieten als ein Best-of seiner Vorgänger. Jansons’ Beethoven ist immer klug, ohne zu klügeln. Er reflektiert, ohne darüber den direkten Bezug zur Musik zu verlieren. Alles zu wissen, um es im entscheidenden Augenblick vergessen zu kön-nen, ja vergessen zu haben, ist eine rare, kostbare Gabe. Meist teilen sich die Beethoven-Interpre-ten – und hier wird die Virilität der Musik zur Falle! – in Triebtäter und in Blaustrümpfe. Nur wenige haben an beidem teil.
Das Gewitter in der Sechsten verzieht sich eine Spur zu schnell
Christian Thielemann kann das in guten Mo-menten, Carlos Kleiber konnte es. Und das ist vielleicht der einzige Vergleich, dem Jansons nicht ganz standhält, so herrlich mürbe und nach Freischütz klingend er die Hörner im Lustigen Zusammensein der Landleute in der Sechsten auch aufspielen lässt, so brettern der Tanzboden bebt: Stellen wie der Übergang vom vierten zum fünf-ten Satz, von den Schwefelschlieren des Gewit-ters zum Hirtengesang, jene Zittrigkeit im Dank, noch einmal davongekommen zu sein, jenes Un-gläubige, Zarte, Neugeborene – die gelingen ihm dann doch zu schnell zu vital. Und daran ändern auch die »Reflektionen« zeitgenössischer Kom-ponisten nichts (von Kancheli bis Widmann), die den Symphonien zugeordnet sind und Fens-ter ins 21. Jahrhundert öffnen sollen. Weil sie notgedrungen im Schatten ihres Über-Ichs ste-hen. Und weil der Hörer nach solch neunfach lodernder Intensität einfach erledigt ist.
Ludwig van Beethoven, The Symphonies and Reflections (BR Klassik)
Mariss Jansons und die BR-Symphoniker auf Tournee in Tokio
Foto
(A
uss
chn
itt)
: K
. M
iura

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4168 MUSIK
Gegen Lebensende bekannte Giuseppe Verdi, dass die still verbrachten Stunden mit Gott doch wieder zu seinen schönsten zählten. Dass dem so sei, verdanke er seiner Frau Giu-seppina: »Ich hatte mich«, schreibt Verdi, »ein bisschen abseits geschlichen, aber Peppi-na hat mich wieder zu ihm zurückgeführt.«
Mit dem Einsetzen der enigmatischen Tonleiter des Ave Maria in den Quattro pezzi sacri meint man, diesen Weg förmlich vor sich zu sehen: Hier öffnet sich ein Staunen machender Raum, der harmonisch weit ins 20. Jahrhundert hineinreicht, bis Luigi Nono ebendiese Tonleiter für sein Streichquartett Fragmente – Stille, An Diotima wieder auf-nehmen wird.
Nach einem famosen Requiem und dem musikalisch nicht minder gelungenen Salzbur-ger Don Carlo versteht der Dirigent Antonio Pappano die Quattro pezzi sacri als Stück der Gegensätze: Grandios verschattet, aber immer filigran, als packe er die Piani mit der Pinzette an, um sie unters Mikroskop zu legen, gelin-gen ihm die A-Capella-Teile Ave Maria und die Laudi; kompakt beredt hingegen, ohne je theatralisch zu werden, erscheinen Stabat Ma-ter und Te Deum. Natürlich kann man sich für die Stücke keinen besseren Chor wünschen als den der Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Jeder Manierismus ist den Sängern fremd. Doch Pappano gibt sich nicht nur den kon-templativen Momenten hin, er arbeitet vor al-lem wie selbstverständlich das Ende eines his-torischen Bogens bei Verdi heraus, indem er stets mitschwingen lässt, woher dieser kommt. Schließlich hat der »papa dei cori«, der Papst der Chöre, in der Masse – je länger, je besser – immer Inseln der Individualität zu bilden verstanden. Hier kann man hören, mit wie viel Seele(n) sie belebt sind.
Nicht zufällig gibt Pappano sowohl das Ave Maria von 1880 dazu, das man als Vor-studie für Desdemonas Gebet im Otello anse-hen kann, sondern auch das Libera me aus der Messa per Rossini, die Verdi als posthume Ge-meinschaftsarbeit initiiert hatte, ohne ihre Uraufführung zu erleben (die gelang erst Helmuth Rilling und der Stuttgarter Bach-akademie 1988). Im Verein mit Pappano ge-lingt dem warmen, lyrischen Sopran von Maria Agresta ein seltenes Kunststück: Ohne jede Peinlichkeit, fast ungehemmt wendet sie die Spiritualität der Musik von innen nach außen. Bitte: So geht Verdi! MIRKO WEBER
»Sacred Verdi«: Antonio Pappano dirigiert Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Warner)
Was muss das für eine tolle Band sein, die das dänische DJ-Duo Den Sorte Skole mit sei-nem neuen Album Lektion III herbeisinniert: Meister der indischen Klassik spielen selbst-verständlich mit deutschen Elektronikpionie-ren, amerikanischen Folksängerinnen, türkischen Jazzmusikern und französischen Art-Rockern. Jegliche Kombination ist denkbar. Musiker unterschiedlichster Hintergründe verständi-gen sich; sie leben sogar in unterschiedlichen Jahrzehnten. Wie das geht? Indem man ein Archiv in seine Einzelteile zerlegt und die neu zusammenbaut.
Den Sorte Skole haben aus Hunderten Platten zehntausend Instrumentalpassagen und Stimmen herausgeschnitten. Haben die nach Tempo, Rhythmus und Tonart katalo-gisiert und dann zusammengefügt zu virtuel-len Jam Sessions. Martin Højland und Simon Dokkedal treiben die Kulturtechnik des Samplings auf die Spitze. Langsam, fast sphä-risch entfaltet sich das Album. Es besteht aus sechs Erzählsträngen, manche Hymne ist da-bei. Immer wieder hält die Musik inne, ver-harrt und sortiert sich von Neuem. So ent-stehen anderthalb Stunden wahrhaft neuer Musik. Genres, Kontinente und Jahreszahlen verschmelzen. Das klingt mal wie Jazz und oft wie ganz etwas anderes. Als ginge das Ohr zur Welt auf.
Den Sorte Skole spielen zu Hause in aus-verkauften Hallen oder vor 30 000 Festival-besuchern in Roskilde. Ihr Name bedeutet übersetzt so viel wie »Die Schwarze Schule«. Und verweist natürlich auf Vinyl. Und auf die Illegalität, denn zehntausend Samples von sechs Kontinenten zu lizenzieren ist qua-si unmöglich. So bewegt sich Die Schwarze Schule in einer Grauzone, auch beim Ver-trieb. Man kann dieses Album umsonst oder gegen eine Spende aus dem Netz herunter-laden. Eine Dreifach-LP oder Doppel-CD in kleiner Auflage wird spontan auf der Straße verkauft. Fans werden über Soziale Netz-werke informiert.
Warum kann so ein Projekt nicht rech-tens sein? Ist Sampling nicht auch eine Form der Überlieferung? Baut Musik nicht immer auf anderer Musik auf? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Beiheft respektive E-Booklet. Hier werden auch alle vertrete-nen Künstler aufgelistet, kurze Biografien erzählen ihre Geschichte, interpretieren ihre Arbeit. Sekundärliteratur für den schwarzen Bildungskanal. SEBASTIAN REIER
Den Sorte Skole: »Lektion III«, als Download, 3 LPs oder 2 CDs via www.densorteskole.net
Die Musikwissenschaft ist nebenbei eine herr-lich detektivische Disziplin. Aus Tinte oder einem Wasserzeichen kann sie Kompositions-daten ermitteln, ein schütteres Gedicht kann sie wie aus dem Nichts einer Arie zuschreiben, der die Zeilen verloren gingen. Doch einige biografische Aufgaben harren noch der Erle-digung: Warum ist es nie zu dem geplanten Treffen zwischen Bach und Händel gekom-men? Haben Mozart und Beethoven einander in Wien wirklich verpasst? Und haben Agosti-no Steffani und Jean-Baptiste Lully einander tatsächlich nie in die Augen gesehen?
Steffani (1654 bis 1728) war ein weltläufi-ger Italiener, Priester, Politiker und Komponist in einer Person, gebildet und raffiniert, erleb-nishungrig und doch der Tradition verpflich-tet. Mit zwanzig Jahren wurde er Musikus am Münchner Hof, ein rechter Tausendsassa an Cembalo und Orgel, und als er später die Welt der Oper erobern wollte, beschloss er, sie erst einmal gründlich kennenzulernen. Dazu musste er nach Paris, zum großen Jean Baptiste Lully, dem Sonnenkönig der französischen Oper, der am Hofe Ludwigs XIV. wirkte.
1678 ging Steffani nach Paris, vergrub sich in Bibliotheken und besuchte zahllose Auf-führungen. Dem berühmtesten König Euro-pas hat er persönlich vorgespielt, doch ob er auch seinem Idol Lully begegnet ist, wissen wir nicht. Vielleicht hat er einige Privatstun-den bei ihm genommen, sich ein paar Kniffe zeigen lassen. Es bleibt Spekulation. Dabei hätten die beiden viel zu bereden gehabt, so-gar ohne Sprachbarrieren, denn Lully, vormals Giovanni Battista Lulli, war ja selbst gebürti-ger Italiener. Beerbt hat Steffani seinen Lully überreich, denn Französisch war damals musi-kalische Weltsprache. In jedem zweiten Steffa-ni-Takt merkt man, wie viele französische Spurenelemente in seinem Labor zirkulierten.
Jetzt präsentiert das italienische Spezial-ensemble I Barocchisti unter Diego Fasolis ein schmuckes Gebinde aus Steffanis Opern-ouvertüren. Das ist wunderbar rassige, im Tanzbein juckende, kreuzvitale und im besten Sinne schmissige Musik, die auch ohne das musiktheatralische Bezugswerk für sich stehen kann. Köstlich, wie Steffani Streicher und Holzbläser führt, wie er Ensembles gruppiert und diebisch wieder auflöst, wie er Rhythmen federn und pfeffern lässt – und doch nie auf italienische Gesanglichkeit verzichtet. Diese CD bietet eine wunderbare Bereicherung un-seres angeblich so abgezirkelten barocken Kut-schenparks. WOLFRAM GOERTZ
Agostino Steffani: Danze e Ouvertures (Decca)
Was ist das schönste Wort im Land? Gäbe es einen Wettbewerb für Literaten, die sich mit klangvollen Erweiterungen der deutschen Sprache befassen, Markus Berges hätte Chan-cen, einen der vorderen Plätze zu belegen. Berges, Jahrgang 1966, wird sich kaum als Romancier oder Dichter bezeichnen, wenn-gleich ihm 2010 mit Ein langer Brief an September Nowak ein raffiniertes Stück Co-ming-of-Age-Poesie glückte. Der Sänger und Liedautor spielt seine Wortlust hauptberuf-lich in den fluffigen Popsongs seiner Band Erdmöbel aus, auf inzwischen neun Alben. Berges hat sich diesmal wahrscheinlich selber am allermeisten gewundert, welch kregle Kreationen ihm wieder gelungen sind und welch fantastische Worte er aufgetrieben hat. Ins Heimwehheim, zu Hauhechelbläulingen und Ypsiloneulen führt der aktuelle Erdmö-bel-Song Cardiff; im Club der senkrecht Be-grabenen dürfen die Sterne hinken, an einer anderen Stelle sind es Sterninnen, die dabei zugeguckt haben müssen, als der Songwriter einmal die Kreide vom Sportplatz klaute.
Kein Reim, der zu schwierig ist, dass Berges ihn nicht mit Emphase um die Ecke biegt und mit einem Leben füllt, auf das sich einen Reim zu machen dem Publikum überlassen bleibt. Berges schreibt auch deshalb so wunderbare Popsongs, weil er die Worte nie nach Sinn ab-klopft, vielmehr lässt er sich von ihnen in im-mer neue Zusammenhänge und Abgründe tragen. »Arbeiten am Geheimnis« nennt Ber-ges das. Ist das Wort dann gesungen, reiht es sich ein in die vielen instrumentalen Ausrufe-zeichen, die die Band setzt – in Liedern, die an Vorabendfernsehmelodien der 1970er, Tanz-musik aus der »Offenen Jazzhausschule« oder den Teatime-Soul der Doobie Brothers erin-nern dürfen. Im Assoziationstheater von Erd-möbel verwischen sich Wort und Musik, wenn der Sänger aus dem Nachtzug der Bedingungdie Liebe posaunt und die Flötentöne für Vivi-an Maier dem Duktus eines Märchenerzählers folgen. Eine Kunst, die sich zeitgemäß nennen darf, weil sie sich so selbstverständlich in ande-ren Zeiten verlustiert.
Die elf Songs auf Kung Fu Fighting gehen darüber hinaus als Anleitung zum Selberma-chen durch, zum Neusortieren von Silben und Sachen, die ganz seltsame Sachen machen, wenn man sie erst mal von der klassischen Er-zählleine lässt. »Es regnet Lieder Junge, komm wieder, Freundin des Violetts, was von zu we-nig genug, das jetzt.« FRANK SAWATZKI
Erdmöbel: »Kung Fu Fighting« (Jippie!/Rough Trade)
Die Frage muss man stellen: Ist das über-haupt noch Rap? Das, was Casper da ver-anstaltet auf seinem neuen Album Hinter-land? Diese akustischen Gitarren? Diese Harmonien aus nordamerikanischen Gara-gen? Diese Raspelstimme, die jedes einzelne Wort durch die Kauleiste quält, als könnte es das letzte sein? Diese Texte, die aus der Pro-vinz berichten, von der Suche nach Heimat, von verlorenem Leben und fröhlichem Tod?
Vielleicht war sie ja nur ein Missverständ-nis, die Geschichte von Benjamin Griffey. 30 Jahre alt mittlerweile, geboren in Extertal, eine Kindheit in Augusta, Georgia, eine Jugend in Bösingfeld bei Lemgo, vor gut zwei Jahren ausgerufen zum Retter des deutschen Rap. Dem er mit XOXO tatsächlich aufhalf, indem er die Brücke schlug zu Indie-Rock und Punk, sogar zu Metal, neue Perspektiven eröffnete und aus dem selbst gebauten Ghetto erlöste. XOXO kletterte auf Platz eins und setzte sich 48 Wochen lang in den deutschen Charts fest.
Hinterland aber geht zu weit. Mit seinem dritten Album begibt Casper sich in Gegen-den, wo »jeder Tag aus Warten besteht und die Zeit scheinbar nie vergeht«, in ein Land »zwischen Bahnschienen und Schrebergär-ten«, in dem »verlorene Jungs« einen Existen-zialismus an der Schwelle zur Todessehnsucht leben. Auch musikalisch verschleppt Casper den Hip-Hop, dessen Vergangenheit und Gegenwart doch eigentlich urban ist, in die Provinz, allerdings in die amerikanische: Das Stakkato-Klavier, mit dem Im Ascheregen, der erste Song des Albums, beginnt, erinnert in all seiner juvenilen Dringlichkeit nicht zufäl-lig an die Passage, mit der Thunder Road von Bruce Springsteen Fahrt aufnimmt.
Es ist nur der Beginn einer Reise, die, an-geleitet von den zwei denkbar Rap-fernsten Produzenten Konstantin Gropper (Get Well Soon) und Markus Ganter (Sizarr und Muso), an einem angetrunkenen Saloon-Piano und zart glimmenden Lagerfeuerklampfen vorbei-führt. Mit im Bus sitzen Bob Dylan und Ly-nyrd Skynyrd, die in seiner Jugend gehört zu haben Casper in Jambalaya gesteht. Nein, das ist kein Rap mehr. Nicht nur, weil Caspers Methode, jedes Wort mit allergrößtem Nach-druck der Welt zu überantworten, sich der im Hip-Hop üblichen Vokalakrobatik entgegen-stellt, und auch nicht nur, weil deutscher Hip-Hop noch nie so konsequent in rurale Ame-ricana abgetaucht ist. Sondern deswegen, weil Rap heute am besten ist, wenn er kein Rap mehr ist. THOMAS WINKLER
Casper: »Hinterland« (Four Music/Sony)
Das Ohr zur Welt
So gehtVerdi!
Pfeffern und federn
Senkrechtbegraben
Rap oder Nicht-Rap
Casper in Gegenden, »in denen jeder Tag aus Warten besteht und die Zeit scheinbar nie vergeht«. Reimt sich.
Priester, Politiker, Komponist, Tausendsassa: Agostino Steffani spielte Orgel und Cembalo und liebte die Oper
Nur Oper? Von wegen! Antonio Pappano entdeckt Giuseppe Verdi auch als Komponisten geistlicher Musik
Erdmöbel stehen für schicke Outf its – und für Wortschöpfungen wie »Hauhechelbläulinge«
Virtuosen des Samplings: Die beiden Musiker von Den Sorte Skole arbeiten rechtlich in einer Grauzone
Foto
: K
rist
off
er
Jue
l Po
uls
en
Foto
: ak
g-im
age
s
Foto
: O
laf
He
ine
Foto
: Se
bas
tian
We
ise
Foto
: L
auri
eL
ew
is/
Le
bre
cht
Mu
sic
& A
rts

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
77
FernbeziehungAuf den Azoren hilft ein neues Netz von Unterkünften beim Inselhopping mit Familienanschluss S. 79REISEN
Der Arbeitsplatz von Ronny Haug ist ein niedriges Kabuff. Durch ein Fenster hat er seine 40 Köche stets im Blick. »Kjøk-kensjef« (Küchenchef) steht in großen Buchstaben unter einer geöffneten Luke. Am Freitag in einer Woche, kurz vor elf Uhr, wird Haug seinen Kommandopos-
ten ausnahmsweise verlassen, mitten in den Vorbereitungen für das Mittagessen. Er wird sich aus der Großküche im Keller nach oben in einen Konferenzraum begeben und mit den an-deren Abteilungsleitern des Grand Hotel vor den Fernseher setzen. Punkt elf Uhr verkündet dann der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, wer in diesem Jahr den Friedens-nobelpreis erhalten soll. Dem Küchenchef bleiben noch zwei Monate Zeit, sein wichtigstes Essen des Jahres vorzubereiten.
Am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, werden die nach ihm benannten Preise verliehen – der Friedenspreis hier in Oslo, die übrigen von Physik bis Literatur in Stockholm. Nach der offiziellen Feier im Rathaus wird der Preisträger mit einem Dinner im ehrwürdigen Osloer Grand Hotel geehrt.
Gepökeltes Lamm mit Flatbrod und geräucherter Tomatenmarmelade(Erster Gang, Europäische Union 2012)
Ronny Haug ist 35 Jahre alt. Unter der hohen Kochmütze aus weißem Papier sieht man ein schmales Jungengesicht, das auch zu einem norwegischen Langläufer passen würde. Seit fünf
Jahren kreiert er als stellvertretender Küchenchef des Grand Hotel die Menüs für den Weltfrieden. Und das unter strenger Geheimhaltung: So wie noch nie vor der Bekanntgabe im Ok-tober durchgesickert ist, wer den bedeutendsten Preis der poli-tischen Welt bekommen soll, erfährt auch niemand vor dem Abend des 10. Dezember, welche fünf Gänge im Spiegelsaal des Grand Hotel serviert werden.
Sehr gern erzählt Haug aber von den Banketten der Vergan-genheit. Die Menüs der letzten zehn Jahre können Besucher sogar selbst probieren, man kann sie im Restaurant des Grand Hotel buchen. Vor allem Firmen machen von diesem Angebot Gebrauch, wenn sie verdiente Mitarbeiter belohnen oder sich bei guten Kunden bedanken möchten. Amerikanische Touristen bestellen gern das Obama-Menü aus dem Jahr 2009.
Der Küchenchef holt sein Smartphone aus der Tasche, klickt sich erst durch viele Fotos seines zweijährigen Sohns und zeigt dann eine Aufnahme von der Vorspeise des letzten Jahres. Da wurde die Europäische Union geehrt, und als ers-ten Gang bekamen die 250 geladenen Gäste gepökelte Lammhaxe, so dünn geschnitten wie Carpaccio. »Das Lamm stammt aus Bergen, ich kenne den Erzeuger«, sagt Haug und fügt stolz hinzu: »Wir Norweger haben die besten Lebens-mittel der Welt. Unser Fisch, unser Fleisch – du findest nir-gendwo was Besseres.«
Lange Zeit war Norwegen nicht durch besonderen kulina-rischen Ehrgeiz aufgefallen. Das Land ist protestantisch ge-prägt, seine Bewohner machten nie viel Gedöns ums Essen. Das änderte sich erst mit dem plötzlichen Reichtum durch das Öl in der Nordsee. Seit den neunziger Jahren holen nor-
wegische Köche nach, was ihre Vorgänger an Selbstbewusst-sein und Raffinesse vermissen ließen.
Norwegische Produkte bilden die Basis jedes Friedensmenüs. Aber zu dem Lammcarpaccio mit knäckebrotdünnem Flatbrød (Flachbrot) gab es einen deutschen Weißwein – Steinberger Riesling Kabinett aus dem Kloster Eberbach. Die Kellner ser-vierten wie jedes Jahr mit weißen Glacéhandschuhen.
Langustinen auf Stockfisch-Brandade(Zweiter Gang, Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee,
Tawakkul Karman 2011)
Das norwegische Nobelkomitee stellt für das Dinner ein Bud-get von umgerechnet 75 000 Euro zur Verfügung. Das Menü, zumindest einzelne Gänge, sollen dem Preisträger und den kulinarischen Traditionen seines Landes Reverenz erweisen. Vor zwei Jahren stand Ronny Haug deshalb vor einer kniffligen Aufgabe: Der Friedensnobelpreis ging an drei Frauen – zwei aus Afrika, eine aus dem Nahen Osten. Die Politikerinnen El-len Johnson Sirleaf und Leymah Gbowee stammen aus Libe-ria, die Menschenrechtlerin Tawakkul Karman kommt aus dem Jemen. »Da musste ich erst mal googeln, was man dort so isst«, sagt der Küchenchef. Zu seiner großen Erleichterung fand er heraus, dass Stockfisch in den Heimatländern der Frauen zu den wichtigen Nahrungsmitteln gehört. »Und das ist für uns Norweger ja eine leichte Übung.« Den gesalzenen Fisch verarbeitete er zu einer Brandade, einer Art Püree, das er mit gebratenen Langustinen veredelte.
Küchenchef Ronny Haug mit dem EU-Dessert von 2012 Gespeist wird im Spiegelsaal des Grand Hotel Die Obamas winkten hinter Panzerglas vom Balkon
Fortsetzung auf S. 78
Foto
s: F
red
rik N
aum
ann
/Fe
lix F
eat
ure
s (l
.);
Gra
nd
Ho
tel
(2)
Am 11. Oktober wird bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis 2013 erhält – und im Osloer Grand Hotel beginnt
die Planung für das große Festmenü im Dezember. JOHANNES SCHWEIKLE hat in der Küche nachgefragt, worauf es dabei ankommt
Fünf Gänge fürden Frieden

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Wie jedes Jahr kam das Nobelkomitee im November zum Probeessen. Geir Lundestad, der Sekretär des Komitees, hat es nur ein paar Hundert Meter vom Nobelinstitut zum Grand Hotel. Auf diesem kurzen Weg durch die Innenstadt von Oslo liegen alle wichtigen Institutionen Norwegens: links das könig-liche Schloss mit dem einladenden Park, durch den Mütter ihre Kinderwagen schieben. Gleich nach der Wohnung Henrik Ib-sens, in der heute ein Museum für den Dramatiker eingerichtet ist, kommt das Nationaltheater. Am Ende des Platzes liegt das Parlament, links das Grand Hotel: wie die meisten Bauwerke an der Karl-Johan-Straße ein Gebäude aus der Gründerzeit, von einem Turm gekrönt, mit hohen Sprossenfenstern und ge-schmiedeten Geländern an der breiten Fassade.
In der Suite Nummer 201, im ersten Stock über dem Haupt-eingang, gibt der Friedenspreisträger seine Interviews. Die pas-tellfarbene Tapete ist mit Bourbonenlilien bedruckt, im schma-len Flur, der zum Wohnraum führt, hängen Porträts der Aus-gezeichneten. Eine Glastür führt von der Suite auf einen klei-nen geschwungenen Balkon. Von dort grüßt der Preisträger vor dem Bankett das Volk.
Geir Lundestad ist Historiker. Seine Leidenschaft gilt mehr dem politischen Diskurs als der Kulinarik, darum bringt er zum Probeessen im November lieber seine Frau mit. Sie habe den Stockfisch prima gefunden, sagt der Küchenchef. Er servierte die Brandade mit Sprossengemüse und einem Hauch Chiliöl. Dazu gab es einen üppigen und teuren Chardonnay aus dem Burgund, Les Setilles von dem Winzer Olivier Leflaive.
Aquavit-Sorbet(Dritter Gang, Barack Obama 2009)
Ole Heide, der Sicherheitschef im Grand Hotel, erinnert sich noch sehr genau an den Freitag im Oktober 2009, als er mit den anderen Abteilungsleitern vor dem Fernseher saß. »Mein Herz setzte für ein paar Schläge aus, als ich hörte, dass Barack Obama den Preis bekommt.«
Normalerweise kümmert sich die norwegische Polizei um die Sicherheit der Gäste beim Friedensbankett. Sie schickt einen Hund in den Spiegelsaal, der nach Sprengstoff schnüffelt. An-sonsten hat sie großes Vertrauen in die Friedfertigkeit der Welt. Wer am Abend des 10. Dezember seine Einladung präsentiert, darf ohne weitere Kontrollen ins Hotel.
In diesem Fall übernahm der amerikanische Secret Service das Kommando. In der Innenstadt von Oslo schweißte man die Gullydeckel zu. Das Personal wurde durchleuchtet: Jeder Koch und jeder Kellner musste für die vergangenen fünf Jahre einen festen Wohnsitz in Norwegen nachweisen. Das Grand Hotel hatte nicht genügend Angestellte, die diese Bedingung erfüllten. Der Direktor war gezwungen, geeignete Leiharbeiter in anderen Häusern zu rekrutieren. In der Lobby wurde eine Sicherheits-schleuse wie an einem Flughafen installiert.
»Für mich lief ’s richtig ruhig«, sagt Ronny Haug, der Küchen-chef. Normalerweise fällt das Bankett mitten ins Weihnachtsge-schäft. Aber als Obama erwartet wurde, sperrte der Secret Service
das ganze Hotel. Keine Gäste im Restaurant, keine Weihnachts-feiern, keine Besucher im Café.
Die Sicherheitsleute stellten sich gut mit der Küche. Das Grand Hotel wurde für ein paar Tage ihre Kantine. Als Gegen-leistung spendierten sie den Köchen Süßigkeiten und Cham-pagner, eingeflogen aus den USA, alles versehen mit dem Logo des Weißen Hauses.
2009 servierte Ronny Haug als dritten Gang ein Aquavit-Sorbet – eine Konstante in den wechselnden Menüs, diese Er-frischung gibt es jedes Jahr. Wie immer bereiteten die Köche in einem Nebenraum des Spiegelsaals das Gericht vor: Auf langen Tischen legten sie 250 Teller aus, auf denen das Sorbet portioniert und angerichtet wurde. Aber diesmal durften die Kellner nicht einfach servieren. Der Secret Service wandelte die Tradition des königlichen Vorkosters ab und wählte unter den 250 angerichteten Tellern willkürlich zwei aus: für den Präsidenten und die First Lady.
Nur wenige Male musste der Küchen-chef vom traditionellen Aquavit-Sorbet abweichen: zum Beispiel 2003, als die ira-nische Menschenrechtsaktivistin Schirin Ebadi den Friedensnobelpreis erhielt. Als Muslimin wollte man sie nicht mit Alkohol in Verlegenheit bringen und servierte ein Limonensorbet.
»Eigentlich sind die Preisträger unkom-plizierte Gäste«, sagt Ronny Haug. Vege-tarier oder Veganer seien in seiner Zeit noch nicht dabei gewesen. Es gab zwar jüdische Preisträger, aber diese bestanden nicht auf den orthodoxen Speisegeboten und koscherem Essen. Falls jemand unter den geladenen Gästen unter Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten leidet, ist der Küchenchef vorbereitet und hält alternative Gerichte in Reserve. Aber auch auf diese musste er bisher noch nie zurück-greifen. »Die Leute essen, was auf den Tisch kommt«, sagt Haug trocken.
Rentierfilet mit Sellerieschaum(Vierter Gang, Muhammad Yunus 2006)
Im Festsaal des Grand Hotel schmücken hohe Spiegel und ein großer Gobelin die Wände. Von der Decke hängen schwere Kristalllüster. Die Gäste sitzen an runden Zehnertischen. Das Nobel-Menü wird auf einem speziellen Service aufgetragen. Ein goldenes Medaillon von Alfred Nobel ziert die Platzteller, die Stiele der schnörkellosen Weingläser sind handvergoldet. Als Obama kam, sollte das Protokoll noch eine Nuance festlicher sein. Die Gäste fanden handgeschriebene Namenskärtchen auf ihren Plätzen. Diese kalligrafische Feinarbeit bedeutete aber so viel Auf-wand, dass man zwei Jahre später wieder zu den gedruckten Tisch-kärtchen zurückkehrte.
In Oslo legt man Wert auf den Unterschied zu Stockholm und achtet auf die norwegische Note: Beim Friedenspreis soll es bescheidener, intimer und entspannter als in Schweden zu-gehen. In Stockholm tragen die Herren Frack, in Oslo reicht der Smoking. In Schweden filmen Kameras das Bankett. Aber die Norweger sagen: Wie, bitte schön, soll man gelöst zu Abend essen, wenn das Fernsehen dabei ist? In Stockholm gehört der König selbstverständlich zu den Gästen. Doch die Norweger sind stolz auf ihre demokratische Gesellschaft, die wenig auf Hierarchien gibt. Am 10. Dezember musste der König, der gleich neben dem Grand Hotel wohnt, deshalb lange Zeit
woanders essen.Erst 2006 geriet das norwegische No-
belkomitee in eine protokollarische Ver-legenheit: Der Preisträger und Wirt-schaftswissenschaftler Muhammad Yu-nus aus Bangladesch wollte die spanische Königin Sophia einladen. Das hätte ziemlich blöd ausgesehen, wenn sie ne-ben dem evangelischen Bischof von Oslo oder sonst einem Bürgerlichen ihr Ren-tierfilet mit Sellerieschaum hätte essen müssen. So erhält das norwegische Kö-nigspaar seitdem eine Einladung. Der Kronprinz und seine Gattin mussten noch drei Jahre länger warten – seit Oba-ma sind auch sie dabei.
Schokoladenkuchenmit Erdnusscreme(Fünfter Gang, Jimmy Carter 2002)
Das Nobelkomitee erhält regelmäßig Briefe von Menschen, die gern am Ban-kett teilnehmen würden. »Aber auf Selbsteinladungen reagieren wir nicht positiv«, sagt Dag Ulrik Kühle, der Ver-waltungschef. Das macht dieses Essen so exklusiv: Niemand kann sich den Zutritt erkaufen.
Hinter den Kulissen gibt es fast jedes Jahr einen Kampf um die 250 Plätze im Spiegelsaal. Der Preisträger darf 30 Gäs-te mitbringen. Manche finden das zu wenig. »Es gab schon Kritik«, gibt der Verwaltungschef offen zu. »Manche sa-gen: Da geht es mehr um Norwegen als um den Ausgezeichneten.«
Was das Menü betrifft, will Küchen-chef Ronny Haug diesen Vorwurf nicht gelten lassen: Die Kö-che gäben sich doch solche Mühe, auf den Preisträger einzuge-hen. 2002 etwa erhielt Jimmy Carter den Friedensnobelpreis. Der hatte eine Erdnussplantage bewirtschaftet, bevor er Präsi-dent der Vereinigten Staaten wurde. Deshalb gab es zum Nach-tisch lauwarmen Schokoladenkuchen mit Erdnusscreme.
www.zeit.de/audio
78 REISEN
Das Grand Hotel liegt im Herzen von Oslo Auch Touristen können vom Nobel-Service speisen Ronny Haug ist seit fünf Jahren Küchenchef
Fünf Gänge für den Frieden
Fortsetzung von S. 77
Siehe auch Politik, Seite 10
Das Grand Hotel, erbaut 1874, liegt im Herzen von Oslo. Viele Sehenswürdigkeiten der Stadt sind bequem zu Fuß zu erreichen. Das Grand Café, in dem das Frühstück serviert wird, war das Stammlokal von Henrik Ibsen. Es heißt, er habe sich jeden Mittag Schlag zwölf an den für ihn reservierten Tisch begeben. Besucher können die Friedenspreis-Menüs der vergangenen zehn Jahre buchen. Für Gesellschaften ab 15 Personen wird das Essen auf dem speziellen Nobel-Service aufgetragen. Fünf Gänge mit begleitenden Weinen kosten ca. 251 Euro
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Tel. 0047-23/21 20 00, www.grand.no. DZ/Frühstück ab ca. 214 Euro
Grand Hotel
Foto
s (v
.l.n
.r.)
: H
alvo
r Pe
de
rse
n/
ST
EL
LA
PIC
TU
RE
S/
face
to
fac
e;
Gra
nd
Ho
tel; F
red
rik N
aum
ann
/P
ano
s fü
r D
IE Z
EIT
; A
bb
.: w
ww
.no
be
lpri
ze.o
rg
ZEIT-GRAFIK
400 m
Oslo
Oslo
Nor
weg
en
Schw
eden
Finn
land
GRAND HOTELKöniglichesSchloss
Rathaus
Oslofjord
Prinsens gateRådhusgata
Haupt-bahnhof
M u nkedam
sv
eien
Karl Johans gate 31

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 REISEN 79
Am grünen Rand der WeltKaum ein Stück Europa ist so einsam gelegen wie die Azoren – vielleicht wird deshalb die Gastfreundschaft
besonders großgeschrieben. Jetzt vermittelt ein neues Netzwerk Privatunterkünfte mit Familienanschluss VON SUSANN SITZLER
Wenn eine Landschaft zärt-lich sein kann, dann diese hier. Weit ausgebreitet lie-gen Wiesen unter einem blassen, hohen Himmel. Dahinter glänzt die weiße Gischt des Atlantiks. Die
Luft ist weich und etwas diesig, sie macht die Kon-traste mild. Ich stehe auf der Azoreninsel Faial in ei-nem Garten voller Farn und Rosenbüsche. Dahinter lugen zwei sauber gestrichene Holzhäuser hervor. Sie gehören Francisco Ribeiro, einem Insulaner von Mit-te 40 mit schwermütigen Augen und einem fröhli-chen Lächeln. Bis er 17 Jahre alt war, hatte er die Azoren nie verlassen. Einmal war er mit seinen Freunden auf der Nachbarinsel Pico gewesen und hatte dort den gleichnamigen Berg bestiegen. »Vom Gipfel aus sah ich Faial zum ersten Mal als Ganzes. 172 Quadratkilometer. Das ist also der Ort, wo du herkommst, dachte ich. Ein unbedeutendes Spiegelei im Atlantik. Das hat mich traurig gemacht.« Francis-co zog nach Lissabon, um Landwirtschaft zu studie-ren. Vor zwölf Jahren kam er zurück, übernahm das Haus seines Großvaters, kaufte zwei Nachbargrund-stücke dazu und eröffnete zusammen mit seiner Frau Susana ein Gästehaus. Aus Erinnerung an die einst bäuerliche Nutzung des Grundes, von der noch im-mer ein halbmondförmiger Steinsockel im Garten zeugt, nannten sie es Quinta da Meia Eira – Land-haus zum halben Dreschkreis. Inzwischen sind drei Söhne herangewachsen. Die finden den neuen rosa-farbenen Anstrich des Familienhauses peinlich. »Sie meckern, rosa sei eine Mädchenfarbe«, sagte Francis-co. »Aber ich wusste, dass sie das Grün des Gartens zum Leuchten bringt.«
Die Azoren gehören zu Portugal und liegen auf halbem Weg zwischen Europa und den USA. Vulkan-ausbrüche am Meeresboden haben insgesamt neun steinerne Flecken in den Atlantik gesetzt, die erst seit ein paar Hundert Jahren bewohnt sind. Auf der größ-ten Insel São Miguel leben heute etwa 100 000 Ein-wohner, auf den übrigen Inseln noch weitere 150 000. Weil das feuchte Klima und die vulkanischen Hänge für üppige Vegetation sorgen, kommen die meisten Besucher zum Wandern. Ich habe meine Trekking-schuhe allerdings zu Hause gelassen. Seit Kurzem er-möglicht es ein Netz von Privatunterkünften, bei Einheimischen zu übernachten. Ich habe vor, mir einige der Casas Açorianas, der azorischen Häuser, anzusehen und dabei ihre Besitzer kennenzulernen. »Viele wissen nichts von uns«, sagt Francisco. »Sogar manche Festlandportugiesen denken, dass auf den Azoren Wilde leben.« Er kichert über diesen Unsinn. Als echter Insulaner ist ihm Besuch immer willkom-men. »Er bringt uns die Welt ins Haus.«
Als Francisco und seine Familie längst schlafen, streife ich noch einmal durch den Garten und lege mich in den Swimmingpool. Er befindet sich in einer Art Treibhaus, wo die Sonne tagsüber das Wasser auf-wärmt. Draußen bimmeln die Glocken von Francis-cos zwölf Kühen, die Katze maunzt, und der Golden Retriever Kunigunde hält Wache. Mir fällt kein Ort ein, der vom Rauschen der Welt weniger behelligt wäre. Später, im restaurierten Bett von Oma, summt mich der Inselwind in einen tiefen Schlaf.
Gestochen scharf heben sich auf Pico am nächsten Tag die kalkweißen Mauern vom schwarzen Tuffstein und dem vollen Grün der Weiden ab. Mit der Fähre habe ich übergesetzt. Pico ist die zweitgrößte Azoren-
insel, keine zehn Kilometer von Faial entfernt. Im Dorf Praínha wohne ich in einem unverputzten Häus-chen, das ganz aus klobigen Steinen gebaut ist. Es liegt an einem Hang aus anthrazitfarbener Vulkanerde. »Hier wurde früher Wein gelagert«, heißt es in der Broschüre auf dem Küchentisch. Zur Begrüßung hat mir die Besitzerin, wie jedem Gast, einen Fresskorb mit Milch, Käse, Brot und Eiern in die enge Küche stellen lassen. Morgen früh treffe ich sie persönlich. Heute sehe ich mich alleine um. Im oberen Stock stehen zwei altmodische Bettgestelle aus Schmiede-eisen. Von zwei Schaukelstühlen aus kann man durchs Fenster schauen. Die Schlafkammer mit ihren rohen Felsblockwänden wirkt archaisch, aber behaglich. In solchen niedrigen, feuchten Behausungen haben früher vielköpfige Familien zum Teil mit Tieren ge-lebt, das habe ich gelesen. Und es ist immer noch ziemlich klamm in diesen Mauern. Nach einer Weile brauche ich Sonne und Luft, darum mache ich mich auf zum Berg Pico im Landesinneren.
Die menschenleere Heidelandschaft liegt in glit-zerndem Licht. Die Erikabüsche am Straßenrand sehen aus wie gigantische Brokkolistauden. Mit 2351 Metern ist die Spitze des Pico der höchste Punkt Portugals. Leider wird er heute von Nebel umhüllt, der in kühlen Schlieren den Berg hinabzieht. Die Luft riecht nach Thymian. Der Blick über die terrassierten Wiesen hinunter zum Meer ist ergreifend. Außer Faial ist nur Wasser zu sehen.
Am nächsten Morgen scheint die Sonne durchs Fenster. Ich bin auf der anderen Seite der Insel im Hafenstädtchen Lajes mit der Hausbesitzerin Maria Serpa verabredet. Im Restaurant O Lavrador,
das berühmt ist für seinen spektakulären Blick übers offene Meer, hält sie Hof. Ihr gehören zwölf solcher Steinhäuser in Praínha, und es sollen noch mehr werden. Maria sitzt in einer türkis leuchtenden Bluse am Tisch, und fast jeder, der hereinkommt, wechselt mit ihr ein paar Worte. »Sweetie, schön, dass du mein Gast bist«, ruft sie mir zur Begrüßung zu und küsst mich, als sei ich ihre lange vermisste Lieblingsnichte. Einst war Maria Lehrerin im Dorf. Dann wanderte sie in den siebziger Jahren mit ihrem Mann nach Kalifornien aus. Für den Lebensabend kehrte das Paar zurück, und Maria begann, verlassene Emigran-tenhäuser aufzukaufen. »Mir ist langweilig, wenn ich nichts zu tun habe«, sagt sie. »Außerdem wollte ich die Erinnerung an die Armut wachhalten, in der wir hier früher lebten. Aber auch an die große Gast-freundschaft, die immer selbstverständlich war.«
In fast jedem Dorf der Azoren gibt es eine Rua dos Emigrantes, eine Straße der Auswanderer. Vulkanaus-brüche und Erdbeben machten auf den Inseln immer wieder Tausende obdachlos. Anderen verhieß der Wal-fang in Amerika eine bessere Zukunft. Im 15. Jahr-hundert hatte die fruchtbare Inselgruppe den Ent-deckerschiffen einen letzten Versorgungsstopp ge-boten. Das verhalf für eine Weile zum Wohlstand. Im 19. Jahrhundert brachte der Orangenanbau Reich-tum. Aber dann vernichtete die weiche Napfschildlaus alle Plantagen. In den Jahren der portugiesischen Diktatur, die bis 1974 andauerte, wurden die Azoren fast völlig von einer wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt. Den Militärstrategen geriet die Insel-gruppe wegen ihrer Lage zwischen Europa und Ame-rika allerdings nie vom Radar. Auf der Insel Terceira hat die U. S. Army eine Basis. Heute leben die Azorer
von Milchwirtschaft, europäischen Subventionen und Tourismus. Und von den Zuwendungen der Ver-wandten im Ausland. Den Häusern am Straßenrand sieht man an, ob ein Besitzer aus Amerika zurückge-kehrt ist. Dann strahlen sie bunt und haben einen riesigen Carport. Bei den Daheimgebliebenen steht das Auto im Freien, und die Häuser haben manchmal nur zwei Fenster und eine Tür.
Auf der Hauptinsel São Miguel werden bald die Hortensien blühen. Aber noch regiert das schaumige Grün der Büsche. Es lässt die Hügel am nächsten Tag wie die Landschaft einer Modelleisenbahn wirken. Ich bin unterwegs zu einer ehemaligen Mühle am westli-chen Zipfel der Insel, O Moinho da Bibi, Bibis Müh-le. Vater, Mutter und Tochter der Familie Carreiro stehen bei meiner Ankunft aufgereiht im Garten. Sie strahlen mich an, als sei ich auch ihre verlorene Nich-te oder Cousine. Früher waren die Carreiros eine Sata-Familie – jedes Mitglied arbeitete zeitweise für die azorische Fluggesellschaft. Jetzt gehört das Herzblut der alten Mühle. Die 28-jährige Tochter Patricia küm-mert sich ums Alltagsgeschäft, der Vater um die Wer-bung und die Mutter um die Dekoration. »Wir haben alles von Grund auf erneuert«, schwärmt Patricia. »Jede Schraube des Dachs ist maßgefertigt«, bestätigt der Vater und reaktiviert dafür sein Englisch. Die Mutter, mit dem Kosenamen Bibi, macht sich am Kräuterbeet zu schaffen und überreicht mir einen dicken Büschel Rucola. »Hier, zum Abendbrot.« Patricia hantiert mit einem komplizierten Schlüssel. »Willst du sehen, wo du schläfst?« Dann stehen wir alle im Eingang der Mühle, und die Familie weidet sich an meinem über-raschten Blick. Vor mir führt eine elegante Treppe in die Tiefe. Nur Schlafstube und Eingang befinden sich im engen Rumpf der Mühle. Bad, Küche und Wohn-zimmer liegen unter der Erde des Gartens. Eine ge-schickt angelegte Terrasse versorgt die Unterkellerung mit Tageslicht.
Das Geld für die Restaurierung historischer Ge-mäuer kommt von der EU. Stolze Gastgeberfamilien wie die Carreiros sind Stützen des sanften Tourismus auf den Azoren. Als sie gegangen sind, lege ich mich auf eine sonnenwarme Steinbank im Garten, höre dem Wind und den Vögeln zu und wünsche, ich könnte hier draußen übernachten. Aber dazu ist die Inselnacht zu kühl. Als es dunkel wird, klettere ich ein wenig beklommen in mein Schlafkämmerchen im ersten Stock der Mühle. Gerade ein Doppelbett hat darin Platz. Die dicken Mauern sind bis auf eine kleine Luke fensterlos. »Habˇkeine Angst«, hatte Patricia zum Ab-schied gesagt. »Der Teufel meidet runde Räume.«
Am nächsten Morgen peitscht der Regen die Land-schaft wie mit Seilen. Durch Pfützen pflügt sich das Auto nach Povoação an der Südseite der Insel. Mitten im Dorf, an niedrige Häuser gereiht, liegt die Quinta Atlantis. Sofort öffnet sich die Haustür, und eine jun-ge Frau kommt mit einem Schirm auf mich zu. »Auf keinen Fall sollst du nass werden«, sagt sie und stellt sich mit strahlenden grünen Augen als die Haushäl-terin Leslie vor. »Das würde Miss Adélia nicht gefal-len.« Dicke Mauern aus schaumigem schwarzem Tuffstein versprechen Schutz vor dem Wetter. Einst war hier die Grundschule des Dorfes untergebracht. Adélia Soares, auf einer Nachbarinsel geboren, kaufte die Schule vor ein paar Jahren und ließ sie zum Gäste-haus ausbauen. Nicht alle Azorer, die hier ein Haus besitzen, wollen auch dauerhaft auf der Insel wohnen. Miss Adélia lebt in Luxemburg. Davon profitiert die 24-jährige Leslie. Sie wohnt im Nachbardorf und ist
immer für die Gäste da. Ihren Vornamen hat sie von den Bermudas, wo sie zur Welt kam. Als Leslie neun Jahre alt war, kehrten ihre Eltern in die Heimat zu-rück. In der großen Küche mit dem modernen Herd und dem hundertjährigen Steinboden hat sie den Ofen schon eingeheizt und den Kühlschrank gefüllt. »Ich würde dir zum Abendbrot gerne Gesellschaft leisten«, sagt sie. »Aber wir haben im Moment den Heiligen Geist zu Hause, da kommt ständig Besuch.« Die Festa do Espirito Santo ist ein jahrhundertealter Brauch der Azoren. Über Monate feiert jedes Dorf sein eigenes Fest. Das Los bestimmt, welche Bewohner für jeweils eine Woche die Insignien des Heiligen Geistes, Krone und Zepter, beherbergen dürfen. »Es ist eine große Ehre«, sagt Leslie.
Ich verbringe den Abend vor dem Ofen im Wohnzimmer und bewundere Miss Adélias Sammlung von europäischem Porzellan. Schokolade, Bücher, Filme und Musik in mehreren Sprachen liegen bereit. Hier sollen
die Gäste des Hauses zusammenkommen, das Sofa bietet mindestens ein Dutzend Plätze. Ich bin aller-dings allein, denn individueller Tourismus in Pri-vathäusern ist noch neu auf den Azoren.
Zum Frühstück serviert Leslie Eier von Miss Adé-lias Hühnern. Dann lädt sie mich ein, bei ihrer Fami-lie den Heiligen Geist zu besuchen. In Lomba do Al-caide, einem Dorf im Hinterland, halten wir vor dem letzten Haus des Ortes. Leslie winkt mich ins Wohn-zimmer, wo mich auch ihre Tante nach Art der wie-dergefundenen Cousine begrüßt. Der halbe Fußboden ist mit einem Meer aus weißem Satin belegt. Darauf stehen meterhohe Hände aus Karton. Auf einer kleinen Säule ruhen Krone und Zepter, darüber hängt eine Papiertaube. Im Laufe der Woche werden alle Nach-barn zum Staunen und zum Beten vorbeikommen. »Und zum Essen«, sagt Leslie und lotst mich zum Bü-fett. Sie strahlt, als ich beherzt zugreife. »Es macht uns Azorer sehr stolz, wenn Fremde das schätzen, was wir zu geben haben«, sagt sie.
Am Nachmittag reißt der Himmel wieder auf, und die Dörfer liegen in gleißendem Licht. Ich bin auf dem Weg in die Hauptstadt Ponta Delgada. Hier wohne ich zum ersten Mal mit einer Gastgeberfami-lie unter einem Dach. Die Casa Glória ao Carmo ist ein rosa Herrschaftshaus aus dem 18. Jahrhundert. José und Eduarda Santos, die mich in der Eingangs-halle begrüßen, sind Neuazorer. Vor ein paar Jahren zogen sie aus Porto hierher, weil José als Ingenieur eine Stelle an der hiesigen Uni bekam. Das große Haus schrie nach Gästen, und Eduardas Hobbys sind »Kochen und Einrichten«. Große Gläser mit schi-cken Kerzen erleuchten die über Jahrhunderte aus-getretene Steintreppe, die in die Familienräume im oberen Stock führt. Auf dem Sofa im Wohnzimmer lümmelt der siebenjährige Sohn. Auch er entwickelt schon erste Anzeichen des azorischen Gastgeberta-lents. »Immer, wenn sich Besucher mit Kindern an-melden, will er genau wissen, wie alt diese sind«, sagt Eduarda. »Dann stellt er extra ein paar Spielsachen zusammen und legt sie bei Ankunft bereit.« Ein grau-haariger Herr kommt lächelnd herein. Das muss der Großvater sein. In dieser familiären Wärme schmilzt der letzte Rest meiner nordischen Zurückhaltung, und ich begrüße ihn wie meinen schmerzlich ver-missten Onkel. Er schaut hilfesuchend zu Eduarda. »Das ist auch ein Gast«, flüstert sie und kocht mir erst mal einen Tee.
Sonnenuntergang an der Nordküste der größten Azoreninsel São Miguel
Foto
s: A
nd
reas
Hu
b/
laif
(gr.
); R
uth
Fra
u f
ür
DIE
ZE
IT (
kl.)
AnreiseSata International fliegt immer sonntags und bis Ende Oktober auch mittwochs von Frankfurt nach Ponta Delgada auf der Hauptinsel São Miguel, weitere Flüge bietet TAP Portugal an. Alle Inseln außer Corvo sind von Ponta Delgada aus per Flugzeug zu erreichen. Mit dem Blue Sea Pass kann man drei frei wählbare Azoreninseln für 89 Euro pro Person auch mit der Fähre ansteuern, www.atlanticoline.pt
UnterkunftFaial: Quinta da Meia Eira in Castelo Branco/Horta, www.meiaeira.comPico: Adegas do Pico/Casa da Vinha in Praínha, www.adegasdopico.comSão Miguel: Moinho da Bibi in Candelária/Ponta Delgada, www.moinhodabibi.comQuinta Atlantis in Povoação, www.quintaatlantis.comCasa Glória ao Carmo in Livramento/Ponta Delgada, www.gloriaaocarmo.com
Alle genannten Häuser gehören zum Netzwerk Casas Açorianas, über das man eine große Auswahl von Privatunterkünften auf fast allen Azoreninseln online buchen kann. Die Häuser unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. www.casasacorianas.com
ZEIT-GRAFIK 100 km
Flores
Terceira
São Jorge
Graciosa
Santa Maria
Atlantischer OzeanCorvo
Faial
SÃO MIGUEL
AZOREN(zu Portugal)
Azoren
USA
Atlantik
Portugal
Familie Santos vor ihrem Haus auf der Insel São Miguel

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4180 REISEN
Die Letztenihrer Art
Diese Männer vom äthiopischen Volk der Karo tragen ihre Körperbemalungen und kunst-vollen Frisuren wie seit Urzeiten. Dass sie auch in der Gegenwart angekommen sind, bezeugen die Gewehre in ihren Händen. Der britische Fotograf Jimmy Nelson zeigt Menschen, von denen man fürchten muss, dass sie die Letzten ihrer Art sind. Der Stamm der Karo etwa zählt heute wenig mehr als tausend Angehörige. Ob in der Mongolei, der Südsee oder der afrikani-schen Wildnis – Nelson hat traditionell leben-de Völker in monumentalen Landschaften und auf höchst ästhetisierte Weise fotografiert. Seine Bilder sind eine melancholisch gefärbte Bestandsaufnahme von Kulturen, die vielleicht schon bald verschwunden sein werden. ROD
Jimmy Nelson: Before they pass awayVerlag teNeues, Kempen 2013; 424 S., 128 €
BLICKFANG
Foto
: Jim
my
Ne
lso
n P
ictu
res
BV
/w
ww
.be
fore
the
y.co
m

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Für 8 Euro von München nach Stuttgart, für 22 von Köln nach Berlin: Wer heute quer durch die Republik reisen will, braucht dafür nicht mehr viel Geld auszugeben. Er muss sich nur für ein Fortbewegungsmit-
tel entscheiden, das im hiesigen Straßenver-kehr noch recht neu ist: den Fernlinienbus.
Bis Ende 2012 schützte ein Gesetz die Deutsche Bahn vor dieser Konkurrenz. Seit Januar jedoch dürfen nun auch Fernbusse zwischen den Städten fahren – zumindest, wenn sie wenigstens eine Stunde lang oder 50 Kilometer weit unterwegs sind. Fast wöchent-lich kommen neue Verbindungen dazu. Seit dieser Woche mischt noch ein weiterer Groß-anbieter mit: der ADAC-Postbus, der zu-nächst nur zwischen Köln und München ver-kehren soll und von November an auch wei-tere Großstädte bedient.
Innerhalb weniger Monate ist hier ein neu-er Markt entstanden, dessen Konturen nach und nach sichtbar werden. Dabei zeigt sich, dass manche der anfänglichen Vorbehalte of-fenbar unbegründet waren. So könne keine Rede davon sein, dass die Busse der Bahn massenhaft Kunden abjagten, sagt Heidi Tischmann vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). Beide Anbieter hätten schließlich eine ganz unterschiedliche Klientel. »Wer sich gern die Beine vertritt und lieber an der Zeit spart als am Geld, fährt sowieso eher Bahn«, sagt Tischmann. Auf den meisten Strecken seien Züge noch immer deutlich schneller und seltener verspätet.
Den meisten Fernbus-Kunden dagegen ist die Bahn schlicht zu teuer. Viele Studierende fahren lieber für weit weniger Geld bei Frem-den im Auto mit – und genau dieser Trans-port-Sparte machen die Fernbusse mittlerwei-le auch zu schaffen. Martin Rammensee be-zeichnet die Mitfahrzentralen als »die großen Verlierer der Reform«. Zusammen mit zwei Kommilitonen betreibt er das Portal Buslini-ensuche.de, eine Webseite, auf der Nutzer eine Strecke auswählen und anschließend sämtliche Anbieter vergleichen können.
Auf der Strecke Berlin–Hamburg kosten Tickets jetzt acht statt 25 Euro
Bei ihrer Analyse des Markts sind Rammen-see und seine Mitstreiter auf markante Ver-änderungen gestoßen. So werden etwa auf der Strecke Freiburg–Tübingen rund 80 Pro-zent weniger Mitfahrgelegenheiten angebo-ten, seit Fernbusse dieselbe Route im Pro-gramm haben. Offenbar verzichten viele Reisende gerne auf den obligatorischen Smalltalk mit dem Kleinwagenfahrer und geben Bussen den Vorzug, die im Übrigen erwiesenermaßen seltener in Unfälle verwi-ckelt sind. Rammensee betrachtet die neuen Angebote als Freiheitsgewinn, vor allem für Menschen mit geringem Reisebudget: »Wer wenig Geld hat, kann jetzt einfacher und si-cherer Städtereisen unternehmen.«
Wie stark die Preise durch die neue Kon-kurrenz bereits gesunken sind, lässt sich be-sonders deutlich an der Strecke Berlin–Ham-burg ablesen. Hier verkehrt seit Jahren der Berlin-Linienbus, weil für die Route schon vor der generellen Marktfreigabe für Fernbus-se eine Sonderregelung galt. Die einfache Fahrt, sagt Rammensee, habe früher etwa 25
Euro gekostet. Inzwischen sei ein Ticket schon ab 8 Euro zu haben. Tatsächlich werden viele Fahrten regelrecht verramscht. Was die Konkurrenz ärgert, aber nicht die Kosten deckt. »Die Preise werden wieder steigen müs-sen«, sagt Verkehrsclub-Expertin Tischmann, sonst würden einige Betriebe langfristig kaum überleben können.
Mit Dumpingpreisen allein lassen sich die vielen neuen Busse sowieso nicht füllen. Da-her gehen einige Anbieter inzwischen neue Wege: mehr Komfort statt quälender Enge, dank weniger Zwischenstopps schneller ans Ziel. »Wir wollen gar nicht der billige Stu-dentenbus sein«, sagt etwa Gregor Hintz von Mein Fernbus, einem Zusammenschluss von 47 Mittelständlern, der sich als einer der größten Anbieter auf dem Markt etabliert hat. Immerhin sechs bis acht Prozent der Nutzer seien Geschäftsleute, die unterwegs in Ruhe am Laptop arbeiten wollten. Und die Busfahrer seien mehr als nur Chauffeure: Älteren Passagieren trügen sie natürlich auch ihren Koffer.
Fernbusse werben mit Steckdosen, WLAN und größerer Beinfreiheit
Mein Fernbus ist kein Einzelfall. Auch Unter-nehmen wie city2city und Flixbus rüsten mitt-lerweile ihre Busse mit Steckdosen aus und bauen weniger Sitze ein, was die Beinfreiheit vergrößert. Der neue ADAC-Postbus stellt sich ebenfalls als »gehobener Fernbus« dar. Ältere Reisende sollen davon profitieren, dass man die Tickets nicht nur im Internet, sondern auch in manchen Post- und ADAC-Filialen kaufen kann. Die junge, medienaffine Generation wird mit »Bordentertainment«, Filmen, TV-Serien und Hörbüchern, gelockt. WLAN während der Fahrt gehört bei allen vier genannten Betrei-bern kostenlos zum Angebot. Zwar klagen Kunden darüber, dass das Netz in der Praxis nicht immer funktioniert – aber immerhin ist es ein Extra, das die Bahn nicht einmal theo-retisch bietet. Anders als im ICE dürfen die Gäste in vielen Bussen auch ein Fahrrad mit-nehmen. Es sieht ganz danach aus, als könnte der Fernbus der Bahn in Zukunft doch noch Konkurrenz machen.
Auch einer anderen Branche, den Reise-veranstaltern, werden manche Busanbieter mittlerweile gefährlich. Ruhrtours etwa bie-tet Fahrten nach Köln, Frankfurt, Nürnberg, Hamburg und Cuxhaven an, die auch eine Übernachtung beinhalten. Die Reisebusse chauffieren ihre Passagiere am Ziel direkt vors Hotel.
Vermutlich wird der harte Wettbewerb manches Unternehmen wieder aus dem Ren-nen werfen. Dennoch hat die Branche insge-samt gute Wachstumschancen: Das Berliner Iges-Institut hat errechnet, dass in Zukunft zehn Prozent des gesamten Verkehrsaufkom-mens in Deutschland auf Fernbusse entfallen könnten – eine Entwicklung, die nicht ein-mal der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland bedenklich findet. »Was die Umweltbilanz betrifft, geben sich Bus und Bahn nicht viel«, sagt Heidi Tischmann. Zwar lasse sich die Bahn, die mit Strom fährt, leichter auf erneuerbare Energien um-stellen. Aber ein vollständiger Wechsel sei bisher ohnehin noch nicht erfolgt. »Und bes-ser für die Umwelt als Auto und Flugzeug ist der Bus allemal.«
Der Wille zur AntikeReiste ein Athener aus dem alten Griechen-land mit der Zeitmaschine zum Brandenbur-ger Tor, er fühlte sich dort womöglich auf Anhieb heimisch. Schließlich stellt das Bau-werk den Aufgang zum Tempelbezirk der Göttin Athene dar. Erklärte man ihm aber, dass dieses Tor gar kein Eingang ist, sondern 30 Jahre lang an einer trennenden Mauer zwischen zwei Staaten lag, dann wäre der Zeitreisende mit seinem Griechisch wohl schnell am Ende. Ob Humboldt-Universität, Reichstag, Ku’damm oder Theater des Wes-tens – Berlin ist voll von Antike, nur eben als Remix: Klassizismus und Historismus haben sich in dieser Stadt besonders gründlich aus-getobt. Anhand von sechs Spaziergängen führt dieses in jede Manteltasche passende Bändchen zu den »Straßenkindern« der Anti-ke in Charlottenburg, Kreuzberg, Mitte und anderen Stadtteilen. Manchmal lädt die Au-torin und Altertumswissenschaftlerin Susan-ne Weiss auch zu einem Abstecher in die Mu-seen ein, wo die »feinen Verwandten« auf dem Sockel stehen. Besonders spannend sind die »Mischwesen«: Medusen, Sphinxen und die in Berlin besonders beliebten Greife, die als Himmelswächter auf Dächern oder Bal-konen sitzen. Ob beim Gang durch Dahle-mer Villen oder beim Blick auf die Pflanzen-welt des Botanischen Gartens mit Lorbeer, Myrte und Olivenbaum: Dass der »Wille zum Antikisieren« bei den Berliner Bauher-ren des 18. und 19. Jahrhunderts das Pro-gramm bestimmte, ist nicht zu übersehen.BC
Susanne Weiss: Athene an der Spree. Berliner Spaziergänge in die Antike. Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt 2013; 100 S., 14,99 €
Von Hütte zu HütteDie Falkenhütte im Karwendel, eine klassi-sche Bergsteigerunterkunft, thront hoch über dem Tal vor den abweisenden Laliderer Wänden. Jetzt hat der Wirt ein Mountain-bike neben seine Hütte gehängt – nicht als Gag, sondern als Gruß: »Biker willkom-men!« Längst sind die Sportler mit ihren voll gefederten Maschinen in den Bergen ein ebenso vertrautes Bild wie die Wanderer. Und auch sie nutzen Hütten und Almen zum Übernachten oder Pausieren. Mehr als hundert dieser Ziele in Bayerns Alpen hat das Autorenteam mit 16 Radrouten ver-bunden – Touren, bei denen ordentlich Strecke und Höhe zusammenkommen. Das Buch, erschienen in der Großformat-Reihe des Bruckmann Verlags, enthält eine Menge sinnvoller Informationen und anschauliche Streckenporträts. Zudem werden die Hüt-ten und Almen mit all ihren Angeboten, Be-sonderheiten und sogar den Eigenschaften ihrer Wirtsleute so ausführlich beschrieben, dass das Buch auch als Kompendium der Berg-Stützpunkte gute Dienste leistet. ALB
Helmut Walter/Carmen Fischer/Nadine Oberhuber: Biken von Hütte zu Hütte.16 Traumtouren und über 100 Hütten in den Bayerischen Hausbergen. Bruckmann Verlag, München 2013; 192 S., 26,99 €
LESEZEICHEN
82 REISEN
Bus, du hast den Gast gestohlenSeitdem in Deutschland Fernbusse unterwegs sind, verlieren vor allem
Mitfahrzentralen Kunden. Auch für die Bahn könnte es in Zukunft
enger werden VON COSIMA SCHMITT
Illu
stra
tio
n:
Ge
rt A
lbre
cht
für
DIE
ZE
IT/
ww
w.g
ert
alb
rech
t.d
e
Fast wöchentlich neue Verbindungen: Fernbusse drängen auf den deutschen Reisemarkt

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
83
ZEIT: Sie würden den Islam gerne befreien von dem herkömmlichen Scharia-Verständnis?Khorchide: Man muss sich lösen von dem Ge-danken, der islamische Gott sei ein angstma-chender Gott, der nur dann zufrieden ist, wenn ich Gesetze den Buchstaben nach erfülle; es geht ihm um die Absicht dahinter. Gerade 80 von den 6236 Versen im Koran sprechen juris-tische Belange bezüglich der Gesellschaftsord-nung an. Der Islam ist keine Gesetzesreligion.ZEIT: Was ist mit dem Strafrecht, Erbrecht?Khorchide: Was wir heute als islamisches Recht bezeichnen, ist nicht göttlich, das ist von dama-ligen Rechtsgelehrten entwickelt, die im Geist ihrer Zeit gedacht haben. Auch im Koran vor-kommende juristische Aussagen, dass Dieben die Hand abzuhacken sei oder dass Frauen nur halb so viel erbten wie ein Mann, müssen in ihrem historischen Kontext gelesen werden. Nicht solche juristischen Maßnahmen machen die Scharia aus, sondern die Prinzipien dahin-ter wie Gerechtigkeit. Versteht man sie so, wäre es auch kein Problem, die Scharia mit unseren Menschenrechten zu vereinbaren.ZEIT: Machen Sie es sich nicht zu einfach mit diesem, sagen wir es zugespitzt, Wohlfühl-Islam?Khorchide: Umgekehrt: Die Orthodoxen und die Salafisten machen es sich leicht. Salafisten können den Islam in 30 Sekunden auf YouTube zusammenfassen. Die sagen: Fünfmal am Tag beten, fasten, pilgern, kein Alkohol, und das Pa-radies wartet. Orthodoxe Lehrbücher erklären ausführlichst, wie man die Finger beim Gebet halten soll, damit man gottgefällig ist. So klein-lich kann Gott nicht sein. Ich sage: Es geht nicht um die Fassade, es geht um den Kern, um das Innere des Menschen. Als guter Muslim muss ich mir mein Leben lang einen Spiegel vorhal-ten, ob ich mich aufrichtig verhalte. Der Weg zu einer reinen Seele ist länger und mühsamer, als sich an Äußerlichkeiten zu halten.ZEIT: Sehen Sie sich eigentlich in der Rolle ei-nes Wissenschaftlers oder eines Predigers?Khorchide: Ich sehe mich in erster Linie als Wis-senschaftler. Aber nicht nur: Ich möchte auch dazu beitragen, dass Muslime lernen, ihren Glauben zu reflektieren. Ich würde mich aber nie als Aufklärer oder Reformer bezeichnen.ZEIT: Wir hören eine gewisse Mission heraus?Khorchide: Das wäre zu viel gesagt, aber die Professur für islamische Theologie ist nicht nur ein Beruf für mich, es ist eine Berufung. Viel-leicht haben auch deshalb einige Muslime Pro-bleme mit mir.ZEIT: Wen meinen Sie?Khorchide: Diejenigen, die in Deutschland die Deutungshoheit über den Islam für sich bean-spruchen.ZEIT: Die muslimischen Verbände?Khorchide: Ich werde hier keine Namen nen-nen. Man muss nur wissen, dass einige, die meinen, im Sinne der Muslime zu handeln, le-diglich die Interessen ihrer Gruppen oder Ideo-logien vertreten. ZEIT: Nach Ihrem letzten Buch, in dem Sie eine neue Lesart des Korans forderten, wurden Sie von drei Funktionären muslimischer Ver-bände zur »Reue« aufgerufen. Khorchide: Es ist peinlich und unislamisch, je-mandem zu unterstellen, er sei abgefallen von seiner Religion, nur anhand von Gerüchten und Interviewausschnitten, ohne sich vorher zu vergewissern.ZEIT: Der konkrete Vorwurf lautete, Sie wür-den behaupten, jeder, der Gutes tue, sei ein Muslim, auch wenn er nicht an Gott glaube.Khorchide: Ich habe nie gesagt, dass der Glau-be an Gott obsolet ist.
DIE ZEIT: Professor Khorchide, essen Sie ab und zu Gummibärchen?Mouhanad Khorchide: Gerne und mit
gutem Gewissen. Sie fragen wegen der Gelatine, in der Reste vom Knochenmark von Schweinen ver-arbeitet sind?ZEIT: Viele Muslime halten den Verzehr von Ge-latine deshalb für eine Sünde.Khorchide: Es gilt hier die islamische Formel: Wenn sich die Eigenschaften eines Stoffes so ver-ändern, dass er nicht mehr zu erkennen ist, ist es nicht mehr derselbe Stoff. Das Problem vieler Muslime ist, dass sie schlecht über die islamische Lehre informiert sind. Abgesehen davon, reduzie-ren viele den Islam auf rechtliche Regelungen, an-statt sich auf zentrale Dinge wie Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit zu konzentrieren. ZEIT: Islamische Rechtsgelehrte scheinen Ihnen ein Dorn im Auge zu sein, in Ihrem neuen Buch über die Scharia bezeichnen Sie sie als Götter, die es nicht geben dürfte.Khorchide: Ich habe nichts gegen die Rechtsge-lehrten. Ich habe etwas dagegen, dass wir Muslime ihre Aussagen unhinterfragt als göttliche Wahrheit für alle Zeiten übernehmen. Dabei haben auch sie nur den Koran interpretiert. Wir haben aus ihnen Götter gemacht.ZEIT: Warum ist es so gekommen?Khorchide: In der muslimischen Welt herrscht seit dem 9. Jahrhundert ein restriktiver Geist. Wir hin-terfragen kaum. Wir vertrauen der Vernunft nicht mehr als normgebender Quelle, und wenn heute ein Muslim dies tut, wird er schnell zum Häretiker erklärt. Die politischen Herrscher haben seit den Anfängen des Islams das Bild eines Gottes kon-struiert, dem Gehorsam über alles geht, um einen Geist der Unterwerfung zu etablieren. ZEIT: Sie sagen, die Scharia stehe im Widerspruch zum Islam. Ist sie nicht wesentlicher Teil des Islams und regelt das Leben der Muslime bis ins Detail?Khorchide: Ich will mit diesem Klischee aufräu-men. Nur wenn man die Scharia als juristisches Werk versteht, steht sie im Widerspruch zum Is-lam, denn dann schiebt sich der Rechtsgelehrte mit seinen Interpretationen des Korans zwischen Gott und den Menschen und verhindert die direk-te, persönliche Beziehung zu Gott. Der Prophet Mohammed sagte: »Frag dein Herz, egal, was sie dir an religiösen Rechtsgutachten geben.« ZEIT: Und wie verstehen Sie die Scharia?Khorchide: Scharia bedeutet: der Weg zu Gott. Das ist der Weg des Herzens. Es geht um Prinzi-pien wie Gerechtigkeit, es geht um innere Läute-rung, nicht um einzelne Gesetze, kleinliche Vor-schriften. Gott darf nicht auf einen Richtergottreduziert werden.ZEIT: Was sagen Ihre Studenten zu dieser Lesart?Khorchide: Die junge Generation von Muslimen nimmt ihre Religion ernster als die Elterngenerati-on. Sie wollen verstehen. Sie hinterfragen. Daher bekomme ich viel Zustimmung. Dieses Jahr haben sich bei uns an der Uni Münster schon über 700 Studenten auf die 150 Studienplätze beworben, und die Anmeldefrist ist noch nicht einmal um.
ZEIT: Ist Ihre Sicht manchen nicht zu weit ent-fernt von dem, was sie bisher kannten?Khorchide: Es sind nur wenige, die auf dem Vor-handenen beharren. Die meisten begreifen, dass ich den Islam weiterentwickeln will.
ZEIT: Haben Sie keine Sorge, dass von Ihnen aus-gebildete Lehrer für den Religionsunterricht von vielen Eltern und islamischen Gemeinden nicht akzeptiert werden?Khorchide: Für die Eltern ist es wichtig, dass sie sich mit dem identifizieren können, was ihr Kind von der Schule mit nach Hause bringt. Und das können sie. Ich verkünde hier ja keine Irrlehren.ZEIT: Der Islam kennt keine Strukturen wie die Kirche. Um mit dem Islamunterricht und der Aus-bildung der Lehrer beginnen zu können, wurde ein Beirat gegründet. In dem sitzen auch Vertreter der muslimischen Verbände. Die haben eine Lehr-erlaubnis nach dem Vorbild der katholischen Kir-che eingeführt. Wie finden Sie das?Khorchide: Ich würde diese Lehrerlaubnis am liebs-ten abschaffen, eine amtliche Beurteilung, ob je-mand religiös genug ist, gibt es nicht im Islam. Aber die Verbände wollten es so. Die Lehrerlaubnis verleiht ihnen mehr Mitspracherecht, mehr Macht.
Ich halte eine Selbstverpflichtung für sinnvoller, in der steht, dass man ein Leben nach islamischen Maßstäben führt.ZEIT: Hat sich denn das Beiratsmodell insgesamt bewährt?Khorchide: Es ist ja als Übergangslösung gedacht. Danach sollen allein die Verbände das Sagen haben, was Lehrinhalte in den Schulen angeht. Das ist aber noch etwas zu früh. ZEIT: Warum?Khorchide: Die Verbandsfunktionäre waren bisher nicht mit inhaltlichen Fragestellungen konfron-tiert. Sie wären damit überfordert, weil sie die theologischen Kompetenzen dafür nicht besitzen. Ich würde mir wünschen, dass Absolventen der neuen theologischen Studiengänge einmal diese Verbände bereichern.ZEIT: Könnten es noch mehr Absolventen sein, wenn es kein Kopftuchverbot an den Schulen ge-ben würde?
Khorchide: Ja, sicher. Ich hoffe, dass sich bis 2017, wenn unsere Absolventinnen in die Schulen gehen, etwas getan hat. Für mich gehört es zur Religions-freiheit, dass man das Kopftuch in Schulen tragen darf. Auch außerhalb des Islamunterrichts. ZEIT: Was genau könnte sich tun? Glauben Sie, dass das Kopftuchverbot für Lehrerinnen aufgeho-ben wird?Khorchide: Man kann nach Kompromissen suchen. Denkbar wäre eine Selbstverpflichtung, in der die Lehrerin bestätigt, dass das Tuch eine rein private Sache ist und sie die Schülerinnen in keiner Weise beeinflussen wird, es ebenfalls zu tragen.
Das Gespräch führten ARNFRID SCHENK und MARTIN SPIEWAK
Mouhanad Khorchide: »Scharia – der missverstandene Gott. Der Weg zu einer modernen islamischen Ethik« (Herder Verlag)
Die Scharia muss neu interpretiert werden, meint Mouhanad Khorchide.
»So kleinlich kann Gott nicht sein«Mouhanad Khorchide bildet an der Uni Münster Lehrer für den
islamischen Religionsunterricht aus. Ein Gespräch über seine
Lesart der Scharia, Klischees und das Kopftuchverbot an Schulen
1971 wurde Khorchide als Sohn palästinensischer Flüchtlinge im Libanon geboren. Er ist in Saudi-Arabien aufgewachsen, hat in Beirut Theologie studiert und ging für die Promotion in Soziologie nach Wien.
Seit 2010 ist er Professor für islamische Religionspädagogik am Centrum für Religiöse Studien der Universität Münster. Khorchide ist einer der führenden islamischen Theologen in Deutschland.
Mouhanad Khorchide
Nächste Woche: Spezial
Abitur – was dann?Auf 52 Seiten das Wichtigste zum Leben nach dem SchulabschlussCHANCENSchule S. 84
Hochschule S. 85
Beruf S. 86
Foto
: U
te F
rie
de
rike
Sch
ern
au f
ür
DIE
ZE
IT/
ww
w.u
te-f
rie
de
rike
-sch
ern
au.d
e

Schutzraum für LangsamlernerFinnland hat die meisten seiner Sonderschulen abgeschafft.
Was kann Deutschland davon lernen?
Ein Besuch in Jyväskylä VON MARTIN SPIEWAK
Tuomas macht keine großen Wor-te. Das ist bei Jungen in seinem Alter so. Bei finnischen vielleicht erst recht. Die Haare pechschwarz gefärbt unter einer Schirmmütze, am Körper schlabbern ein Sweat-shirt und eine übergroße Hose:
So sitzt der 14-Jährige vor ei nem Bildschirm und löst Eng lischaufgaben. »Was machst du, Tuomas?« – »Für’n Test ler nen.« – »Warum bist du nicht in deiner Klasse?« – »Weil ich beim Tupa mehr Hilfe krieg.« – »Ge fällt dir der Tupa-Unterricht?« »Is’ schon okay.«
Tupa bedeutet auf Finnisch »Hütte« oder »Schutz-raum«. An der Sekundarschule von Jyväskylä heißt so der Förderunter richt. Während seine Klassen-kameraden dem nor malen Stundenplan folgen, übt Tuomas hier dreimal die Woche mit einem Förder-lehrer Eng lisch und Mathe. Zwei Mäd chen und ein Junge sitzen an diesem Mor gen an den Neben tischen. Es sind die Langsamlerner ihrer Klasse, die Null-Bock-Kandidaten, die sozial Auffälligen.
In Deutschland wäre mancher von ihnen auf einer Sonderschule. Doch die gibt es in Jyväskylä, einer Uni-versitätsstadt in Mittelfinnland, nicht mehr – zu-mindest nicht für Schüler mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensproblemen. In den vergangenen dreißig Jahren hat Finnland fast zwei Drittel seiner Sonderschulen geschlossen. Die Zahl der Schüler, die eine spezielle Unterstützung erhalten, ist aber nicht kleiner geworden. Im Gegenteil, bis Ende der neunten Klasse war sage und schreibe jeder zweite junge Finne einmal Förderschüler. Nirgendwo dürfte diese Quote höher sein als im Bildungsvorzeigeland Finnland.
Das ist interessant, und zwar besonders für die Debatte über Inklusion in Deutschland. Der Fach-begriff steht in der UN-Be hin der ten rechts kon ven-tion. Die Bundesrepublik hat sie vor vier Jahren rati-fiziert. Das Abkommen hat eine Reform angestoßen, gegen die andere bildungspolitische Neuerungen zu Petitessen schrumpfen: die Eingliederung von Schü-lern mit einem Handicap in allgemeine Schulen.
Dabei wird der Streit über die Inklusion hierzulan-de recht provinziell geführt. Lange Zeit dachten die Deutschen, es sei normal, besondere Schüler möglichst durchgängig in besonderen Schulen zu unterrichten. Dem war nie so. Kein anderes Land der Welt unterhält ein so ausgebautes Sonderschulwesen. Deutschland ist Weltmeister im Aussondern. Heute nun denken viele, Ziel einer inklusiven Schule nach den UN-Vor-gaben müsse sein, alle Schüler – vom Hochbegabten bis zum geistig Behinderten – zu jeder Zeit gemeinsam zu unterrichten. Das wiederum gibt es nirgendwo auf der Welt, nicht einmal in Italien, das die Sonderschu-len bereits vor 30 Jahren abgeschafft hat.
Finnland geht einen Mittelweg. Vielleicht könn-te es deshalb in manchem als Beispiel taugen: für die Zusammenarbeit von Fachlehrern und Sonder-pädagogen, für die Infrastruktur der Förderung, für den Pragmatismus. Über allem steht die eine Frage: Was nützt dem einzelnen Schüler?
Mit dieser Frage beschäftigt sich auch die Runde, die an der Sekundarschule in Jyväskylä an diesem Vor-mittag im Büro der Schulleiterin zusammen gekommen ist. Es geht um die Sorgenkinder der Schule: Warum kommen bestimmte Schüler im Unterricht nicht mit? Welcher Jugendliche ist unangenehm aufgefallen? Wer benötigt Tupa-Stunden? Alle drei Wochen trifft sich der »Ausschuss für Schülerfürsorge«. Die Rektorin und einige Lehrer sind dabei sowie natürlich die vielen Sonderpädagogen der Schule.
Sonderpädagogen genießen ein höheres Ansehen als Lehrer und verdienen mehr
Spezialpädagogen heißen sie in Finnland. Jedem Schülerjahrgang ist einer zugeordnet. Tiina Pilbacka-Rönkä begleitet die drei neunten Klassen. Sie hat ein paar Schaubilder mitgebracht, mit vielen Pfeilen, Farben und Kreisen. In der Mitte stehen die oppilas, die Schüler. Darum gruppieren sich die vielen Pro-fessionen, die man an allen finnischen Schulen fin-det: der Sozialarbeiter, die Psychologin, die Schul-krankenschwester, der Laufbahnberater sowie der zuständige Polizeibeamte. Je nach Fall werden die Experten zur Förderkonferenz hinzugezogen.
Drei weitere Spezialpädagogen arbeiten neben Pilbacka-Rönkä an der Sekundarschule von Jyväsky-lä. Sie alle waren einmal normale Klassenlehrer, haben sich dann an der Universität spezialisiert. Sonder-pädagogen genießen in Finnland ein noch höheres Ansehen als die ohnehin sehr geschätzten Lehrer. Ihr Gehalt ist besser als jenes ihrer Fachkollegen. Den-
noch sind sie voll ins Kollegium integriert.
Als Speziallehrerin testet Pilbacka-Rönkä die Schüler auf Lern-schwierigkeiten, erstellt Nachhilfe pläne und na-vigiert ihre Schützlinge durch die ausgeklügelte Förderstruktur. Am An-fang steht stets die Unter-stützung im normalen Unterricht. »Dafür sind Klassenlehrer und Spezial-pädagoge gemeinsam zustän-dig«, sagt Pilbacka-Rönkä. Die in Deutschland häufig anzutref-fende Vorstellung, der Förder-lehrer sei nur für die Problemfälle der Klasse zuständig, trifft man in Finnland kaum an. Wem die Hilfe im Klassenverband nicht reicht, der hat Anrecht auf gezielte Förderung. Allein oder in kleinen Gruppen holen die Schüler den Stoff mit einem Speziallehrer im Tupa-Raum nach. Die meisten kehren nach ein paar Monaten in ihre Klasse zurück. Gelingt dies nicht, kommt die dritte Stufe der Förder pyramide zum Ein-satz: Die Schüler werden von den Anforderungen des Curriculums befreit und arbeiten nach einem eigenen Lehrplan. Dafür benötigt es für jedes betroffene Fach ein sonderpädagogisches Gutachten.
Jedes finnische Kollegium organisiert die Förder instrumente etwas anders. An manchen Schulen verlassen die »Sonderschüler« überhaupt nicht ihre Klasse, sondern arbeiten ihr eigenes Pensum im regulären Unterricht ab. In anderen Fälle verbleiben sie den ganzen Schultag in einer eigenen Gruppe. Pilbacka-Rönkä und ihre Kolle-gen haben sich vor ein paar Jahren jedoch von den Sonderklassen verabschiedet. »Die Versuchung, einige Schüler ganz dorthin abzuschieben, war einfach zu groß«, sagt die Lehrerin.
Dennoch würde niemand an ihrer Schule auf die Idee kommen, alle Lernprobleme ließen sich im Klassenverband lösen. In Deutschland meint man-cher Inklusions-Befürworter, die Lehrer müssten ihren Unterricht nur entsprechend »individualisie-ren«, dann könne man auf Sonderschulen verzich-ten. Diesen Gedanken hält man in Finnland für illu sorisch. Schon zu Beginn der Schulzeit setzen die finnischen Schulen hier auf regelmäßige Tests und die kontinuierliche Förderung durch Spezialisten.
Wenn jeder zweite Extrastunden erhält, ist »Förderschüler« kein Stigma
»Je früher man interveniert, desto besser. Das gilt besonders für die Hauptfächer«, sagt Sakari Moberg von der Universität Jyväskylä. Schon ein Jahr nach der Einschulung soll jedes Kind flüssig lesen können. Damit das Ziel erreicht wird, geht bisweilen die Hälfte der Klasse zum Förderunterricht. Die Bezeich-nung Förderschüler ist dann kein Stigma mehr.
Für Moberg, den bekanntesten Experten auf dem Feld, ist diese intensive Förderung das Geheimnis des Pisa-Erfolgs seines Landes. Bis heute strömen Politiker und Professoren aus der ganzen Welt nach Jyväskylä, in das Zentrum der finnischen Bildungs-forschung, um herauszubekommen, warum aus-gerechnet die Finnen bei den Schulvergleichen her-vorstechen. Selbst aus China und Chile melden sich die Besucher an. Gerade am unteren Rand des Leis-tungsspektrums haben sich die finnischen Schulen in den vergangenen vier Jahrzehnten kontinuierlich verbessert. »Ein Hauptgrund dafür dürfte der in-tensive Förderunterricht sein«, sagt Moberg.
Völlig unumstritten ist das Modell auch in Finn-land nicht. Sein wichtigster Kritiker ist Mobergs Kollege an der Universität Jyväskylä, Timo Saloviita. Er sitzt nur wenige Büros weiter. »Eine Schule für alle« heißt sein bekanntestes Buch. Für Saloviita ist jede Form des Unterrichts außerhalb des Klassen-verbandes ein Bruch mit der Inklusionslogik – und Finnland deshalb alles andere als ein Vorbild. Dass die meisten geistig behinderten Kinder in eigenen Klassen lernen und nur in den Pausen oder beim Essen Kontakt zu anderen Schülern haben, kritisiert er immer wieder scharf. Doch Saloviitas vertritt eine Außenseiterposition. Die meisten Integrationsexper-ten wollen – ähnlich wie Lehrer und Eltern – von einer vollständigen Abschaffung aller Sonderschulen nichts wissen.
Besonde-re Kinder be-nötigen besondere Hilfe, je größer das Lern problem, desto individu-eller muss die Antwort des Bil-dungssystems ausfallen. So könnte man die finnische Inklusionsphilosophie beschreiben. Dem Hamburger Erziehungswissenschaftler Karl Dieter Schuck gefällt der Ansatz. Er hat ihn bei einem Besuch vor einigen Jahren in Jyväskylä kennen-gelernt. »Die Debatte in Deutschland verläuft da-gegen zu sehr in Extremen«, erklärt der Experte für Integrationspädagogik. Während die einen am liebsten weiterhin alle Kinder mit Lernschwierig-keiten in Sonderschulen unterrichten würden, meinen andere, es sei schon diskriminierend, ein Handicap auch nur festzustellen. »Etwas weniger Fundamen-talismus und mehr finnischer Realismus würden der deutschen Diskussion guttun«, sagt Schuck.
Wie dieser Realismus aussieht, kann man gut am Rande von Jyväskylä studieren. Einst stand hier eine der größten Blindenschulen des Landes. Heute ist auf dem Campus mit seinen vielen Flachbauten Onerva untergebracht, das nationale Kompetenzzentrum für hör- und sehgestörte Kinder. Die Mitarbeiter von Onerva testen in ihren Labors neue Lesegeräte und Schreibcomputer, entwickeln Unterrichtsmethoden und konzipieren Schulbücher. Daneben sind sie im ganzen Land unterwegs und beraten Lehrer und El-tern im Umgang mit blinden und gehörlosen Schü-lern. Wenn möglich, sollen die betroffenen Kinder die nächstgelegene Schule besuchen.
Dennoch wurde das ehemalige Blindeninternat nicht aufgelöst. »Inklusion ist wichtig, und wir haben sie in Finnland noch nicht erreicht«, sagt Onerva-Leiterin Tuula Vähäkainu-Kujanen. »Doch nicht alle Behinderungen sind gleich.« Einige Kinder brauchten eben besondere Hilfen: mehrfach behinderte Schüler, die spezielle Rehabilitation benötigen; Kinder aus Familien, die mit dem Handicap überfordert sind.
Sie besuchen weiterhin eine der beiden Blinden-klassen in Jyväskylä und folgen dort ihrem individu-ellen Lernplan. Die Klassenräume sind mit neuester Technik vollgestellt. Vor einem Bildschirm hacken die Schüler in ihre Tastatur, geben Anweisungen ins Mikrofon, üben spezielle Lernspiele. Wären da nicht die übergroßen Buchstaben und die Bücher in Brail-le-Schrift auf den Tischen, man könnte meinen, man wäre in einer Werkstatt für Game-Entwickler.
Wochenweise kommen auch sehbehinderte Schüler aus ganz Finnland ins Onerva-Zentrum nach Jyväskylä. Der Grund: Sie wollen mit Gleichaltrigen zusammen sein, die ihr Schicksal teilen. »Das dient der Identitätsbildung«, sagt die Schulleiterin. Doch nach einer Woche führen sie gern zurück zu Eltern und Freunden. »Keiner von ihnen würde freiwillig in einer Sonderschule nur unter Blinden lernen wollen.«
84 CHANCEN Schule
E s ist für viele Berliner Schüler das ver-flixte siebte Jahr. Wer nach der sechs-ten Klasse die Grundschule verlässt
und auf ein Gymnasium wechselt, muss dort ein Jahr lang zittern, ob er bleiben darf oder nicht. Drei Schüler des Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums in Berlin-Neukölln durften nicht. Auf ihren Zeugnissen wimmelte es am Ende des Schuljahres nur so von Fünfen. Zu-sammen erhielten sie 25-mal »mangelhaft«.
Durchaus nachzuvollziehen also, dass die Schule die Eignung dieser Schüler für den Weg zum Abitur infrage stellte. Die drei Schüler und ihre Eltern hingegen machten für die schlechten Leistungen vor allem die Zusammensetzung der Klasse verantwort-lich. Es habe am hohen Anteil an Schülern nichtdeutscher Herkunft gelegen (63 Pro-zent), dass die drei Jugendlichen in vielen Fächern von der Note Zwei oder Drei auf eine Fünf abgerutscht seien. Eine so schlech-te Durchmischung der Klasse sei rechtswid-rig und diskriminierend, fanden die Famili-en, die selbst türkischer und arabischer Ab-stammung sind, und zogen vor das Berliner Verwaltungsgericht.
Ihre Klage wurde vergangene Woche ab-gewiesen. Zwar gebe es laut Schulgesetz die Verpflichtung, Schüler deutscher und nicht-deutscher Herkunft gemeinsam zu unter-richten, so das Gericht, das bedeute aber nicht, dass man Kinder mit Migrationshintergrund gleichmäßig auf alle Klassen verteilen müsse. Es bleibe dem Spielraum und der Or ga ni sa tion der einzelnen Schule überlassen, nach welchen Kriterien sie die Klassen zusammensetze.
Im Falle des Neuköllner Gymnasiums gab es im Jahrgang der klagenden Schüler acht siebte Klassen. Bei zweien lag der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund bei 63 Pro-zent, bei der »Lateinklasse« dagegen nur bei 13. Die Schule berücksichtigte bei der Zu-sammensetzung der Klassen auch den Besuch des Religionsunterrichts. Für den Anwalt der Kläger, Carsten Ilius, sind das »indirekte Dis-kriminierungskriterien«. »Es fällt nicht schwer, sich auszurechnen, welche Zusammensetzung eine solche Auswahl zur Folge hat.«
Immerhin hätte es auch in der Latein-klasse fünf Schüler gegeben, die nach dem Probejahr von der Schule gehen mussten, sagt die Sprecherin der Berliner Bildungsbehörde. In der Klasse der Kläger waren es zehn. Al-lerdings zeigt die Statistik auch, dass mehr Schüler nichtdeutscher Herkunft das Probe-jahr auf den Berliner Gymnasien nicht be-stehen als deutsche. Im Schuljahr 2012/13 zählte man 761 Abgänge insgesamt, darunter waren 433 Schüler nichtdeutscher Herkunft.
Nicht nur für den Anwalt Carsten Ilius stellt sich da die Frage, wie ernst es die Schu-len damit meinen, wirklich allen Schülern die bestmögliche Förderung zukommen zu las-sen. »Wir haben die Gymnasien bewusst für Migranten und Arbeiterkinder geöffnet«, sagt der bildungspolitische Sprecher der Berliner Grünen Özcan Mutlu. »Nun hat die Schule die Pflicht, diesen Kindern optimale Lern-bedingungen zu bieten.« Für Mutlu wurde es höchste Zeit, dass das Thema der Klassen-durchmischung vor einem Gericht landet. Die meisten Eltern hätten keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, und wer es sich leisten könne, versuche, seine Kinder von vornherein an Schulen anzumelden, an denen weniger Migranten lernen. Nach diesem Gerichtsurteil wird sich daran wohl so schnell auch nichts ändern in Berlin. Die drei be-troffenen Schüler übrigens lernen inzwischen auf einer Sekundarschule und schreiben dort alle wieder gute Noten. JEANNETTE OTTO
Mit 25 Fünfen durchgefallen
Berliner Schüler klagen gegen Diskriminierung – und scheitern
TIPPS UND TERMINE
Forschen zu EnergieDie Siemens Stiftung veranstaltet einen Wettbewerb für Schüler ab der zehnten Klasse zum Thema »Energie neu denken! Bewegt etwas für Eure Zukunft«. Aufgabe ist es, eine konkrete Forschungsfrage zur nach-haltigen Energieversorgung zu stellen und zu beantworten. Die erfolgreichsten Schüler fahren zum Vorentscheid nach Aachen, Ber-lin oder München. Wer es unter die besten neun schafft, reist 2014 nach Berlin und kann Geld für eine Ausbildung gewinnen. Anmelde schluss ist der 15. November 2013. http://bit.ly/siemens_energie
Studienstart im JanuarAn der privaten Zeppelin Universität in Friedrichshafen beginnt das Studium in ei-nigen Bachelorstudiengängen erst im Januar. Dazu gehören Politikwissenschaften, Ver-waltung und Internationale Beziehungen, Kommunikations- und Kulturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften sowie Soziologie, Politik und Ökonomie. Bewerbungen sind bis zum 11. November 2013 möglich. www.zu.de/spring
Sieger im VergleichFinnische Schüler schneiden bei Schul-leistungsstudien wie den Pisa-Tests seit Jahren vorbildlich ab, die Unterschiede zwischen den Schulen sind gering. Dabei gibt Finnland nicht mehr Geld aus als Deutschland, und die Unterrichtsmethoden sind eher konventionell. Ein Erfolgsgrund dürfte die Zusammensetzung der Schülerschaft sein. Die finnische Gesellschaft ist sozial wie kulturell ziemlich homogen. Dazu passt die Schulstruktur: Bis zur neunten Klasse gehen alle gemeinsam zur Schule.
Wert der BildungFinnische Schulen genießen großes Vertrauen, der Lehrerberuf ist beliebt. Hinzu kommt eine gut ausgebaute Förderkultur. Es gibt nahezu keine Sitzenbleiber oder Schulabbrecher; private Nachhilfe ist so gut wie unbekannt. Fast alle Schüler machen einen Abschluss. Probleme bereitet der Anschluss: Schul- und Uni-Abgänger brauchen lange, bis sie einen Beruf finden. Die Jugend-arbeitslosigkeit ist hoch.
Musterland Finnland?
www.zeit.de/audio
Je größer das Lernproblem ist, desto mehr Hilfe bekommen
die Schüler in Jyväskylä in Mittelf innland
Foto
s: M
atti
Sal
mi
für
DIE
ZE
IT/
ww
w.m
atti
salm
i.co
m

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 CHANCEN 85Hochschule
Manager contra ModeratorWolfgang Herrmann und Bernd Huber führen in München die erfolgreichsten deutschen Universitäten – jeder auf sehr eigene Weise VON MARION SCHMIDT
Die Ludwig-Maximilians-Universität in München gehört mit beinahe 50 000 Studenten zu den größten Hochschulen Deutschlands. Ihr stei-nernes Herz sind die prachtvollen
Bauten im historischen Rundbogenstil an der Lud-wigstraße, wo Sophie Scholl 1943 die Flugblätter der Weißen Rose in den Lichthof segeln ließ. Von den Treppenaufgängen blicken antike Geistesgrö-ßen und königliche Herrscher auf die Eintretenden herab. Doch der Präsident dieser Universität, Bernd Huber, sitzt anderswo. Er ist in einem schmucklo-sen, dunklen Gebäude aus den siebziger Jahren untergebracht. Dort werden Personalkarten noch in einer alten Stechuhr ab-gestempelt. Im vierten Stock lässt sich Huber in einen ab-gewetzten Ledersessel fallen, den er von seinem Vorvorgänger geerbt hat, und zündet sich eine Marlboro an. »Ich bin ein un-eitler Mensch«, sagt er und bläst den Rauch aus. »Mir sind Äu-ßerlichkeiten nicht wichtig.«
Nur ein paar Straßen weiter empfängt Wolfgang Herrmann, Präsident der ebenso erfolgrei-chen Technischen Universität München (TUM), seine Gäste im sogenannten Blauen Salon und führt sie dann über vor-nehm knarrendes Fischgrätpar-kett in sein weitläufiges Büro. Auf einem Tisch stapeln sich die Merchandising-Produkte: TUM-Seidentücher, TUM-Ta-schenlampen, TUM-Schreibblö-cke. Herrmanns Uni ist eine Marke, der Präsident hat sie dazu gemacht, er selbst ist der Markenkern. »Wir sind ein Wissen-schaftsunternehmen, wir brennen für unsere Pro-dukte«, sagt er und lehnt sich jovial lächelnd zu-rück. Wenn er Raucher zu Gast hat, bietet er gern ein Zigarillo an, obwohl im ganzen Gebäude Rauchverbot gilt – mit Ausnahme seines Büros.
Beide Hochschulpräsidenten, Wolfgang Herr-mann und Bernd Huber, stehen jeweils an der Spitze der – auch im internationalen Vergleich – erfolg-reichsten deutschen Universitäten. Alle beide residie-ren in der bayerischen Landeshauptstadt, wo der Ministerpräsident seinen Geldsack gern zum Ruhm des Landes öffnet. Beide wurden kürzlich einstimmig wiedergewählt. In dieser Woche treten sie ihre neue Amtszeit an. Für den TUM-Chef Herrmann, der im April 65 Jahre alt geworden ist, wird es die letzte sein.
In den vergangenen Jahren haben die zwei Prä-sidenten ungezählte Reformen umgesetzt und große Erfolge errungen: Sie haben ihre Wissenschaftler im Exzellenzwettbewerb von Bund und Ländern zu
Spitzenleistungen angetrieben und jeweils den für das Renom-mee so wichtigen Titel der Elite-universität ergattert. Damit haben zwei von nur neun deut-schen Elite-Unis ihren Sitz in München. Beide Männer führen unter den gleichen politischen und wirtschaftlichen Rahmen-bedingungen – und doch auf höchst unterschiedliche Weise. Nicht nur, weil sie ganz ver-schiedene Charaktere sind, sondern auch weil sie Fächer-kulturen vertreten, die verschie-dener nicht sein können: Hier die hinterfragenden Geisteswis-senschaften, dort die lösungs-orientierten Ingenieure.
In den deutschen Hoch-schulen ist in den vergangenen zehn Jahren kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Das ge-samte Lehrangebot wurde auf
Bachelor-Master-Programme umgestellt. In der Ver-waltung können Unis heute deutlich eigenverant-wortlicher handeln und müssen sich nicht mehr wie nachgeordnete Behörden vom Wissenschaftsminis-terium gängeln lassen. Sie verwalten ihr Budget selbst und berufen ihre Professoren. Sie müssen sich aber auch mehr als früher im internationalen Wettbewerb
um die besten Studenten und Forscher bemühen und im Kampf um Fördergelder behaupten. Dafür brauchen sie an der Spitze Persönlichkeiten, die Lust haben, sich der wissenschaftlichen Konkurrenz zu stellen. Der Manager Wolfgang Herrmann und der Moderator Bernd Huber sind, bei allen Unterschie-den, solche Kämpfer. »Beide sind unermüdliche Reformer, sie haben den Willen – und den Mut –, es immer wieder zu probieren und dabei nicht nach-zulassen, auch wenn sie schon viel erreicht haben«, sagt Frank Ziegele. Er muss es wissen, er ist Professor für Wissenschaftsmanagement an der Hochschule Osnabrück. Doch ihre Erfolge verkaufen die beiden Münchner auf sehr unterschiedliche Weise.
Als an der TUM neulich ein neues Karrierever-fahren für Nachwuchswissenschaftler eingeführt wurde, der sogenannte Tenure-Track, mit dem sich Nachwuchsspitzenforscher für eine feste Stelle qualifizieren können, da feierte der TUM-Chef Herrmann das als akademische Sensation, als bun-desweit einmaliges Verfahren. Und Bernd Huber? Der hat sich geärgert: »Wir haben den Tenure-Track schon seit zehn Jahren«, sagt er und holt tief Luft, »ich habe das bloß nicht an die große Glocke gehängt.« Für ihn ist wichtig, dass der Erfolg nach innen wirkt. Für Wolfgang Herrmann dagegen ist es wichtig, dass es draußen jeder merkt.
Seit 18 Jahren steht der Naturwissenschaftler, der selbst über 700 Fachartikel veröffentlicht hat, an der Spitze der TUM. In der Zeit hat er aus einer regio-nalen Ingenieurhochschule eine technische Uni ge-macht, die in den Welt-Rankings ganz oben steht. Der 65-Jährige ist Chemiker und experimentiert gern. Alles, wofür die Uni heute steht, wurde von ihm angeschoben und gegen manchmal heftige Wider-stände durchgesetzt: der Exzellenzstatus, das Konzept unternehmerische Universität, das Fundraising, die Internationalisierung. Allein die Einnahmen aus For-schungsdrittmitteln wuchsen unter seinem Dirigat von 84 auf 280 Millionen Euro. Pausenlos muss er anbauen. Auf all das ist er stolz, und das möchte er zeigen. Herrmann liebt die Bühne, Erfolge verkauft er offensiv. Wenn er mit dem Botschafter von Singa-pur Wissenschaftskooperationen verabredet, bestellt er selbstverständlich die Presse hinzu.
Seinem Kollegen Bernd Huber ist das »zu viel Bohei«. Auf den Webseiten der LMU ist von diesem Präsidenten nicht einmal ein Lebenslauf zu finden. Herrmann hingegen wird von seinem 15-köpfigen Corporate Communications Office seitenlang für seine Leistungen und Reformen gepriesen. Huber dagegen ist eher scheu. Selten tritt er bei Veranstal-tungen auf, zu den großen Wortführern im Wissen-schaftsbetrieb gehört er nicht. »Die Wissenschaftler sollen glänzen, nicht der Präsident«, ist sein Credo.
Der 53-jährige Finanzwissenschaftler, der über Staatsverschuldung promoviert hat, möchte mehr die Professorenschaft nach innen überzeugen als die Öffentlichkeit. Er agiert eher im Hintergrund und versucht dort, Kompromisse zwischen den zuweilen streit-baren Gelehrten auszuloten. Die Manager-Attitüde, mit welcher der TUM-Chef Herrmann oft auftritt, käme an einer klassi-schen Volluniversität wie der LMU mit ihren 150 Studien-fächern gar nicht gut an. Hier muss man auch mit widerspens-tigen Geisteswissenschaftlern zurechtkommen. Etwa mit dem bekannten Philosophen Julian Nida-Rümelin, der öffentlich immer wieder die schlechte Umsetzung der Studienreform auch an seiner Uni beklagt und sich traute, vor drei Jahren in einer Kampfkandidatur gegen Bernd Huber anzutreten. Die hat er dann haushoch verloren.
Denn Huber mag nach au-ßen eher unscheinbar daher-kommen, nach innen aber hat er es verstanden, die Reihen hinter sich zu schließen. Er hat – und das ist alles andere als selbstverständ-lich – die mächtigen Dekane auf seiner Seite. Die Erfolge in der Exzellenzinitiative haben ihn fast un-angreifbar gemacht. Wenn Bernd Huber über sein Führungsverständnis spricht, fallen Worte wie »in-tegrativ«, »konsensorientiert«, »Akzeptanz schaffen«,
»viel kommunizieren«. Das klingt, als ob er nieman-dem auf die Füße treten wolle. Doch manchmal muss er genau das tun. Seit einiger Zeit läuft an der LMU ein Programm, nach dem nur noch jede zwei-te Professur automatisch so besetzt wird bisher. Die andere Hälfte wird neu ausgeschrieben, um zu-kunftsorientierte Schwerpunkte zu setzen und die Qualität zu verbessern. »Da gibt es einige Konflikte durchzustehen«, konstatiert Huber.
Er ist, anders als sein Name nahelegt, nicht aus Bayern, sondern aus Wuppertal. Er fühlt sich im aka-demischen Milieu am wohlsten. Mit den manchmal krachledernen Bayern fremdelt er bis heute. Zum Starkbieranstich auf dem Nockherberg, einem gesell-
schaftlichen Höhepunkt im Frei-staat, kommt er im Anzug und nicht wie alle anderen im Trach-tenjanker. Er geht auch früh heim. Hier im Zentrum der bayerischen Folklore wird der Unterschied zwischen Herrmann und Huber vielleicht am deut-lichsten: Herrmann, bayerisch bis in die Schnurrbartspitzen, be-herrscht die Klaviatur von volks-nah bis forschungsexzellent, er ist leutselig und regierungsnah – ohne sich anzubiedern. »Alle Menschen wertschätzen, egal, ob in der Werkstatt oder im Hörsaal, auch das ist Führung«, sagt er. Er lobt den Millionenspender eben-so wie den Pförtner, der das Geld entgegengenommen hat. In ei-nigen Jahren könnte es für die TUM schwierig werden, diesen umgänglichen bayerischen Son-nenkönig zu ersetzen.
Welcher Führungsstil ist nun der erfolgverspre-chendere? »Es gibt nicht den einen richtigen«, sagt Frank Ziegele, der Professor für Wissenschaftsmana-gement, »die Führung muss zur Hochschule passen.« In einem sich selbst organisierenden System wie einer Universität wollen viele kritische und intelligente Menschen mitgenommen und eingebunden sein.
Anzahl der Studierenden:
32 500Anzahl der Professoren:
507Höhe der Drittmittel:
280 Mio. EuroPlatzierung in den weltweit wichtigsten Rankings:50 (Shanghai Academic), 105 (Times Higher Education)
Promotionen pro Jahr:
911
TU München
Anzahl der Studierenden:
48 938Anzahl der Professoren:
737Höhe der Drittmittel:
114,7 Mio. EuroPlatzierung in den weltweit wichtigsten Rankings:61 (Shanghai Academic), 48 (Times Higher Education)
Promotionen pro Jahr:
1205
Uni München
Bernd Huber, Präsident der Uni München, drängt sich nicht nach vorn, er vermittelt mehr nach innen und kümmert sich auch um alltägliche Dinge
Wolfgang Herrmann, Präsident der TU München, sieht sich als Manager einer
unternehmerischen Uni. Kritiker nennen ihn auch
gern mal Sonnenkönig
Illu
stra
tio
n:
Julia
n R
en
tzsc
h f
ür
DIE
ZE
IT/
ww
w.ju
lian
ren
tzsc
h.d
e

Schreiben »›Am Abend ist mit Dunkelheit zu rechnen‹, kommentierte mein ehemali-ger Chef meine ersten Berichtseiten. Was er damit sagen wollte? Alles, was ich geschrieben hatte, waren Banalitäten. Als Berater braucht man auch ein Talent für Sprache und die Lust, zu formulieren, zu präsentieren, zu kommunizieren. Mündlich – und
vor allem auch schriftlich: Gut die Hälfte der Arbeitszeit verbringen wir mit Schreiben. Ob Briefe, E-Mails, Analysen oder Berichte, immer kommt es darauf an,
Tatsachen auf den Punkt zu bringen und zugleich ein Gespür für Nuancen zu bewahren. Dafür müssen wir unsere Kunden gut kennen, um zu wissen: Was ist das für ein Mensch, wie viel verträgt er, wie direkt darf man Kritik äußern? Welche Sprache spricht er selbst, wie viele Fremdwörter benutzt er? Nur wer überzeugt, kann etwas bewegen. Am Anfang ist jedes Blatt furchterregend leer. Unsere Herausforderung ist es, das Papier mit den richtigen Worten zu füllen, scheinbar klare Fakten zu interpretieren und daraus abzuleiten, was zu tun ist. Zum Beispiel: Wenn es dunkel wird – dann mach das Licht an!«
Timo Renz, 45, Partner und Mitglied der Geschäftsführung der Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner in München
86
2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
nur durch neue Kredite finanziert werden. Aber der Widerstand gegen Kürzungen ist groß. Krstić meint, nur als Experte und nicht als Politiker kann eine neue Finanzpolitik gemacht werden. »Ich muss keine Inte-ressen bedienen, kann unabhängig sein, es gibt keinen politischen Einfluss auf mich. Das erlaubt mir, fair zu kürzen.« In die Parteipolitik will er sich deshalb nicht einmischen.
Aber Politik ohne Interessen, geht das überhaupt? Hinter seiner Nominierung steht der mächtigste Politiker Serbiens, Aleksandar Vučić, stellvertretender Ministerpräsident. Viele sagen, Krstić muss das durch-setzen, was schon lange feststeht und ökonomisch auf der Hand liegt. Mit ihm könne man die Kürzungen aber besser verkaufen. Vučić braucht jetzt einen Durchbruch, um Serbien vor dem Kollaps zu retten. Der einst rechtsnationale Politiker konnte im letzten Jahr erstaunliche Erfolge vorweisen, die vor allem
einer pragmatischen Politik ge-schuldet waren. Jetzt hat er die Wirtschaft zum wichtigsten Thema erklärt und nominiert einen Serben mit internationalen Erfahrungen, einen unbestritten guten Analytiker und vor allem eine neutrale Gestalt. Wenn der die längst geplanten Einschnitte im öffentlichen Sektor vorschlägt oder die Renten deckeln will, wer soll ihm da noch widersprechen?
Es ist nicht schwer zu erken-nen, dass der junge Krstić eine taktische Wahl ist, mit der Vučić in mehrfacher Hinsicht einen Scoop gelandet hat: Er frischt das Image der Regierung auf, holt sich jemanden, den die Finanz-märkte mögen; der obendrein als Rückkehrer das Signal an andere Serben gibt, auch wieder in ihre Heimat zu kommen. Und er ist die sachliche Stimme, die eine unpopuläre Politik vertreten kann. Auch das ist gelegentlich ein Grund, Unternehmensbera-ter zu engagieren: Man holt sich von außen die vermeintlich ob-jektive Beratung, um längst be-schlossene Maßnahmen rechtfer-tigen zu können.
Krstić ist der perfekte Läufer auf dem Schachbrett der serbischen Regierung. Er weiß, dass er politisch von Vučić abhängt, aber er nimmt für sich in Anspruch, dass er jetzt erst mal selbst die finanzpolitischen Konzepte erarbeitet. Seine Feuertaufe ist schon in zwei Wochen, dann muss der Budgetplan fürs nächste Jahr vorgestellt werden. Für die Sanierung des Haushaltes hat er sich von McKin-sey noch fünf serbische Kollegen ins Ministerium geholt; ein enger Zirkel, der weiß, wie man die Lage schnell analysiert und Ergebnisse so vermittelt, dass sie umgesetzt werden. Nur, jetzt ist Krstić Teil der Macht, und er ahnt, dass es Widerstände geben wird, vor allem Misstrauen gegenüber einem jungen Seiten-einsteiger wie ihm. Aber bei allen taktischen Überle-gungen, warum er jetzt da sitzt, wo er sitzt, wünschen sich die meisten Serben, dass er Erfolg hat. Haupt-sache, es gelingt endlich ein Durchbruch, der Serbien vor der Pleite rettet und dem Land eine wirtschaftliche Perspektive gibt.
Für einen 29-Jährigen ist das eine ganz schön heikle Aufgabe, als Berater hätte er es sicherlich etwas leichter. »Ich will, dass meine Kinder später mal so aufwachsen können, wie ich es konnte«, sagt er über seine Motivation und meint das ganz persönlich. Er wolle gerne in Serbien bleiben, »das ist mein Land, ich habe nur eins«. Einer seiner Vorgänger als Finanz-minister wurde auch schon mal von McKinsey geholt, mit 30 Jahren. Er hatte damals die erhoffte wirt-
schaftliche Wende nicht geschafft. Vielleicht ist jetzt die Zeit dafür. Der mächtige Vučić will den Erfolg, gibt Krstić Rückendeckung. Wenn seine Vorschläge politisch nicht durchsetzbar sein sollten, das weiß Krstić auch, wird er das erste politische Opfer sein. Aber einen Misserfolg wird ihm niemand persönlich anlasten, dafür ist er zu kurz im Geschäft. Auch wenn er jetzt als Minister nur beschämende 1000 Euro ver-dient, werden ihm mit diesem Karriereschritt danach die Türen in Serbien und anderswo offenstehen. Schafft er es, wäre er, Lazar, der Retter.
BERUFCHANCEN-SPEZIAL: Wirtschaftsprüfer & Unternehmensberater
Vom Mecki zum MinisterSeit einem Monat ist Lazar Krstić serbischer Finanzminister. Der 29-Jährige soll das Land vor dem Bankrott retten VON JUSTUS VON DANIELS
In seinem Ministerbüro in Belgrad wirkt Lazar Krstić noch wie sein eigener Gast. Bei der Begrüßung stößt er aus Verse-hen gegen eine Kommode, deren Tür daraufhin aufgeht. Er entschuldigt sich und lacht, weil nichts drin ist, auch die Bücherschränke sind leer. Ihm würde es
wahrscheinlich reichen, wenn er mit Laptop und Telefon in einem schlichten Raum sein Lager aufschlagen könnte, ganz ohne Ministermöbel.
Mehr als drei Koffer brauchte der 29-Jährige nicht, um von New York nach Belgrad zu ziehen. Sein Leben sah bisher so aus, wie man es sich bei jungen Unternehmensberatern vorstellt. Er reiste von Projekt zu Projekt, in New York teilte er sich eine fertig eingerichtete Wohnung mit einem Mit-bewohner, der in der Finanzbranche arbeitet. Ein Leben ohne jeden Ballast. Lazar Krstić war für McKinsey vor allem in Europa unterwegs, beriet Ölfirmen und Banken. Auch in Serbien, seiner Hei-mat, war er schon als »Mecki«, also für McKinsey. Das erste Mal während eines Praktikums, da war er 23 Jahre alt. Ein paar Wochen ist sein Umzug nun her, diesmal soll er Serbien vor dem Bankrott retten, als jüngster Finanzminister aller Zeiten.
Sein Alter, darüber reden alle. Was ist in eine Regierung gefahren, so einen jungen Mann in einer schweren Krise zum Finanzminister zu ma-chen, ihm das mächtigste Amt im Kabinett zu geben? Die Serben hörten seinen Namen vor gut einem Monat zum ersten Mal, sprechen ihn aber schon ziemlich respektvoll aus. Denn in den Me-dien wird die Geschichte eines Wunderkindes ver-breitet, eines Mathegenies, eines Talents, das in Amerika ausgebildet wurde und nun zurückkehrt, um das Land zu retten. Auch Krstić erzählt es gerne so. Er, das Einzelkind aus einfachen Verhält-nissen, gewann erst in seiner Heimatstadt Nis, später landesweit alle Wettbewerbe in Mathematik. »Klar, ich war als Schüler ziemlich introvertiert«, sagt er. Nach seiner Schulzeit bewarb er sich in den USA, wurde an der berühmten Yale University mit einem Stipendium genommen und war auch dort
Jahrgangsbester, studierte neben Mathematik noch Politik und Ökonomie in einem Begabtenpro-gramm. »In Yale habe ich gelernt, mich zu öffnen, denn in den USA war ich fremd. Für so jemanden wie mich war das eine ziemliche Herausforde-rung.« Mit 23 fing er bei McKinsey an. Für Krstić ging es immer schnell bergauf. »Ich war an vielen Stellen der Jüngste und habe bisher immer zuge-sagt, wenn es weiterging. Bisher hat es funktio-niert.« Warum jetzt nicht Minister?
Der Blick von außen ist das, was Unterneh-mensberater ausmacht. Sie haben keine Verant-wortung, müssen keine Interessen bedienen. Sie machen Vorschläge für eine Sanierung und ver-schwinden dann wieder. Serbien ist gerade ein echter Sanierungsfall, denn das Land steht kurz vor der Pleite. Doch Krstić sagt: »Ich bin hier nicht als Berater!« Die Unterscheidung ist ihm sehr wichtig. »Es ist keine Beratung, sondern eine echte Aufgabe. Der Unterschied zur Beratung ist: Hier trage ich die volle Verantwortung für meine Entscheidungen und muss sie danach vertreten können.«
Krstić ist eine taktische Wahl, ein Scoop in mehrfacher Hinsicht
Doch dass er von außen kommt und keine Er-fahrung in der serbischen Politik hat, ist sein großer Vorteil, sagen selbst Kritiker. Denn es gibt in Serbien keinen Politiker, der nicht in irgendetwas verstrickt ist, korrupt oder von mächtigen Interessen abhängig. Krstić kann frei von Bindungen handeln, er ist hier ein unbe-schriebenes Blatt. Das macht es für Interessen-vertreter schwer, ihn einzuschätzen.
Dass er nun eine öffentliche Person ist, »das passt eigentlich nicht unbedingt zu mir«, sagt er. Schon jetzt ist er mit seinem gestutzten Vollbart auf allen großen Zeitungen und Magazinen zu sehen. Er sieht wirklich noch ziemlich jung aus. Mit dem Bart macht er sich etwas älter, um reifer zu wirken. Eigentlich hatte er mal überlegt, nach ein paar Jahren bei McKinsey in den USA zu pro-
movieren, theoretische Mathematik und Politik, eine akademische Karriere, so was. Dann kam der Anruf, der ihn doch ziemlich überrascht hat. Als sich das Büro des stellvertretenden Ministerpräsi-denten auf seinem amerikanischen Handy mel-dete, war er gerade für ein Projekt in Europa. Ob er denn eine Idee hätte, wie man die Finanz-probleme Serbiens lösen könne, wurde er gefragt. Am Ende des Gesprächs bot man ihm den Posten des Finanzministers an.
Er, der smarte Berater, brauchte jetzt selbst Rat: Kann ich das, will ich das? Er hatte die Brücken nach Serbien nie abgebrochen, aber kennt er sich in der Politik gut genug aus? Er rief seinen besten Freund aus Schulzeiten in seiner Heimat Nis an, er fragte seine Eltern, seine Freundin, die er in Berlin kennengelernt hat und die in London lebt. Auch seinen deutschen WG-Mitbewohner aus New York rief er an. Der sagte: »Alles, was du bisher gemacht hast, hat funktioniert. Go for it.« Mach es, das rieten ihm zum Schluss alle. Krstić hat sich, wie er sagt, auch in Selbstgesprächen gefragt, ob er das kann und, vor allem, ob er auch genug Unterstützung von der Regierung bekommt.
Warum hat die Regierung gerade ihn, einen Berater ohne jede politische Erfahrung, gewählt? »Das habe ich den stellvertretenden Ministerprä-sidenten auch gefragt.« Der habe ihm gesagt, alles, was Krstić gemacht habe, sei bisher erfolgreich gewesen. Und in Serbien sei er als Talent ja auch bekannt gewesen, fügt Krstić selbstbewusst hinzu. Es waren jedoch wohl nicht seine Mathematik-preise ausschlaggebend, sondern eher die Bezie-hungen der Regierung zu McKinsey.
Krstić selbst hat während der Finanzkrise mit einem kleinen Team schon mal die Regierung be-raten, das Unternehmen unterhält gute Kontakte zu Serbien. Und die serbische Regierung benötigte dringend ein unverbrauchtes Gesicht: kein Finanz-minister konnte die längst überfälligen Reformen durchsetzen. In Serbien sind zwei Drittel aller Ar-beitnehmer beim Staat angestellt, die Rentenkassen belasten den Haushalt enorm, das Staatsdefizit kann
Wieso wechselt ein McKinsey-Mitarbeiter in die Politik? Wozu brauchen Wirtschaftsprüfer Golfschläger im Büro? Und was sollten Berater können? Ein Spezial übers Schreiben, Reden, Prüfen, Aussteigen und Spielen
Was ist Ihr Job?Womit Berater sich die
meiste Zeit beschäftigen
1984 wird er in Serbiens zweitgrößter Stadt Nis gebo-ren. Als Schüler gewinnt er sämtliche Wettbewerbe in Mathematik und später auch eine Medaille bei der Mathematikolympiade
2003 erhält er ein Stipendium für die Yale University, die er als Jahr-gangsbester abschließt. Im Begabtenprogramm studiert er neben Mathematik noch Ökonomie und Politik. Mit 24 Jahren wird er Unternehmensberater bei McKinsey in New York
2013 bietet die serbische Regierung dem parteilosen Krstić das Amt des Finanz-ministers an. Der 29-Jährige ist seit dem 2. September Finanzminister und jüngstes Mitglied im Kabinett
Lazar Krstić
Reden »Momentan bin ich in Botswana, wo ich mit Kollegen ein Unternehmen aus der Industriegüterbranche berate. Das ist nicht ungewöhnlich, wir reisen viel und arbeiten beim Kunden vor Ort. Auch unsere Aufgaben variieren je nach Anforderungen des Projekts. Jeder Tag ist anders. Gestern saß ich mit meinen Kollegen im Teamraum, wir haben über Daten und Zahlen gebrütet und das
weitere Vorgehen diskutiert. Heute habe ich ein Meeting nach dem anderen, führe Interviews mit den Mitarbeitern, diskutiere Fakten und bespreche die
nächsten Schritte. Zusammen arbeiten und miteinander reden – das ist für unseren Job besonders wichtig. Als ich vor drei Jahren als Praktikantin bei der Boston Consulting Group war, arbeitete ich mit Kollegen an einem Projekt im Bereich Windkraft und stellte fest, dass sich die Abteilungen des Kunden in Indien und in Deutschland nicht genügend abstimmten. Darauf führten wir wöchentliche Konferenzen ein, um Probleme zu besprechen und Lösungen zu finden, was die Ergebnisse deutlich verbesserte. Diese Erfahrung war der Auslöser für meine Entscheidung, hier zu arbeiten: Ich kann etwas verändern und einen wirklichen Beitrag leisten.«
Hanna Schumacher, 27, Associate bei der Boston Consulting Group
Aufgezeichnet von INES SCHIPPERGES
Lazar Krstić kam aus New York zurück, um jüngstes Kabinettsmitglied in Belgrad zu werden
Foto
s: E
astw
ay;
pri
vat
(2);
ZE
IT-G
rafi
k

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
87 BERUFCHANCEN-SPEZIAL: Wirtschaftsprüfer & Unternehmensberater
Prüfen»Vielleicht überrascht es: Eine derwichtigsten Fähigkeiten für diesen Beruf ist Kreativität. Man muss auch malungewöhnliche Wege finden und in andere Richtungen denken können.Unser Job erinnert an Detektivarbeit. 80 Prozent des Tages überprüfe ich Dinge. Zunächst gewinne ich einen Überblick über die Buchhaltung, über Kontrollsysteme und Handbücher. Ich
spüre Unklarheiten auf, suche Fehler, erkenne Risiken. Im persönlichen Gespräch mit den Mitarbeitern forsche ich dann gezielt nach. So stelle ich fest, wo
alles in Ordnung ist und wo Gefahren bestehen. Oft spielen wir Handlungen nach und prüfen auf diese Weise, ob interne Regeln befolgt werden. Dadurch entdeckte ich neulich, dass in einer Firma Rechnungen über höhere Beträge bezahlt wurden, auch wenn nur ein ein-ziger Mitarbeiter sie freigab. Das wider-spricht dem Vieraugenprinzip. Wichtige und kritische Entscheidungen dürfen nie von einer Person allein getroffen werden. Die Unternehmensleitung war mir sehr dankbar für diesen Hinweis – ohne dieses Prinzip ist es leicht, mit Betrügereien davonzukommen.«
Sven Drasler, 33, Wirtschaftsprüfer bei PricewaterhouseCoopers
Aufgezeichnet von INES SCHIPPERGES
Sie können auch andersMit Bürogolf-Turnieren wollen Wirtschaftsprüfer ihr Image aufbessern und um mehr Nachwuchs werben VON CONSTANTIN WISSMANN
Bevor er zum ersten Schlag an-setzt, schaut Dirk Beil noch ein-mal auf seine Finger, als wolle er fragen, ob die so richtig auf-gestellt sind. »Ich habe noch nie Golf gespielt«, sagt er. Das ver-wundert ein wenig. Denn Beil
ist als Partner bei einer Münsteraner Wirtschafts-prüfungsgesellschaft dafür zuständig, die Ge-schäfte von Unternehmen zu kontrollieren. Und die besten Geschäfte, sagt man, werden ja auf dem Golfplatz gemacht.
Aber auch bei seinem ersten Spiel steht Beil nicht auf dem saftigen Grün einer schönen An-lage im Münsterland, sondern auf einem karier-ten Teppich in der dritten Etage eines Hotels am Stadtrand von Münster. Das »Loch« ist eine Art Aschenbecher auf dem Boden. Dahinein soll Beil den Ball treiben, durch einen Türrahmen hindurch, an mehreren Konferenztischen vorbei.
Bürogolf nennt sich das Ganze. Man kennt es aus US-amerikanischen Filmen, wenn Manager selbst im Büro an ihrer Putt-Technik arbeiten. Daraus hat sich in den USA so etwas wie eine Trendsportart entwickelt. Auch in der Frankfur-ter Bankenszene wird es angeblich viel gespielt. Und es ist das Geschäftsmodell einer Eventfirma, die damit ein wenig Abwechslung in den Alltag von Unternehmen bringen will.
Beim lustigen Spielchen sollen die Teilneh-mer »gemeinsam Netzwerken«, wie es auf der Webseite steht, ohne die langweiligen Standards Fachvortrag, Stehtisch und Schnittchen. Statt-dessen gibt es an diesem Septembertag in Müns-ter bei der deutschen Bürogolf-Meisterschaft Currywurst und vegetarische Paella. Dazu jede Menge Bier und Wein. Die Stimmung unter den etwa 100 hier versammelten Bürogolfern ist daher schon prächtig, bevor einer von ihnen den ersten Ball versenkt hat.
Dirk Beil aber ist nicht nur zum Spaß hier. Er spielt, sozusagen, für die Zukunft seiner Zunft.
Die deutschen Wirtschaftsprüfer machen sich Sorgen um den Nachwuchs. Sie befürchten, dass sie unter dem allerorts prognostizierten Fachkräftemangel besonders leiden werden. Schon jetzt sind fast die Hälfte von ihnen 50 Jah-re und älter. Im vergangenen Jahr sank erstmals die Zahl der Kandidaten für das Examen zum Wirtschaftsprüfer. 785 nahmen teil, zehn Pro-zent weniger als zuvor. Diesem Trend wollen die Wirtschaftsprüfer entgegenwirken, zum Beispiel indem einige Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ihre Räume zu Golfplätzen ummodeln. Natür-lich nur zeitweise.
Auch Beils Firma Dr. Schumacher & Partner macht mit. Hoffentlich dann mit etwas mehr Fantasie, als bei der Meisterschaft im Ho-tel zu sehen ist. Hier geht es vor allem um Werbung, Wer-bung für Firmen, die sich an jedem »Loch« präsentieren, hübsche Hostessen erklären den Golfern, was sie dort zu tun haben. Bei der Münster-schen Zeitung etwa muss man um mehrere Zeitungsstapel herumspielen. Nun ja.
Die Teilnehmer, allesamt im casual dress, lassen sich jo-vial auf die Sache ein, feuern sich gegenseitig an, auch wenn einige ihren sportli-chen Ehrgeiz nur schwer ver-bergen können. Zum »Netz-werken« allerdings bleibt kaum Zeit bei der manchmal arg komplizierten Suche nach dem nächsten Loch. Beil mag das egal sein, er nutzt das hier als Trai-ning für die Veranstaltung im eigenen Haus. Im Oktober findet dort ein »Qualifikationsturnier zur Deutschen Schüler- und Studentenmeister-schaft im Bürogolf« statt.
Das mag alles ein wenig merkwürdig anmu-ten, ist aber Bestandteil einer groß angelegten Kampagne des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW). »Gerade junge Menschen haben oft kei-ne klare Vorstellung von unserem Tätigkeitsspek-trum«, sagt IDW-Vorstand Manfred Hamannt. Teilweise liegt das in der Natur der Sache. Wirt-schaftsprüfer sind zur Verschwiegenheit gegen-über ihren Klienten verpflichtet und können des-wegen nur vage über ihre Arbeit reden. Mit der Folge, dass die meisten Menschen sie wenig wahrnehmen oder sogar negativ. Denn wenn Wirtschaftsprüfer Fehler machen, handelt es sich, schlagzeilenwirksam, oft um schwindelerre-gende Summen. Während der Finanzkrise etwa wurde die Bilanzsumme der vom Steuerzahler geretteten Bank Hypo Real Estate um ein Siebtel zu hoch angesetzt. Die bestellten Abschlussprü-fer des renommierten Hauses Pricewaterhouse-Coopers übersahen das, in der Presse war vom »55-Milliarden-Rechenfehler« die Rede.
Hinzu kommt das veränderte BWL-Studium, aus dem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften traditionell den Großteil ihres Nachwuchses ge-winnen. Im früheren Diplomstudiengang wäre
noch jeder im Grundstudium an das Fach heran-geführt worden, ehe er sich im Hauptstudium dann ganz darauf hätte spezialisieren können, sagt Hamannt. Für diese Einführungskurse fehle im heutigen BWL Bachelor meist die Zeit. Viele Studenten kämen dann gar nicht erst auf die Idee, einen der Masterstudiengänge für Wirt-schaftsprüfer zu beginnen.
Vor allem aber geht es Hamannt und seinen Kollegen um eine Imagekorrektur. Viele stellen sich unter Wirtschaftsprüfern unscheinbare Her-ren in Anzügen vor, die den ganzen Tag im stil-len Kämmerlein auf Zahlenkolonnen starren. Klar, auf Techno-Raves träfe man auch in der Realität wohl eher selten auf sie. Doch mit der Bürogolf-Aktion wollen sie zeigen, dass selbst Wirtschaftsprüfer nicht immer alles ganz so ernst nehmen. Gleichzeitig will das IDW so dafür sorgen, dass sich doch mehr Studenten für den Schwerpunkt entscheiden. Den Gewinner aller Turniere belohnt der Verband mit einem sehr konkreten Preis: Er oder sie bekommt ein kom-plettes Wirtschaftsstudium bezahlt.
»Das lohnt sich«, sagt Beil, kurz nachdem er auf dem Parkplatz des Hotels viermal vergeblich versucht hat, den Golfball durch eine offene Autofensterscheibe zu chippen. In seiner Spiel-gruppe wird immer deutlicher, dass einige schon öfter einen Golfschläger in der Hand gehalten haben, und so gerät Beil auf dem Parcours bald ins Hintertreffen. Doch der 43-jährige zweifache Vater trägt es mit Humor. »Ich kann meine im-mense Kraft eben nicht immer kontrollieren«, sagt der eher schmächtige Mann, als der Ball ein-mal weit übers Ziel hinausschießt.
Die Sache mit dem Bürogolf gefällt ihm. Heu-te und generell. »Ein Wirtschaftsprüfer wirkt gern im Hintergrund, ich auch, und Selbstdarstellung ist nicht wirklich unser Ding. Aber wir müssen uns einfach besser präsentieren«, sagt er. »Der Beruf bietet so viel mehr, als die Leute denken.« Die klassische Prüfung – Jahresabschlüsse zu be-gutachten und dann mit dem Bestätigungs-vermerk (»Testat«) amtlich zu machen – sei eben nur ein Teil davon. Ohnehin hätte er es meist mit nicht börsennotierten Unternehmen zu tun, die sich zum Teil freiwillig prüfen lassen, etwa um für Investoren interessant zu werden. Dort würde er auch als Berater agieren. Da er mit Firmen aus allen möglichen Branchen zusammenarbeite, sei der Beruf »alles andere als langweilig«.
Keine Frage, anstrengend ist er auch. Allein bis man sich Wirtschaftsprüfer nennen darf, ver-geht viel Zeit. Dirk Beil selbst hat nach dem Studium direkt bei der Firma angefangen, wo er heute Partner ist, sein Examen aber erst nach
zehn Jahren abgelegt. Durch-aus normal in der Branche, das Examen gilt als eines der schwierigsten überhaupt. Als Assistent kümmert man sich um Zuarbeiten. Nach zwei bis vier Jahren kann man sich Senior nennen und Teilpro-jekte leiten. Erst Partner zeichnen für das Testat ver-antwortlich. Gerade in der busy season – so nennen Wirt-schaftsprüfer die Zeit von November bis April, weil für viele Unternehmen im De-zember der Jahresabschluss-bericht fällig ist – sind Zwölf-stundentage nichts Unge-wöhnliches.
Sollten die Wirtschafts-prüfer nicht vielleicht besser ihre Anforderungen etwas herunterschrauben, um für junge Menschen attraktiver
zu werden, statt Golfturniere zu veranstalten? Dirk Beil schüttelt energisch den Kopf. »Das
wäre der falsche Weg. Unsere Kunden und auch die Öffentlichkeit müssen ja unseren Fähigkeiten absolut vertrauen können. Aber wir müssen uns öffnen, damit vielleicht auch Menschen aus an-deren Bereichen zu uns finden. IT-Experten oder Ingenieure etwa kann unsere Branche sehr gut gebrauchen«, sagt Beil, bevor er sich auf den Bo-den legt, um zu prüfen, wie er den Ball am besten durch einen Kartontunnel bringt. Trotzdem lan-det der Ball beim ersten Schlag an der Wand.
Am Ende des Turniers hat Beil für die neun Löcher 34 Schläge benötigt: »Nicht schlecht, aber ausbaufähig.« So ähnlich könnte man über die Sache mit dem Bürogolf urteilen.
Im Hotel wird viel gelacht, Turnschuhträger aus der Skateboardfirma schäkern mit Manage-mentdamen im grünen Business-Kostüm. Doch umso länger sich das Ganze hinzieht, umso stär-ker wird der Verdacht, dass das auch an den vie-len Wein- und Bierflaschen liegen könnte, welche die Hostessen immer weiter großzügig verteilen. Der Wow-Effekt, drinnen Golf zu spielen, scheint doch recht schnell zu verblassen. Ob man damit junge Menschen für einen so ernsthaften Beruf begeistern kann, darf bezweifelt werden. Es sei denn, sie träfen dabei auf einen, der seine Arbeit aufrichtig gern macht und so auch darü-ber erzählt. Auf einen wie Dirk Beil.
»Wir wirken gern im Hintergrund, Selbstdarstellung ist nicht unser Ding. Aber wir müssen uns besser präsentieren«
Statt Jahresabschlüssen prüft Dirk Beil in Münster den Abstand zum nächsten Loch
Was ist Ihr Job?Womit Berater sich die
meiste Zeit beschäftigen
Foto
s: M
aike
Bra
utm
eie
r fü
r D
IE Z
EIT
/w
ww
.mai
ke-b
rau
tme
ier.
com
; p
riva
t (r
.);
ZE
IT-G
rafi
k

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
97
3919. SEPTEMBER 2013
Ihre Zuschriften erreichen uns am schnellsten unter der Mail-Adresse: [email protected]
Zuschriften an:Aus No: Jedes Mal, wenn wir einkaufen, geben wir ein politisches Statement ab. Den Menschen scheint generell das Gespür für faule Geschäfte abhandengekommen zu sein.
Zeit der Leser S. 98
von Markus Jostock
»Die unhandlichste Zeitung der Welt« nannte ZEIT-Leser E. Wagner unser Blatt und emp-fahl, fortan Sackmesser zum Aufschneiden zu verteilen. Darauhin regt sich Protest:
Bitte hören Sie nicht auf den Leser aus der Schweiz! Ich liebe die ZEIT gerade deswegen, weil man ganz einfach ohne Schere oder Schwert eine besonders interessante Seite he-rausreißen und aufheben kann. Bei den klei-neren Formaten geht das nicht. Außerdem finde ich gut, dass die Artikel gewöhnlich nicht auf eine zweite Seite umlaufen.Sie werden es mir nicht glauben, aber ich lese die ZEIT seit meiner Pubertät regelmäßig und hoffe, das weiterhin tun zu können. So schöne Beiträge wie von Robert Neumann gibt es heute leider selten.Klemens Borkowski, per E-Mail
Bitte lassen Sie das Format der ZEIT, wie es ist. Ich komme bestens damit zurecht. Ich falte die Zeitung seitwärts und zur Mitte, je nachdem, und es passt, egal, ob ich zu Hause oder im Café lese.Anke Hieke, Passau
Eine weitere Handreichung für Leser: Die ZEITwird handlich, wenn man sie gleich nach der Zustellung mit einem Büroheftgerät klammert. Beilagen sind vorher zu entnehmen. Die zehn Klammern sollten mindestens sechs Millime-ter tief gehen und bei der Mittelfaltung einen größeren Abstand lassen. Ich empfehle, die umgebogenen Klammerspitzen mit dem Ham-mer nachzuklopfen. Danach ist die ZEIT als Gesamtausgabe in der Reihenfolge der Seiten verfügbar und kann auch halbiert gefaltet im Bett oder im kleinsten Gemach des Hauses gelesen werden. Das macht so seit 46 Jahren:Christian G. Schnabel, jetzt in Lüneburg
Falten, reißen,klammernLeserbrief von E. WagnerZEIT NR. 39
»... und verbraucht (als Diesel) auch bei flotter Fahrt nur acht bis zehn Liter.«Herr Joffe lebt in (s)einer Autowelt, die vor 30 Jahren vielleicht noch normal war. Spritver-bräuche in diesen Größenordnungen sind antiquiert und dürfen nicht noch Anlass zu Lobeshymnen sein. Im Übrigen führen sie auch die Verbrauchsangabe von 5,3 Liter ad absurdum. Man könnte diese Angabe auch Betrug nennen, und das sollte in der Tat Gegenstand eines »Autotests« sein.Joachim Amann, Bad Schönborn-
Langenbrücken
AntiquierterSpritverbrauchVon A nach BZEIT NR. 39
Der Artikel greift zu Recht die Frage auf, wa-rum Jugendliche unter 18 nicht wählen dür-fen, alte Menschen aber selbst dann, wenn sie dement sind. Das Mindestalter für das aktive Wahlrecht ist schon deshalb nicht vertretbar, weil junge Menschen ab 14 strafmündig und religionsmündig sind. Der Staat traut ihnen also Kenntnis der Gesetze zu, sonst könnten sie nicht strafmündig sein. Und er traut ihnen eine grundlegende Entscheidung über Werte und den eigenen Lebensweg zu, sonst könn-ten sie nicht religionsmündig sein. Wenn dieses Zutrauen gerechtfertigt ist, kann man schwer begründen, warum sie nicht wählen dürfen. In der evangelischen Kirche wird zu-nehmend Gemeindegliedern, die konfirmiert sind, also schon 14-Jährigen, das aktive Wahl-recht in ihrer Kirchengemeinde zugestanden. Was selbst die eher konservativen Kirchenver-antwortlichen vormachen, sollte unser Staat nicht verweigern.Ulrich Finckh, Bremen
Was der Staat den Jungen zutraut»Auch Jugendliche wollen wählen!«ZEIT NR. 39
Der wahre PreisWolfgang Uchatius: »Soll ich wählen oder shoppen?« ZEIT NR. 39
Warum regen sich Leute eigentlich über Peer Steinbrücks Mittel-finger auf?Den Mittelfinger könnte man als »fuck you« oder »mir egal«
interpretieren. Und schon ist das Geschrei groß. Doch Steinbrück sagt weder »fuck you« noch »mir egal« zu Syrien, Griechenland oder sonstigen Pro-blemen. Er antwortet auf die Frage, was er von seinen vielen negativen Spitznamen hält, die durch Ausrutscher und Skandale entstanden sind. Und er hat recht. Ihn interessiert das ganze Theater um seine Ausrutscher und angeblichen
Skandale nicht. Er befasst sich mit Wichtigerem. Er macht Politik und lässt sich nicht von den Klatsch-Attacken seiner Gegner aus der Bahn werfen. So etwas beweist Stärke, die sicherlich auch etwas über seinen Politikstil aussagt. Er zeigt damit aber auch Menschlichkeit. Denn wer hat nicht schon einmal geflucht? Und zu guter Letzt: Wirkt das nicht sympathischer als die ewi-ge Raute der Kanzlerin?Leo Dammer, 15 Jahre, Mannheim
Mehr Empörung über Steinbrücks Stinkefinger als über die NSA-Affäre, die uns alle mehr oder
weniger betrifft. Des Deutschen Sorgen mag ver-stehen, wer will. Und die politischen Gegner stürzen sich sofort auf diese Steilvorlage und drü-cken ihr Entsetzen aus. Bevor sie in ihrer Empö-rung die Kontrolle über sich verlieren und sich wie die Aasgeier auf Steinbrück stürzen, sollten sie sich lieber auf Rücken-Udo oder Teppich-Dirk (Niebel) besinnen. Wenn man denn schon mal beim Erbsenzählen ist …Kurt Nickel, Goch
Nachdem Merkel mit ihrer Finger-Raute bereits
Steinbrücks Finger, Merkels RauteBernd Ulrich: »So schön, so hässlich« ZEIT NR. 39
Beilagenhinweis
Die heutige Ausgabe enthält Publikationen folgender Unternehmen, in der Gesamtauf-lage: Deutsche Fernsehlotterie gGmbH, 20149 Hamburg; sowie in Teilauflagen: Büchergilde Gutenberg Verlagsgesellschaft mbH, 60329 Frankfurt/Main; Peek & Cloppenburg KG, 40212 Düsseldorf; Peter Wagner Vertriebsgesellschaft m.b.H., A-4030 Linz; Plan International Deutsch-land e.V., 22305 Hamburg; Verlag Der Ta-gesspiegel GmbH, 10785 Berlin
Wolfgang Uchatius lässt eine Reihe von Möglich-keiten politischen Enga-gements einfach unter den Tisch fallen. Man denke nur an die aktive Mitgliedschaft in einer
Partei, Bürgerinitiative oder Nichtregierungsorga-nisation. Das Grundproblem scheint jedoch nicht zu sein, dass es nicht genügend Möglichkeiten der politi-schen Betätigung gebe. Problematisch ist vielmehr ein konsumistisches Bild vom Bürger, der entwe-der im Supermarkt oder an der Wahlurne nicht mehr tut, als unter fertigen Angeboten dasjenige auszuwählen, das den eigenen Wünschen am Nächsten kommt. Die von mir aufgeführten, von Herrn Uchatius ignorierten Möglichkeiten politi-scher Partizipation verlangen die tatsächliche ak-tive Mitgestaltung. Sie verlangen, dass man sich die Mühe macht, zwei Stunden draußen in der Kälte einen Infostand zu betreuen, statt nur die paar Hundert Meter zum Wahllokal und zurück zu gehen. Sie verlangen, dass man sich mit politi-schen Streitfragen intensiv genug befasst, um die eigene Meinung mit guten Argumenten vertreten zu können. Sie verlangen die Bereitschaft, ge-meinsam mit anderen die ganze »unsichtbare Drecksarbeit« zu erledigen, ohne die kaum etwas funktionieren würde, also zum Beispiel die Aus-einandersetzung mit der Bürokratie, um eine De-monstration genehmigt zu bekommen. Und warum sollte man das alles auf sich nehmen? Weil so das Konzept Demokratie mit Leben ge-füllt und die Unkenrufe, das Volk sei bloßes »Stimmvieh«, als haltlos entlarvt werden. Tobias Gehring, per E-Mail
Ich lebe in einer Landgemeinde bei Bonn. Fast alle hier sind Akademiker mit Haus und Garten, die Statussymbole heißen Einbauküche und Neu-
wagen, aber auch Ökohaus, Kamin, Photovoltaik. Größter Landbesitzer ist jedoch ein Obsthof, der vor allem Erdbeeren anbaut und regional ver-kauft. Die Hundertschaften der Erntearbeiter kann hier jeder sehen: gebückt auf dem Feld, von Februar bis Oktober. Das flache Gebäude, in dem sie kaserniert sind, kann man kilometerweit se-hen. Abends kaufen sie bei Aldi ein und laufen mit den schweren Tüten zu ihrer Kaserne zurück, drei Kilometer weit. Die Bürger in den Ökohäusern aber sprechen weder mit diesen neuen Mitbürgern, noch über sie – wir wissen nicht einmal, ob es Rumänen oder Bulga-ren sind. An den Kaffeetischen sprechen wir über Biobaumwolle, nicht über den Stundenlohn dieser Arbeiter. Kein Akademikerkind trägt hier Kleidung von KiK – aber alle Akademikerkinder essen Erd-beeren vom Obsthof. Keines lernt zu fragen, wo die Kinder der Erdbeerpflückerinnen sind.In Ihrem klugen Artikel fehlt mir deshalb: Die bittere Wahrheit, dass der Konsument wegschaut, je näher das von ihm verursachte Leid liegt.Dr. Gesine Jordan, Wachtberg
Welch trefflicher Wahl-Essay von Uchatius – auf dass der SPD-Wähler durch diese finale Hand-reichung etwas umzukrempeln vermag!Gert Paschelke, Sinntal
Soll ich wählen oder shoppen? Also, mal ganz ehr-lich und knapp: Shoppen ist wählen.Martina Ohrt, Ottersberg bei Bremen
Die Informationen über Firmen, das heißt deren Produktionsmethoden, Geschäftsfelder und Ge-winnverwendung, sind eigentlich für alle verfüg-bar, nur bewegen wir uns mit unserem Verhalten keinen Deut in die Richtung dieser Informatio-nen. Jedes Mal, wenn wir einkaufen, geben wir ein politisches Statement ab, man kann nicht müde werden, es noch einmal zu erläutern.
Dennoch: Sie mussten rund 1000 Euro Lehrgeld bei Vapiano lassen, um festzustellen, das dort etwas nicht stimmt? Den Menschen scheint gene-rell das Gespür für faule Geschäfte abhanden-gekommen zu sein. Wie kann man bei einer Möbelfirma einkaufen, die den letzten Produk-tionsprozess (Montage) auf den Kunden abwälzt?Meiner Meinung nach liegt unser Problem als Konsument darin, dass wir alles haben können, den (wahren) Preis aber nicht dafür bezahlen möch-ten. Gerne gebe ich einer guten Bedienung in meinem Lieblingsrestaurant ein Trinkgeld, be-zahle beim lokalen Werkzeughandel einen Mehr-preis für Beratung und Produktqualität und richte mich nach Öffnungszeiten und Angebot meiner Dorfläden. Geld kann nur einmal ausgegeben werden – wenn aber, dann mit einem guten Ge-fühl der Zufriedenheit!Markus Jostock, per E-Mail
Politikverweigerung liegt im Trend! Auch Sie – als politisch Interessierter – überlegen, nicht zu wäh-len, denn Gespräche über Politik seien letztend-lich Gespräche über Konsum – und der Konsu-ment habe ja über den Staatsbürger gesiegt (Crouch).Daher achten Sie und Ihre Politikverweigerer lieber darauf, dass Äpfel aus der Region gekauft werden, dass der Strom sauber erzeugt wird, dass das Fleisch von glücklichen Tieren kommt. Ist aber meine Stimme für eine Partei nicht Aus-druck einer übergeordneten Ideologie, die ich begehre? Ist mir der Unterschied der übergeord-neten Grundhaltungen der Parteien – trotz An-näherung – nicht bewusst? Diese politischen Grundhaltungen, mit denen sich die Wähler-schaft identifiziert, führen im Falle einer Regie-rung zu unterschiedlicher Gesetzgebung: Und damit folgt der Sieg des Staatsbürgers über den Konsumenten.Pietro Schumann, Passau
Das Leserzitat
LESERBRIEFE
ein gestisches Wiedererkennungsmerkmal besitzt, ist Steinbrück nun mit dem Stinkefinger an ihr vorbeigezogen. Doch mit seiner persönlichen Ab-sage an eine Große Koalition entgeht Steinbrück dem Verdacht der Obszönität. Die unanständige Kombination aus Steinbrücks Effe-Finger und der Merkel-Raute lässt endlich erklären, warum sich Steinbrück persönlich aus einer möglichen Gro-ßen Koalition ausschließt.Er möchte nicht obszön erscheinen …Es könnte eng werden – für Steinbrück. Weiteres: siehe Steini-Plag.Daniel Himmelseher, Sasbach
Ab
b.:
Tit
el
DIE
ZE
IT N
r. 3
9/
20
13
(Illu
stra
tio
n:
Sm
ete
k f
ür
DIE
ZE
IT)

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
98
Montagmorgen in der Teeküche der Reha-klinik. Während der Wasserkocher ächzt, entdecke ich an der Pinnwand eine kleine Sammlung von Was mein Leben reicher macht. So liebevoll und zugleich eine so starke Geste. Ich bin gerührt und weiß, dass ich hier gut aufgehoben bin.
Kerstin Gramolla, Leipzig
Scrabbeln. Scrabbeln mit meinem Mann, Scrabbeln online, Scrabbeln mit den beiden Enkeln. Scrabbeln mit Schülern in einer Projektwoche an einer Schule, Scrabbeln mit Senioren im Seniorenbüro Neumüns-ter, Scrabbeln mit Freunden …
Edelgard Lessing, Neumünster
In einer Woche geht es los, die Spannung steigt. Überall Kartons. Möbel werden auf den Sperrmüll getragen. Am Samstag der große Umzug: Mit meiner Frau und unse-rer gemeinsamen Tochter von 18 Monaten, die alles tapfer erträgt, was da um sie herum geschieht, gehen wir das Abenteuer Aus-landsstudium in Kopenhagen an. Ich bin so glücklich, dass ich das mit den beiden Damen meines Lebens erleben darf.
Tilman Yngve Wappler, Offenbach/Main
Wir leben in einer eher rauen Gegend. Doch eines der ausgesäten Dillkörner wuchs zu einer großen Pflanze mit zahl-reichen Dolden heran. Gestern entdeckte ich an der kahlen Pflanze fünf wunderschö-ne Raupen: gelb, mit schwarzen Streifen, in denen rote Punkte sind. Gleich nach-geschlagen: Es werden Schwalbenschwän-ze! Da verzichten wir gern auf den Dill, den sie uns weggefressen haben.
Tamara Hasselblatt, Grävenwiesbach, Taunus
Ich spaziere mit einem Freund durch eine ruhige Nebenstraße, da fährt ein Auto lang-sam an uns vorbei. Ein Jüngling hängt aus dem Fenster und ruft uns zu: »This girl’s on fire!« Das rothaarige girl freut sich ’nen Ast ab: Es wurde gerade 65.
Ingrid Schipper, Berlin
Rennradtouren, die Fußballspiele meiner Jungs, Wetten, Lesen, Schreiben, Alkohol und die paar Jahre bis zur Pension.
Alfred Bolha, Moers
Trockenfallen mit einem Segelschiff auf dem Wattenmeer. Nachts, wenn alles schläft, warm eingepackt noch einmal an Deck des Schiffes liegen, um in dem ein-zigartigen Sternenhimmel zu versinken. Und zur Krönung dieses Augenblicks eine Sternschnuppe entdecken.
Friederike Ehrhardt, Köln
Das achtjährige Nachbarsmädchen, das neulich am Sonntagmorgen an unserem Garten vorbeiradelte und dabei inbrünstig und weithin hörbar »Freude schöner Göt-terfunken« sang. Das »Elysium« lag leider hinter der Kurve, und so werde ich nie er-fahren, wie sie mit dem schwierigen Wort klarkam.
Angela Körner-Armbruster, Salem
Jeden Samstag und dennoch immer wieder unverhofft sagt mir mein Mann, wie viele Wochen wir schon zusammen sind. Ich freue mich auf die vierstelligen Zahlen!
Dyana Röben, Berlin
Ich bringe meinen Enkelsohn Magnus, vier Jahre, zu Bett. Zwischen Gutenachtge-schichte und Beten muss ich fragen: »Was war heute das Schönste?« Er antwortet: »Omi, es fängt mit A an!« Ich kann es nicht erraten. Da sagt er: »Alles, Omi, alles!« Und nimmt meinen Kopf in seine Hände und küsst mich auf die Stirn und auf den Mund. Was will ich mehr?
Gloria Ziller, Dresden
* Die Redaktion behält sich Auswahl, Kürzung und die redaktionelle Bearbeitung Ihrer Beiträge vor. Mit der Einsendung geben Sie Ihr Einverständnis, Ihren Beitrag in der ZEIT, im Internet unter www.zeit.de/zeit-der-leser und eventuell auch in einem ZEIT-der-Leser-Buch zu veröffentlichen.
Die Kritzelei der WocheTinte und Füllfederhalter, beides sollte auf einem al-ten Blatt auf Funktion ge-testet werden. Gedacht, ge-kritzelt! Nach Jahren in der Schublade offenbarten sich nach Umzugsarbeiten diese wirren Streifzüge der Feder als ein Bild mit zwei Cha-rakteren.
Bianca Stierand, Essen
Platz für Ihre Eindrücke und Einfälle
EIN GEDICHT!Klassische Lyrik, neu verfasst
Herbstwahl(sehr frei nach Rainer Maria Rilke, »Herbsttag«)
Hey Mann: Der Sommer war zu kurz und verdammt heiß!
Zum Glück finden wir nun überall Schatten,
und der Wind kühlt unsere erhitzten Gemüter.
Die Bäume hängen voll mit leckeren Früchten.
Wir nehmen uns noch ein paar Tage frei für den Süden
und freuen uns auf den süßen, schweren Wein.
Gott sei Dank: Wir haben ein großes Haus und bauen uns
keines mehr,
Zum Glück sind wir auch nicht allein.
Wir schlafen lange, lesen ein wenig und schreiben
unseren Freunden kurze E-Mails.
Durch die Einkaufspassagen schlendern wir ganz cool
hin und her, wenn die letzten zerfetzten Wahlplakate im
Wind treiben.
Rudi Thal, Leutenbach
Schon bei meinem ersten Aufenthalt in Florenz im April dieses Jahres sind mir etliche, von einem Unbekannten neu ge-staltete Verkehrszeichen aufgefallen. Als ich nun im September wieder dort war, habe ich festgestellt, dass inzwischen noch mehr Motive hinzugekommen sind.
Marina Baier, Springe-Bennigsen
STRASSENBILD
WIEDERGEFUNDEN
Was mein
LEBENreicher macht
Das linke Bild zeigt meinen Großvater Oskar im September 1934 vor seinem Wohnhaus im französischen Viertel von Shanghai. Es muss heiß gewesen sein an diesem Tag. Seit 1906 lebte mein Großvater als Kaufmann in China, verließ Shanghai 1937 nach dem japanischen Einmarsch für immer, träumte aber bis zu seinem Tod im Jahr 1947 weiter von einer Rückkehr. Im vergangenen Jahr habe ich Shanghai besucht und mich – achtzig Jahre nach meinem Großvater – vor dem Haus fo-tografieren lassen. Und so gewaltig die Ver-änderungen in Stadt und Land auch sind: Das Haus im Art-déco-Stil ist das gleiche geblie-ben. Was mir durch den Kopf ging? Wie gut es uns als Enkelgeneration doch geht!
Rolf J. Langhammer, Flintbek
Zeitsprung: In Shanghai
Ich habe keine Ahnung, was es mit dieser Rechnung auf sich hat, die ich im Nachlass meines Vaters (Geburtsjahrgang 1913) fand. Eines steht jedenfalls fest: Der dem Anlass entsprechend gepflegte Herr mit roter Halsbinde hat sich im Jahr 1935 um 0,50 Reichsmark verrechnet. Ob es seine Tanzstundendame war, die den Irrtum (mit Bleistift) korrigierte?
Renate Steinhorst, Bamberg
MEIN WORT-SCHATZ
Schildbürger
Liebe Leserinnen und Leser, den Aufmerksamen unter Ihnen wird es nicht entgehen: Zum zweiten Mal hintereinander parodiert »Ein Gedicht« Rilkes »Herbsttag«. Warum? Weil der »Herbsttag« eines unserer allerschönsten Gedichte ist. Und weil Rudi Thals Parodie so aktuell und wunderbar frei daherkommt WL
AL
LT
AG
SK
UN
ST
Teure Dame
In meiner Kindheit hörte ich zuweilen meine Mutter bei der Arbeit singen: »Im schönsten WIESENGRUNDE ist meiner Heimat Haus ...« Das Wort Wiesengrund gefiel mir und blieb mir im Gedächtnis. Jahrzehnte später hörte ich das Wort wie-der: In der Unfallklinik Murnau kümme-re ich mich ehrenamtlich um Patienten wie den querschnittsgelähmten Herrn G. Aufgrund einer Komplikation war er mo-na telang ans Bett gefesselt. In dieser Zeit hat er mir viel aus seinem Leben erzählt – von seiner Familie, von sonntäglichen Wanderungen in seiner schwäbischen Hei mat, von einem Wiesengrund, auf den er von einem Hügel hinabblicken konnte. Aufgrund seiner Behinderung sind die meisten dieser Orte für ihn heute un-erreichbar. Herr G. las viel; niemals hörte ich ihn klagen. Er erträgt seine Krankheit mit Würde und Geduld. Wiesengrund – ich stelle mir vor: ein grünes, schattiges Tal, ein gewundener Bachlauf, die Ufer gesäumt von Erlen und Weiden. Das laut Duden »veraltende« Wort wird wohl bald ganz vergessen sein. Doch seit ich es von dem schwerbehin-derten Herrn G. wieder hörte, erinnert es mich an Kindheit und eine noch junge singende Mutter, an Heimat und Sommer, an die Schönheit auch des Alltäglichen, an das Glück eines ganz normalen Lebens.
Karin von der Saal, Murnau, Oberbayern
1934 2012
Schicken Sie Ihre Beiträge* für »Die ZEIT der Leser« bitte an: [email protected] oder an Redaktion DIE ZEIT, »Die ZEIT der Leser«, 20079 Hamburg
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.zeit.de/zeit-der-leser
ZEIT DER LESER Leserbriefe S. 97
Aus meinem Garten
Lange Zeit führte dieser kleine Baum ein trostloses Dasein als wild austreiben-der Ahorn an der Ecke un-serer Einfahrt – wo er uns immer im Weg stand. Mehr-fach haben wir ihn weg-geschnitten oder plattgetre-ten. Er gab nicht auf. Beim Umbau der Einfahrt grub ich ihn schließlich aus, kürz-te seine Wurzeln und setzte ihn in einen Topf. Wir ha-ben keine Ahnung von Bonsai, wir biegen die Pflan-ze nicht, wir nehmen die ersten größeren Blätter weg, und sie schenkt uns eine zweite Generation kleineren Laubes. Der »lästige« kleine Ahorn: Jetzt wird er zehn Jahre alt, und wir lieben ihn.
Jürgen Eulenpesch, Ulm

PREIS ÖSTERREICH 4,60 €
Kleine Fotos (v.o.n.u.): Roland Schlager/APA/picturedesk.com; Pressefoto Baumann/imago
A
Abonnement Österreich, Schweiz, restliches Ausland
DIE ZEIT Leserservice, 20080 Hamburg, Deutschland Telefon: +49-40 / 42 23 70 70Fax: +49-40 / 42 23 70 90E-Mail: [email protected]
Österreich
ZEIT ONLINE GmbH: www.zeit.de; ZEIT-Stellenmarkt: www.jobs.zeit.de
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, 20079 HamburgTelefon 040 / 32 80 - 0; E-Mail: [email protected], [email protected]
Umarmt die Strache-FPÖAnton Pelinka über die WahlSeite 12
Die österreichischen Sozialdemo-kraten stehen nach den Na-tionalratswahlen, bei denen sie mit knapper Not die Nase vorn behielten, vor einem Dilemma. Die logische Konsequenz des
Ergebnisses vom Sonntag wäre es, eine Regierungs-koalition mit dem freiheitlichen Wahlsieger an-zustreben. Doch genau dieses Bündnis hat der bisherige und auch wohl künftige Bundeskanzler, Werner Faymann, dezidiert ausgeschlossen. Noch am Wahlabend bekräftigte er seine seit Langem bestehende Absage.
Die Vorstellung, die größte Pensionistenpar-tei in Österreich, die SPÖ, könnte mit der größ-ten Arbeiterpartei, der FPÖ, zusammengehen, gilt weithin als Ketzeridee. Zu unterschiedlich seien beide Gruppierungen: auf der einen Seite die Garanten sozialer Wärme, auf der anderen die hinterwäldlerischen Fremdenhasser. Staats-tragende Regierungsverantwortliche gegen hetze-rische Schmuddelkinder, Beschwichtigungsred-ner gegen hetzerische Agitatoren, ruhige Hand gegen geballte Faust. Die Sozialdemokraten wür-de es im Fall eines solchen Experiments zerfetzen, behauptet der politische Hausverstand.
Tatsächlich sind sich aber die Parteien ähn-licher, als ihnen lieb sein kann. Beide wenden sich hauptsächlich an Wählersegmente, die im wirtschaftlichen Verteilungskampf ins Hinter-treffen geraten sind. Beide rücken die sozialen Ängste ihrer Anhänger in den Mittelpunkt ihrer Politik. Beide pflegen ähnliche Feindbilder: Ban-ken, Millionäre, Spekulanten – bloß leisten sich die Freiheitlichen noch ein zusätzliches Schreck-gespenst, vor dem auch so mancher Genosse bibbert. Es sollte nicht vergessen werden, dass es die Gewerkschaften waren, die gegen den »Ge-nossen Lohndrücker« aus dem Ausland wetter-ten, und dass es ein Zentralsekretär der SPÖ war, der erstmals behauptete: »Das Boot ist voll.« Erst anschließend schmiedeten die Freiheitlichen aus diesem Thema ihre wichtigste Propagandawaffe.
SPÖ und FPÖ eint mehr, als es auf den ersten Blick scheint
Zwar ist die FPÖ nach wie vor die Heimat einer deutschnationalen Nostalgiesekte, doch allein auf diese Gefolgschaft angewiesen, würde die Partei heute gewiss an der Vierprozenthürde scheitern. Längst hat sie sich breite Wählerschichten erschlos-sen, die der Sozialdemokratie abtrünnig geworden sind und nun das Gefühl haben, die Protestpartei der kleinen Leute verleihe ihrem Missmut eine Stimme, die gehört wird. Diese Entwicklung, an der die SPÖ langsam ausblutet, hat sich auch in der Wahl dieses Jahres fortgesetzt. In einstmals roten Hochburgen, etwa der obersteirischen Industrie-region, verlor die alte Arbeiterpartei teilweise über zehn Prozent direkt an ihre Nachfolgepartei.
Seit dem Putsch von Jörg Haider und dem anschließenden Rechtsruck der FPÖ gehört ein
antifaschistischer Grundkonsens zum Identitäts-kern der Sozialdemokraten. Würde die Partei daher nicht ihre Seele verkaufen, sollte sie solch einen Pakt mit dem Teufel schließen? Man kann ein entschlossenes Eintreten gegen rechtes Ge-dankengut auch als den pädagogischen Auftrag verstehen, eine verhaltensauffällige Partei dazu zu verführen, sich in Richtung der gesellschaft-lichen Mitte zu bewegen. Es ist ein Geschäft, das auch schlichte Gemüter verstehen: Um in ein-flussreiche Positionen zu gelangen, müssen die schlechten Manieren abgelegt werden.
Woran der Wendekanzler Wolfgang Schüssel vor sieben Jahren kläglich gescheitert war, könn-te nun Werner Faymann leichter von der Hand gehen: den blauen Parteiführer Heinz-Christian Strache zu domestizieren. Der ist weit weniger erratisch und viel berechenbarer als sein Vorgän-ger Haider, ihn umschwirrt keine Horde junger, hungriger Glücksritter, und vor allem verfügt er über kein eigenes Prinzipat, von dem aus er sein Spielchen treiben kann, wie das einst Haider in Kärnten tat. Schon aus Eigeninteresse würden Strache und seine Männer in einer Koalition be-müht sein, sich in Stil und Inhalt wohltuend von dem schwarz-blauen Modell der Selbstbereiche-rung abzuheben.
Vor allem aber fiele es der Sozialdemokratie in einem rot-blauen Regierungsbündnis un-gleich leichter, viele ihrer zentralen Reform-vorhaben, von der Bildungspolitik bis zu ver-mögensbezogenen Steuern, zu verwirklichen. Sie würde erstaunlich wenig Zugeständnisse an die-sen ungeliebten Partner machen müssen. In der restriktiven Ausländerpolitik schrammt Öster-reich heute ohnehin hart am Rand der europäi-schen Legalität entlang, und manche radikale Ideen, welche die Freiheitlichen hegen, stehen im Widerspruch zum EU-Recht, bleiben ein Hirngespinst. Es wäre, ganz im Sinne von Søren Kierkegaard, ein Sprung des Glaubens, den die SPÖ da wagen müsste. Wer etwas wagte, schrieb der dänische Philosoph, der verliere vielleicht für einen Augenblick festen Halt; doch wer nichts wage, der verliere sich selbst.
Denn was ist die Alternative? In einer 50,6-Pro-zent-Koalition an der Seite einer wehleidigen und störrischen Volkspartei weiter zu verschrumpeln. Die wird nun mit der ständigen Drohgebärde, sie verfüge ja auch über andere Möglichkeiten, ver-suchen, zusätzliche Schlüsselkompetenzen für sich zu beanspruchen (etwa ein aufgeblähtes Bildungs-ressort, das vom Kindergarten bis zur Uni für alles zuständig ist). Dadurch kann sie sich in der Folge auf Kosten der roten Jasager profilieren und ihre Klientel bedienen. Die Beteuerung, die alte rot-schwarze Koalition müsse nun ganz neu gedacht und neu konstruiert werden, ist ein rhetorischer Ladenhüter, der nie sonderlich zu überzeugen wusste. Und in fünf Jahren würde dann erst recht die Stunde der Rechtspopulisten schlagen.
Modell Rot-BlauDie SPÖ muss nun einen mutigen Schritt wagen, um trotz ihrer
Auszehrung bei Wahlen überleben zu können VON JOACHIM RIEDL
www.zeit.de/audio
KOALITIONSPOKER IN WIEN
DIE ZEITW O C H E N Z E I T U N G F Ü R P O L I T I K W I R T S C H A F T W I S S E N U N D K U L T U R 2. OKTOBER 2013 No 41
Der Hahn krähtDer frühere Tennisspieler Boris B. und der frühere Komiker Oliver P. fetzen sich auf Twitter wegen frü-herer Affären und früherer Frauen, was insofern förderlich ist, als jetzt ein Buch über das Leben des Boris B. erscheint. Es illustriert den alten Spruch Omne animal post coitum triste praeter gallum qui cantat(Nach dem Koitus ist jedes Tier traurig, außer dem Hahn, der kräht). Sehr schön, denn nun wis-sen wir, wer der Hahn ist. GRN.
PROMINENT IGNORIERT
68.JAHRGANG C 7451 C
No41
Ein Gespenst hat sich verzogen: die rot-rot-grüne Koalition. Als pro-pagandistisches Schreckensszenario im Wahlkampf erfüllte das linke Bündnis noch seinen Zweck. Doch nun, wo es im Bundestag tatsächlich
eine linke Mehrheit gibt, spielt es keine Rolle mehr. Nur für die ganz Linken in den linken Parteien dient sie noch als schmerzlindernde Utopie.
Die Regierungsbildung allerdings liegt wie selbstverständlich in der Hand der Kanzlerin. Und die scheint nicht sehr zu fürchten, die drei linken Parteien könnten sie stürzen. Die Frage nach der künftigen Koalition lautet schlicht: Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün? Und das, obwohl sich die potenziellen Partner mit einer Regierungsperspektive an Merkels Seite sicht-lich schwertun.
Aus Angst vor der Großen Koalition schraubt die SPD schon jetzt ihre Forderungen so hoch, dass die kommenden Verhandlungen leicht scheitern könnten. Und die Grünen sind vom Wahlergebnis noch so benommen, dass ernst-haftes Nachdenken über die Zumutung einer schwarz-grünen Koalition bei ihnen noch gar nicht begonnen hat. Nur eins scheint allen klar: Es gibt keine linke Option.
Das hat zuerst einmal einen ganz naheliegen-den Grund: Die SPD hat eine solche Zusammen-arbeit vor der Bundestagswahl ausgeschlossen. Zyniker und Politikverächter mögen einwenden, solche Versprechen vor der Wahl hätten nach der Wahl doch keine Bedeutung mehr. Aber das ist falsch. In Hessen hat die SPD 2008 dramatisch erfahren, was es bedeutet, ein solches Versprechen aus purem Machtopportunismus zu brechen. Es ruinierte die Partei und endete im Scheitern.
So geschähe es nun wieder, nur auf der gro-ßen Berliner Bühne. Wer vor der Wahl, wie SPD-Chef Siegmar Gabriel, inständig beteuert, er werde mit dem Land nicht va banque spielen, der tut es auch nicht. Andernfalls ist er politisch tot.
Die Wahl markiert eine Etappe der Entfeindlichung der politischen Lager
Hinzu kommt ein ganz praktisches Problem. Wer versuchen wollte, heute ein Bündnis aus
SPD, Linken und Grünen in Gang zu bringen, müsste sich darüber hinwegsetzen, dass die Mehrheit von vier Sitzen für ein solches Experi-ment arg knapp bemessen ist. Denn immer gäbe es unter den SPD-Abgeordneten aus dem Osten, bei wirtschaftsfreundlichen Grünen oder bei besonders prinzipienfesten Linken potenzielle Abweichler und damit ein permanentes Erpres-sungspotenzial aus unterschiedlichsten politi-schen Richtungen.
So ließe sich das Schlüsselland in der Mitte Europas nicht regierten. Die von ihren Wahl-ergebnissen ernüchterten rot-grünen Spitzen-vertreter sind offenbar nüchtern genug, dieses Risiko zu erkennen.
Noch gravierender wäre allerdings das Legiti-mationsdefizit einer linken Koalition. Ihr fehlt nämlich die gesellschaftliche Mehrheit. Weder stand Rot-Rot-Grün als gemeinsames Koalitions-angebot zur Wahl, noch erreichten die drei Parteien die Mehrheit der Wähler. Dass sie zu-sammen im Parlament über einen knappen Vor-sprung verfügen, ist allein dem Umstand geschul-det, dass FDP und AfD an der Fünfprozenthürde gescheitert sind. Die Mehrheit hat nicht für die drei Parteien aus dem linken, sondern für die drei aus dem rechten Spektrum votiert.
Doch was besagt diese Entscheidung heute überhaupt noch? Wenn die zurückliegenden Wahlen etwas bedeuten, dann doch eher einen weiteren Schritt zur Auflösung der politischen Lager. Denn dass die breite Unterstützung für Merkel auf eine »rechte Mehrheit« in Deutsch-land hindeutet, glauben bestenfalls noch dieje-nigen, die ihre eigene Lagerordnung verbissen verteidigen. Wer Zweifel hegt, wie wenig »Rechtes« in Angela Merkel schlummert, sehe sich auf YouTube die Szene vom Wahlabend an: Da entwindet eine barsche Kanzlerin dem CDU-Generalsekretär Gröhe das schwarz-rot-goldene Fähnchen, mit dem er seiner Sieges-freude Ausdruck verleihen will: Schluss mit dem Quatsch!
Merkel hat ihren Wahlsieg weder mit rech-ten Themen noch im »rechten« Spektrum er-reicht. Sie hat gewonnen, weil sie den Menschen in einem ökonomisch erfolgreichen, wohl-standsgesättigten Land das Gefühl gegeben hat, mit ihr werde es noch eine Weile so weiter-gehen. Ihren unpolitischen Wahlkampf kann man kritisieren, als rechte Kampagne lässt er sich kaum deuten. Das ahnt man natürlich auch bei SPD, Grünen und selbst in der Linkspartei. Deshalb kommen sie jetzt gar nicht auf die Idee, sich gegen Merkel zu verbünden. Es fehlt der ideologische Schwung, ohne den ein solch spektakuläres Experiment nicht durchzuhalten ist. Es fehlt auch der Mut, die hochpopuläre Kanzlerin zu stürzen.
So markiert die Bundestagswahl eine weitere Etappe der Entfeindlichung der deutschen Poli-tik. Statt scharfer, ideologisch befeuerter Geg-nerschaft herrscht weitgehender Konsens. Ob es um Europa oder Afghanistan, um gleich-geschlechtliche Partnerschaften oder prekäre Be-schäftigungsverhältnisse geht, es gibt heute kein relevantes Thema der deutschen Politik, bei dem die Differenzen zwischen den etablierten Partei-en so fundamental wären, dass sich aus ihnen die plausible Begründung für eine rot-rot-grüne Ko-alition ergäbe. Auch deshalb wirkt es jetzt so selbstverständlich, dass die beiden denkbaren Koalitionsvarianten, Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün, die Lagergrenzen überbrücken, statt sie neu zu zementieren. Rot-Rot-Grün durch die Hintertür ist jedenfalls keine Alternative.
www.zeit.de/audio
Kein MorgenrotIm Bundestag haben die Linken eine Mehrheit – in der
Gesellschaft vorerst nicht VON MATTHIAS GEIS
ROTROTGRÜN
Tit
elil
lust
rati
on
: M
art
Kle
in u
nd
Mir
iam
Mig
liazz
i fü
r D
IE Z
EIT
Im Dschungel der Bücher
80 Seiten Literatur zur Frankfurter Buchmesse:Die abenteuerlich schönen Bücher des Herbstesund die vitalen, melancholischen Autoren des diesjährigen Gastgeberlandes Brasilien
4 1 9 0 7 4 5 1 0 4 5 0 0 4 1

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Matthias Strolz, Chef der liberalen Neos,
feiert den Einzug seiner Partei ins
Parlament
A
12 ÖSTERREICH
Na, war das ein überraschendes Ergebnis bei der Nationalratswahl! Verblüffend, wie leichtfüßig die Neos auf Anhieb den Einzug ins Parlament geschafft haben. Da wurde es den Paläos aber mächtig gezeigt. Die haben zwar immer noch merkwürdigerweise eine Mehrheit, aber nur mehr hauchdünne. Auch die Frankos sind dabei, wären vielleicht noch mehr dabei, wenn ihr Anführer sich der alten Weisheit des Si tacuisses besonnen hätte. Die Orangos blieben unter vier Prozent, was eben-falls alle überraschte. Erstaunlich auch, wie souve-
rän die Strachos wieder einmal mit alten Sprüchen punkteten, diesmal mit solchen aus der Bibel. Und ganz überraschend blieben auch die Umfragelieblinge der Grünos deutlich unter den Erwartungen. Das ein-zig Erwartbare war der große Erfolg der Nicht-wähler. Mit 26 Prozent sind die Nixos nunmehr die zweitstärkste Partei des Landes. Zahlreiche Rätsel umranken dieses Ergebnis. Rein vom Programm her
scheint die reine Leere kein wirklich signifikanter Unterschied zu anderen Mitbewerbern zu sein. Offensichtlich handelt sich es sich bei den Demo-kratieabstinenzlern um eine spezifische Form des Protestwählers. Dieser begnügt sich aber nicht mit spießigem Dagegensein, nein, er ist einfach nichts. Nirgendwo ist es so gemütlich wie in diesem poli-tischen Niemandsland. Man kann alles schlecht finden, muss aber selbst keine Initiative ergreifen. Das scheint ein sehr österreichisches Verständnis von Politik zu sein. Wer weiß, vielleicht haben die Nixos bald die absolute Mehrheit in diesem Land. Dann könnte man das Wählen ja überhaupt ab-schaffen. Und wahrscheinlich wird dann das Matschgern und Sudern wieder von Neuem be-ginnen. Nämlich darüber, dass man hier in diesem verdammten Land einfach keine Wahl hat.
Die Nixos
DONNERSTALK
Foto
: In
go P
ert
ram
er
Alfred Dorfer sieht den Tag kommen, an dem niemand wählt
Schwerpunkt: Nationalratswahlen 2013
So sehen Sieger ausDie große Koalition ist noch nicht am Ende, bequem sollte
sie es sich aber trotzdem nicht machen VON ANTON PELINKA
Die Wahlgewinner könnten unterschied-licher nicht sein: da die Neos, die auf Anhieb die Vierpro-zenthürde überspran-gen; eine Partei der
Modernisierungsgewinner, die gut in die kleine, aber feine Parteienfamilie der Libe-ralen in Europa passt. Dort die Freiheit-lichen, die nach dem politischen Ende des BZÖ da angelangt sind, wo sie schon ein-mal waren: auf Augenhöhe mit Sozial-demokraten und Volkspartei. Die Neos: proeuropäisch. Die FPÖ: die Partei der Ressentiments gegen die ohnehin beschei-denen Umverteilungen innerhalb der EU. Hier eine Protestpartei des jungen Bil-dungsbürgertums und der oberen Zehn-tausend, die in ihrer sozialen Komposition den Grünen nicht unähnlich ist; da die Partei, die seit geraumer Zeit der SPÖ die Rolle der Arbeiterpartei streitig macht – und das mit steigendem Erfolg.
Die Neos werden die europapolitische Allianz stärken. Sie werden wohl auch die Zweidrittelmehrheit im Nationalrat si-chern, wenn europäische Weichenstellun-gen notwendig sind.
Ganz im Gegensatz zum anderen Wahlgewinner. Die Freiheitlichen werden sich jeder Vertiefung der EU entgegen-stemmen – in trauter Zweisamkeit mit dem Team Stronach. Diese antieuropäi-sche Allianz wird über nicht unerhebliche Schlagkraft verfügen und vermutlich 53 Abgeordnete stellen. Zu wenig, um eine entschlossene Regierung ernsthaft infrage zu stellen, die ihre Europapolitik noch dazu mit Grünen und Neos abstimmt. Aber allemal genug, um innerhalb der beiden Regierungsparteien die Ängste wei-ter zu schüren, dass ein entschiedenes, durch Handeln begleitetes Bekenntnis zur europäischen Integration unpopulär sein könnte. Deshalb haben SPÖ und ÖVP im Wahlkampf über alles Mögliche gespro-chen – dabei aber kein Sterbenswörtchen über die Zukunft Europas verloren.
Die durch die Neos gestärkte proeuro-päische Zweidrittelmehrheit wird nicht reichen, den Eindruck eines signifikanten Rechtsrucks zu vermeiden, den das Wahl-ergebnis vermittelt. Wenn FPÖ, Team Stronach und das BZÖ auch keinen ho-mogenen Block bilden, so vereinten trotz-dem jene Parteien, die einen entschiede-nen Anti-EU-Kurs befürwortet haben, 30 Prozent der Stimmen auf sich.
Die Pinken lassen hoffen, dass Österreich lernfähig ist
Viel wird über eine angeblich neue politische Landschaft gesprochen, in der sich drei Par-teien fast auf Augenhöhe gegenüberstehen. Doch war da nicht das Wahlergebnis von 1999, als die SPÖ zwar ihre relative Mehrheit rettete, aber FPÖ und ÖVP, nicht viel schwä-cher als heute und vor allem praktisch gleich-auf, den zweiten Platz einnahmen? Nichts Neues unter der österreichischen Sonne, könnte man meinen.
Wirklich neu ist freilich der Erfolg der Neos. Die Pinken lassen hoffen, in Öster-reich könnte sich eine liberale Stimme auf Dauer etablieren. Ein liberales oder zumindest liberaleres Österreich, in dem der kulturelle Liberalismus vor allem von den Grünen, der wirtschaftliche von den Neos verkörpert wird? Nicht einmal der österreichischen Gesellschaft sollte man die Lernfähigkeit absprechen. Und der Erfolg der Neos hilft, die Hoffnung am Leben zu erhalten.
SPÖ und ÖVP haben noch einmal eine Mehrheit geschafft. Können sich die beiden nun beruhigt zurücklehnen, in der Meinung, es sei alles nicht so schlimm? Natürlich nicht. Das wirklich Schlimme für die Sozialdemo-kraten und die Volkspartei ist nicht das Wahlergebnis. Das wirklich Schlimme ist, dass sich ein Trend unerbittlich fortzusetzen scheint: Seit Jahrzehnten verlieren SPÖ und ÖVP beständig. Was wechselt, sind die
Nutznießer des Abstiegs der ehemals Gro-ßen. Dazu gehört vor allem die FPÖ – sofern sie in Opposition ist. Sozialdemokraten und Volkspartei sind die Parteien der Alten. Die Stammwähler sterben weg, und die Jungen stehen politisch woanders: bei den Grünen und Neos sowie bei den Freiheitlichen.
Dieser Trend, der schon 1983 einsetz-te, wurde nur zweimal unterbrochen: 1995, in Form einer nicht nachhaltigen Momentaufnahme; und 2002, als die Konfrontation zwischen der schwarz-blau-en Koalition und der SPÖ-Opposition vor allem der ÖVP, aber auch der Sozialdemo-kratie zu deutlichen Gewinnen verhalf und die Freiheitlichen dramatisch abstür-zen ließ.
Die FPÖ hat die besten Chancen, 2018 Nummer eins zu werden
Gerade diese Erfahrung, dass die FPÖ nach weniger als drei Jahren Regierungs-beteiligung zwei Drittel ihres Stimmen-anteils verlor, muss die Partei vorsichtig machen. Das für die Freiheitlichen kata-strophale Ergebnis ihrer Allianz mit der Schüssel-ÖVP müsste bei Heinz Christian Strache zum Schluss führen, nicht in die Regierung zu drängen, sondern zu akzep-tieren, dass die Zeit dafür noch nicht reif ist. Er kann aber darauf bauen, dass sich bei einer Neuauflage einer großen Koali-tion der Abnützungseffekt mit eherner Gesetzmäßigkeit weiter fortsetzen wird und 2018 die beiden Noch-Regierungspar-teien keine gemeinsame Mehrheit mehr zustande bringen werden. Die FPÖ, die dann nicht nur die noch vorhandenen Res-te des BZÖ ohne Mühe einsammeln wird, sondern der auch wesentliche Stimmen-anteile der Liste Stronach zufallen könn-ten, hätte beste Chancen, zur Nummer eins zu werden. Dann, erst dann, könnte eine neue Ära anbrechen: die Ära eines Bundeskanzlers Heinz Christian Strache.
Wie das verhindert werden könnte? Da bietet sich die Erfahrung der Ära Schüssel an: die FPÖ an die Brust zu nehmen. In der Regierung könnten die Freiheitlichen ähnlich schnell entzaubert werden wie zwischen 2000 und 2003. Also die Türen auf für eine Regierungsbeteiligung der FPÖ, um diese zu zerstören.
Es gibt dazu nicht nur das österreichische Beispiel. In der Slowakei hat die sozialdemo-kratische SMER 2006 zwei nationalistische Krawallparteien als Mehrheitsbeschaffer in die Regierung gehievt. Auf europäischer Ebene bekam Regierungschef Robert Fico deshalb erhebliche Probleme mit seinen so-zialdemokratischen Schwesterparteien. Doch die Nationalisten erwiesen sich rasch der Aufgabe in der Regierung professionell nicht gewachsen. Heute regiert SMER, nach der Zwischenphase einer Mitte-Rechts-Regie-rung, mit absoluter Mehrheit. Die Nationa-listen der SNS aber sind nicht einmal mehr im Parlament vertreten.
Auch wenn die SPÖ nicht in Versu-chung geführt wird: Es bleibt die Verführ-barkeit der ÖVP.
Diese müsste freilich eine komplizierte Dreierkoalition zusammenstellen. Mit den Neos? Die wären schlecht beraten, in eine solche Koalition zu gehen, in der sie sich den Ruf einhandeln würden, Steigbügelhalter Straches zu sein. Das Team Stronach? Die Geschichte der Fraktionsbildung dieser Partei zeigt, dass deren Gründungsmitglieder nicht nur extrem flexibel sind, was ihre Loya-litäten betrifft, sondern sie kommen dazu noch zu einem Gutteil ohnehin aus dem Dunstkreis von FPÖ und BZÖ.
Also doch ein Kanzler Michael Spinde-legger, der auf den Schüssel-Effekt hofft? Aufschwung für seine Partei bei gleichzei-tigem Absturz der Koalitionspartner? Auch wenn das niemand in der ÖVP wirklich will – mühsame Regierungsver-handlungen, die nicht rasch zu einer SPÖ-ÖVP-Vereinbarung führen, könnten eine Eigendynamik zur Folge haben. Und an deren Ende könnte die Wiederholung des Experiments Schüssel stehen.
Foto
(A
uss
chn
itt)
: M
ich
ael
Gru
be
r/E
XPA
/p
ictu
red
esk
.co
m

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Was die Helden von morgen wollenJunge Persönlichkeiten, die künftig Verantwortung in Österreich übernehmen werden, richten ihre Wünsche an die nächste Regierung
ÖSTERREICH 13
Wir müssen in Österreich endlich die Dikta-tur der Mittelmäßigkeit durchbrechen, und zwar in allen politischen Bereichen – von
der Außenpolitik bis zur Energiewende. Gerade in der EU gilt für die Regierung leider die Beschreibung der Österreicher von Josef Hader, »patschert, aber berech-nend«. Undiplomatisch und gleichzeitig egoistisch. Etwa bei der Blockade der Aufhebung des Bank-geheimnisses zur Verfolgung von Steuerflüchtlingen.
In der Krisenpolitik ist Österreich völlig visions-und ideenlos. Was Merkel sagt, wird getan. Obwohl in Griechenland, Portugal, Spanien und Zypern Trans-formationsprozesse stattfinden, mit ungeheuren Kon-sequenzen und Gefahren; es regiert weiter das Mittel-maß, und jeder Anspruch einer Vision, die über den nächsten Wahlkampf hinausgeht, fehlt. Gerade in der Krise müssen wir mit der Zivilgesellschaft die Fehler analysieren und mutige Ansätze entwickeln, die Eu-
ropa demokratischer, sozialer und stabiler machen. Es braucht eine Allianz der kleinen und mittleren Staaten. Nur so kann aufgelöst werden, dass Deutschland und Frankreich den Kurs diktieren. Österreich könnte das organisieren, wir sind ein reiches Land, Nettozahler und hätten dadurch eine starke Position als Vermittler.
Darüber hinaus stehen wir vor einem demokratie-politischen Problem: der fehlenden Gewaltenteilung von Regierung und Parlament. Eine echte Trennung wurde nie durchgesetzt. Die Ansätze der letzten zehn Jahre vom Österreichkonvent bis zum versprochenen Demokratiepaket blieben bislang folgenlos. Die ge-wählten und unabhängigen Abgeordneten müssen ihrer Rolle endlich gerecht werden, die Regierungs-gesetzgebung überwinden und die Kontrollfunktion tatsächlich wahrnehmen. Nur so kann das Vertrauen in die Institution des Parlaments erhöht und die Arbeit verbessert werden.
Im Asylbereich muss endlich klargestellt werden, dass wir von einem zu garantierenden Grundrecht und nicht von politischen Almosen zu sprechen. Selbstverständlich brauchen wir in einer EU ohne Binnengrenzen auch eine gemeinsame Asylpolitik. Alles andere ist absurd. Und ja, ein faires europäi-sches Verfahren würde bedeuten, dass Österreich künftig mehr Asylfälle prüfen müsste.
Wichtig ist auch eine lebendige und kritische Kunst- und Kulturpolitik. Die wird zwar großge-schrieben, und es fließt viel Geld, aber es geht zu sehr um das Konservieren von veralteten Öster-reichbildern und das Inszenieren eines für den Tou-rismus bestimmten Spektakels. Kunst sollte etwas Emanzipatorisches, etwas Herausforderndes, etwas Mutiges haben.
Aufgezeichnet von FLORIAN GASSER
Resigniert, politikverdrossenund ins Privatleben zurück-gezogen – so sieht das Bild aus, das von jener jungen Generation gezeichnet wird, die sich anschickt, in Österreich Verant-wortung zu über-nehmen. Vor einem Jahr stellte die ZEIT eine Reihe junger Per-sönlichkeiten vor, die diesem Eindruck widersprechen: Wir baten renommierte Exper-ten, Nachwuchstalente zu nominieren, denen sie zutrau-en, einmal in ihre Fußstapfenzu treten. Aus Anlass der
Nationalratswahlen vom vergangenen Sonntag ha-ben wir fünf der damals Porträtierten gebeten, uns ihre Wünsche an die nächste Regierung zu nennen.
Was erwarten sich jene von der Politik, die dieses Land in Zukunft prägenwerden, welche Themen liegen
ihnen besonders am Herzen? Mehr Visionen, wurde oft genannt, mehr Mut und Offenheit und weniger Provinzialismus.Die Politik täte gut daran, diese Stimmen zu hören. FG
Jakob Redl, 30, ist Referent für Außen- und Entwicklungspolitik im Parlamentsklub der Grünen. Nominiert wurde er von Johannes Voggenhuber
Schwerpunkt: Nationalratswahlen 2013
Das Bildungsthema ist für mich das wichtigste. Ich hatte in den vergange-nen Jahren viele berufliche Begegnun-
gen mit Jugendlichen. Meine Mitarbeiter und ich testeten ein App-Game in Schulen und Jugendzentren. Die Schüler hatten Angst vor der Rechtschreibung. Wenn man ihnen keine Hilfe anbot, blieben die Zettel weiß. Wir brau-chen unbedingt mehr qualifi-zierte Lehrer.
Das jetzige System hat für die Wünsche der Lehrer nichts übrig. Die Schulen sollen weni-ger an Parteiapparate geknüpft sein. Es ist schade, dass die Be-setzung von Direktorenstellen politisch ist. Wer etwas werden will, muss sich als Systemsoldat etablieren. Aber wir brauchen Leute, die quer denken.
Generell fehlt mir bisher eine inspirierende Vision in der Politik. Was ist die Identi-tät für Österreich? Wo geht dieses Land hin? Wo liegen die Stärken? All diese Fragen werden nicht ge-stellt. Ich habe Bruno Kreisky als aktiven Po-litiker nicht mehr erlebt. Wenn ich über ihn lese, denke ich mir, er war womöglich unser letzter Politiker mit Visionen und einer Poli-tikphilosophie.
Dialoge sind unbedingt notwendig. Mich begeisterte die Initiative Re:think in Kooperati-
on mit dem Forum Alpbach. Junge Politiker und Vertreter der Gesellschaft trafen in einem un-politischen Setting aufeinander. Das zeigte mir, wie fruchtbar es sein kann, wenn sich Politiker außerparlamentarisch auf Augenhöhe begegnen.
Ich bin Unternehmerin im Bereich der Fi-nancial Literacy, der Allgemeinbildung im Finanzbereich, und es war für mich erschre-
ckend, welch geschlossene Bastion das Bildungsministe-rium ist. Im Gegensatz zu an-deren Ministerien ist hier kein Dialog möglich.
Als ich bei einem interna-tionalen Treffen weiblicher CEOs in London zu Gast war, saß Tennislegende Billie Jean King auf dem Podium. Sie erzählte, dass du ein Match nicht in den Momen-ten gewinnst, in denen du den Ball schlägst. Sie sagte, es sei für den Erfolg entschei-dend, wie du mit den restli-chen 75 Prozent des Spielver-
laufs umgehst – mit den Stärken, Ängsten und Sorgen. Dieser Gedanke gefällt mir. Dass es in der Politik nicht nur um Wahl-kampf und hitzige Debatten im Parlament geht, das soll sich die neue Regierung zu Herzen nehmen.
Aufgezeichnet von JOHANNES LUXNER
Katharina Norden, 28, ist Sozialunternehmerin. Sie wurde nominiert vom ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler
Angst vor der RechtschreibungKatharina Norden will mit der Politik einen Dialog auf Augenhöhe führen
Der Politik zu sagen, welche konkreten Schritte sie setzen soll, ist nicht meine Aufgabe. Ich kann aber Aspekte be-
nennen, die für mich zu einer lebenswerten Gesellschaft dazugehören.
Ein solcher Aspekt ist der große Bereich ge-sellschaftlicher Vielfalt: Als Theologin denke ich nicht nur an religiöse Vielfalt, sondern auch an ethnische Vielfalt, an verschiedene Lebensent-würfe, Begabungen oder Ein-schränkungen, an verschiedene Sprachen und Traditionen. Vielfalt soll in einer Gesellschaft nicht nur geschützt, nicht nur »toleriert« oder »geduldet« werden, sondern gefördert. Sie gehört zu einem friedlichen Zu-sammenleben dazu. Durch meine Arbeit merke ich sehr oft, dass etwa Menschen mit einer auch nur ganz leichten Behinderung kaum Chancen am Arbeitsmarkt haben.
Ein zweiter Aspekt sind die öffentlichen Strukturen. Ich würde mir wünschen, dass sie mein Vertrauen als Staatsbürgerin verdienen, weil sie gewährleisten, dass jeder Mensch Zu-gang zu gesellschaftlich relevanten Lebensberei-chen hat – etwa wenn es um den Zugang zu sozialen Einrichtungen, zu Bildung, zu Kultur oder Verkehr geht. Uns Evangelische betrifft das in manchen Fällen, weil wir – ebenso wie viele andere in Österreich – in einer Minderheiten-
situation leben. Da ist es oft sehr schwierig, das Recht auf schulischen Religionsunterricht zu gewährleisten. Oft sind wir auf das persönliche Entgegenkommen Einzelner angewiesen. Das gilt auch für die Muslime sowie andere kleinere Gruppen und schult unseren Blick dafür, wie kompliziert es für Minderheiten oft ist, ihre ei-gene kulturelle Besonderheit zu bewahren.
Andere Beispiele für meinen Wunsch nach vertrauenswürdigen Strukturen: Als Staatsbürgerin möchte ich davon ausgehen können, dass die Justiz verantwortlich ar-beitet, dass sie ihre Aufgaben wahrnimmt, auch wenn es un-populär ist. Ich möchte den staatlichen Strukturen so weit vertrauen, dass sie anständig mit Asylwerbern umgehen, dass die Prozeduren ihre Richtigkeit haben, dass Asylbescheide auf-grund von sachlichen Argu-menten erteilt werden und nicht willkürlich. Ich möchte Vertrauen haben, dass eine Asyl-werberin von der zuständigen
Stelle richtige Informationen bekommt, dass sie informiert wird, welche Fristen es beispiels-weise gibt – bislang war ich mir dessen nicht immer sicher. Als eine, die damit immer wieder zu tun hat, möchte ich nicht gegen die Institu-tionen arbeiten, sondern mit ihnen.
Aufgezeichnet von NINA BRNADA
Marianne Pratl-Zebinger, 32, ist evangelische Theologin und Pfarrerin in Leibnitz. Nominiert wurde sie von Peter Pawlowsky
Dem System vertrauen könnenMarianne Pratl möchte, dass die Vielfalt von der Politik gefördert wird
Die Diktatur der MittelmäßigkeitJakob Redl wünscht sich mehr Visionen für Österreichs EU-Politik
Foto
s: G
ian
mar
ia G
ava
A

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
A
Die politische Klasse ist visionslos, sie braucht Input von außen. Anstatt sich in politischen Kleinkriegen zu ergehen,
sollte die Regierung mit der Zivilgesellschaft und NGOs zusammenarbeiten. Es gibt heute so viele, die Expertise in verschiedenen Bereichen an-gehäuft haben – Amnesty International, Green-peace, die Armutskonferenz, SOS Mitmensch, Pflegeinitiativen. Sie sollten in einen ständigen Prozess der Bürgerbeteiligung eingebunden wer-den. Um zu vermeiden, dass der Dialog mit der Zivilgesellschaft zur punktuellen Alibiaktion ver-kommt, sollten die NGOs strukturell eingebettet werden: Das Ziel ist ein ständiger Prozess der Bürgerbeteiligung an der Gesetzeswerdung.
Auch wenn es viele nicht mehr hören können: Bildung ist das wichtigste Thema der kommenden fünf Jahre. Gesamtschule, Ganztagsschule, Früh-förderung – all diese längst überfälligen Reform-schritte sind schon hundertmal verkündet wor-den, also bitte machen wir es doch endlich! Ich wünsche mir außerdem Antirassismustrainings an Schulen, aber auch in der Lehrerausbildung. Ich habe als »Deutsch als Fremdsprache«-Lehrerin selbst erlebt, was es heißt, überfordert zu sein, wenn sich zwei Kursteilnehmer gegenseitig ihre
Herkunft an den Kopf werfen. Der Umgang mit solchen Situationen will gelernt sein.
Auch die wachsende Ungleichverteilung des Wohlstands sollte der neuen Regierung Sorge be-reiten. An Vermögensteuern führt deshalb kein Weg vorbei. Das Geld, das durch diese Steuern hereinkommt, sollte in den Ausbau von Kinder-gartenplätzen, Ganztagsschulen und die Siche-rung des freien Hochschulzugangs fließen.
Korruption muss weiterhin konsequent be-kämpft werden. Transparency International weiß, wie es geht, man muss ihnen nur zuhö-ren. Das Amtsgeheimnis gehört abgeschafft, das wäre ein erster Schritt. Was Österreichs Außenpolitik betrifft, sollte die Regierung wie-der mutiger auftreten und sich mehr engagie-ren. Der Golan-Rückzug ist ein gutes Beispiel, wie es nicht funktionieren kann.
Und schließlich noch ein ganz wichtiger Punkt: Die lange versprochene Evaluierung der vielen Fremdenrechtsnovellen, die in den ver-gangenen Jahren beschlossen worden sind, soll-te endlich stattfinden, um in diesem Rechts-bereich wieder für Klarheit zu sorgen.
Aufgezeichnet von MARIA STERKL
Politik ist kein Wunschkonzert, sie muss für alle da sein. Ich möchte, dass Öster-reich ein Land bleibt, in dem es keine
riesigen Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt. Ich möchte nicht in einer gated communityleben müssen, um mich vor Ärmeren in meiner Welt abzuschotten. In den USA etwa, obwohl es ein »Erste-Welt-Land« ist, sind die Unterschiede im alltäglichen Leben präsent, bei uns nicht so stark. Ich hoffe, das bleibt so. Das bedeutet na-türlich nicht, dass keine sinnvolle Wirtschafts-politik gemacht werden soll, aber bei allen not-wendigen Maßnahmen soll das Wichtigste im Auge behalten werden: eine Gesellschaft, die so gleich und gerecht wie möglich ist und dabei gemischt und pluralistisch bleibt. Das sollte die Hauptsorge eines Staates sein.
Persönlich liegt mir die Hochschulpolitik am Herzen. Die Verantwortung für die Universitäten wurde völlig abgegeben, sie wurden einfach in die Autonomie geschickt. Politische Linien gibt es keine, es wird immer nur von »Exzellenzuniver-sitäten« gesprochen, aber die sind als Massenuni-versitäten eine Illusion.
Die Bildungs- und Universitätspolitik ist völ-lig konzeptlos, mir fehlen die großen Entwürfe
dafür. Ich würde mir eine ehrliche und offene Dis-kussion über die Hochschulen wünschen.
Das Schwierige an Politik ist, dass sie derzeit hauptsächlich aus Reagieren auf Finanzmärkte besteht. Große Zukunftsvorstellungen, Fantasie und Mut waren in den vergangenen Jahren Anti-wörter. Mir ist bewusst, dass das Zeitalter dafür nicht besonders günstig ist. Die Politik ist so stark an die Wirtschaft gebunden ist, dass es zu ihrer Hauptaufgabe wird, kein Sklave der Finanzmärk-te zu sein. Das kann aber kein Land allein, das geht nur in Europa. Deshalb wünsche ich mir weiterhin eine starke EU. Dazu könnte Österreich beitragen. Doch das wird mehr Weltoffenheit brauchen. Ein Antiprovinzialismus wäre hilfreich, um sich von der eigenen Nabelschau zu entfernen.
Viel zu wenig wird auf die prekär Beschäftig-ten geachtet. Die können nicht auf die Pension sparen und sich vielleicht bald nicht mehr die Miete leisten. Was soll aus diesen Leuten werden?
Und ich will endlich eine effiziente Frauen-politik. Im Vergleich zu anderen Ländern stagniert bei uns die Einkommensschere. Woran kann das liegen? Ich bin fast ein wenig ratlos.
Aufgezeichnet von FLORIAN GASSER
Sophie Loidolt, 33, ist Assistentin für Philosophie an der Universität Wien. Sie wurde von Konrad Paul Liesmann nominiert
Romy Grasgruber-Kerl, 29, Projektkoordinatorin in der Initiative Gemeinnütziger Organisationen. Sie wurde von Anneliese Rohrer nominiert
14 ÖSTERREICH
DRINNEN
Ich lebe seit vier Jahren in Wien, bin mit einem Wiener verheiratet und fühle mich dieser Stadt in einer heißen, kitschigen Liebe verbunden. Aber die Wiener machten es mir anfangs nicht leicht. Erst später habe ich verstanden, dass die einfach so sind, ein bissl grantig. Liegt das womöglich daran, dass sie wenig Erfahrung damit haben, selbst fremd zu sein?
Meine Familie stammt eigentlich von den Azoren. Der Urgroßvater kam als Walfänger nach Kalifornien. Mein Vater, der als Soldat verwundet wurde und daher Anspruch auf ein Stipendium hatte, war dann der Erste in unserer Familie, der ein College besuchen konnte. Deine Vorfahren sind mittellos in dieses Land gekommen, um ein besseres Leben zu erkämpfen: Diesen amerikanischen Traum hat meine Familie lange gläubig gelebt, bis sie von der Finanzkrise kalt erwischt wurde.
Mein Interesse für Geschichte verdanke ich mei-ner Schwester, die als Elfjährige aus Nicaragua adop-tiert wurde. Um ihre Kultur besser zu verstehen, habe ich mich in die Geschichte Mit-telamerikas eingelesen und am Agnes Scott College, ei-ner Frauen-Uni in Atlanta, auch Geschichte studiert. Als ich ein paar Jahre später meine Forschungsarbeit in Österreich vorbereitete, stieß ich auf den Mythos der Trümmerfrauen. Die arche-typische anonyme Trüm-merfrau galt als unpolitisch. Diese Frauen wurden nicht als Täterinnen wahrgenommen und boten sich somit ideal als Imageträger für die Nation an, die sich ja als erstes Opfer Hitlers verstehen wollte. So konnten sich potenziell alle Österreicher mit diesem Mythos iden-tifizieren. Um ihn zu hinterfragen, habe ich 25 ältere Damen aus Wien interviewt. Da zeigte sich, dass diese Frauen natürlich viel komplexere Geschichten hatten als diese idealisierten Trümmer-Heldinnen.
Aufgezeichnet von ERNST SCHMIEDERER
Träume und TrümmerEine Amerikanerin in Österreich: Molly Roza, 27, Historikerin
Molly Roza aus Kalifornien lebt in Wien
Schwerpunkt: Nationalratswahlen 2013
Bürgerbeteiligung statt KleinkriegeRomy Grasgruber-Kerl will keine Alibiaktionen mehr, sondern echte Reformen
Mehr Antiprovinzialismus, bitteSophie Loidolt wünscht der Politik mehr Fantasie und Mut
Foto
s: G
ian
mar
ia G
ava
; E
rnst
Sch
mie
de
rer
(r.)

CH
PREIS SCHWEIZ 7.30 CHF
Schweiz
Kleine Fotos (v.o.n.u.): plainpicture; Pressefoto Baumann/imago
Abonnement Österreich, Schweiz, restliches Ausland
DIE ZEIT Leserservice, 20080 Hamburg, Deutschland Telefon: +49-40 / 42 23 70 70Fax: +49-40 / 42 23 70 90E-Mail: [email protected]
ZEIT ONLINE GmbH: www.zeit.de; ZEIT-Stellenmarkt: www.jobs.zeit.de
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, 20079 Hamburg Telefon 040 / 32 80 - 0; E-Mail: [email protected], [email protected]
Ich habe Stress! Warum lassen die Firmen ihre Mitarbeiter allein?Seite 13
Die FDP der vergangenen vier Jahre war ein Ärgernis. Mit der verunglückten Regierungs-arbeit hat sie sich ihre Abwahl redlich verdient. Aber keine zwei Wochen später, da Berlin
nur über Steuererhöhungen diskutiert, wünscht man sich die Liberalen schon fast wieder zurück.
Es ist paradox. Deutschland ist im Auf-schwung, der Staat nimmt mehr Steuern ein denn je und erzielt bereits Überschüsse. Und doch reden alle plötzlich über höhere Abgaben. Jetzt rächt es sich, dass Angela Merkel im Wahl-kampf kein eigenes Programm vertreten hat, al-lenfalls ließ sie – wie im Streit um die Maut – ein kurzes »Mit mir nicht« hören. Ganz anders die Opposition, die sich genau ausmalte, wer mehr bezahlen soll. Jetzt müssen diese beiden Seiten koalieren, und das heißt: eine Mitte finden zwi-schen den Forderungen der SPD und den Nicht-forderungen der Frau Merkel.
Ohne den Anker eigener Vorhaben bewegt sich die Union auf das zu, was die möglichen Partner zur Linken gerne möchten. Und nichts haben die sich im Wahlkampf mehr gewünscht als höhere Steuern. Also war es schon vor dem ersten Sondierungsgespräch ausgemachte Sache: Der Spitzensteuersatz steigt. Alles unter 50 Pro-zent ist offenbar gar kein Problem mehr. Noch bevor die Sozialdemokraten nur einen Schritt getan haben, ist die Union ihnen schon ent-gegengeeilt. Da hilft auch das neueste Dementi aus Bayern nichts mehr.
Die oberen zehn Prozent tragen mehr als die Hälfte der Einkommensteuer
Man kann mit Recht behaupten, das Votum für Merkel sei auch eines gegen neue Belastungen gewesen, weil die Union sie im Wahlkampf ab-gelehnt hat. Aber im Ringen um Koalitionen übt die Position des Verlierers eine eigentümliche Anziehung aus – vor allem da, wo sie sich in ein-fachen Zahlen ausdrückt, zum Beispiel in Steu-ersätzen. Das Problem bei diesem Mechanismus ist, dass er weder nach Wählerwunsch noch nach Sinnhaftigkeit der Kompromisse fragt.
Egal, wie es ums Land bestellt ist, es ist immer absurd, im Ringen um die richtige Wirtschafts-politik mit Steuererhöhungen anzufangen. Das »Wie viel« vor dem »Wofür« zu beantworten ist ein sicheres Rezept, den Staat aufzublähen. Heu-te ist das Vorgehen noch besonders fragwürdig. Deutschland genießt in Europa eine Sonderkon-junktur, nichts weist darauf hin, dass sie schnell vorüberginge. Der Staat nimmt also ohnedies von Jahr zu Jahr mehr ein.
Auch die Erfahrung der vergangenen zehn Jahre spricht gegen die Erhöhung. Im Jahr 2003, als Deutschland der kranke Mann Europas war, lag der Staatsanteil bei über 48 Prozent, heute, da es als einzig gesunder Mann dasteht, geneh-migt sich der Staat weniger als 45 Prozent der
volkswirtschaftlichen Leistung. Ein erfolgreicher Staat ist nicht unbedingt besonders groß, son-dern besonders wirksam: Die deutsche Wende gelang auch deshalb, weil Berlin sparte, anstatt sich zu bedienen.
Es stimmt, Deutschland muss in seine Zu-kunft investieren. Kitas und Schulen, Universi-täten und Forschung brauchen neue Mittel. Ei-nerseits. Andererseits verschleudert der Staat Steuern, für das Betreuungsgeld zum Beispiel, das Mütter aus ärmeren Schichten in die Sack-gasse lockt, weg von der Erwerbsarbeit. Auch für Steuervorteile, wie sie Hoteliers und Firmen-erben genießen, werden Milliarden verschwen-det. All das sollte die Politik erst korrigieren und Steuersünder konsequent verfolgen, bevor sie dem Volk neue Einnahmen abringt.
Es ist ja nicht so, als fehle es der nächsten Re-gierung an Herausforderungen. Die Energie-wende muss gelingen, der Strom sicher fließen, sowohl das Klima wie auch das Portemonnaie der kleinen Leute muss dabei geschützt werden. Der Euro ist noch nicht gerettet, selbst manche Bank in Deutschland wird wieder Hilfe brau-chen – und das, obwohl viele Bürger rettungs-müde sind. Außerdem muss die Politik um die jungen Menschen am unteren Rand der Gesell-schaft kämpfen, die auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben. Das alternde Deutschland braucht sie dringend – das kostet.
Doch wer mehr Gerechtigkeit bei den Abga-ben will, sollte bei der schleichenden Enteignung der Steuerzahler ansetzen: Normalverdiener rü-cken durch eine Gehaltserhöhung im Steuertarif automatisch nach oben und müssen dann höhe-re Prozentsätze zahlen – selbst wenn ihr Ver-dienst nur mit der Inflationsrate steigt. So kann es geschehen, dass sie trotz fleißiger Arbeit an Kaufkraft verlieren. Diese sogenannte kalte Pro-gression treibt vor allem die Mittelschicht in immer höhere Steuerregionen. Sie sollte endlich gestoppt werden.
Im Großen und Ganzen funktioniert die Umverteilung der Einkommen: Die oberen zehn Prozent tragen mehr als die Hälfte der Steuerlast. Anders sieht es bei den Vermögen aus, was auch an der unfairen Struktur der Erbschaftsteuer liegt, welche die Erben von Unternehmen fast vollständig verschont. Für das Argument, da-durch würden Jobs gerettet, gibt es so gut wie keine Belege – wohl aber dafür, dass derzeit viele Millionäre die unfaire Lage nutzen, um ihr Ver-mögen steuerfrei auf die Kinder zu übertragen.
Karlsruhe dürfte das Gesetz im nächsten Jahr zurückweisen. Aber Union und SPD hätten ei-nen triftigen Grund, diese Fehlentwicklung auch ohne das Einschreiten der Verfassungsrichter zu korrigieren, könnten sie damit doch einen eige-nen Fehler beheben: Das Gesetz war eine der letzten Taten der Großen Koalition von Angela Merkel und Peer Steinbrück aus dem Jahr 2009.
www.zeit.de/audio
Erst mal zahlenDer Staat erwirtschaftet Überschüsse, und doch will er die Abgaben
erhöhen. Auch weil er Milliarden verschleudert VON UWE JEAN HEUSER
STEUERN
DIE ZEITW O C H E N Z E I T U N G F Ü R P O L I T I K W I R T S C H A F T W I S S E N U N D K U L T U R 2. OKTOBER 2013 No 41
Der Hahn krähtDer frühere Tennisspieler Boris B. und der frühere Komiker Oliver P. fetzen sich auf Twitter wegen frü-herer Affären und früherer Frauen, was insofern förderlich ist, als jetzt ein Buch über das Leben des Boris B. erscheint. Es illustriert den alten Spruch Omne animal post coitum triste praeter gallum qui cantat(Nach dem Koitus ist jedes Tier traurig, außer dem Hahn, der kräht). Sehr schön, denn nun wis-sen wir, wer der Hahn ist. GRN.
PROMINENT IGNORIERT
68.JAHRGANG C 7451 C
No41
Ein Gespenst hat sich verzogen: die rot-rot-grüne Koalition. Als pro-pagandistisches Schreckensszenario im Wahlkampf erfüllte das linke Bündnis noch seinen Zweck. Doch nun, wo es im Bundestag tatsächlich
eine linke Mehrheit gibt, spielt es keine Rolle mehr. Nur für die ganz Linken in den linken Parteien dient sie noch als schmerzlindernde Utopie.
Die Regierungsbildung allerdings liegt wie selbstverständlich in der Hand der Kanzlerin. Und die scheint nicht sehr zu fürchten, die drei linken Parteien könnten sie stürzen. Die Frage nach der künftigen Koalition lautet schlicht: Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün? Und das, obwohl sich die potenziellen Partner mit einer Regierungsperspektive an Merkels Seite sicht-lich schwertun.
Aus Angst vor der Großen Koalition schraubt die SPD schon jetzt ihre Forderungen so hoch, dass die kommenden Verhandlungen leicht scheitern könnten. Und die Grünen sind vom Wahlergebnis noch so benommen, dass ernst-haftes Nachdenken über die Zumutung einer schwarz-grünen Koalition bei ihnen noch gar nicht begonnen hat. Nur eins scheint allen klar: Es gibt keine linke Option.
Das hat zuerst einmal einen ganz naheliegen-den Grund: Die SPD hat eine solche Zusammen-arbeit vor der Bundestagswahl ausgeschlossen. Zyniker und Politikverächter mögen einwenden, solche Versprechen vor der Wahl hätten nach der Wahl doch keine Bedeutung mehr. Aber das ist falsch. In Hessen hat die SPD 2008 dramatisch erfahren, was es bedeutet, ein solches Versprechen aus purem Machtopportunismus zu brechen. Es ruinierte die Partei und endete im Scheitern.
So geschähe es nun wieder, nur auf der gro-ßen Berliner Bühne. Wer vor der Wahl, wie SPD-Chef Siegmar Gabriel, inständig beteuert, er werde mit dem Land nicht va banque spielen, der tut es auch nicht. Andernfalls ist er politisch tot.
Die Wahl markiert eine Etappe der Entfeindlichung der politischen Lager
Hinzu kommt ein ganz praktisches Problem. Wer versuchen wollte, heute ein Bündnis aus
SPD, Linken und Grünen in Gang zu bringen, müsste sich darüber hinwegsetzen, dass die Mehrheit von vier Sitzen für ein solches Experi-ment arg knapp bemessen ist. Denn immer gäbe es unter den SPD-Abgeordneten aus dem Osten, bei wirtschaftsfreundlichen Grünen oder bei besonders prinzipienfesten Linken potenzielle Abweichler und damit ein permanentes Erpres-sungspotenzial aus unterschiedlichsten politi-schen Richtungen.
So ließe sich das Schlüsselland in der Mitte Europas nicht regierten. Die von ihren Wahl-ergebnissen ernüchterten rot-grünen Spitzen-vertreter sind offenbar nüchtern genug, dieses Risiko zu erkennen.
Noch gravierender wäre allerdings das Legiti-mationsdefizit einer linken Koalition. Ihr fehlt nämlich die gesellschaftliche Mehrheit. Weder stand Rot-Rot-Grün als gemeinsames Koalitions-angebot zur Wahl, noch erreichten die drei Parteien die Mehrheit der Wähler. Dass sie zu-sammen im Parlament über einen knappen Vor-sprung verfügen, ist allein dem Umstand geschul-det, dass FDP und AfD an der Fünfprozenthürde gescheitert sind. Die Mehrheit hat nicht für die drei Parteien aus dem linken, sondern für die drei aus dem rechten Spektrum votiert.
Doch was besagt diese Entscheidung heute überhaupt noch? Wenn die zurückliegenden Wahlen etwas bedeuten, dann doch eher einen weiteren Schritt zur Auflösung der politischen Lager. Denn dass die breite Unterstützung für Merkel auf eine »rechte Mehrheit« in Deutsch-land hindeutet, glauben bestenfalls noch dieje-nigen, die ihre eigene Lagerordnung verbissen verteidigen. Wer Zweifel hegt, wie wenig »Rechtes« in Angela Merkel schlummert, sehe sich auf YouTube die Szene vom Wahlabend an: Da entwindet eine barsche Kanzlerin dem CDU-Generalsekretär Gröhe das schwarz-rot-goldene Fähnchen, mit dem er seiner Sieges-freude Ausdruck verleihen will: Schluss mit dem Quatsch!
Merkel hat ihren Wahlsieg weder mit rech-ten Themen noch im »rechten« Spektrum er-reicht. Sie hat gewonnen, weil sie den Menschen in einem ökonomisch erfolgreichen, wohl-standsgesättigten Land das Gefühl gegeben hat, mit ihr werde es noch eine Weile so weiter-gehen. Ihren unpolitischen Wahlkampf kann man kritisieren, als rechte Kampagne lässt er sich kaum deuten. Das ahnt man natürlich auch bei SPD, Grünen und selbst in der Linkspartei. Deshalb kommen sie jetzt gar nicht auf die Idee, sich gegen Merkel zu verbünden. Es fehlt der ideologische Schwung, ohne den ein solch spektakuläres Experiment nicht durchzuhalten ist. Es fehlt auch der Mut, die hochpopuläre Kanzlerin zu stürzen.
So markiert die Bundestagswahl eine weitere Etappe der Entfeindlichung der deutschen Poli-tik. Statt scharfer, ideologisch befeuerter Geg-nerschaft herrscht weitgehender Konsens. Ob es um Europa oder Afghanistan, um gleich-geschlechtliche Partnerschaften oder prekäre Be-schäftigungsverhältnisse geht, es gibt heute kein relevantes Thema der deutschen Politik, bei dem die Differenzen zwischen den etablierten Partei-en so fundamental wären, dass sich aus ihnen die plausible Begründung für eine rot-rot-grüne Ko-alition ergäbe. Auch deshalb wirkt es jetzt so selbstverständlich, dass die beiden denkbaren Koalitionsvarianten, Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün, die Lagergrenzen überbrücken, statt sie neu zu zementieren. Rot-Rot-Grün durch die Hintertür ist jedenfalls keine Alternative.
www.zeit.de/audio
Kein MorgenrotIm Bundestag haben die Linken eine Mehrheit – in der
Gesellschaft vorerst nicht VON MATTHIAS GEIS
ROTROTGRÜN
Tit
elil
lust
rati
on
: M
art
Kle
in u
nd
Mir
iam
Mig
liazz
i fü
r D
IE Z
EIT
Im Dschungel der Bücher
80 Seiten Literatur zur Frankfurter Buchmesse:Die abenteuerlich schönen Bücher des Herbstes und die vitalen, melancholischen Autoren des diesjährigen Gastgeberlandes Brasilien
4 1 9 0 7 4 5 1 0 4 5 0 0 4 1

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
Die Schweiz ist kein formelles Mitglied der Europäischen Union. Mehrmals hat der Souverän den Beitritt zur Union und zum EWR in Volksabstimmungen verwor-fen. Die zunehmende Dyna-
mik der Rechtsentwicklung auf europäischer Ebene stellt die Schweiz allerdings vor Probleme. Die star-ren sogenannten bilateralen Verträge können nicht schnell genug an die Veränderungen der EU an-gepasst werden. Deshalb verhandelt die Regierung aktuell über eine Lösung der »institutionellen Fra-ge«. Die extreme Rechte unter ihrem Anführer Christoph Blocher nimmt dies zum Anlass, die be-vorstehenden Volksabstimmungen zu einem Ent-scheid »für oder gegen Europa« hochzustilisieren.
Diese zweidimensionale Debatte – für oder ge-gen Europa – ist allerdings von der Realität über-holt. Die Frage »Europa oder nicht Europa?« stellt sich längst nicht mehr. Europa wird gebaut, so oder so. Wir stehen aber an einem Scheideweg: Welches Europa wollen wir? Entweder ist es das Europa der Banken und Finanzoligarchen, oder es ist das de-mokratische Europa der Menschen. Als Nichtmit-gliedsland kann man dieser Täuschung schnell un-terliegen. Umso erstaunlicher ist es, dass die gleiche Debatte auch in Deutschland geführt wird. Die deutsche SPD hat sich im Wahlkampf empört, als ihr von Kanzlerin Merkel »europapolitische Un-zuverlässigkeit« vorgeworfen wurde. Der Fraktions-vorsitzende Steinmeier nannte die Aussage eine Sauerei. Der Punkt ist: Merkel hat recht. Nur im genau umgekehrten Sinn, als sie und die SPD mei-nen. Europapolitisch unzuverlässig und verantwor-tungslos ist genau die von der Kanzlerin wesentlich geprägte Europapolitik der Troika IWF, Weltbank, EU. Und verantwortungslos ist es, dieser Politik ein Plazet auszusprechen.
Die Rettungspolitik baut das Europa der Banken und Finanzoligarchen zulasten des Europas der Men-schen weiter aus. Die Rettungspakete und -schirme, die Strukturmaßnahmen und die »Hilfe« für Griechen-land sind vor allem ein gigantisches Umverteilungs-projekt von der Peripherie ins Zentrum und von unten nach oben. Die globalisierungskritische Organisation attac hat nachgerechnet: Laut ihrer Studie landeten gut drei Viertel der sogenannten Hilfe für Griechen-land in Wahrheit bei Banken und vermögenden Gläu-bigern. Fast 30 Prozent der Gelder wurden für die Rekapitalisierung der griechischen Banken verwendet. Gut 50 Prozent flossen direkt in die Taschen der Gläu-biger des griechischen Staates. Und nur etwas über 20 Prozent der Hilfen landeten tatsächlich im grie-chischen Staatshaushalt.
Bezahlt wird diese »Rettung« einerseits von den deutschen (und anderen) Steuerzahlern und Steuer-zahlerinnen und andererseits vor allem von den Griechinnen und Griechen selber. Das griechische Volk wird durch die regelrechte Pulverisierung des Sozialstaates und den Ausverkauf staatlicher Betrie-be schrittweise enteignet. Mit verheerenden Folgen: Offiziell sind im August 2013 27 Prozent der Grie-chinnen arbeitslos. Unter den Jugendlichen sind es 62 Prozent. Das reale Einkommen des durch-schnittlichen griechischen Haushaltes ging seit 2009 um 40 Prozent zurück. 3,4 Milliarden Grie-chinnen und Griechen sind heute armutsgefährdet, 40 Prozent von ihnen sind bereits ohne Kranken-kasse. Im Vergleich zu 2008 hat sich die Suizidrate mehr als verdreifacht. Und die Perspektiven für die meisten Griechen sind katastrophal: Die Preise und die Steuern dürften weiter steigen, die Löhne, die Renten und die Chancen auf Arbeit weiter sinken.
Es grenzt an ein kleineres Wunder, dass in Grie-chenland noch nicht geschossen wird – und in den anderen Krisenstaaten im Süden des Kontinents sieht es nur wenig besser aus. Die eigentliche Ge-fahr für Europa ist das aktuelle Krisenmanagement der Troika, diese Mischung aus ökonomischem Di-
lettantismus und knallharter Interessenpolitik. Wer Europa retten will, muss ziemlich genau das Ge-genteil von dem tun, was heute getan wird: Es braucht ein europaweites Investitionsprogramm, finanziert durch eine materielle Harmonisierung der Besteuerung von Unternehmen und großen Vermögen – und keine Austerität. Wir müssen die Finanzmärkte und die Finanzprodukte deutlich strenger regulieren – stattdessen belassen wir es bei einer Bankenunion. Und die Europäische Zentral-bank muss dringend reformiert werden, damit sie in Zukunft die Staaten direkt unterstützen kann. Zudem müssen die Wirtschafts- und Sozialpoliti-ken koordiniert werden, insbesondere ist ein Lohnwachstum in Deutschland gefragt, das wie-der mit der Produktivitätsentwicklung mithält. Nur so können die Binnenkaufkraft gestärkt und die Leistungsbilanzungleichgewichte in Europa abgebaut werden. Und zu guter Letzt: ein Schul-denschnitt für die betroffenen Länder, damit der Abbau der Sozialstaaten nicht noch weiter geht, und eine gemeinsame Bürgschaft für Staatsschul-den in der Zukunft.
Dieses Programm ist das Gegenteil von dem, was die Regierungsversprechen der CDU beinhal-ten. Aber es stellt weitgehend die Schnittmenge der Wirtschaftsprogramme von SPD, Grünen und Linken dar. Und es gibt dafür nach der Wahl eine Mehrheit im Bundestag. Dann nämlich, wenn man die 319 Mandate von SPD, Grünen und Linken zusammenzählt (CDU: 311). Der Koalitions-entscheid in Deutschland wird für Europa wegwei-send sein. Die Position der deutschen Regierung wird das Gesicht Europas entscheidend prägen. Deutschlands aktuelle Position im europäischen Machtgefüge bringt eine enorme Verantwortung für den Kontinent mit sich.
Aber Merkel und ihre CDU sind ökonomisch unfähig und politisch unwillig, diese Verantwor-tung wahrzunehmen. Jetzt würde eine Mehrheit von acht Stimmen für eine links-grüne Achse Ber-lin–Paris reichen, die die Kraft hätte, die Politik der Troika grundlegend zu verändern. Bei der gegen-wärtigen Entwicklung in den Ländern des Südens bleibt nicht mehr viel Zeit. Dass diese Chance nach dem aktuellen Stand der Dinge an einer un-verständlichen Phobie der SPD-Führung vor ein paar westdeutschen Linken scheitert, ist absurd. Europapolitisch viel verantwortungsloser, als diese gewiss nicht einfache Einigung zumindest zu ver-suchen, wäre es, sich für das Europa der Banken und Finanzoligarchen zu entscheiden. Und genau das tut die SPD, wenn sie Merkel den Kanzlerstuhl vier weitere Jahre überlässt.
Der Autor ist Aargauer SP-Nationalrat
Stürzt Merkel!
Zum Wohle Europas: Die SPD müsse mit Grünen und
Linken an die Macht meint CEDRIC WERMUTH
CH
12 SCHWEIZ
Illu
stra
tio
n:
Joch
en
Sch
ievi
nk f
ür
DIE
ZE
IT/
ww
w.jo
che
nw
orl
d.d
e

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 SCHWEIZ 13
So einStress
Der Druck am Arbeitsplatz macht so vielen
Menschen zu schaffen wie noch nie. Was
unternehmen große Schweizer Firmen, um ihre
Mitarbeitenden vor der zunehmenden
Arbeitsbelastung zu schützen? Nichts
VON SARAH JÄGGI
Der erste Kontakt für diesen Artikel. Am Telefon Max Scheidegger, Geschäftsfüh-rer der Dachorganisation HR Swiss, der Schweizeri-schen Gesellschaft für Per-sonalwesen. Ja, sagt er, na-
türlich sage ihm das Thema etwas – und erzählt dann nicht von Verbandsmitgliedern, sondern zuerst von sich selbst: »Heute Morgen, da ging es mir wohl wie vielen, als ich meine E-Mails las. Ich hatte eine Nachricht von meinem Vorgesetzten im Posteingang. Verschickt um 00.53 Uhr.«
Dass Scheidegger seine Mails erst auf dem Weg ins Büro abruft, ist heute ein Verhalten, das ausstirbt. Würde der Arbeitnehmer in den USA leben, wäre er die große Ausnahme. Laut einer Studie lesen dort 80 Prozent der Befragten ihre E-Mail-Nachrichten, wenn sie noch im Bett sind.
Dank E-Mail und Smartphones sind wir heute rund um die Uhr erreichbar. Die Trennung zwi-schen Arbeit und Freizeit, die früher die Stempel-uhr markiert hat, löst sich auf. Das schafft neue Freiheiten, aber auch neue Probleme. Allen voran: mehr Stress.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt beruflichen Stress zu den »größten Gefahren des 21. Jahrhunderts«. Dass Stress auch in der Schweiz nicht nur eine Handvoll ruhelose Spitzenmanager betrifft, sondern breite Massen von Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmern, zeigt die Stressstudie 2010 des Schweizer Staatssekretariats für Wirt-schaft (Seco): Jeder dritte Erwerbstätige fühlt sich bei der Arbeit chronisch gestresst, sieben Prozent so sehr, dass sie die Überforderung schlecht oder gar nicht bewältigen können. Das entspricht einer Zunahme von 30 Prozent innerhalb von nur zehn Jahren. Zeitdruck, lange Arbeitszeiten, unklare Anweisungen und Arbeiten, die in der Freizeit erledigt werden müssen, machen immer mehr Menschen zu schaffen.
Dass Max Scheidegger sich von den nächt-lichen Mails nicht stressen lässt, hat er sich und seinem Chef zu verdanken. Sich selbst, weil er dis-zipliniert genug ist, nächtens keine E-Mails zu le-sen. Und seinem Chef, weil dieser nicht erwartet, dass seine Nachrichten sofort beantwortet wer-den. Trotzdem ist für Scheidegger klar: »Spätes-tens der Fall Carsten Schloter hat gezeigt, dass es ein Umdenken braucht, dass es Zeit ist, nicht nur über Beschleunigung, sondern auch über Ent-schleunigung nachzudenken.« Der Suizid des Swisscom-CEO hat die Rund-um-die-Uhr- Arbeiter in der Schweiz aufgerüttelt. Er war einer von ihnen, einer, den sie alle bewunderten. Wenn es ihn trifft, könnte es alle treffen.
Ein Unternehmen, das seit zwei Jahren ver-sucht, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mehr Erholung zu zwingen, ist Volkswagen. Beim
größten Autohersteller Europas wird der E-Mail-Zugang der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über Nacht unterbrochen. Eine halbe Stunde nach Arbeitsschluss ist Schluss, dann werden kei-ne Nachrichten mehr auf Smartphones weiter-geleitet. Durchgesetzt hat die Regelung der Be-triebsrat. Er will damit den Arbeitnehmern zu ih-rem Recht auf Erholung verhelfen – und sie vor ihren ruhelosen Chefs schützen. Denn für diese gilt die E-Mail-Sperre nicht.
Für den Zürcher Arbeits- und Gesundheits-forscher Georg Bauer vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin an der Universität Zürich hat eine solche Maßnahme vor allem symbolische Bedeutung. Der überbordende Umgang mit E-Mail und Smartphone ist für ihn nur die Spitze des Eisberges. Verdichtung und Beschleunigung der Arbeit sind für ihn die großen Gesund heits-risiken einer modernen, dienstleistungsorien-tierten Arbeitswelt: »Immer weniger Leute müs-sen in immer kürzerer Zeit immer mehr Aufgaben bewältigen.« Welche volks-wirtschaftlichen Kosten ge-stresste Erwerbstätige verursa-chen, wenn sie krank werden, wurde in der Schweiz zuletzt vor 13 Jahren erhoben. Die Kosten wurden damals auf jährlich 4,2 Milliarden Fran-ken geschätzt.
Im Arbeitsgesetz steht, dass der Arbeitgeber »alle Maß-nahmen treffen muss, die nö-tig sind, um den Gesundheits-schutz zu wahren und zu verbessern und die physische und psychische Gesundheit zu gewähr-leisten«. In der Praxis tun sich die Unternehmen damit allerdings schwer. Auch darum, so Bauer, »weil Stress trotz seiner großen Verbreitung viel zu sehr als Problem des Einzelnen und nicht als Teil einer Unternehmenskultur betrachtet wird«. Da-rum sucht man die Lösung beim Mitarbeiter und nicht bei der Firma.
Wie also gehen große Schweizer Unternehmen mit dem E-Mail-gefluteten Alltag im Büro um? Welche Instrumente kennen sie, um ihre Mit-arbeitenden vor Stress und sich selbst vor Arbeits-ausfällen zu schützen? Wen man auch fragt, ob Migros, Credit Suisse, UBS oder die Bundes-verwaltung: Die Antworten der Verantwortlichen gleichen sich und lassen nicht darauf schließen, dass das Thema Stress hohe Priorität genießt.
Das klingt dann zum Beispiel so: »Als ver-antwortungsvoller Arbeitgeber leistet die Credit Suisse ihren Beitrag zur Gesundheit ihrer Mit-arbeitenden, unter anderem mit einem umfang-reichen Angebot bei Gesundheitsförderung, Er-holung und Sport.« Und: »Generell unterstützt die Credit Suisse ihre Mitarbeitenden bei der Er-
reichung einer Balance zwischen Beruf und Pri-vatleben. Dies unter anderem mit flexiblen Arbeits zeitmodellen. Zudem bietet die Credit Suisse ihren Mitarbeitenden eine interne Bera-tungsstelle.« Die Bundesverwaltung in Bern lässt ausrichten, dass eine generelle Regelung im Um-gang mit E-Mails »undenkbar« sei. Dies darum, weil die 36 000 Mitarbeitenden in verschiedenen Zeitzonen arbeiten würden. Außerdem können Maßnahmen wie eine Mailsperre auch dazu füh-ren, »dass sich der Stress der Mitarbeitenden ein-fach auf den nächsten Morgen verlagert«.
Fragen wir also beim größten Telekomanbieter der Schweiz, der Swisscom. Welche Lehren hat man aus dem Tod des eigenen CEO gezogen, der sich in Interviews mehrmals zu seinem eigenen Leiden an den modernen Arbeitsrhythmen und -tempi geäußert hat? »Beschleunigung lässt sich nicht mit Einzelmaßnahmen bekämpfen«, sagt Personalchef Hans Werner. »Wir haben eine breit abgestützte Unternehmenskultur, die bereits sehr
viel Flexibilität zulässt. Zudem ermöglichen wir unseren Ka-dermitarbeitenden alle fünf Jahre einen längeren Sabbati-cal. Insofern sahen wir keinen Grund, nach dem Tod von Carsten Schloter zusätzliche Instrumente auf Personal-ebene zu installieren, die den Umgang mit Smartphones und E-Mails regeln.« Statt-dessen setzt Werner auf eine »gesunde Team- und Füh-
rungskultur sowie auf die Eigenverantwortung« der Mitarbeitenden. »Wir stärken unsere Leute darin, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Beruf zu finden, und motivieren sie, Ferien zu beziehen und das Wochenende wenn irgend mög-lich zur Erholung zu nutzen.«
Der hilflose Umgang der Schweizer Unterneh-men mit dem Stress ihrer Mitarbeiter ist für Gesund-heitsforscher Georg Bauer eine verpasste Chance: »Wenn wir die Gesundheit bei der Arbeit verbessern möchten, sollten wir in Zukunft nicht nur an Lärm, Sturzgefahr und Schadstoffbelästigungen denken, sondern genauso selbstverständlich auch an Stress.« Und uns von der Vorstellung verabschieden, dass nur der ein guter Arbeitnehmer ist, der vor lauter Arbeitsbelastung auf dem Zahnfleisch geht.
Ein Mittel, dies zu tun, ist der »Gesundheits-index«, den Bauer und sein Team entwickelt ha-ben. Das Instrument, das bereits versuchsweise von Firmen getestet wurde, misst das Stressniveau für ein ganzes Unternehmen. Über Mitarbeiterbe-fragungen werden berufliche Ressourcen und Be-lastungen erhoben. Zeitdruck, Unterbrechungen oder unklare Zuständigkeiten werden gegen klare Aufträge, Wertschätzung von Vorgesetzten, Auto-
nomie oder ganzheitliche Aufgaben aufgerechnet. In den Betrieben, in denen genügend finanzielle und personelle Ressourcen vorhanden sind, wur-den deutlich weniger Absenzen und weniger Schlafstörungen festgestellt. »Interessant ist dabei, dass ein verbesserter Indexwert nicht nur zu bes-serer Gesundheit führt, sondern auch mit einer höheren Leistung einhergeht«, so Bauer. Ende dieses Monats werden Georg Bauer und sein Team den »Gesundheitsindex« vorstellen und mit interessierten Betrieben weiterentwickeln.
Aber vielleicht müssen ja Einzelbeispiele Schu-le machen und den Großunternehmen als Vorbild dienen. Einer, der sich seit Jahren persönlich um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter kümmert, ist Roger Herzig, seit 15 Jahren CEO des Türenher-stellers RWD Schlatter mit 180 Mitarbeitenden. Das Unternehmen in Roggwil, St. Gallen, gehört zur Arbonia Forster Gruppe und wuchs in den vergangenen Jahren stetig.
Für Roger Herzig sind vor allem zwei Dinge Chefsache: Zukunftsszenarien für die Firma zu entwickeln und seine Mitarbeiter zu entlasten. Er tut dies auf seine ganz eigene Weise. Herzig führt nämlich, indem er seinen Mitarbeitenden ver-traut: Rapportblätter sind für ihn Zeitverschwen-dung, also hat er sie abgeschafft. Arbeitszeiterfas-sung findet er unnötig, also gibt es sie nur für Mitarbeiter, die an einen Gesamtarbeitsvertrag gebunden sind – auch wenn Herzig sich damit arbeitsrechtlich in einer Grauzone bewegt. »Ich kann jemanden nicht loben, der besonders lange braucht, um eine Arbeit zu erledigen«, sagt er. Dass er einen Mitarbeiter zu mehr Arbeit anhält, komme darum nie vor, dass er einen motiviert, den Nachmittag freizumachen, immer mal wie-der. Die Absicht dahinter: Druck wegnehmen.
Seit einem Jahr gehört auch eine Frau zum Antistressprogramm des Türenfabrikanten, sie ist als Coach einmal pro Woche da und widmet sich den persönlichen Anliegen der Mitarbeiter. Das Angebot wird rege genutzt – hauptsächlich, um private Probleme zu besprechen. Die 50 000 Franken pro Jahr übernimmt die Firma. »Die pri-vaten Probleme meiner Mitarbeiter gehen mich zwar nichts an, aber sie tangieren mich. Darum habe ich ein Interesse, diese zu lösen.«
Manchmal muss Roger Herzig seine Mitarbei-ter auch vor sich selbst schützen. So wie neulich jenen Mann aus dem mittleren Kader, der sich nach einer Operation zu Hause erholte und acht Wochen krankgeschrieben war. Dass er dort, statt sich zu erholen, weiterarbeitete, Projekte ent-wickel te und Kunden kontaktierte, bemerkte Herzig erst, als sein Kollege wieder zurück in der Firma war. Und so entschied er kurzerhand, den Mitarbeiter noch einmal in die Ferien zu schi-cken. Um sich nachträglich zu erholen. Ferien als Strafaufgabe sozusagen.
Sind wir erst gut, wenn wir auf dem Zahnfleisch gehen?
Der CEO, der es anders macht, sagt: »Die privaten Sorgen meiner Mitarbeiter tangieren mich. Also will ich sie lösen«
CAROLINA MÜLLERMÖHL
Seit den tragischen Suiziden von Carsten Schloter und Pierre Wauthier spekulieren die Medien über das »Warum«? Dramatische Vor-fälle wie diese eignen sich offensichtlich in Zeiten des Auflagenrückgangs der Printme-dien, um die Verkaufszahlen anzukurbeln. So hat eine Schweizer Wochenzeitschrift das The-ma gleich zweimal auf der Titelseite ausgestellt. Ich finde das geschmacklos, insbesondere wenn es dabei darum geht, Schuldige zu suchen und an den Pranger zu stellen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. Wie er damit umgeht, ist seine Sache, und vor allem ist es seine Verant-wortung. Ich maße mir an dieser Stelle keine Bewertung an.
Was mich aber nach den Medienberichten der vergangenen Wochen als Verwaltungsrätin verschiedener Unternehmen beschäftigt, ist die Frage, was einen guten Verwaltungsrat aus-macht. Wurde dem Swissair-Verwaltungsrat nach dem spektakulären Grounding und den UBS-Verantwortlichen nach der staatlichen Rettungsaktion Führungsschwäche vorgewor-fen, so lautet die Kritik in der aktuellen Dis-kussion, dass sich der Verwaltungsrat zu stark in das operative Geschäft eingemischt und ei-nen unangemessenen Druck auf die operative Führung ausgeübt habe.
Tatsache ist, dass die öffentliche, vor allem aber die veröffentlichte Meinung oft wenig da-mit zu tun hat, was selbst ein gut funktionie-render Verwaltungsrat in der Schweiz tun soll und kann. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich: Jedes Gremium funktioniert anders. Und jeder personelle Wechsel verändert die Grup-pendynamik. Es gibt Verwaltungsratspräsiden-ten, die autoritär führen, sich nur mit wenigen Vertrauten vertieft besprechen und die Ent-scheidungen im Kleingremium treffen, es gibt aber auch Verwaltungsräte, die ein starkes Team bilden, das die ihm zugewiesenen Frage-stellungen und Aufgaben gemeinsam angeht und löst.
Deshalb ist aus meiner Sicht, neben cha-rakterlicher Integrität und Führungskultur, der richtige Mix das Wichtigste für einen gut funktionierenden Verwaltungsrat. Dieser ist nicht nur ein Gebot der Good Corporate Go-vernance, er ist auch entscheidend für das Zu-sammenspiel der Verwaltungsräte untereinan-der und für deren Beziehung zu der operativen Geschäftsleitung. Es ist also keineswegs ein persönliches Hobby von mir, die richtige »Di-versity« in einem Aufsichts- und Strategie-Gre-mium anzumahnen, sondern schlichtweg eine Notwendigkeit, die über den Erfolg eines Un-ternehmens mitentscheidet. Und was ist der richtige Mix? Selbstverständlich ist Know-how gefragt und, gerade in internationalen Firmen, eine Durchmischung der Kulturen. Zudem ist echte Unabhängigkeit zentral und – natürlich – die angemessene Vertretung von Frauen. Für lange Zeit delegierte das »Boys Network« seine Vertreter in die prestigeträchtigen Verwal-tungsräte renommierter Schweizer Unterneh-men.
Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Heute sind in einem optimal zusammengesetzten Verwaltungsrat Meinungsvielfalt und Kon-fliktfähigkeit gefragt.
Für Professor Martin Hilb, Leiter des Insti-tuts für Führung und Personalmanagement an der HSG, generiert Diversität aber nur dann einen Nutzen, wenn der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung die Stärken und Schwä-chen aller Teammitglieder kennen. Komple-mentäre Qualitäten und ein ausbalanciertes Rollenverhalten im Team garantieren am ehes-ten den Erfolg. Erfolgreiche Headhunter ach-ten inzwischen auf diese Balance, wenn sie Kandidaten und Kandidatinnen für einen Ver-waltungsrat vorschlagen.
Nur wenn eine kritisch-konstruktive Hal-tung gefordert und gefördert wird, kann ein Verwaltungsrat im Krisenfall schnell und ziel-sicher entscheiden. Denn eines ist sicher: Die Öffentlichkeit und der Gesetzgeber werden ihr Augenmerk mehr denn je auf die Qualität und die Fähigkeiten der Menschen legen, welche die »Oberleitung der Gesellschaft«, wie es das Obligationenrecht postuliert, ausüben. Per-sönliche Profilierungsbedürfnisse und einsame Entscheide haben da keinen Platz mehr.
Carolina Müller-Möhl ist Unterneh-merin in Zürich
Foto
s [M
]: d
oc-
sto
ck (
o.)
; T
ho
mas
Bu
chw
ald
er
Die Oberleitung unserer Gesellschaft
Warum es immer wichtiger wird, einen guten Verwaltungsrat zu haben

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
CH
14 SCHWEIZ
NORDSÜDACHSE
Am 22. September haben sich die Tessiner mit großer Mehrheit für ein Vermummungsverbot, das auf die Verbannung der Burka aus dem öffentlichen Raum abzielt, ausgesprochen. Die Burka war aber nur ein Vorwand, um mit dem Stimmzettel dem existierenden Unbehagen Luft zu verschaffen.
Und schon haben die üblichen gegenseitigen Anschuldigungen begonnen. Die einen, die dafür gestimmt haben, werden als Troglodyten und Rassisten beschimpft, diejenigen, die dagegen waren, als Landesverräter. Anstatt die Wähler hochnäsig zu belehren, was zu nichts führt, wäre es nützlich, die Überlegungen von Samuel P. Huntington in Erinnerung zu rufen. Sein Essay The Clash of Civilizations, erschienen 1993 in Foreign Affairs, und der darauf folgende Buch-Bestseller wurden in unzählige Sprachen über-setzt. Huntingtons These: Die Ursache der zu-künftigen Konflikte auf dieser Erde wird weder ideologisch noch ökonomisch, sondern kulturell bedingt sein. Es wird ein Kampf der Kulturen stattfinden. Eine Vision, die im totalen Gegensatz steht zu marxistischen und anderen Analysen, welche die These vertreten, die Wurzel jeden Kon-flikts sei ökonomischer Natur. Sicher war es kein politisch korrektes Buch.
Was nach der Analyse des Wissenschaftlers pas-siert ist, spricht für seine Überzeugungen: 9/11, die Anschläge von Lon-don und Madrid, das Wiedererwachen der slawischen Kultur, die Probleme in Georgien, die Ermordung von Christen. Und als Saudi-Arabien den islamischen Bosniern zur Zeit des Balkankriegs Waffen und Geld geliefert hat, geschah dies sicher nicht aus ökonomischen oder territorialen Interessen.
Huntington bekämpft den Multikulturalis-mus zu Hause und den globalen Universalismus. Er plädiert für die Einzigartigkeit unserer Kultur. Man müsse die Verschiedenheiten anerkennen, aber gleichzeitig keine neokolonialistische Illusi-on hegen, die westliche Kultur gelte universell.
Kriege, die mit dem Vorwand der Demokra-tisierung geführt wurden (wie im Irak und in Libyen), haben andere Clans und Stämme an die Macht gebracht, große Unsicherheit in den ein-zelnen Ländern gestiftet und keine grundsätzliche Änderung der Verhältnisse erreicht. Der Arabi-sche Frühling ist bei uns sofort fälschlicherweise als ein Verlangen nach unserer Form von Demo-kratie verstanden worden. Der arme tunesische Straßenhändler, der sich angezündet hat, wusste nicht einmal, was Demokratie ist. Er war nur ver-zweifelt, weil die korrupten Polizisten tagtäglich ein Bakschisch von ihm verlangten, das er nicht mehr bezahlen konnte.
Unsere Haltung ist einerseits oft von kulturel-ler Arroganz und Unkenntnis anderer Kulturen geprägt und andererseits von einer fehlenden Ver-teidigung unserer einzigartigen Werte und Kultur, eine Unart, die man auch Selbstentmündigung nennen könnte. Wer seine Werte verteidigt, ist noch lange nicht respektlos gegenüber anderen.
Behörden, Gerichte und Medien sollten sich ernsthaft fragen, ob und wie sie das reale Un-behagen mitverschuldet haben. Vielleicht sollten sie deshalb mal Huntington lesen.
Nächste Woche in unserer Kolumne »Nord-Süd-Achse«: die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz
Tito Tettamanti ist Financier in Lugano
Lest mal Huntington!
Warum das Tessin die Burka verboten hat VON TITO TETTAMANTI
Ihre Leber ist vergrößert!« So der Arzt, der die Ultraschalluntersuchung durchführt. Herr Kel-ler, ein 47-jähriger Manager, der seit längerer Zeit unter undefinierbaren Bauchschmerzen leidet, bekommt Herzklopfen. Der Arzt sagt
auch noch: »Sehen Sie, dies hier ist der Magen, dies die Gallenblase, auf beiden Seiten die Nieren, sie sehen gut aus, es sind keine Steine nachweisbar, und die Darm-tätigkeit ist normal. Es gibt keine Zeichen von Ent-zündungen an Divertikeln oder einer Vergrößerung der Prostata.« Was aber hört der Patient? Er hört »Ihre Leber ist vergrößert« und fragt sich, was das heißt. Hat er doch zu viel getrunken und nun eine Fettleber oder gar eine Leberzirrhose, oder könnte dies sogar Krebs bedeuten? Am Ende der Un-tersuchung schüttelt er dem Arzt freund-lich die Hand und bedankt sich. Die nahe liegende Frage, was eine vergrößerte Leber überhaupt bedeutet, wird jedoch verwor-fen, da der Patient aufgrund seiner beruf-lichen Position gewohnt ist, sich keine Blöße zu geben.
Mehr als vier Dinge können nicht er-innert werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass fünfzig Prozent der Informa-tionen vergessen sind, sobald man zu Hause ist. Beim Verlassen der Notfallsta-tion verstehen 78 Prozent der Patienten nicht, was sie tun müssen, 20 Prozent wussten nach einer Operation nicht ein-mal, ob der Blinddarm entfernt wurde oder nicht. Fachjargon in der medizini-schen Aufklärung muss vermieden wer-den, denn es verstärkt die Ungleichheit zwischen Arzt und Patient. In der un-gewohnten Situation als Kranker ist Ver-stehen sowieso schwierig, Verstehen von Fachjargon unmöglich. Wenn man je-doch nicht weiß, was man hat, was ge-macht wurde und was zu tun sein wird, ist dies schlecht für den Heilungsverlauf. Wichtig bei der Kommunikation ist nicht nur, was man als Arzt sagt, sondern auch, wie man es sagt und dass man Unausgesprochenes, das im Raum steht, anspricht.
Was der Arzt gut gemeint hat, kann beim Patienten ganz falsch ankommen
Ein junges Mädchen geht zum ersten Mal zum Frau-enarzt, dem Arzt seiner Mutter. Dieser begrüßt es herz-lich, erkundigt sich nach dem Befinden der Mutter und betont, was für eine interessante und tüchtige Mutter das Mädchen habe. Dann macht er der jungen Dame ein Kompliment über ihre schönen langen Haa-re. Es folgen die Fragen nach der ersten Periode, nach Beschwerden während des Zyklus und danach, ob sie schon einen Freund habe. Dann sagt er: »Sie können sich jetzt ausziehen.« Das Mädchen zieht sich splitter-nackt aus und erscheint völlig verschüchtert vor dem Vorhang. Der Arzt lacht und sagt: »Nein, nein, ganz brauchen Sie sich nicht auszuziehen, ziehen Sie sich vorerst unten wieder etwas an.« Es erfolgt die Routine-untersuchung der Brust und der inneren Organe auf dem Untersuchungsstuhl, die für keine Frau wirklich angenehm ist, und während der Routineuntersuchung spricht der Arzt vergnügt weiter, befragt das Mädchen über die Schule, über den Sport und darüber, was sie denn für einen Beruf ergreifen möchte. Am Ende sagt er: »Es ist bei Ihnen alles in bester Ordnung.«
Was war hier alles falsch, wenn auch gut gemeint?– Das Mädchen wird nicht als Einzelperson ernst
genommen, sondern vor allem als Tochter der Mutter.
– Ein Kompliment an eine Patientin, wenn auch nett gemeint, ist falsch, es sei denn, man kennt die Patientin wirklich gut.
– Die Frage nach ihrer sexuellen Erfahrung ist in diesem Kontext falsch, denn das Mädchen weiß nicht, dass der Arzt an seine Schweigepflicht gebun-den ist und die Mutter nicht über das Gespräch auf-klären wird.
– Der Arzt lacht, weil er nicht erwartet hat, dass das Mädchen sich ganz auszieht, es fühlt sich aber aus-gelacht. Eine gynäkologische Untersuchung ist immer ein Sichausliefern, insbesondere beim ersten Mal. Vor der Untersuchung muss der Patientin der Ablauf er-
klärt werden. Während der Untersuchung über Schule und Sport zu sprechen ist ein gut gemeintes Ablen-kungsmanöver, in diesem Moment ist jedoch die Un-tersuchung zentral, sodass man besser diese erklärt.
Über Jahrhunderte entschieden die Ärzte paterna-listisch über ihre Patienten, ohne Widerspruch zu dulden. Der Patient wurde bevormundet und weder über seine Krankheit noch über die Therapie infor-miert, geschweige denn in Entscheidungen mit-einbezogen. Lange Zeit galt es als üblich und sogar richtig, den Patienten bei schlechten Diagnosen oder tödlich verlaufenden Krankheiten über die Ernsthaf-tigkeit der Krankheit zu belügen. Alte Bücher, wie bei-spielsweise Die Frau als Hausärztin aus dem Jahr 1911, zeugen von dem zunehmenden Bedürfnis der Patien-ten, über Ursprung, Art von Krankheiten und mög-liche Therapien informiert zu sein.
Ab Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelte sich der unmündige zum mündigen, informierten, ja sogar zum autonomen Patienten. Bei chronischen und selte-nen Krankheiten ist es oft so, dass die Patienten die Spezialisten sind und wesentlich mehr über ihre Krankheit wissen als der normale Arzt. Neu sind die Patienten, die bereits alle ihre Symptome gegoogelt haben und sich etwas zurechtgelegt haben, häufig ohne es wirklich zu verstehen. Sie können einen als behandelnden Arzt mit unbequemen Fragen ganz schön nerven und auch verunsichern. Hier hilft oft die Frage: Offenbar haben Sie sich schon intensiv mit Ih-rem Leiden auseinandergesetzt, was denken Sie selber, was Ihnen fehlt oder was zu tun ist?
Alle spielen Theater, der Arzt wie der Patient. Beim Arzt beginnt die Inszenierung bereits mit der Wahl des Praxisstandortes: Aussersihl oder Zürichberg teilen et-was mit, ebenso Größe und Glanz des Messingschildes sowie die Praxiseinrichtung. Der weiße Kittel ist einer-seits Inszenierung von Seriosität, Ernsthaftigkeit und Hygiene, aber auch Demarkationslinie zwischen dem Körper des Patienten und demjenigen des Arztes. Der weiße Kittel, auch wenn er bewusst weggelassen wird, hat einen hohen Symbolgehalt. Gewisse Inszenierun-gen vertreiben Patienten: So verließ eine Bekannte die Praxis eines Psychiaters, der meterhohe Stapel von Krankenakten in seinem Behandlungszimmer liegen
hatte, auf Nimmerwiedersehen. In diese Akten wollte sie ihr Leben nicht einordnen.
Was bleibt, wenn keine Heilung mehr möglich ist
Der Tod ist der Feind von Patient und Arzt gleichermaßen. Auch in den Augen des Patien-ten kann der Arzt versagt haben, da er nicht in der Lage war, das Unabwendbare zu vermei-den. In dieser Situation ist es sehr wichtig, dass sich Arzt und Patient der eigenen Sterblichkeit bewusst sind, der Tatsache, dass niemand dem Tod entgehen kann, also der Kampf nie end-gültig gewonnen wird. Ist keine kurative The-rapie mehr möglich, gibt es erstaunlich viele Möglichkeiten, das Leben des Patienten zu verbessern, was unter dem Begriff der Palliati-on oder Palliativmedizin zusammengefasst wird. Am Ende des Lebens sollten unnötiger Aktionismus, unnötige Abklärungen und unnötige Therapien vermieden werden, und es sollte vor allem das Wohlbefinden des Patienten im Vordergrund stehen. Trotz na-hendem Lebensende darf die Visite nicht aus-bleiben, auch wenn man als Arzt Scheu emp-findet, einen Schwerstkranken zu untersuchen. Bei dem Patienten könnte sonst das Gefühl entstehen, eine Untersuchung lohne sich nicht
mehr. Gerade bei Patienten, die sich nicht gut artikulieren können, ist es wichtig, dass der Arzt durch die körperliche Untersuchung erkennt, wo er Schmerzen hat, ob er of-fene Hautstellen vom Liegen hat oder eine spezielle Mund-pflege benötigt. Bei der Kommunikation ist es wichtig, die Hierarchie zu vergessen. Der Arzt sollte nicht von oben auf den Patienten herabsprechen, sondern auf Augen-höhe sein, auf einem Stuhl neben dem Bett sitzend.
Wenn der Arzt einem Schwerstkranken etwas mitteilt, woran er selbst nicht glaubt, wird der Patient das intuitiv spüren und seinen Lebenswillen verlieren. Allzu scho-nungslose Kommunikation kann aber auch Hoffnung zerstören. Die Wahrheit so zu kommunizieren, dass sie noch Hoffnung zulässt, ist eine hohe Kunst.
Dieser Artikel ist eine mit der Autorin abgestimmte Collage aus ihrem Buch »Diagnose einer Beziehung«
Brida von Castelberg: Diagnose einer Beziehung Kein&Aber, erscheint im Oktober 2013
Der Arzt sollte nicht von oben auf seinen Patienten herabsprechent
»Sie können sich jetzt
ausziehen« Was Patienten verstehen, wenn
Mediziner reden. Die ehemalige
Chefärztin BRIDA VON CASTELBERG erzählt
Foto
: G
ett
y Im
age
s, M
on
tage
: D
Z

Die FDP der vergangenen vier Jahre war ein Ärgernis. Mit der verunglückten Regierungs-arbeit hat sie sich ihre Abwahl redlich verdient. Aber keine zwei Wochen später, da Berlin
nur über Steuererhöhungen diskutiert, wünscht man sich die Liberalen schon fast wieder zurück.
Es ist paradox. Deutschland ist im Auf-schwung, der Staat nimmt mehr Steuern ein denn je und erzielt bereits Überschüsse. Und doch reden alle plötzlich über höhere Abgaben. Jetzt rächt es sich, dass Angela Merkel im Wahl-kampf kein eigenes Programm vertreten hat, al-lenfalls ließ sie – wie im Streit um die Maut – ein kurzes »Mit mir nicht« hören. Ganz anders die Opposition, die sich genau ausmalte, wer mehr bezahlen soll. Jetzt müssen diese beiden Seiten koalieren, und das heißt: eine Mitte finden zwi-schen den Forderungen der SPD und den Nicht-forderungen der Frau Merkel.
Ohne den Anker eigener Vorhaben bewegt sich die Union auf das zu, was die möglichen Partner zur Linken gerne möchten. Und nichts haben die sich im Wahlkampf mehr gewünscht als höhere Steuern. Also war es schon vor dem ersten Sondierungsgespräch ausgemachte Sache: Der Spitzensteuersatz steigt. Alles unter 50 Pro-zent ist offenbar gar kein Problem mehr. Noch bevor die Sozialdemokraten nur einen Schritt getan haben, ist die Union ihnen schon ent-gegengeeilt. Da hilft auch das neueste Dementi aus Bayern nichts mehr.
Die oberen zehn Prozent tragen mehr als die Hälfte der Einkommensteuer
Man kann mit Recht behaupten, das Votum für Merkel sei auch eines gegen neue Belastungen gewesen, weil die Union sie im Wahlkampf ab-gelehnt hat. Aber im Ringen um Koalitionen übt die Position des Verlierers eine eigentümliche Anziehung aus – vor allem da, wo sie sich in ein-fachen Zahlen ausdrückt, zum Beispiel in Steu-ersätzen. Das Problem bei diesem Mechanismus ist, dass er weder nach Wählerwunsch noch nach Sinnhaftigkeit der Kompromisse fragt.
Egal, wie es ums Land bestellt ist, es ist immer absurd, im Ringen um die richtige Wirtschafts-politik mit Steuererhöhungen anzufangen. Das »Wie viel« vor dem »Wofür« zu beantworten ist ein sicheres Rezept, den Staat aufzublähen. Heu-te ist das Vorgehen noch besonders fragwürdig. Deutschland genießt in Europa eine Sonderkon-junktur, nichts weist darauf hin, dass sie schnell vorüberginge. Der Staat nimmt also ohnedies von Jahr zu Jahr mehr ein.
Auch die Erfahrung der vergangenen zehn Jahre spricht gegen die Erhöhung. Im Jahr 2003, als Deutschland der kranke Mann Europas war, lag der Staatsanteil bei über 48 Prozent, heute, da es als einzig gesunder Mann dasteht, geneh-migt sich der Staat weniger als 45 Prozent der
volkswirtschaftlichen Leistung. Ein erfolgreicher Staat ist nicht unbedingt besonders groß, son-dern besonders wirksam: Die deutsche Wende gelang auch deshalb, weil Berlin sparte, anstatt sich zu bedienen.
Es stimmt, Deutschland muss in seine Zu-kunft investieren. Kitas und Schulen, Universi-täten und Forschung brauchen neue Mittel. Ei-nerseits. Andererseits verschleudert der Staat Steuern, für das Betreuungsgeld zum Beispiel, das Mütter aus ärmeren Schichten in die Sack-gasse lockt, weg von der Erwerbsarbeit. Auch für Steuervorteile, wie sie Hoteliers und Firmen-erben genießen, werden Milliarden verschwen-det. All das sollte die Politik erst korrigieren und Steuersünder konsequent verfolgen, bevor sie dem Volk neue Einnahmen abringt.
Es ist ja nicht so, als fehle es der nächsten Re-gierung an Herausforderungen. Die Energie-wende muss gelingen, der Strom sicher fließen, sowohl das Klima wie auch das Portemonnaie der kleinen Leute muss dabei geschützt werden. Der Euro ist noch nicht gerettet, selbst manche Bank in Deutschland wird wieder Hilfe brau-chen – und das, obwohl viele Bürger rettungs-müde sind. Außerdem muss die Politik um die jungen Menschen am unteren Rand der Gesell-schaft kämpfen, die auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben. Das alternde Deutschland braucht sie dringend – das kostet.
Doch wer mehr Gerechtigkeit bei den Abga-ben will, sollte bei der schleichenden Enteignung der Steuerzahler ansetzen: Normalverdiener rü-cken durch eine Gehaltserhöhung im Steuertarif automatisch nach oben und müssen dann höhe-re Prozentsätze zahlen – selbst wenn ihr Ver-dienst nur mit der Inflationsrate steigt. So kann es geschehen, dass sie trotz fleißiger Arbeit an Kaufkraft verlieren. Diese sogenannte kalte Pro-gression treibt vor allem die Mittelschicht in immer höhere Steuerregionen. Sie sollte endlich gestoppt werden.
Im Großen und Ganzen funktioniert die Umverteilung der Einkommen: Die oberen zehn Prozent tragen mehr als die Hälfte der Steuerlast. Anders sieht es bei den Vermögen aus, was auch an der unfairen Struktur der Erbschaftsteuer liegt, welche die Erben von Unternehmen fast vollständig verschont. Für das Argument, da-durch würden Jobs gerettet, gibt es so gut wie keine Belege – wohl aber dafür, dass derzeit viele Millionäre die unfaire Lage nutzen, um ihr Ver-mögen steuerfrei auf die Kinder zu übertragen.
Karlsruhe dürfte das Gesetz im nächsten Jahr zurückweisen. Aber Union und SPD hätten ei-nen triftigen Grund, diese Fehlentwicklung auch ohne das Einschreiten der Verfassungsrichter zu korrigieren, könnten sie damit doch einen eige-nen Fehler beheben: Das Gesetz war eine der letzten Taten der Großen Koalition von Angela Merkel und Peer Steinbrück aus dem Jahr 2009.
www.zeit.de/audio
Erst mal zahlenDer Staat erwirtschaftet Überschüsse, und doch will er die Abgaben
erhöhen. Auch weil er Milliarden verschleudert VON UWE JEAN HEUSER
STEUERN
DIE ZEITW O C H E N Z E I T U N G F Ü R P O L I T I K W I R T S C H A F T W I S S E N U N D K U L T U R 2. OKTOBER 2013 No 41
Der Hahn krähtDer frühere Tennisspieler Boris B. und der frühere Komiker Oliver P. fetzen sich auf Twitter wegen frü-herer Affären und früherer Frauen, was insofern förderlich ist, als jetzt ein Buch über das Leben des Boris B. erscheint. Es illustriert den alten Spruch Omne animal post coitum triste praeter gallum qui cantat(Nach dem Koitus ist jedes Tier traurig, außer dem Hahn, der kräht). Sehr schön, denn nun wis-sen wir, wer der Hahn ist. GRN.
PROMINENT IGNORIERT
68.JAHRGANG C 7451 C
No41
Ein Gespenst hat sich verzogen: die rot-rot-grüne Koalition. Als pro-pagandistisches Schreckensszenario im Wahlkampf erfüllte das linke Bündnis noch seinen Zweck. Doch nun, wo es im Bundestag tatsächlich
eine linke Mehrheit gibt, spielt es keine Rolle mehr. Nur für die ganz Linken in den linken Parteien dient sie noch als schmerzlindernde Utopie.
Die Regierungsbildung allerdings liegt wie selbstverständlich in der Hand der Kanzlerin. Und die scheint nicht sehr zu fürchten, die drei linken Parteien könnten sie stürzen. Die Frage nach der künftigen Koalition lautet schlicht: Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün? Und das, obwohl sich die potenziellen Partner mit einer Regierungsperspektive an Merkels Seite sicht-lich schwertun.
Aus Angst vor der Großen Koalition schraubt die SPD schon jetzt ihre Forderungen so hoch, dass die kommenden Verhandlungen leicht scheitern könnten. Und die Grünen sind vom Wahlergebnis noch so benommen, dass ernst-haftes Nachdenken über die Zumutung einer schwarz-grünen Koalition bei ihnen noch gar nicht begonnen hat. Nur eins scheint allen klar: Es gibt keine linke Option.
Das hat zuerst einmal einen ganz naheliegen-den Grund: Die SPD hat eine solche Zusammen-arbeit vor der Bundestagswahl ausgeschlossen. Zyniker und Politikverächter mögen einwenden, solche Versprechen vor der Wahl hätten nach der Wahl doch keine Bedeutung mehr. Aber das ist falsch. In Hessen hat die SPD 2008 dramatisch erfahren, was es bedeutet, ein solches Versprechen aus purem Machtopportunismus zu brechen. Es ruinierte die Partei und endete im Scheitern.
So geschähe es nun wieder, nur auf der gro-ßen Berliner Bühne. Wer vor der Wahl, wie SPD-Chef Siegmar Gabriel, inständig beteuert, er werde mit dem Land nicht va banque spielen, der tut es auch nicht. Andernfalls ist er politisch tot.
Die Wahl markiert eine Etappe der Entfeindlichung der politischen Lager
Hinzu kommt ein ganz praktisches Problem. Wer versuchen wollte, heute ein Bündnis aus
SPD, Linken und Grünen in Gang zu bringen, müsste sich darüber hinwegsetzen, dass die Mehrheit von vier Sitzen für ein solches Experi-ment arg knapp bemessen ist. Denn immer gäbe es unter den SPD-Abgeordneten aus dem Osten, bei wirtschaftsfreundlichen Grünen oder bei besonders prinzipienfesten Linken potenzielle Abweichler und damit ein permanentes Erpres-sungspotenzial aus unterschiedlichsten politi-schen Richtungen.
So ließe sich das Schlüsselland in der Mitte Europas nicht regierten. Die von ihren Wahl-ergebnissen ernüchterten rot-grünen Spitzen-vertreter sind offenbar nüchtern genug, dieses Risiko zu erkennen.
Noch gravierender wäre allerdings das Legiti-mationsdefizit einer linken Koalition. Ihr fehlt nämlich die gesellschaftliche Mehrheit. Weder stand Rot-Rot-Grün als gemeinsames Koalitions-angebot zur Wahl, noch erreichten die drei Parteien die Mehrheit der Wähler. Dass sie zu-sammen im Parlament über einen knappen Vor-sprung verfügen, ist allein dem Umstand geschul-det, dass FDP und AfD an der Fünfprozenthürde gescheitert sind. Die Mehrheit hat nicht für die drei Parteien aus dem linken, sondern für die drei aus dem rechten Spektrum votiert.
Doch was besagt diese Entscheidung heute überhaupt noch? Wenn die zurückliegenden Wahlen etwas bedeuten, dann doch eher einen weiteren Schritt zur Auflösung der politischen Lager. Denn dass die breite Unterstützung für Merkel auf eine »rechte Mehrheit« in Deutsch-land hindeutet, glauben bestenfalls noch dieje-nigen, die ihre eigene Lagerordnung verbissen verteidigen. Wer Zweifel hegt, wie wenig »Rechtes« in Angela Merkel schlummert, sehe sich auf YouTube die Szene vom Wahlabend an: Da entwindet eine barsche Kanzlerin dem CDU-Generalsekretär Gröhe das schwarz-rot-goldene Fähnchen, mit dem er seiner Sieges-freude Ausdruck verleihen will: Schluss mit dem Quatsch!
Merkel hat ihren Wahlsieg weder mit rech-ten Themen noch im »rechten« Spektrum er-reicht. Sie hat gewonnen, weil sie den Menschen in einem ökonomisch erfolgreichen, wohl-standsgesättigten Land das Gefühl gegeben hat, mit ihr werde es noch eine Weile so weiter-gehen. Ihren unpolitischen Wahlkampf kann man kritisieren, als rechte Kampagne lässt er sich kaum deuten. Das ahnt man natürlich auch bei SPD, Grünen und selbst in der Linkspartei. Deshalb kommen sie jetzt gar nicht auf die Idee, sich gegen Merkel zu verbünden. Es fehlt der ideologische Schwung, ohne den ein solch spektakuläres Experiment nicht durchzuhalten ist. Es fehlt auch der Mut, die hochpopuläre Kanzlerin zu stürzen.
So markiert die Bundestagswahl eine weitere Etappe der Entfeindlichung der deutschen Poli-tik. Statt scharfer, ideologisch befeuerter Geg-nerschaft herrscht weitgehender Konsens. Ob es um Europa oder Afghanistan, um gleich-geschlechtliche Partnerschaften oder prekäre Be-schäftigungsverhältnisse geht, es gibt heute kein relevantes Thema der deutschen Politik, bei dem die Differenzen zwischen den etablierten Partei-en so fundamental wären, dass sich aus ihnen die plausible Begründung für eine rot-rot-grüne Ko-alition ergäbe. Auch deshalb wirkt es jetzt so selbstverständlich, dass die beiden denkbaren Koalitionsvarianten, Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün, die Lagergrenzen überbrücken, statt sie neu zu zementieren. Rot-Rot-Grün durch die Hintertür ist jedenfalls keine Alternative.
www.zeit.de/audio
Kein MorgenrotIm Bundestag haben die Linken eine Mehrheit – in der
Gesellschaft vorerst nicht VON MATTHIAS GEIS
ROTROTGRÜN
Tit
elil
lust
rati
on
: M
art
Kle
in u
nd
Mir
iam
Mig
liazz
i fü
r D
IE Z
EIT
Im Dschungel der Bücher
80 Seiten Literatur zur Frankfurter Buchmesse:Die abenteuerlich schönen Bücher des Herbstes und die vitalen, melancholischen Autoren des diesjährigen Gastgeberlandes Brasilien
PREIS DEUTSCHLAND 4,50 €
PREISE IM AUSLAND:DKR 45,00/NOR 65,00/FIN 7,00/E 5,50/Kanaren 5,70/F 5,50/NL 4,80/A 4,60/ CHF 7.30/I 5,50/GR 6,00/B 4,80/P 5,50/ L 4,80/HUF 1960,00
ZEIT ONLINE GmbH: www.zeit.de; ZEIT-Stellenmarkt: www.jobs.zeit.de
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, 20079 Hamburg Telefon 040 / 32 80 - 0; E-Mail: [email protected], [email protected]
Kleine Fotos (v.o.n.u.): DAVIDS; imago; Presse-foto Baumann/imago
Ist der Westen noch der Maßstab? 18 Antworten aus dem ganzen LandSeite 12-14
ABONNENTENSERVICE:
Tel. 040 / 42 23 70 70,Fax 040 / 42 23 70 90,E-Mail: [email protected]
JETZT JEDEWOCHE MIT
3SEITEN ZEIT
IM OSTEN
4 1 9 0 7 4 5 1 0 4 5 0 0 0 1 4 4 1S

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41
POLITIK
2 Regierungsbildung Warum
Frank-Walter Steinmeier kein guter
Außenminister wäre
3 Einwanderung Wir brauchen ein
Migrationsministerium
4 SPD Wie Hannelore Kraft die
Sozialdemokraten retten will
5 Grüne Ein Mann entscheidet:
Tarek al-Wazir
6 Italien Ex-Außenminister
Gianfranco Frattini über die
Dauerkrise seines Landes
7 Analysen
Was macht Italien so gefährlich?
Was bedeutet die Spaltung der
syrischen Opposition?
9 Geschichte Wie die ZEIT 1969
Pädophilie verharmloste
Fatale Freude an der Provokation –
ein Rückblick
10 Friedensnobelpreis Wer ihn
bekommt – und warum
11 China Parole: Zurück zu Mao
ZEIT IM OSTEN12 Deutschland Ist der Westen noch
der Maßstab? Antworten von Margot Käßmann, Kurt Beck, Claudia Michelsen und anderen
13 Ostkurve VON CLEMENS MEYER
14 Dritter Oktober Was es dieses Jahr zu feiern gibt VON SIBYLLE BERG
DOSSIER15 Datenschutz Ein EU-Abgeordneter
kämpft für ein neues Gesetz
GESCHICHTE18 Wahn »Blutige Romantik« – eine
Schau in Dresden
19 Aufklärung Ein Porträt zum 300. Geburtstag von Denis Diderot
20 FUSSBALL
Emotion Was Wutausbrüche bewirken
WIRTSCHAFT21 Erdgasförderung Norwegen plant
gigantische Maschinenparks in der arktischen Tiefsee
21 Krise Vorsicht vor einfachen Lösungen
23 Wirtschaftskompetenz Welche Lücke hinterlässt die FDP?
Markus Kerber Der BDI-Haupt-geschäftsführer fordert Investitionen in die Infrastruktur
24 Huffington Post Das erfolg-reichste Nachrichtenportal der USA
25 Amazon Hersteller wollen den Versandhändler boykottieren
26 Hafenwirtschaft Hamburg droht die Bedeutungslosigkeit
27 Lettland Ministerpräsident Valdis Dombrovskis über Sparmaßnahmen
28 Glücksspiel Automatenaufsteller streiten um Gewinne
29 Datenschutz Eine französische Firma verkauft Sicherheitslücken
30 Indien Der Chef der indischen Notenbank über die Krise
31 Europa Billigflieger und Urlaubs-reisen zeigen die Realität der Idee
Rüstung Warum Rheinmetall und Ferrostaal Rohstoffländern helfen
32 Was bewegt … Frank Asbeck?
WISSEN33 Physik Der Orientierungsstreit der
Forscher
34 Medien Online-Kommentare
35 Archäologie Inka – Die Diktatoren der Anden
36 Medizin Demenz kranke im Krankenhaus
37 Grafikseite Giftige Pilze
38 Genealogie Eine App soll Inzest in Island verhindern
41 KINDERZEIT
Fernsehen Zu Besuch auf »Schloss Einstein«
42 KINDER- & JUGENDBUCH
Portät Ein Spaziergang mit dem Jugendbuchautor Klaus Kordon
43 Neue Bücher Tipps für den Herbst
44 LUCHS des Monats
FEUILLETON45 Pop Der Sänger der Band
Rammstein schreibt jetzt Gedichte
46 Nachruf Der Schauspieler Walter Schmidinger ist tot
47 Emanzipation Frauen und soziale Rollenbilder
48 Kino Filmförderung in Gefahr? Ein Interview mit Iris Berben
49 Theater »Hamlet« in Wien
50 Internet Netz-Intellektuelle sind blind für die Macht der IT-Konzerne
51 Oper Zum 200. Geburtstag von Guiseppe Verdi
54 Kino Edgar Reitz’ »Andere Heimat«
56 Kunstmarkt Alte Meister in den Herbstauktionen
57 Jeff Koons’ »Balloon Dog« in Orange bei Christie’s in New York
58 Literatur Zum 100.Geburtstag von Claude Simon
59 Buchmarkt Die Konjunktur kleiner Bookstores in den USA
60 GLAUBEN & ZWEIFELN
Assisi Papst Franziskus besucht den Geburtsort des Heiligen Franz
REISEN 77 Oslo Das Festessen für den
Friedensnobelpreisträger
79 Azoren Wohnen mit Familienanschluss
82 Fernbusse Der Markt wächst
CHANCEN83 Religionspädagogik Ein Gespräch
mit dem islamischen Theologen Mouhanad Khorchide
84 Inklusion Die Finnen schaffen die Sonderschulen ab
Gymnasium Berliner Schüler klagen gegen Diskriminierung
85 Hochschule Zwei Unipräsidenten
Spezial: Wirtschaftsprüfer und
Unter nehmensberater
86 Serbien Ein junger Finanzminister soll das Land vor dem Bankrott retten
50 IMPRESSUM
97 LESERBRIEFE
98 ZEIT DER LESER
IN DER ZEIT
Die so gekennzeichneten Artikel finden Sie als Audiodatei im »Premiumbereich« von ZEIT ONLINE unter www.zeit.de/audio
Florian David FitzEs gab in Deutschland bestimmt einen gewissen Kul-turmachismo. Das war wohl nicht böse gemeint, aber der Westen sah sich die längste Zeit als Maßstab. Nun gab es in der DDR eine ganz andere Schauspieltra-dition, vielleicht ein wenig härter, präziser, unsenti-mentaler. Corinna Harfouch, Ulrich Mühe oder Henry Hübchen haben, hatten ja einen ganz anderen Hintergrund. Das hat die Landschaft extrem berei-chert. Auch bei Regisseuren wie Andreas Dresen spielt die Sozialisierung doch eine massive Rolle. Außerdem kamen mit der Wende ja eine Unmenge an großen und kleinen Geschichten auf, die erzählt werden wollten. Der Maßstab wurde dadurch un-merklich verschoben. Nicht unbedingt nach Osten. Die DDR gibt es ja nicht mehr. Was manchmal ver-gessen wird: die alte BRD übrigens auch nicht.
Fitz, 1974 in München geboren, ist Schauspieler (»Vincent will Meer«, »Die Vermessung der Welt«)
Winfried Glatzeder
Ob der Westen der Maßstab ist, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass eine Ostdeutsche die Maßstäbe in diesem Land gerade gewaltig verschiebt. Angela Merkel wird ja immer vorgeworfen, dass sie zu viel
aussitzt. Dabei ist das doch die wichtigste Eigen-schaft, die ein Politiker braucht: auf den richtigen Moment warten können. Das kann Frau Merkel wie kaum jemand sonst. Vielleicht, weil sie eine Ost-deutsche ist, wir waren es ja gewohnt zu warten.
Merkel hat eine der größten politischen Verände-rungen durchgebracht: Sie hat die Wehrpflicht aus-gesetzt. Und sie hat gesagt, man zwingt keinen jungen Mann in den Krieg. Mit diesem Satz hat sie meinem Vater nachträglich die Ehre erwiesen. Er ist im Krieg gefallen. Und mutig war die Kanzlerin, als sie kürzlich Die Legende von Paul und Paula als ihren Lieblingsfilm präsentierte. Als Hauptdarsteller war ich auch eingeladen. Und konnte nicht glauben, dass sie diesen lupenreinen DDR-Film wählt. Sie hätte es sich so viel leichter machen können, mit ei-nem Wim Wenders, bei dem das Feuilleton jubelt.
Glatzeder, 1945 bei Danzig geboren, Schauspieler, tritt ab 9. 10. in der Comödie Dresden auf (»Toutou«)
Margot Käßmann
Ich habe kürzlich einen mitteldeutschen Pfarrer be-sucht, der 13 Gemeinden betreut. Dreizehn! Das ist für manch westdeutsches Kirchenmitglied unvor-stellbar. Dieser Pfarrer hätte allen Grund gehabt,
erschöpft zu sein. War er aber nicht. Ohne Murren hat er sich überlegt, wie er das wohl würde stemmen können. Jeden Sonntag fährt er nun in eine andere Kirche, Gottesdienste legt er zusammen, Kirchen-vorstände hat er vereinigt. Im Westen ist es kein Wagnis gewesen, ein Christ zu sein. Im Osten sehr wohl. Wie kämen wir Westdeutschen auf die Idee, für ostdeutsche Christen der Maßstab sein zu kön-nen? In der Lutherstadt Wittenberg haben wir letztes Jahr einen Open-Air-Gottesdienst gefeiert, der im ZDF übertragen wurde. Zuvor hatten viele abgeraten – es sei zu riskant, weil so wenige Christen in dieser Stadt lebten. Der Marktplatz würde niemals voll. Und er wurde es doch. Die Gemeinde hat sich ins Zeug gelegt, manche Besucher kamen auch schlicht aus Neugier. Ich schätze diese ostdeutsche Pragmatik: So ist die Lage, wir machen das Beste daraus. Und diese Haltung wird uns noch helfen können. Es gibt heute viele Gebiete, in denen die Zahl der Kirchen-mitglieder stetig sinkt. Vielleicht sollte der eine oder andere Großstadtpfarrer mal nach Sachsen-Anhalt oder Thüringen reisen und sich erklären lassen, wie das geht: Kirche sein in einer entkirchlichten Region.
Käßmann, 1958 in Marburg geboren, Theologin, ist Lutherjahr-Botschafterin der Evangelischen Kirche
Roman HerzogDie Deutschen waren immer verschieden, den Ein-heitsdeutschen gibt es nicht. Hier bei uns in Heil-bronn schaut man nach Frankreich, in Sachsen eher nach Polen und Tschechien. Es gab in Deutschland, auch innerhalb des Westens, nie gleiche Lebensbedin-gungen. Der Westen kann also gar kein Maßstab sein. Früher war das Ruhrgebiet das industrielle Herz, heute ist es Süddeutschland, und keiner weiß, wo es morgen sein wird. Es gibt Landesteile im Osten, die heute besser dastehen als andere im Westen. Es gibt keine Überlegenheit des Westens mehr. Im Gegen-teil, es gibt im Westen Landstriche, die sich bis heu-te noch nicht von der Auswanderung nach Amerika im 19. Jahrhundert erholt haben. Von vielen aus dem Osten Abgewanderten lese ich, dass sie zurück in ihre Heimat wollen. Und das finde ich gut so.
Herzog, 1934 in Landshut geboren, war von 1994 bis 1999 Deutschlands siebter Bundespräsident
Stefan Hermann
Für mich als Koch ist eher der Osten der Maßstab. Fast nirgends in Deutschland ist es so schwer, die Leute für Sternegastronomie zu begeistern. Das Publikum in Dresden tickt sehr pragmatisch: Wenn
12 ZEIT IM OSTEN
Ist der Westen noch der Maßstab?Egal ob jung oder alt, Politiker oder Schauspieler, Koch oder Künstler: Alle 18 bekannten Deutschen, denen wir unsere
Einheitsfrage vorgelegt haben, teilen eine Beobachtung – das Verhältnis zwischen Ost und West hat sich grundlegend geändert
Schwerpunkt:
Die Einheitsfrage
Jetzt wird wieder 3. Oktober gefeiert, fast ein Vierteljahr- hundert nach der Wende. Auf diesen Seiten sagen Menschen aus Ost und West, von Roman Herzog bis Claudia Michelsen, von Margot Käßmann bis Florian David Fitz, ob der Westen noch unser Maßstab ist. Außerdem, auf S. 14: Die Autorin Sibylle Berg über den Mythos 3. Oktober – und ein großartiges Deutschland
Margot Käßmann Kurt Biedenkopf Jette Joop
Claudia Michelsen
Bernhard Vogel
Udo Reiter
Jana Hensel
Foto
s [
M]
(im
Uh
rze
ige
r v.
o.l.)
: S
. B
on
ess
/V
isu
m;
J. K
nap
pe
/3
60
Be
rlin
/p
ho
top
oo
l; E
. O
ert
wig
/Sch
roe
wig
; J.
Gya
rmat
y/V
isu
m;
Ro
eh
e/
Davi
ds;
M.
Man
n;
BU
G/
dd
p
Für die Große Koalition fordert die SPD sechs Minister und einen ideologischen Preis: Steuern rauf! Die Kanzlerin wird ihn wohl entrichten, da-mit sie Kanzlerin bleibt. Aber wirtschafts- und gerechtigkeitspolitisch ergibt der Spitzensteuersatz der SPD – 49 statt 42 Prozent – keinen Sinn.
Nicht einmal für Klassenkämpfer, schlägt doch das SPD-Modell schon bei 60 000 Euro zu (ledig, keine Kinder). 5000 pro Monat verdient ein Handwerksmeister oder eine Pilotin bei einer Billig-Airline – die gehobene Mittelschicht eben. Da gibt die jetzige »Reichensteuer« (45 Prozent ab 250 000) ein sinnfälligeres Umverteilungs-instrument her.
Zahlen wir zu wenig Steuern? Seit Jahren steigt das Aufkommen (bis auf das Krisenjahr 2009) ge-radlinig nach oben. Ganz ohne Tarif-Fummelei, schätzt das Finanzministerium, werden in den nächsten vier Merkel-Jahren zusätzlich 300 Mil-liarden Euro in die Kassen gespült. Müssen wir wie Griechenland das Defizit stauchen? Deutsch-land ist der einzige große EU-Staat mit praktisch
ausgeglichenem Haushalt. Erfordert eine grau same Staatsschuld mehr Steuern? Mit rund 80 Prozent der Wirtschaftsleistung steht Deutschland dezidiert bes-ser da als Frankreich, Ita-lien, England und Ameri-ka, von Japan (210 Prozent Staatsverschuldung) ganz zu schweigen.
Wozu also den Steuer-eintreiber von der Leine lassen? Die Sozialdemo-
kraten haben plötzlich die marode Infrastruktur entdeckt, die ihnen bis 2009 (Große Koalition I) entgangen war. Faktencheck: Das Weltwirt-schaftsforum hat gerade seinen Bericht zur Wett-bewerbsfähigkeit veröffentlicht. Deutschland steht weltweit an der Spitze – auf Platz drei. Klafft die Gerechtigkeitsschere immer weiter aus-einander? Optisch schon, wenn man die Millio-nengehälter von Hedgefonds-Akrobaten, Ban-kern, Entertainern und Fußballern betrachtet, die von exzessiv bis obszön reichen.
Aber das sind Stammtisch-Storys. Eine ver-lässlichere Messlatte gibt der »Gini-Koeffizient« her, der die Einkommensungleichheit auf einer Skala von null (alle gleich) bis eins (einer hat al-les) misst. Der deutsche gehört mit 0,27 weltweit zu den niedrigsten und liegt knapp unter dem des hochegalitären Schweden. Der Grund: Bei der Umverteilung ist Deutschland ein sozial-demokratisches Traumland. Seine Sozialleis-tungsquote liegt etwa bei einem Drittel der Wirt-schaftsleistung. (Nur Frankreich und Schweden sind etwas besser.)
Statt der SPD nachzugeben, sollte Merkel sie an das Offenkundige erinnern: dass die Schröder-Regierung die Einkommens- und Unternehmens-steuer gedrückt und den eingefrorenen Arbeits-markt aufgetaut hat. Dass Gabriel Steuern noch im August sogar senken wollte. Mithin ist es kein Zufall, dass die hiesige Arbeitslosigkeit heute halb so hoch ist wie die von Euroland. Die Hände weg von den Steuern!, möchte man Merkel zurufen – allein damit sie angesichts früherer Gelübde ihre Glaubwürdigkeit rette.
Die Macht ist wichtig, noch wichtiger aber die Vernunft, die sagt: Der minimale Umverteilungs-effekt wiegt die Nachteile nicht auf. Je höher die Steuern, desto stärker der Drang, Steuern zu ver-meiden. Höhere Sätze bedeuten nicht unbedingt mehr Einnahmen. Prinzipien darf man ruhig ehren, wenn sie auch pragmatisch sinnvoll sind. Die SPD-Steuerwünsche sind es nicht.
Unvernunftsehe
ZEITGEIST
Josef Joffe
ist Herausgeber
der ZEIT
Warum Merkel der SPD keine Steuererhöhung schenken darfJOSEF JOFFE:
Foto
: V
era
Tam
me
n f
ür
DIE
ZE
IT

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 41 ZEIT IM OSTEN 13
Und da machten wir uns auf aus der Stadt L in die Stadt H, Niedersachsen-City, um der Kunst zu huldigen. Sascha Hawemann inszenierte am Schauspiel dort die Drei Schwestern des großen Tschechow. Hawemanns Regie-arbeiten der letzten Jahre in L haben uns begeistert, und vier der Schauspieler haben mal in Leipzig die Bühne gerockt, also nichts wie auf in den Westen, Auswärtsspiel, »Hurra, Hurra, die Sachsen, die sind da!«.
Da dröhnt der Bahnhof der Stadt H, dieser große Fleischmarkt, auf dem sich die Schienenstränge und Ener-gien kreuzen. Hannover ist ja eine verhältnismäßig sau-bere Stadt, hier schlägt einem nicht Uringeruch entgegen wie in Frankfurt am Main, Düs-seldorf oder in den Trümmern der Ruhrpottmetropolen, die nach dem Soli dürsten. Kürzlich sah ich in Frankfurt am Main, ausgerechnet am Wahltag war das, wie sich zur Mittagszeit ein grindiger dünner Mann in der Fußgängerzone einen Schuss auf-kochte, sich diesen auch setzte. Ich will zurück ins Sachsenland! Urinschwerer Dunst everywhere.
Als ich in Bonn, einige Tage zuvor, aus dem Zug gestiegen war, erschrak ich angesichts einer großen Bande unvorstellbar abgerissener Gestalten, die den U-Bahn-Zugang belagerten (ja, Bonn hat eine U-Bahn!), verdammt noch mal, dachte ich, wir leben auf anderen Planeten. Klar, auch im Osten gibt es räudige Orte, die sich jeder Beschreibung entziehen, schreckliche Provinzen, in denen sich NSU und sonst was ausbrütet, Leipzig Crystal-Hauptstadt ... STOPP. Die Kunst, nur die Kunst kann uns retten. Und so sitzen wir Leipziger Hawemann-Fans im Schauspiel der großen Stadt H, sehen die großen Fragen des Seins und die Lethargie und den Zerfall der menschlichen Strukturen in der Zeit. Wo sind wir? Ost, West, südliche Gefilde? »Moskau, wir müssen nach Moskau!«, rufen sie auf der Bühne, auf der im Dun-kel ein großes M leuchtet. Und wir applaudieren begeis-tert, ja, große Kunst, auch hier wieder. Danke, Sascha!
Clemens Meyers neuer Roman »Im Stein« ist einer von sechs Kandidaten für den Deutschen Buchpreis 2013, der am 7. Oktober in Frankfurt am Main verliehen wird
OSTKURVE
Urinschwerer Dunst
Clemens Meyer, geboren 1977, Schriftsteller, lebt im Osten Leipzigs
wir Geld für Essen ausgeben sollen, muss es bitte schön auch schmecken! Der Maßstab, den die Gäste hier an Gastronomen anlegen, ist noch höher als in den alten Ländern, glaube ich. Es ist nicht selbst-verständlich, sich gutes Essen sehr viel kosten zu lassen. Deshalb gibt es zwar nur einige wenige Spit-zenköche in den neuen Ländern – aber die sind oft besser als manch westdeutsche, denn sie müssen sich richtig anstrengen. Als ich 1997 nach Dresden zog, dachte ich, ich käme in den wilden Osten, wo alles möglich sei. Aber ich musste mehr kämpfen. Ich höre oft von westdeutschen Urlaubern: »Wenn Ihr Res-taurant in Hamburg stünde, hätten Sie eine Warte-liste von drei Monaten.« Die habe ich hier nicht.
Hermann, geboren 1970 nahe Stuttgart, ist Inhaber des Dresdner Sternerestaurants Bean & Beluga
Andreas Mühe
Ich war zur Wendezeit Schüler. Wenn ich mir das heutige Bildungssystem angucke, diese Kleinstaaterei, in der Kinder so früh aussortiert werden – ehrlich, da hätte ruhig der Osten Maßstab sein können. Ich gehöre ja der letzten Generation an, die noch eine gewisse DDR-Prägung hat. Manchmal wundere ich mich, wie unpolitisch Leute meines Alters im Westen dahinsiechen. Wir im Osten sind lockerer, bekom-men von unseren Eltern keine Wohnung in Prenz-lauer Berg geschenkt. Wir müssen entweder mehr tun, um etwas zu erreichen – oder wir lassen generell das Leben entspannter angehen. Vielleicht sollten wir da besser mal der Maßstab sein? Ich finde es je-denfalls absurd, dass nach 24 Jahren so viele immer noch davon reden, wir müssten irgendeine Anglei-chung schaffen. Das ist doch kleinkariert und zurück-geblieben. Stattdessen müsste überall für gleiche Arbeit der gleiche Lohn gezahlt werden. Der Westen ist nicht mehr Maßstab, heute orientieren wir uns an Europa, vielleicht an Amerika und, schwer im Kom-men, China, Indien. In der Kunst spielen Ost und West keine Rolle. Manche sagen, in der Diktatur war die Kunst besser, weil die Reibung größer war. Ich glaube das nicht. Kunst hat Qualität oder eben nicht.
Mühe, 1979 in Karl-Marx-Stadt geboren, gehört zu den wichtigsten deutschen Fotografen
Jette Joop
In Deutschland ist gerade der hippe, junge Berlin-Style Maßstab: lässig, verschroben, auf keinen Fall macht man sich richtig schick. Man trägt Hosen, die aussehen, als lägen sie schon Jahre im Schrank. Tun sie natürlich nicht, die Materialien sind hoch-wertig, ökologisch einwandfrei. Diese Kleidung zeigt: Es geht dem Träger nicht nur ums Outfit, sondern auch um das Zurschaustellen innerer Werte. Ich glaube, dass Angela Merkel diesen Sty-le nachhaltig beeinflusst hat. Merkel pflegt diese uneitle Art der Selbstdarstellung, ihr Besinnen auf Inhalte hat die Mode beeinflusst. Da hat eine Ost-deutsche den Modemaßstab verschoben!
Joop, 1968 in Braunschweig geboren, Tochter von Wolfgang Joop, ist Modedesignerin
Kurt Biedenkopf
Der Westen ist noch nie der Maßstab für den Osten gewesen, auch wenn es manche Westdeutsche viel-leicht gerne sein wollten. Mit der Wiedervereinigung hat sich auch die alte Bundesrepublik verändert. Die Freiheit, die die Menschen im Osten lieben, ist für die Westdeutschen zu sehr zur Selbstverständlichkeit geworden. Und geht es ihnen denn besser? Nicht unbedingt! Wir Sachsen wundern uns, wie die West-
deutschen zu ihren Psychiatern strömen, weil sie sich ausgebrannt fühlen. Sächsische Bauern reiben sich die Augen, wenn sie sehen, wie planwirtschaftlich die EU-Bürokratie funktioniert. Wie sie die Größe von Maisfeldern mit Satelliten bemisst, um exakt zu kon-trollieren, dass nicht zu viel und nicht zu wenig an-gepflanzt wird. Da strahlt der alte Westen doch nun nicht gerade. Die Prioritäten sind in beiden Teilen des Landes bis heute verschieden. Aber eins darf nicht vergessen werden: Seine Stärke verdankt der Westen auch dem Osten. Nach der deutschen Teilung flohen viele Firmen aus der DDR in die BRD, von Audi bis Miele. Damit wurde der Aufbau Ost auch von Ost-deutschen getragen. Die Wiedervereinigung war für die alten Länder ein riesiges Konjunkturprogramm. Ja, der Westen bestand immer schon aus einem guten Stück Osten. Und die Menschen hier wundern sich, dass man aus ihren Erfahrungen so wenig lernen will.
Biedenkopf (CDU), 1930 in Ludwigshafen geboren, war von 1990 bis 2002 Sachsens Ministerpräsident
Reiner Calmund
Pünktlich zum Tag der deutschen Einheit stöhnen viele Klubs im Osten über die Wettbewerbsnach-teile nach der Vereinigung. Falsch! Nicht einmal 20 Prozent der Deutschen leben im Osten. Aber in der Zweiten Liga beträgt der Anteil der ostdeutschen Klubs 22 Prozent, in Liga drei gar 25 Prozent. Was fehlt, ist ein Bundesligist. Und auch den wird es bald wieder geben. RB Leipzig kann es schaffen, denn Red Bull investiert nicht nur in Beine, sondern auch in Steine. Eigentlich hätte auch Dynamo Dresden, mit seinem Stadion und den vielen Fans, beste Chancen – wenn sich der Verein nicht permanent durch Intrigen und Zuschauer-Ausschreitungen selbst schwächen würde. Dresden stellt sich gern als Wen-deverlierer dar, aber ich sehe das anders. Da geht den Heckenschützen gegen den eigenen Klub nie die Munition aus. Ich hoffe auf bessere Zeiten für Dy-namo, diesen fantastischen Verein, das ehemalige Bayern des Ostens. Außerdem ist Union Berlin, das St. Pauli des Ostens, beneidenswert gut geführt. Und Erzgebirge Aue hält sich seit neun Jahren im Profi-fußball. Ein Klub aus einer Kleinstadt, fast wie das winzige gallische Dorf! Die wahren Wendeverlierer sind Clubs wie RW Essen oder RW Oberhausen und weitere Westvereine, die früher eine bedeutende Rol-le spielten, aber in den vergangenen Jahren immer mehr von Klubs aus dem Osten verdrängt wurden.
Calmund, geb. 1948 in Brühl, war Geschäftsführer von Bayer Leverkusen und beriet Dynamo Dresden
Bernhard Vogel
Es ist gut, wenn der Westen, was Wirtschaft und Arbeit betrifft, ein Maßstab bleibt. Die Erfahrung lehrt: Wer sich mit scheinbar Unerreichbarem misst, erreicht viel mehr. Thüringen hat heute eine gerin-gere Arbeitslosigkeit als Nordrhein-Westfalen. Das finde ich beachtlich. Natürlich war nach 1990 der Maßstab West für die Wirtschaft des Ostens über-trieben hoch. Aber er hat auch geholfen und hilft bis heute. Man muss sich doch an hohen Zielen orien-tieren. Als ich 1992 nach Erfurt kam, war ich zuvor Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz gewesen. Ich wusste, wie man regiert, eine Kabinettssitzung leitet. Aber ich wusste nur wenig von Thüringen. Mir war klar: Dass ein Fremder wie ich hier regiert, ist nur für eine Übergangszeit eine Option, mein Nachfolger muss Thüringer sein. Das hat geklappt. Heute re-gieren Ostdeutsche den Osten. Das politische Per-sonal ist im Osten immer noch schön durchmischt, in Landtag und Kabinett sitzen Politiker mit allen
Es begann 2009 mit eigenen Seiten aus Dres-den. Von nun an erscheint die »ZEIT im Osten« jede Woche in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Sach-sen-Anhalt. Schreiben Sie uns zu Themen, die Ihnen wichtig sind, und schicken Sie uns Fra-gen, die Sie bewegen, gern an die E-Mail-Adres-se [email protected] IHRE REDAKTION
Herzlich willkommen!
Berufen. Da war der Westen einmal nicht Maßstab. Ich habe in Erfurt mit Physikern, Tierärzten und Theologen regiert. Das kannte ich aus Mainz nicht. Inzwischen wünschte ich mir, dort hätten sich nicht nur Juristen und Lehrer durchgesetzt.
Vogel (CDU), geb. 1932, war Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz (76–88) u. Thüringen (1992–2003)
Jana Hensel
Kurz nach der Bundestagswahl und vor der Frank-furter Buchmesse liegt die Frage, was Politik und Literatur eigentlich gemeinsam haben, nahe. Also, was meinen Sie? Genau, es gewinnen fast immer die Ostdeutschen. Hätte mir das jemand in den dunklen neunziger Jahren gesagt, ich hätte es nicht
geglaubt. Angela Merkel kann beinahe allein re-gieren. Die komplette Spitze der Grünen tritt zu-rück, nur Katrin Göring-Eckardt bleibt übrig. Gregor Gysi führt die zweit- oder drittstärkste Op-positionskraft im Bundestag an. Nicht zu vergessen: Joachim Gauck. Nun hat Clemens Meyer noch den besten Roman des Herbstes geschrieben. Und er sollte nach Julia Franck, Uwe Tellkamp, Kathrin Schmidt oder Eugen Ruge unbedingt als fünfter Ostdeutscher den Deutschen Buchpreis gewinnen. Also wenn es nach uns ginge. Wie war noch mal die Frage: Ob der Westen noch der Maßstab ist?
Hensel, geb. 1976 in Borna, ist Autorin (»Zonen-kinder«) und Vize-Chefredakteurin des »Freitag«
Winfried Glatzeder
Florian David Fitz Reiner Calmund
Andreas Mühe
Roman Herzog Stefan Hermann
Fortsetzung auf S. 14
Foto
s [M
] (i
m U
hrz
eig
er
v.o
.l.)
: Z
imm
erm
ann
/la
if;
Hag
em
ann
/H
ard
t/im
ago
; Sch
mid
t/d
apd
/d
dp
; B
aue
r; G
ou
rme
tPic
ture
Gu
ide
/Ja
hre
sze
ite
nve
rlag
; Im
age
bro
ker/
imag
o;
Mo
dje
sch
/d
dp
S

2. OKTOBER 2013 DIE ZEIT No 4114 ZEIT IM OSTEN
Claudia MichelsenAm übernächsten Sonntag wird der erste Magdebur-ger Polizeiruf mit Sylvester Groth als Kommissar und mir als Kommissarin ausgestrahlt. Der Sohn der Kommissarin gehört einer rechtsradikalen Clique an. Einigen Leuten hat das scheinbar nicht gefallen. Es gab wohl Politiker, die kritisierten, dass wir uns in Sachsen-Anhalt mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen. Wir machen aber keinen touristischen Werbefilm oder Imagefilm über Magdeburg. Nein, wir erzählen von Problemen, die es dort wie anderswo gibt. Rechtsradikalismus ist ein gesamtdeutsches Pro-blem. Manchmal glaube ich, dass uns das Ost-West-Klischee-Denken hemmt. Es gibt nicht nur den Osten, nicht nur den Westen. Die Frage, inwieweit der Westen noch Maßstab ist, klingt für mich fast wie eine Drohung. War der Westen jemals Maßstab?
Michelsen, 1969 in Dresden geboren, ist Film- und Theaterschauspielerin (»Der Turm«, »Polizeiruf 110«)
Kurt Beck
Der Westen taugt nicht als »der« Maßstab. Moralisch nicht, und wenn wir ehrlich sind: ökonomisch auch nicht mehr. Ostdeutschland ist so wichtig geworden. Wenn 2020 der Solidarpakt ausläuft, kommt die Zeit, in der auch manche Regionen des Ostens irgendwann zu Gebenden werden könnten. Der Aufbau Ost ist vorbei. Kräfteverhältnisse verschieben sich.
Die Energiewende zum Beispiel wird in wesent-lichen Teilen von Ostdeutschland geschultert. Als ich neulich mit dem Auto durch Brandenburg fuhr, sah ich wieder diese Landschaften, da wird ohne Ende Braunkohle abgebaut. Darüber spricht ja kaum einer – wie viel Braunkohle als Brückentechnologie nötig ist, damit wir schnell aus dem Atomstrom aussteigen können. Vor allem ostdeutsche Braunkohle. Was die Moral anbelangt: Da haben viele Westdeutsche ihren Vorbildstatus gleich nach der Wende verspielt. Sie wollten in den neuen Ländern eine Art Geister-Infrastruktur errichten: überdimensionierte Indus-triegebiete, für die es nicht genügend Unternehmen gibt; Abwassersysteme, für es nicht genug Abwasser gibt. Man hat falsch beraten, manchmal wissentlich. Lassen wir die Ratschläge jetzt mal sein. Partner im Geben und Nehmen ist das Gebot der Zukunft.
Beck, 1949 in Bergzabern geboren, war SPD-Chef und bis 2013 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz
Udo Reiter
Der sächsische Vater fährt mit seinem Sohn am Wo-chenende nach Bayern: »Damit du mal siehst, mei Gleenor, wie bei uns die Straßen früher ausgesehen haben.« Später, wenn der Gleene in die Lehre will, geht er aber doch lieber nach München. Da findet er leichter eine Stelle. Man sieht: Wenn man fragt, ob der Westen noch Maßstab ist, muss man erst einmal
fragen: Wofür? Für ein besseres Leben, bessere Auto-bahnen, eine gerechtere Welt? Die Lage ist unüber-sichtlich. Unsere Straßen sind heute in der Regel besser, unsere Fernsehserien erfolgreicher (In aller Freundschaft), unsere Mieten niedriger – auf anderen Gebieten geht es nur zäh vorwärts. Bei Löhnen und Gehältern zum Beispiel, vor allem aber beim Image. Da gelten die Ossis immer noch als gestrig. Von meiner Frau, einer stark verwestlichten Ostdeutschen, muss ich mir heute noch anhören, der MDR sei eine Fortsetzung der DDR mit anderen Mitteln, eine Art zynisches Ossi-Museum mit Mumien, Monstren, Mutationen. Das ist natürlich total falsch.
Reiter, 1944 in Lindau am Bodensee geboren, war Gründungsintendant des MDR (bis 2011)
Anke Domscheit-Berg
Im Gegenteil. Mir kommt es so vor, als würden Frauen aus dem Osten inzwischen zum Maßstab in der Politik. Immer wenn die Kacke richtig am Damp-fen ist, sucht man ihre Hilfe. Gerade ist meine Partei im Umbruch, die Piraten suchen neues Führungs-personal. Die Frauen, die hoch im Kurs stehen, haben Wurzeln in Osteuropa: Marina Weisband und Ka-tharina Nocun. Das finde ich schon auffällig. Offen-bar traut man uns, die wir schon eine ganze Gesell-schaftsordnung haben untergehen sehen, besonders hohe Krisenkompetenz zu. Das hat ja bei der CDU schon geklappt: Die ostdeutsche Angela Merkel hat ihre Partei aus dem Spendenkrisen-Loch geholt.
Domscheit-Berg, geboren 1968 in Premnitz (Havel-land), ist Unternehmerin und Aktivistin der Piraten
Sarah Wiener
Die Landwirtschaft in den neuen Ländern ist wie Himmel und Hölle. Es gibt hier zwei Sorten Bauern. Die einen sollten liebend gern der Maßstab für ganz Deutschland werden. Das sind die Biobauern, die in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern nach der Wende die Chance ergriffen haben, kleine Höfe aufzubauen, um gesunde, faire Landwirtschaft zu betreiben. Die Böden werden nicht mit Pestiziden und Kunstdünger traktiert, die Hennen nicht zu Tausenden auf kleinstem Raum eingepfercht und mit Antibiotika flächendeckend behandelt.
Die anderen Landwirte im Osten sollten nicht Vorbild sein: Agrarkonzerne, die die Großstrukturen der DDR-Agrargenossenschaften aufrechterhalten; die wegen der subventionierten Biogasanlagen die Felder zum Beispiel mit Mais zupflastern. Und die die Bodenpreise für fruchtbares Ackerland hoch-treiben. Als Köchin habe ich, um für meine Restau-rants beste Lebensmittel zu bekommen, in Branden-burg ein Stück Feld gepachtet, das eine Biobäuerin für uns bewirtschaftet. Was dort wächst, liegt bei meinen Gästen auf den Tellern. Und ich bin mit
meinem Bioacker vor den Toren der Stadt zum Glück nicht alleine: Da entsteht ein neuer Maßstab für gute Landwirtschaft und für gesundes Essen. Wobei ich mich frage, wie viel das noch mit Ost und West zu tun hat. Aber das liegt vielleicht dran, dass ich weder Wessi noch Ossi bin, sondern Ösi.
Wiener, 1962 in Halle (Westfalen) geboren und in Österreich aufgewachsen, ist Fernsehköchin
Matthias Müller
Nein, nicht für einen Unternehmer. Will er erfolg-reich sein, muss sein Maßstab die Welt sein. Er muss sich im globalen Wettbewerb behaupten. Und das kann man heute von Westdeutschland genauso gut wie von Ostdeutschland aus. Dafür ist Porsche mit seinen beiden Standorten in Stuttgart und Leipzig ein gutes Beispiel. Wir fühlen uns in Sachsen genauso zu Hause wie in Baden-Württemberg. Für uns ist weder Ost noch West ein Maßstab – unser Maßstab ist die weltweite Zufriedenheit der Kunden mit unseren Sportwagen. Und übrigens ist beides, Stuttgart wie Leipzig, made in Germany. Genauso wie Schwaben und Bayern ihre Kultur und Tradition pflegen, haben sich auch die Thüringer und Sachsen ihre kulturelle Identität bewahrt. Und als gebürtiger Chemnitzer, der in Ingolstadt aufgewachsen ist und heute in Stutt-gart lebt, finde ich es schön, das alles in mir zu tragen.
Müller, 1953 in Karl-Marx-Stadt geboren, wuchs in Bayern auf. Er ist Vorstandschef der Porsche AG
Huong Trute
Mein Maßstab ist der Osten – der Ferne Osten. Ich will, so gut es nur geht, japanisch und vietnamesisch kochen. Egal ob für George Clooney oder jeden an-deren, der mein Gast ist. Clooney hat bei uns im Restaurant seinen Geburtstag gefeiert, als er im Harz einen Film drehte. Ich glaube, es hat ihm geschmeckt.
1987 kam ich in die DDR, als Maschinenbau-ingenieurin. Damals lebten viele meiner Landsleute hier, aber keiner traute sich, ein vietnamesisches Res-taurant zu eröffnen. Manche machten später Asia-Imbisse auf, in denen das serviert wurde, was den Menschen vertraut war: gebratene Nudeln. Ich be-schloss, es anders zu versuchen, eröffnete mein Lokal. Es ist gar nicht so einfach, den Menschen in Ost-deutschland die vietnamesische Küche schmackhaft zu machen. Vielleicht liegt das daran, dass viele so gerne Urlaub in All-inclusive-Hotels machen. Dort bekommen sie, egal ob in Vietnam oder Mallorca, das gleiche europäische Essen. Ostdeutsche lassen sich zu Recht nicht gern belehren, das haben sie viel zu oft erlebt. Aber sie lassen sich beraten. Und diese Men-talität ziehe ich der westdeutschen Abgeklärtheit vor.
Trute, geb. 1958 in Nam Dinh (Vietnam), führt das Feinschmeckerlokal Orchidea Huong in Wernigerode
S
Ist der Westen noch der Maßstab?
Fortsetzung von S. 13
Ziemlich großartiges LandSchon wieder 3. Oktober: Einheitsfreude. Und was feiern wir in diesemJahr so? Vielleicht, dass alles wieder im Lot ist, schlägt SIBYLLE BERG vor
Im Jahr 1989. Sich fremde Menschen in Deutschland umarmen einander zügellos. Das allein wäre Grund genug, einen nationalen Gedenktag einzuführen. Aber es geht weiter.
Deutsche betrachten andere Deutsche, die sich unbekannterweise umarmen. Tränen. Gänsehaut. Vereinigung. Der Ostdeutsche ist kurzfristig glück-lich und frei, der Westdeutsche emotional. Der Osten war den Bewohnern des Westens, falls nicht mit Ostdeutschen verwandt oder in der KP, meist weiter entfernt als Italien.
Drollige Geschichten wussten sie zu erzählen, von wertlosem Geld nach Zwangsumtausch, Bücherkäu-fen wegen Ratlosigkeit und irre schlechtem Sekt. Die DDR schien vielen Menschen in der BRD ein Dis-neyland in Schwarz-Weiß mit ständigem Schneefall. Dem Menschen der DDR wohnte ein großer Kom-plex dem coolen Westdeutschen gegenüber inne. Das Unwissen war beidseitig. Die Vorurteile dito.
Seit 1990 feiern wir staatlich verordnete Rührung, und beim ersten Feiertag, ein Jahr nach dem Fall der Mauer, 28 Jahre nach der Teilung durch dieselbe, waren die Menschen noch entzückt. Da war es wie-der, ihr schönes großes Deutschland. Über prächtige, teils romantisch kaputte Straßen von Rügen bis in den Schwarzwald befahrbar, endlich Urlaub an der Ostsee, als Westdeutscher. Und der ehemalige DDR-Bürger konnte Suhl und Harzgerode hinter sich lassen, um in Fulda ein Auto zu kaufen, hurra, end-lich Autos. Der Taumel der Freude, das Interesse am Nachbarn, an Bruder und Schwester hielt so lange an, bis passierte, was Menschen immer passiert: der Hass, die Missgunst, die Scheu vor dem Fremden.
Schlag auf Schlag verödeten die tränenreich begonnenen Beziehungen. Der Solidaritätszuschlag, die Treuhand, die Neonazis, das Misstrauen wuch-sen in dem Maße, wie sich offenkundig Ost und West vermischten. Ich erinnere mich gerne an den
Gipfel der Vorurteile, ein Magazin beauftragte mich, ein Essay zu schreiben, These »Der Westen verostet«. Inklusive der steilen Vermutung, dass dem Westen das Geld fehle, das im Osten verbaut wird. Ich konnte die These nicht bekräftigen, der Artikel erschien nicht. Oft wollen Redaktionen nur das bestätigt sehen, was sie am Redaktionstisch be-schlossen haben.
Aber das ist ein anderes Thema. Im Osten wurde renoviert, im Westen herrschte Wohnraumnot, fast generationenweise wanderten Ostdeutsche wegen
fehlender Arbeitsplätze in den Westen aus, und ir-gendwann wurde der 3. Oktober nur zu einem Tag mehr, an dem man nicht arbeiten musste, falls man Arbeit hatte. Die Ansprachen im Fernsehen lassen sich ebenso wegzappen, wie die Tonnen von Artikeln (leises Husten) sich überblättern lassen. Deutsch-land. Zusammenwachsen, geteilt, aber was war da geteilt worden? Ein Kaiserreich? Germanien?
Vielleicht war der wesentliche Unterschied zwi-schen den beiden Teilen Deutschlands die Demo-
kratie, die der eine Teil schon etwas länger üben konnte. Optisch gibt es kaum mehr klar definier-bare Unterschiede. Im vereinten Land dieselben großen Modeketten und Schnellrestaurants, die Zeit, in der überhebliche Westdeutsche den gemeinen Ostdeutschen an schlechten Dauerwellen erkannte, ist auch vorbei. Alle zusammen sind wir jetzt Deut-sche. »Aus den neuen Bundesländern« sagt kaum noch einer unter Vierzig, und hassen tuen sich die Menschen auch nicht mehr. Die Hohlköpfe im Land vereinen sich im Hass auf Ausländer, auf Feminis-tinnen, der Dummkopf findet sich in Ost und West auf der Suche nach Bedrohung, die jetzt endlich wieder von außen kommt. »Asylanten«, Muslime, Juden zu hassen verbietet sich öffentlich. Dann ist es eben der Israeli, den man nicht kennt, aber irgendwie legitim verurteilen kann. Alles wieder im Lot. Deutschland ist ein normales europäisches Land geworden, in dem man sich irrsinnig gerne in Grup-pen aufhält, ein Land, in dem man Autoritäten im-mer noch zu gerne folgt und in dem man den Staat immer noch mit dem Monarchen verwechselt.
Eigentlich ein ziemlich großartiges Land, in dem der neue Feind der zu stark beschleunigte Kapitalis-mus sein könnte, in dem man die Erfahrung aus Ost und West zu einer wunderbaren neuen Form ver-einigen könnte, aber vielleicht ist es dazu zu früh.
Jetzt haben wir wieder für vier Jahre eine schöne, die Reichen des Landes reicher machende Regie-rung, eine Absage an das Grundeinkommen und ein klares Ja zur Überwachung. Noch vier Jahre CDU/CSU, vier Jahre Tag der Wiedervereinigung; vier Jahre, in denen die Republik noch näher zu-sammenwachsen und Demokratie üben kann. Glückwunsch. Gehen Sie feiern, und mögen Sie ihr Land, egal ob links oder rechts auf der Landkarte. Die Menschen haben viel erreicht. Ein bisschen mehr geht immer noch.
Sarah Wiener
Kurt Beck Huong Trute Anke Domscheit-Berg
Sibylle Berg
Foto
s [M
] :
(o.v
.l.)
Ke
rbe
r/la
if;
Jose
/SZ
Ph
oto
/la
if;
Sch
mid
t/d
apd
/d
dp
; Ste
ffe
ns/
dd
p;
AA
B/
Bre
ue
l B
ild (
u.)
Gesammelt von ANNE HÄHNIG und STEFAN LOCKE