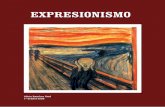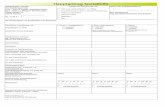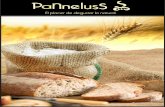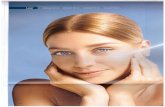Dossier Sozialhilfe
-
Upload
sozialwerke-pfarrer-sieber -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Dossier Sozialhilfe
Zürich, im Dezember 2014
Unverantwortliches Spiel mit den Schwachsten der Gesellschaft Aufgrund weniger Missbrauchsfälle und einiger überforderter Gemeinden findet in der Parteienlandschaft und in den Medien gegenwärtig ein regelrechtes Sozialhilfe-Bashing statt. Dabei geht das Augenmass verloren. Unverhältnismässig wird auf die Schwächsten unserer Gesellschaft eingedroschen. Diese wehren sich kaum – aus Angst, das Wenige, das sie noch haben, auch noch zu verlieren.
Weil sich einige Begünstigte in missbräuchlicher Weise an der Sozialhilfe bereicherten (und die meist gut funktionierenden Kontrollmechanismen versagten!), werden nun Sozialhilfebezügerinnen und -Bezüger generell des Sozialschmarotzertums verdächtigt. Wegen einzelner schwarzer Schafe wird eine ganze Gruppe von Mitgliedern unserer Gesellschaft dem Generalverdacht ausgesetzt, sich bequem zurückzulehnen und auf Kosten des Staates und der Allgemeinheit ein Herrenleben zu führen, weil sich das Arbeiten angesichts der Ströme von Milch und Honig, die der Staat fliessen lässt, sowieso nicht lohnt. Dabei wird gerne übersehen, dass dank der Institution Sozialhilfe seit Ihrer Gründung Hunderttausende von Menschen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt vorübergehend verloren hatten, vor der Verarmung und Verelendung bewahrt werden konnten.
Veränderte Gesellschaftsstruktur Es ist unbestritten, dass das Sozialhilfesystem Reformen nötig hat. Doch dem Sozialhilfesystem einen grundsätzlichen Konstruktionsfehler zuzuschreiben, ist unsinnig. In den letzten zehn Jahren ist die Schweizer Bevölkerung um rund 11%1 gestiegen, während die Anzahl Arbeitsplätze um weniger als 5% zugenommen hat. Angesichts dieser Entwicklung darf nicht erstaunen, dass die Belastungen gestiegen sind, die Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe und Invalidenversicherungen zu tragen haben. Der grösste Teil derer, für die auf dem Arbeitsmarkt kein Platz ist, werden heute in diesem System „parkiert“. Den Betroffenen dieser Entwicklung die Schuld an der Kostensteigerung im Sozialversicherungswesen zuzuweisen, ist zynisch und lenkt von den wahren Herausforderungen ab! Ebenso unsinnig ist es, die Schuld im Wesentlichen bei den zugezogenen Ausländern zu suchen. Viele sind von unserer Wirtschaft gesucht und geholt worden und sind häufig Facharbeiter und Kaderleute – und nicht schlecht qualifiziert, arbeitslos oder von der Sozialhilfe abhängig.
1 Die Zahlen beziehen sich auf die im Statistischen Jahrbuch der Schweiz abgebildeten Grössen.
Das Problem liegt an einem anderen Ort Die Herausforderungen sind andernorts zu suchen. Sie liegen zum einen in den Anreizen, die das System generieren müsste, zum anderen im Zusammenspiel von Sozialhilfe und Wirtschaft, das völlig aus den Fugen geraten ist. Es bringt nichts, wenn einzelne Gemeinden aus der SKOS austreten – die SKOS-Richtlinien bleiben bindend, weil sich die Kantone darauf verpflichtet haben. Es bringt ausser Wahlkampfgetöse auch nichts, wenn der Kanton Zürich aus der SKOS austritt, vielmehr würde ein solcher Schritt vorerst zu einem gravierenden Vakuum führen, da der Kanton zuerst eigene Richtlinien erarbeiten müsste. Der politische Prozess, der damit verbunden wäre, würde Jahre in Anspruch nehmen. Jahre, die die Betroffenen Unsicherheit und behördlicher Willkür aussetzen würden und letztlich zu einem Sozialhilfe-Tourismus führen würden. Hilfreicher wäre ein Bundes-Rahmengesetz, das z.B. den Finanzausgleich zwischen finanzschwachen und stark betroffenen Gemeinden sowie finanzstarken und weniger betroffenen Gemeinden regeln würde. Gemeinde wie Kantone sind gut beraten, ihre Kräfte und Erfahrungen in diesen politischen Prozess zu legen. Damit geben sie auch jenen eine Stimme, um die es letztlich geht: Um Menschen, die zum allergrössten Teil in Würde wieder in den Arbeitsprozess eingeführt werden möchten!
Weltfremde Kritik Es bringt nichts, wenn Betroffenen das Autofahren vorenthalten werden soll. Die Arbeitswelt setzt auf die Mobilität ihrer Teilnehmer. Oft ist ein Auto Bedingung für eine Stelle (Aussendienst, Lieferung, Handwerk, etc.). Es bringt auch nichts, die SKOS zu kritisieren, weil sie einen PC und einen Internet-Anschluss dem Grundbedarf zuordnet. Die e-Bewerbung ist heute Standard. Gerade jüngere Menschen, die „digital natives“, organisieren ihr ganzes Leben und Netzwerk elektronisch, und sämtlich Temporär-Anbieter nehmen Erstbewerbungen über digitale Anmeldemasken herein. Wer also will, dass Sozialhilfe-Bezügern die Mobilität verwehrt und der Zugang zu zeitgemässen Kommunikationsformern abgeschnitten wird, will nicht, dass sie in den Arbeitsmarkt zurückfinden.
Niederschwellige Arbeitsplätze wegrationalisiert Im Arbeitsmarkt liegt aber der Schlüssel zur Entlastung des Sozialhilfesystems. Dass die Entwicklung neuer Arbeitsplätze nicht mit der Bevölkerungsentwicklung mithalten konnte, wurde bereits beschrieben. Was diese Entwicklung oder eben Nicht-Entwicklung noch schmerzhafter macht: In den letzten zehn Jahren sind Tausende von sogenannt einfachen Arbeitsplätzen verschwunden. Sie wurden entweder ins kostengünstigere Ausland verlegt oder automatisiert. Das bedeutet, dass weniger gut ausgebildete sowie junge und ältere Arbeitnehmende, die aus welchen Gründen auch immer Unterbrüche in ihrem Arbeitsleben haben, den Wiedereinstieg in diesen Markt nicht mehr finden. Vor diesem Hintergrund Sozialfirmen zu kritisieren, die diese schmerzhafte Lücke zu schliessen versuchen, ist unredlich. Sozialfirmen decken lediglich ab, was der freie Arbeitsmarkt offenkundig nicht mehr hergibt.
Wo sind die sozialen Unternehmer? Wenn also von Anreizen gesprochen wird, wenn markige Sätze fallen wie „Arbeit muss sich wieder lohnen“, dann muss die Frage nach einem sozialen Unternehmertum gestellt werden und nach den Rahmenbedingungen, die braucht, wer auch weniger produktive und schwächer qualifizierte Mitarbeitende einstellen will. Wer auch bereit ist, einem ehemaligen Drogenkranken, einem
Milieukind, einer ausgestiegenen Prostituierten oder einem aus dem Knast Entlassenen einen anständigen Job zu geben. Es muss kein Direktorenposten sein – einfache, ehrliche, sinnführende Arbeit würde genügen. Arbeit, deren Lohn der Arbeiter wert ist.
Langes Warten macht psychisch kaputt In den Einrichtungen der Sozialwerke Pfarrer Sieber begegnen wir täglich Menschen, die auf solche Arbeit angewiesen wären. Menschen, die zum Teil seit Jahren arbeitslos, ausgesteuert und von der Sozialhilfe abhängig sind, obschon sie ARBEITEN KÖNNEN UND ARBEITEN WOLLEN. Obwohl sie Biografien haben, die von Konflikten, Süchten und Delinquenz gezeichnet sind. Und vom Warten auf eine neue Chance. Ein Warten, das je länger es dauert, sie desto mehr psychisch und physisch zeichnet. Welche Anreize brauchen ein Industrieller, ein KMU-Betreiber, eine öffentliche Unternehmung, die diese Menschen menschenwürdig einstellt – als Arbeitnehmer auf Augenhöhe?
Ernsthaftigkeit statt Populismus Diese Diskussionen müssen geführt werden, wenn die Sozialhilfe wieder zu dem werden soll, wofür sie erfunden wurde – als Überbrückung in einer persönlichen Krisensituation. Einfach Leistungskürzungen, SKOS-Austritte und Autofahr-Verbote hinauszuposaunen, ist Unfug und gefährdet das Erfolgsmodell Schweiz. Es braucht ein fruchtbares Zusammenspiel zwischen den Sozialversicherungen und den Arbeitgebern und keinen billigen Wahlkampf auf Kosten der Ärmsten in unserem reichen Land. Es sei an dieser Stelle an die „Clinton-Reform“ erinnert, die in den 1990er-Jahren die Armut in den USA spürbar einzuschränken und die kaum mehr zu bezahlenden „Welfare“-Kosten wieder in Griff zu kriegen vermochte. Die „Clinton-Reform“ verband Leistungskürzungen für Sozialhilfe-Empfänger/-innen mit Anreizen für Unternehmer, Arbeitsplätze zu erhalten oder zu schaffen, damit „Welfare“-Empfängerinnen schneller wieder in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden konnten. Der Forderung an die Sozialhilfe-Empfänger/-innen, sich möglichst schnell wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren, stand ein adäquater Arbeitsmarkt gegenüber.
Schweigegeld statt Selbstverantwortung Dabei ging es letztlich auch um die Lösung eines moralischen Problems: Dass es unmenschlich und unsozial ist, Menschen dafür zu bezahlen, nichts zu tun. Nichts zerstört Menschen schneller. Ein System, das Menschen langfristig die Chance nimmt, das eigene Leben selber zu bestreiten, indem es ihnen einfach Geld gibt, damit sie Ruhe geben und nicht unangenehm auffallen, handelt nicht sozial. Es nimmt den Menschen ihre Würde2.
Die Sozialwerke Pfarrer Sieber (SWS) bieten Menschen in Not – wie Suchtkranken, Obdachlosen, psychisch und physisch Leidenden, Mittellosen und Heimatlosen – seelsorgerliche, soziale, medizinische und materielle Hilfe an. Dazu gehören die Schaffung von Einrichtungen, die Durchführung wie auch die Unterstützung von Projekten, die es Betroffenen ermöglichen, menschenwürdig zu leben und sich selbst als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft zu erfahren. Die SWS werden dort aktiv, wo andere Netze fehlen. Gegenwärtig arbeiten 170 Mitarbeitende und rund 200 Freiwillige für die SWS. Gegründet wurde die Stiftung 1988.
2 Charles Murray, Losing Ground, 10. Auflage 1994