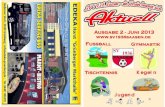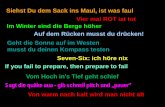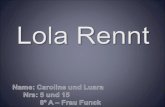„Du bist dumm und faul“
Transcript of „Du bist dumm und faul“

„Du bist dumm und faul“Beschämungen in pädagogischen Interaktionen und was dagegen zu tun ist
In pädagogischen Arbeitsfeldern laufen Kinder und Jugendliche Gefahr, von den für sie professionell zuständigen Erwachsenen beschämt zu werden. Ob sie diese Erfahrung machen, hängt davon ab, ob sie das Pech haben, zu einer Klasse oder Gruppe zu gehören, in der Pä-dagogInnen arbeiten, die sie häu�g beschämend ansprechen. Es handelt sich um eine folgenreiche Form der Diskriminierung, die Ein-samkeit, Angst und Lernblockaden erzeugt und Entwicklungs- und Bildungsprozesse schädigt.
Der Beitrag setzt sich in drei Schritten mit Stu-dien zu Beschämungen in pädagogischen Arbeits-feldern auseinander: 1. Theoretische Ansätze zum Verständnis von
Beschämung und verbaler Gewalt werden vorgestellt.
2. Studien zur Realität des Beschämens von Kin-dern und Jugendlichen durch ihre professio-nellen Pädagoginnen und Pädagogen werden erläutert.
3. Abschließend werden Vorschläge zur Verbes-serung pädagogischer Interaktionen gemacht.
Worte und Gesten können gewalttätig seinZum Verständnis von Scham in sozialen Situa-
tionen tragen Theorien bei, die sich damit aus-einandersetzen, dass auch durch Sprache Ge-walt ausgeübt werden kann. In der Regel werden sprachliche Interaktionen im Gegensatz zu kör-perlichen Auseinandersetzungen als kon�iktlö-send und friedlich angesehen. Aber Studien zur verbalen Gewalt bestätigen die alltägliche Erfah-rung, dass Menschen einander mit Sprache hef-tige Verletzungen zufügen können, die durchaus als gewalttätig anzusehen sind (Herrmann/Krä-mer/Kuch 2007). Sprachliche Gewalt wirkt beschämend, sie setzt
die adressierten Personen herab und inszeniert und festigt Machtverhältnisse (Neckel 1993). Wenn Erziehende
die ihnen Anvertrauten beschämen, bringen sie das Machtgefäl-le im Generationenverhältnis auf verbal gewalttätige Weise zum Ausdruck. Zugleich erzeugen oder verfestigen sie damit Hierarchi-en in der Peergruppe, da sie meist vor den Augen der Gruppe oder Klasse ihre verletzenden Äußerungen machen und die beschämte Person in pädagogischen Settings wenige Möglichkeiten hat, sich zu wehren. Wenn Beschämungen überhand nehmen und es an An-erkennung mangelt, werden existentielle Bedürfnisse der Heran-wachsenden vernachlässigt und problematische Entwicklungen, zum Beispiel Verhaltensprobleme, verursacht. In der Neufassung von § 1631 des BGB aus dem Jahr 2000 wer-
den seelische Verletzungen eindeutig als unzulässig bezeichnet. Sie sind verboten. Allerdings ist es nicht immer ganz einfach, eine verbotene Beschämung von einer akzeptablen oder gar notwendi-gen Schamerfahrung zu unterscheiden. So kommt es auch vor, dass Kinder und Jugendliche sich schämen, wenn sie lobend hervor-gehoben werden oder wenn sie eine wichtige Einsicht in eigenes Unvermögen gewinnen. Solche Situationen und ihre Widersprü-che können Gegenstand spannender Fallbesprechungen werden.
Beschämungen durch Erziehende sind RealitätBeobachtungsstudien im Rahmen des Projektnetz INTAKT (So-
ziale Interaktionen in pädagogischen Arbeitsfeldern) geben Ein-blick in Situationen in Schulen und Einrichtungen der Jugend-hilfe. Im Folgenden (wie auch im Titel des Beitrags) informieren wir über eine Reihe von Szenen, in denen verschiedene Formen der Beschämung protokolliert wurden. Die Dokumente entstan-den in den letzten fünf Jahren in sozialpädagogischen und schuli-schen Arbeitsfeldern, alle Namen wurden geändert (vgl. Zschip-ke 2011; Prengel 2013).
Abstract / Das Wichtigste in Kürze Tagtäglich kommen Beschämungen von Kindern und Jugendlichen durch professionelle Pädagoginnen und Pädagogen vor. Fast jeder hat solche Beschämungen schon erlebt oder beobachtet; auch Untersuchungen belegen, dass und wie oft sie vorkommen. Zwar werden sprachliche Interaktionen im Gegensatz zu körperlichen Auseinandersetzungen als weniger gewalttätig angesehen, Studien zur verbalen Gewalt aber zeigen, dass Menschen einander mit Sprache heftige Verletzungen zufügen können, die in vielen Fällen als gewalttätig anzusehen sind und zu heftigen Reaktionen bei den Betro¢enen führen. In allen pädagogischen Arbeitsfeldern werden Maßnahmen zur Verbesserung von pädagogischen Beziehungen dringend benötigt.
Keywords / Stichworte Beschämung, Scham, Schule, Kita, Psychische Gewalt, pädagogische Beziehungen, Interaktion.
Annedore Prengel *1944
Prof. Dr. em., Erzie-hungswissenschaftler-in, Universität Potsdam, Schwerpunkte: Pädagogi-sche Beziehungen, Hete-rogenität in der Bildung, Menschenrechtsbildung, Qualitative Forschungs-methoden in der Erzie-hungswissenschaft, Pä-dagogische Diagnos-tik, Inklusion in Kita und Schule.
Katja Zschipke *1985
Pädagogin mit erstem Staatsexamen, Arbeits-schwerpunkte: Pädago-gische Beziehungen, Kin-der-Copoeira.
47
Sozial Extra 3 2014: 47-49 DOI 10.1007/s12054-014-0067-0
Durchblick Scham und Beschämung

Frau E.: „Ihr kommt bald in die Schule. Euer Verhalten ist dumm und re-spektlos. So scha�t ihr die Schule nicht.“
Peter weint, weil er das Falten nicht hinkriegt. Luise geht hin und hilft ihm. Als er das Kästchen fertig hat, sagt Frau K.: „Und, haben dir die Trä-nen geholfen? Ne, oder? Du musst nicht immer heulen, das ist immer das Selbe. Das hilft dir auch nicht weiter.“
Bodenturnen. Jonas weint, weil er eine Übung nicht kann. Nina geht zu ihm und sagt: „Macht doch nichts, dafür kannst du besser Fußball spielen.“ Frau S. und Frau B. reagieren nicht.
Max schlägt mit seinem Kopf gegen die Wand. Frau N.: „Der Wand tut es nicht weh. Dem Kopf schon. Und uns nervt es.“ Max hört nicht auf. Frau N.: „Möchtest du, dass ich dich anschreie?“ Max schüttelt den Kopf, die anderen Kinder lachen.
Vor der Pause: Frau G. sagt ganz laut vor der Klasse: „Gescha�t hat es Paul noch nicht“.
„Schere!“, sagt Frau P., „das ist kein ‚ch‘- es sei denn, man hat einen Sprachfehler.“
Frau J. sitzt an ihrem Pult und korrigiert die fertigen Arbeitsblätter. Sie ruft Ronja zu sich und sagt ihr, dass sie alles falsch gemacht habe (sehr laut, alle können es hören). Ronja schlägt sich mit der Hand gegen den Kopf und lacht verlegen.
Zwei Kinder stehen sich gegenüber und bekommen eine Kopfrechenaufga-be. Wer zuerst das Ergebnis nennt, darf stehen bleiben. Der Andere muss zurück zu seinem Platz. Zu jedem Verlierer sagt (gehässig) Frau O.: „Und Tschüss“!
Diese Szenen, sogenannte „Feldvignetten“, zeigen, dass verlet-zende Beschämungen sowohl derb und o¢en als auch scheinbar humorvoll und verdeckt vorkommen können. Kinder reagieren darauf sehr unterschiedlich: Einige Kinder ziehen sich zurück, andere arbeiten oder spielen still weiter, manche erstarren und wieder andere überspielen die erfahrene Beschämung durch ein Lächeln oder einen Scherz. Einige Kinder sind wiederholt von Be-schämungen betro¢en. Auch Reaktionen der nicht direkt betrof-fenen Peergruppe lassen sich beobachten: Einige Kinder schrei-ten ein und helfen, andere halten sich zurück, aber – und das ist häu©g protokolliert worden – sehr viele steigen in die Aggression mit ein, lachen den oder die Betro¢ene aus und verursachen er-neute Beschämungen.Auswertungen von umfangreichen Befragungen und Beobach-
tungen zeigen, wie häu©g Verletzungen durch Erziehende vor-kommen (vgl. auch Krumm/Eckstein 2002). Während wir auf-grund unserer Studien annehmen können, dass durchschnittlich etwa drei Viertel aller pädagogischen Interaktionen als anerken-nend oder neutral zu interpretieren sind, müssen durchschnitt-lich annähernd ein Viertel aller Interaktionen als verletzend, und das heißt in der Regel auch beschämend, angesehen werden. Da-bei sind ungefähr sechs Prozent aller Interaktionen als sehr verlet-zend zu kategorisieren. Die Befunde für sozialpädagogisch ausge-bildete Professionelle fallen etwas besser aus, aber auch diese Be-
rufsgruppen beschämen Kinder und Jugendliche schon von der Krippe an erheblich (vgl. Prengel 2013).Die umfangeichen Beobachtungen zeigen, dass bei nahezu al-
len PädagogInnen beschämende Handlungen vorkommen, aber in sehr unterschiedlicher Häu©gkeit und Intensität. Einige Päda-gogInnen verletzen ihre Adressaten überdurchschnittlich oft, teil-weise richten sich die Beschämungen immer wieder gegen die gleichen Personen. Andere interagieren nahezu ausschließlich an-erkennend und respektvoll mit den ihnen Anvertrauten. In al-len Schulen und Einrichtungen, in denen Interaktionen beobach-tet wurden, konnte sehr respektvolles, achtendes Verhalten Tür an Tür mit verletzenden und beschämenden Handlungen gefun-den werden. Oft gehen persönlich-interaktive und strukturell be-dingte Beschämungen eine destruktive Verbindung ein (Stähling 2005; Schröder 2002).
Beschämungen sind individuell und gesellschaftlich schädlichWenn verletzende Beschämungen durch Erwachsene in pädago-
gischen Arbeitsfeldern vorkommen, machen Kinder und Jugend-liche zerstörerische existentielle Erfahrungen, denn dem Grund-bedürfnis nach Anerkennung wird nicht entsprochen. Darüber hi-naus wird auch ihre demokratische Sozialisation gestört, so dass gesellschaftlicher Schaden entsteht. Vor allem für Heranwachsen-de, die auch in ihren Familien erheblich psychisch verletzt wur-den, sind solche Situationen folgenreich: Sie lernen, dass verbale Gewalt einschließlich der demütigenden Diskriminierung ande-rer Menschen erlaubt sei und können keine Selbstachtung ent-wickeln, die eine Basis zur Anerkennung der anderen bildet. Sie laufen Gefahr, dann eine Quelle von Anerkennung in der Verlet-zung anderer zu suchen (Quellenangaben dazu in Prengel 2013). Wegen der zerstörerischen Wirkungen von verletzenden Beschä-
mungen ist es dringend geboten, in allen pädagogischen Arbeits-feldern Maßnahmen zur Verbesserung pädagogischer Beziehun-gen zu stärken (Prengel/Winklhofer 2014). Dabei ©nden sich in sozialpädagogischen Settings schon weiter entwickelte Ansätze als in Schulen. Einige solcher Ansätze werden im Folgenden be-schrieben.•Für Kinder und Jugendliche leicht erreichbare Ombuds- und
Beschwerdestellen werden �ächendeckend benötigt, damit Be-tro¢ene bei externen Ansprechpartnern problemlos Hilfe ©n-den (Urban-Stahl/Jann u.a. 2013).
•Innerhalb von pädagogischen Institutionen werden interne Strukturen zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen benötigt, um unkompliziert problematische Erfahrungen be-merken und bearbeiten zu können. Solche Strukturen kön-nen vom Kummerkasten in Klassen oder Gruppen über demo-kratische Mitbestimmungsgremien bis hin zu umfassenden Be-fragungen durch die Schul- und Einrichtungsleitung reichen.
•Regelmäßige Teamgespräche dienen zum kollegialen Feedback und zur Suche nach konstruktiven Lösungen für den Umgang mit als schwierig erlebten Heranwachsenden. Damit wird die
48
Sozial Extra 3 2014
Durchblick Scham und Beschämung

Gefahr der Verstrickung und der aggressiven beschämenden Reaktion der Erwachsenen vermindert und sie können gemein-sam verstehen lernen, welchen subjektiven Sinn zunächst un-verständliche Verhaltensweisen haben und welche Signale da-von ausgehen.
In der Geschichte der Pädagogik hat es – trotz früh formulierter Kritik – lange gedauert, bis körperliche Gewalt überall geächtet war, sexualisierte Gewalt wurde in den letzten Jahren ö¢ entlich umfassend thematisiert, für psychische Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, die meist in verbalen Beschämungen zum Ausdruck kommt, muss eine breite Aufmerksamkeit erst noch geweckt wer-den (Schubarth/Winter 2012). Das ist eine Entwicklungsaufgabe des Bildungswesens in all seinen verschiedenen Arbeitsfeldern. s
Literatur HERRMANN, STEFFEN, KRÄMER, SYBILLE UND KUCH, HANNES (HRSG.) (2007).
Verletzende Worte. Die Grammatik sprachlicher Missachtung. Bielefeld: Transcript
KRUMM, VOLKER UND ECKSTEIN, KIRSTIN (2002). Geht es Ihnen gut oder haben Sie noch Kinder in der Schule? URL: https://www.sbg.ac.at/erz/salzburger_beitraege/herbst%202002/krumm_202.pdf (21.01.2012)
NECKEL, SIGHARD (1993). Status und Scham. Zur symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit. Frankfurt am Main: Campus
PRENGEL, ANNEDORE (2013). Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz. Opladen u.a.: Barbara Budrich
PRENGEL, ANNEDORE UND WINKLHOFER, URSULA (HRSG.) (2014). Kinderrechte in der Praxis pädagogischer Beziehungen. Opladen u.a.: Barbara Budrich (im Druck)
SCHRÖDER, ACHIM (2002). Beziehungen in der Jugendarbeit – Wie sie gestaltet und re� ektiert werden. In: Deutsche Jugend. Zeitschrift für Jugendarbeit, 50 (2) 2002, S. 59-69
SCHUBARTH, WILFRIED UND WINTER, FRANK (2012). Problematisches Lehrerverhalten als „Lehrergewalt“? Annäherung an ein Tabuthema. In: Prengel, Annedore und Schmitt, Hanno (Hrsg.), Netzpublikationen des Arbeitskreises Menschenrechtsbildung in der Rochow-Akademie für historische und zeitdiagnostische Forschung an der Universität Potsdam, 2012. URL: http://www.rochow-museum.uni-potsdam.de/arbeitskreis-menschenrechtsbildung/netzpublikationen-des-ak-mrb.html (11.4.2012)
STÄHLING, REINHARD (2005). Der aufhaltsame Abstieg des „schwachen“ Schülers in Deutschland. Bildungsbenachteiligung im Schnittpunkt von Schule und Jugendhilfe. In: Die Deutsche Schule, 1, S. 67-77
URBAN-STAHL, ULRIKE U.A. (2013). Beschweren erlaubt! 10 Empfehlungen zur Implementierung von Beschwerdeverfahren in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Handreichung aus dem Forschungsprojekt „Bedingungen der Implementierung von Beschwerdeverfahren in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“ (BIBEK). Berlin: Freie Universität
ZSCHIPKE, KATJA (2011). Missachtung im Anfangsunterricht. Unv. Examensarbeit. Potsdam
49
Aller Anfang ist Bildung. Spenden Sie heute für morgen.
Spendenkonto BLZ 100 www.spendenbildet.de
Ich werde mal