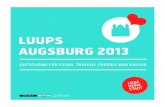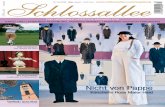Fachhochschule Augsburg
Transcript of Fachhochschule Augsburg
Fachhochschule AugsburgFachbereich Elektrotechnik
NachrichtenübertragungstechnikPrüfungsaufgabenSS 98 bis WS 02/03
Prof. Dr. Clemen
Jan 2005
Seite 2 von 50
Inhalt:
Diplomprüfung WS 02/03....................................................................................................... 4
1. Aufgabe (Quellencodierung) ............................................................................................ 4
2. Aufgabe (Fehlercodierung) .............................................................................................. 6
3. Aufgabe (Digital-Richtfunkstrecke)................................................................................. 7
Lösung:............................................................................................................................... 10
1. Aufgabe ........................................................................................................................... 10
2. Aufgabe ........................................................................................................................... 12
3. Aufgabe:.......................................................................................................................... 14
Diplomprüfung SS 02 ........................................................................................................... 17
2. Aufgabe ( PCM-Repeater ) ............................................................................................ 17
3. Aufgabe (Analoge Modulation digitaler Signale).......................................................... 19
Diplomprüfung SS 00 ........................................................................................................... 21
1. Aufgabe (Scrambler, Entzerrer) ..................................................................................... 21
2. Aufgabe (Fehlercodierung) ............................................................................................ 22
3. Aufgabe (Mischer).......................................................................................................... 23
4. Aufgabe (nichtsynchrone und synchrone Demodulation von PSK)............................... 24
5. Aufgabe (allg. Fragen) .................................................................................................... 26
Lösung 4a und 4b : ............................................................................................................ 27
Diplomprüfung SS 99 ........................................................................................................... 28
2. Aufgabe (RDS-Fehlercodierung, Rahmenerkennung) .................................................. 28
3. Aufgabe (RDS-Modulationsverfahren) .......................................................................... 29
Lösung Aufgabe 2............................................................................................................... 31
Lösung Aufgabe 3............................................................................................................... 33
Diplomprüfung WS 98/99..................................................................................................... 36
2. Aufgabe (Zyklischer Hamming Code)............................................................................ 36
3. Aufgabe (Bluetooth-Modulationsverfahren).................................................................. 37
Lösungen............................................................................................................................ 39
2. Aufgabe ........................................................................................................................... 39
3. Aufgabe ........................................................................................................................... 40
Diplomprüfung SS 98 ........................................................................................................... 44
2. Aufgabe (AM/FM-Rundfunkempfänger) ....................................................................... 44
Prüfungsuafgaben NachrichtenübertragungstechnikProf. Dr. C. Clemen
Seite 3 von 50
3. Aufgabe (Zyklischer Hamming Code: Codier– und Decodierschaltung)...................... 45
4. Aufgabe (Richtfunk mit 8-QAM) ................................................................................... 47
Lösung ................................................................................................................................ 48
3. Aufgabe ........................................................................................................................... 48
4. Aufgabe ........................................................................................................................... 50
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. ClemenDiplomprüfung WS 02/03 Jan. 2004
Seite 4 von 50
Diplomprüfung WS 02/03
1. Aufgabe (Quellencodierung)
In der Abbildung ist das Prinzip eines DPCM-Codierers für schwach auflösendes Video-Telefon(niedrige Bildfrequenz) gezeigt. Das Quellensignal wird mit 4 Bit codiert und nach derDifferenzbildung einer Huffman Codierung unterzogen. In der Abbildung ist dieWahrscheinlichkeitsverteilung für die DPCM-Worte angegeben. Vor der Differenzbildung ist dieWahrscheinlichkeitsverteilung einigermassen „gleichmässig“.
4-BitPCM
Huffmanak
ak-4
dk+
-
p(x)
0100
1001
1110
1010
1100
0000
0010
0001
0110
1100
0101
nachDifferenzbildung
Verzög.um
4 Bit
0,4
0,2
a) Auf der nächsten Seite sind zur Erstellung des Codebaums die Symbole mit ihrenWahrscheinlichkeiten aufgelistet. Führen Sie die Huffman- Codierung durch .
b) Wie groß ist der mit dem DPCM-Verfahren erreichbare Kompressionseffekt?
c) Decodieren Sie die Huffman-Codierung für die Folge 01110110101100011011......
d) Anstelle der Huffman-Codierung kann auch eine sogenannte Komma-Codierung eingesetztwerden. Dabei werden den nach fallender Wahrscheinlichkeit geordneten Symbolen eine Folgevon Einsen , die mit einer Null abgeschlossen wird, zugeordnet: für das erste Symbol x1 ↔ 0,für das zweite x2 ↔ 10, für das dritte x3 ↔ 110,.... für das elfte x11 ↔ 011111111110. Wiegroß ist der Kompressionsfaktor für die Komma -Codierung?
e) Was versteht man unter dem Informationsgehalt einer Nachricht.
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 1. Aufgabe (Quellencodierung) Jan. 2004
Seite 5 von 50
x1
x2
x3
x4
x5
x6
0,40
0,175
0,175
0,09
x7
x8
x9
x10
x11
0,09
0,028
0,028
0,005
0,005
0,002
0,002
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 2. Aufgabe (Fehlercodierung) Jan. 2004
Seite 6 von 50
2. Aufgabe (Fehlercodierung)
Das Generatorpolynom g(x) = x8 +x4 + x2 +x + 1 erzeugt einen zyklischen (15,7)-Hamming-Code(Blocklänge = 15, Zahl der Infobits = 7), mit dem Doppelfehler korrigiert werden können. In derAbbildung ist die sog. „Maggitt“- Codier- und Dekodierschaltung gezeigt.
i(x) bzw. c'(x)
r0r1r2r3r4r5r6r7
a) Welchen Zusammenhang können Sie zwischen der Struktur der Schaltung und demGeneratorpolynom erkennen?
b) Wie unterscheidet sich diese Schaltung von der in der Vorlesung eingeführten Schaltung?
c) Bei dieser Schaltung ergibt sich beim Codierprozess schon nach 7 Takten der Rest.Überprüfen Sie dies für die Codierung der Informationswörter i1(x) ↔ 0000001 und i2(x) ↔0000011. Berechnen Sie zuerst die Codewörter (Ergebnis : c1(x) ↔ 0000001 00010111 undc2(x) ↔ 0000011 00111001) . Wie lauten die Bildungsgesetze für die Folgezustände derRegisterinhalte? Berechnen Sie dann den Rest über die Registerinhalte derSchieberegisterschaltung mit einer Tabelle : i(x) r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 ).
d) Die angegebene Schaltung lässt sich auch zur Decodierung der empfangenen Wörter einsetzen.Dabei werden durch 15- maliges Schieben aus den empfangenen Wörtern 8 BitSyndromewörter gebildet. Wie groß ist die Zahl der verschiedenen Syndromwörter, die auf 1
Bit- und 2 Bit-Fehler zeigen? (Lösung 9515
1
== ∑=i
iN )
Welches Syndrom ergibt sich bei fehlerfreier Übertragung?
Formeln:
12
)()()(',1,12,1
+=
+=++≥+≥+≥
n
xexcxctsdtdsd
r
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (Digital-Richtfunkstrecke) Jan. 2004
Seite 7 von 50
3. Aufgabe (Digital-Richtfunkstrecke)
Die Digital-Richtfunkstrecke DRS 140 / 11200 für 140 Mbit/s arbeitet mit der Modulationsart 16QAM. Die Modulation erfolgt bei einer Zwischenfrequenz von 140 MHz. Das Sendeband liegt beieiner Trägerfrequenz von 11,2 GHz. Die Abbildung zeigt die Stufen der Signalverarbeitung auf der Senderseite sowie dasZustandsdiagramm des Modulators.
KabelentzerrerHDB3/NRZ
Speicher
Dienstkanalmultipl.Kennwortgenerator
MUX Scrambler
Takt
fBit ca.140 Mbit/s
Modulator ZF-Verstärker
Sendefreq.-Umsetzer Sender
0000
00010011
00101000
10011011
1010
1100
11011111
1110 0100
01010111
0110
a) Wieviele Telefongespräche können über diesen Richtfunkkanal übertragen werden?
b) Wozu dient der Kabelentzerrer, wie ist er aufgebaut?
c) Was bedeutet NRZ und HDB3? Erläutern Sie die Eigenschaften der Codierung eventuell aneinem Beispiel.
d) Wozu dienen die Blöcke: Speicher, Dienstkanalmultiplexer, Kennwortgenerator, MUX,Scrambler?
e) Zeichnen Sie ein Blockschaltbild für den Modulator. Erläutern Sie die Funktion. anhand desAdditionstheorems für die Cosinusfunktion.
f) Welche Bandbreite muß das Filter im ZF-Verstärker haben?
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (Digital-Richtfunkstrecke) Jan. 2004
Seite 8 von 50
g) Zeichnen Sie ein Blockschaltbild für den Umsetzer. Machen Sie auch Frequenzangaben.
h) Zeichnen Sie ein Blockschaltbild für den Demodulator.
i) Die nächste Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus dem Demodulatorteil. Geben Sie dieSpannungsschwellen für die Komparatoren an. Wählen Sie einen geeigneten Bezugswert für dieSpannung z.B. den Maximalwert des Nutzsignals.
logischesNetzwerk
(z.B. GAL)
ui(t)
uq(t)
D-Flip-FlopKomparator x1
x2
x3
x4
x5
x6
a
Takt
b
c
d
j) Welche Aufgabe haben die D-FF’s , mit welchem Takt werden sie angesteuert?
k) Fügen Sie der Decodiertabelle drei weitere Zeilen an.
x1 x2 x3 x4 x5 x6 a b c d
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
l) Geben Sie ein Schaltungsprinzip für die Mischer an.
m) Warum verwendet man 16-QAM anstelle 16-PSK?
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen Lösung: Jan. 2004
Seite 9 von 50
Formeln:
ba
a
sbitNSldBCBkTFP
rPS
Gr
GGPP
c
cb
HFN
ESSE
loglog
log
/)/1(
)4/(4 20
2
=
+⋅=⋅⋅=
⋅=
⋅=
πη
πλ
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 1. Aufgabe Jan. 2004
Seite 10 von 50
Lösung:
1. Aufgabe
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen
2. Aufgabe Jan. 2004
Seite 12 von 50
2. Aufgabe
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe: Jan. 2004
Seite 14 von 50
Aufgabe 2 d:Einbit-Fehler: Zahl der möglichen Fehlerorte = 15Zweibit-Fehler:Erstes Bit fehlerhaft à 14 mögliche Orte für zweites fehlerhaftes BitZweites Bit fehlerhaft à 13 mögliche Orte für zweites fehlerhaftes Bit..........................................vierzehntes Bit fehlerhaft à 1 Orte für zweites fehlerhaftes Bit
-à
==
⋅==++++= ∑
= 215
8521415
1...12131414
1i
iN
Fehlerfreie Übertragung: s = 0 .
3. Aufgabe:
a) 140 Mbit/s 2Mbit/s à 30 Telefon Gespräche
8 Mbit/s à 120 Telefon Gespräche34 Mbit/s à 480 Telefon Gespräche140 Mbit/s à 1920 Telefon Gespräche
b) Kabelentzerrer: Entzerrt das Leitungssignal . Die Pulsverzerrungen sind Folge der FrequenzabhängigenDämpfung des Kabels und der Echos aufgrund von InhomogenitätenAufbau des Kabelentzerrers gemäß einem transversalen Filter . Wenn Echos unterdrückt werdenSolen ist an den Zeitverzögerungsgliedern die Zeiteingestelt um die das Echo verzögert ist. DieKoeffizienten lassen sich dann aus einer Entwicklung der Übertragungsfunktion berstimmen. Beieinem digitalen Filter haben die Zeitverzögerungen die Dauer der Abtastperiode und dieKoeffizienten entsprechen den Abtastwerten der Pulsantwort des Entzerrers.
))((..)( 1 fHTFth eq−=
Σ s2(t)=ΣΑns1(t-n∆t)
s1(t) ∆t
A0 A1A2 AN
c) NRZ = non return to zero. Leitungscode, innerhalb des Bitintervalls wird logisch 0 durchSpannung 0 (Low) und logisch 1 durch Spannung 5 V ( High) dargestellt. HDB3 = High Density Bipolar of Order 3 , Leitungscode mit der Eigenschaft, dass genugTaktinformation übertragen wird und das Signal keinen Gleichspannungsanteil aufweist.
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe: Jan. 2004
Seite 15 von 50
V
NRZ
NRZHDB3
HDB3 ist ein quasiternärer bipolarer Code, der der AMI Regel folgt . Bei mehr als 4aufeinanderfolgenden Nullen werden nach einem bestimmten Schema 1 bis zwei Zusatzbitseingefügt , die die AMI-Regel verletzen und so im Empfänger erkannt und decodiert werdenkönnen.d) Speicher : elastischer Speicher um Takt an neuen Rahmen anzupassen.Kennwortgenerator: erzeugt Bits für das Rahmenerkennungswort.Dienstkanalmultiplexer : Steuert den Multiplexer gemäß den Kanälen.MUX erzeugt eigenen Rahmen und fügt die empfangenen Bits ein.
Scrambler: Verwürfler, erzeugt aus Datenstrom einen umcodierten Datenstrom, bei demRegelmäßigkeiten im Bitstrom verwischt werden. Kann im Empfänger selbstsynchronisierend mitdem Descrambler wieder rückgängig gemacht werden. Dadurch werden im Spektrum desEmpfangssignals dominante Linien neben der Bitfrequenz vermieden auf die der PLL bei derTaktrückgewinnung im Empfänger sonst einrasten könnte.
f) Bandbreite des ZF-Filters : B= 1,6 fsym = 1,6 fBit/4 = 1,6⋅ 140 /4 MHz = 56 MHzg) Umsetzer Mischen mit LO ; fLO = (11,2 –0,14 )GHz = 11,06 GHz und anschließend
Tiefpaßfilter, welches das obere Seitenband wegfilter und das untere Seitenband durchläßt(Grenzfrequenz z.B. 200 MHz) .
h) Siehe Vorlesungi) Siehe Vorlesung U1 = 2/3 ⋅1/ √2 ⋅ Umax, U2 = 0 , U3 = - U1 .j) Die D-FF werden mit dem wiedergewonnenen Symboltakt getaktet und setzen somit die durch
den Entscheider detektierten Symbole in das richtige zeitliche Raster ein.
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe: Jan. 2004
Seite 16 von 50
k) x1 x2 x3 x4 x5 x6 a b c d1 0 0 1 0 0 1 1 0 00 0 0 1 0 0 1 1 1 00 0 0 0 0 0 1 1 1 1
l ) z.B: Ringmodulator siehe Vorlesungm) Bei 16-QAM ist gegenüber 16 PSK für ein bestimmtes BER am Empfänger ausgang amEingang ein um ca. 4 dB niedrigeres S/N erforderlich, d. h. man brauch weiger Leistung.
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 2. Aufgabe ( PCM-Repeater ) Jan. 2004
Seite 17 von 50
Diplomprüfung SS 02
2. Aufgabe ( PCM-Repeater )
Die Abbildung zeigt das Prinzipschaltbild eines PCM-Zwischengenerators. Das Leitungssignal istRZ – HDB 3-codiert.
a) Tragen Sie in die Abbildung 2-1 auf Seite 3 die fehlenden Signalverläufe an den Punkten C bisK ein und erläutern Sie die Funktion der einzelnen Blöcke, z.B. : Wozu dienen diesymmetrischen Übertrager, wozu dient der Entzerrer, wozu dienen die Komparatoren( k ), Welche Aufgabe erfüllt der Signalsummierer Σ.. ?Hilfe: Die Pulsgeneratoren erzeugen bei einem Signal High am Eingang am Ausgang einen Pulsder Dauer TBit/2 .
b) Was versteht man unter der bipolaren RZ- HDB3-Codierung. Erläutern Sie die Funktion.
c) Wie funktioniert der Entzerrer?
VCO
H
I
K
Tbit/2Pulsgen.
Pulsgen.
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (Analoge Modulation digitaler Signale) Jan. 2004
Seite 18 von 50
zu Aufgabe 2:
1 0 1 1 1 1 0 0 0 V 0 1 0
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
Abbildung 2-1
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (Analoge Modulation digitaler Signale) Jan. 2004
Seite 19 von 50
3. Aufgabe (Analoge Modulation digitaler Signale)
Die Abbildung aus (Elektronik 11, 2002, S. 60) zeigt Spektren für mehrere Signale, die die beidenSatelliten-Systeme GPS und GALILEO für Navigation übertragen.
Die beiden Signale von GPS (GPS C/A-Code und GPS P/Y-Code ) werden inQuadraturmultiplex mit einem Träger bei fT=1575 MHz übertragen. Die Signale von GALILEOwerden im Zeitmultiplex nacheinander auf zwei verschiedenen Trägern bei 1565 MHz und 1585MHz übertragen. Nehmen Sie an, dass jedes Signal einen Datenstrom mit fBit = 200 Symbole /süberträgt. Alle Signale sind PN-codiert.
a) Bestimmen Sie (möglichst genau) die Bitrate der PN-Codes fPN.
b) Wie hoch ist das Verhältnis fPN/ fBit? Geben Sie die daraus resultierenden Vorteile für das S/Nim Empfänger gegenüber nicht gespreizter Datenübertragung an.
c) Schätzen Sie nach Shannon-Hartley das C/N für den Empfang des GPS C/A-Code Signals abunter der Annahme, dass bei der Übertragung ohne PN-Code ein (S/N)1 = 103 notwendigwäre.
2loglog
log10
102
xx =
d) Welche weiteren Vorteile hat die Übertragung mit PN-Code?
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (Analoge Modulation digitaler Signale) Jan. 2004
Seite 20 von 50
e) In der nächsten Abbildung ist ein schematischer Plan für den Empfänger gezeigt. Verstärkersind der Einfachheit halber weggelassen worden. In der Praxis wird der Empfänger mitAusnahme des zweistufigen analogen Abwärtsmischers in digitaler Technik realisiert.
PN2
TP
TP
Korrelator
PN1
Start
Start
PN-Takt
BPF1 BPF2
BPF32 MHz
fm1 =204 MHz
fm2 =70 MHz
x?
PLL-Frequenz
gen.
digitaler Frequenzgen,Quarzstabilisiert
10,71MHz
:?fc1 fc2
?
?
Berechnen Sie die Faktoren für den Frequenzvervielfacher und den Frequenzteiler. Im erstenFall ist fc1 <fT und im zweiten Fall ist fm1<fc2 . Was bedeutet das ? Welche Bandbreite habendie Bandpaßfilter BPF1 und BPF2? Was bedeuten die gestrichelten Pfeile?
f) Vervollständigen Sie die nachstehende Formel und erläutern Sie ihren Inhalt fürLOTLOT und Ω<ΩΩ>Ω
[ ] =Ω+Ω ttttA LOT cos)(cos)( ϕ
g) Nach welchem Prinzip erfolgt die Demodulation?
h) Wie wird der PN-Code erzeugt? Welche Eigenschaften hat er?
i) Geben Sie ein Schaltungsprinzip für die HF-Mischer an und erläutern Sie es.
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 1. Aufgabe (Scrambler, Entzerrer) Jan. 2004
Seite 21 von 50
Diplomprüfung SS 00
1. Aufgabe (Scrambler, Entzerrer)
Bei einer PCM-Übertragungsstrecke werden die Nutz-Daten in einen Rahmen eingefügt. Bevor sievom Sender auf die Leitung geschickt werden, erfolgt noch eine Verwürfelung in einem Scramblerund anschließend eine Umwandlung in Leitungssignale (Leitungscodierung).a) Welchem Zweck dienen diese Schritte?b) In der Abbildung ist das Funktionsschaltbild eines Scrambler- Descrambler Paares gezeigt(selbstsynchronisierend ). Vervollständigen Sie die Descrambler-Schaltung und zeigen Sieallgemein, daß der Descrambler die verwürfelte Datenfolge wieder in die ursprüngliche Folgezurückwandelt.
c) Zeichen Sie die Amplitudenverteilungsfunktionen für den 0 und 1 Empfangsimpuls einesverrauschten NRZ Signals. Wie läßt sich daraus die Bitfehlerrate ermitteln?d) Bei der Übertragung der Pulse trete aufgrund Reflexionen am Leitungsende und Leitungsanfangzusätzlich zum direkten Puls ein schwaches , um ∆t verzögertes Echo auf.s t k s t t k s t t t2 1 1 0 2 1 0( ) ( ) ( ( )))= − + − + ∆Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des Kanals.e) Bestimmen Sie die zugehörige Entzerrer-Übertragungsfunktion und skizzieren Sie Betrag undPhase. Wie kann der Entzerrer aufgebaut werden?
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (Mischer) Jan. 2004
Seite 22 von 50
2. Aufgabe (Fehlercodierung)
Gegeben sei das Generatorpolynom eines zyklischen (15,11)-Hamming-Codes:g(x) = x4+x+1.a) Berechnen Sie die Codevektoren zu den folgenden Informationswörtern:i1 <--> (0000000100) und i2 <--> (11111111111).b) Wie lauten die Syndromvektoren für ein übertragenes Codewort für den Fall einer Einbit-Störung an der 7. Stelle sowie an der 9. Stelle (jeweils von rechts nach links gelesen) ?c) Man gebe die allgemeine Formel für die Codiervorschrift und die Syndrombildung an.d) Die folgende Abbildung zeigt die Codierschaltung. Verifizieren Sie für das Informationswort i1die Codewortbildung.
e) Mit dem o.g. Generatorpolynom läßt sich auch ein PN-Generator aufbauen (s.u.) . WelcheEigenschaften hat er? Erläutern Sie Einsatzgebiete für PN-Folgen.
Hilfe:
c’(x) = c(x) + e(x)
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (Mischer) Jan. 2004
Seite 23 von 50
3. Aufgabe (Mischer)
Die Fa. Infineon Technologies hat einen neuen GaAs-Mischer für die Mobilfunktechnik entwickelt,der nach dem Schalterprinzip arbeitet und aufgrund seiner sehr gute Linearitäts- undIntermodulations-Eigenschaften und der geringen Stromaufnahme eine günstige Alternative zu denteureren und viel Platz beanspruchenden Diodenringmischern bildet.Anbei ist ein Prinzipschaltbild gezeigt. Der Schalter wird durch einen GaAs-FET realisiert, der miteiner Steuer-Rechteckschwingung (LO-Pumpfrequenz) zwischen leitend und gesperrt hin und hergeschaltet wird. Der Mischer kann bidirektional d.h. als Aufwärts- wie auch als Abwärtsmischereingesetzt werden.
a) Betrachten Sie den Betrieb für die Aufwärtsmischung eines ZF-Signals (fZF = 130 MHz,Bandbreite <200 kHz) durch eine LO-Rechteckschwingung mit 1,38 GHz. Auf welche Frequenzkann das ZF-Signal durch den Mischvorgang umgesetzt werden?b) Ergänzen Sie für ein Einton-Eingangssignal u1(t) = uZF(t) = U0sin(2πfZFt) und das angegebenenLO- Rechtecksignal die Signale u0(t) und u3(t) in der Abbildung und zeichnen Sie die zugehörigenAmplitudenspektren.Zeichnen Sie die Bereiche der beiden Bandpaßfilter in das Diagramm.
Hilfe: Die Filter dienen neben der Entfernung überflüssiger Modulationsprodukte auch derEntkopplung der Eingänge bzw. Ausgänge. Sie werden durch einfache LC- Parallel- bzw.Serienschwingkreise realisiert.
Bandpaß-Filter Bandpaß-Filter
u0
ZF-Signal u1
HF-Signal u3
ZF-Signal
LO-Signal u2
LO-Signal
HF-Signal
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 4. Aufgabe (nichtsynchrone und synchrone Demodulation von PSK) Jan. 2004
Seite 24 von 50
u1
tuLO
tu0
tu3
t
f
f
f
f
u1(f)
u0(f)
uLO(f)
u3(f)
c) Begründen Sie unter Zuhilfenahme von b) die Funktion des Mischers.
d) Stellen Sie das Prinzip eines Diodenringmischers dar, evtl. unter Zuhilfenahme von Diagrammenwie in b).
e) Stellen Sie weitere Mischer-Prinzipien dar.
4. Aufgabe (nichtsynchrone und synchrone Demodulation von PSK)
Die Übertragung von digitalen Signalen mit PSK zeichnet sich dadurch aus, daß die Information inder Phase untergebracht ist. Deshalb muß der Empfänger bei der Demodulation auch dieTrägerphase kennen, sei es durch Übertragung eines Pilottones oder durch Trägerrückgewinnung.Trotzdem gibt es bei PSK ein Übertragungs-Verfahren, das ohne Trägerrückgewinnung auskommt,jedoch vor der Modulation eine Codierung des Datenstromes voraussetzt. Außerdem muß dieTrägerfrequenz mit der Bitfrequenz synchronisiert sein d.h. fT = NfBit , Tbit = NTT , N = ganzeZahl.
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 4. Aufgabe (nichtsynchrone und synchrone Demodulation von PSK) Jan. 2004
Seite 25 von 50
Die Eingangsdatenfolge ak wird dabei so umkodiert, daß bei den codierten Datenbits bk dieDifferenz zwischen dem aktuellen und dem vorangegangenen Bit gleich Null ist, wenn ak = 1 undEins ist, wenn ak = 0 : sogenannte Differenzcodierung.
ak = 1 ⇔ bk = bk-1
ak = 0 ⇔ bk ≠ bk-1
a) Verifizieren Sie diese Codiervorschrift für die angegebene Beispielfolge, indem Sie die beidenFolgen ak und bk untereinanderschreiben.
b) Zeigen Sie, daß mit der folgenden Empfängerschaltung aus der mit 2-PSK moduliertenDatenfolge bk die Datenfolge ak zurückgewonnen wird.
Hilfe: Im k-ten Bitintervall hat die modulierte Trägerschwingung die Form
m t A t bk T T k( ) cos( )= + +Ω ϕ πBerechnen Sie das Signal nach dem Mischer
c) Zeichen Sie ein Schema für die normale 2-PSK Modulation mit synchroner Demodulation underläutern Sie die Funktionsweise.Dazu: Zeichnen Sie eine Funktionsschaltung für den Sender und für den Empfänger und weisen Siedie Demodulationseigenschaft nach.d) Die nächste Abb. zeigt für den Fall der normalen 2-PSK die Trägerrückgewinnung.
Erläutern Sie die einzelnen Baugruppen. Wie wird das Problem mit der Phasenunsicherheit von180° gelöst?
bkak
Differenzcodierer
11000110110110100
mk(t)
mk-1(t)
ak
syn zu fBit
cos(ΩTt)- cos(ΩTt)PLLBP ÷2
Schwelle bei 0V
Signal-Verzögerungum TBit
TP SchwellwertDetektor
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen Lösung 4a und 4b : Jan. 2004
Seite 26 von 50
5. Aufgabe (allg. Fragen)
a) Was versteht man unter dem Informationsgehalt einer Nachricht?b) Was versteht man unter der theoretischen Kanalkapazität?c) Erläutern Sie das Prinzip einer Huffman- Codierung und wozu dient sie?d) Erläutern Sie die SDH.e) Wie erfolgt die analoge Rundfunkübertragung im MW- und UKW-Bereich?f) Erläutern Sie einige Grundzüge der Übertragung beim CD-Verfahren.
SS00: Formeln
[ ]cos( ) cos( ) cos( ) cos( )x y x y x y= + + −12
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen Lösung 4a und 4b : Jan. 2004
Seite 27 von 50
Lösung 4a und 4b :
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen Jan. 2004
Seite 28 von 50
Diplomprüfung SS 99
2. Aufgabe (RDS-Fehlercodierung, Rahmenerkennung)
Das RDS-System überträgt Daten in Form eines kontinuierlichen binären Datenstromes mit 1,1875bit/s. Die Daten-Organisation sieht verschiedene - je 104 bit lange - Gruppen vor, die jeweils ausvier Blöcken zu je 26 bit bestehen. Das 26 bit Datenwort enthält 16 Informationsbits und 10Prüfbits. Die Berechnung der Prüfbits basiert auf der Verwendung eines (verkürzten) zyklischenBlockcodes zur Fehlerkorrektur. Außerdem werden zu diesen Kontrollbits („Checkwörter“) nochausgewählte „Offset-Wörter“ hinzu addiert (mod 2), um die Block- und Gruppensynchronisaton imEmpfänger (Decoder) zu ermöglichen.Generatorpolynom : g(x) = x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x3 + 1.
Ch Checkwort à r(x)A/B/C/C‘/D Offset-Wörter , à d(x)Al2-3 Adressierte Information à i(x)A 0011111100B 0110011000C 0101101000C‘ 1101010000D 0110110100a) Der Code erlaubt es nicht nur 1-bit Fehler zu korrigieren. Das erkennt man an dem
Zahlenverhältnis zwischen Informationsbits und Prüfbits. Erläutern Sie diesen Umstand.Bestimmen Sie Syndromvektoren für Übertragungsfehler in den letzten drei Stellen (ganzrechts).
b) Zeigen Sie, daß es sich bei den folgenden drei nacheinander empfangenen Wörtern Vi‘umWörter aus den Blöcken 2, 3 und 4 handelt, daß die ersten beiden Wörter fehlerfrei übertragenwurden und daß das dritte Wort einen Fehler an der vorletzten Stelle aufweist. (- die ersten 13bit sind jeweils Null: 0...............0 ! - ):V1’ 0.................0 010 1011101010V2’ 0.................0 011 1110100011V3’ 0.................0 100 1011101011
c) Zeigen Sie am Beispiel des ersten empfangenen Wortes, daß Sie die in der Aufgabe b)durchgeführten Operationen - Subtraktion und Division - auch in umgekehrter Reihenfolgedurchführen können.
d) Wie lautet die allgemeine Formel zur Codierung und zur Fehlererkennung und Korrektur?e) Wie läßt sich die Gruppensynchronisation erzielen?f) Welche Vorteile bieten die zyklischen Hamming–Codes gegenüber den normalen Hamming-
Codes?
InfowortAl2
InfowortAl3
InfowortGA,TP,PTY,Al1
Ch+DCh+CCh+C‘
Ch+BCh+AInfowortPI
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (RDS-Modulationsverfahren) Jan. 2004
Seite 29 von 50
SS 99: Formeln:
12
)()()()()()()()()('
,1,12,1
+=
+=+=+=
++≥+≥+≥
n
xrxixxcxdxcxvxexvxv
tsdtdsd
r
r
3. Aufgabe (RDS-Modulationsverfahren)
Die Abbildung zeigt die Frequenzbelegung im Spektrum des Stereomultiplex-Basisband Signals,inklusive Verkehrsfunk und Radio-Daten- System (RDS) des UKW-Rundfunks.
a) Entwerfen Sie ein Blockschaltbild für die Einrichtungen, mit denen aus dem Mittensignal(L+R)/2 und dem Seitensignal (L-R)/2 das Stereomultiplexsignal erzeugt werden kann.
b) Geben Sie ein Schaltungsprinzip für den Modulator an.
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (RDS-Modulationsverfahren) Jan. 2004
Seite 30 von 50
c) In der folgenden Abbildung sehen Sie das Blockschaltbild für die RDS-Ausrüstung am Sender.Erläutern Sie die Funktionen der Baugruppen A, B und C.
d) Bestimmen Sie das Spektrum der Pulsfolge 4, indem Sie zunächst das Spektrum einerPulsfolge bestimmen, die durch Gleichrichtung der Folge 4 entsteht (TBit = td = 1/(1200 bit/s)). Tragen Sie in dieses Spektrum qualitativ die Veränderungen ein, die sich beim Übergang zuFolge 4 ergeben.
e) Wie sieht das Spektrum von Signal 5 (Signal nach dem Formungsfilter ) aus?f) Zeichnen Sie qualitativ das Signal und das Spektrum an der Stelle 6.g) Wie läßt sich trotz des gleichzeitigen 57 kHz Trägers für Verkehrsfunk- und RDS-Signal - -
und der damit verbundenen engen Nachbarschaft der Spektren - die Trennung der Signale imEmpfänger erreichen? Erläutern Sie das Prinzip!
h) Geben Sie ein prinzipielles Verfahren zur Erzeugung und Demodulation derFrequenzmodulation an. Vergleichen Sie die Frequenzmodulation mit derAmplitudenmodulation.
i) Zeichnen Sie ein Blockschaltbild für den RDS-Empfängerteil und spezifizieren Sie die Funktionder einzelnen Einheiten.
SS 99: Formeln:
Spektrum einer Pulsfolge mit Amplitude A, Periode T und Pulsbreite τ :
)(
)sin(τπ
τπτ⋅⋅
⋅⋅⋅=
k
kk f
fT
Ac
Modulation:
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen Lösung Aufgabe 2 Jan. 2004
Seite 31 von 50
)(Re
sin)(sin)(cos)(cos)()](cos[)()( tjtj
TTT
TeetA
tttAtttAtttAΩ⋅=
=Ω−Ω=+Ωϕ
ϕϕϕ
Lösung Aufgabe 2
a) n= k+r , wobei n = Blocklänge, k = Anz. Der Infobits und r = Anz. Der Kontrollbits. Falls 1 Bit Fehler erkannt und korrigiert werden sollen, müssen die Syndromvektorens ≠ 0 eindeutig den Fehlerpositionen zugeordnet werden können. Daher sind r Kontrollbits mit derfolgenden Eigenschaft erforderlich :
12 += nr à r = log2(n+1)= log2(27) = log(27)/log2 = 4,755 , also nur 5 Kontrolbits.Tatsächlich werden aber 10 Kontrollbits verwendet.
Syndromvektoren für Übertragungsfehler in den letzten 3 Stellen berechnen sich aus
44 344 2144 344 21
44 344 2144 344 21
44 344 2144 344 21
StellenStellen
StellenStellen
StellenStellen
xsxe
xsxe
xsxe
xgxe
stxs
102
262
101
261
100
260
100...............0)(100...............0)(
010...............0)(010...............0)(
001...............0)(001...............0)(
)()(
Re)(
=⇒=
=⇒=
=⇒=
=
b) Nach erfolgter Gruppensynchronisation werden von den Blöcken jeweils das Offset-Wortabgezogen und dann zur Syndrombildung durch g(x) geteilt.
V1‘ 0................00101011101010B 0110011000V1‘-B 0................00101101110010:g(x) 10110111001r(x) 0000000000
à kein Fehler
V2‘ 0................00111110100011C 0101101000V2‘-B 0................00111011001011:g(x) 10110111001r(x) 10110111001:g(x) 10110111001r(x) 0000000000
à kein Fehler
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen Lösung Aufgabe 2 Jan. 2004
Seite 32 von 50
V3‘ 0................01001011101011D 0110110100V3‘-D 0................01001101011111:g(x) 10110111001r(x) 10110111011:g(x) 10110111001r(x) 0000000010
à Fehler an der 2. Stelle von rechts
c)V1‘ 0................00101011101010:g(x) 10110111001Rest = B 0110011000- B 0110011000r(x) 0000000000
à kein Fehler
c) Codierung
)()()(
)()(
Re)()()()(10
10
xdxcxv
xgxix
stxrmitxrxixxc
+=
=+=
Fehlererkennung
)()()('
)()()('
Re)(
xexvxv
xgxdxv
stxs
+=
+
=
d) er empfangene Bitsrom wird in eine 26 –Bit Schieberegister geführt. Nach jedem Takt wirdder Inhalt des Schieberegisters durch das Generatorpolynom geteilt. Haben sich 3xhintereinander Offset-Wörter in der richtigen Reihenfolge ergeben, so waren dies drei Wörterfehlerfrei und die Synchronisation kann gestartet werden.
e) zyklische HammingCodes:
Codierung und Decodierung mit einfachem Algorithmus möglich à DivisionEinfache Hardware Realisierung durch über EXOR rückgekoppelte Schieberegisterschaltungen.
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen Lösung Aufgabe 3 Jan. 2004
Seite 33 von 50
Lösung Aufgabe 3
a) und b) siehe Vorlesungb) A: Differenzcodierer. Die binären Daten werden so umcodiert, dass Empfänger keine
Probleme mit Detektion hat. Ohne diese Codierung würde evtl. das invertierte Signal amEmpfängerausgang erscheinen.B: Biphase – Zeichengenerator
Erzeugung eines Codes mit folgenden EigenschaftenGleichspannungsfreiIm Empfänger kann Takt regeneriert werdenKeine längeren Pausen ( Folge von Nullen)
C: Modulator : MischerVersetzt das Basisbandsignal (5) in den Frequnezbereich des Trägers bei 57 kHz. Erzeugungeines Zweiseitenbandsignals mit unterdrücktem Träger.
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen Lösung Aufgabe 3 Jan. 2004
Seite 34 von 50
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen Lösung Aufgabe 3 Jan. 2004
Seite 35 von 50
g. Durch Quadraturmultiplex (Erläuterung siehe Vorlesung)h) Erzeugung VCODemodulation PLL oder Flankendiskriminator (Erläuterung siehe Vorlesung)
i)
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (Bluetooth-Modulationsverfahren) Jan. 2004
Seite 36 von 50
Diplomprüfung WS 98/99
2. Aufgabe (Zyklischer Hamming Code)
a) Was versteht man unter Quellencodierung, Kanalcodierung und Leitungscodierung?b) Was versteht man unter den folgenden Begriffen: HDB3-Code, DPCM-Codierung undScrambler? Welche Eigenschaften sind damit verbunden?c) Gegeben sei ein zyklischer Hamming-Code der Hamming Distanz d = 3 mit der Blocklänge 7und dem Generatorpolynom g(x) = x3 +x +1.c1) Wieviele Fehler können mit diesem Code erkannt und korrgiert werden?c2) Berechnen Sie das Codewort zum Informationswort (1010). Wie lautet die allgemeine Formelzur Berechnung des Codewortes?c3) Geben Sie eine Schaltung an, mit der die Berechnung der Prüf-Bits erfolgen kann.c4) Nach welcher Vorschrift wird das Syndrom berechnet? Berechnen Sie für sämtliche Fehler eidie Syndromvektoren.c5) Prüfen Sie die folgenden Wörter, ob sie einen Übertragungsfehler enthalten und wenn ja, anwelcher Stelle: 1000011; 0111111; 1001010; 1011000.
Hilfe:
c’(x) = c(x) + e(x)
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (Bluetooth-Modulationsverfahren) Jan. 2004
Seite 37 von 50
3. Aufgabe (Bluetooth-Modulationsverfahren)
In der Abbildung ist der funktionelle Aufbau einer Sende- und Empfängereinheit gezeigt, mit derLaptops oder andere mobile Systeme drahtlos an bestehende Netzwerke angebunden werdenkönnen. Die Übertragung erfolgt mit Spread-Spectrum-Technik, die auch unter ungünstigenÜbertragungsbedingungen arbeitet und Schutz vor Abhören bietet.
a) Die Modulation erfolgt in zwei Stufen:• Spreizung des Digitalsignals s(t) mit einer PN-Folge PN(t) (EXOR-Addition): c(t).• PSK-Modulation des gespreizten Signals c(t) --> m(t).Vervollständigen Sie die darunter dargestellten Signalverläufe unter der Annahme einesSpreizfaktors von 1:8 und QPSK-Modulation.
t
t
t
f
f
f
f
s(t)
PN(t)
c(t) c(f)
PN(f)
s(f)
m(f)
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen Lösungen Jan. 2004
Seite 38 von 50
b) Zeichnen Sie das Spektrum des Basisbandsignals s(f), das der Spreizfunktion PN(f) und das desmodulierten Signals m(f) in obiges Diagramm ein.c1) Erläutern Sie, was man unter einem PN-Signal versteht und welche Eigenschaften es besitzt.c2) Wie kann ein PN-Signal praktisch erzeugt werden (nur allgemeines Prinzip). Welche Rollespielt das Generatorpolynom?d) Erläutern Sie für den Sendeweg die Funktionend1) des Basisband-Prozessors,d2) des Zwischenfrequenz-Quadratur Modulators. Zeichnen Sie dafür das Zustandsdiagramm fürden QPSK- Modulator und erstellen Sie eine Tabelle für die Zuordnung der Codewörter zu ur unduq!d3) des HF/ZF Konverters.f) Nach welchem Prinzip wird die Funktion ‘Despread’ ausgeführt?g) Es können Datenübertragungsraten bis zu 2 Mbit/s realisiert werden. Welche Bandbreite müssendie Kanal-Filter TP1, BP2 und BP3 haben? (Hilfe : bei harter Tastung würde das Filter TP1
wegfallen!)h) Bei welcher Frequenz erfolgt die Übertragung?
WS 98/99: Formeln:
u t t u t t A t t t A t t t
A t emit
A t u t u t tu t
u t
A t e A t t
r T q T T T
j t
r qq
rj t
( )cos ( )sin . ( )cos ( ) cos ( ) sin ( ) sin
.................................... Re ( ) ..............
( ) ( ) ( ) tan ( )( )
( )
( ) ( ) cos ( ) ............
( )
( )
Ω Ω Ω Ω− = − =
=
= + =
= +
ϕ ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
2 2
........ ( ) .................= +u tr
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 2. Aufgabe Jan. 2004
Seite 39 von 50
Lösungen
2. Aufgabe
a) Quellencodierung:Dem Digitalsignal wird durch spezielles Verfahren Redundanz entzogen. Dadurch verringert sich dieDatenrate. Es werden aus dem Signals bestimmte Eigenschaften herausgenommen, welche derEmpfänger nicht zur Erkennung der Information braucht. Kanalkodierung:Dem Digitalssignal wird in bestimmter Weise Redundanz hinzugefügt. Dadurch wird die Datenrateerhöht. Die Redundanz dient dazu, im Empfänger Übertragungsfehler erkennbar und eineKorrektur möglich zu machen.Leitungscodierung:Das Digitalssignal wird vor der Übertragungs in ein Siganl umgewandelt, das dieÜbertragungseigenschaften verbessert.• Entfernung von Gleichspannungsanteil• Formung des Spektrums und Kanalfilter• Entfernung von Perioden mit mehreren Nullen• Aus dem Signal muß der Takt regeneriert werden könnenb) HDB3-Code : Leitungscode, der bei PCM-Übertragung eingesetzt wird.der Code stellt sicher , daß nicht mehr als 3 Nullen aufeinander folgen.DPCM-Codierung: differentielles PCM nach dem Prädiktor-Verfahren. Bereiche in demQuellensignal, die sich wenig ändern (nicht die volle Bandbreite ausnutzen), werden komprimiertübertragen. Dadurch läßt sich die Datenrate von 64 kBit/s bei PCM auf etwa die Hälfte reduzieren.Scrambler:Durch den Scrambler werden die Bits für die Übertragung verschlüsselt. Dies geschieht unterUmweg über ein mit EXORS rückgekoppeltes Schieberegister. Im Empfänger wird dieVerschlüsselung durch eine entsprechende inverse Schaltung rückgängig gemacht. Dadurch erreichtman, daß das Digitalsignal für die Übertragung eine günstigere (gleichmäßigere) Verteilung derspektralen Leistungdichte bekommt. Lange Folgen von Nullen oder Einsen werden so vermiedenund auch periodische Bitfolgen werden zu „zufälligeren“.Bsp.: 4-stufiger Scrambler aus der Vorlesung:
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe Jan. 2004
Seite 40 von 50
3. Aufgabe
t
t
t
f
f
f
f
s(t)
PN(t)
c(t) c(f)
PN(f)
s(f)
m(f)
fT fT+fPN/2
fBitTBit
TPN=1/8 TBItfPN=8 fBIt
wegen Weichtastung!
a), b)
c1)PN= Pseudo Noise: binäre Zufallsfolge, die nach einem bestimmten Algorithmus gebildet ist. DieFolge ist periodisch mit der Blocklänge 2n - 1 . Innerhalb eines Blocks treten alle möglichen n-Bitwörter in bel. Reihenfolge auf. Das Spektrum ist daher nahezu das eines Rauschens bis auf diePeriodizität, die eine Diskretisierung im Frequenzbereich mit Frequenzabstand 1/(nTa) bedingt.c2)
D
Q
D
Q
D
Q
D
Q
++
D
Q
D
Q
D
Q
D
Q
++
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe Jan. 2004
Seite 41 von 50
mit Kette von n-Verzögerungsgliedern (Schiebregisterschaltung), die über EXOR rückgekoppeltwerden. Die Struktur der Rückkopplungen ergibt sich aus dem Generatorpolynom, das dem Codezugrunde liegt. Das Generatorpolynom ist ein Polynom vom Grad n mit binären Koeffizienten undist irreduzibel d.h., es besitzt keine Teiler außer sich selbst.d)d1) Basisband-Prozessor:DPSK-Modulation: Differentielles PSK. Umcodierung des binären Datenstroms derart, daß amAusgang eine Folge entsteht, die nur mehr auf Signalwechsel reagiert. Dadurch spielt eine etwaigeUmpolung des Signals bei der Weiterverarbeitung keine Rolle mehr. Diese Umpolung kann bei derTaktrückgewinnung im Empfänger entstehen und würde ohne DPSK zu einer fehlerhaftenDemodulation führen. Im Empfänger wird die Codierung durch eine inverse Schaltung wiederrückgängig gemacht.
Spread: Hier wird das digitalsignal mit dem PN-Code gespreizt . Beide Signale werden überEXOR verknüpft. Anschließend wird der Datenstrom in Dibits unterteilt und, unter Reduzierung derDatenrate auf die Hälfte (=Symbolrate), das erste Bit des Dibits dem unteren, das zweite demoberen Ausgang zugeführt (Seriell-Parallel-Wandlung).d2) Zwischenfrequenz-Quadratur Modulator:QPSK-Modulation . Es handelt sich um 4-PSK mit weicher Tastung. Der ZF-Träger liegt bei 600MHz. Das modulierte Signal nimmt, entsprechen den 4 möglichen Dibitwerten, vier Phasenzuständeein.
Der Verstärker setzt das erste und zweite Bit des Dibits in eine bipolares Signal um. Durch dieseSignale wird durch den Mischer der Träger mit +/- 1 multipliziert. Die Überlagerung vonCophasalem und Quadratursignal ergibt das Phasenmodulierter Signal, wie in obigerVektorzerlegung zu sehen ist.
uq
10ab=00
+=
ur
0111
a=1
b=0
a=0
b=1
ur ur
Decodierer im EmpfängerCodierer im Sender
bk akbkak
bk
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe Jan. 2004
Seite 42 von 50
S/P
90
+
D/A
D/A
ab
a
b
cos(Ωt)
-sin(Ωt)
-uq(t)sin(Ωt)
ur (t)cos(Ωt)
A(t)cos(Ωt+φ(t))ur (t)
uq (t)TP
TP
u t t u t t A t t t A t t t
A t t t A t e emit u u
A t u t u t tu t
u t
A t e A t t jA t t u
r T q T T T
Tj t j t
r q
r qq
rj t
T
( )cos ( )sin . ( )cos ( ) cos ( ) sin ( ) sin
. ( )cos( . ( )) Re ( ) .,
( ) ( ) ( ) , tan ( )( )
( ), , ,
( ) ( ) cos ( ) ( )sin ( )
( )
( )
Ω Ω Ω Ω
Ω Ω
− = − =
+ == ± = ±
= + = = → = ° ° ° °
= + =
ϕ ϕ
ϕ
ϕ ϕ
ϕ ϕ
ϕ
ϕ
1 1
14 45 135 225 3152 2
r qt ju t( ) ( )+
ab ur uq
00 1 101 -1 110 -1 -111 1 -1
a bzw. b uq bzw. ur
0 11 -1
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe Jan. 2004
Seite 43 von 50
d3) HF/ZF Konverter.Hier wird das phasenmodulierte Signal vom Zwichenfrequenzbereich bei 600 MHz auf denSendebereich heraufgemischt. Das Filter BP3 dient dazu das untere Seitenband wegzufiltern.f) DespreadDie Signale ur und uq werden durch eine Pegelumsetzer und nach Paralle /Seriell-Umsetzungwieder in das Digitalsignal umgestzt. Dann wird dem Datenstrom die beim Spreizen zugemischtePN-Folge erneut phasenrichtig zugemischt. Dadurch wird das ursprünglich gespreizteAusgangssignal wieder in das Basisband zurückversetzt. unerwünschtes Rauschen oderNachbarsender werden von diesem Prozeß nicht dekodiert und bleiben hochfrequent. Um dieEingangsfolge mit dem PN-Träger zu synchronisieren (Aquisition), wird eine Korrelationsbildungdes Eingangssignals mit dem PN-Signal durchgeführt, aus der die Phasenlage des PN-Trägers zumEingangssignal entnommen werden kann. Nach erfolgter Demodulation und Tiefpaßfilterung mußnoch die Differenz-Codierung rückgängig gemacht werden (siehe d1).
g)
f1,4fsym
2fsym
Das Tiefpaßfilter TP1 muß eine Bandbreite von 5,6 MHz haben, die Filter BP2 und BP3jeweils eine Bandbreite von 11,2 MHz.
h)
3 GHz0,6 GHz
2,4 GHz
HP
4.2) a) siehe Aufgabe 3. d2b) siehe Aufgabe 3. g:
B ff MBit s
MHzsymBit= = =
⋅=1 4 1 4
21 4 20 48
214 34, ,
, , /,
c) f = 16,83 GHz
B ff
MBit sMHz
symPN= =
=⋅ ⋅
=
14 142
14 8 22
112
, ,
, /,
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 2. Aufgabe (AM/FM-Rundfunkempfänger) Jan. 2004
Seite 44 von 50
Diplomprüfung SS 98
2. Aufgabe (AM/FM-Rundfunkempfänger)
Die Abbildung zeigt das Blockschaltbild für den LM 1868 AM/FM Radioempfänger-IC vonNational Semiconductor. Damit läßt sich ein Empfänger mit 0,5 Watt aufbauen.a) Erläutern Sie die Funktionsgruppen des AM-Teils. Hinweise: L1 ist die Ferritantenne. CF1 istein Bandpaßfilter, das aus zwei Schwingkreisen und einem Oberflächenwellenfilter aufgebaut ist.Diese sind induktiv gekoppelt. Der interne AM Detektor ist so wie die externe Detektor Schaltungaufgebaut. Die zusätzliche externe Detektorschaltung sorgt für ein besseres Regelverhalten.b) Geben Sie ein mögliches Schaltungsprinzip für den Mischer an.c) Warum muß der Kondensator C21 eine große Kapazität besitzen (hier 250 µF)?
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe (Zyklischer Hamming Code: Codier– und Decodierschaltung) Jan. 2004
Seite 45 von 50
3. Aufgabe (Zyklischer Hamming Code: Codier– und Decodierschaltung)
Die Abbildung zeigt eine Codier-Schaltung zur Fehlerkorrektur. Der Schaltung liegt ein zyklischerHamming-Code der Hamming Distanz d = 3 mit der Blocklänge 7 und dem Generatorpolynomg(x) = x3 +x +1 zugrunde.
-- -- --+
+S1 S2 S3
S4
1
2
SR2
SR1
Schieberichtung
+ =1=
Codierer
Eingang
Ausgang
a) Wieviel Fehler können mit diesem Code erkannt und korrgiert werden. Wie groß ist die Zahlder redundanten Korrekturbits?
b) Berechnen Sie mit Polynomdivision das Codewort zum Informationswort i = (1010).c) Wie lautet die allgemeine Formel zur Berechnung des Codewortes?d) Funktion der Schaltung: Am Eingang des Codierers liegt das Nachrichtenbitmuster (i0,i1,i2,i3).
Zunächst sind die Schalter S1, S2 und S3 geschlossen. Der Schalter S4 sei in Stellung 2. Dannwird 4 mal geschoben, wobei in SR1 die Schieberichtung nach links und in SR2 nach rechtsgeht. Nun werden die Schalter S1, S2, S3 geöffnet und S4 in Stellung 1 gebracht.Anschließend wird noch für weitere 3 Takte geschoben. Demonstrieren Sie die Erzeugung derCheck-Bits mit der Schieberegisterschaltung, indem Sie die Registerinhalte desSchieberegisters SR1 bei getaktetem Ablauf für das oben gewählte Eingangswort i = (1010)berechnen.
e) Nach welcher Vorschrift wird das Syndrom berechnet? Berechnen Sie für sämtliche Fehler ei
die Syndromvektoren (Tabelle zur Fehlermuster-Erzeugung ).f) Prüfen Sie die folgenden Wörter, ob sie einen Übertragungsfehler enthalten und wenn ja, an
welcher Stelle: 1000011; 0111111; 1001011; 1011000.
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 4. Aufgabe (Richtfunk mit 8-QAM) Jan. 2004
Seite 46 von 50
g) Die folgende Abbildung zeigt die Dekodier- und Fehlerkorrekturschaltung. Erläutern Sie dieFunktionsweise.
Einige Hinweise:
zunächst ist A auf LOW , Takt 1 und Takt 2 aktiv,
mit dem Impuls kann die parallele Übernahme des Fehlermusters in das Schieberegister SR3veranlaßt werden.
c’(x) = c(x) + e(x)
-- -- --+
+SR 1
-- ---- -- -- -- --
-- ---- -- -- -- --
Fehlermuster-Erzeugung
&
+
Takt 1
Takt 2SR 2
SR 3
Fehlerkorrektur
Impuls
A
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 4. Aufgabe (Richtfunk mit 8-QAM) Jan. 2004
Seite 47 von 50
4. Aufgabe (Richtfunk mit 8-QAM)
Ein Digitalsignal mit 140 Mbit/s soll über eine Richtfunkstrecke bei 6 GHz übertragen werden. AlsModulationsverfahren soll 8-QAM mit der in der Abbildung dargestellten Codierung verwendetwerden. Zum Vergleich ist die 8-PSK Modulation mit angegeben. Die Modulation erfolge bei einerZwischenfrequenz von 140 MHz , anschließend werde das Signal in den Sendebereich innerhalbeines Frequenzmultiplexsignals umgesetzt.
1
110
2
1
111
011
010
001
000
100
101
011
111
3 31 2
1
110100
101
001
000 010
8-PSK 8-QAM
a) Bei 8-QAM treten die Amplituden A1 und A2 = 3 ⋅A1, bei 8-PSK nur die Amplitude A0 auf.
Zeigen Sie, daß bei gleicher Sendeleistung A0 = 2,12⋅A1 ist (Die Leistung ist bei 8-PSK P =A0
2/2R).b) Bestimmen Sie für beide Modulationsverfahren den maximalen Amplitudenwert derRauschspannung ( bezogen auf A0
), für den noch unverfälschte Detektion möglich ist.c) In beiden Fällen erfüllt die Codierung die Anforderungen, die an einen Gray-Code gestelltwerden. Wie ist das zu verstehen und welchen Vorteil bringt das?d) Man erläutere das Blockschaltbild für den Modulator und berechne die Spannungen, welche dieDigital-Analog Wandlereinheiten für 8-QAM liefern müssen ( Codiertabelle).
S/P
90
+
D/A
D/A
abc
a
b
c
e) Vervollständigen Sie die Formeln:
u t t u t t A t e
A t e A t t u t
r T q Tj t
j tr
( ) cos ( ) sin ..................................... Re ( ) ..............
( ) ( ) cos ( ) .................... ( ) .................
( )
( )
Ω Ω− = =
= + = +
ϕ
ϕ ϕ
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 3. Aufgabe Jan. 2004
Seite 48 von 50
f) Zeichnen Sie ein Blockschaltbild für den Empfänger.g) Was versteht man unter Trägersynchronisation, Symbolsynchronisation undRahmensynchronisation?h) Wie groß ist die benötigte Übertragungsbandbreite? (entspricht der bei 8-PSK)i) Auf welche Frequenz ist der Hilfsoszillator des Umsetzers eingestellt?
Lösung
3. Aufgabe
c1) d = 3: Nach der Formel 2t+1<= d , kann t = 1 Fehler erkannt und korrigiert werden.
c2)1010000:1011= 1001 +011/1011 ----> c= 10100111011 1000 1011 011
c x i x x sti x xg x
g x x x( ) ( ) Re( )
( )( )= ⊕
= ⊕ ⊕3
33 1mit
c3)
r2r1 r0+
+Codiereri0i1i2i3
nach 4-maligem Takten steht der Rest im Register
r2‘= r1, r1‘= i ⊕ r2 ⊕ r0 , r0‘= i ⊕ r2
k i r2 r1 r0
0 1 0 0 01 0 0 1 12 1 1 1 03 0 1 0 04 0 1 1
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 4. Aufgabe Jan. 2004
Seite 49 von 50
c4)
s x stc xg x
ste xg x
stc xg x
( ) Re'( )( )
Re( )( )
Re( )( )
=
=
, da = 0
1000000:10111011 1100 1011 1110 1011 101
c5)
i ei si
0 0000000 0001 1000000 1012 0100000 1113 0010000 1104 0001000 0115 0000100 1006 0000010 0107 0000001 001
1000011:10111011 1101 1011 1101 1011 110 ---> Fehler an 3. Stelle v. links
0111111:1011 1011 1001 1011 101 ---> Fehler 1. Stelle v. links
1001010:10111011 1001 1011 100 ---> Fehler 5. Stelle v. links
1011000:10111011 000 --> kein Fehler
Aufgaben Nachrichtenübertragungstechnik Prof. Dr. C. Clemen 4. Aufgabe Jan. 2004
Seite 50 von 50
4. Aufgabe
a)
b)
110 2 0 54
001 2 124
100 2 0 532 4
: , cos
: , cos
: , cos
⋅ +
− ⋅ + +
− ⋅ + +
V t
V t
V t
Ω
Ω
Ω
π
ππ
ππ
c)
011
010
000
001
110
111
100
101
1
0,5
0,5 1
Ae A jA u jujr q
ϕ ϕ ϕ= + = +cos sin
1 2 3 f/kHz
ff
Hz ff
TBit
TBit− +
31700
3
2/3fBit
Bpr=2240Hz
Prakt. Bandbreite:fT-1,4fBit/6=580Hz=fT+1,4fBit/6=2820Hz