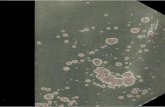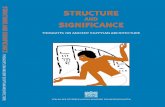Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit: Auf dem Weg zu einem kritischen Selbstverständnis –...
Transcript of Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit: Auf dem Weg zu einem kritischen Selbstverständnis –...

Nachgefragt/WiedereNtdeckt
Zusammenfassung: Eine Funktionsbestimmung Sozialer Arbeit bedarf einer Analyse gesell-schaftlicher Verhältnisse, innerhalb derer sie agiert. Die Diagnose einer veränderten wohlfahrts-staatlichen Programmatik im aktivierenden Sozialstaat ist aktuell Anlass zahlreicher Diskussionen unter der Überschrift k/Kritischer Sozialer Arbeit. Für den vorliegenden Beitrag wird eine ältere Kritiktradition wiederentdeckt, für die exemplarisch der Aufsatz „Hilfe und Kapital. Zur Funk-tionsbestimmung der Sozialarbeit“ von Walter Hollstein aus dem Jahr 1973 steht. Die Funktions-bestimmung von Hollstein – Hilfe als Helfersdienst für die bestehende Herrschaft – bringen wir in Dialog mit drei aktuellen Denkfiguren der k/Kritischen Sozialen Arbeit. Das Entdecken von Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen „alter“ und „neuer“ Kritik trägt dazu bei, ein auf gegenwärtige Verhältnisse bezogenes Selbstverständnis Sozialer Arbeit zu schärfen.
Schlüsselwörter: Hilfe · Kapital · k/Kritische Soziale Arbeit · Kritik · Funktionsbestimmung
Thoughts about the function of social work: on the way to a critical self-concept. Inspired by Walter Hollstein (1973/1980) – “Hilfe und Kapital. Zur Funktionsbestimmung der Sozialarbeit”
Abstract: In order to define social work’s function it is necessary to analyse the societal condi-tions within which it acts. Recently, the diagnosis of a changed welfare policy within the activat-ing state triggers numerous discussions under the headline of radical/critical social work. This article rediscovers an older tradition of critique. Walter Hollstein’s essay “Hilfe und Kapital. Zur
Soz Passagen (2013) 5:267–283DOI 10.1007/s12592-013-0140-8
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
M. Hartmann ()Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik,Universität Duisburg-Essen, Berliner Platz 6.8,45127 Essen, DeutschlandE-Mail: [email protected]
K. HerzogHS Ludwigshafen am Rhein FB IV – Sozial- und Gesundheitswesen, Maxstr. 29, 67059 Ludwigshafen am Rhein, DeutschlandE-Mail: [email protected]
Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit: Auf dem Weg zu einem kritischen Selbstverständnis – inspiriert von Walter Hollstein (1973/1980)„Hilfe und Kapital. Zur Funktionsbestimmung der Sozialarbeit“
Meike Hartmann · Kerstin Herzog

268 M. Hartmann und K. Herzog
Funktionsbestimmung der Sozialarbeit” which was first published in 1973, is an example of this tradition. We confront Hollstein’s argumentation—social work as the ruling authority’s ally—with three current positions of critical/radical social work. Spotting the differences and similarities between “old” and “new” critique helps sharpen a self-concept of social work which takes the current societal conditions into account.
Keywords: Help · Capital · Critical/radical social work · Critique · Function
1 Einleitung
Über die Funktion Sozialer Arbeit nachzudenken ist nicht vorstellbar ohne eine Diagnose der gesellschaftlichen Verhältnisse, innerhalb derer sie verortet ist und sich selbst veror-tet. Bereits Klaus Mollenhauer betonte die konstitutive Verwiesenheit Sozialer Arbeit auf die jeweils spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisse sowie deren Veränderungen. Die Funktion Sozialer Arbeit lasse sich demnach daraus ableiten, worauf sie „antworte“ (vgl. Mollenhauer 1959, 1964/1993).
Mit diesem Artikel möchten wir eine Funktionsbestimmung Sozialer Arbeit wieder-entdecken, die auf einer grundsätzlichen Kritik an kapitalistischen Verhältnissen beruht. Unser Ziel ist dabei eine Wiederentdeckung im doppelten Sinn von Aufgehobensein: Wir möchten bewahren, was es zu verteidigen gilt und überwinden, wo inzwischen weiter-gedacht wurde. Den Anlass hierfür sehen wir in der Bestimmung gegenwärtiger gesell-schaftlicher Verhältnisse. Wenn aktuell Soziale Arbeit als „aktivierungspädagogische Akteurin“ (vgl. Kessl 2006) analysiert wird, geschieht dies vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Transformation, die als „neosozial“ verstanden wird. Mit neosozial in Abgrenzung zu neoliberal beschreibt Stephan Lessenich (2009) die wohlfahrtsstaat-liche Programmatik im aktivierenden Sozialstaat, die sich weniger durch einen Abbau des Sozialstaats als durch seinen Wandel auszeichne. Aktivierungspolitik sowie der sie begleitende Diskurs seien hierbei auf „doppelt verantwortungsvolle Subjekte“ gerichtet, die sich selbst und dem „Gemeinwohl“ gegenüber verantwortlich handeln, um ihre Ver-antwortung wissen und sich dementsprechend verhalten“ (Lessenich 2009, S. 163). Im Mittelpunkt ständen nicht die einzelnen Individuen mit ihren Bedürfnissen und Rechten sondern vielmehr die Gesellschaft, zu deren Wohl jeder Einzelne sein Verhalten voraus-schauend und risikomindernd zu kontrollieren habe. Die Verlagerung von Verantwortung kollektiver Risiken wie Arbeitslosigkeit auf die Individuen gehe einher mit einer Indivi-dualisierung von Risiken.
In diesen Prozessen wird Soziale Arbeit nicht nur als von veränderten sozialpolitischen Regulierungen betroffen begriffen, vielmehr kommt ihr selbst die Rolle einer eigenstän-digen Akteurin zu, die an Ausschließungsprozessen nicht nur beteiligt ist, sondern diese selbst produziert. Die Angebote der Sozialen Arbeit würden nicht abgebaut, vielmehr fände eine „konzeptionelle Neujustierung im Sinne aktivierungspädagogischer Logiken“ statt (Kessl und Otto 2012, S. 1324). Michael Galuske betont für die Soziale Arbeit im aktivierenden Sozialstaat, „dass die Waage von Hilfe und Kontrolle sich wieder deutli-cher und stärker zur Kontrollseite neigt“ (Galuske 2007, S. 25). Während Soziale Arbeit zunehmend als Aktivierungsinstanz tätig werde, würde sich eine zunehmende „Sozialpä-dagogisierung“ auch anderer Bereiche wie der Polizei oder der Schule vollziehen: Soziale

Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit ... 269
Arbeit befände sich in der paradoxen Situation zwischen „gleichzeitige[r] Marginalisie-rung und weitreichender Anerkennung“ (Kessl und Otto 2012, S. 1325).
Diese und ähnliche Analysen sind aktuell Ausgangspunkt zahlreicher Veröffentli-chungen und (sozial-)politischer sowie aus der Praxis kommender Bündnisse unter der Überschrift „k/Kritische Soziale Arbeit“1 (für einen Überblick vgl. Kessl 2013, S. 93 ff.). Hierbei handelt es sich jedoch keineswegs um eine Gruppe von homogenen AkteurInnen, vielmehr finden sich unter dieser Selbstbeschreibung nicht nur unterschiedliche Kritik-verständnisse wieder, auch variieren die Sprecherpositionen sowie die Reichweite der politischen Forderungen. In all ihrer Heterogenität interpretieren wir diese aktuelle Kon-junktur jedoch als Raum der Verhandlung und des Austausches, der zumindest darauf verweist, dass es einen Anlass zur Kritik gibt.
Ab den späten 1960er Jahren bis Anfang der 1980er Jahre gab es innerhalb der bundes-republikanischen Sozialen Arbeit eine Phase, die ähnlich erscheint: Ausgehend von einer Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen und der Eingebundenheit der Sozialen Arbeit in kapitalistische Strukturen wurde die Funktion Sozialer Arbeit reflektiert. Insbesondere die Kontroll- und Stigmatisierungsaspekte wurden betont sowie die enger werdenden Hand-lungsspielräume für professionelles Handeln beklagt (vgl. insbesondere Hollstein und Meinhold 1973/1980, Kunstreich 1975, Lau und Wolff 1981, Peters und Cremer-Schäfer 1975). Bisherige Konzepte, sowie Denk- und Handlungsweisen der Sozialen Arbeit wur-den abgelehnt und nach Alternativen auf praktischer und konzeptioneller Ebene gesucht. Im Kontext dieser gesellschafts- und institutionenkritischen Auseinandersetzungen bil-deten sich (ebenfalls) Zusammenschlüsse. Sven Steinacker, der sich intensiv mit der historischen Aufarbeitung kritischer Sozialer Arbeit seit den ausgehenden 60er Jahren beschäftigt hat, spricht gar von einer „breiten Protest- und Alternativbewegung“ (Stein-acker 2011, S. 30), die unter dem Titel „kritisch“ firmierten2 und ausgehend von einer ideologiekritischen Analyse von Gesellschaft sowie pädagogischem Handeln (zumindest teilweise) politische Ansprüche formulierten (für einen ersten Ein- und Überblick vgl. Kunstreich 2001, Steinacker 2011).
Wir werden im Folgenden in einen zentralen und viel rezipierten Text der damaligen Diskussion, den Beitrag „Hilfe und Kapital. Zur Funktionsbestimmung der Sozialarbeit“ von Walter Hollstein (1973/1980) in dem von ihm mit herausgegebenen Sammelband „Soziale Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen“ einführen (2.1.). Die aktuelle Konjunktur der Kritik an der Sozialen Arbeit sowie der sich k/Kritisch verstehen-den Sozialen Arbeit erscheint uns als angemessener Anlass für diesen historischen Rück-griff. Im Anschluss an die Relektüre des Textes werden aktuelle Bezüge hergestellt (2.2.) und folgend Leerstellen in der Argumentation von Hollstein markiert (2.3.). Im Weiteren werden wir nach Möglichkeiten suchen, die von uns markierten Leerstellen zu füllen
1 „k/Kritisch“ verweist darauf, dass sich je nach Bezug zur Kritischen Theorie oder auf gesell-schafts- und herrschaftskritische Traditionslinien die (Selbst)Bezeichnungen unterscheiden kön-nen. Gemeinsam ist jedoch beiden Denktraditionen die gesellschafts- und herrschaftskritische Perspektive (vgl. hierzu auch Kessl 2013, S. 93 FN 36).
2 Neben der Überschrift „kritisch“ fanden sich Benennungen mit dem Präfix „Anti“, wie bspw. die Anti-Psychatriebewegung, die diesem Diskussionszusammenhang ebenfalls zuzurechnen sind (vgl. Cremer-Schäfer und Resch 2012, S. 83).

270 M. Hartmann und K. Herzog
und zeigen, dass es im Gegensatz zu Hollsteins Funktionsbestimmung sinnvoll ist, Hilfe abhängig von der Position des Hilfeempfangenden zu denken (3) und zu reflektieren, wie Soziale Arbeit mit ihrer Verwobenheit in gesellschaftliche Strukturen umgehen kann (4). Abschließend werden wir resümieren, warum uns eine (Re-) Lektüre von Hollsteins Funktionsbestimmung unter gegenwärtigen Bedingungen sinnvoll scheint.
2 Soziale Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen
2.1 Die Funktionsbestimmung Sozialer Arbeit bei Walter Hollstein
Hollsteins (1973/1980) Funktionsbestimmung Sozialer Arbeit3 ist eingebettet in eine his-torisch-materialistische Analyse kapitalistischer Produktionsbedingungen, die auf dem Grundwiderspruch zwischen Arbeit und Kapital beruhen. Während „allgemein produ-ziert [wird], [wird] das Resultat gesellschaftlicher Arbeit aber nur privat akkumuliert“ (S. 171). Der ökonomische Konzentrationsprozess, der sich stetig verstärke, führe zu einer Vormachtstellung der Kapitalbesitzer in allen gesellschaftlichen Bereichen. In Folge öffne sich die Schere zwischen Arm und Reich, oder wie Hollstein es formulieren würde, zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse, weiter, eine immer größer werdende Gruppe von Armen werde zu AdressatInnen4 der Sozialen Arbeit.
Soziale Arbeit wird damit zur Vermittlerin zwischen den negativen Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen, die sich aus dem kapitalistischen System ergeben, und den Menschen, die davon betroffen sind. Um zu einer Funktionsbestimmung zu kommen, so betont Hollstein, bedürfe es dem Blick auf die „gesellschaftlichen Tatsächlichkeiten“ (Hollstein 1973/1980, S. 170).
Davon grenzt er das sozialarbeiterische Selbstverständnis der Hilfe ab, welches er als Ideologie analysiert. So zeigt er anhand damaliger zentraler Theoriediskurse wie bspw. von Friedländer und Pfaffenegger auf, wie die Hilfe der/des Sozialarbeiter_in als ein-zigartig und durch eine „persönliche Natur“ gekennzeichnet konzipiert werde (Hollstein 1973/1980, S. 168). Beansprucht würde theoretisch, methodisch sowie in der Selbst-beschreibung, die_den Hilfebedürftige_n als „Freund“ oder „Freundin“ anzusehen, die Hilfe selbst sei durch die Gabe der „Liebe“ gekennzeichnet.
Hollstein betont, dass sich der Hilfebegriff jedoch nicht nur in religiös oder humanis-tisch motivierten Konzeptualisierungen niederschlage, sondern sich ebenfalls semantisch in der Gesetzgebung wiederfinde, so bezeichne bspw. das damalige Bundessozialhilfe-
3 In den Originalzitaten werden wir den von Hollstein verwendeten Terminus „Sozialarbeit“ belas-sen, ansonsten verwenden wir den heute üblicheren „Soziale Arbeit“. Die historische wie theo-riesystematische Unterscheidung sowie Veränderung kann an dieser Stelle kein Thema sein. Für einen Überblick vgl. Kessl und Otto 2012, S. 1307 ff.
4 Hollstein spricht, wie damals üblich, von Klient_innen. Wir werden in Abgrenzung dazu auf-grund der defizitären Implikationen des Begriffs hilfsweise auf den Adressat_innen-Terminus zurückgreifen. Hilfsweise deshalb, da es auch hier um einen Begriff aus institutioneller Perspek-tive geht; denn „nur wenn ein Hilfe- oder Angebotsbedarf institutionell festgestellt wird, werden Personen zu Adressat_innen“ (Bitzan und Bolay 2013, S. 39).

Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit ... 271
gesetz (BSHG) die Anspruchsberechtigten als Hilfesuchende und Hilfeempfänger (Holl-stein 1973/1980, S. 169).
Durch diese juristische Verankerung des Hilfebegriffes werde die Hilfebedürftigkeit rechtlich festgeschrieben. Unter Rückgriff auf Hans Scherpners Unterscheidung zweier Grundformen von Hilfebedürftigkeit, einerseits die wirtschaftliche oder auch Armut und andererseits die moralische oder auch Verwahrlosung (vgl. Scherpner 1962, S. 138 zit. nach Hollstein 1973/1980, S. 169), kommt er zu dem Schluss, dass beiden Definitionen von Hilfebedarf gemein sei, dass sie eine gesellschaftliche Unangepasstheit beschreiben, die durch die Hilfe von Sozialer Arbeit behoben werden soll. Implizit unterstellt werde so, dass Soziale Arbeit helfe. Hollstein enttarnt dieses Selbstverständnis als Ideologie: „Dass Sozialarbeit hilft, ist (…) nur ein Dogma, an das sich glauben lässt“ (Hollstein 1973/1980, S. 170).
Diese Einordnung bildet für ihn den Ausgangspunkt einer Analyse der gesellschaft-lichen Situation über welche er versucht, die Funktion Sozialer Arbeit zu bestimmen. Hinter der Konzeption der Hilfe sowie Hilfebedürftigkeit stehe die Annahme einer „har-monischen Gemeinschaft“ (Hollstein 1973/1980, S. 169), die Adressat_innen als anders und abweichend markiere, dies als individuelles „Versagen“ deute und hierdurch Nor-malität und Ordnung (re)produziere. Primäre Adressat_innen Sozialer Arbeit seien so nicht die Hilfebedürftigen, da diese an Gesellschaft angepasst werden sollen, sondern die Gesellschaft selbst. Zu kritisieren sei zudem, dass einem solchen ordnungstheoretischen Denken ein Modell des Konsenses statt des Konflikts zugrunde gelegt werde. Die Ideo-logie verdecke den Grundwiderspruch des kapitalistischen Produktionssystems. Die kon-kreten Funktionen Sozialer Arbeit seien somit nicht als Hilfe zu fassen, sondern dienen vielmehr der Herrschaftssicherung (Hollstein 1973/1980, S. 189). Hollstein unterscheidet
1. die ökonomische Funktion, die dazu diene „Arbeitskraft im kapital-adäquaten Maß-stab“ zu reproduzieren.
2. Die soziale Funktion, die auf eine Milderung von Klassenunterschiede und daraus resultierenden Diskriminierungen abziele, und die
3. Politische Funktion, die eine Befriedigung der Bedürfnisse der (wirtschaftlich) Armen insoweit stabilisiere, als dass der „soziale Frieden“ gesichert werde (vgl. Hollstein 1973/1980).
Soziale Arbeit fungiere aufgrund ihrer herrschaftssichernden Funktion als „Agentur der sozialen Kontrolle“ (Hollstein 1973/1980, S. 190), die jedoch, im Gegensatz zu anderen Institutionen der sozialen Kontrolle wie die der Polizei oder Justiz, mit subtileren Mecha-nismen, d. h. einem „Mixtum von Beistand und Unterdrückung“ (Hollstein 1973/1980, S. 191) agiere. Kritisch merkt Hollstein an, dass durch die Ausrichtung des sozialarbei-terischen Handelns an der Integration der „anormale[n] Personen“ in die bestehende Gesellschaft unterbleibe, das – als abweichend definierte – Handeln selbst als Verneinung konkreter Werte zu verstehen. Die Gültigkeit der postulierten gesellschaftlichen Normen werde so bestätigt, anstatt diese auf ihre machtvollen Grenzziehungen zu befragen.
Als Maßstab für die Normverstöße, die geahndet werden, würden nicht nur die gesetz-lichen Grundlagen dienen, sondern die von den Sozialarbeiter_innen verinnerlichten gesellschaftlichen Normen. „Subjektiv befriedigendes Leben“ werde so gleichgesetzt mit einem „normenkonformen Leben“, das in die Gesellschaft und ihre Bedingungen integ-

272 M. Hartmann und K. Herzog
riert sei. Bestimmend für kapitalistische Produktionsverhältnisse sei hierbei die Orientie-rung an Lohnarbeit als übergeordneter Norm. Nicht die subjektiven Maßstäbe des „guten Lebens“ würden sozialarbeiterisches Handeln bestimmen, sondern die (vermeintlich) als objektiv gesetzten Maßstäbe der kapitalistischen Produktionsverhältnisse.
Verstöße gegen die Norm zu sanktionieren unterliege wie beschrieben u. a. der Sozialen Arbeit. Selbst wenn sie als Hilfe präsentiert werde, so habe sie dennoch „Strafcharakter“. Hollstein führt hier beispielhaft die Unterkünfte für Wohnungslose an, die bewusst einfach und unattraktiv gehalten würden. „Es ist das Prinzip der Sozialarbeit, ihre ‚Hilfe’ so zu strukturieren, dass sie dem Klienten gerade das Nötigste gibt, um überleben zu können“ (Hollstein 1973/1980, S. 199 f.). Dadurch solle nicht nur vermieden werden, dass, so würde man heute polemisch sagen, sich zu viele in der „sozialen Hängematte“ ausruhen, sondern Zwang ausgeübt werde, der die Wiedereingliederung als Arbeitskraft zum Ziel habe.
Diese Orientierung an Lohnarbeit als leitendem Prinzip führt Hollstein zu einer Aus-differenzierung der Gruppe der „Armen“. So unterscheidet er drei Typen von Sozialer Arbeit entlang des jeweiligen Status der AdressatInnen im Produktionsprozess:
Diejenige die sich um „Lohnarbeiter kümmert, die aufgrund des sozio-psychischen Drucks, der alltäglich auf sie ausgeübt wird, in Problemsituationen geraten sind, wel-che sie aufgrund ihres reduzierten ökonomischen Status nicht selbsttätig lösen können“ (Hollstein 1973/1980, S. 186), jene „die die ‚industrielle Reservearmee’ pflegt, damit ein-zelne ihrer Mitglieder bei Bedarf in den Arbeitsprozeß reintegriert werden können“ (Holl-stein 1973/1980, S. 186, H.i.O.), und die Soziale Arbeit, die „Bürger materiell unterstützt, die endgültig aus dem Produktionsprozeß der Gesellschaft eliminiert wurden“ (Hollstein 1973/1980, S. 186).
Welche Unterstützungsangebote Soziale Arbeit mache, orientiere sich demnach an der Arbeitsfähigkeit bzw. an den Bedarfen des Kapitals. Um „Hilfe“ zu bekommen, gelte es für Adressat_innen sich entlang der kapitalistischen Norm zu verhalten. Wie bereits beschrieben würden Verstöße als Abweichung begriffen und von der Sozialen Arbeit kon-trolliert und sanktioniert. Von den Adressat_innen werde „gefordert, dass sie einerseits ihr früheres Verhalten als falsch bewerten und das jetzt von ihnen verlangte Verhalten als richtig erkennen“ (Hollstein 1973/1980, S. 199). In diesem Sinne gutes Verhalten werde belohnt und falsches sanktioniert, was bis zum Ausschluss von Angeboten der Sozialen Arbeit führen könne. Bedingungen für den Zugang zu und das Zur-Verfügung-Stellen von Sozialer Arbeit fänden sich so im gesellschaftlichen Wohlverhalten der Adressat_innen.
Der Prozess der Ausschließung derer, die sich nicht anpassen, fungiere als Grenz-ziehung: So diene er einerseits der Abschreckung anderer, sich nicht ebenfalls dem Normenkorsett zu entziehen, zum anderen zwinge er die Angepassten weiter zum Gehor-sam indem ihnen vorgeführt werde, wohin Verweigerung führe (Hollstein 1973/1980, S. 202 ff.). Im Sinne der kapitalistischen Logik
teilt die Strafe die Gesellschaft in Gut und Böse ein. Der sozio-ökonomische Wider-spruch zwischen Kapital und Lohnarbeit kaschiert sich im moralischen von Wohlver-halten und Abweichung. (…) Solche Ablenkung von den wirklichen Trennungslinien in der kapitalistischen Gesellschaft stärkt diese und wirkt also herrschaftsstabilisie-rend. Gewissermaßen entsteht so die Gemeinschaft der Guten, Ordentlichen und Fleißigen, zu der Kapitalist und Lohnarbeiter je zusammen gehören; ihr gemeinsa-mer Feind ist der Böse, Unordentliche und Faule (…) (Hollstein 1973/1980, S. 203).

Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit ... 273
Die Eingebundenheit der Sozialen Arbeit in die kapitalistische Gesellschaft führe im All-tag der Sozialarbeiter_innen ebenfalls zu Widersprüchen. So betont Hollstein, dass „der einzelne Sozialarbeiter z. B. gezwungen [sei], trotz des verfügbaren Wissens um die sozi-alstrukturelle Bedingtheit sozialer Chancenungleichheit (...) jeweils am Einzelfall das zu lindern, was seiner ‚Diagnose’ nach sich als Ergebnis sozialer Wirkfaktoren und Ursa-chenzusammenhänge darstellt, die zu beeinflussen er aber in den seltensten Fällen in der Lage ist.“ (Böhnisch 1972 zit. nach Hollstein 1973/1980, S. 192 f., H.i.O.).
Hollstein verweist hier demnach durchaus auf einzelne Sozialarbeiter_innen die die Problematik ihres Handelns erkennen, jedoch gezwungen sind, sich mit den gegebenen Strukturen zu arrangieren, diesen sogar hilflos gegenüber stünden. Bürokratisierungs- und Administrationszuwächse führten zu fehlender Zeit für die konkrete Arbeit mit den AdressatInnen, wodurch die Arbeit auf die Verwaltung reduziert werde(n müsse). Die Administration erfolge dann im Sinne eines „reibungslosen Funktionierens der Institu-tion und im Interesse der Ökonomie“ (Hollstein 1973/1980, S. 192, H.i.O.) Gerade auch die_der einzelne Sozialarbeiter_in verbleibe demnach unter kapitalistischen Produktions-bedingungen von den bestehenden Strukturen abhängig, die durch sein_ihr eigenes Han-deln reproduziert würden. Für eine kritische Praxis innerhalb der bestehenden Strukturen scheint es so wenig bis keinen Spielraum zu geben. So sieht Hollstein die Ohnmacht der Sozialen Arbeit bestätigt in der Aberkennung des Zeugnisverweigerungsrechtes mit dem Hinweis der fehlenden Unabhängigkeit und Eigenverantwortung von Sozialarbei-ter_innen durch das Bundesverfassungsgericht (Hollstein 1973/1980, S. 194 f.).
Zusammenfassend kommt Hollstein mit seiner Funktionsbestimmung zu einem des-illusionierenden Portrait der Sozialen Arbeit. „Kapital schafft Klienten“ (Hollstein 1973/1980, S. 204) und Soziale Arbeit sei in diesem Sinne Advokat Diaboli für das Kapital. Als Teil der Sozialpolitik leiste sie „Helferdienst für die bestehende Herrschaft“ (Hollstein 1973/1980, S. 204; H.i.O). Sie sei das „institutionalisierte schlechte Gewissen der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber den Problemen mit denen sie nicht fertig [wird]“ (Hornstein 1970, S. 99 zit. nach Hollstein 1973/1980, S.204). Nicht die Ideologie, son-dern „Sinn und Zweck von der ihr zugrunde liegenden Struktur, die sie reproduzieren hilft“ (Hollstein 1973/1980, S. 171) würden die Funktion Sozialer Arbeit bestimmen.
2.2 Zur Aktualität von Hollstein
Hollsteins Funktionsbestimmung von Sozialer Arbeit als „Helfersdienst für die bestehende Herrschaft“ (Hollstein 1973/1980, S. 204, H.i.O) ist auch 2013 nicht unbe-deutend, da aktuell kritische Stimmen innerhalb der Sozialen Arbeit erneut lauter werden. Die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zwar in großen Teilen grundlegend verändert, dennoch finden sich erstaunliche Parallelen zwi-schen der Situation 1973 und 2013, von denen wir drei Beispiele skizzenhaft benennen möchten. Eine fundierte Analyse ist an dieser Stelle nicht möglich, dennoch möchten wir unsere Irritationen in Bezug auf die Ähnlichkeiten, evtl. auch Verschärfungen, zu Holl-steins Beschreibungen kurz aufrufen:
Hollsteins Analyse, Soziale Arbeit habe Lohnarbeit und die Bereitstellung einer „Reser-vearmee“ als Maxime, ist für gegenwärtige Sozialpolitik hochaktuell. Gerade in den Arbeitsfeldern der Bildung sowie der Arbeitsförderung finden sich zunehmend Projekte

274 M. Hartmann und K. Herzog
und Angebote der Sozialen Arbeit, die die Arbeitsmarktintegration ihrer Adressat_innen begleiten und befördern sollen. „Employability“ wird mehr und mehr zum übergeordne-ten Interesse erklärt, eine konkrete Aushandlung über das „was das Problem ist“ und wel-cher Unterstützung es diesbezüglich bedarf, findet so ihre Begrenzung. In Bezug darauf, wie sich die Aktivierungsprogrammatiken auf der Ebene der konkreten Praxis nieder-schlagen, besteht noch Forschungsbedarf, erste Ergebnisse finden sich bspw. bei Kolbe (2011) und Ott (2011).
Das Prinzip der Sozialen Arbeit sei, ihre Hilfe so zu strukturieren, dass sie den Klienten nur das Nötigste zum Überleben gäbe, damit diese sich nicht gegen die bestehenden Ver-hältnisse auflehnen würden, so Hollstein. Angesichts der stets wieder aufkommenden Dis-kussionen um die Höhe des Regelsatzes im SGB II sowie der angemessenen Wohnkosten, zeigt sich, dass die Definition eines Existenzminimums auch weiterhin umkämpft bleibt. Dass die aktuelle Höhe des derzeit gezahlten Satzes die Existenz nicht ausreichend sichert, lässt die Zunahme von Angeboten der „Mitleidsökonomie“ (vgl. Kessl und Wagner 2010, Kessl 2013, S.137 ff.) vermuten. Hierhin werden zudem vor allem diejenigen verwiesen, denen „berechtigterweise“ eine (Mit)Schuld an ihrer Situation zugeschrieben wird.
Feststellbar bleibt zudem, dass auch weiter eine semantische Festschreibung von Sozia-ler Arbeit als Hilfe besteht. Auch wenn die für Soziale Arbeit relevanten gesetzlichen Grundlagen seit 1973 fast gänzlich überarbeitet wurden, spricht bspw. das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG/ SGB VIII) auch dann von Hilfe zur Erziehung, wenn die Kon-trollfunktion Sozialer Arbeit überwiegt (vgl. Schefold 2011, S.12; Gängler 2005, S. 772).
2.3 Leerstellen der Argumentation
Hollsteins Funktionsbestimmung weist einige Leerstellen auf, die im Folgenden heraus-gearbeitet werden sollen. Bei der nachstehenden Analyse interpretieren wir Hollsteins Argumentation als auf die Profession Sozialer Arbeit und weniger auf eine Disziplin Sozialer Arbeit bezogen, auch wenn ein Übertrag sicher teilweise möglich wäre.
Gemäß Hollsteins Analyse Sozialer Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbe-dingungen kommt dieser als Teil der Sozialpolitik die Funktion zu, auf die Missstände des Kapitalismus zu antworten und diese abzumildern. Im Mittelpunkt seiner Diagnose steht die einseitige Anpassung der Individuen an die Gesellschaft. Jegliches Handeln der Sozialarbeiter_innen bleibt determiniert von der kapitalistischen Logik, seine Argumen-tation bezieht sich (ausschließlich) auf die strukturelle Ebene. Und hierin liegt auch die Schwäche seiner Argumentation.
Aus dem Blick gerät so dreierlei:
1. Zum einen die Berücksichtigung der konkreten Interaktionen zwischen Sozialarbeiter_in und Adressat_in: Diese Situationen können trotz der überaus ein-flussreichen Machtstrukturen nicht ausschließlich über die gesellschaftlichen Struktu-ren bestimmt werden, sondern beinhalten Potenzialitäten für widerständiges Verhalten auf beiden Seiten.
2. Zudem erachten wir die Tendenz der Vereinheitlichung Sozialer Arbeit als problema-tisch: Hollstein spricht durchweg von DER Sozialen Arbeit, obwohl er seine Funk-tionsbestimmung in einer Zeit entwickelt, in der kritische Zusammenschlüsse von Sozialarbeiter_innen auf anderes verweisen. Diese Bündnisse können als Spuren des

Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit ... 275
Bruchs mit Routinen, als Suche nach Alternativen sowie als Formen des alltäglichen Widerstands interpretiert werden. Möglichkeitsräume pädagogischen und politischen Handelns werden so von ihm nicht berücksichtigt. Auch hier gerät durch den Blick-winkel seiner Analyse auf der Strukturebene die Handlungsebene aus dem Blick.
3. Darüber hinaus verbleibt der Hilfebegriff unterbestimmt: Gerade durch die einseiti-ge Auflösung der Widersprüche von Hilfe und Kontrolle in Richtung der Kontrolle unterbleibt eine Auseinandersetzung mit Kriterien, durch welche Hilfe gefasst werden könnte. Wir wollen damit nicht bestreiten, dass es sich bei Selbstbeschreibungen wie dem von Hollstein beschriebenen Hilfe- Selbstverständnis um „signifikante Symbo-le“ handelt, die auch ideologische Bedeutungen haben können, dennoch sind diese Bedeutungen nicht festgeschrieben, sondern müssen vielmehr in verschiedenen ge-sellschaftlichen Kontexten verhandelt und erneuert werden (vgl. Cremer-Schäfer und Resch 2012, S. 82).
Anschließend an diese Kritik möchten wir im Weiteren Angebote machen, wie die mar-kierten Leerstellen gefüllt werden könnten. Dafür wenden wir uns zunächst dem Selbst-verständnis von Sozialer Arbeit als Hilfe zu (3), um dann aus einer differenzierten, feministisch inspirierten Perspektive Soziale Arbeit in ihrer widersprüchlich verwobenen Position in Gesellschaft zu betrachten (4).
Bei aller Kritik an der Perspektive Hollsteins, beantwortet unser Beitrag am Ende die Frage, warum es dennoch lohnt, sich mit dieser auseinander zu setzen.
3 Hilfe als Grundkategorie für ein Selbstverständnis Sozialer Arbeit?
Historisch beziehen sich alle Selbstbeschreibungen Sozialer Arbeit „letztlich auf den Hilfebegriff, allerdings in jeweils unterschiedlicher Ausprägung hinsichtlich Objekt und Subjekt, Form und Begründung des Helfens“ (Gängler 2005, S.773). Für Hollstein ist diese Selbstbeschreibung ausschließlich eine ideologische, die beanspruche, Menschen Hilfe zur Führung eines besseren Lebens anzubieten. Dabei orientiere sie sich jedoch an gesellschaftlichen Normen, welche nur scheinbar objektive Kriterien für ein gutes Leben beschreiben, und im Kern lediglich an der Erhaltung des kapitalistischen Systems interessiert seien. Da Hollstein das kapitalistische System als ein ausschließendes und ausbeutendes System beschreibt, könne Hilfe, die sich an den Normen dieses Systems orientiere, nur eine ideologische Verschleierung desselben sein.
Sven Steinacker kritisiert, Hollsteins Analyse reduziere Soziale Arbeit auf „ihre Rolle als Büttel von Staat und Kapital“ (Steinacker 2011, S. 35). Dabei übersehe sie, dass Soziale Arbeit neben der Eingebundenheit in das kapitalistische System eine unterstüt-zende Funktion für ihre Adressat_innen haben könne. Die Reduktion auf ein „ideologi-sches Feigenblättchen“ (Steinacker 2011, S. 35) werde der Komplexität der Hilfefunktion Sozialer Arbeit nicht gerecht. Steinacker widerspricht Hollstein hier nicht in der grund-sätzlichen Analyse, Soziale Arbeit sei ein herrschaftsstabilisierender Teil des kapitalisti-schen Systems. Er betont vielmehr, es dürfe nicht vergessen werden, dass die Hilfe, die Soziale Arbeit erbringe, zu einer Linderung tatsächlicher Not beitrage.
Ebenso argumentierte 1984 schon Micha Brumlik gegen die zu enge Fokussierung des „ideologische[n] und herrschaftstützende[n] Charakter[s]“ von Hilfe, da hierdurch

276 M. Hartmann und K. Herzog
„echte, materielle und psychische Verelendungserscheinungen“ sowie ihre notwendige Bearbeitung nicht berücksichtigt würden (vgl. Brumlik 1984, S. 115). Marxistische Ana-lysen würden unterstellen, dass Adressat_innen aufgrund ihrer ideologischen Beeinflus-sung nicht die Fähigkeit besäßen, ihre eigene Lebenslage zu reflektieren.
Basierend auf dieser Unterstellung werde advokatorisches Handeln mit dem Ziel der Organisation der Betroffenen legitimiert. Diese Stellvertretung könne allerdings nicht Soziale Arbeit übernehmen, da sie in ihrer Funktion herrschaftsstabilisierend wirke und sich nicht gegen das gesellschaftliche System stellen könne. Es bedürfe deshalb einer politischen Interessenvertretung ohne staatlichen Auftrag, die diese Funktion übernähme (vgl. Ahlheim et al. 1971 zit. nach Brumlik 1984, S. 116).
Aufbauend auf seiner kritischen Analyse formuliert Brumlik seine Definition von Hilfe: Hilfe sei das „Erbringen einer erbetenen Leistung ohne weitere Bedingung“ (Brumlik 1984, S. 115, H.i.O). Näher bestimmt werden könne dieses Verhältnis durch die Positionen des „Helfers“, als demjenigen „der diese Leistung erbringt“ und dazu auch willens und fähig sei, sowie dem, „der diese Leistung erbittet“ und durch dieses Erbitten als „hilfsbedürftig“ bestimmt werde (Brumlik 1984, S. 115, H.i.O.). Brumlik zufolge geht dem Erbitten voraus, dass die Hilfe nachfragende Person für sich definiere, sie sei „nicht dazu in der Lage (…), einen erwünschten bzw. von ihr als wertvoll erachteten Zustand ihrer selbst, oder ihrer Umwelt aus eigener Kraft zu erlangen“ (Brumlik 1984, S. 115).
Die eigene Definition desjenigen, der Hilfe nachfragt, ist demnach maßgeblich für die Bestimmung einer Situation als Hilfesituation – oder wie es Helge Peters (2002) formu-liert: „Anlass einer Hilfehandlung (…) wäre das subjektiv empfundene Leiden und das deswegen artikulierte Bedürfnis des Adressaten oder der Adressatin, das zum Handeln treibt“ (Peters 2002, S. 140). Es kann also nur dann von Hilfe gesprochen werden, wenn die Leistung nicht gegen den Willen einer Person erbracht wird5. Ebenso kann Hilfebe-dürftigkeit nicht entlang objektiver Kriterien abgestritten werden, wenn die nach Hilfe fragende Person sich als bedürftig definiert (vgl. Brumlik und Keckeisen 1976, S. 258).
In Siegfried Müllers Aufsatz zum „Sozialarbeiterischen Alltagshandeln“ aus dem Jahr 2001, der erstmalig bereits 1978 in der Zeitschrift Neue Praxis veröffentlicht wurde, findet sich eine Möglichkeit, die scheinbar gegensätzlichen Positionen Hollsteins und Brumliks zu verbinden. Er betont die Notwendigkeit, die Funktion Sozialer Arbeit in Handlungs- und Strukturebene zu differenzieren. Auf beiden Ebenen, so Müller, sei Soziale Arbeit „in je spezifischer Gewichtung Hilfe und Kontrolle zugleich“ (Müller 2001, S. 34).
Somit lässt sich Hollstein entgegnen, dass eine auf Kritik an kapitalistischen Pro-duktionsverhältnissen basierende Funktionsbestimmung Sozialer Arbeit die negativen Effekte ihrer strukturellen Abhängigkeit beleuchtet, zugleich aber sowohl die Hilfeas-pekte der Strukturebene, sowie die Handlungsebene insgesamt ausblendet.
Die scharfe Kritik Hollsteins an Hilfe als Vehikel kapitalistischer Ideologie und Grundlage für ein Selbstverständnis Sozialer Arbeit hat dennoch ihre Berechtigung. Der Verweis auf die Abhängigkeit Sozialer Arbeit von den bestehenden Herrschaftsverhält-nissen zeigt mindestens, dass eine Reflexion eben dieser nicht einfach, und ein kritisches Handeln in ihnen noch schwieriger ist.
5 Ungelöst bleibe, so Brumlik, die Fragen nach Situationen der Hilflosigkeit, in denen eine Person aufgrund ihres Leidens nicht in der Lage sei, einen Hilfebedarf zu formulieren (vgl. Brumlik 1984).

Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit ... 277
Dennoch vergibt Hollstein durch seine Reduzierung von Hilfe auf Ideologie die Mög-lichkeit, Soziale Arbeit in ihrer Ambivalenz zu erfassen: Sie ist eben nicht nur von gesell-schaftlichen Verhältnissen abhängig sondern bestimmt sich ebenso über diejenigen, die Hilfe nachfragen.
An Brumliks Hilfeverständnis muss hingegen kritisiert werden, dass er die Hilfe-Di-mension der Handlungsebene fokussiert und damit die Kontroll-Dimension sowie die Strukturebene, zumindest an dieser Stelle, weitgehend vernachlässigt. Deutlich wird das insbesondere dann, wenn Brumlik in seiner Definition von Hilfe voraussetzt, dass sie „ohne weitere Bedingung“ (Brumlik 1984, S. 115, H.i.O) gewährt werde. Dies ist jedoch in vielen sozialarbeiterischen Handlungsfeldern nicht der Fall (vgl. Schefold 2011, S. 12): Eine Hilfeleistung wird oft nur dann erbracht, wenn Adressat_innen glaubhaft machen können, dass sie aktiv an der Veränderung der Situation mitwirken wollen. Ihre Mitwir-kungsbereitschaft und Motivation wird hierbei nicht nur in Hinblick auf den Zugang zur Sozialen Arbeit überprüft, sondern während des gesamten Prozesses.
Ausdruck davon sind bspw. auch die Verträge zwischen Sozialarbeiter_innen und Adressat_innen, die in vielen Handlungsfeldern zu Beginn der Hilfe geschlossen wer-den, in welchen Ziele festgehalten, sowie bei Nichterreichen dieser oder fehlender Mit-wirkung der Adressat_innen Sanktionen bis zur Beendigung der Hilfe drohen. Beispiele hierfür sind Hilfepläne in den Hilfen zur Erziehung oder im ambulant betreuten Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung sowie die Eingliederungsvereinbarungen im JobCenter. Die von Brumlik geforderte Bedingungslosigkeit als Kriterium für Hilfe fin-det ihre Grenze zumindest auf struktureller Ebene an den rechtlich festgeschriebenen Rahmenbedingungen.
Wir plädieren demnach dafür, den Hilfe-Begriff nicht vollständig als Ideologie zu verwerfen, möchten diesen vielmehr hinreichender bestimmen durch die Position der Hilfe-Nachfragenden. Zugleich ist dies nicht ausreichend um zu erfassen, was Soziale Arbeit innerhalb kapitalistischer Strukturen (auch) tut, wenn sie Angebote macht und mit welcher Funktion. Eine Soziale Arbeit, die sich ihrer herrschaftsstabilisierenden Anlage bewusst ist, gleichzeitig „echte“ Hilfe für ihre Adressat_innen anbieten möchte, muss beantworten, auf welche Problemlagen hin sie agiert, wessen Definition diesen zugrunde liegt, und welche Mittel dafür legitim sind.
Das bedeutet, dass Soziale Arbeit sich zu ihrer Verwobenheit in Gesellschaft herr-schaftskritisch positionieren muss, und dies stets wieder neu.
4 Soziale Arbeit in Gesellschaft
Mit Mollenhauer haben wir zu Beginn dieses Artikels festgehalten, dass einer Bestim-mung der Funktion Sozialer Arbeit eine Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse vor-ausgehen muss. Solch eine Analyse ist Voraussetzung für eine Soziale Arbeit, die sich k/Kritisch verstehen möchte. Kritisch werden Gesellschaftsanalysen jedoch erst dadurch, dass sie Macht- und Herrschaftsstrukturen sowie deren Ein- und Ausschließungsmecha-nismen in den Blick nehmen. Das bedeutet für Soziale Arbeit die eigene Position innerhalb der, als ungerecht, ausschließend, undemokratisch o.ä. beschriebenen, gesellschaftlichen Verhältnisse zu reflektieren. Diesem Projekt widmen sich, aktuell mit einer auffallenden Konjunktur, unterschiedliche Denkströmungen und theoretische wie praktisch-politische

278 M. Hartmann und K. Herzog
Ansätze k/Kritischer Sozialer Arbeit. Fragen die sich an solch eine Diagnose anschließen sind: Wie verändert sich Soziale Arbeit in diesen Prozessen? Welche Rolle oder Aufgabe übernimmt sie? Welchen Zwängen unterliegt sie? Und wo gestaltet sie aktiv Ungerech-tigkeiten (mit)? Und was ist eigentlich ihr Gegenstand? Die Antworten von k/Kritischen SozialarbeiterInnen sind so unterschiedlich, wie die Gruppierungen, Zusammenschlüsse, Arbeitskreise und Denkschulen, die sich unter diesem Label verorten.
Bereits zu Beginn dieses Beitrags haben wir skizzenhaft auf Analysen der gegenwärti-gen gesellschaftlichen Verhältnisse verwiesen.
Im Folgenden möchten wir nun drei ausgewählte Denkfiguren vorstellen, die den Anlass ihrer Kritik aus der gegenwärtigen neosozialen Gesellschaftsformation (vgl. Lessenich 2009) ableiten. Wir verstehen ihre aktuelle Kritik zugleich als in der Tradi-tion früher Projekte der Kritik stehend, die Möglichkeiten bieten, Soziale Arbeit in ihrer Komplexität zwischen den Bedürfnissen ihrer Adressat_innen und der Verwobenheit in die jeweils spezifischen gesellschaftlichen Kontexte zu reflektieren. Mit den Autorinnen Melanie Plößer, Helga Cremer-Schäfer, Christine Resch und Susanne Maurer fokussie-ren wir eine feministisch inspirierte Kritikperspektive. Im Gemeinsamen werden wir das Besondere jeweils herausstellen, um weitere Anregungen für eine kritische Auseinander-setzung mit Hollsteins Argumentationen zu entdecken. Hierbei nutzen wir Plößer ins-besondere für die Dekonstruktion von gesellschaftlichen Normen, sowie Cremer-Schäfer und Resch für die Verwobenheit der Wissenschaft sowie der Notwendigkeit, die Position der Adressat_innen einzuholen. Von Maurer greifen wir insbesondere den Blick auf die Räume und Praxen kollektiver (Selbst-) Reflexion auf.
4.1 Melanie Plößer: dekonstruktive Soziale Arbeit
Die erste Denkfigur beschreibt Melanie Plößer in ihrem Aufsatz „Differenz performa-tiv gedacht. Dekonstruktive Perspektiven auf und für einen Umgang mit Differenzen“ (2010). Plößer versteht Soziale Arbeit „als eine Disziplin und Praxis […] die auf soziale Unterscheidungen reagiert“ (Plößer 2010, S. 218) und gleichzeitig beteiligt ist an der Herstellung eben dieser Differenzordnungen (vgl. Plößer 2010). Ihr Ausgangspunkt für diesen „doppelten Bezug [von Sozialer Arbeit, Anm. MH & KH] auf Differenz“ sind sprachphilosophische Überlegungen in Anlehnung an John L. Austin und Judith Butler. Mit ihnen stellt sie heraus, dass Sprechakte performativ seien und in der Folge soziale Bedeutungen erzeugten. Oder anders gesagt: Wenn Soziale Arbeit Differenzen sprach-lich markiere, rezipiere sie demnach nicht nur die in den gesellschaftlichen Normen ein-gelagerten Differenzordnungen, sie trage auch aktiv dazu bei, diese Differenzen durch Wiederholung zu produzieren und zu verfestigen.
In Folge dessen positioniere Soziale Arbeit mit ihrem Handeln Subjekte und konstru-iere sie als normal oder abweichend (vgl. Plößer 2010, S. 223). In diesen Akten der Diffe-renzierung sieht Plößer eine nicht aufzulösende Ambivalenz. Auf der einen Seite böte die Benennung der Differenzordnungen den „notwendigen Rahmen […] um fehlende Res-sourcen, Diskriminierungen und Benachteiligungen problematisieren zu können“ (Plößer 2010, S. 223 f.), auf der anderen Seite trage eben diese Markierung zur Aufrechterhaltung der bestehenden Normierungen bei.
Plößer plädiert aufgrund dieses konstitutiven Widerspruchs für einen „dekonstruktiven Umgang mit Differenz“ (Plößer 2010, S. 227, H.i.O.), in welchem die Anerkennung von

Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit ... 279
Differenzzuschreibungen ergänzt werden müsse durch ein kontinuierliches Hinterfragen der vorgängigen Normen.
Plößers Figur von Sozialer Arbeit als (Re-)Produzentin gesellschaftlich verhandelter Werte und Normen ist unserer Ansicht nach gut geeignet, um eine Leerstelle zu füllen, die Hollstein durch seine Argumentation auf rein struktureller Ebene hinterlässt. Soziale Arbeit hat in ihren Überlegungen durchaus Spielräume und Möglichkeiten auch innerhalb des bestehenden Systems dieses zu kritisieren und zu verändern. Voraussetzung hierfür ist ein Verständnis von gesellschaftlichen Normen und daran angelagerten Differenzordnun-gen als fluide, konstruiert und somit veränderbar. Es ergeben sich in Konsequenz dann zwei Aufgaben für Soziale Arbeit. Zum einen müsse sie „die Definitionsmacht über die jeweili-gen Kategorien stärker den Betroffenen“ (Plößer 2010, S. 230) überlassen und zum anderen Verengungen und Diskriminierungen aufgrund dieser skandalisieren (vgl. Plößer 2010).
4.2 Helga Cremer-Schäfer und Christine Resch: „Reflexive Kritik“
Auch Helga Cremer-Schäfer und Christine Resch (2012) legen ihrem Kritikverständ-nis eine Perspektive auf Gesellschaft als von Akteur_innen in Interaktionen „gemacht“ zugrunde. Gesellschaft wird so in interaktionistischer Perspektive nicht als System von Gruppen, Personen oder Strukturen, sondern von Situationen interpretiert (vgl. Cremer-Schäfer und Resch 2012, S. 85). Kategorisierungen von Akteur_innen oder deren Hand-lungen seien abhängig von der unterschiedlichen Deutungsmacht über Situationen. Die „Bedeutungen“ werden somit selbst als „Relation und das Ergebnis einer Geschichte von Normsetzungen“ (Cremer-Schäfer und Resch 2012, S. 85) interpretiert. So wird deutlich, dass ähnlich wie bei dem von Plößer vorgeschlagenen dekonstruktiven Umgang mit Dif-ferenz, die Vorannahmen und dahinterstehenden Normen in den Blick zu nehmen sind. Dies sei dann auch die erste Voraussetzung der Kritik.
Cremer-Schäfer und Resch betonen als weitere nicht hintergehbare Notwendigkeit die Anforderung, die eigene gesellschaftliche Position in die Analyse mit einzubeziehen. So mache es durchaus einen Unterschied, innerhalb welcher Produktionsbedingungen Kritik betrieben, und welcher Anspruch davon abgeleitet werde. Wichtig sei in diesem Zusam-menhang, wie für Kritik allgemein hilfreich, eine „negative Bestimmung“ der Prozesse die zur Verwaltung, Anwendung, Etablierung und Veränderung bestimmter Kategorisierungen führen, sowie die Analyse der eigenen Beteiligung bspw. von Wissenschaft6. Wissenschaft müsse somit, kritisch-reflexiv, als „gesellschaftliches Verhältnis“ begriffen werden. Hierfür schlagen sie vor „Ideologiekritik als Kulturtechnik des Interpretierens“ (Cremer-Schäfer und Resch 2012, S. 98) zu verstehen, durch welche Herrschaftsverhältnisse „verflüssigt“ (Cremer-Schäfer und Resch 2012) werden könnten. Für eine kritische Wissenschaft bedeute das eine Arbeit an den Begriffen, im Sinne einer Suche nach angemesseneren Begriffen, in denen sich das fände, was unterdrückt oder systematisch verkannt werde.
6 In ihrem Beitrag zur „Reflexiven Kritik“ beziehen sie sich in erster Linie auf eine kritische Wis-senschaft, welche nicht Legitimationswissenschaft für Praxis sein könne, da sie genau dadurch die Reflexionsgewinne ihrer Praxisferne verspiele (vgl. Cremer-Schäfer und Resch 2012, S. 98).

280 M. Hartmann und K. Herzog
Die Autorinnen benennen als vierte Notwendigkeit einer kritischen Wissenschaft die Orientierung an Befreiungstheorien7. Als Perspektive für eine kritische, reflexive Soziale Arbeit empfehlen sie eine Orientierung an einer „Wohlfahrtspolitik von unten“ (Cre-mer-Schäfer und Resch 2012, S. 103). Soziale Arbeit wird in diesem Sinn als soziale Ressource innerhalb einer „sozialen Infrastruktur“ (Cremer-Schäfer und Resch 2012) verstanden, die von AkteurInnen für die Arbeit am eigenen Leben genutzt werden kann. Aus dieser alltagsorientierten Perspektive gelangen die Blockierungen und Verhinderun-gen der Nutzung in den Blick. Kritische Soziale Arbeit zeichne sich dann dadurch aus, dass sie „zuerst alles (…) unterlassen [soll], was ihrer [der Sozialen Arbeit, Anm. MH & KH] Nutzung als eine Ressource für die Bewerkstelligung eines ’eigenen Lebens’ ent-gegensteht“ (Cremer-Schäfer und Resch 2012, H.i.O.), um dann in einem zweiten Schritt zu überlegen, was gebraucht werde.
Auch von diesen Überlegungen ausgehend lässt sich an Hollstein anschließen: In Übereinstimmung mit Plößer wird betont, dass es durchaus einen Möglichkeitsraum der Kritik gibt. Bedingungen für den Umgang mit der gesellschaftlichen Verwobenheit wur-den genannt, insbesondere die Reflexion der eigenen gesellschaftlichen Position erscheint hierfür unabdingbar. Eine reflexive kritische Soziale Arbeit könnte institutionellen und ordnungstheoretischen Logiken eine Orientierung am Alltag gegenüberstellen. Alltags-praktiken als Bearbeitung von Blockierungen des Zugangs zu gesellschaftlich erzeugten Ressourcen zu verstehen und zum Ausgangspunkt von Überlegungen zu Hilfe zu machen, gerade auch aus herrschaftskritischer Perspektive, könnte hier eine Lücke schließen.
4.3 Susanne Maurer: Soziale Arbeit als Gedächtnis sozialer Konflikte
Ähnlich wie Cremer-Schäfer und Resch differenziert Susanne Maurer (2012) Orte und Bedingungen der Kritik, die sie in der Figur der Doppelspur zusammenfasst: Auf der einen Seite müsse es Orte der Kritik geben, an denen es möglich sei, eine „Distanz zu all-täglichen Handlungsanforderungen und -herausforderungen“ (Maurer 2012, S. 299) ein-zunehmen. Diese Bedingungen könnten bspw. Orte in der Wissenschaft aufgrund ihrer grundsätzlichen Möglichkeit der Entlastung vom Handlungsdruck erfüllen. Davon zu unterscheiden sei eine „gute Praxis“ (vgl. Maurer 2012, H.i.O.) Sozialer Arbeit, die bei ihren Versuchen, eine kritische Perspektive einzunehmen, an den Grenzen der täglichen Handlungsnotwendigkeiten agiere.
Gleichzeitig ist Maurer eine Bescheidenheit in der Reichweite des kritischen Potenzi-als von Sozialer Arbeit wichtig:
„Kritische Soziale Arbeit verbindet sich für mich daher mit einer nicht- privilegierten Erkenntnis-Position, die sich ein Stück weit auch zurück nimmt gegenüber dem Wis-sen, den Erfahrungen und Sichtweisen der Adressaten und Adressatinnen“ (Maurer 2012, S. 320).
Kritik bedeute so stets auch Selbstkritik, die gerade auch dafür sensibel zu sein habe, welche Position sie innerhalb des kritisierten Zusammenhangs einnehme. Kritik habe elastisch zu bleiben, sich „auf die Suche nach dem Widerspenstigen im Leben der Men-schen“ (Maurer 2012, S. 300) zu machen. Hieraus ergibt sich folgende These Maurers:
7 Eine Unterscheidung von Befreiungs- und Ordnungsdenken findet sich bei Cremer-Schäfer (2005).

Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit ... 281
„[W]enn Soziale Arbeit als Disziplin wie Profession ihre (selbst-)kritische Reflexivität wahren, kultivieren und angesichts der jeweiligen aktuell anstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen zum Einsatz bringen will“ (Maurer 2012, S. 308), müsse sie sich vergewissern, „dass der ‚Komplex Soziale Arbeit‘ auf spezifischen gesellschaftlichen Erfahrungen beruht, die es immer wieder zu rekonstruieren und freizulegen gilt“ (Maurer 2012, H.i.O.).
Dieses Erinnern an gesellschaftliche Erfahrungen nennt Maurer „Gedächtnisarbeit“. Die Geschichte Sozialer Arbeit zeichne sich dadurch aus, dass sie historisch trotz ihrer Normalisierungs- und Kontrollfunktion soziale Konflikte thematisierte und auf Ungleich-heitsverhältnisse als strukturierende gesellschaftliches Prinzip hinweisen konnte (vgl. Maurer 2012, S. 305). In der Rekonstruktion der „vielen kleinen Prozesse“ der „Gesamt-entwicklung Sozialer Arbeit“ (Maurer 2012, S. 310) könne (wieder) entdeckt werden, wo Handlungsalternativen im Sinne einer kritischen Sozialen Arbeit eingehakt werden könnten. Maurer betont als unhintergehbare Grundlage für die „Re-Konstruktion und Belebung der kritischen Dimension Sozialer Arbeit“ die Notwendigkeit von „Räumen und Praxen des Kollektiven“ (Maurer 2012): Kritik und kritische Soziale Arbeit benötige die Auseinandersetzung mit anderen. In diesem Sinn der „Gedächtnisarbeit“ möchten wir die Analyse von Hollstein wiederentdecken und einen Raum für die historischen Poten-ziale der Kritik schaffen.
Vor dem Hintergrund der Anforderungen, die Plößer, Maurer, Cremer-Schäfer und Resch für das Projekt der Kritik in der Sozialen Arbeit nennen, möchten wir deshalb fragen, welche Hinweise uns die (Re-)Lektüre Walter Hollsteins Funktionsbestimmung in Bezug auf die aktuelle Situation der Sozialen Arbeit geben kann.
5 Ein „Stachel im Fleisch“ der Sozialen Arbeit
Die aktuelle Konjunktur von Kritik lesen wir als einen Hinweis auf die Notwendigkeit einer Verständigung, oder – um mit Maurer zu sprechen – als einen Ort für das „Unbeha-gen in der Gesellschaft“ (Maurer 2012, S. 320).
In diesem Zuge wird einerseits auf gesellschaftliche Verhältnisse und deren Veränderun-gen verwiesen, die als kritisierungswürdig erachtet werden. Zugleich steht zentral die Frage im Raum, wie Soziale Arbeit hiervon einerseits betroffen ist, sich andererseits auch posi-tioniert und wie sie agiert. Es geht wieder und weiter um die Funktion, die Soziale Arbeit in Gesellschaft einnimmt oder einnehmen will. Die von uns vorgestellten Denkfiguren ver-weisen darauf, dass Kritik, ebenso wie k/Kritische Soziale Arbeit, weniger als erreichtes Ziel denn vielmehr als permanent zu betreibender Prozess vorstellbar ist. Auch wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse sowie Problemdefinitionen und Normen ändern, und Soziale Arbeit so mit, kann einiges von den bisher betriebenen Reflexionen gelernt werden.
Aus diesem Grund möchten wir Walter Hollsteins Analyse als einen „Stachel im Fleisch“ der Sozialen Arbeit verstehen, der uns an folgende Punkte erinnern sollte:
1. Die Position Sozialer Arbeit zu reflektieren und zu hinterfragen bleibt ein aktuelles Projekt. Soziale Arbeit als Teil der Sozialpolitik wird immer auch herrschaftsstabili-sierende Anteile haben. Dies gilt es bewusst in den Blick zu nehmen.

282 M. Hartmann und K. Herzog
2. Vorgängige Normen sind zu hinterfragen, auch und gerade in der Position der (relativ) handlungsentlasteten Wissenschaftler_innen. Statt innerhalb der Normen zu arbeiten, kann eine Arbeit an und über die Normen den Blick auf Alternativen und alltäglichen Widerstand lenken.
3. Differenzierungen, Kategorisierungen, Markierungen von Adressat_innen sind auf ihre Herrschaftsmomente und Ausschließungseffekte zu reflektieren. Auch die Suche nach „angemesseneren“ Begriffen bleibt Thema für eine k/Kritische Soziale Arbeit.
4. Kritik benötigt eine Transparenz über die Sprecher_innenposition auch und gerade in Hinblick auf die eigene Verwobenheit in Herrschaftsstrukturen.
5. Ein zentraler Maßstab für die Bestimmung von Hilfe ist die Position der Adressat_innen die mit ihren Problemdefinitionen und Bedürfnissen ernst zu nehmen sind. Dies er-fordert einen Ort und Raum, in dem die Situation der Adressat_innen überhaupt ver-stehbar werden kann. Dazu bedarf es, wie es Maurer formuliert, des Wissens um die nicht-privilegierte Erkenntnisposition des_der Professionellen. Was wiederum auf die bereits genannte Notwendigkeit verweist, die eigene (Macht-)Position sowie Voran-nahmen und Normen der Reflexion zu unterziehen.
Literatur
Ahlheim et al. (1971). Gefesselte Jugend: Fürsorgeerziehung im Kapitalismus. Frankfurt: Suhrkamp.
Bitzan, M., & Bolay, E. (2013). Konturen eines kritischen Adressatenbegriffs. In G. Grasshoff (Hrsg.), Adressaten, Nutzer, Agency: Akteursbezogene Forschungsperspektiven in der Sozialen Arbeit (S. 35–52). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Brumlik, M. (1984). Was heißt Helferkompetenz?. In S. Müller et al. (Hrsg.), Handlungskompetenz in Sozialarbeit und Sozialpädagogik (S. 115–125). Bielefeld: Kleine.
Brumlik, M., & Keckeisen, W. (1976). Etwas fehlt: Zur Kritik und Bestimmung von Hilfebedürf-tigkeit für die Sozialpädagogik. Kriminologisches Journal, 4, 241–262.
Cremer-Schäfer, H. (2005). Soziologische Modelle von Kritik in Zeiten sozialer Ausschließung. In W. Braun & M. Nauerth (Hrsg.), Lust an der Erkenntnis: Zum Gebrauchswert soziologischen Denkens für die Praxis Sozialer Arbeit (S. 151–177). Bielefeld: Kleine.
Cremer-Schäfer, H., & Resch, Ch. (2012). „Reflexive Kritik“: Zur Aktualität einer (fast) verges-senen Denkweise. In R. Anhorn et al. (Hrsg.), Kritik der Sozialen Arbeit – kritische Soziale Arbeit: Perspektiven kritischer Sozialer Arbeit (S. 81–105). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Galuske, M. (2007). Nach dem Ende des sozialpädagogischen Jahrhunderts: Soziale Arbeit zwi-schen Aktivierung und Ökonomisierung. In R. Knopp & Th. Münch (Hrsg.), Zurück zur Armutspolizey?: Soziale Arbeit zwischen Hilfe und Kontrolle (S. 9–32). Berlin: Frank & Timme.
Gängler, H. (2005). Hilfe. In H.-U. Otto & H. Thiersch (Hrsg.), Handbuch Sozialarbeit Sozialpäd-agogik. München: Ernst Reinhardt.
Hollstein, W., & Meinhold, M. (Hrsg.). (1973/1980). Sozialarbeit unter kapitalistischen Produkti-onsbedingungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Hollstein, W. (1973/1980). Hilfe und Kapital: Zur Funktionsbestimmung der Sozialarbeit. In W. Hollstein & M. Meinhold (Hrsg.), Sozialarbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingun-gen. (S. 167–207). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit ... 283
Hornstein, W. (1970). Kindheit und Jugend in der Gesellschaft: Dokumentation des 4. Deutschen Jugendhilfetags. München: Juventa.
Kessl, F. (2006). Aktivierungspolitik statt wohlfahrtsstaatlicher Dienstleistung?: Das aktivierungs-politische Re-Arrangement der bundesrepublikanischen Kinder- und Jugendhilfe. Zeitschrift für Sozialreform, 52(2), 217–233.
Kessl, F. (2013). Soziale Arbeit in der Transformation des Sozialen: Eine Ortsbestimmung. Wiesba-den: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Kessl, F., & Wagner, T. (2010). „Was vom Tisch der Reichen fällt…“: Zur neuen politischen Öko-nomie des Mitleids. Widersprüche, 31(119/120), 55–76.
Kessl, F., & Otto, H.-U. (2012). Soziale Arbeit. In G. Albrecht & A. Groenemeyer (Hrsg.), Hand-buch soziale Probleme (S. 1306–1331). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Kolbe, Ch. (2011). Geforderte Aktivierer: Fachkräfte im SGB II zwischen Ansprüchen und Bewäl-tigungen. Frankfurt a. M.: Fachhochschulverlag.
Kunstreich, T. (1975). Der institutionalisierte Konflikt. Offenbach: Verlag 2000.Kunstreich, T. (2001). Grundkurs Soziale Arbeit: Sieben Blicke auf Geschichte und Gegenwart
Sozialer Arbeit (Bd. 2: Blicke auf die Jahre 1955, 1970 und 1995 sowie ein Rückblick auf die Soziale Arbeit in der DDR, 2. korr. Aufl.). Bielefeld: Kleine.
Lau, Th., & Wolff, St. (1981). Bündnis wider Willen: Sozialarbeiter und ihre Akten. Neue Praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik, 11(3), 199–214.
Lessenich, S. (2009). Mobilität und Kontrolle: Zur Dialektik der Aktivgesellschaft. In K. Dörre et al. (Hrgs.), Soziologie – Kapitalismus – Kritik: Eine Debatte (S. 126–177). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Maurer, S.(2012). ,Doppelspur der Kritik‘: Feministisch inspirierte Perspektiven und Reflexionen zum Projekt einer ,Kritischen Sozialen Arbeit‘. In R. Anhorn et al. (Hrsg.), Kritik der Sozialen Arbeit – kritische Soziale Arbeit: Perspektiven kritischer Sozialer Arbeit (S. 299–323). Wies-baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Mollenhauer, K. (1964/1993). Einführung in die Sozialpädagogik: Probleme und Begriffe der Jugendhilfe (10., unveränd. Aufl.). Weinheim: Beltz (Edition sozial).
Mollenhauer, K. (1959). Die Ursprünge der Sozialpädagogik in der industriellen Gesellschaft: eine Untersuchung zur Struktur sozialpädagogischen Denkens und Handelns. Weinheim: Beltz.
Müller, S. (2001). Sozialarbeiterisches Alltagshandeln zwischen Hilfe und Kontrolle: Aspekte einer gesellschaftlichen Funktionsbestimmung der Sozialarbeit/ Sozialpädagogik. In S. Müller (Hrsg.), Erziehen – Helfen – Strafen: Das Spannungsverhältnis von Hilfe und Kontrolle in der Sozialen Arbeit (S. 33–43). Weinheim: Beltz Juventa.
Müller, S. (1978). Sozialarbeiterisches Alltagshandeln zwischen Hilfe und Kontrolle. Neue Praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik, 8(4), 342–348.
Ott, M. (2011). Aktivierung von (In-)Kompetenz: Praktiken im Profiling – eine machtanalytische Ethnografie. Konstanz: UVK-Verlags-Gesellschaft.
Peters, H. (2002). Soziale Probleme und soziale Kontrolle. Wiesbaden: Westdeutscher.Peters, H., & Cremer-Schäfer, H. (1975). Die sanften Kontrolleure: Wie Sozialarbeiter mit Devian-
ten umgehen. Stuttgart: Enke.Plößer, M. (2010). Differenz performativ gedacht: Dekonstruktive Perspektiven auf und für den
Umgang mit Differenz. In F. Kessl & M. Plößer (Hrsg.), Differenzierung, Normalisierung, Andersheit: Soziale Arbeit als Arbeit mit den Anderen (218–232). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Schefold, W. (2011). Hilfe als Grundkategorie Sozialer Arbeit. Soziale Passagen, 3(1), 11–27.Steinacker, S. (2011). Hilfe und Politik: Auf der Suche nach einer neuen Sozialen Arbeit im Gefolge
von „1968“. Soziale Passagen, 3(1), 29–47.Scherpner, H. (1962). Theorie der Fürsorge. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.