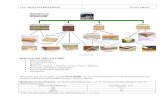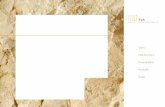HCI-12 -Gesetze und Normen - schmiedecke und Normen.pdf · TFH Berlin Normen § Norm DIN EN ISO...
Transcript of HCI-12 -Gesetze und Normen - schmiedecke und Normen.pdf · TFH Berlin Normen § Norm DIN EN ISO...
TFH Berlin
HCI-12 - Gesetze und NormenØÜberblickØBildschArbV und BITVØDIN EN ISO 6385, 9241, 14915ØShneidermans "Goldene Regeln"
© Ilse Schmiedecke 2013BHT Berlin
TFH Berlin
Ergonomie per Gesetz?
§ Schlecht gestaltete Arbeit macht krank!– körperliche Beschwerden– psychische Beschwerden– Leistungseinbrüche– soziale Einbrüche– plötzliche Erkrankungen
§ Menschengerechte Arbeitsgestaltung ist gültiges Arbeitsrecht!– DIN EN ISO 9241, Teil 2– Betriebsverfassungsgesetz § 75,2– DIN EN ISO 10075– Bildschirmarbeitsverordnung §§ 3 u. 5– Arbeitsschutzgesetz §§ 3 u. 4
© schmiedecke 08 HCI 2
TFH BerlinMenschengerechte Arbeitsgestaltung!
§ Gut gestaltete Arbeit baut auf!
© schmiedecke 08 HCI 3
Arbeit formt die Persönlichkeit
Ob negativ oder positiv - jede Arbeit beeinflusst die Persönlichkeit. Deshalb ist es wichtig, die Arbeit so zu gestalten, dass der Arbeitende dazulernen kann. Eine persönlichkeitsfördernde Arbeit muss stets neueHerausforderungen bieten. Dabei sollten die Beschäftigten ihre vorhandenen Qualifikationen umfassend nutzen und weiterentwickeln, aber auch neue Kenntnisse aneignen können: beispielsweise beim Einsatz neuer Technik und neuer Arbeitsverfahren, bei neuen Kundenkontakten usw.
Quelle: www.ergo-online.de
TFH BerlinGesetze
§ Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)– Grundlage für den gesetzlichen Arbeitsschutz.
§ Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)– seit 1996– Konkretisierung des Arbeitsschutzgesetzes im Bereich der
Bildschirmarbeit
§ Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV)– seit 2002– Vorschrift für öffentliche Internetauftritte der Bundesbehörden – barrierefreie Technik, v.a. für Sehbehinderte und Blinde
Hinweis: Verordnung = Konkretisierung eines Gesetzes, bindend© schmiedecke15 HCI 4
TFH BerlinNormen
§ Norm DIN EN ISO 6385– ergonomische Grundnorm für die Gestaltung von Arbeitssystemen
§ Normenreihe DIN EN ISO 9241– seit 1996, Überarbeitung seit 2000, teilw. noch in Planung – früher „Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmen“– heute „Ergonomie der Mensch-Computer-Interaktion“– für uns am wichtigsten Teil 110 und Teil 12–
§ Normenreihe DIN EN ISO 14915– seit 2003, wird weiter entwickelt, bisher 3 Teile– Software-Ergonomie für Multimedia-Benutzungsschnittstellen
§ Norm DIN EN ISO 9241-210– seit 2011, vorher DIN EN ISO 13407 – Benutzer-orientierte Gestaltung interaktiver Systeme. 5
TFH Berlin
BildschArbV
§ Weit gefasst– Bildschirmgeräte– Arbeitsplatz– Arbeitsumgebung– Softwaregestaltung– Arbeitsorganisation
§ Wenig konkret à Näheres regeln die Normen– Anh. 21.1 Die Software muss an die auszuführende Aufgabe
angepasst sein.– Anh. 9. Form und Anschlag der Tasten müssen eine ergonomische
Bedienung der Tastatur ermöglichen. …
© schmiedecke15 HCI 6
TFH Berlin
BITV
§ Grundlage Web Content Accessibility Guidelines 1.0) des World Wide Web Consortiums vom 5. Mai 1999
§ Zwei Anpassungsstufen§ Technisch genau beschrieben, daher auch als Handbuch für
Barrierefreiheit geeignet.
© schmiedecke15 HCI 7
Aus dem Anhang 1 (1. Kompatibilitätsstufe)1. Für jedes Nicht-Text-Element ist ein äquivalenter Text bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für: Bilder, graphisch dargestellten Text einschließlich Symbolen, Regionen von Imagemaps, Animationen (z. B. animierte GIFs), Applets [….]
2. Für jede aktive Region einer serverseitigen Imagemap sind redundante Texthyperlinks bereitzustellen.
3. Für Multimedia-Präsentationen ist eine Audio-Beschreibung der wichtigen Informationen der Videospur bereitzustellen.
4. Für jede zeitgesteuerte Multimedia-Präsentation (insbesondere Film oder Animation) sind äquivalente Alternativen (z. B. Untertitel oder Audiobeschreibungen der Videospur) mit der Präsentation zu synchronisieren.
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 8
Normen im Interaktionsentwurf
§ Produktionsnormen sind Industriestandards mit den Hauptzielen– effektive Produktion durch Standardmaße
gesicherte Verfügbarkeit von Teilen und Werkzeugen,Passgenauigkeit von Halbzeugen
– Sicherheit und Qualität der Produkte durch GüteklassenWärmefestigkeit von Werkstoffen, Festigkeit von Schrauben, Belastbarkeit von Schaltkreisen, ...
– Gesichertes Wissen über Stoffe und Gegenständeabrufbare Fakten
§ Ergonomienormen sollen den arbeitenden Menschen schützen– vor Gesundheitsschäden– aufgrund von Fehlhaltung, einseitige Belastung,
Überlastung– aufgrund von Lärm, Hitze, Kälte und Strahlung
TFH Berlin
© schmiedecke 08 HCI 9
DIN-EN-ISO 6385 (2004)Gestaltung von Arbeitssystemen
Die "Ergonomische Grundnorm" umfasst:§ Arbeitsumgebung
– physikalische, chemische, biologische, organisatorische, soziale und kulturelle Faktoren, die einen Arbeitenden / Benutzer umgeben.
§ Arbeitsmittel– Werkzeuge, einschließlich Hard- und Software, Maschinen, Fahrzeuge,
Geräte, Möbel, Einrichtungen und andere im Arbeitssystem benutzte (System-)Komponenten.
§ Arbeitsplatz– Kombination und räumliche Anordnung der Arbeitsmittel innerhalb des
Arbeitsplatzes unter den durch die Arbeitsaufgabe erforderlichen Bedingungen.
TFH Berlin
© schmiedecke 08 HCI 10
Belastung und Beanspruchungnach DIN-ISO-EN 6385§ Belastung
– Gesamtheit der Bedingungen und Anforderungen der Arbeit
– „Unter Belastung ist jede Einflussgröße zu verstehen, die am menschlichen Organismus eine Wirkung hervorrufen kann."
§ Beanspruchung– innere Reaktion auf die Arbeitsbelastung– „Als Beanspruchung bezeichnet man
Veränderungen des Organismus, die durch Belastung hervorgerufen werden."
§ Über- und Unterforderung– Fehlbelastung, die zur Fehlbeanspruchung führt. – Körperliche und physische Beschwerden können resultieren.
TFH Berlin
Beanspruchung reduzieren!
Unmittelbar gestaltungsabhängig:§ Beanspruchung der Augen§ Beanspruchung der Konzentration
§ à Diese haben wir in den entsprechenden Kapiteln bereits diskutiert.
Umfeldabhängig:§ Beanspruchung des Bewegungsapparats§ neues Krankheitsbild: "Maushand"
© schmiedecke 08 HCI 11
TFH Berlin
© schmiedecke 08 HCI 12
Grundmodell der ergonomischen Arbeitsgestaltung
"Menschengerecht gestaltete Arbeit ist ausführbar, schädigt nicht, ist erträglich, zumutbar und persönlichkeitsfördernd."(nach W. Hacker)
Ergänzungen?
Kompetenzen werden eingebracht und erweitert
psychisches Wohlbefinden bleibt erhalten, berücksichtigt soziale Werte und Normen
körperliche Gesundheit bleibt erhalten, langfristig durchführbar
den physischen und psychischen Voraussetzungen angepasst,nicht unmittelbar gesundheitsschädigend
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 13
Normenreihe DIN-EN-ISO 9241:Ergonomie der Mensch-System-Interaktion
§ Titel bis 2006:Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten
(kurz: Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung, BSchAVo)
§ heute 28 Teile, Interaktionsergonomie für Hard- und Software
• Teil 1: Allgemeine Einführung• Teil 2: Anforderungen an die Arbeitsaufgaben - Leitsätze• Teil 3: Anforderungen an visuelle Anzeigen• Teil 4: Anforderungen an Tastaturen• Teil 5: Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung und Körperhaltung• Teil 6: Anforderungen an die Arbeitsumgebung• Teil 7: Anforderungen an visuelle Anzeigen bezüglich Reflexionen• Teil 8: Anforderungen an Farbdarstellungen• Teil 9: Anforderungen an Eingabegeräte - außer Tastaturen
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 14
DIN-EN-ISO 9241:Ergonomie der Mensch-System-Interaktion
• Teil 110: Grundsätze der Dialoggestaltung • Teil 11: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit - Leitsätze• Teil 12: Informationsdarstellung• Teil 13: Benutzerführung• Teil 14: Dialogführung mittels Menüs• Teil 15: Dialogführung mittels Kommandosprachen• Teil 16: Dialogführung mittels direkter Manipulation• Teil 17: Dialogführung mittels Bildschirmformularen• Teil 151: Leitlinien zur Gestaltung von Benutzungsschnittstellen für das
World Wide Web (zurzeit im Entwurfsstadium)• Teil 171: Leitlinien für die Zugänglichkeit von Software• Teil 210: Benutzerorientierte Gestaltung interaktiver Systeme
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 15
DIN-EN-ISO 9241:Ergonomie der Mensch-System-Interaktion
• Teil 300: Einführung in Anforderungen und Messtechniken für elektronische optische Anzeigen
• Teil 302: Terminologie für elektronische optische Anzeigen (zurzeit im Entwurfsstadium)
• Teil 303: Anforderungen an elektronische optische Anzeigen (zurzeit im Entwurfsstadium)
• Teil 304: Prüfverfahren zur Benutzerleistung• Teil 305: Optische Laborprüfverfahren für elektronische optische Anzeigen
(zurzeit im Entwurfsstadium)• Teil 306: Vor-Ort-Bewertungsverfahren für elektronische optische Anzeigen
(zurzeit im Entwurfsstadium)• Teil 307: Analyse und Konformitätsverfahren für elektronische optische
Anzeigen (zurzeit im Entwurfsstadium)• Teil 400: Grundsätze und Anforderungen für physikalische Eingabegeräte• Teil 410: Gestaltungskriterien für physikalische Eingabegeräte (zurzeit im
Entwurfsstadium)
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 16
Die normative Kraft der Norm
§ Ist das eine Norm?– Normwerte vor allem im Dialogbereich (110-17)
nicht präzise messbar– damit nicht erzwingbar und garantierbar
§ Der Softwareteil nennt sich Gestaltungsempfehlung– Kompetenzsammlung– internationaler Konsens– didaktischer Aufbau– enthält ein durchgehendes Beispiel!– normierendes Lehrwerk– (muss leider käuflich erworben werden!)
§ Framework– setzt die Teile in Beziehung zueinander – strukturiert die Fortentwicklung
TFH Berlin
© schmiedecke 08 HCI 17
DIN-EN-ISO 9241-Teil2Leitsätze zur Arbeitsgestaltung
§ "Das allgemeine Ziel, ergonomische Grundsätze in der Arbeitsgestaltung zu berücksichtigen, ist es, optimale Arbeitsbedingungen in Bezug auf das Wohlbefinden, die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen zu schaffen."
§ Humankriterien aus ISO-EN 9241-Teil 2:– Benutzerorientierung– Anforderungsvielfalt– Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit– Handlungsspielräume– Rückmeldungen– Entwicklungsmöglichkeiten
TFH Berlin
1. Benutzerorientierung
§ Anpassung an Benutzerklassen§ Vermeidung von psychischer Belastung
durch unter- oder Überforderung§ Individualisierungskonzepte§ Qualifizierung
© schmiedecke 08 HCI 18
TFH Berlin
2. Anforderungsvielfalt, Vielseitigkeit
§ Anwendung einer angemessenen Vielfalt von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten (DIN)
§ Abwechslung von Konzentration und Routine, Bildschirm- und Papierarbeit, Bewegung
§ Erhält die geistige Beweglichkeit(vermeidet Monotonieeffekte)
© schmiedecke 08 HCI 19
TFH Berlin
3. Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit
§ Eigenständige Arbeit von der Planung bis zur Überprüfung
§ Sinn und Zweck der Arbeit im Gesamtkontext erkennbar
§ Umsetzung von allgemeinden Vorgaben in Arbeitsschritte
§ erhält psychisches Wohlbefinden und Motivation
© schmiedecke 08 HCI 20
TFH Berlin
4. Handlungsspielräume
§ Freiheiten in Reihenfolge, Vorgehensweise und Tempo
§ Selbstorganisation und -regulation
§ allein die Möglichkeit reduziert Stress
§ nachweisbar gesünder§ Fehlen macht passiv!
© schmiedecke 08 HCI 21
TFH Berlin
5. Rückmeldungen
§ Durch Software und Kollegen§ Sollen als Frustpuffer wirken!!!
§ Gestaltung von Software-Rückmeldungen unterstützend!
© schmiedecke 08 HCI 22
TFH Berlin
6. Entwicklungsmöglichkeiten
§ Erweiterung der Qualifikation§ Möglichkeiten zum Weiterlernen
§ Qualifikation anstelle von Unter- oder Überforderung.
© schmiedecke 08 HCI 23
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 24
EN 9241 – 110Grundsätze der Dialoggestaltung
§ Neuer Anwendungsbereich "Interaktive Systeme"§ Neue Definition Benutzungsschnittstelle:
"Alle Bestandteile eines interaktiven Systems (Software oder Hardware), die Informationen und Steuerelemente zur Verfügung stellen, die für den Benutzer notwendig sind, um eine bestimmte Arbeitsaufgabe mit dem interaktiven System zu erledigen."
§ Gestaltungskriterien ISO 9241-110
1. Aufgabenangemessenheit2. Selbstbeschreibungsfähigkeit3. Steuerbarkeit4. Erwartungskonformität5. Fehlertoleranz6. Individualisierbarkeit7. Lernförderlichkeit
TFH Berlin
ASSEFIL-Fragebogender Firma C2web
§ http://c2web.de/quest/fragen.pdf
© schmiedecke15 HCI 25vormals: www.c2web.de/quest/fragen.html
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 26
9241-110 Aufgabenangemessenheit
"Ein Dialog ist aufgabenangemessen, wenn er den Benutzer darin unterstützt, seine Arbeitsaufgbe effektiv und effizient zu erledigen."
– keine unnötigen Pflichtangaben im Formular– geeignet vorausgewählte Knöpfe und Auswahlen– Auto-Vervollständigen– Minimale Ladezeit für Grafiken– Bei Eingabefehlern Cursor an der zu korrigierenden Stelle– Erhalt der Einträge bei Such- oder Auswahldialogen– Erhalt der Zwischenergebnisse während Online-Transaktion– Shortcuts zu den wichtigsten Aktionen– Fachgerechte Eingabeformate und Feedbacks– keine nicht fachlich begründeten Aktionen (interne Aufgaben,
Bedienungsaufgaben)
TFH Berlin
Aufgabenangemessenheit
Beispiel Druckdialog: Häufige Funktionen oben anzeigen, seltene unten
© schmiedecke15 HCI 27
Quelle: www.ergo-online.de
TFH Berlin
Aufgabenangemessenheit
Vorauswahl aufgrund der IP-Adresse wäre möglich
© schmiedecke15 HCI 28
Vorauswahl von Datum wäre möglich
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 29
9241-110Selbstbeschreibungsfähigkeit
§ "Ein Dialog ist selbstbeschreibungsfähig, wenn jeder einzelne Dialogschritt durch Rückmeldung des Dialogsystems unmittelbar verständlich ist oder dem Benutzer auf Anfrage erklärt wird."
– Hilfesystem mit Suchfunktion– Einführungen / Tutorials– Icons, Menüpunkte und Kommandos im Fachkontext unmittelbar
(intuitiv) verstehbar, oder Hilfe direkt angeboten (Tool-Tip-Text. kontextsensitive Hilfe)
– Ziele von Links vorhersagbar formuliert– Erläuternde Links zu komplizierten Fehlermeldungen – Feedback bei länger dauernden Operationen– Status verborgener Information erkennbar oder abrufbar
(z.B.Umfang einer Treffer-Liste am Tabellenanfang ablesbar)
TFH Berlin
SelbstbeschreibungsfähigkeitBeispiele
§ Prozessvorschau zur Orientierung des Benutzers
© schmiedecke15 HCI 30
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 31
SelbstbeschreibungsfähigkeitBeispiele
§ Meldung statt Sanduhr
§ Direkthilfe
§ Tooltip-Text(Kurzhilfe)
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 32
SelbstbeschreibungsfähigkeitNegativbeispiele
§ Formular:– Angabe zum
Datumsformat fehlt
§ DHL-Website:- Links nicht erkennbar
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 33
9241-110Steuerbarkeit
§ "Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist."
– Dialogteile in unabhägigen, frei ansteuerbaren Fenstern– Freie Wahl zwischen verschiedenen Ein- und Ausgabegeräten – Konfigurierung der Anzeige von Ein- und Ausgabedaten – Tastensteuerung als Alternative zur Maus– Unterbrechen und Wiederaufnehmen des Dialogs– Freie Wahl zwischen alternativen Arbeitswegen– Beliebig lange Reaktionszeit auf modale Dialoge– Rücksetzmöglichkeit für alle Interaktionen
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 35
Steuerbarkeit Beispiele
§ unabhängige Fenster (MDI)
§ Steuerbare Such§ Steuerbare Navigation
Quelle: www.ergo-online.de
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 36
9241-110Erwartungskonformität
§ "Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er konsistent ist und den Merkmalen des Benutzers entspricht, z.B. seinen Kenntnissen aus dem Arbeitsgebiet, seiner Ausbildung und seiner Erfahrung sowie den allgemein anerkannten Konventionen."
– Der Link zur Startseite ist unter dem Firmenlogo oben links platziert.– Unterstrichene Wörter sind immer Hypertext-Links.– Beim Drücken der Tabulator-Taste springt der Cursor auf das nächste
Eingabefeld– F1 ruft die Hilfefunktion auf– Der Tabulator in einem Textprogramm ist am Linealsymbol
verschiebbar– Beim Speichern ohne Zielangabe entsteht eine Datei am als Standard
voreingestellten Ort– Ctrl-S bedeutet speichern
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 37
ErwartungskonformitätÄußere und innere Konsistenz
§ bekannte Symbole in üblicher Weise einsetzen
§ eigene Symbole mit gleichbleibender Bedeutung einsetzen
TFH Berlin
Negativbeispiele äußere und innere Konsistenz
© schmiedecke15 HCI 38
Mangelnde äußere Konsisitenz:
Adobe Reader: Öffnet Druckdialog
WordPad: Druckt sofort
Mangelnde innere Konsistenz:
Adobe Reader: Suche-Tool erscheint nicht im Menü
Quelle: www.ergo-online.de
TFH Berlin
Erwartungskonformität:Metaphorische Konsistenz
§ Bei Verwendung von Metaphern im konzeptuellen Modell:– Aktionsmöglichkeiten auf Methaphern-Ebene sollen mit der
Realwelt konsistent sein.
§ Beispiele:– Papierkorb - ausleeren– Mail (Briefsymbol) - versenden, öffnen, Anhang hinzufügen– archivieren , in Archiv suchen - Datei liegt nicht mehr im
aktuellen Verzeichnis.
§ Bewusste Inkonsistenz– Undo-Funktion ist oft in der Realwelt nicht möglich.
© schmiedecke15 HCI 39
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 40
9241-110Fehlertoleranz
§ "Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem Korrekturaufwand seitens des Benutzers erreicht werden kann."
– Bei Fehlerhaften Eingaben erscheint eine verstehbare Fehlermeldung, ggf. mit Reparaturhinweis oder -angebot
– Beim Rückwärtsbrowsen in einer Web-Applikation mit der Back-Taste wird die Information immer aktualisiert
– Fehlermeldungen werden nicht technisch verklausuliert oder als Nummer angezeigt, sondern in der Sprache der Benutzer formuliert.
– Warnhinweise werden deutlich von Fehlermeldungen unterschieden– Es wird klar kommuniziert, ob und welche Systemänderung die
fehlerhafte Eingabe bewirkt hat.
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 41
FehlertoleranzBeispiele
Fehlermeldung• mit Hilfehinweis• mit Hilfeangebot
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 43
9241-110Individualisierbarkeit
§ "Ein Dialog ist individualisierbar, wenn das Dialogsystem Anpassungen an die Erfordernisse der Arbeitsaufgabe sowie an die individuellen Fähigkeiten und Vorlieben des Benutzers zuläßt."
– Die Sprache der Benutzeroberfläche ist wählbar– Auswahl zwischen Assistenten- und Expertenmodus– Vorausgefüllte Webformulare aufgrund des Benutzerprofils– Auf der Startseite einer Website besteht die Möglichkeit, eine HTML-
oder Flash-Version anzuwählen und zu bookmarken.– Erstellung von Makros, ggf. per Aufzeichnung– Freie Umgruppierung der Menüs und Werkzeugleisten
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 45
9241-110Lernförderlichkeit
§ "Ein Dialog ist lernförderlich, wenn er den Benutzer beim Erlernen des Dialogsystems unterstützt und anleitet."
– Es gibt eine Anleitung für die ersten Schritte und eine Beispielanwendung.
– In einer "Guided Tour" werden die Benutzer mit besonderen Tricks in der Bedienung einer Applikation vertraut gemacht.
– Beim Starten der Anwendung werden Tipps eingeblendet.– Im Buchungs-System eines Reiseanbieters besteht die Möglichkeit
eine Probebuchung vorzunehmen.– In einer Sitemap kann man sich ansehen, nach welcher Logik eine
Website strukturiert ist.– Es gibt Feedback zur Vereinfachung häufig angewendeter Befehle.
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 46
Lernförderlichkeit Beispiele
§ Angebot alternativer Eingabemöglichkeiten bei der Auswahl
§ Tipps und Tricks beim Programmstart§ Erste Schritte und Tutorials
TFH Berlin
Lernförderlichkeit: Beispiel zu Diskussion
§ Regel: identische Anfangsbuchstaben für Textauswahl und Tastenkürzel§ Konflikt: äußere Konsistenz© schmiedecke15 HCI 47
Quelle: www.ergo-online.de
TFH Berlin
Durchgängiges Beispiel: IKEA-Webshop
verfügbar unter http://slideplayer.org/slide/894288/© schmiedecke15 HCI 48
TFH Berlin
DIN-EN-ISO 9241-210 (ehem 13407)Benutzerorientierte Gestaltung interaktiver Systeme
§ Vorgehensweise bei der Gestaltung§ Einbeziehung vieler Fachpersonen
– Endbenutzer, Einkäufer, Führungskräfte,, Systemanalytiker,, Programmierer, Marketingfachleute, Grafikdesigner, HCI-Experten, Handbuchautor, Ausbilder, Wartungspersonal …
§ Usability-Engineering-Zyklus:– Anforderungen aus Nutzungszweck und -kontext erfassen– Anforderungen der Benutzergruppen erfassen– Gesamtlösungen entwerfen– Lösungsentwürfe gegenüber Anforderungen evaluieren– Iterieren, bis das Evaluationsziel erreicht ist.
© schmiedecke15 HCI 49
TFH Berlin
DIN-EN-ISO 14915Software-Ergonomie für Multimedia-Benutzungsschnittstellen
§ Drei Teile– Gestaltungsgrundsätze und Rahmenbedingungen– Multimedia-Navigation und Steuerung– Auswahl und Kombination von Medien
§ Eignungskriterien– für das Kommunikationsziel– für Wahrnehmung und verständnis– für die Exploration– für die Benutzungsmotivation
© schmiedecke15 HCI 50
TFH Berlin
© schmiedecke15 HCI 51
Zeitlos gültig:Shneidermanns Goldene Regeln des Dialogentwurfs
1. Versuche Konsistenz zu erreichen. 2. Biete erfahrenen Benutzern Abkürzungen an.3. Biete informatives Feedback. 4. Dialoge sollten abgeschlossen sein. 5. Biete einfache Fehlerbehandlung. 6. Biete einfache Rücksetzmöglichkeiten. 7. Unterstütze benutzergesteuerten Dialog. 8. Reduziere die Belastung des
Kurzzeitgedächtnisses.
aus : Designing the User Interface, Addison-Wesley 1987