(Interventionen 14) Anne Nigten (Auth.), Jörg Huber (Eds.)-Einbildungen-Springer Vienna (2005)
-
Upload
wendell-e-s-lopes -
Category
Documents
-
view
23 -
download
2
description
Transcript of (Interventionen 14) Anne Nigten (Auth.), Jörg Huber (Eds.)-Einbildungen-Springer Vienna (2005)


Interventionen
Eine Koproduktion des Instituts fiir Theorie der Gestaltung und Kunst (ith)
an der Hochschule fiir Gestaltung und Kunst Zurich (HGKZ) und
Edition Voldemeer Zurich SpringerWienNewYork
Das Institut fiir Theorie der Gestaltung und Kunst Ziirich (ith) betreibt Grundlagen- und angewandte Forschung und entwickelt entlang aktueller asthetischer Fragen ein Theorie-verstandnis, das in engem Bezug zur Praxis der Gestaltung und Kunst und deren gesell-schaftlicher Relevanz steht.
The Institut fur Theorie der Gestaltung und Kunst Zurich (Institute for Theory of Art and Design Zurich, ith) pursues basic and applied research. With reference to contemporary aesthetic issues, the ith develops theoretical concepts pertinent to the practice of design and art and its social relevance. The work of the ith is trans disciplinary and oriented toward knowledge transfer and networking.
Interventionen i Wahrnehmung von Gegenwart, Basel / Frankfurt am Main 1992 Interventionen 2 Raum und Verfahren, Basel / Frankfurt am Main 1993 Interventionen 3 »Kultur« und »Gemeinsinn«, Basel / Frankfurt am Main 1994 Interventionen 4 Instanzen /Perspektiven /Imaginationen, Basel / Frankfurt a. M. 1995 Interventionen 5 Die Wiederkehr des Anderen, Basel / Frankfurt am Main 1996 Interventionen 6 Konturen des Unentschiedenen, Basel / Frankfurt am Main 1997 Interventionen 7 Inszenierung und Geltungsdrang, Ziirich 1998 Interventionen 8 Konstruktionen Sichtbarkeiten, Ziirich / Wien / New York 1999 Interventionen 9 Darstellung: Korrespondenz, Ziirich / Wien / New York 2000 Interventionen 10 Kultur - Analysen, Ziirich / Wien / New York 2001 Interventionen 11 Singularitdten - Allianzen, Ziirich / Wien / New York 2002 Interventionen 12 Person/Schauplatz, Zurich / Wien / New York 2003 Interventionen 13 Asthetik Erfahrung, Ziirich / Wien / New York 2004 Interventionen 14 Einbildungen, Ziirich / Wien / New York 2005
Herausgegeben von Jorg Huber (Interventionen 2-5 mit Alois Martin Miiller, 6-8 mit Martin Heller)

Farideh Akashe-Bohme Lebensentwurf und
Verstrickung: Biographien zwischen den Kulturen
7:39-56
Aleida Assmann Exkarnation: Gedanken zur
Grenze zwischen Korper und Schrift 2:133-155
Jan Assmann Zeit der Erneuerung, Zeit der
Rechenschaft: Mythos und Geschichte in friihen
Kulturen 3:171-194
Dirk Baecker Die Unterscheidung der Arbeit
10:175-196
Mieke Bal Performanz und Performativitat
10:197-241
Zygmunt Bauman Uber Kunst, Tod und Demo-
kratie und was sie gemeinsam haben 7:185-205
Hans Belting Hybride Kunst? Bin Blick hinter die
globale Fassade 9:99-112
Seyla Bentiabib Von der »Politik der Differenz«
zum »sozialen Fern in ism us« in der US-Frauenbewe-
gung: Ein Pladoyer fiir die 90er Jahre 4:225-248
Jessica Benjamin Psychoanalyse, Feminismus
und die Rekonstruktion von Subjektivitat 3:35-58
Gottfried Boehm Zwischen Auge und Hand:
Bilder als Instrumente der Erkenntnis 8:215-227
Gemot Bohme Ethik leiblicher Existenz:
Moral zwischen Asketik und Rhetorik 12:19-36
Hartmut Bohme Aussichten einer asthetischen
Theorie der Natur 1:31-53
Cornelia Bohn Individuen und Personen:
Vom Inklusionsindividuum zum
Exklusionsindividuum 12:161-182
Karl Heinz Bohrer Zeit und Imagination:
Die Zukunftslosigkeit der Literatur 1:81-101
Norbert Bolz Zur Theorie der Hypermedien
2:17-27
Mandakranta Bose Wem gehort der klassische
indische Tanz? Die Frage nach den Besitzverhaltnissen
und die AuffiJhrung auf der globalen Buhne
11:109-128
Christina von Braun Nada Dada Ada -
Oder Die Liebe im Zeitalter ihrer technischen Repro-
duzierbarkeit 1:137-168
Horst Bredekamp Die zeichnende Denkkraft:
Uberlegungen zur Bildkunst der Naturwissen-
schaften 14:155-172
Elisabeth Bronfen Sigmund Freuds Hysterie,
Karl Jaspers Nostalgie 5:145-168
Hauke Brunkhorst Ansichten eines Intellek-
tuellen: Vom deutschen Mandarin zur Asthetik der
Existenz 2:43-64
Martin Burckhardt Der Traum der Maschine
5:197-222
Judith Butler Das Ende der Geschlechter-
differenz? 6:25-43
lain Chambers Am Rand der Welt: Sichtweisen
entorten, Geschichten verorten - Wessen Ort, wessen
Zeit? 9:171-185
Drucilla Cornell Feministische ZukiJnfte: Trans-
nationalismus, das Erhabene und die Gemeinschaft
dessen, was sein sollte 11:129-146
Douglas Crimp Scham dich, Mario Montez!
10:257-274
Lorraine Daston Bilder der Wahrheit, Bilder der
Objektivitat 14:117-154
Georges Didi-Huberman Nachleben oder
das Unbewusste der Zeit: Auch die Bilder leiden an
Reminiszenzen 11:177-188
Diedrich Diederichsen Coolness: Souveranitat
und Delegation 12:243-254
Jose van Dijck Fantastische Reisen im Zeitalter
der Endoskopie 14:47-74
Werner Durth Synthetische Traditionen:
Zur Inszenierung von Geschichtlichkeit 4:29-49
Alexander Garcia Diittmann Bilderverbote
6:221-238
Richard Dyer Homosexualitat und Erbschaft
10:275-298
Rosi Braidotti Uber nomadische Subjektivitat und
das World Wide Web 12:37-52
Terry Eagleton Kulturkriege 11:27-36

Regula Ehrliholzer Mapping: eine abgekartete
Sache? 6:129-150
Elena Esposito Internet-Rhetorik und Gedachtnis
der Gesellschaft 8:47-60
Erika Fischer-Lichte Fur eine Asthetik des
Performativen 10:21 -43
Douglas Fogle Virtueile Hysterische: Korper als
Medium und das Interface 5:245-263
Manfred Frank Ober Subjektivitat: Rede an die
Gebildeten unter ihren Reduktionisten 5:83-101
Peter Fuchs Die Signatur des Bewusstseins:
Zur Erwirtschaftung von Eigen-Sinn in psychischen
Systemen 12:123-136
Michael L Geiges Streiflichter: Aus der
Moulagensammlung des Universitatsspitals und
der Universitat Zurich 11:189-232
Peter Geimer Theorie der Gegenstande: »Die
Menschen sind nicht mehr unter sich« 12:209-222
Andre Gelpke Caroline am Strand 7:131-161
Sander L Gilman Glamour und Schonheit:
Die Idee von Glamour im Zeitalter der Schonheits-
operationen 14:173-192
Wlad Godzich Das Moderne Subjekt und die
Globalisierung 13:125-136
Christoph Grab Event Display: Visualisierung
in der Teilchenphysik 2:189-204
Boris Groys Die Logik der Sammlung 3:249-267
Hans Ulrich Gumbrecht Das Nicht-Hermeneu-
tische: Skizze einer Genealogie 5:17-35
Encarnacion Gutierrez Rodriguez Grenzen
der Performativitat: Zur konstitutiven Verschrankung
von Ethnizitat, Geschlecht, Sexualitat und Klasse
10:45-77
Alois M. Haas Unsichtbares sichtbar machen:
Feindschaft und Liebe zum Bild in der Geschichte der
Mystik 8:265-286
Alois Hahn Eigenes durch Fremdes: Warum wir
anderen unsere Identitat verdanken 8:61 -87
Michael Hardt Gemeinschaftseigentum
11:61-84
Ulla Haselstein »My Middle Writing Was
Painting«: Gertrude Steins literarische Portrats
9:113-131
Friederike Hassauer Sexus der Seele, Geschlecht
des Geistes: Zwei Kapitel aus der Geschichte der
Konstruktion des Zusammenhangs von Korper und
BewuBtsein 7:77-94
N. Katherine Hayles Fleisch und Metall:
Rekonfiguration des Geistkorpers in virtuellen
Umwelten 11:289-304
Bettina Heintz Die Intransparenz der Zeichen -
Mathematik, Kunst und Kommunikation 6:109-128
Agnes Heller Politik in der gottverlassenen
Welt 4:75-94
Irmela Hijiya-Kirschnereit »What a happy life
and death«: Japanische Selbstinszenierungen fur das
21.Jahrhundert 13:79-96
Dieter Hoffmann-Axthelm Stadt oder Gestal-
tung - wir haben die Wahl 4:17-28
Claudia Honegger Karl Mannheim und Raymond
Williams: Kultursoziologie oder Cultural Studies?
10:115-146
Axel Honneth Pathologien der individuellen
Freiheit: Hegels Zeitdiagnose und die Gegenwart
9:215-232
Jochen Horisch Beschleunigung und Bremsen:
Die Entdeckung der Zeit in der Moderne 3:195-215
Huang Qi Tausend Augen und wohlriechender
Rauch 9:133-170
Andreas Huyssen Erinnerte Leere: Hohlraum
Berlin 8:25-45
Yasuo Imai Die Idee des »Musters« (Kata) und
die asthetische Konstruktion des Ich im japanischen
Kontext 13:61-78
Wolfgang Kaempfer Die Zweizeitigkeit des
Zeitgetriebes 3:149-170
Dietmar Kamper Wahrnehmung als Passion:
Pladoyer fur ein Zeit-Korper-Denken 4:191 -198
Derrick de Kerckhove Psychotechnologien:
Interfaces zwischen Sprache, Medien und Geist
11:271-288

Friedrich A. Kittler Geschichte der Kommunika-
tionsmedien 2:169-188
Karin Knorr Cetina »Viskurse« der Physik:
Wie visuelle Darstellungen ein Wissenschaftsgebiet
ordnen 8:245-263
Gertrud Koch Der kinematographische Fail der
Autoritat 7:95-107
Doris Kolesch Imperfekt: Zur Asthetik anderer
Korper auf der BiJhne 14:193-206
Albrecht Koschorke Staaten und ihre Feinde: Ein
Versuch iiber das Imaginare der Politik 14:93-116
Helga Kotthoff Worte und ihre Werte: Konversa-
tionelle Stildifferenzen und Asymmetrie 3:73-98
Sybille Kramer Stimme - Schrift - Computer:
Ober Medien der Kommunikation 7:239-256
Julia Kristeva Proust: Identitatsfragen 6:45-78
Joachim Krug »Ein Auge welches sieht, das
andre welches fuhlt«: Bilder aus der physikalischen
Nanowelt 8:229-244
Peter Kubelica Die eBbare Metapher: Ober das
Kochen als Ursprung der Kunst 4:249-262
Herbert Lachmayer The Transient Office:
Zur Zukunft der Arbeit 7:17-37
Ernesto Laciau Die Politik der Rhetorik
10:147-174
IVIanuel de Landa Markt, Antimarkt und Netz-
werk-Okonomie 6:205-219
Bruno Latour Die Versprechen des Konstruktivis-
mus 12:183-208
Teresa de Lauretis Kino und Oper, offentliche
und private Phantasien (mit einer Lektiire von David
Cronenbergs »M. Butterfly«) 7:109-129
Maurizio Lazzarato Das Video »Passing Drame«:
Uberlegungen zu Politik und Asthetik 12:53-64
Rainer Leitzgen Organe des Menschen
5:129-143
Elisabeth Lenk Achronie: Versuch iiber die litera-
rische Zeit im Zeitalter der Medien 4:177-190
Thomas Y. Levin Geopolitik des Winterschlafs:
Zum Urbanismus der Situationisten 6:257-286
Elisabeth List Schmerz: Der somatische
Signifikant im Sprechen des Korpers 5:223-244
Mario G. Losano Der nationale Staat zwischen
Regionalisierung und Globalisierung 9:187-213
Susanne Ludemann Die Nachahmung der Gesell-
schaft 6:79-98
Jean Francois Lyotard Eine postmoderne Fabel
1:15-30
Thomas H. Macho Bilderflut oder Bilderkrise:
Vorlaufige Uberlegungen zum Streit zwischen Augen
undOhren 4:159-175
Nabil Mahdaoui Decadrage 8:89-104
Ram Adhar Mall Interkulturelle Asthetik:
Ihre Theorie und Praxis 11:85-108
Kevan A. C. Martin Vision, in my view
12:137-160
Peter von Matt Die Gewalt. Der Schlachten-
diskurs. Das Fest: Zur Inszenierung des politischen
UnbewuBten in der Literatur 6:99-107
Judith Mayne Eingesperrt und gerahmt:
»Frauen im Gefangnis«-Filme 11:249-270
Angela McRobbie »Jeder ist kreativ«:
KiJnstler als Pioniere der New Economy? 11:37-60
Bettine Menke Die Ver-Stellung und die schone
Stimme: Zum Konzept eines dekonstruktiven Feminis-
mus 2:65-87
Christoph Menke Die Dialektik der Asthetik:
Der neue Streit zwischen Kunst und Philosophie
13:21-40
Dieter Mersch Kunst und Sprache: Hermeneutik,
Dekonstruktion und die Asthetik des Ereignens
13:41-60
Alfred Messerii Grenzen der Schriftlichkeit
2:127-132
Johann Baptist Metz Gotteskrise als Signatur
der Zeit? 4:95-109
Eva Meyer Erzahlen und Zahlen 1:103-119

Marie-Jose Mondzain Die Angst im Bild: Aspekte
der Herrschaft mit Hilfe von Bildern 14:33-46
Herta Nagl-Docekal Fenfiinistische Asthetik:
Versuch einer Zwischenbilanz 9:75-97
Richard Rorty Menschenrechte, Vernunft und
Empfindsamkeit 3:99-126
Gillian Rose Feministische Geographien:
Von Grenzlinien zu Netzwerken 12:85-106
Jean-Luc Nancy Das Bild: Mimesis & Methexis
13:171-190
Barbara Naumann Chuck Close: Gesichter und
Sehen 10:299-315
Anne Nigten Interdisziplinare Praxis:
Online-Partizipationsumgebungen 14:19-32
Irene Nierhaus Super-Vision: Eine Geschlechter-
figur von Blick und Raum 11:233-248
Helga Nowotny Grenzen und Grenzenlosigkeit:
Kreativitat und Wissensdistribution 6:151 -172
Ayse Oncu Die Sinnlichkeit globalisierter Bilder
und die Banalitat der Alltagserfahrung im heutigen
Istanbul 12:107-122
Ursula Panhans-Biihler Zwischen Zufall und
Ewigkeit: Marcel Broodthaers MUSf E - MUSEUM
enfants non admis 8:127-171
Lisa Parks Orbit-Performance-Kunstler und
Satelliten-Ubersetzer: Kunst im Zeitalter des
ionospharischen Austauschs 12:65-84
Armando Petrucci Schrift ais Erfindung - Schrift
alsAusdruck 2:157-167
Sadie Plant In die Theorie hinein und wieder
hinaus 10:243-255
Samuel Sami Rachdi Timetables 10:367-372
Hans Ulrich Reck Medientheorie und -techno-
logie als Provokation gegenwartiger Asthetiken
1:169-188
Birgit Recki Der Grund der Originalitat und die
MachtdesNamens 10:317-332
Florian Rotzer Asthetische Herausforderungen
von Cyberspace 2:29-42
Renata Salecl Sexuelle Differenz als Einschnitt
indenKorper 7:163-183
Eric L. Santner Mein ganz privates Deutschland:
Daniel Paul Schrebers geheime Geschichte der
Moderne 5:169-196
Saskia Sassen Digitale Netzwerke und Macht
6:189-203
Hans Wolfgang Schaffnit Die Armut des
Individuums in der Gesellschaft offenbarer Indlfferenz
1:121-135
Michael Schirner The Party: Das elektronlsche
Parlament 5:53-62
Renate Schiesier Zur Rivalitat zwischen Tragodie
und Philosophle 3:127-148
Marianne Schuller Bilder - Schrift - Gedachtnis:
Freud, Warburg, Benjamin 2:105-125
Gerhard Schuize Auf der Suche nach dem
schonen Leben: GliJcksmodelle, Kunst und Publikum
der Gegenwart 3:269-295
Martin Seel Asthetische und moralische
Anerkennung der Natur 2:205-227
Walter Seitter Das Insistieren der Steine:
Zur Analytik der Kirche in Schongrabern 5:265-288
Kaja Silverman Der Blick 6:239-255
Hans-Georg Soeffner Stile des Lebens:
Asthetische GegenentwiJrfe zur Alltagspragmatik
10:79-113
Christoph Rehmann-Sutter Die Seele von
Gen-Maschinen 8:105-125
Willem van Reijen Ein Spaziergang durch
Prosperos Bibliothek 5:37-51
Irit Rogoff Die Anderen der Anderen: Spectator-
ship und Differenz 5:63-82
Erika Spiegel Die Stadt als Interaktionssystem:
Zum Verhaltnis von DIchte, Interaktion und Innova
tion 4:51-73
Barbara Maria Stafford Die kombinatorische
Asthetik der Neurobiologie 9:43-59

Philipp Stoellger Der Wert der Herkunft:
Zur theologischen Vorgeschichte der Originalitat und
ihrer ewigen Wiederkehr 10:333-366
Peter Strasser Die Kunst als Religion 4:111-126
Katharina Sykora Ver-Korperungen:
WeibiichJceit - Natur - Artefakt 2:89-103
Georg Christoph Thoten Der blinde Fleck
des Sehens: Uber das raumzeitliche Geflecht des
Imaginaren 8:191-214
Kathe Trettin Logik. Form-Faszination und
fenfiinistische Kritik 4:199-223
Akiko Tsukamoto Zur Flexibilitat der
Japanischen Kunst 3:217-248
Gianni Vattimo Die Philosophie am Ende des
Jahrhunderts zwischen Religion und Wissenschaft
8:15-23
Jan Verwoert Double Viewing: Versuch iiber
die Bedeutung des »Pictorial Turn« fiir einen
ideologiekritischen Umgang mit visuellen Medien -
im Medium Videokunst 12:223-242
Barbara Vinken Transvestie - Travestie:
Mode und Geschlecht 7:57-76
Joseph VogI Alb der Perversion. Amok und soziale
Irrealitat 13:137-154
Bernliard Waldenfels Die Macht der Ereignisse
13:155-170
iViichael Warner Glamour und Gegen-Glamour
13:213-224
IMartin Warnke Synthese Mimesis Emergenz:
Entlang des Zeitpfeils zwischen Berechenbarkeit und
Kontingenz 14:75-92
Sigrid Weigel Bilder als Hauptakteure auf dem
Schauplatz der Erkenntnis: Zur »poiesis« und »epis-
teme« sprachlicher und visueller Bilder 13:191-212
Hans U. Weiss Die Kuche erwacht: Koche,
Kochinnen und Kiichen in Abbildungen frijher Koch-
bijcher 4:127-157
Wolfgang Welsch Zwei Wege der Asthetisierung
1:55-79
Horst Wenzel Der Leser als Augenzeuge: Zur
mittelalterlichen Vorgeschichte kinematographischer
Wahrnehmung 11:147-176
IVIichael Wetzel Ober das Sehen (hinaus): Blind-
heit und Einsicht bei Goethe und Derrida 8:173-190
Linda Williams Die visuelle und korperliche Lust
der Pornographie in bewegten Bildern: Ein kurzer
historischer Uberblick 5:103-128
Theresa Wobbe Violentia: Uberlegungen zur Ver-
schrankung von Rassismus und Sexismus 3:19-34
Christoph Wulf Mimetische Grundlagen soziaien
Handelns: Weltaneignung und rituelle Praxen
9:17-42
Beat Wyss Das indexikalische Bild: Kultur nach der
Schrift 9:61-73
James E. Young Der Holocaust als Vergangenheit
aus zweiter Hand: Art Spiegelmans »Maus« und
David Levinthals »Mein Kampf« 7:207-237
Ismail Zain The Eye has a Veil 13:97-124
Siegfried Zielinski Supervision und Subversion:
FiJr eine Anarchaologie des technischen Visionierens
6:173-188
Slavoj Zizek Metastasen des GenieBens:
David Lynch mit Lacan 3:59-71

Einbildungen
Interventionen 14
Interventionen von
Horst Bredekamp Lorraine Daston Jose van Dijck
Sander L. Gilman Doris Kolesch
Albrecht Koschorke Marie-Jose Mondzain
Anne Nigten Martin Warnke
herausgegeben von
Jorg Huber
Institut fiir Theorie der Gestaltung und Kunst
Zurich (ith)
Edition Voldemeer Zurich SpringerWienNewYork

Jorg Huber Institut fiir Theorie der Gestaltung und Kunst Zurich (ith)
Das Institut fiir Theorie der Gestahung und Kunst (ith, Leitung: Prof. Dr. Jorg Huber) ist Teil des Departement Cultural Studies in Art, Media, and Design (ICS, Leitung:
Prof. Dr. Sigrid Schade) der Hochschule fiir Gestaltung und Kunst, Zurcher Fachhochschule (HGKZ, Leitung: Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz).
Das Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere die der Ubersetzung, des Nachdruckes,
der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photo-mechanischem oder ahnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanla-
gen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verarbeitung, vorbehalten.
Copyright © 2005
Institut fiir Theorie der Gestaltung und Kunst Ziirich (ith) www.ith-z.ch
und f V^ Edition Voldemeer Ziirich ^^ Postfach 'ft** CH-8039 Ziirich
Administration Interventionen: Claudia Hiirlimann und Irene Hediger, ith, Ziirich
Lektorat: Ulrich Hechtfischer, Freiburg i. Br. Satz: Marco Morgenthaler, Ziirich
Bildbearbeitung: Manii Hophan, Ziirich Druck: Novographic GmbH, Wien
Gedruckt auf saurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier - TCF Printed in Austria
SPIN 11590941
Mit II Abbildungen
ISSN 1420-1526
ISBN-io 3-211-30658-7 Springer-Verlag Wien New York ISBN-13 978-3-211-30658-1 Springer-Verlag Wien New York
SpringerWienNewYork, Sachsenplatz 4-6, A-1201 Wien www.springer.at
www.springeronline.com

Inhalt
Jorg Huber Vorwort i i
Anne Nigten Interdisziplindre Praxis: Online-Partizipationsumgebungen 19
Marie-Jose Mondzain Die Angst im Bild:
Aspekte der Herrschaft mit Hilfe von Bildern 33
Jose van Dijck Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 47
Martin Warnke Synthese Mimesis Emergenz: Entlang des Zeitpfeils zwischen Berechenharkeit und Kontingenz 75
Albrecht Koschorke Staaten und ihre Feinde:
Ein Versuch iiber das Imagindre der Politik 93
Lorraine Daston Bilder der Wahrheit, Bilder der Objektivitdt 117
Horst Bredekamp Die zeichnende Denkkraft: Uberlegungen zur Bildkunst der Naturwissenschaften 155
Sander L. Gilman Glamour und Schonheit: Die Idee von Glamour im Zeitalter der Schonheitsoperationen 173
Doris Kolesch Imperfekt: Zur Asthetik anderer Korper auf der Biihne 193
Zu den Autorlnnen 207

Vorwort
Gebrauchsweisen der Bilder - so konnte man den thematischen roten Faden benennen, der sich durch die hier versammelten Texte zieht. Dem Prinzip der Interventionen folgend, wurde dieser thematische Fokus nicht anfanglich bestimmt; er ergab sich nachtraglich und spiegelt damit auch die Arbeitsschwerpunkte und Interessen des Instituts fiir Theo-rie der Gestaltung und Kunst (ith). Es geht hier nicht primar um die grundlegenden Fragen der Bildtheorie, die sich mit dem Wesen des Bil-des, einer Ontologie und/oder einer Kulturanthropologie der Bilder be-schaftigen, sondern um »Bilder an der Arbeit«. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf konkrete Arbeitssituationen, in denen Bilder eine RoUe spielen und aus denen sich Fragen ableiten lassen beziiglich der Funk-tionen und Bedeutungen, die den Bildern zugewiesen werden, und der Art und Weise, wie mit Bildern verfahren wird. Wichtig ist, dass wir uns dabei nicht auf den Kontext der Naturwissenschaften konzentrieren, einen Themenbereich, der in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Konjunktur erlebt hat - nicht immer, wie uns scheint, zu Gunsten einer kritischen Bildtheorie. Uns interessiert vielmehr, welche Fragen die Kultur- und Geisteswissenschaften an die Bilder stellen, wenn sie deren Auftreten und Agieren in der Wissenschafts- und Alltagskultur sowie in der Kunst und im Design beobachten.
Die einzelnen Beitrage sind denn auch in unterschiedlichen Kontexten veranlasst. Doris Koleschs Text steht in Zusammenhang mit dem For-schungsprojekt von Gesa Ziemer zu Bildern von so genannt behinderten Korpern, das heifit konkreter: zu Wahrnehmungs-, Darstellungs- und Konstruktionsweisen auf dem Theater (»Verletzbare Orte«), ein Pro-jekt, das iibrigens durch den Einsatz von Video nicht nur iiber, sondern auch mit Bildern arbeitete. Dieser Aspekt, das heifit die Frage, wie in den Kultur- und Geisteswissenschaften mit Bildern gearbeitet wird, wie
I I

12 Jorg Huber
also der Gegenstand der Arbeit sich auch in die Arbeitsweisen eintragt und Spuren hinterlasst, bildet gegenwartig einen Themenschwerpunkt am ith.^ In Bezug auf diese Frage wichtig sind die Forschungsarbeiten von Flavia Caviezel, in deren Zusammenhang die Debatte zu den so ge-nannten »Partizipativen Environments« in der Netz-Kunst und -Kom-munikation steht, die der Beitrag von Anne Nigten reprasentiert/ Martin Warnkes Text ist ein Beitrag zu dem Forschungsprojekt von Matthias Vogel, das die Bedeutung der Archive fiir die Medien-Bildoffenthch-keiten untersucht. Albrecht Koschorkes Beitrag betrifft sowohl unsere Auseinandersetzung mit der Frage der pohtischen Bilder, respektive der PoHtik der Bilder, wie auch die Thematisierung des fiir eine Kultur- wie eine Bildtheorie wichtigen Begriffs des Imaginaren. Auf diesen Kon-text bezieht sich auch der Beitrag von Marie-Jose Mondzain, der durch die Tagung »Prasenz in Literatur und Kunst« veranlasst wurde, die das Seminar fiir Vergleichende Literaturwissenschaft der Universitat Ziirich organisiert hat (Andre Bucher, Marco Baschera). Und Sander L. Gil-mans Diskussion der Bedeutung der Vor-Bilder fiir die (Selbst-)Model-lierung und Inszenierung der Korper und der Person unter dem Stich-wort des Glamourosen ist ein Beitrag zu der vom ith zusammen mit dem Kulturwissenschaftler Tom Holert organisierten Veranstaltungs-reihe »Doing Glamour«.^ Und last, but not least sind mit Jose van Dijck, Lorraine Daston und Horst Bredekamp drei prominente Vertre-terlnnen einer bildtheoretischen Forschung vertreten, die explizit die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und Wissenskulturen in ihrem produktiven Wechselverhaltnis reflektieren und thematisieren. Der fol-gende knappe Durchgang durch die einzelnen Beitrage soil eine erste Orientierung und einen kursorischen Uberblick ermoglichen.
Thema des Beitrags von Anne Nigten ist die Forschungspraxis von Kunstschaffenden im digitalen Raum. Dabei geht es um die Schaffung von Gemeinschaften mittels partizipativen Strategien im Kontext visuel-ler Informationsraume. Ziel ist, neue Moglichkeiten von sozialen Pro-zessen und Designmethoden zu erforschen; Voraussetzungen sind unter
1 Vgl. dazu Juerg Albrecht / Jorg Huber / Kornelia Imesch / Karl Jost / Philipp Stoell-ger [Hgg.], Kultur Nicht Verstehen, Zurich / Wien / New York 2005 (= T:G 04) und die Nummer 5 des ith-Magazins j / (Juni 2005). 2 Vgl. dazu die Aktivitaten des Rotterdamer Instituts V2 und das aktuelle Forschungsprojekt von Flavia Caviezel und Susanna Kumschick, »Check it« - www.ith-z.ch. 3 Vgl. dazu Tom Holert / Heike Munder, The Future has a Silver Lining: Genealogies of Glamour, Zurich 2004.

Vorwort 13
anderem die Offenheit der Anlage und des Rahmens sowie die Interdis-ziplinaritat, die eine ebenso offene, »kombinierte oder gemorphte« For-schungsmethode erf ordert. Der kiinstlerischen Forschung ist die Metho-denkoharenz, die wissenschaftliche Forschung allgemein verlangt, nicht oberstes Gebot, im Gegenteil. So wie sie die Kombination von For-schungsansatzen und -verfahren betont, ist ihr das Prozessuale, das heifit das Unfertige und Unvorhersehbare, wichtig. Vor diesem Hinter-grund wird einsichtig und anschaulich gemacht (wobei gerade bei diesem Thema das Fehlen des visuellen Materials des Vortrags hier im Buch bedauerlich ist), wie bedeutsam das Mitagieren und Autor-Werden der Teilnehmenden ist und welch wichtige RoUe das Design iibernimmt.
In der heutigen Welt dominiert Angst, so die Beobachtung von Marie-Jose Mondzain, und dies so wirksam nicht zuletzt auf Grund der Macht der Bilder. Zwei Strategien der Herrschaft mittels Angst sind zu unterscheiden. Die eine ist die »Phobokratie«; sie bedient sich der Bilder, um Macht zu errichten. Die andere, die »Ikonophobie«, beschwort die Macht der Bilder und erweckt Angst vor ihnen. Die Analyse dieser Verfahren der KontroUe respektive der Verteufelung der Bilder fiihrt Mondzain zu einer grundlegenden Unterscheidung: In beiden Zusam-menhangen zieht sie es vor, von der Industrie des Sichtbaren zu spre-chen und den Begriff des Bildes nur dort zu verwenden, wo die visuelle Prasentation Partizipation ermoglicht und auf Herrschaft verzichtet. Es geht hier also um die Rettung des Bildes oder um den Mut zu dem oder des Bildes: das Bild als »einzige Zuflucht vor der Angst«. Das Bild hat seine fiir die Menschheit konstituierende Kraft in der Konstruktion von Intersubjektivitat, in seiner Bedeutung fiir die Kommunikation und Imagination - gegen die Herstellung von symbiotischen Gemeinschaf-ten (einer »Welt ohne Andersheit«, Phantasma der »Verschmelzung«, Unfahigkeit zur Trennung etc.), die von der Herrschaft mittels Angst scheinbar gegen die Angst beschworen werden, die jedoch die Einzel-nen »entsubjektivieren« und unterwerfen und ihnen die Moglichkeit nehmen, auf die Wirklichkeit einzuwirken.
Fantastic Voyage - dieser Titel eines Hollywood-Science-Fiction-Films ist, so Jose van Dijck, Programm der gegenwartigen und zukiinf-tigen Chirurgie. Die Reisen durch den menschlichen Korper, die der Film zeigt, werden in der medizinischen Realitat auf sehr ahnliche Weise unternommen. Van Dijck zeigt, wie sich die endoskopische Technologic und die entsprechenden Blickregime seit etwa 1800 rasant entwickelt haben, vom gynakologischen Speculum und Rektoskop, und damit dem

14 JorgHuber
noch »kurzsichtigen« Blick durch die natiirlichen Offnungen des Lei-bes, bis zu den Totalerlebnissen, die die virtuelle Endoskopie und die computergestiitzten Bildgebungstechnologien auch einem breiten Publi-kum offerieren. Wichtige Themen dieser Entwicklung sind - neben der Problematik der veranderten Arbeitsbedingungen der Arzte und Arztin-nen - die Entgrenzung der Reprasentation zum Gefiihl totaler Immersion; die Verwandlung des Korpers vom physischen Objekt zur digi-talen Umgebung; das Reinheitsphantasma des auch bei jedem Eingriff unangetasteten Korpers; das Zusammenspiel von Medizinpraxis und Medientechnologien, die iiber die visuelle Asthetik TV, Kinounterhal-tung und die Darstellung medizinischer Vorgange kurzschliefien; sowie nicht zuletzt die Fragen der Medizinethik vor dem Hintergrund, dass die korperliche Intimitat des Einzelnen zum offentlichen Spektakel ent-grenzt wird.
Auch der Computer und die Computerkultur haben eine Geschichte, die allgemein kaum zur Kenntnis genommen wird, so die These von Martin Warnke. Sie kann in drei Entwicklungsphasen beschrieben wer-den, deren signifikante Stichworter Synthese, Mimesis und Emergenz lauten. Warnke skizziert in seinem Beitrag die drei Stufen als eine Entwicklung von der Computerkultur, die aus sich heraus arbeitet und wo alles deterministisch und zwangslaufig geschieht, iiber ein System, bei dem die entscheidenden und charakteristischen Einfliisse von aufien kommen und damit Kontingenz bedeutsam wird, zu einer dritten und jiingsten Phase, in der die Vernetzung (von Bewusstseinen und Maschi-nen) signifikant ist, die Grenzen zwischen Berechenbarkeit und Kontingenz schwimmend werden, Modellbildungen unmoglich sind und Emergenz vorherrscht. Warnke beschreibt fiir die drei Stufen sowohl die jeweiligen technologischen Merkmale wie auch Moglichkeiten asthe-tisch kiinstlerischer Verfahren und fordert, dass die Informatik als die zustandige Disziplin sich vermehrt anderen Disziplinen wie etwa der Soziologie und den Kulturwissenschaften gegeniiber offnen sollte, damit die Entwicklungen und historischen Situationen der Computerkultur in der Verbindung von Technologic, Gesellschaft und Kultur disku-tiert werden konnen.
Die Parallelen zwischen den Geschichten und Bildern der Science-Fiction-, Katastrophen- und Untergangsfilme aus Hollywood einerseits und den Aktionen des internationalen Terrorismus andererseits sind oft beschrieben und besprochen worden. Um hier weiterzukommen, braucht es, soyl/Z?rec/7tXo5c/7or^e, eine politische Analyse der Bilderoder

Vorwort 15
allgemeiner des Imaginaren. Diese fiihrt iiber den iiblichen Gegensatz hinaus, der einer westlichen Moderne einen traditionalistisch orientier-ten islamistischen Fundamentalismus und Terrorismus entgegenstellt. Letztere sind Effekt ein und derselben (Post-)Moderne. Die Terroristen verfiigen iiber enge Verbindungen mit dem Westen und sind mit diesem in denselben AUtagswelten und Symbolsystemen sozialisiert. Koschorke analysiert die Bedeutung dieser Nahe und der mentalen Verwandtschaft der Widersacher, der gegenseitigen Anpassung an die Bilder, die man vom jeweils Anderen macht, der gerade, je deutlicher die Kooperation ist, umso radikaler in seiner Alteritat gezeichnet wird. Dieser untergriin-dige imaginare Rapport zwischen den feindlichen Akteuren verbindet Koschorke mit der Analyse der imaginaren Grundlagen von Staatlich-keit. Verfolgt man die Genealogie der Staatsgriindungen und -entwick-lungen, so zeigt sich, dass die Grenzziehungen zwischen Gesetz und Gewalt, Staat und Outlaw gar nicht so eindeutig vorzunehmen sind und dass Staat und Rauberei durchaus komplexe Wechselbeziehungen ein-gingen und eingehen. Die Grenze zwischen legitimer und illegitimer Gewalt ist oft nur eine Frage der Perspektive, was uns zwingen sollte, die Frage des Terrorismus auch aus der anderen Sicht, der Sicht der Anderen wahrzunehmen.
Um Bilder geht es auch im Beitrag von Lorraine Daston. Seit dem 16. Jahrhundert werden in den Wissenschaften Bilder und allgemein Visualisierungen verwendet. Damit tauchte auch das Problem auf, ob Bilder das zeigen, was vorgegeben ist, als Abdriicke quasi, oder ob sie »Gestaltungen« sind, in denen die Wissenschaftler selbst ihre Spuren hinterlassen. Die Frage also, wie sich in den Bildern Erkenntnisideal und Verfahren eintragen und welche Rolle die bildgebenden Verfahren und Apparate spielen; die Frage nach Objektivitat und Wahrheit, zwei Wissenschaftskonzepten, die, wie Daston in ihrem Uberblick iiber die Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert zeigt, nicht etwa deckungs-gleich waren, sondern sich oft widersprachen oder sich gar gegenseitig ausschlossen.
An Daston anschliefiend, entwickelt Horst Bredekamp an Beispielen aus der Naturwissenschaft die These, dass die Zeichnung als Medium der Forschung eine eigene Dynamik und Wirkung erzielt, die iiber das Denken hinausfiihrt. In Bezug auf ihre Performativitat konne man, in Anlehnung an die Sprechakttheorie, von einem Sketchact reden. Als Korperspur setzt die Zeichnung eine forschende Phantasie frei, die gerade auch heute, im Zeitalter der Computertechnologie und der moder-

16 Jorg Huber
nen Bildgebungsverfahren (erneut) von grofier Bedeutung ist. Anhand von Beispielen, die einen Bogen von Galilei bis Frank Gehry spannen, welche die Symbolik der S-Linie nutzen, macht Bredekamp anschau-lich, wie die Bilder in den verschiedenen Kontexten der Wissenschaft und Kunst zu Akteuren werden.
Auch bei Sander L. Gilman spielen Bilder eine RoUe: Vor-Bilder, die einzelne Menschen leiten in ihrem Begehren, den eigenen Leib zu veran-dern und ihn dabei einem vorbildlichen Korper anzunahern. Die asthe-tische Chirurgie liefert die Schauplatze, Magazine und TV-Sendungen schaffen die Offentlichkeit. Die Grenzen zwischen der so genannten Gesundheits- und Schonheitschirurgie werden fliefiend. Oft handelt es sich bei den »Patienten« um Vertreterlnnen der unteren Schichten, die versuchen, sich iiber Mehrfachoperationen die Schonheit und den Glamour ihrer (Hollywood-)Vorbilder in den Leib zu schreiben, um auch soziale Anerkennung zu finden. Ahnliches passiert, wenn Orlan in »Kunst-Operationen« ihre Vorbilder in der Kunstgeschichte findet. Das zentrale Problem ist, dass es, ob Barbie oder Mona Lisa, keine Ori-ginale gibt: Die Kopie ist Kopie einer Kopie etc. Es geht, so Gilman, um Assemblagen, multiple Kopien, Erscheinungen in der Umarmung der TV-Kameras - um die Natur des Glamours im Zeitalter der techni-schen Reproduzierbarkeit des Korpers.
Um den anderen Korper, den, der nicht den gangigen Idealen und Normen entspricht, den imperfekten Korper, geht es im Beitrag von Doris Kolesch. Und genauer: um dessen asthetische Wahrnehmung, spe-ziell in theatralen Zusammenhangen. Gerade das Theater macht es mog-lich, dass das Andere, Imperfekte nicht nur negativ und als Defizit, son-dern als andere Ordnung exponiert werden kann und dass das Publikum ungehemmt hinschauen darf. Die dem Theater spezifische Transitorik der Performance provoziert zudem Wahrnehmungssituationen und -weisen, die das jeweilige Geschehen stets mit der Erinnerung des (eben) Gesehenen und Gehorten - des Geschehens im Perfekt - konfrontiert. Die Zuschauer erleben so standig das »Ineinander von sinnlicher Prag-nanz und Entzug, von Verstehen und Nichtverstehen, von Wahrneh-mungs-, Assoziations- und Deutungsvermogen und deren Scheitern«. Dazu kommt, dass das aktuelle Theater exphzit die Konvention der asthetischen Distanz durchbricht und radikal das »Hier und Jetzt der Existenz« ausstellt. An konkreten Beispielen zeigt Kolesch, dass und wie das Theater die Vorstellung von (Im-)Perfektion auf die Fragilitat und Sterblichkeit des Menschen zuriickfiihrt, ein Fokus, der in anderen

Vorwort 17
Bereichen der Gesellschaft ausgeblendet wird - was ja auch Thema von Sander L. Gilman ist.
Seit 14 Jahren konnten wir die Interventionen in Gang halten, ungefahr 170 Referentlnnen in Zurich begriifien und ihre Beitrage in 14 Ausgaben des Jahrbuchs veroffentlichen. Damit ergab sich eine interessante Topo-graphie der Themen und Debatten, die die kulturtheoretische Arbeit an der HGKZ und im Speziellen am ith reprasentiert und mitbestimmt hat. Mit dem vorHegenden Buch geht dieses Projekt zu Ende. Wir danken alien, die seit 1991 mitgemacht haben und bereit waren, die Interventionen zu unterstiitzen. Im Rahmen des letzten Programms danken wir speziell den verschiedenen Mitarbeiterlnnen fiir die Konzeption und Organisation einzelner Veranstaltungen: Tom Holert (Sander L. Gil-man), Gesa Ziemer (Doris Kolesch), Matthias Vogel (Martin Warnke), Marco Baschera (Marie-Jose Mondzain), Flavia Caviezel (Anne Nig-ten), Regula Burri (Jose van Dijck). Benjamin Marius Schmidt danken wir fiir die Ubersetzungen der Beitrage von Lorraine Daston, Jose van Dijck, Sander L. Gilman und Anne Nigten sowie Beate Thill fiir die Ubersetzung des Beitrags von Marie-Jose Mondzain. Claudia Hiirli-mann sei Dank fiir die Leitung der Projekt-Administration und Irene Hediger sowie Roland Roos fiir ihre Mitarbeit. Vor allem aber danken wir dem Publikum, das uns 14 Jahre lang mit seinem Interesse und seiner wachen Prasenz unterstiitzt hat.
Jorg Huber

Anne Nigten
Interdisziplindre Praxis Online-Partizipationsumgebungen
Immer mehr Kiinstler und Designer arbeiten mit offenen Umgebungen, in denen das Publikum zum Koautor und Mitschopfer des digitalen Raums wird. Im Rahmen einer interdisziplinaren Praxis beschaftigen sich solche Projekte mit einem breiten Spektrum von Forschungs- und Designfragen, das visuelles Design, Biologie, Systemtheorie und Ver-haltensforschung umfasst und in partizipatorischen Online-Umgebun-gen zusammenbringt.
Im folgenden Text werden einige Aspekte ihres praktischen und theoretischen Kontextes ausgefiihrt, welche dringende Fragen interdis-ziplinarer Art betreffen. Hauptbezugspunkt dieses kurzen Essays bil-den Fragen zu Forschung und Design auf dem Gebiet visueller Informa-tionsraume, in denen die Online-Teilnehmer ihre eigenen thematischen Gemeinschaften miterschaffen.
Im vergangenen Jahrzehnt war die Visualisierung von Information ein Gebiet wachsenden Forschungs- und Designinteresses, das fiir viele Aspekte friiher Internetanwendungen relevant war. Als Oberbegriff fiir dieses Cluster von Forschungen im Bereich von Kunst und Design, die sich mit der Visualisierung von Information in weitem Sinne befassen, scheint der englische Ausdruck »Mapping« (Erstellen einer Karte) angemessen. Im Bereich des Mappings konnen mehrere Kate-gorien unterschieden werden: vom Notationssystem iiber die karto-grafische Landkarte bis hin zu assoziativen oder mentalen Karten. All diese Karten reprasentieren bestimmte Realitaten, die oft auf einem jeweils spezifischen Wissensgebiet oder einer Disziplin beruhen. Die ersten beiden Kategorien beziehen sich mit Hilfe von bereits allgemein bekannten und akzeptierten Reprasentationsmethoden (Symbole und Kartografie) auf physikalische Realitat. Die meisten dieser Karten werden in Mapping Cyberspace von Martin Dodge und Rob Kitchin be-
19

20 Anne Nigten
sprochen/ Fiir diese Art Karten wird meist eine kausale Forschungs-methode angewendet, die bei traditionellen Designmethoden beginnt, welche auf die Losung eines Problems oder eines Sets von Problemen abzielen. Insbesondere in den friihen Tagen des Internets waren diese Karten wichtig, um abstrakte oder immaterielle Sachverhalte in Netz-werken zu kommunizieren, wobei haufig Metaphern fiir die Kompen-sation der vertrauten, aber hier »unbekannten« oder fehlenden Visua-lisierungselemente eingesetzt wurden. Die anderen Karten, die wir hier mentale oder assoziative Karten nennen wollen, bieten demgegeniiber eine personliche, emotionale oder kiinstlerische Sicht abstrakter Daten oder Informationen ohne Aquivalent in unserer physikalischen Realitat - eine spezifische, subjektive Interpretation unseres Lebens. Die kiinstlerische Forschung auf diesem Gebiet geht iiber eine sexy Verpackung abstrakter Inhalte weit hinaus; sie bietet vielmehr oft eine kritische Sicht auf die Nutzung des Internets und seines Potenzials jenseits einer Extrapolation der Realitat, wie wir sie kennen.
Kiinstler und Kiinstlergruppen haben in den letzten Jahrzehnten an Projekten gearbeitet, die das Potenzial vernetzter Umgebungen unter-suchen - zum Aufbau von Gemeinschaften, fiir Systeme des Wissens-austauschs und als Instrumente, mit denen giinstige Bedingungen fiir soziale Kohasion untersucht werden konnen. Zudem wurden die Ver-bindungen und Beziehungen zwischen vernetzten Umgebungen und physischer Realitat erforscht. Daher war unter Kiinstlern, Designern und Architekten die Frage von Netzwerken als Erweiterung stadtischer oder offentlicher Raume ein verbreitetes Thema fiir Forschung und Dis-kussion. Unterschiedliche Foren und Online-Diskussionsexperimente wurden genutzt, um die verschiedenen Realitaten zu verbinden und neue Moglichkeiten fiir soziale Prozesse und Designmethoden zu er-kunden. Die meisten dieser »Typen« friiher Internetarbeiten sind im Atlas of Cyberspace^ von Martin Dodge und Rob Kitchin beschrieben und in dem von Noel Douglas, Geert Strengholt und Willem Velthoven herausgegebenen Website Graphics Now ^ abgebildet.
1 Martin Dodge / Rob Kitchin, Mapping Cyberspace, London / New York 2001, 2 Dies., The Atlas of Cyberspace, Harlow / New York 2001. 3 Noel Douglas / Geert Strengholt / Willem Velthoven (Hgg.), Website Graphics Now, New York 1999.

Interdisziplindre Praxis 21
Kontextualisierung
Wenn man sich die kiinstlerische Forschung auf diesem Gebiet naher ansieht, so fallt auf, dass dem Thema der Kontextualisierung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird: dem flexiblen Spiel der Bedeutungen, der Metadaten und ihrer fiir die Zwecke der Kommunikation relevan-ten (Neben-)Wirkungen. Dies bringt eine kombinierte oder gemorphte Forschungsmethode mit einer starken Betonung auf standigem Wandel und Flexibilitat mit sich, die von verschiedenen Bereichen wie Linguis-tik, Philosophie, Biologie, Systemtheorie usw. beeinflusst ist. Dieser standige Fluss erfordert ein gewisses Mafi an Offenheit innerhalb des jeweiligen Rahmens. Fiir viele Kiinstler und Designer war die Theorie autopoietischer^ oder selbstorganisierender Systeme eine Hauptquelle der Inspiration fiir die Gestaltung dieser gerahmten Offenheit. Die auto-poietische Theorie hat ihre Wurzeln in der Biologie und beruht auf dem Konzept selbstorganisierender Mechanismen, die innerhalb einer geschlossenen und insofern vorbestimmten Organisationsstruktur ab-laufen. Uber die Jahre sind verschiedene Varianten von Autopoiesis in der Systemtheorie sowie in sozialen und Organisationsmodellen ange-wendet worden. Fiir Partizipationsumgebungen bietet sie eine Theorie und einen Rahmen fiir ein halb offenes Gemeinschaftsmodell, in dem die Schranken oder Grenzen vom Kiinstler oder Designer vorher defi-niert werden. Dieses Modell beinhaltet zwei sehr interessante Themen: Flexibilitat und eine prominente Rolle der Teilnehmer. Die Reorganisation des Inhalts fiihrt Optionen fiir Rekontextualisierung ein, wahrend eine flexible Struktur Moglichkeiten fiir eine dynamische Konstruktion von Bedeutung bietet. Im Laufe der Zeit wird die Bedeutung, die der Information hinzugefiigt wird (zum Beispiel durch neue Beziehungen und durch Spuren friiherer Aktionen), als sozialer Prozess konstruiert, der auf der Beteiligung und dem Engagement der (Online-)Teilnehmer beruht (Umberto Eco^). Eco betont auch die Bedeutung des Prozesses, des Unfertigen und des Unvorhersehbaren gegeniiber dem fertigen Er-gebnis oder Produkt.
4 Humberto R. Maturana / Francisco J. Varela, Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living, Dordrecht/Boston 1980; dies., The Tree of Knowledge, Boston/London 1987. 5 Umberto Eco, 77? Open Work, iibers. von Anna Cancogni, Cambridge MA 1989.

22 Anne Nigten
Die Rolle des Teilnehmers bringt uns auf eine andere Debatte, welche
die Interpretationen autopoietischer Theorie fiir soziale Systeme be-
trifft. Niklas Luhmann^ bezieht sich auf die interaktive Konstruktion
von Bedeutung, schliefit aber die aktive Partizipation der Teilnehmer in
seiner Theorie nicht mit ein. Loet Leydesdorff ^ unterscheidet in einem
sozialen Netzwerk zwei Schichten: ein Netzwerk von Ereignissen
und ein Netzwerk der Wahrnehmung dieser Ereignisse. Da aber alle
menschliche Interaktion Reflexivitat beinhaltet, wird es zwischen den
beiden Schichten einen standigen Feedback-Loop geben (strukturelle
Koppelung). Dies erfordert konsequenterweise eine doppelte Rolle des
Teilnehmers /Beobachters . An diesem Punkt unterscheidet sich Leydes-
dorffs Ansatz von Luhmanns Theorie, da er die Notwendigkeit sozialer
Aspekte (die von Menschen generiert werden) innerhalb der Kette der
Interaktionen betont.
»Wenn auf der Ebene des Netzwerkes Handlung der Kommunikation zugeschrieben wird, dann ist zu erwarten, dass dieses Referenzsystem seine eigenen Dynamik hat. Die Dynamik der Interaktionen, so nimmt man an, selbstorganisiert die Rollen, die den Handelnden zugeschrieben werden. Die Handelnden tragen das Netzwerk an den Knotenpunkten, wahrend die Verbindungen des Netzwerkes eine Architektur liberspan-nen, die mit Blick auf ihre rekursiven Interaktionen zusatzliche Kom-plexitat entwickelt. Die Architektur der Beziehungen kann als Struktur angesehen werden, welche die erwartete Information der weiteren Ent-wicklung des Netzwerkes enthalt.«^
Die prominente Rolle der Teilnehmer als Koautoren bringt sehr spezi-
fische Entscheidungen in Bezug auf die Mechanismen mit sich, die eine
konstruktive Zusammenarbeit der Teilnehmer stimulieren, wahrend sie
gleichzeitig ausreichend Opt ionen fiir eine gewisse thematische Koha-
renz zwischen den Objekten zulassen, um das Erzeugen von Bedeu
tung zu ermoglichen. Diese flexiblen Prozesse beinhalten weitere inter-
essante, wenn auch komplexe Forschungsthemen, wie zum Beispiel die
Frage, wie ein Rahmen entworfen werden kann, der die richtige Menge
an Freiheit bietet, die vitale Infrastruktur fiir eine von unten her auf-
gebaute Organisation, wahrend er zugleich die erforderlichen Aspekte
6 Niklas Luhmann, Soziale Systeme: Grundrifi einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main 1984. 7 Loet Leydesdorff, »Luhmann, Habermas, and the Theory of Communication*, in: Systems Research and Behavioral Science 17/3 (2000), S. 273-288. 8 Ders., »>Structure</>Action< Contingencies and the Model of Parallel Distributed Processing*, m: Journal for the Theory of Social Behaviour 23 (1993), S. ^7-77.

Interdisziplindre Praxis 23
von Schutz, Vertrauen und (thematischem) Kontext beriicksichtigt. Die Gestaltungsprobleme umfassen hier grofiere Themen, welche so-ziale Aspekte, die Konstruktion von Gemeinschaften und den Bau von Systemen ins Spiel bringen. Keine dieser Fragen kann unabhangig von den anderen beantwortet werden. Man konnte sich die Moderations-und Kontrollaspekte ansehen, die in der Architektur der Software, dem Interface, der Struktur der Metadaten und ihrer Visualisierung enthal-ten sind.
DataClouds
Wenden wir uns von hier aus einem praktischen Beispiel zu: den Data-Cloud-Projekten,^ die seit 1998 im V2_Lab,^° einem internationalen Forschungsinstitut im Bereich der digitalen Medien in Rotterdam, rea-lisiert werden. Wir betrachten sie als Fallstudien fiir die Untersuchung von experimentellen Gemeinschaftsprojekten, die sich mit Fragen sozia-ler (Selbst-)Organisation in nicht zielorientierten Onhne-Umgebungen befassen.
DataCloud i.o, auch als DataWolk Hoeksche Waard^^ (DWHW) bekannt, ist ein Projekt von ArchiNed, der Architect International Research Foundation und dem V2_Lab in Zusammenarbeit mit der Provinz Zuid-HoUand im Rahmen der AIR Southbound Konferenzen und Workshops. DataCloud i.o war eine experimentelle Internetseite iiber das Landschaftsdesign fiir die Insel Hoeksche Waard in ihrer Be-ziehung zur Randstad und zur Rhein-Scheldt-Miindung. Die Seite war fiir Designer, politische Entscheidungstrager, Verwaltungsbeamte, Be-wohner der Gegend um Rotterdam und andere interessierte Parteien gedacht. In DataCloud konnte sich jeder an der Diskussion iiber die Qualitaten einer Landschaft in Bezug auf Urbanisierung und Mobilitat beteiligen. Auf der Webseite von DataCloud 1.0 sammelten Designer, politische Entscheidungstrager und Einwohner Daten. Diese Informa-tionen betrafen spezifische Orte auf der Insel Hoeksche Waard. DataCloud 1.0 untersuchte und dokumentierte die physischen und nicht-physischen Kontexte der Hoekschen Waard sowie ihre wechselseitigen Beziehungen und machte diese Informationen durch die Anwendung
9 http://lab.v2.nl/projects/datacloud2.html 10 http://www.v2.nl 11 Die archivierte oder »eingefrorene« Version findet sich auf www.dwhw.nl

24 Anne Nigten
von Methoden und Techniken zuganglich, wie sie fur vernetzte Digital-medien spezifisch sind. DataCloud i.o fiihrte zu einer Sammlung von »weichen« Informationen, die wir eine mentale Karte der Region nann-ten. Erstellt von den Teilnehmern zeigte sie eine Sammlung person-licher, ortsspezifischer Archive/^
Publikumsbeteiligung
Das Beispiel von DataCloud i.o zeigt, dass der Inhalt dieser Art von Partizipationsumgebungen vom Input der Besucher und Mitschopfer abhangt. Das halb offene System von DataCloud i.o bot den Teilnehmern verschiedene Stufen, um unterschiedliche RoUen zu spielen oder gemafi vielfaltigen Hermeneutiken zu agieren/^ Randall Whitaker sieht in diesem Ansatz eine Alternative zu Luhmanns Analyse von Autopoie-sis und sozialen Systemen. Der Ansatz von DataCloud identifiziert die Teilnehmer als die essenzielle Ressource fiir die »Organisation«.^'^ Die Teilnehmer als zentrale »Komponente« zu behandeln bedeutet, seine Hauptaufmerksamkeit den Fragen der Interaktion und dem Problem eines weichen Ubergangs im Wechsel zwischen dem Modus eines Besu-chers und dem eines Koautors zuzuwenden. In DataCloud i.o konnten drei Levels der Interaktion und Partizipation unterschieden werden: Der Besucher betritt die Umgebung auf dem Standardlevel der Interaktion, welcher verschiedene Modi zur Betrachtung von Inhalt und Metadaten bietet sowie Moglichkeiten zur Reorganisation der gesamten Wolke. Der »herangezoomte« Modus - der nachste Level der Interaktion - bietet den ersten Schritt eines wirklichen Engagements, indem man eine Reaktion auf das Objekt eines anderen hinzufiigen und Gruppen von Objekten, die andere Teilnehmer platziert haben, zusammenstellen kann. Von dort aus kann der Besucher in einen proaktiven Modus wechseln und zu einer Schliisselfigur in Debatte und Austausch werden sowie Verbindungen (Kontext) zwischen verschiedenen Informationen schaff en. Von hier aus wiederum kann der Teilnehmer sich auf die dritte, auf die komplexeste
12 Leicht veranderte Version des vom DataCloud-Team geschriebenen Textes: http:// lab.v2.nl/projects/dwhw.html 13 Mehr Information zur Implikation der Teilnehmerrollen bei Leydesdorff (wie Anm. 7). 14 Randall Whitaker, »Autopoietic Theory and Social Systems: Theory and Practice*, in: http://www.acm.org/sigois/auto/AT&Soc.html

Interdisziplindre Praxis 2 5
Interaktionsebene begeben, auf der man neue Objekte und Gruppen einfiigen kann. Auf dieser Ebene wird der Teilnehmer zum Mitschop-fer, zum Mitbetelligten und bestimmt die Menge und Art der Infor-mationen in dieser Umgebung. Die zentrale Rolle der Teilnehmer in DataCloud wurde in eine Forschungs- und Entwicklungsmethode um-gesetzt, die vom Partizipationsdesign als Ansatz fiir Bewertung, Ge-staltung und Entwicklung von Online-Systemen inspiriert ist. In dieser Designmethode sind die Teilnehmer zentral an den Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt. Partizipationsdesign wird heute auf eine Vielzahl von Designdisziplinen angewendet. Auf Grund der kom-merziellen Popularitat, die Partizipationsdesign in letzter Zeit geniefit, mag es einem merkwlirdig vorkommen, es als Kunstpraxis zu betrach-ten. Es gibt jedoch eine Reihe von Sichtweisen in diesem Ansatz, die fiir den Typ von Projekten, die hier diskutiert werden, relevant sind. Zum Beispiel:
»Ein >System< ist mehr als eine Sammlung von Software in Hardware-boxen. Im Partizipationsdesign betrachten wir Systeme als Netzwerke von Menschen, Praktiken und Technologien, die in spezifische Organi-sationszusammenhange eingebettet sind.«^^
Dies ist einer der relevanten Ausgangspunkte der Methodologie von Partizipationsdesign. In den verschiedenen Forschungs- und Entwick-lungsprozessen von DataCloud wurden sowohl die theoretischen wie auch die praktischen Aspekte getestet und als Feedback in den Design-prozess zuriickgegeben. Wahrend des Designprozesses von DataCloud i.o im Jahr 1998 bestanden die Partizipationsereignisse aus praktischen Workshops, die Lernmaterial sowohl fiir die Teilnehmer (Wie benutzt man diese Anwendung?) wie auch fiir die Entwickler (Feedback aus den friiheren Tests) bereitstellten. Auf Grund der damals beschrank-ten Anzahl von Internetverbindungen wurden offentliche Bibliotheken und ein tourender Cyberbus benutzt, um Menschen zu erreichen und ihnen das Projekt vorzustellen, was dann wiederum Teil des standigen Feedback-Kreises fiir das Team war. Hier sollte erwahnt werden, dass es in diesen Fallen, wie sich herausstellte, schwierig war, die Leute an dem Work-in-progress zu beteiligen, da parallel zu der fertigen Anwendung ein funktionierender Prototyp benotigt wurde - ein hypothetischer Luxus angesichts der Deadlines in einer hochexperimentellen Umge-
15 http://www.cpsr.org/program/workplace/PD.html

26 Anne Nigten
bung. Partizipationsdesign enthalt niitzliche Elemente fiir einen Dialog, der zukiinftige Teilnehmer und Koautoren umfasst, welche fiir das Wachstum und die Relevanz des Inhalts verantwortlich sein werden.
Nach der Beschaftigung mit den drei Ebenen von Interaktion und Engagement in DataCloud i.o konzentrierte sich die weitere Forschung an DataCloud auf einige der Hauptthemen, die fiir eine verbesserte Publikumsbeteiligung als relevant erachtet wurden. Dabei war die Ver-schiebung von der dritten zur ersten Person eine zentrale Herausforde-rung. Die Gesamtansicht von DataCloud begann aus der Perspektive einer »dritten Person«. Der Computerbildschirm funktionierte wie der Sucher einer Kamera, durch den Objekte betrachtet werden konnten. Der Benutzer befand sich durch die Nutzung von Kamerafunktionen wie Zoom, Fahrt, Schwenk und Panorama in standiger Interaktion. Ko-autorschaft an der dynamischen Karte von DataCloud ware aus einer Perspektive der dritten Person oder vom Standpunkt eines Betrachters aus in diesem Operationsmodus - der aus Spielen, Flugsimulatoren und 3D-Panoramen vertraut ist - nicht moglich gewesen. Die Verschiebung vom Beobachter zum Koautor und Interaktionsteilnehmer war nun eine bewusste Entscheidung. Edition und Koautorschaft an DataCloud erforderten eine Perspektive der ersten Person. Die Verschiebung von dritter zu erster Person konnte als eine Erweiterung der raumlichen und zeitlichen Navigation zum Zweck eines personlichen Involviertseins verstanden werden. In der aktuellen Phase des Projekts (DataCloud 2.5) wird eine Verbindung zwischen dem Teil, in dem Autorschaft moglich ist, und den 2D-Ebenen entworfen. Ein fliissiger Perspektivenwechsel konnte alle Interaktionen unterstiitzen. Ein einfacher Mechanismus ermoglicht das Durchsuchen und Erkunden des Inhalts, und ein Set von Media-ControUern erleichtert das Editieren und Hinzufiigen von Inhalt. Dies wird wahrscheinlich zu einer Mischung von Mechanismen fiihren, die einerseits aus alteren Medien (Film, Photographic) und ande-rerseits aus neuen Medien bekannt sind, welche keine Entsprechung in der physischen Welt haben. Die Mischung der Medien und der mit ihnen zusammenhangenden PublikumsroUen wird entsprechend ihrer intrinsischen Charakteristika und Moglichkeiten behandelt und nicht auf Grund einer Extrapolation bestehender oder bekannter Umgangs-formen mit Medien.

Interdisziplindre Praxis 2 J
Werkzeuge und Instrumente
fiir den Umgang mit Interfaces
Der Ansatz von DataCloud 2 war starker instrumentell, was zum Teil an
der Na tu r des Inhalts, den geografisch weiter verstreut wohnenden Teil-
nehmern und den Archiv-Aspekten lag. DataCloud 2 beschaftigte sich
mit der »Genetik der Wilden Stadt«, einem Themen- und Informations-
austauschkonzept der Stealth-Gruppe.^^ Die Forschung befasst sich mit
dem heutigen Belgrad aus einer architektonischen Perspektive:
»Das Forschungsprojekt >Genetik der Wilden Stadt< untersucht eine Stadt in der Krise - ein komplexes und instabiles Gelande, auf dem die Regeln der Produktion urbaner Substanz und die Logik urbaner Vitalitat standig neu erfunden werden. [...] Die Forschung geht von der Realitat von Belgrad aus, der Hauptstadt Jugoslawiens mit einer Bevolkerung von zwei Millionen Menschen. Belgrad ist eine Stadt, die als Ergebnis eines Jahrzehnts der Krisen vor kurzem einen abrupten Wechsel von zentralisiertem zu atomisiertem Wachstum erfahren hat. Der Ausloser fiir die Metamorphose der Stadt war das Embargo der Vereinten Natio-nen im Jahr 1992, inmitten einer Atmosphare von Kriegstrauma, Medien-obsession und Politisierung. Wahrend die Planungsinstitutionen der Stadt in dieser Periode ihre Macht verloren, begannen Privatinitiativen die Kontrolle iiber neue Entwicklungen der Stadt zu iibernehmen. In diesem Zusammenhang fiihrte die solchermafien losgetretene Lawine von privaten Initiativen wie eine Kompensation fiir den Kollaps von Staat und Institutionen zu Innovation in buchstablich jedem Bereich der Stadt, von der Industrie iiber den Immobilienbau bis hin zu den offent-lichen Diensten. Eine neue, unregulierte Struktur entstand, die den offentlichen Raum iiberflutete und sich wie eine Schicht von Mutanten iiber die bestehende Stadt legte.«^7
Das Projekt DataCloud 2 zielte darauf ab, neue Formen spontaner Ar-
chitektur oder dynamischer Designprozeduren zu ermoglichen. Die
Intentionen des Projekts bestanden nicht darin, Realitat zu ersetzen,
sondern die (technischen und sozialen) Charakteristika jedes spezifi-
schen Mediums miteinander zu verbinden. Der instrumentelle Aspekt
und der damit verbundene Mehrwert fiir die verteilte Kommunikat ion
gehoren zu den von Stealth untersuchten Merkmalen. Dies weist einige
16 Stealth-Gruppe: Ana Dzokic, Milica Topalovic, Marc Neelen und Ivan Kucina. http://www.stealth-g.net/ 17 Text von der Steakh-Gruppe und dem DataCloud-Team von V2_.

28 Anne Nigten
Parallelen mit dem Ansatz von Knowbotic Research auf: »An Stelle eines Eintauchens in eine abgetrennte, separate Umgebung versuchen wir bewusst, das Oszillieren zwischen den Aktionsfeldern des realen urbanen Raums und denen des Datenraums zu erhohen.« ^ Beide Heran-gehensweisen befassen sich mit der Uberschneidung und dem standigen Austausch zwischen den beiden ReaHtaten, an denen wir teilnehmen, und nutzen das beste beider Welten als Erweiterung unserer sozialen Netzwerke fiir Kreation und Austausch.
Wie in den DataCloud-Projekten gezeigt wurde, verlangt die aktive Beteihgung des Besuchers ein Design, das nicht mehr fixiert oder vor-bestimmt ist, sondern in dem der Rahmen vielmehr als Werkzeug oder Instrument funktioniert. Systemarchitektur, (Interaktions-)Design und Fragen der Moderation sind ganzhch miteinander verflochten. Ein rela-tiv komplexes Set von Forschungsthemen muss gleichzeitig angegan-gen werden. Im RiickbUck ist es interessant zu sehen, wie verschiedene Kiinstler und Forschungsgruppen mit den Werkzeugen umgegangen sind, um zu diesen neu definierten Problemen und Chancen zu gelangen. Knowbotic Research^^ zeigten in ihren Projekten^° verschiedene Heran-gehensweisen, die als Inspirationsquelle fiir die friihen Ideen der Data-Cloud-Reihe dienten.
Ted Kriiger erlauterte in seinem Eroffnungsvortrag fiir den Data-Cloud-Workshop bei NiJ-^ die verschiedenen Perspektiven, die in der Forschung an solchen werkzeugahnlichen Rahmen enthalten sind:
»Herbert Simon postuliert in Sciences of the Artificial zwei Arten von Wissenschaften: die >naturlichen< und die >artifiziellen<. Natiirliche Wissenschaften wie Physik, Chemie und Biologic suchen die Welt zu verstehen, >so wie sie ist<. Ihre Aufgabe ist grundlegend deskriptiv und analytisch. Sie hat es mit Denken zu tun. Die Wissenschaften des Artifi-ziellen hingegen - Wirtschaft, Ingenieurswesen, der gesamte Bereich des Design zum Beispiel - beriicksichtigen in erster Linie die Welt, >wie sie sein sollte<. Ihre Aufgabe ist propositional und synthetisch. Sie beschaf-tigt sich hauptsachlich mit Tun, mit Intentionalitat.
18 Knowbotic research + cF, »The Urban as Field of Action«, in: V2_: TechnoMorphica, hg. von Joke Brouwer und Carla Hokendijk, Rotterdam 1997, S. 63. 19 http://www.krcf.org/krcfhome/ 20 Zum Beispiel Knowbotic Research, »IO_dencies«, in: http://www.krcf.org/krcf-home/IODENS_SAOPAULO/lIOdencies.htm 21 Den gesamten Text des Eroffnungsvortrags von Ted Kriiger findet man auf http:// www.dwhw.nl/help/frameset_acht.html

Interdisziplindre Praxis 29
Diese inharenten Unterschiede erf ordern unterschiedliche Ausstattun-gen. Instrumentierung hangt mit Beobachtung und Beschreibung, also mit Aufzeichnungsgeraten zusammen, wahrend Instrumentalitat mit Handlung und Intention, also mit Werkzeugen zusammenhangt. Katego-rien wie >naturlich< und >artifiziell< gehoren einer Weltsicht an, die sich in der zeitgenossischen Kultur nur schwer aufrechterhalten lasst. Ihr Ge-brauch hier heifit nicht, dass dieses Verstandnis gutgeheifien wird, son-dern es ist vielmehr ein Rahmen, innerhalb dessen wir verstehen konnen, auf welche Weise sich verschiedene Haltungen gegeniiber dem Gebrauch von Informationen entwickelt haben und welche Arten von Erwartun-gen an DataCloud herangetragen werden konnten.«
Forschungsmethodologien
Die in diesem Text erwahnten experimentellen Netzwerkprojekte wur-
den alle in einem interdisziplinaren Kontext entwickelt. Wie wir wis-
sen, bringt dies Herausforderungen, Inspirationen und Frustrationen
mit s ich/^ Der Text streift nur ein kurzes Set von Forschungszielen, wah
rend in Wirklichkeit deutlich mehr Probleme wissenschaftlicher und
technischer Art sowie Probleme des Inhaltsmanagements gelost werden
mussten. Aber das Material, das ausgebreitet wurde, deckt genug ab, um
zu verstehen, dass ein Hybr id von Forschungsansatzen und -methoden
angewendet wurde, und wichtiger noch, dass es keine wirkliche Metho-
denkoharenz gab. Wenn man von der Perspektive einer spezifischen
Disziplin aus analysiert, wie diese Projekte erforscht und entwickelt
wurden, kann einem die Arbeitsmethode seltsam oder chaotisch vor-
kommen. Leider stellt sich das in praktischer Hinsicht haufig als p ro -
blematisch heraus. Der Wert kiinstlerischer Forschung liegt jedoch oft
in einer Re-Kombinat ion oder Re-Interpretation bestehenden Wissens
oder bekannter Methoden. Wenn wir uns den Ansatz von DataCloud in
Bezug auf verschiedene Versionen selbstorganisierender Prinzipien an-
sehen, so kann man sagen, dass er zu den Diskussionen um Luhmanns
Theorie^^ in Bezug auf formale Elemente und die Konstrukt ion von Be-
deutung durch die Autopoiesis menschlicher Interaktionen quersteht.
22 Mehr zu Fragen der Kollaboration siehe in Anne Nigten, »Human Factors in Multi and Interdisciplinary Collaborations*, 2002, in: http://lab.v2.nl/resources/index. html#papers 23 Eine Zusammenfassung dieser Diskussion findet sich bei Leydesdorff (wie Anm. 7) sowie bei Whitaker (wie Anm. 14).

30 AnneNigten
Theorie und Praxis tauschen standig ihren Ort, mal als fiihrende Inspi-rationsquelle, mal als Referenz fiir Bewertung oder Rechtfertigung. Reinterpretationen oder Missverstandnisse von »nutzlichen« oder inter-essanten Elementen aus einem weiten Bereich, der Systemtheorie, Geis-teswissenschaften und Designpraxis umfasste, wurden miteinander ver-mischt und zu einem neuen oder hybriden Wissensbereich kombiniert. Dieses Verkniipfen ist eines der charakteristischen Merkmale kiinstleri-scher Forschung, da es Raum fiir spannende Experiment bietet/"^ Experiment und Innovation in interdisziplinarer Kollaboration entspringen oft einer Bandbreite von Forschungsprogrammen, die von den Team-mitgliedern eingebracht werden. Anders als der Grofiteil sonstiger Forschung und Entwicklung zielt diese interdisziplinare Forschung nicht auf Problemlosung oder aufgabenspezifische Anwendungen ab, son-dern konzentriert sich stattdessen auf Publikumsbeteiligung, durch die sie wertvoUe neue Einsichten in medienbasierte soziale Interaktion und Benutzererfahrungen generiert. Wenn man sich an die erwahnten Ansatze von DataCloud i.o im Bereich Design und Benutzertests er-innert, so entdeckt man darin Spuren aus der Ethnografie (Studium von Gemeinschaften und Interaktionen) und der symbolischen Interaktion (Erschaffen von Bedeutung durch Interaktion), kombiniert mit quanti-tativer Datensammlung, obwohl keiner dieser Ansatze allein auf diese Situation gepasst hatte. Im Cyberbus gab es beispielsweise nur einen kurzen Moment der Beobachtung, und die Verwendung von offent-lichen Terminals machte es in DataCloud i.o nur noch schwieriger, Daten fiir eine Analyse der Aktionen der Teilnehmer iiber einen lange-ren Zeitraum hinweg zu gewinnen. Zudem war das Projekt wahrend seiner ganzen Dauer von einer physisch stattfindenden Konferenz, einer Debatte und einem Workshop begleitet, welche die Aufmerksamkeit der Teilnehmer in Anspruch nahmen und das Projekt fiir sie dringend und verstandlich machen soUten. Obwohl sich diese Projekte oft als technische Herausforderungen herausstellten, kann man auf einer theo-retischen Ebene aus dieser Art von Experimenten eine eindrucksvolle Materialsammlung gewinnen. Obwohl sie nicht ausschliefihch aus der Perspektive einer einzelnen Disziplin bewertet werden sollten, konnte hier ein enorm reicher Diskurs konstruiert werden, der sich aus dem Wissen der Medienkiinste, der Informatik, des Design, der Ethnografie
24 Vgl. Anne Nigten, »Tunnels, Collisions and Connections*, 2003, in: http://lab. v2.nl/resources/index.html#papers

Interdisziplindre Praxis 31
und der kritischen Theorie speist. Dies kann als Einladung an Spezia-listen im Bereich der Kulturwissenschaften und der kritischen Theorie verstanden werden.
(AHS dem Englischen von Benjamin Marius Schmidt)

Marie-Jose Mondzain
Die Angst im Bild Aspekte der Herrschaft mit Hilfe von Bildern
Das Thema liefie sich mit folgendem Satz umreifien: In einer Welt, in der die Angst herrscht oder vielmehr die Angst die Herrschaft iibernommen hat, wird die Medienindustrie, die ich heber Industrie des Visuellen nen-nen mochte, zum Verwaher und Hersteller von Angst. Der Begriff des Bildes soil im Folgenden nur fiir Modifizierungen von wahrnehmbaren Erscheinungen der Welt gelten, die Teilnahme gestatten und auf Herrschaft verzichten.
Zwei Formen der Herrschaft mit Hilfe der Angst sind zu unterschei-den, sie haben ahnliche Auswirkungen, auch wenn sie historisch ge-trennt auftraten. Die eine nenne ich Phobokratie, das heifit Herrschaft der Angst, die sich auf die Bilder stiitzt und sich ihrer bedient, um ihre Macht zu errichten. Die andere nenne ich Ikonophobie oder die Angst vor der Herrschaft des Bildes, die sich auf die von ihm ausgehenden Ge-fahren stiitzt und ihm sogar die Macht zuschreibt, genauso gefahrlich zu sein wie die realen Gefahren, die uns bedrohen. Alle beiden Regimes der Furcht sind von dem Willen geleitet, zu herrschen oder herrschen zu lassen. In einem Fall beansprucht die Macht das Monopol iiber das Visuelle und die Kontrolle der Emotionen, im anderen Fall wird jede Herrschaft des Visuellen verteufelt, um die unsichtbaren Diktaturen der Gottheit, des Buchs oder der Vernunft zu errichten. Doch Angst und Bild wirken jedes Mai gleich, namlich im Sinne einer Auffassung von Macht, die auf der Aneignung des Wahrnehmbaren durch den Herrscher basiert. Diesen beiden Diktaturen der Angst, die das Bild nur in Begrif-fen der Macht sehen, einer Macht, die das Bild ausiibt, oder einer Macht, die iiber das Bild ausgeiibt wird, mochte ich ein anderes Regime gegen-iiberstellen: Es gilt, das Bild zu begreifen als etwas, zu dem Mut gehort, und seine konstituierende Kraft in der Konstruktion von Intersubjekti-vitat zu erkennen. Erscheint es doch notwendig, sich der beschriebenen
33

34 Marie-Jose Mondzain
doppelten Herrschaft der Angst zu widersetzen und Zeichen hervor-zubringen, die es uns erlauben, das Ungesicherte und Buntschillernde der Erscheinungen der Welt miteinander zu teilen. Anders ausgedriickt soil nachgewiesen werden, dass das Bild allein keine Herrschaft aus-iibt. Ob man die Bilder herrschen lasst, ob man mit ihrer Hilfe herrscht oder ob man sie ausschaltet, indem man mit Drohung und Angst vor ihnen herrscht, all diese Machtregimes lassen die Kraft der Bindungen verschwinden, die iiber das Visuelle zwischen begehrenden Subjekten entstehen, das heifit Subjekten, die sprechen und sich Bilder machen, die imaginieren. Eben weil das Bild keine Herrschaft ausiibt, kann es als wesentlich fiir die Konstitution der Menschheit begriffen werden.
I Die Phobokratie oder die Herrschaft der Angst mit Hilfe der Bilder
Es ist nicht iiberraschend, dass heute die Bilder unter dem Gesichtspunkt der Angst zu betrachten sind, da wir in einer Welt leben, die von Bildern iiberflutet wird und in der die Angst dominiert. Die Angst ist zu der am weitesten verbreiteten Form des Sozialen geworden, nach meiner Einschatzung tendiert sie sogar dahin, als soziales Bindeglied zu wir-ken und den Platz aller anderen Formen solidarischen Debattierens und Wirkens einzunehmen. Die Angst halt zusammen, und die am hochsten entwickelten Formen der Macht sind Phobokratien geworden, um ein-mal diese Wortneuschopfung fiir die Verbreitung koUektiver Angst zu verwenden. Gemeinsam Angst zu haben fiihrt zu der Illusion, gleicher Meinung zu sein und daher in der gleichen Welt zu leben. Zusammen-leben reduziert sich schliefilich darauf, zusammen Angst zu haben. Die Ereignisse vom i i . September 2001 in New York dienen im Moment als Paradigma fiir die Verschmelzung aller unter dem Zeichen des Terrors und fiir die Legitimation jeghcher Gewalt unter der Vorgabe der Not-wehr.
Angst benotigt die Reprasentation, denn sie nahrt sich allein aus vor-weggenommenen Vorstellungen und von der Spannung vor dem Affekt des Schreckens. Darin unterscheidet sie sich von der Panik, die mit dem Verschwinden jeglicher Reprasentation und dem Scheitern jeglicher Symbolisierung einhergeht. Andererseits blockiert die Reglosigkeit in der Schau des Angstauslosenden ebenfalls die Fahigkeit zur Symbolisierung beim sprechenden Subjekt; es handelt sich um ein stummes

Die Angst im Bild 3 5
Schauen. Wer die Angst herrschen lassen will, um mit ihrer Hilfe selbst zu herrschen, schiitzt die Gemeinschaft vor der Panik, gibt jedoch keine Hilfestellung bei der Symbolisierung, das heifit bei der Reprasentation. Zeigen ist nicht reprasentieren, und die Zurschaustellung des Terrors kann ihrerseits zum terroristischen Akt werden, da seine Gewalt die Fahigkeit des Subjekts zu sprechen und zu denken angreift. Ich wahle daher die Bezeichnung Phobokratie fiir die Industrie der Zurschaustellung des Schreckens, die strategisch zur Rechtfertigung von Polizeistaat und Krieg eingesetzt wird.
Wir kommen nun zu der Verbindung zwischen diesem System - es handelt sich um ein systematisches Biindel von Mafinahmen, die kol-lektiven Pathos verwenden - und den Bildern.
Mit der Angst zu herrschen heifit, Bilder zu produzieren, die dem schauenden Subjekt die Kontrolle liber die Wirkhchkeit entziehen, die es sieht. Die Angst basiert also auf der Ohnmacht des Einzelnen, von der die visuellen Strategien ausgehen. Anders formuliert ist zu vermuten, dass dies, was ich als System bezeichne, sich methodisch nur iiber eine besondere Behandlung des Visuellen konstruieren kann, und zwar iiber eine Industrie des Visuellen, die in den Dienst der Angst gestellt ist.
Angesichts von Bildern, die gewollt oder ungewollt Angst erzeugen, konnte man sich vorstellen, dass die Angst der Bilder nur eine vermit-telte Angst ist, namlich die Angst davor, Bilder zu sehen, die furchterre-gend sind. Auf diese Weise fiirchtet etwa die so genannte Erwachsenen-welt die Zurschaustellung von Bildern voll Gewalt, da sie der jiingeren Generation Angst einflofien konnten. Die Erwachsenen haben Angst vor Bildern, die den Kindern Angst machen. Wenn es aber eine Verbindung zwischen der Furcht vor den Bildern und ihrem furchterregenden Inhalt gibt, wie erklart sich dann, dass die Uberflutung mit Bildern, die Angst auslosen, ihre Ubermacht, den eintraglichsten Markt innerhalb der Industrie des Visuellen darstellt?
Wie konnten die Machtigen auf diese Bilder bauen, um polizeiliche und militarische Gewalt zu rechtfertigen, wenn sie nur Abscheu her-vorrufen wiirden? In diesem Fall wiirden sie nicht mehr betrachtet, sie wiirden iiber eine Derealisierungsreaktion all ihre rhetorische Wirksam-keit verlieren.
Die dem phobokratischen Markt innewohnende Ambivalenz ist in ihrer ganzen Perversitat zu Tage getreten, als die Erniedrigungen der irakischen Gefangenen angeblich unkontroUiert verbreitet wurden. An diesem Fall wurde offensichtlich, es gibt eine Industrie der Angst,

36 Marie-Jose Mondzain
eine politische Steuerung der hervorgerufenen und aufrechterhaltenen Angste, und diese Industrie ist zumeist mit Erotik aufgeladen.
Es ist hier allerdings zu unterstreichen, dass es die Kirche war, die zuerst mit Bildern herrschte. Die visuellen Botschaften vom bildtrach-tigen Kult eines Gemarterten wurden zusammen mit der eindringlichen Verbreitung der Vorstellungen vom Bosen und der Holle politisch kon-struiert. Hierbei blieb auch die ambivalente Wirkung der Versuchung nicht ausgespart, denn die Ikonographie der Versuchung gestattet es, straflos alle Siindenfallen und ihre verfiihrerische Wirkung ebenso zu betrachten wie die Figuren des geistigen Widerstands dagegen. Die Erlosung bemisst ihren Wert nach der Gefahrlichkeit des bekampften Feindes. Gewalt und Schrecken waren die beliebtesten Werkzeuge einer Macht, die bereits versprach, die Heilmittel des Trostes und der Gnade mitzuliefern. Phobokratien fiirchten also nicht etwa die Bilder, die Angst erzeugen, sie wollen ihre Form und ihre Wirkung kontroUieren, indem sie das Regime von Schrecken und Lust mehr oder weniger ge-schickt manipuHeren. Die Bilder diirfen weder Abscheu noch Unglau-ben hervorrufen. Das bedeutet, diese Bilder miissen den Blick fesseln und im Gedachtnis haften bleiben. Sie miissen des Weiteren glaubwiir-dig sein und den Betrachter genau an die Schwelle jenes Zustands des Schreckens und der Ohnmacht bringen, der bei ihm wie bei einem Kind - dem Kind, das in jedem von uns steckt - ein Bediirfnis sich anzu-lehnen, ein Verlangen nach Schutz und Sicherheit auslost. Dazu ist es notwendig, dass die Betrachter des Bildes sich in einem Zustand ver-minderter Subjektivitat befinden, der sie in diesen archaischen, infan-tilen, vorsprachlichen Situationen halt oder wieder in sie hineinver-setzt. Wenn dem so ist, stellt sich die Frage, iiber welche Wege sich die Versetzung des Betrachters an einen solchen desubjektivierten Stand-ort bewerkstelligen lasst. Das Ziel der Phobokratien ist letztlich, jede Moglichkeit des Ausweichens auszuschalten, etwa die Herausbildung von Unterschieden nicht nur zwischen den Subjekten, sondern auch im Innern des Subjekts selbst. Das Individuum wird als ein Gebilde be-handelt, wie eine kompakte Substanz, eine Einheit, die fiir sich existiert. Dieses Kind ohne Sprache verliert seinen Platz, das heifit seine fragile Zuordnung zu einem Standort, an dem es sich selbst in der Zirkula-tion der intersubjektiven Zeichen begreift. Aus diesem Grund muss die Strukturierung der Zeitlichkeit beim Betrachter erschiittert werden, es muss das beeintrachtigt werden, was jedes Subjekt in die Geschichte und damit ins Sprechen einschreibt. Dies geschieht, indem eine unge-

Die Angst im Bild 3 7
brochene und ungeteilte Welt geschaffen wird, kurz, eine Welt ohne Andersheit.
Die Zeitstruktur der Angst enthalt eine antizipatorische Beschleuni-gung, der eine Synkope der Lahmung folgt. Dieses traumatisierende Regime der Impulse wird paradoxerweise mit dem Terminus Realzeit bezeichnet. Der Historiker Francois Hartog hingegen hat den Begriff des »Prasentismus« eingefiihrt, um die allgemeine Unfahigkeit zu einem Geschichtsbewusstsein zu bezeichnen, das Problem, dass sich das kol-lektive Gedachtnis immer um Angst und das Verlangen nach Sicher-heit dreht. Er sieht diesen »Prasentismus« im Zusammenhang mit dem neuen Kult des »nationalen Erbes«. Nichts zerstort die Zeit und die Dauerhaftigkeit des Sozialen mehr als die Industrie, die das bedrohliche Uberborden herstellt, da sie das Subjekt der Geschichte verschwinden lasst. Visuelle Informationen erscheinen als Objekte einer kontrahierten Realitat, die von Anfang bis Ende bezeichnend ist und alles einbezieht. Die Kontraktion der Zeit schliefit jede Moglichkeit der Reprasentation, einer Aufiensicht, aus, angefangen bei der des Betrachters selbst.
Die industrielle Verwertung der Angst steht aufierdem, und dies ist zu unterstreichen, in direkter Verbindung zur industriellen Verwertung des Todes. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert, das die extremsten politischen Formen der Bedrohung und Barbarei gegeneinander stellte. Die Naziherrschaft war eine schreckliche Form der Phobokratie und hat gezeigt, dass sie bei der Produktion dessen, was enthiillt und was verborgen wird, absolute Macht ausiiben konnte.
Im Grunde stellt jedes Bild die Frage der Trennung und des Todes. Es mahnt den Betrachter, zu leisten, was Freud mit Trauerarbeit bezeich-nete. Er pragte den Begriff im Zusammenhang mit der klinischen Be-handlung der Melancholie, im Jahr 1915, als Europa an der Schwelle eines grofien Verlustes stand. Hier sei darauf hingewiesen, dass nichts naher an der melancholischen Struktur liegt als das audiovisuelle Dis-positiv, das die Zeit anhalt und jede Dynamik der Fiktion in die Reg-losigkeit des »Fixierens« verwandelt. Auf dem Markt der Angst und der wiedergefundenen Sicherheit findet eine richtiggehende Verwertung der Impulse depressiver Zustande und anschliefiender euphorisierender Entlastung statt. Zu beobachten ist das Auftreten von Melancholie und eine halluzinatorische Zuflucht zum sozialen Gewebe einer zeitgenos-sischen Gemeinschaft, die zu alien psychischen Vorgangen der Trennung unfahig ist. Die Unfahigkeit zu trauern geht mit den Phantasmen der Verschmelzung einher, die bis an die Grundfesten dessen riihren.

3 8 Marie-Jose Mondzain
was verboten ist. Die Phobokratien sind inzestuose Gesellschaften, bei denen der Markt der Padophilie und der Pornografie Bliiten treibt.
Das Begehren ist zum Objekt unablassiger Vermarktung geworden, deren Beendigung allgemeine subjektive Fassungslosigkeit zur Folge hatte, ohne dass der Einzelne liber die Mittel verfiigt, um seinen Zu-sammenbruch zu gewartigen. Daraus ergibt sich folgendes Paradox: Die Bilder dessen, was bedrohlich ist, konnen antidepressiv wirken, ihr Konsum muss sich immer weiter steigern, der Entzug macht Angst, und eine Pause erschliefit die Moglichkeit, aktiv zu werden.
II Die Ikonophobie
Es war wohl der immer wieder drohende Zusammenbruch der Fahigkeit zur Symbolisierung beim sprechenden Subjekt, der die grojRen Lehren dazu bewog, die Herrschaft des Bildes zu zerstoren.
Es sind zwei exemplarische Falle zu nennen, die bis heute struktu-rell nichts von ihrer Kraft eingebiifit haben. Zum einen jener Fall, wo die Produkte des Visuellen als direkte Bedrohungen fiir das sprechende symbolbildende Subjekt in seiner Beziehung zur Transzendenz des Ge-setzes und zur Konstitution der Andersheit aufgefasst werden. Zum anderen der Fall, wo diese Produkte entwertet werden auf Grund ihrer Gefahrdung fiir die metaphysische Sicht des Seins und damit fiir die ontologische Beschaffenheit der Welt und der Wahrheit. Im ersten Fall findet man die Angst und die Verdammung der Gotzenbilder, im zweiten die Abwertung der Erscheinungen - der eidola, der phantas-mata - und all dessen, was der Phantasie oder der Wahrscheinlichkeit entspringt.
Es handelt sich also um zwei Ikonophobien, bei denen die Angst vor den Bildern untrennbar ist von einer Politik der Sicherheit, einer Polizei des Korpers und des Begehrens. So will das hebraische Den-ken das Subjekt vor den Gefahren der Gotzenanbetung schiitzen und das philosophische Denken die Subjekte vor dem Irrtum bewahren. Hier sollen diese beiden Haltungen nicht analysiert werden, sondern es gilt herauszufinden, welcher Art die Gefahr ist, die durch das Bild droht, das der Herrschaft Gottes oder der Wahrheit und der Vernunft im Wege steht. In beiden Fallen geht es darum, durch die Verteufelung der Bilder sich der Haltbarkeit der Bindungen zu versichern, die in der Gemeinschaft herrschen. Die Ikonophobie, die zu den Bilderverboten

Die Angst im Bild 39
und den bilderfeindlichen Vorschriften fiihrte, ist eine politische Position.
Diesen beiden grofien theoretischen Konstruktionen liegt eine bilder-feindliche Struktur zu Grunde, aber diese erhalt ihre Geltung nur aus der Fiktion einer disjunktiven Welt. Disjunktiv ist ein Regime zu nen-nen, das seine Geltung aus dem Ausschluss aller anderen bezieht. Bei den zwei Beispielen, namlich der hebraischen Theologie und der klas-sischen Metaphysik, kann die Reinheit des eidos nur zum Preis einer Blindheit aufrechterhalten werden, die ihren Trost in einer Rhetorik der blendenden Herrlichkeit findet. Um die Kraft und die Reinheit des Bildes zu verteidigen, erklart man es fiir unsichtbar und schliefit alle anderen Worter wahrnehmbarer Produktionen dafiir aus, weil sie das echte Bild verfalschen. Dies ist der springende Punkt: Da das Bild dem Wahren treu ist, kann es sein Antlitz nicht zeigen und sich nicht dem Blick aussetzen.
Dieses Verlangen nach Trennung, die den Zugang der Menschheit zu ihren Kraften der Symbolisierung konditioniert, durchzieht das ge-samte hebraische Denken. Zeichen zu geben heifit, an der Abwesenheit zu arbeiten. Die Angst sitzt an dieser Stelle, sie wendet sich sogar gegen die Grundlagen der sozialen Verfasstheit und der Zirkulation der Giiter und Personen in einer Verstandigungsgemeinschaft. Dabei zeichnet das menschliche Wesen gerade die Fahigkeit zur Sprache und Ansprache aus. Der Monotheismus erweist sich hier als eine Theologie der Bezie-hung, also der Abweichung und des Unterschieds, wahrend die ReUgio-nen des Bildes Kulte der Immanenz der miitterlichen Kraft, der Imma-nenz der Macht der Zeichen selbst sind. Das Bild ist agyptisch, es ist die Erde, die der Mensch verlassen muss. Wenn Gotzenbilder zerstort werden, geschieht dies, um zu zeigen, dass der Religion der Verhiillung nichts fremder ist als die den Dingen innewohnende Magie, die zum Animismus gehort. Das Bild dem Unbeseelten zuriickzugeben heifit fiir diesen Monotheismus, ihm jede Beziehung und damit jeden Sinn zu nehmen. In dieser Position der Disjunktion, wie ich sie nenne, werden die Subjekte angewiesen, welche Wahl sie treffen sollen, zwischen dem Zusammenleben in Unterschieden oder der todlichen Verschmelzung ohne Unterschied. Die Ikonophobie ist eine Angst, die die Panik vor der Kastration als Konsequenz aus der Lust an der Herstellung und am Kult der Bilder heraufbeschwort.
In dem Denken, das sich mit der Souveranitat des Seins befasst, hat die Frage des Bildes die Philosophen unaufhorlich beschaftigt. Mai

40 Marie-Jose Mondzain
wurde es verteufelt, weil es ins Vielfaltige zerstreut, wegen dieses Uber-mafies, von dem eingangs die Rede war, mal weil es die Erscheinung des Seienden herabsetzt, herabmindert. Die Kritik am Abbild als Her-absetzung des Seins oder an der Vielfalt als Unbestimmtheit des Seienden verlegt das Bild in den Bereich des Unmafies oder des Unbestimm-baren, das jeder Beherrschung und Regulierung entgeht und in keinem Fall zum Gegenstand eines Diskurses werden konnte, der das sichtbare Antlitz des Seienden bestimmt.
Eine unmogliche Beziehung ist definitionsgemafi das Scheitern des Logos, der daher bei Plato vor jeder Beziehung Disjunktion, bei Aristo-teles jedoch dialektische Artikulation ist: Die Angst ist die Leidenschaft am Grunde der Zusammenkunft im Theater, und die Zusammenkunft erhalt ihre Rechtfertigung aus der Behandlung dieser Angst selbst. Keine Angst vor den Bildern, ganz im Gegenteil, es wird das Phantasmati-sche heraufbeschworen und das Intime abgehandelt, vom Inzest bis zum Tod, mit Hilfe der Zurschaustellung des Wahrnehmbaren und des Affekts iiber den Weg oder die Stimme des Logos. Der Weg des Logos lost die Angst durch das Sprechen, die Stimme des Logos lost die Angst durch das Schauspiel der Korper der Schauspieler. Aristoteles bleibt zwischen diesen beiden Moglichkeiten unentschieden.
Ill Die christliche Okonomie der Versprechungen und der Angst
Das Christentum verlasst erstmalig das Regime phantasmatischer Angst und betritt komplexere Bereiche, in denen das Bild kein Gegenstand mehr ist, sondern Standort einer intersubjektiven Krise, bei der es weder um die Ewigkeit noch um die Wahrheit geht, sondern um die Frage der Zeithchkeit des Begehrens. Das Bild erzeugt nicht mehr Angst, im Gegenteil, hier wird es mit alien Ruhmestiteln gefeiert, die dem Triumph iiber das Nicht-Abbildbare, iiber den Inzest und den Tod zu verdanken sind.
Das christliche Denken hat eine dialektische Antwort auf die disjunk-tiven Situationen der Ikonophobie gefunden, indem es in seiner Bilder-freude ein Bild prasentiert, das nicht mehr herrschen, sondern befreien soil. Es wird aufgefasst als Matrix aller Verwertungen des Visuellen mit dem Ziel der Unterwerfung. Die Handlungen Christi, des Befreiers des Blicks, geben den Blinden die Sehkraft zuriick und den Frauen ihr

Die Angst im Bild 41
Blut, er nimmt sich die Macht des Mannes und des Sohnes, um Visuel-les herzustellen, das ratselhaft und daher nicht gotzenhaft ist. Daraus ergibt sich, dass die Frage des Gegenstands auf das Subjekt verlegt wird mit der Behauptung, was ein Bild qualifiziere, sei die Art des Blicks, der darauf geworfen werde. Die ganze Lehre von der Inkarnation lauft darauf hinaus, in einem Glaubenssatz festzulegen, dass die Inkarnation nichts anderes ist als die Bildwerdung Gottes.
Daraus folgt, dass das Bild zwar nicht Herrschaft ausiibt, dafiir aber hinfort ein Reich unterstiitzen wird, und mehr noch, iiber die weltweite Ausbreitung sich selbst als einen Okzident geben wird, und damit als das Modell aller zu bildenden Reiche. Wenn das Christentum also be-ziiglich des Bildes auf jede Dominanz verzichtet und dem Blick alle Freiheit gibt, so herrscht es dafiir als kirchliche Institution. Das herr-schende Bild ist das Bild, das predigt, anriihrt, iiberzeugt, zum Glauben fiihrt, das alle Missionen der Kommunikation ubernimmt, von der Pada-gogik bis zur militarischen Strategic.
Das Bild erhalt die Aufgabe, alle unveraufierlichen Verbindungen zum Phantasma und zur Angst wiederherzustellen, sobald die christliche Okonomie darin ein Mittel der Eroberung und Unterwerfung sieht.
Das Bild als Gegenstand einer Macht ist vielleicht die Matrix des-sen, was den Ikonophoben Angst einflofite und was bei uns heute noch Angst erzeugt, denn in Verbindung mit Herrschaft wird es zu einem Mittel, einem Instrument, einem Medium, das sich fiir alle Nutzungen innerhalb der Akte der Eroberung, der Werbung oder der Propaganda hergibt. Dieses institutionalisierte Bild, das ich das ikonokratische Regime des Visuellen nenne, ist dogmatisch auf dem Sakrament der Inkor-poration konstruiert, das heifit auf dem Ritual der Eucharistie. Nach ihm wird das Bild des Vaters beziehungsweise des Sohnes zum Leib und damit zum Gegenstand des Verzehrs und einer Verdauung ohne Rest, da der aufnehmende und verdauende Korper identisch mit dem ver-dauten ist, denn es handelt sich um den Kopf und die Glieder ein und desselben Korpers.
IV Das Bild ubt keine Herrschaft aus oder der Mut des Bildes
Miissen also, sobald ein Bild vorhanden ist, zugleich auch die Dispositive der Identifikation und der Furcht entstehen, bei denen die imagi-

42 Marie-Jose Mondzain
nierenden Subjekte friiher oder spater alle Hoffnung auf Menschlich-keit und Andersheit fahren lassen miissen? Das Gegenteil ist der Fall, es ist zu zeigen, dass das Bild gerade am Ursprung der Menschwer-dung der Subjekte und ihrer Sozialisation steht. Wenn den Ikonokraten und Phobokraten so viel daran liegt, die Bilder zu verteufeln oder zu kontrollieren, dann, weil sie alle von der gleichen Angst vor dem be-gehrenden Subjekt, dem imaginierenden Subjekt, getrieben sind. Jedes imaginierende Subjekt ist Glauben und Begehren unterworfen. Daher ist es unmoglich, ohne Bilder zu herrschen, sondern nur in einer Situation unausgesetzter Krise zwischen der Turbulenz des Begehrens und der Polizei des Visuellen. Das Bild ist das Ding schlechthin, in dem das Subjekt sich als getrenntes konstituiert, mit dem Blick auf sich selbst in der Triangulation, auf der das Erkennen des Spiegelbilds beruht. Dank der Psychoanalyse wurde auf klinischem Weg herausgefunden, dass psy-chisches Leid kindlich ist und vom Scheitern der bildlichen Ich-Kon-struktion zu Beginn des Lebens herriihrt. Frangoise Dolto hat dann den Begriff eines unbewussten Korperbilds gepragt, um die langwierige, komplizierte Herausbildung der Einheit des eigenen Korpers und des eigenen Bewusstseins zu bezeichnen. Sie erfolgt sukzessiv iiber Ab-losungsschritte, die im besten Falle zur gliicklichen Begegnung mit dem Spiegelbild als dem einigenden und getrennten Selbstbild fiihren. In dieser bildlichen Konstitution liegt die Moglichkeit der Sprache und des Spracherwerbs begriindet. Es ist die Konstruktion einer heilsamen Distanz, die alle existenziellen Unterschiede eroffnet. Das Leben wird dann zu einer Folge von Abstimmungen, der Identifikation und des Ver-zichts, der Investitionen von Emotion und der Substitutionen, die jeden von uns endlos schiitzen vor der Regression in die Verschmelzung und die uns endlos zu dem intersubjektiven Gewebe eines Begehrens trei-ben, das geteilt wird oder nicht geteilt werden kann.
Der Titel meines Schlusses konnte lauten: Vom notwendigen Mut zur Schaffung von Bildern. Das Bild ist unsere einzige Zuflucht vor der Angst. Der Mut ist hier keinesfalls eine kriegerische oder heldische Tugend, selbst wenn es heute mehr und mehr notig ist zu kampfen, um die Wiirde unserer Bilder zu bewahren.
Ich mochte mich einer grofien Stimme anschliefien, der Stimme Walter Benjamins bei seiner Lektiire von zwei Gedichten Holderlins. Es ging Benjamin darum, die Stadien der Holderlinschen Dichtung an die-sen beiden Gedichten mit den Titeln »Dichtermut« und »Blodigkeit« zu vergleichen. Benjamin ordnet das eine der Reifezeit, das andere der

Die Angst im Bild 43
Spatzeit zu. Die Frage, die sich Benjamin iiber die beiden Stadien eines
gleichen Gedichts stellt, ist auch die unsere: Worin besteht der politi-
sche Kern des Werks in der letzten Fassung, in der der Dichter endlich
in reiner Form bestimmt, was seine Aufgabe ist, das heifit, wie er die
Freiheit dessen konstruiert , an den er sich in dem poetischen Gestus der
Ansprache wendet. Stellen wir uns nicht die gleiche Frage, wenn wir
nach der Aufgabe des Bildschopfers fragen, der seinem Bild die Form
der Freiheit dessen einschreibt, an den er sich wendet? Benjamins Ant-
wor t sticht aus dem Gedankengang seiner Interpretation heraus: Der
poetische Kern des Werks sei der Mut.
Ich mochte einige Passagen dieses Textes anfiihren:
»Beide Gedichte sind in ihrem Gedichteten verbunden und zwar in einem Verhalten zur Welt [...]. Mut ist Hingabe an die Gefahr, welche die Welt bedroht [...], dem Mutigen besteht die Gefahr und dennoch achtet er sie nicht. Denn er ware feige, wiirde er sie achten; und bestiinde sie ihm nicht - er ware nicht mutig. Dieses seltsame Verhaltnis lost sich, indem dem Mutigen selbst die Gefahr nicht droht, jedoch der Welt. Mut ist das Lebensgefiihl des Menschen, der sich der Gefahr preisgibt [...].
Die Grofie der Gefahr entspringt im Mutigen - erst indem sie ihn trifft, in seiner ganzen Hingabe an sie, trifft sie die Welt.«^
Etwas weiter zitiert Benjamin Friedrich Schiller aus dem Brief »Uber
die asthetische Erziehung des Menschen«:
»Darin [...] besteht das eigentliche Kunstgeheimnis des Meisters, daiS er den Stoff durch die Form vertilgt [...]. Das Gemiit des Zuschauers und Zuhorers mufi vollig frei und unverletzt bleiben, es mufi aus dem Zauberkreis des Kiinstlers rein und voUkommen wie aus den Handen des Schopfers gehen.«^
Den Mut des Kiinstlers zu verstehen, verlangt also eine Neudefinition
des wahren Wesens der Gefahr, die uns bedroht, eine Nachforschung
nach den grundlegenden Konstituierungen des sprechenden Subjekts
und nach dem, was es in dieser Konstituierung bedroht. Mir fallt dazu
der Mut ein, den der Mensch gebraucht hat, um mit einem imaginieren-
den Gestus die Beziehung zur Welt gerade in dem Moment herzustel-
len, als seine Menschwerdung gefahrdet war. Die stillen Operat ionen,
von denen wir die Zeichen an den Wanden der Felsgrotten lesen, schei-
1 Walter Benjamin, »Metaphysisch-geschichtsphilosophische Studien: Zwei Gedichte von Friedrich HolderUn«, in: ders., Gesammelte Schriften, Band III, i, Frankfurt am Main 1974, S. 122 ff. 2 Ebd., S. 125.

44 Marie-Jose Mondzain
nen mir machtvoUe Bezeugungen dessen zu sein, worum es beim Bild in seinem Bezug zur Angst geht, ein Beweis der Entfaltung seiner Kraft angesichts der Bedrohung. Der Mensch zeigt sich darin verletzlich und bezeichnet schlagartig die grundlegende Gefahr, welche die Herausbil-dung des Menschen und damit die menschliche Zukunft selbst bedroht. Der imaginierende Gestus hat die Zeitlichkeit der Menschheit selbst zur Grundlage. Bereits zu Anfang wurde auf die Ausloschung der Zeit in der Phobokratie hingewiesen, da sie mit Hilfe der Negierung jeder zeit-lichen Dimension herrscht. In ihr wird die Situierung eines jeden von uns in einer zugleich intimen und gemeinsamen Geschichte zum Ver-schwinden gebracht. Die Ikonophobie hat, ausgehend von einer ande-ren Position, die gleiche desastrose Wirkung, indem sie die vorhistori-sche Ewigkeit der Transzendenz oder die Zeitlosigkeit einer souveranen RationaUtat herrschen lasst. Das Bild iibt jedoch keine Herrschaft aus, da es das Zeichen der Zeitlichkeit ist und sich immer an einer Schwelle aufhalt. Wenn das Bild ein freiheitlicher Gestus ist, das heifit einer der Loslosung und Trennung, gibt es sich als unbestimmte Zukunft fiir alle Blicke, die es aufnehmen werden. So habe ich die Zeichen an den Wan-den der Felsgrotten gelesen. Ihre Interpretation hat keine Bedeutung, die im Zusammenhang mit dem Schicksal dessen stiinde, der sie mit seiner Geste hinterhefi. Die Bestimmung dieser Zeichen spricht aus ihnen selbst wie aus dem Gedicht Holderlins, das Benjamin 1914/15 analy-sierte, als die Menschheit sich mit der zunehmenden Gewalt und Bar-barei der beiden Weltkriege in Gefahr brachte. Der Dichter erschien Walter Benjamin als einer, der sein eigenes Leben riskieren muss, um die Spur seines Muts fiir die menschliche Zukunft zu hinterlassen: »Der Dichter hat den Tod nicht zu fiirchten, er ist Held, weil er die Mitte aller Beziehungen lebt.«^
Meines Erachtens ist das Bild, und mehr noch das, was ich seinen Mut nenne - die imaginierende Tugend, die uns als getrennte Wesen konstituiert - , nichts anderes als die poetische Dimension jedes Bildes. Nichts ist der Angst fremder als der Gestus der Kunst, als das voile Be-wusstsein der Gefahr, die wir eingehen, indem wir unsere Einsamkeit als Menschen verlieren. In diesem Sinne glaube ich, dass Holderlins Dichtung eine phylogenetische Kraft besitzt, bei der jedes Wort nach-klingt als ein Gestus, der die Menschheit ihrem unendlich verletzlichen und bedrohten Schicksal zuordnet. In Zeiten wie den unseren, es wurde
3 Ebd., S. 124.

Die Angst im Bild 4 5
eingangs erwahnt, ist die Angst zu einem Instrument der Macht gewor-den, zu einem Instrument, das den Zusammenbruch jeglichen Denkens mit sich bringt. Das Streben nach Sicherheit ist an den Platz des Muts getreten, da wir zudem in einer Zeit leben, die durch Isolierung unfahig macht zur Einsamkeit. Holderlins Gedicht hallt fiir uns wie fiir Benjamin mit einer erstaunlichen Kraft nach. Man hort darin das Echo einer Griindung von Gemeinschaft, die von der Welt eingeschiichtert ist und dennoch nicht vor ihr zittert. Der Mensch misst sich an dem, was ihn bedroht. Ich wiirde gerne behaupten, das Bild gebe uns im Visuellen den Mafistab fiir diese Konfrontierung mit der Welt. Das Bild steht zwi-schen der Welt und den Gottern, wie der Dichter in der standigen Be-wegung steht, die unsere zugleich zarten und soliden Bindungen an den Sinn kniipft und wieder lost. Das Lob des Mutes ist von der Schwache nicht zu trennen. Was ware der Mut ohne das Wissen um die Gefahr?
Ich glaube, man kann das Ratsel dieses Gedichts anhoren, wie man die Felsbilder anschaut, das heifit wie eine Aufforderung, keine Angst mehr zu haben, ohne auch nur fiir einen Moment das Wissen um die Gefahr zu verlieren.
Hier ist das »Blodigkeit« iiberschriebene Gedicht, dessen Titel Furcht oder Zuriickhaltung ausdriickt und das mit dem Ratsel des Muts beginnt:
»Sind denn dir nicht bekannt viele Lebendigen Geht auf Wahrem dein Fufi nicht, wie auf Teppichen? Drum, mein Genius! Tritt nur Bar in's Leben, und sorge nicht!
Was geschiehet, es sei alles gelegen dir! Sei zur Freude gereimt, oder was konnte denn Dich beleidigen, Herz, was Da begegnen, wohin du sollst?
Denn, seit Himmlischen gleich Menschen, ein einsam Wild Und die Himmlischen selbst fiihret, der Einkehr zu, Der Gesang und der Fiirsten Chor, nach Arten, so waren auch
Wir, die Zungen des Volks, gerne bei Lebenden, Wo sich vieles gesellt, freudig und jedem gleich Jedem of fen, so ist ja Unser Vater, des Himmels Gott,

46 Marie-Jose Mondzain
Der den denkenden Tag Armen und Reichen gonnt, Der, zur Wende der Zeit, uns die Entschlafenden Aufgerichtet an goldnen Gangelbanden, wie Kinder, halt.
Gut auch sind und geschickt einem zu etwas wir, Wenn wir kommen, mit Kunst, und von den Himmlischen Einen bringen. Dock selber Bringen schickliche Hande wir.«'
Ich mafie mir nicht an, eine bessere Interpretation zu liefern als Walter Benjamin, jedenfalls lasst jedes Wort dieses Gedichts etwas in mir an-klingen, das aus der Tiefe der Zeit zu kommen scheint. Ich hore darin, dass das Bild wie das Gedicht schiichtern, angstlich, fragil ist in seiner Zuriickgezogenheit, da es fiirchtet, dem eigenen Zauber zu erliegen und dabei die Macht der Freiheit und des Unbestimmten zu verlassen.
Ich mochte mit der Behauptung schliefien, dass jedes grofie Bild nie-mals ein Ding ist, das Herrschaft ausiibt oder sich unterwerfen liefie, es ist nie mehr als ein Gestus, dessen Spur einen Anspruch umreifit und eine Bestimmung einschreibt.
(Aus dem Franzosischen von Beate Thill)
4 Friedrich Holderlin, »Gedichte«, in: ders., Werke^ Band i, S. 318.

Jose van Dijck
Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie
In dem Sciencefiction-Film Fantastic Voyage (Fantastische Reise) aus dem Jahr 1966 begibt sich eine Gruppe von drei Mannern und einer Frau (Raquel Welch) auf eine spezielle Mission/ Sie betreten eine Raumkap-sel, die auf Miniaturgrofie zusammengeschrumpft und dann in die Vene eines anasthesierten Patienten injiziert wird - eines beriihmten Atom-physikers, dessen Leben durch einen Hirntumor bedroht ist. Die Kor-perreise fiihrt die Besatzung durch lebenswichtige Organe wie Lunge und Herz und lasst sie die Wunder des Korperraums erfahren. »Der Mensch ist das Zentrum des Universums. Wir stehen in der Mitte einer Unendhchkeit des aufieren und des inneren Raums, und keiner von ihnen hat ein Ende oder eine Grenze«, fliistert Mr. Grant, einer der Bionauten, voll staunender Bewunderung fiir die kosmischen Anbhcke, die sich um das Raumschiff herum entfalten. Nach verschiedenen span-nenden Begegnungen mit organischen Hindernissen erreicht das minia-turisierte Team schUefiHch das Hirn, wo es den Tumor des Mannes mit Hilfe von Laserstrahlen entfernt. Die Flucht aus dem Korper geUngt ihnen durch die Augenfliissigkeit, gerade noch rechtzeitig bevor sie wie-der auf ihre urspriingUche Grofie anwachsen. Fantastic Voyage bietet eine Kombination aus wissenschaftUcher und operativer Expedition: Die Besatzung will den Korper von innen sehen, Bilder aus seinem Inneren in die aufiere Welt bringen und Fehler in seiner organischen Textur re-parieren.^ Richard Fleischers Film steht als Emblem fiir das jahrhun-dertealte Verlangen von Arzten, die inneren Geheimnisse des Korpers
1 Fantastic Voyage, Regie Richard Fleischer, Columbia Pictures, 1966. 2 Eine sehr interessante Analyse des Filmes aus kulturwissenschaftlicher Perspektive findet sich in Kim Sawchuk, »Biotourism, Fantastic Voyage, and Sublime Inner Space«, in: Wild Science: Feminist Images of Medicine and Body, hg. von Janine Marchessault und Kim Sawchuk, New York 2000, S. 9-23.
47

48 Jose van Dijck
zu entdecken, sein unbekanntes Terrain zu erfassen und seine Fehler zu korrigieren.^
Was aber ist die weitere Bedeutung dieser mythischen Reise, die dar-auf abzielt, den inneren Korper zu erkunden und zu reparieren, ohne eine Spur auf seiner aufieren Hiille zu hinterlassen? Reflektiert sie eine unschuldige Fantasie, ein utopisches Verlangen oder eine wissenschaft-liche Projektion der Zukunft? In diesem Aufsatz argumentiere ich, dass die »fantastische Reise« inklusive der medizinischen Logik, auf der sie basiert, tatsachlich eine rhetorische Figur ist, die der Entwicklung, An-wendung und Verbreitung einer wichtigen medizinischen Bildgebungs-technologie zu Grunde liegt: des Endoskops. Vom griechischen »endo« (innen) und »skopein« (betrachten) abgeleitet bezeichnet dieser Begriff die Macht, die Reichweite des menschlichen Auges in das Korperinnere hinein zu erweitern. In seiner friihesten Form tat ein Endoskop genau das: Es erlaubte Arzten, in den menschlichen Korper zu bHcken. Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts war die Endoskopie immer weniger dar-auf beschrankt, nur die visuellen Kapazitaten des Arztes zu verstarken, sondern sie zielte auch darauf ab, die manuellen Fahigkeiten des Opera-teurs unter der Haut zu erweitern, so dass Untersuchung und Operation wahrend ein und derselben operativen Expedition stattfinden konnten. Mit den heutigen video-endoskopischen Instrumenten konnen Arzte ungewoUte Wucherungen im Korper visuahsieren, diagnostizieren und entfernen, ohne auf der Haut des Patienten mehr als eine kleine Narbe zu hinterlassen. Der technologische Fortschritt hat jiingst einen vorlau-figen Hohepunkt erreicht mit der Entwicklung der »virtuellen Endo-skopie«, einer Technik, die anscheinend eine Sciencefiction-Fantasie zur chirurgischen Realitat werden lasst: Chirurgen sagen voraus, dass sie bald in der Lage sein werden, sich im Korper zu bewegen und darin zu operieren, ohne die Haut des Patienten zu beschadigen.
Die Entwicklung medizinisch-chirurgischer Instrumente erfolgt nie isoliert, sie ist vielmehr Teil eines komplexen Netzes, in dem Technologic, medizinische Praxis und kulturelle Reprasentation sich wechsel-seitig bedingen. In Bezug auf die Endoskopie sehen wir, wie ihre Ent-
3 Jonathan Sawday, The Body Emblazoned: Dissection and the Human Body in Renaissance Culture, London 1995, erklart, wie Anatomen im 16. und 17, Jahrhundert sich mit zeitgenossischen Entdeckern wie Columbus identifizierten; sie schnitten Korper auf, um die wahren Orte und Funktionen von Organen zu entdecken, und wie geografische Kartografen gaben sie den neu erfundenen Korperteilen ihre eigenen Namen wie etwa Fallopius oder Eustachius.

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 49
wicklung unaufloslich mit Innovationen in den Medientechnologien wie Photographic, Video und Computer verbunden ist. Endoskopische Techniken haben gewisse medizinische Praktiken dramatisch verandert, insbesondere die chirurgischen Fertigkeiten, die Szenerie des Opera-tionssaals und die BeteiHgung des Patienten. In ihrer Zweitrolle als Me-dientechnologie hat die Endoskopie auch einen grofien Einfluss darauf gehabt, wie der innere Korper in popularen Medien wie dem Fernsehen vorgestellt und reprasentiert wird. Das Zusammenspiel von Technologic, medizinischer Praxis und kultureller Aneignung wird in dem, was ich den »endoskopischen Bhck« nenne, manifest. Im Gegensatz zu Laura Mulveys »cinematischem BHck« bedeutet der endoskopische Bhck die durch medizinische Technologic crmoglichte Sicht des Kor-pers von innen.4 In den Ictzten fiinfzig Jahren hat sich unsere - durch das Auge der Chirurgin vermittclte - Perspektive auf das Korperinnere von aufien nach innen verschoben. Wir schauen nicht mehr von aufien durch einen Einschnitt in der Haut hinein, sondern die Instrumente er-lauben uns »unmittelbaren« Zugang zu den kleinsten Details des Kor-pers. Diese Innenansicht gegeniiber dem Korper hat inzwischen unsere Kultur durchdrungen.
Aber was sind die Implikationen dieses iiberall anzutreffenden endo-skopischen Blicks? Welche Auswirkungen haben Innovationen in der endoskopischen Technologic auf die Konzeptc von Korpcrwirklichkeit bei Arzten und Patienten? Und beeinflussen diese wiederum unsere kollektive Einschatzung von chirurgischen Interventionen und ihren Konsequenzen? Mit anderen Worten: Fiihren sic zu neuen Definitio-nen unserer Normen und Erwartungen in Bezug auf die Perfektibilitat des Korpers als eines physischen Behalters? Zwischen den friihesten Versuchen mit Endoskopen und den jiingsten Experimenten mit com-
4 Laura Mulvey stellt in ihrem beruhmten Artikel »Visual Pleasures and Narrative Cinema«, in: Screen 16 (1975), S. 6-18, die These auf, dass der cinematische Blick nach Geschlechtern verschieden ist. Ein mannUcher Bhck untersucht entweder voyeuristisch oder fetischisiert ein weibhches Objekt. Erzahlung und Spektakel sind hier von den Anforderungen des patriarchalen Unbewussten beherrscht. Der endoskopische Bhck, so argumentiere ich hier, folgt diesem von Mulvey behaupteten Vektor nicht; vielmehr zwingt er den Blick des Betrachters in die Sichtweise eines unpersonlichen, entsexua-lisierten und daher ungeschlechtlichen Insiders. Natiirlich stimme ich Mulveys Argument zu, dass die Achse der Zuschauerschaft geschlechtlich codiert ist, und um das zu unterstreichen, werde ich hier konsequent von einer weiblichen Chirurgin und einem mannlichen Patienten sprechen, wenn ich Arzte und Patienten im Allgemeinen meine. Spater werde ich zeigen, wie der klinische Blick des Endoskops die (geschlechtercodier-ten) Grenzen des Objektes auf lost.

50 Jose van Dijck
putergestiitzten Bildgebungstechnologien haben sich die Mythen der Transparenz und Non-intervention in den medizintechnologischen Entwicklungen und in ihren klinischen und kulturellen Anwendungen gleichermafien durchgesetzt. Mit einer Skizze der Vergangenheit, Gegen-wart und Zukunft eines spezifischen Bildgebungsinstruments will ich eines der breiter angelegten Argumente dieses Aufsatzes vorantreiben: dass namlich Technologien der Korpervision untrennbar mit unserer Vision von Technologie in der Vorstellung des permeablen Korpers ver-bunden sind.
Von auflen hineinschauen
In ihrer primitiven Form existiert die Endoskopie seit etwa 1800. Die friihesten Visualisierungshilfen, die Arzte benutzten, um in den Korper hineinzuschauen, ahnelten einem Teleskop oder Binokular. Das gynako-logische Speculum und das Rektoskop ermoglichten dem Arzt den Ein-blick durch natiirliche Offnungen in innere Korperhohlen und Organ-zwischenraume, da sie auf der Reflektion von AulSenlicht beruhten. Weiter innen liegende Gegenden wie der Magen wurden erreicht, indem man ein gerades, statisches Rohr durch die Speiserohre einbrachte. Die ersten so genannten »Gastroskope« wurden in den i85oer Jahren ein-gefiihrt.^ 1877 erweiterte der deutsche Arzt Max Nitze das Sichtfeld, indem er kiinstliche Lichtquellen in den Korper brachte: Sein »Zysto-skop« fiihrte einen auf Weifiglut erhitzten Platindraht in die Blase ein, gefolgt von einer Art Teleskop. Spater ersetzte er den Platindraht durch eine Edisonlampe. Im friihen 20. Jahrhundert begannen die Chirurgen, die Endoskopie zum Eintritt in den Korper nicht nur durch natiirliche Offnungen, sondern auch durch absichtliche Einschnitte in die Haut anzuwenden. Perkutane Techniken, wie diese Eingriffe genannt werden, sind inharent invasiv, da sie eine Operation mit Narkose erfordern.
Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts blieben Endoskopien hochinva-sive Verfahren, und oft waren sie schon in sich chirurgische Eingriffe, deren Gefahren durch den potenziellen Nutzen kaum wettgemacht wurden. Wenn eine Chirurgin entweder wahrend oder nach der endo-skopischen Diagnose entschied, eine Operation durchzufiihren, war die
5 Laurits Lauridsen, Laterna Magica in Corpore Humano: From the History of Endoscopy, Aarhus 1998, bietet eine hervorragende Einfiihrung in die Geschichte der Endoskopie.

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 51
gesamte Szenerie des Operationssaals darauf ausgelegt, den Blick der Chirurgin von aufien nach innen zu ermoglichen. Vergrofierungsglaser, Stirnspiegel und Lampen unterstiitzten den chirurgischen Blick. Wah-rend solcher offener chirurgischer Verfahren - immer noch die verbrei-tetste Form moderner Chirurgie - sind die Augen und Hande der Chirurgin in direktem Kontakt mit dem Patienten, und der Einschnitt in die Haut soUte grofi genug sein, um die Beriihrung der erkrankten Korper-teile durch die Finger der Chirurgin zuzulassen. Wie Stefan Hirschauer es in seiner »dichten Beschreibung« des chirurgischen Aktes gewandt ausdriickt: »Man muss sehen, um mehr zu schneiden, und schneiden, um mehr zu sehen.«^ Der Korper des Patienten wird auf die Gegend der Operation reduziert - ein zum Schweigen gebrachtes Objekt, mit Ausnahme einer sterilen Offnung der Haut, von Decken verschleiert. Narkotisiert und ohne Bewusstsein wird der Patient ein virtueller Teil-nehmer; man spricht iiber ihn, aber nicht mit ihm; Narkose und/oder Tuchwande schiitzen den Patienten vor Schmerz, aber auch vor un-angenehmen AnbHcken, vor Furcht und Scham gegeniiber dem eigenen nackten Inneren7 Der Operationssaal selbst symbohsiert eine abge-grenzte Gegend. In der Sterihtatszone ist der Korper davor geschiitzt, dass Bakterien und Keime in den offen gelegten Korper gelangen; die Mauern markieren die Privatsphare, und der Eintritt in den Operationssaal ist gleichbedeutend mit dem Eintritt in den Patienten.
Um die Endoskopie als diagnostisches Instrument niitzlicher und weniger invasiv zu machen, mussten drei Haupthindernisse iiberwun-
6 Stefan Hirschauer, »The Manufacture of Bodies in Surgery«, in: Social Studies of Science 21 (1991), S. 279-319, S. 299. 7 Nach der Argumentation von Hirschauer (wie Anm. 6), S. 305, sahe die Szene vol-Ug anders aus, wenn der Patient bei Bewusstsein ware: »Ein aufgeschnittener und innen blofigelegter Korper - mit heraushangenden Organen - ist mehr als nackt. Sein Bewoh-ner ware von Furcht und Entsetzen ergriffen, wiirde aber auch mit einem anderen sozia-len Affekt reagieren, der fiir Zustande geringerer Auflosung der eigenen Erscheinung erforderUch ist: Scham.« Eine ahnHche Sicht findet sich bei Karen Dale, »Identity in a Culture of Dissection: Body, Self and Knowledge*, in: Ideas of Difference: Social Spaces and the Labour of Division, hg. von Kevin Hetherington und RoUand Munro, London 1997, S. 94-113, S. ^^^ die Skalpell und Spiegel als zwei Symbole fiir Furcht beziehungs-weise Begehren, das eigene Innere zu erblicken, ansieht: »Das Skalpell weist darauf hin, wie weit verbreitet das Begehren ist, unter die Oberflache zu schneiden, das Verborgene sichtbar zu machen, hineinzuschneiden. Andererseits zeigt der Spiegel unser Begehren an, uns selbst zu kennen, selbstreflexiv zu sein, eine koharente Vorstellung unserer eigenen Identitat zu haben. Doch uns selbst von innen zu sehen, ist eine zutiefst verstorende Aktivitat, denn unser Inneres zu beobachten - Eingeweide, Innereien und Organe - be-deutet, dem Personlichen auf eine Weise gegeniiberzustehen, die eine Vorahnung von Tod und Verwesung bedeutet.«

52 Jose van Dijck
den werden. Man brauchte hoch entwickelte optische Geratschaften sowie eine sichere und verlassliche innere Lichtquelle und vorzugsweise ein flexibles Kabel, das leicht durch die Raume innerhalb oder zwi-schen den Organen gefiihrt werden konnte. 1957 boten die Erfindung des optischen Glasfaserkabels durch den danischen Ingenieur Holger MoUer-Hansen und seine spatere Perfektionierung durch den engHsch-amerikanischen Chirurgen Basil Hirschowitz Losungen fiir die drei Grundprobleme Optik, Licht und FlexibiHtat der Rohre.^ Das neue Kabel bestand aus diinnen Perspex-Faden, die Licht von Faser zu Faser iibertrugen; es war vollig flexibel und konnte durch die meisten natiir-lichen und kiinstlichen Offnungen eingefiihrt werden, ohne seine optische Qualitat zu verlieren, wenn die Rohre gebogen wurde. Ein Ver-grofierungsglas wurde am vorderen Ende des Kabels angebracht, und ein Aufsatz fiir das Auge deckte das hintere Ende ab. Das neue Kabel verbesserte die visuelle Reichweite der Chirurgin im Korper betracht-lich; wichtiger aber, es verbesserte Wohlbefinden und Sicherheit des Patienten.
Es dauerte bis in die sechziger Jahre, bevor es Technikern gelang, Photographic mit Endoskopie zu kombinieren, wodurch es den Arzten moglich wurde, Souvenirs von ihren Erkundungstouren nach Hause zu bringen. Fast gleichzeitig mit dem Aufkommen des optischen Glasfaserkabels entwickelte das japanische Unternehmen Olympus 1963 eine Minikamera, die am Ende des Kabels angebracht werden konnte. Mit einem Weitwinkelobjektiv, Blitz und Film ausgestattet konnten Arzte nun Bilder des Korperinneren von innen aufnehmen; die Haut war fiir das Kameraauge permeabel geworden; Schnappschiisse innerer Wahr-zeichen und Landschaften entstanden. Ein grofies technisches Problem bestand damals darin, dass die Standbilder »blind« aufgenommen werden mussten, da das Objektiv nicht von aufien gesteuert werden konnte. Zudem fiihrte das Weitwinkelobjektiv inharent zu einer Verzerrung des Bildes, und der Fokus wurde oft durch Korperfliissigkeiten wie Galle, Blut oder Schleim vor der Linse irritiert.
Obwohl endoskopische Bilder bis in die siebziger Jahre hinein in der Chirurgie nur eine kleine NebenroUe spielten, erwiesen sie sich als sehr niitzlich fiir die Verbreitung des endoskopischen Blicks aufierhalb des medizinischen Bereichs. In den sechziger und siebziger Jahren begannen
8 Lauridsen (wie Anm. 5), S. 72-82, beschreibt die genaue Entwicklung dieser drei Losungen.

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 5 3
medizinische Zeitschriften, endoskopische Bilder insbesondere als Be-lege erfolgreicher Interventionen zu reproduzieren. »Vorher und nach-her«-Bilder von entfernten pathologischen Wucherungen oder Fremd-korpern waren stumme Zeugen der pionierhaften Professionalitat der Chirurgin. Durch den Einsatz von Kameras konnten Arzte eindrucks-voUe Belege nicht nur ihrer okularen Anwesenheit im Inneren, sondern auch von der Erfiillung ihrer Missionen produzieren. Friihe endoskopische Bilder dienten auch als Lehrmittel, um zukiinftige Chirurgen mit dem endoskopischen Blick vertraut zu machen. Mit der Verbesserung der photographischen Qualitat und der Massenverbreitung der Farb-photographie trugen die faszinierenden Schnappschiisse zur Verbrei-tung dieses Blicks bei und legten die Welt unter der Haut fiir das Auge der Offentlichkeit frei. Populare Zeitschriften waren begierig, die zu-nachst in medizinischen Zeitschriften veroffentlichten Chirurgen-Tro-phaen staunenswerter Korperlandschaften zu publizieren. Time, Ebony und andere Zeitschriften begannen damit, Ansichten zu zeigen, die die Offentlichkeit nie zuvor gesehen hatte - von Duodenalgeschwiiren, infizierten Stimmbandern oder einem Meniskusriss.^ Damals waren die Fotos selten mit individuellen Menschen verbunden; vielmehr bedeu-teten sie allgemein gesunde oder erkrankte Korperteile und schiitzten so die Privatsphare der abgebildeten Personen. Bilder vom Inneren des lebendigen Korpers halfen den Betrachtern dabei, sich vorzustellen, wie es fiir die Chirurgin ist, von aufien hineinzuschauen. Doch ohne beglei-tende Texterklarungen waren die Bilder so exotisch wie die ersten Bilder vom Mond.
Das Innere nach aujien kehren
Mit der massenhaften Verbreitung endoskopischer Bilder, die durch die Einfiihrung von Videotechniken in den friihen achtziger Jahren mog-lich wurde, wurde das Korperinnere vertrauter und immer weniger exotisch. Eine kleine Videokamera an einem Fernsehkabel ersetzt das Glasfaserkabel; von Auge und Hand der Chirurgin in den Korper ein-gefiihrt und von aufien gesteuert sendet die Kamera Digitalbilder auf
9 Siehe beispielsweise B. Sherman, »Techniques Tomorrow*, in: Modern Photography 36 (Marz 1972); »Dr. Berry: World Renowned Expert on Endoscopy*, in: Ebony 30 (Juni 1975); »Testing Fetuses«, in: Time 115 (24. Marz 1980).

54 Jose van Dijck
einen Videobildschirm im Operationssaal.^° Anders als die Fotokamera schickt die Videokamera Live-Signale, welche bewegte Bilder vom Kor-perinneren projizieren - Bilder, die vergrofiert und aufierhalb des Kor-pers des Patienten manipuliert werden konnen. Vor allem aber erweitert die Video-Endoskopie nicht nur das Auge, sondern auch die Hand der Chirurgin: Durch dieselbe Rohre, durch die die Videokamera in den Korper geschoben wird, kann die Chirurgin Operationsinstrumente einfiihren. Die rein diagnostische Nutzung der Endoskopie machte allmahlich einem kombinierten diagnostisch-therapeutischen Eingriff Platz, wie er in Fantastic Voyage gezeigt wird.
Fast zwanzig Jahre nach ihrer Einfiihrung wird Video-Endoskopie in vielen medizinischen Spezialgebieten durchgefiihrt, von der Gastro-Enterologie zur Gynakologie, von der Urologie zur orthopadischen Operation. Die therapeutische Nutzung beinhaltet das Entfernen von Fremdkorpern, Tumoren, Nierensteinen und das Legen von Drainagen in verstopften Gallegangen. Nieren- oder Gallensteine konnen endo-skopisch mit Hilfe von Ultraschall-Laser zertriimmert oder als Ganzes durch die Rohre entfernt werden. Zwischen sechzig und achtzig Pro-zent aller Gallensteinentfernungen werden heute mit endoskopischer Unterstiitzung durchgefiihrt.^^ Die Vorteile der Video-Endoskopie werden weithin anerkannt. Der Eingriff ist weniger invasiv und daher fiir die Patienten weniger traumatisch als offene Operationen; sie kann manchmal unter lokaler Narkose durchgefiihrt werden, und die wirt-schaftlichen Einsparungen durch die kiirzeren Genesungszeiten kom-men zu den kosmetischen Vorteilen noch hinzu. Wahrend bei einer offenen Operation die Entfernung einer Gallenblase einen fiinfzehn Zentimeter langen Einschnitt in den Bauch erfordert, hinterlasst ein video-endoskopischer Eingriff lediglich die kaum sichtbaren Spuren einiger weniger Stiche am Rand des Nabels.
Video-Endoskopie erzeugt fiir einen Aufienbeobachter ein starkes Gefiihl von Transparenz, aber fiir die Chirurgin bedeutet diese Technologic eher weniger als mehr Zugang zu den inneren Schichten des Patienten. Die Spezialistin sieht nicht mehr direkt auf das Innere eines realen Korpers - auf die Organe und Innereien, die durch einen Einschnitt in
10 B. I. Hirschowitz, »Development and Application of Endoscopy*, in: Gastroenterology 104 (1993), S. 337-342, gibt eine starker medizinisch-technische Beschreibung der Geschichte der Endoskopie. 11 So Lauridsen (wie Anm. 5), S. ^j.

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 5 5
die Haut offen gelegt wurden - sondern auf einen vermittelten Korper: vermittelt durch die Kamera und eine Videoanzeige, die liber dem Ope-rationsort hangt. Im Vergleich zur offenen Operation erfordert die endoskopische Chirurgie radikal andere Fertigkeiten: Die Hand-Auge-Koordination erfolgt iiber die Videoanlage und ihre elektronischen An-zeigen. Da die Haut des Patienten nur geringfiigig eingeritzt ist, muss die Chirurgin ihre Instrumente durch minimale Offnungen navigieren. Wahrend die offene Operation eine erhohte visuelle Scharfe im »Origi-nalmaterial« selbst zu erzielen sucht, versucht der endoskopische Bhck sein MogHchstes, um die lokale Begrenzung des Auges zu iiberwinden. Die Vermittlung durch das Video-Endoskop kann die Sicht der Chirurgin auch soweit begrenzen, dass sie essenzielle Informationen iiber-sieht. Nach der endoskopischen Entfernung von Steinen in der Gallen-blase zum Beispiel konnen SpHtter noch den Zugang zu Leber oder Pankreas blockieren, aber wegen der eingeschrankten Reichweite des Instruments bleiben sie unsichtbar. In manchen Fallen kann eine zu-satzliche offene Operation notig werden, um solche Komplikationen zu korrigieren, die aus den Beschrankungen des Instruments entstan-den sind.^^ Jedes Instrument, das neue Einblicke eroffnet, setzt auch neue Beschrankungen. Trotz seiner visuellen Behauptung von Transpa-renz bietet der endoskopische Blick eine inharent beschrankte Perspek-tive auf das Korperinnere.
Aus der Sicht des Patienten hingegen scheint die Video-Endoskopie die Transparenz zu erhohen. Bei einem offenen Eingriff ist der Patient in der Regel ohne Bewusstsein und mit einem Tuch verhiillt und ab-geschirmt, daher nicht in der Lage, die Operation zu beobachten. Die meisten Arten von Video-Endoskopie werden immer noch unter Voll-narkose durchgefiihrt; eine standig wachsende Zahl von Eingriffen erfordert jedoch lediglich eine Lokalanasthesie und ermoglicht es so dem Patienten, seiner eigenen Operation zuzusehen. Wahrend er auf dem Operationstisch liegt, kann der Patient das Vorgehen der Chirurgin auf dem Bildschirm verfolgen. Es scheint wesentlich leichter zu sein, solchen Operationen auf dem Bildschirm zuzusehen, da der Patient auf diese Weise von seinem eigenen Korper distanziert und vor seinem direkten Anblick geschiitzt ist, der Gefiihle der Furcht und Scham hervorrufen
12 Yutaka Yoshinaka machte hierauf aufmerksam in »Exploring the Boundaries of Technological Practice in-the-making«, Vortrag bei der Demarcation Socialised Conference, Cardiff (GB), August 2000.

56 Jose van Dijck
konnte. Da er keinen Schmerz spiirt, gibt es keine empfundene Verbin-dung zwischen dem, was der Patient auf dem Bildschirm sieht, und dem, was mit seinem Korper geschieht. Auf Grund des exotischen Aussehens und der Sauberkeit des Eingriffs kann der Patient sogar von seiner eige-nen Operation fasziniert sein. In Fallen, in denen endoskopische Chi-rurgie unter VoUnarkose durchgefiihrt wird, will der Patient vielleicht ein Videoband mit nach Hause nehmen; einige Wissenschaftler sagen sogar, dass es einen therapeutischen Effekt haben konne, wenn man sich seine eigene Operation nachtraglich anschaue.^^
Video-Endoskopie macht nicht nur dem Patienten das Korperinnere sichtbar, sondern ladt auch den Blick von Aufienstehenden ein. Video-aufnahmen sind zu Lehrzwecken verwendet worden, um Medizinstu-denten oder Praktikanten zu schulen, und Patienten wollen das Band vielleicht einem anderen Spezialisten zeigen, um eine zweite Meinung einzuholen.^4 Und natiirlich sind Aufnahmen von endoskopischen Ein-griffen von Anfang an als Beweismittel bei Kunstfehlerverfahren vor Gericht benutzt worden.^^ Das gleiche Instrument, das die Transposition des endoskopischen Blicks vom Operationssaal in den Gerichts-saal zuliefi, ermoglichte auch seinen Transport in die Wohnzimmer. Vor 1980 waren chirurgische Eingriffe gelegentlich fiir die Offentlichkeit gefilmt worden - wobei offene Wunden, blutige Eingeweide und die behandschuhten Hande der Chirurgin einen nicht gerade angenehmen Anblick boten. Auch war professionellen Medizinern die Anwesenheit von Fernsehteams in der sterilen Operationsumgebung zu aufdringlich. Doch das Aufkommen der Video-Endoskopie anderte die relative Inti-mitat des Korperinneren des Patienten und des Operationssaales radi-kal. Da endoskopische Bilder weniger blutig und schmutzig aussehen
13 Ella Shohat, »Lasers for Ladies: Endo Discourse and the Inscription of Science«, in: The Visible Woman: Imaging Technologies, Gender, and Science, hg. von Paula Treichler, Lisa Cartwright und Constance Penley, New York 1998, S. 240-272, macht und belegt diese Behauptung. 14 Die Nutzung von videogesteuerten Instrumenten kann sogar Interaktion und Dis-kussion zwischen Arzten und Spezialisten anregen, argumentiert Bonnie Nardie in »Vi-deo-as-Data: Technical and Social Aspects of a Collaborative Multimedia Approach*, in: Video-Mediated Communication, hg. von Abigail Sallen, Sylvia Wilbur und Kathleen Fink, Mahwah NJ 1997, S. 487-517. 15 Zu den rechtlichen Folgen endoskopischer Aufzeichnungen siehe P. D. Gersten-berger / P. A. Plumeri, »Malpractice Claims in Gastrointestinal Endoscopy: Analysis of an Insurance Industry Data-base«, in: Gastrointestinal Endoscopy 39 (1993), S. 132-138; J. Natali, »Medicolegal Implications of Vascular Injuries during Videoendoscopic Surgery*, m: Journal des Maladies Vasculaires 21 (1996), S. 223-226.

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 5 7
als Filmaufnahmen offener Wunden, sind sie fiir das allgemeine Publi-kum verlockender.
In den vergangenen Jahren sind in Europa Endoskopien regelmafiig von offentlichen Fernsehsendern gezeigt worden, entweder in wissen-schaftlichen Dokumentarfilmen oder in Gesundheitsprogrammen; sie haben die Offentlichkeit mit der iiberwaltigenden Sicht von innen ver-traut gemacht. Chirurgenwerk ist ein typisches Beispiel einer popula-ren medizinischen Talkshow in den Niederlanden.^^ Spezialisten und Patienten sitzen in einem Studio, in dem ein Moderator Patienten vor-stellt, deren Krankheiten benutzt werden, um die neuesten und ein-drucksvoUsten chirurgischen Techniken und Instrumente zu demons-trieren. Eine Ausstrahlung in der Serie mit dem Titel »Korperreise: Endoskopische und perkutane Techniken« fiihrt eine Reihe endosko-pischer Verfahren vor, darunter eine Bronchoskopie zur Reinigung der Nebenhohlen, eine laparaskopische Untersuchung der Eierstocke und Eileiter und eine endoskopische Entfernung von Nierensteinen. Zu Be-ginn des Programms ladt der Moderator seine Zuschauer zu einer »auf-regenden Reise durch den menschlichen Korper« ein. Ein Mann wird als der Patient vorgestellt, der den Urologen, der neben ihm sitzt, auf-gesucht hat mit einer, wie der Moderator sagt, »typischen Altmanner-Krankheit«: Prostatavergrofierung. Der »alte Mann«, sichthch schiich-tern und gelegenthch kichernd, Hstet seine Symptome auf - Schmerzen im Urinaltrakt, tropfelnder Urin - , und danach iibersetzt der Arzt die Natur dieser Probleme in den medizinischen Jargon.
Als Nachstes nimmt uns die Kamera mit ins Krankenhaus, wo die Operation ungefahr eine Woche zuvor gefilmt worden war. Ohne Uber-gang gelangen wir durch die Kamera im Uroskop direkt in den Korper des Mannes. Das mechanisierte Auge des Chirurgen fiihrt uns durch den Urinaltrakt, an den Spermarien und Hoden vorbei. Wahrenddes-sen kommentiert der Chirurg die Sicherheit dieser hoch entwickel-ten Technologic. Mit Hilfe eines pulsregulierten Stromdrahts entfernt der Chirurg uberfliissige Zellsubstanz, die das Abfliefien von Fliissig-keiten durch den Trakt verhindert, und kauterisiert offene Blutgefafie. Alle paar Minuten sehen wir eine Gesamtaufnahme, die die ganze Szene zeigt: Der narkotisierte Korper des Patienten ist mit Ausnahme der
16 Die medizinische Talkshow Chirurgenwerk startete 1990 und ist von der Evange-lischen Rundfunkanstalt (Evangelische Omroep), dem konservativsten der danischen offentlichen Sender, wochentlich gesendet worden. Die Talkshows werden von Rene Stokvis produziert; das hier diskutierte Programm wurde 1997 ausgestrahlt.

58 Jose van Dijck
Spitze seines Penis ganz mit blauen Tiichern bedeckt, der Urologe sitzt auf einem Stuhl zwischen seinen Beinen. Nur ganz am Ende des Films, als der Arzt zeigt, wie der Urinaltrakt ausgespiilt und gereinigt wird, er-haschen wir einen Blick auf das Instrument, das den Korper durch die natiirliche Offnung penetriert. Genau wie ein Einschnitt in die Haut den gewohnlichen Betrachter abstofit, wiirde die tatsachliche Penetration des Penis durch das Uroskop die Fernsehzuschauer definitiv ab-stofien.
Wieder zuriick im Studio versichert ein munterer, lachelnder Patient den Zuschauern, dass er von der Operation keine Schmerzen oder sons-tigen unangenehmen Folgen erlitten habe; Reste von Schiichternheit sind der Bewunderung fiir den Chirurgen gewichen.
Die Szene ahnelt einer gefiihrten Tour durch eine Kohlenmine, wo man zusieht, wie fortgeschrittene Technologic eingesetzt wird, um einen eingestiirzten Tunnel zu offnen. Die runde Kante des Rohrentunnels begrenzt den Blick des Betrachters auf einen eingeschrankten Fokus; das triibe Licht tragt noch zu der untergriindigen Spannung am Ort des Geschehens bei. Durch die Videokamera, die den Blick und die Hand-lungen des Chirurgen registriert, bekommen die Zuschauer nur das zu sehen, was der Tourleiter sie sehen lassen mochte: fortschrittliche Technologic, einen geschickten Chirurgen und einen zufriedenen Patienten. Vermittelt durch die endoskopische Kamera wird die Haut, die den Mann »personalisiert«, symbolisch entfernt, wahrend sie tatsachlich unverletzt bleibt. Die endoskopische Kamera fallt mit der Fernseh-kamera zusammen und ermoglicht es so den Zuschauern, sich visuell in den Penis und in den Urinaltrakt des Mannes zu begeben. Obwohl wir wahrend des chirurgischen Verf ahrens keinen Teil seiner Haut sehen, verbinden wir die bewegten Bilder des Korperinneren mit dem Patienten im Studio und identifizieren den Besitzer dieses mannlichen Re-produktionswerkzeugs. Interessanterweise scheint das Blofilegen des Inneren dieses Mannes weniger Anlass fiir offentliche Scham oder Pein-lichkeit zu sein als das Filmen seines Penis von aufien. Der potenziell voyeuristische, sexuell konnotierte Blick, der das Auge von aufien ins Innere des Korpers lenkt, wird ganzlich vom klinischen, endoskopi-schen Blick libernommen, von der Sicht von innen, die offensichtlich alle nicht-medizinischen Signifikate ausloscht.
Fast nicht wahrnehmbar werden in diesem Programm verschiedene Grenzen iiberschritten. Im Fernsehen betrachtet hat diese Talkshow das Format einer mise-en-abime. Im Wohnzimmer sitzend betrachten

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 59
wir Menschen im Studio, die sich selbst in einer Videoaufnahme im Operationssaal betrachten, wahrend uns der operierende Chirurg mit seinem Endoskop auf eine Reise in den Korper des Patienten mitnimmt. Obwohl es zwischen verschiedenen Zwischenebenen der Reprasenta-tion hin und her wechselt, ist der Effekt des Programms der, dass wir die Grenzen, die wir - ob legitim oder nicht - iiberschreiten, zu ver-gessen tendieren: den Fernsehbildschirm, die Studiowande, den Operationssaal und die Haut des Patienten. Operationssaal und Fernsehstudio sind nicht mehr zwei separate Spharen, sondern koagulieren auf dem Bildschirm in unserem Wohnzimmer. In der kulturellen Anwendung der klinischen Endoskopie wird die Chirurgin eine Teamleiterin, die Fernsehkamera ein Inspektionsinstrument und der Patient ein korper-liches Universum. Der ehemals private Raum des inneren Korpers ist zu einem offentlichen Raum fixr Besichtigungen geworden, und, wie die Logik der »fantastischen Reise« diktiert, diese Reise ist unschuldig, informativ und sogar unterhaltsam fiir den Zuschauer. Aber wie unschuldig oder informativ ist die Uberschreitung von Grenzen in einem solchen Programm?
Minimal-invasive Chirurgie hat fiir den Patienten unleugbar grofie Vorteile; doch die Reise in das Korperinnere und wieder hinaus ist heute so leicht, miihelos und schmerzlos geworden, dass ein ernsthaf-tes Risiko besteht, dass solche Eingriffe immer selbstverstandlicher werden/7 Leichte Symptome im Magen oder Schmerzen in der Bauch-gegend konnten allzu schnell zu einfach auszufiihrenden medizinischen Bildgebungsprozeduren fiihren. Wahrend zuvor die Diagnostik bedroh-licher war als Krankheit und Therapie zusammen, kann jetzt die relativ geringe Auswirkung kombinierter diagnostisch-operativer Verfahren bedeuten, dass chirurgische Eingriffe immer haufiger werden.^^ In der offentlichen Wahrnehmung mag eine Endoskopie gleichbedeutend mit einer Rontgenaufnahme oder Ultraschalluntersuchung werden, so dass unkenntlich wiirde, dass all diese Verfahren inharent invasiv sind. Aber Endoskopien sind immer noch chirurgische Eingriffe, und selbst wenn
17 A. Cushieri / G. Berci formulieren diese Warnung in Laparoscopic Biliary Surgery, Oxford 1990, S. IX und 109. 18 Eine Diskussion dieser Problematik einer niedrigeren Schwelle fiir endoskopische Chirurgie findet sich beispielsweise in F. FroehHch / J. J. Gonvers, »Gastrointestinal Endoscopy: Do We Perform too Many or not Enough Procedures?*, in: Canadian Journal of Gastroenterology 13 (1999), S. 345 f.; L. Seematter-Bagnoud / J . Vader, »Overuse and Underuse of Diagnostic Upper Gastrointestinal Endoscopy in Various Clinical Settings*, in: International Journal for Quality in Health Care 11 (1999), S. 301-308.

6o Jose van Dijck
sie nur geringe Narben auf der Haut hinterlassen, ist doch jede Penetration der Oberflache ein Eindringen ins Innere.
Fernsehbilder von Koperreisen leisten einer falschen Wahrnehmung von Transparenz und Non-intervention Vorschub. Obwohl der Zu-schauer die Vorstellung haben soil, Live-Zeuge einer tatsachlichen chi-rurgischen Expedition zu sein - ungeschnitten, direkt vom Ort des Ge-schehens -, sind diese Reisen durch dramatische Konventionen und Sendeprotokolle stark vermittelt. Das Gefiihl von Unmittelbarkeit ist weitgehend das Ergebnis von optischen Effekten, nicht der Technolo-gie als solcher; aufierdem werden die Schnitttechniken von narrativen Konventionen strukturiert, und die Auswahl gewisser Sequenzen wird von den herrschenden asthetischen und ethischen Normen bestimmt. Es ist offensichtlich, dass der Korperraum sorgfaltig nachbearbeitet wird, um nur appetitliche Ansichten zu zeigen und jegliche Szene, die den Betrachter abstofien konnte, auszulassen. Fernsehbilder von Kor-perreisen suggerieren, dass die chirurgische Expedition eine harmlose Operation ist, was durch eine nahezu unversehrte Haut belegt wird; entsprechend schiitzen im Fernsehen iibertragene Szenen den Betrachter vor zu viel Empathie, Unbehagen oder unangenehmen Konfronta-tionen. Der herrschende klinische Blick in diesen Programmen ist das Ergebnis einer doppelten Vermittlung: Der Korper wird sowohl durch die endoskopische Kamera wie auch durch die Fernsehkamera gefiltert und gesaubert. Die Operation wird zu einer non-invasiven, fast asthetischen Erfahrung gemacht, ungetriibt durch Schmerz, Narben ver-ursachende Instrumente oder potenzielle Komplikationen. Der neue video-endoskopische Blick hat tiefe Auswirkungen auf die Konfigura-tion des inneren Raums, indem er den Eindruck hinterlasst, dass unvor-hergesehene Imperfektionen oder unerwiinschte Wucherungen durch non-invasive Technologien, die den Korper nahezu unangetastet lassen, leicht entfernt werden konnen.
Von innen hineinschauen
1966 bot der Film Fantastic Voyage seinen Zuschauern einen imaginier-ten Blick in eine Zukunft, in der Operationen ohne Messer und Narben eine iibliche chirurgische Praxis werden wiirden. Fiinfunddreifiig Jahre spater sind es nicht nur Filmemacher, die die Fantasie von Experten, die in den Korper reisen, um lebensbedrohliche Tumore zu entfernen,

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 61
und durch natiirliche Offnungen entkommen, nahren. Die Medizin hat ihre eigenen Futurologen hervorgebracht, und es soUte uns nicht iiber-raschen, dass die medizinische Fantasie allzu oft von derselben Mischung aus Projektion und Extrapolation gespeist wird, die Hollywood-Regis-seure inspiriert hat und heute noch inspiriert. Im vergangenen Jahr-zehnt haben Chirurgen und medizinische Experten offentlich prophe-zeit, wie fortgeschrittenere Computertechnologien unser gegenwartiges Potenzial, einen erkrankten Korper zu visualisieren, zu bereisen und zu reparieren, verbessern werden. Die veroffentlichten Projektionen eini-ger prominenter medizinischer Wissenschaftler, deren Extrapolationen gegenwartiger technologischer Entwicklungen einen klaren Glauben an die ultimative Fantasie des perfekten, permeablen und unangetasteten Korpers bezeugen (und deren Fantasien wahrscheinlich die Zukunft medizinischer Technologic und Praxis steuern werden), verdienen cine genauere Untersuchung.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ersetzen Digitaltechniken rasant die analogen Instrumente. Das plotzhche Wachstum computergestiitzter Bildgebungstechnologie begann in den friihen neunziger Jahren, als digitale Pulsmodulation oder Digitalisierung die Telekommunikations-systeme (Fernsehen und Video) kompatibel machte mit medizinischen BildgebungsinstrumentenwieComputertomographie,Magnetresonanz-bildern und konfokaler Mikroskopie. Diese Instrumente ermoglichen die dreidimensionale Betrachtung des Korperinneren und tragen so dazu bei, gravierende Einschrankungen der analogen Video-Endoskopie zu iiberwinden. Die vermittelnde Kamera und der Bildschirm geben nur cine zweidimensionale Reprasentation dreidimensionaler Organe und Zwischenraume. Zudem lasst die Kamera, die im Korperinneren her-umwandert, nur eine einzige Perspektive zu und engt so die Fokalisie-rungsmoglichkeiten der Chirurgin ein. Obwohl das Video-Endoskop Zugang zum Korper unter der Haut hat, ist dieser Zugang eingeschrankt: Die Kamera kann nicht tatsachlich ins Herz, ins Hirn oder in die Niere gelangen. Und obwohl es inzwischen Minikameras von weniger als einem halben Millimeter Durchmesser gibt, die in die Arterien einge-fiihrt werden konnen, um Blutklumpen zu entdecken, konnen sic die Innenseite einer Zelle nicht aufnehmen. Schliefilich bedeutet das Un-behagen vor einer (lokaler) Narkose und einem Einschnitt - obwohl minimal - unerwiinschten Stress fiir den Patienten.
Digitale oder virtuelle Endoskopie wird den medizinischen Futurologen Richard Satava und Richard Robb zufolge die Video-Endoskopie

6l Jose van Dijck
in vieler Hinsicht nachahmen und den Korper letztlich transparent ma-chen.^^ Anders als »reale« Endoskopie bietet ihr virtuelles Aquivalent dreidimensionale Reprasentationen von jedem moglichen Winkel aus und ermoglicht so den vollen optischen Zugang selbst zu den versteck-testen und kleinsten Teilen unseres Korpers. Computer konnen aus den digitalen Daten, die von verschiedenen Korperscannern gewonnen wer-den, dreidimensionale Bilder rekonstruieren. Zusammen mit hoch ent-wickelten Computeralgorithmen ergeben diese Daten hochauflosende Bilder, die die bewegten Filme eines Endoskops imitieren und sogar er-setzen konnen. Dies ermoglicht es dem Auge der Chirurgin, das Kor-perinnere von nahezu jedem Punkt aus zu visualisieren, die Wande von Organen zu durchdringen und durch Gefafie und Trakte zu fliegen, in denen eine Kamera sich physisch unmoglich bewegen konnte. Der Trick bei virtueller Endoskopie besteht darin, dass sie einem Video-film ahnelt, der mit einer wirklichen Kamera im Korper aufgenommen wurde, der jedoch tatsachlich nur die Projektion eines angeblich existie-renden Innen ist. Dem Konzept virtueller Endoskopie liegt die Idee zu Grunde, dass der reale Korper als raumliche Information reprasentiert wird, die zu einer hochauflosenden Visualisierung fiihrt, welche weder Foto noch Modell ist, sondern eine animierte Rekonstruktion errech-neter Daten.
Die zukiinftige Digitalisierung des Operationssaales, inklusive der Verwendung virtueller Endoskopie, wird substanzielle Auswirkungen auf die chirurgische Praxis haben. Satava und Robb sagen voraus, dass Chirurgen in nicht allzu ferner Zukunft in der Lage sein werden, sich in einem virtuellen Korper zu bewegen. An Stelle der flachen, zwei-dimensionalen Wiedergaben von Videobildern, die auf einem sperrigen Schirm im Operationssaal angezeigt werden, konnen die Bilder, die aus dreidimensionaler virtueller Endoskopie resultieren, raumlich auf drei verschiedene Arten angezeigt werden. Eine Moglichkeit besteht darin, dass die Chirurgin eine Stereobrille oder eine auf dem Kopf montierte Anzeige tragt, die sie an eine strategisch giinstige Position innerhalb einer Reprasentation der gewonnenen Daten versetzt; indem die Chirurgin sich in einem virtuellen Korper bewegt, hat sie das Gefiihl vollstan-
19 Siehe Richard M. Satava, Cyhersurgery: Advanced Technologies for Surgical Practice, New York 1998; siehe auch Richard A, Robb / S. Aharon, »Patient-specific Anatomic Models From 3-dimensional Medical Image Data for Clinical Apphcations in Surgery and Endoscopy*, m: Journal of Digital Imaging 10 (1997), S. 31-35.

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 63
diger Immersion, die es ihr ermoglicht, von innen hineinzuschauen.^° Das Interface ermoglicht eine Wahrnehmung, bei der der Benutzer im Feld der Visualisierung platziert ist. Satava sieht die Chirurgen in einem wiirfelformigen Raum von drei Meter Kantenlange herumgehen, in dem die dreidimensionalen Bilder projiziert werden/^ Giinstig fiir Lehrzwecke oder als Publicity, jedoch ganzlich nutzlos fiir die Diagnos-tik, ist die Bildschirmanzeige digitaler physiologischer Daten als ani-mierte Videosequenz einer bestimmten Flugbahn, beispielsweise durch die Speiserohre oder durch die Bronchien. Techniker konnen die Algo-rithmen so stark verandern, dass animierte Bildfolgen oder Durchfliige als realistische, wie von bewegten Augen erzeugte Blicke auf dem Bild-schirm erscheinen. Mit anderen Worten, virtuelle Endoskopie bietet Betrachtungsmoglichkeiten, die iiber das Potenzial realer Endoskopie hinausgehen, so dass das Auge der Chirurgin und der Offentlichkeit an Orte reisen kann, wo die materielle Kamera nicht hingelangt. Die Vir-tualisierung des Patientenkorpers ist in der Tat die Umkehr der Idee der Miniaturisierung, wie sie in Fantastic Voyage durchgespielt wird: Statt das Operationsteam zu schrumpfen, wird der Korper zu iiberpropor-tionaler Grofie aufgeblasen.
In der Zukunft soil diese Technologic der Chirurgin beim Navigie-ren und Operieren helfen: Satava sagt die Entwicklung von Opera-tionsrobotern voraus, welche Operationen viel genauer und sauberer ausfiihren als reale Chirurgen. Im selben Atemzug sieht er ein be-schleunigtes Wachstum bei der Verwendung von Laserstrahlen voraus, die unerwiinschte Wucherungen entfernen konnen, ohne die Haut zu penetrieren. Wahrnehmung, Navigation und Schneiden werden alle-samt computervermittelte Aktivitaten, chirurgische Akte per Joystick und Computermaus. Natiirlich werden diese neuen Technologien die chirurgischen Fertigkeiten tief greifend verandern. Eine neue Generation von Chirurgen wird, so postuliert Satava, darin geschult werden miissen, »ihre okulo-vestibulare Achse fiir die visuelle Orientierung von der haptisch-propriozeptiven Achse fiir die Manipulation zu ent-
20 Tim Lenoir, »The Virtual Surgeon«, in: Cahier de Science et Vie (Oktober 1999), S. 52-59, beschreibt detailliert, wie die Arbeit der Chirurgin sich in der neuen Opera-tionsumgebung verandern wird, insbesondere wenn das ARPA-System und das Phantom-System, zwei von Robotern operierte digitale Systeme, die bereits in experimenteller Verwendung sind, voll implementiert werden. Siehe auch E. L. Crimson, »Image-Gui-ded Surgery«, in: Scientific American (Juni 1999), S. 62-69, f ^ ^i^^ klare technische Be-schreibung dieser Hightech-Umgebungen. 21 Satava (wie Anm. 19), S. 22.

64 Jose van Dijck
koppeln«/^ Kinder, die mit Computerspielen aufgewachsen sind, haben die Fahigkeit, visuelle und manuelle Fertigkeiten zu entkoppeln, da sie die Maus als tatsachliches Navigationsinstrument betrachten. Die heu-tigen Nintendo-Kids werden, so versichert uns Satava, die digitalen Arzte von morgen werden - »fur die es natiirlich ist, ein Videobild als reales Objekt zu betrachten, und die den Joystick als Schere benutzen konnen«/^
In dieser Zukunftsvision der Cyberchirurgie ahnelt der Korper des Patienten mehr einer Ansammlung von Daten als einem physischen Objekt. Indem sie sich im Korperraum herumbewegt, kann die Chi-rurgin eingescannte Daten des Korpers aufrufen und sie mit anatomi-schen oder standardisierten Bildern verschmelzen, um Abartigkeiten genau zu identifizieren und zu lokalisieren. Natiirlich ist die raum-liche Entfernung zwischen Chirurgin und Patient dann nicht mehr relevant; mit Hochgeschwindigkeits-Dateniibertragung macht es keinen Unterschied, ob der Patient in Tahiti liegt, wahrend die Chirurgin in Sibirien stationiert ist. Virtuelle Endoskopie und computergestiitzte Bildgebungstechnologien offnen einen Weg fiir die »Teleoperation«, wahrend Computer die physische Entfernung zwischen Chirurgin und Patient ausloschen.^^ Diese Entwicklungen wiederum werden den Operationssaal buchstablich zu einem Computerraum oder KontroU-zentrum machen - ein Bild, das an die Fantastic Voyage erinnert.
Einen prominenten Platz in den medizinischen Futurologien hat das utopische Konzept einer chirurgischen Intervention, die keinerlei unerwiinschte Auswirkungen auf den tatsachlichen Korper hat. Die schmerzlose und spurlose chirurgisch-diagnostische Expedition, wie sie in Fleischers Film verkiindet wird, scheint der Heilige Oral der Cyberchirurgie zu sein. Richard Satava sieht in der computerisierten Bild-gebung das ultimative diagnostisch-operative Instrument, das die medi-zinische Untersuchung so einfach macht wie den Routine-Check durch einen Scanner am Flughafen:
22 Ebd. , S. 142. 23 Ebd. 24 Fiir mehr technische Details zu dieser Praxis der Telechirurgie siehe P. Garner / M. Collins, »The Application of Telepresence in Medicine«, in: Telepresence, hg. von P.J. Sheppard und G. R. Walker, Boston 1999, S. 323-333; siehe auch J. Marescaux / D. Mutter, »The Virtual University Applied to Telesurgery: From Tele-Education to Tele-manipulation«, in: Bulletin de UAcademie Nationale de Medecine 183 (1999), S. 509-522.

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 65
»Ein Patient betritt das Biiro des Arztes und geht durch einen Tiirsturz, dessen Rahmen (wie heute auf Flughafen iiblich) viele Scanner-Instru-mente enthalt, von Computertomographie iiber Magnetresonanz bis hin zu Ultraschall, Infrarot und anderen. Diese Scanner holen nicht nur ana-tomische Daten, sondern auch physiologische und biochemische Infor-mationen ein. Wenn der Patient sich neben dem Arzt niederlasst, er-scheint iiber dem Desktop-Computer schwebend ein dreidimensionales Hologramm des Patienten, eine visuelle Integration der Information, die erst eine Minute zuvor von den Scannern eingeholt worden ist.«^^
In dieser utopischen Projektion wird der aus Digitaldaten rekonstru-
ierte Korper keinerlei optische Geheimnisse mehr fiir den Arzt haben,
der nun Krankheiten diagnostizieren und Interventionen planen kann.
Cyberchirurgen werden wahrscheinlich einige virtuelle Korperrouten
erkunden, u m die potenziellen Effekte verschiedener Interventionen
einzuschatzen und auf der Basis dieser Informationen eine Entschei-
dung zu treffen. Die Vorstellung eines Korpers, der im digitalen Raum
eingefroren und der virtuellen Zeit computerisierter Daten zuganglich
gemacht wurde, ahnelt der Vision eines »tentativen Korpers« - eines
»fantastischen Korpers«, der vom Arzt nach Belieben manipuliert wer
den kann. Der Wissenschaftler kann im Korper frei umherstreifen, um
dessen letzte Geheimnisse zu erkunden.
Intervention durch Nicht-Intervention ist kaum ein neues Verspre-
chen, als Uterarische Figur erscheint es in der westhchen Zivihsation
schon seit Jahrhunderten; es ist vielmehr ein altes Versprechen, das in
eine neue Technologic eingeschrieben v^ird. Ich v^ill keineswegs die Vor-
ziige virtueller Endoskopie fiir die Ausbildung und Schulung von Chi-
rurgen schmalern; diese medizinischen Futurologien sind jedoch eine
Herausforderung fiir unsere Fahigkeit und eine KompUkation beim
Versuch, zwischen ReaHtat und Fantasie, Projektion und Extrapolation
zu unterscheiden. Gegenwartig wird virtuelle Endoskopie lediglich
experimentell als diagnostisches Instrument oder als Schulungsmodell
genutzt. Klinische Langzeitversuche, wie sie die Food and Drug Admi
nistration (FSA) kiirzlich begonnen hat, miissen den Mehrwert virtueller
gegeniiber videobasierter Endoskopie und die Verlasslichkeit der com-
putergenerierten Bilder erst noch belegen.^^ Die Giiltigkeit digitaler
25 Satava (wie Anm. 19), S. 11. 26 Bisher waren Vergleiche zwischen virtueller und videobasierter Endoskopie nahezu ausschliefilich auf den Bereich der Kolonoskopie beschrankt. Siehe etwa Helen M. Fen-Ion, »A Comparison between Virtual and Conventional Colonoscopy for the Detection

66 Jose van Dijck
endoskopischer Bilder ist keineswegs selbstevident: Wie genau sind die Computeralgorithmen, die die Daten in Bilder iibersetzen? Wie werden sie verzerrt? Und was ist genau die Beziehung zwischen video-endosko-pischen Bildern und ihrem virtuellen Aquivalent? Die Frage ist nicht mehr wie bei der Video-Endoskopie, ob die Bilder klar oder hell genug sind, sondern ob sie tatsachlich zeigen, was da ist, und nicht zeigen, was nicht da ist/7 Die Genauigkeit der virtuellen Endoskopie ist nur schwer zu etablieren, da ihre Bezugswahrheit selbst von einem Instrument ver-mittelt und daher eine Reprasentation ist. Ein digitales Bild ist bereits eine Intervention oder, wie William J. Mitchell es nennt, eine »mise-en-image«: eine Kombination aus Komputation, Projektion und Reprasentation.^^
Wegen der hochrealistischen Qualitat der digitalen Bilder sind vir-tuelle Endoskopien schnell in die populare Kultur eingegliedert worden. Gescannte Daten konnen in anderen visuellen Umgebungen viel leichter manipuliert und integriert werden als Videobilder. Virtuelle Korper-reisen sind in der visuellen Unterhaltung zur neuesten Attraktion ge-worden. Body Story, ein britisches padagogisches Dokudrama, zeigt in jedem Teil der Serie jeweils eine andere Reise durch den Korper.^^ Im Wechsel von gespielten Szenen mit Schauspielern und »re-animierten« Sequenzen virtueller Endoskopie erzeugt die Sendung die Illusion, dass
of Colorectal Polyps«, in: New England Journal of Medicine 341 (11. November 1999), S. 1496-1503; siehe auch Martina M. Morrin, »Virtual Colonoscopy: A Kinder, Gentler Colorectal Cancer Screening Test?«, in: The Lancet 354 (25. September 1999), S. 1048f. Zum Nutzen virtueller Endoskopie fiir chirurgischen Unterricht und Schulung siehe P. J. Gorman / A. H. Meier, »Simulation and Virtual Reality in Surgical Education - Real or Unreal?«, in: Archives of Surgery 134 (November 1999), S. 1203-1208. 27 Zum gegenwartigen Zeitpunkt ist virtuelle Endoskopie den meisten Forschern zu-folge weit davon entfernt, allgemein zum Scannen benutzt zu werden, so etwa John H. Bond, »Virtual Colonoscopy - Promising but not Ready for Widespread Use«, in: New England Journal of Medicine 341 (11. November 1999), S. 1540-1542. 28 William J. Mitchell, The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Photographic Era, Cambridge MA 1992, bes. S. 163-166, zur »mise-en-image«. Eugene Thacker, »What Is Biomedia?«, demnachst in Configurations, nimmt eine radikalere Haltung ein, indem er argumentiert, dass Informatik und Biologic (und entsprechend ihre jeweiligen Repra-sentationen) in den zeitgenossischen Biomedien, insbesondere in Bezug auf Bioenginee-ring und Genetik, komplex miteinander verflochten sind: »Biomedia ist weder ein tech-nologisches Instrument, noch eine Essenz von Technologic, sondern eine Situation, in der eine technische, informatische Rekontextualisierung biologischer Komponenten und Prozesse es dem Korper ermoglicht, sich selbst in Erscheinungsformen zu zeigen, die bio-logisch oder nicht-biologisch, medizinisch oder militarisch, kulturell oder wirtschaftlich sein mogen.« 29 Body Story, eine achtteilige Serie der BBC Television, 1998, wurde von verschiede-nen europaischen Sendeanstalten 1998 und 1999 ausgestrahlt.

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 6"/
wir Zuschauer sind, die den Beginn und die progressive Entwicklung eines Herzschlags miterleben. Wir folgen zunachst einem 45-jahrigen Bauunternehmer in Stresssituationen bei der Arbeit, beim Hamburger-essen zu Mittag und schliefilich beim Ballspiel mit einigen seiner Kolle-gen. Alle paar Minuten zoomt die Kamera in seinen Brustraum, und wir schalten um zu virtuellen Bildern aus dem Inneren seines Herzens und seiner Eingeweide. Die endoskopische »Kamera« nimmt den Betrach-ter mit auf eine Achterbahnfahrt durch verschiedene Organe, und die wirbelnden Bilder aus dem Bauch des Mannes sehen so realistisch aus wie die Bilder, auf denen man sieht, wie er den Ball wirft. Eine Kom-mentarstimme unterstiitzt, was unsere Augen sehen: Die Hauptarte-rien sind so verstopft, dass das Herz das Blut nicht mehr durchpumpen kann. Schliefilich erleben wir den Stillstand des Pulses aus dem Inneren des Herzens.
Die zwischen dem aufieren und dem inneren Korper bestandig wech-selnden Betrachterstandpunkte fiigen die virtuellen und realen Video-bilder sauber auf der gleichen Reprasentationsebene zusammen. Anders als Video-Endoskopie konnen virtuelle Reanimationen unsere Blicke durch Organwande fliegen und jeden Ort oder Perspektive einnehmen lassen. Wie Steve Connor argumentiert, ist in der Epoche der Digital-medien die tatsachliche Haut aufgelost und durch eine »polymorphe, unendhch mobile und ausdehnbare Haut sekundarer Simulationen« er-setzt worden.^° Mit anderen Worten, die Immersion in einen virtuellen Korper impliziert, dass der Betrachter zum Einnehmen eines Proprio-zeptionsstandpunkts verfiihrt wird, den er physisch nie einnehmen kann. Indem die virtuelle Endoskopie die natiirlichen Grenzen zwischen Organen auflost, loscht sie die Unterscheidung zwischen dem realen, dem vermittelten und dem »fantastischen« (oder virtuellen) Korper auf. Obwohl die Idee einer intensivierten Immersion oder Erfahrung durch virtuelle Realitat immens verfiihrerisch ist, ist sie auch irrefiihrend. Da-mit der Durchflug sich real anfiihlt, miissen wir unsere imaginativen Fahigkeiten nutzen. Wir konnen diese digitalen Rekonstruktionen nie-mals in einem erfahrbaren Referenzrahmen verifizieren, weil kein phy-sisches oder elektronisches Auge tatsachlich durch Organe reisen kann. Die gespielten Szenen in Body Story sind offensichtlich fiktiv, aber rei-chen die virtuellen Simulationen in dieser BBC-Produktion aus - ob-
30 Steve Connor, »Integuments: The Scar, the Sheen, the Screen«, in: New Formations 39 (1999). S. 32-54> S. 52.

68 Jose van Dijck
wohl sie von »realen Korpern« abgeleitet sind - , um die Bezeichnung »Dokumentarfilm« zu verdienen?
Dokudramas wie Body Story tragen dazu bei, die Illusion zu ver-starken, dass virtuelle Korperinspektionen schmerzlos und spurlos sind; medizinische Diagnostik und Intervention erscheinen dariiber hin-aus als angenehm und sogar abenteuerlich. Es soUte uns daher nicht iiberraschen, dass die korperlichen Durchfliige nicht nur nach »rea-len« (Video-)Endoskopien modelliert sind, obwohl sie durchaus so aus-sehen. Die virtuellen Endoskopien im Fernsehen sind so stilisiert, dass sie dem Format popularer Attraktionen in der Unterhaltungsindustrie entsprechen. Die Achterbahnfahrt in die Speiserohre wiirde nicht funk-tionieren, wenn wir nicht die Erfahrung von Disney-World-Attraktionen wie dem »Space Mountain Ride« oder den »Body Wars« hatten.^^
Virtuelle Endoskopien sagen uns vielleicht mehr liber unsere Repra-sentationskonventionen als iiber unseren »realen« Korper. Sie sind, wie Erkki Huhtamo sie nennt, »technologisch-metapsychologische Maschi-nerien zur Erzeugung gewisser kognitiver und emotionaler Geistes-zustande«.^^ Sowohl als medizinische Diagnostik wie auch als Fern-sehprodukt ist virtuelle Endoskopie der technologische Ausdruck eines kulturellen Begehrens. Computergestiitzte Gastroskopien bedeuten den Hohepunkt einer ultimativen Immersion in den Korper. Zuschauer, die im Computerzeitalter aufgewachsen sind, lassen sich, wie Jay Bolter und Richard Grusin argumentieren, nicht mehr mit Reprasentationen zufrieden stellen.^^ Sie woUen vom Objekt eingesaugt und aufgesogen werden; sie wollen das Organ oder Molekiil nicht sehen, sie woUen er-fahren, wie es ist, innen drin zu sein. Das Begehren, die physiologischen Grenzen des Korpers, des Organs und des Molekiils zu iiberwinden, ist synonym mit dem Begehren, iiber die Grenzen der Reprasentation hinausgehen zu wollen. Manche wiirden behaupten, dass dreidimensio-nale Rekonstruktionen die wechselseitige Verschmelzung von Wahrneh-
31 Die Attraktion »Body Wars«, Teil der Epcot-Disney World in Florida, wird auf der Webseite so beschrieben: »Schrumpfe auf die Grofie einer Blutzelle und geh auf turbu-lente Fahrt durch den menschlichen Korper. Diese Attraktion im Stil eines Flugsimu-lators nimmt dich mit auf ein Rennen durch eine iiberlebensgrofie Version von Herz, Lunge und Hirn mit der Mission, einen Wissenschaftler zu retten, der im inneren Raum in einer Falle sitzt.« 32 Erkki Huhtamo, »Encapsulated Bodies in Motion«, in: Critical Issues in Electronic Media, hg. von Simon Perry, New York 1995, S. 159-186, S, 164. 33 Jay D. Bolter / Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media, Cambridge MA 1998, S. 166.

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 69
mung und Vorstellungsvermogen stimulieren; aus der Besichtigung wird eine Begehung, indem die Unterscheidungen zwischen dem Realen, dem Reprasentierten und dem imaginierten Korper sich in die Landschaft des digitalen Raums auflosen.
Der endoskopische Blick und der unangetastete Korper
Wie wir aus der Erkundung seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zu-kunft schliefien konnen, soUte die Geschichte des endoskopischen Blicks nicht ausschliefilich als die progressive Entwicklung eines medizinischen Instruments gesehen werden. Die Evolution dieses Blicks ist eng verbun-den mit den Instrumenten, die dazu beigetragen haben, ihn in die popu-lare Kultur hinein auszubreiten. In der konstruktivistischen Theorie ist es eine Binsenweisheit, dass die Geschichte medizinischer Technologien immer mit der Geschichte medizinischer Praxis verbunden ist; ebenso ist es ein Gemeinplatz, die Geschichte von Medientechnologien - von der Photographic bis zum Computer - in enger Verbindung mit entste-henden Reprasentationspraktiken zu studieren. Diese beiden Felder zu verschmelzen, mag wie der Versuch einer erzwungenen Koalition aus-sehen, aber das Entstehen des endoskopischen Blicks ist tatsachlich das Ergebnis einer solchen technologischen und kulturellen Ko-Evolution. Beide Entwicklungen sind durch eine lange Tradition in der westlichen Kultur verankert und von einem Glauben an Aufklarung durch technologischen Fortschritt genahrt. Der Film Fantastic Voyage verkorpert das Begehren, alles Subkutane zu sehen, auszustellen und zu rekonstruie-ren, wahrend der aufiere Korper »unberuhrt« bleibt. Wie Bildgebungs-technologien unsere Sicht der korperlichen Realitat verandert haben, ist vielleicht der weniger bekannte Subtext zu den verschiedenen Hel-denerzahlungen von Arzten als Entdecker und Patienten als passende Subjekte. Die Teleologie, dass fortgeschrittenere Instrumente zu besse-rer Behandlung fiihren, hangt von den My then ultimativer Transparenz und Nicht-Intervention ab. Zwischen der Praxis offener Operationen mit der Hilfe primitiver Gastroskope und virtueller endoskopischer Chirurgie auf der Basis einer Vielzahl digitaler Scanner haben wir die Fantasie des »unangetasteten Korpers« genahrt - unangetastet von den Instrumenten der Chirurgin und unangetastet von der standigen offent-lichen Blofilegung vor einem Massenpublikum.

/O Jose van Dijck
Die epistemologische, psychologische und imaginative Verfiihrung des Auges wurzelt in der Konvergenz medizinischer und medialer Tech-nologien. Die erste Art von Verfiihrung findet man in den unterschied-lichen Verschiebungen des klinischen endoskopischen Blicks. Primitive Endoskope ermoglichten es der Chirurgin, von aufien nach innen zu sehen: Der Korper war ausschliefilich dem Auge der Chirurgin zugang-hch. Wenn sie sich zur Operation entschied, musste der Korper auf-geschnitten werden. Das Anbringen einer Kamera am Ende der Rohre beendete das Privileg fiir das Auge der Chirurgin, indem der BHck von innen nach aufien nun von Patienten und anderen geteilt werden konnte. Video-Endoskopie reduziert die Lange des Einschnitts, der fiir das Ein-fiihren der Operationsinstrumente in den Korper benotigt wird: Sehen und Schneiden erfolgen durch einige winzige Locher in der Haut. Drei-dimensionale virtuelle Endoskopie offnet den endoskopischen BHck noch weiter: Wir schauen nun von innen hinein und durchdringen so-gar die Grenzen von Organen. Virtuelle Rekonstruktionen sind sowohl Reprasentationen wie auch Projektionen, und die epistemologische Unterscheidung zwischen Schneiden und Sehen verschwimmt, da beide Akte durch die Computermaus erfolgen.^^ p(jj- J^s digitale Auge und Messer der Chirurgin ist der Korper unendlich zuganglich und unend-lich formbar.
Die psychologische Verfiihrung der endoskopischen Reprasentationen kann man primar in ihrer Einverleibung durch die Medientechno-logien beobachten. Mehr als Rontgen oder Ultraschall verfiihrt uns das Endoskop zu dem Glauben, dass wir eine perfekte mechanische Repro-duktion unseres Korperinneren erhalten - Endoskopie als Landschafts-photographie der Medizin. Wir haben inzwischen jedoch gelernt, dass jede neue Bildgebungstechnologie neue Probleme der Wahrnehmung und Interpretation aufwirft. Wenn iiberhaupt ist der endoskopische Blick im Ergebnis der Kombination verschiedener Digitaltechniken, die jeweils unterschiedhche interpretative Fahigkeiten erfordern, kom-plexer und opaker geworden. Wahrend einerseits endoskopische Tech-nologien den Patienten mehr visuellen Zugang und, so konnte man argumentieren, mehr Macht iiber den eigenen Korper geben, verursacht dieselbe Transparenz andererseits die Problematik von zu viel Zugang.
34 Eine interessante Analyse digitaler Instrumente (insbesondere 3D-Ultrasound) und des philosophisch-ideologischen Rahmens fiir die Beantwortung von Fragen der Kor-pervorstellung findet sich in Karen Barad, »Getting Real: Technoscientific Practices and the Materialization of Reality«, in: Differences lo (1998), S. 87-128.

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 71
Video-Endoskopie hat friihere Vorstellungen korperlicher Integritat verandert: Das Korperinnere ist nicht mehr eine private Zone, die vor den neugierigen Augen von Aufienstehenden geschiitzt ist. Als die Chi-rurgin den Korper noch offnen musste, um zu sehen, was rauszuschnei-den war, war dieser Korper eine relativ abgeschlossene und abgeschie-dene Gegend; ironischerweise ist das Korperinnere nun, da der aufiere Korper wahrend des chirurgischen Aktes nahezu geschlossen bleibt, fast zu offentlichem Eigentum geworden.^^
Das intime Selbst wird Teil einer offentlichen Erfahrung, die von chirurgischen Instrumenten und Instrumenten der Medienreprasenta-tion vermittelt wird. ^ Patienten, die von Bildern versehrter Korperober-flachen und offen gelegter Korperteile eingeschiichtert sind, werden es sich zweimal iiberlegen, bevor sie irgendein chirurgisches Verfahren iiber sich ergehen lassen. Im Fernsehen betrachtet sehen endoskopische Operationen einfach, schmerzlos und zuweilen sogar vergniigUch aus.^^ Visuelle Asthetik definiert die Normen der Betrachter: Etwas, das schon und attraktiv aussieht, kann nicht schmerzhaft oder gefahrhch sein.^^ Der medizinische endoskopische Bhck beinhahet und definiert die Ethik des Sehens bei den Zuschauern.
Kombinierte medizinisch-mediale Technologien machen den Korper transparent, aber Transparenz ist durch Medienkonventionen und SendeprotokoUe stark gefiltert. Durch weite Ausstrahlung in den Mas-senmedien fiihrt deren Asthetik neue Definitionen fiir die Toleranz gegeniiber chirurgischen Verfahren ein. In der AUtagskultur wird der Korper zunehmend empfangUcher fiir chirurgische Eingriffe.
35 Tim Lenoir / Xin Wei Sha, »Authorship and Surgery: The Shifting Ontology of the Virtual Surgeon«, in: From Energy to Information, hg. von Bruce Clark und Linda Henderson, Stanford 2002, argumentieren, dass die Implementierung neuer virtueller Technologien anderen Menschen als nur der Chirurgin Macht iiber den chirurgischen Korper einraumt. 36 Huhtamo (wie Anm. 32), S. 171, argumentiert, dass »Technologie allmahlich zur zweiten Natur wird, zu einem gleichermafien externen und internalisierten Territorium und zu einem Objekt des Begehrens«. 37 Anne Balsamo, Technologies of the Gendered Body: Reading Cyborg Women, Durham 1996, S. 132, weist darauf hin, dass polierte Bilder Korper scheinbar transparenter machen, dass das aber nicht automatisch zu einer besseren Diagnose oder Behandlung fiihrt. Mehr als alles andere erzeugen solche erhebenden Bilder hohere Erwartungen und Normen gegeniiber dem manipulierbaren Korper: »Die Tatsache, dass virtuelle Realita-ten neue Informationsumgebungen bereitstellen, garantiert nicht, dass Menschen die Informationen besser nutzen werden.« 38 Zum Einfluss von Betrachterasthetik auf Patientennormen siehe Eugene Thacker, »Performing the Technoscientific Body: Real Video Surgery and the Anatomy Theater«, in: Body and Society 5 (1999), S. 317-336.

72 Jose van Dijck
Bezeichnenderweise ist ein fiir chirurgische Eingriffe zunehmend empfanglicher Korper immer weniger tolerant fiir Narben, die von den Instrumenten verursacht werden. Das bestandigste Element in der Logik der Korperreise - und, so konnte man argumentieren, auch ihr mythischstes Element - ist die angebliche Fahigkeit der Chirurgin, den Korper magisch zu heilen, ohne seine Oberflache zu vernarben. Endoskopisch unterstiitzte Chirurgie hat eine Metamorphose von einer hoch-invasiven zu einer minimal-invasiven und zu einer projizierten non-invasiven Technik durchgemacht. Die Konvergenz optischer und chirurgischer Instrumente reprasentiert die vorderste Front der Techno-logie, doch die Chirurgen versuchen genau das zu vermeiden: den Schnitt in den Rand (die Haut) des Korpers. Korper ohne Grenzen sind die nachste grofie Herausforderung. Mit der Ankunft virtueller Endo-skopietechnologien scheint das Korperinnere weniger ein physisches Objekt als eine digitale Umgebung - ein Ort des Schauens und Spie-lens.^^ Die Haut ist nicht mehr eine substanzielle Barriere fur den chi-rurgischen Eintritt; und wenn man die Haut umgehen kann, scheinen Narben vermeidbar. Erwartungen eines gesunden und modifizierbaren Inneren steigen proportional mit der Erwartung eines unangetasteten Aufieren im Topzustand. Reparative Medizin halt ein magisches Ver-sprechen, das Versprechen, das von Sciencefiction-Filmen oder popula-ren Fernsehserien wie Fantastic Voyage, Chirurgenwerk und Body Story artikuliert wird.
Neben den epistemologischen und psychologischen Auswirkungen des endoskopischen Blicks macht die imaginative Verfiihrung der Reise ins Korperinnere einen weiteren wichtigen Faktor in der Entwicklung der Endoskopie aus. Wer Fantastic Voyage lediglich als merkwiirdige Hollywood-Fabrikation, typisch fiir die Zeit des Kalten Krieges ansieht, unterschatzt stark den substanziellen Einfluss dieses Films auf die medi-zinisch-technologische geistige Haltung. Wissenschaftler wie Richard Robb und Richard Satava erwahnen den Film ausdriicklich als Inspira-tionsquelle, und mit jeder neuen Stufe im Fortschritt der Endoskopie dient Fleischers Film als Bezugsrahmen, um diese Technologic in den
39 Pierre Levy, Becoming Virtual: Reality in the Digital Age, New York 1998, S. 40, argumentiert, dass Scanner und andere medizinische Bildgebungstechniken die mensch-liche Haut ausloschen, aber zugleich neue Schichten erschaffen: »Jedes neue Gerat fiigt unserem tatsachlichen Korper eine weitere Art Haut hinzu, einen weiteren sichtbaren Korper. Der Organismus wird wie ein Handschuh umgestiilpt. Das Innere erscheint au£en, wahrend es innen bleibt. Denn die Haut ist auch die Grenze zwischen dem Selbst und der auEeren Welt.«

Fantastische Reisen im Zeitalter der Endoskopie 73
Blick zu bekommen. Als die New York Times beispielsweise auf ihrer Wissenschaftsseite von der Erfindung einer so genannten endoskopi-schen Pille berichtete, wurde mit den folgenden Zeilen eroffnet: »Wie man Raquel Welch hineinbekommt, haben die Wissenschaftler [...] nicht herausgefunden, aber sie haben eine pillengrofie Videokamera hergestellt, welche eine fantastische Reise durch den Verdauungstrakt unternimmt und unterwegs Bilder sendet.«'^° Die Geschichte von der miniaturisierten Raumkapsel strukturiert hier wieder einmal die pro-jizierte Entwicklung einer medizinischen Bildgebungstechnologie. In der nahen Zukunft erwarten Wissenschaftler eine Kamerapille, die Instrumente von molekularen Proportionen enthalt, welche das Problem wahrend ihrer Untersuchungsreise durch den Verdauungstrakt beheben, ohne auch nur eine einzige sichtbare Spur auf der Haut zu hinterlassen. »Nicht ganz der Stoff, aus dem die HoUywood-Traume sind«, so schliefit der Journalist, aber das Ergebnis konvergierender Nanotechnologie und medizinischer Bildgebungsverfahren.
Medizinische Instrumente, Medientechnologie und technologische Fantasie sind in der Entwicklung des neuen endoskopischen Blicks un-aufloslich verbunden - des Blicks von innen, der den Korper als permeable Entitat imaginiert. Vielfaltige Vermittlungen offnen den Korper entlang der verschwindenden Privatsphare einer professionalisierten Medizin und erzeugen einen neuen medizinischen Blick, der das Of-fentliche mit dem Intimen verbindet. In einer Kultur, die den offent-lichen Kameras immer mehr Raum gewahrt, sind medizinethische Fra-gen zugleich medienethische Probleme; die Ethik der Reprasentation ist daher ein integraler Teil der Asthetik, wie Korper ohne Grenzen gezeigt werden. Das Versprechen einer vollkommen schmerzlosen und flecken-losen Korperreise sollte daher zugleich als eine medizinische Ambition, als eine Produktion der popularen Kultur und als ein kollektives Ver-langen analysiert werden.
(Aus dem Englischen von Benjamin Marius Schmidt)
40 The New York Times (30. Mai 2000), S. D3.

Martin Warnke
Synthese Mimesis Emergenz Entlang des Zeitpfeils
zwischen Berechenbarkeit und Kontingenz
Die Zeit der Computer
Eine Beschreibung der Computerkultur wird als deren wesentliches Merkmal ihre beispiellose Dynamik zu registrieren haben. Kein ande-res technisches Phanomen hat in dermafien kurzer Zeit Gesellschaft, Okonomie und Kultur der entwickelten Industrienationen so stark ver-andert wie der Computer.
Dabei ist es seltsam, dass der Griindungstext der Informatik, Alan Mathison Turings »On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem«/ iiber Zeit nicht redet, dass diese nur im-phzit im Nacheinander der Verarbeitungsschritte der Turing-Maschine, also im Maschinentakt, eine RoUe spielt. Und das, obwohl die Informatik zu den hastigsten, schnelllebigsten, sogar am heftigsten von Moden heimgesuchten Wissenschaften gehort, die unsere Wissenschaftskultur zu bieten hat. Zeitlose Grundlagen fiir ein extrem dynamisches Metier? Kaum zu glauben.
Dieser Widerspruch liegt derzeit in der Luft.^ Eine Charakterisie-rung des Computers als Rechenmaschine allein wird vollig zu Recht als unbefriedigend, die Einbettung des Computers in kulturelle und soziale Prozesse als iiberfallig empfunden, es ist, kurz und knapp, eine Erkla-
1 Alan Mathison Turing, »On Computable Numbers, with an Application to the Ent-scheidungsproblem«, in: Proceedings of the London Mathematical Society 2/42 (1937) (deutsch in Bernhard Dotzler / Friedrich Kittler [Hgg.], Alan Turing Intelligence Service, Berlin 1987, S. 17-60). 2 Siehe etwa Wolfgang Coy, »[email protected] II«, in: Martin Warnke / Wolfgang Coy / Georg Christoph Tholen (Hgg.), HyperKult, Basel / Frankfurt am Main 1997 (= nexus 41), S. 15-32; Volker Grassmuck, Vom Animismus zur Animation: Anmerkun-gen zur kiinstlichen Intelligenz, Hamburg 1988; Georg Trogemann, »Experimentelle und spekulative Informatik«, in: Glaus Pias (Hg.), ZukUnfte des Computers, Zurich/Berlin 2004.
75

jG Martin Warnke
rung dafiir fallig, warum die Informationsgesellschaft eine Geschichte hat, obwohl ihr Griindungstext nicht von der Zeit redet.
Wie viele weitere Ideen entstand das Thema fiir diesen Text im Ge-sprach mit Glaus Pias. Irgendwie sind wir auf die Frage gestofien, inwie-weit und ob Computer Maschinen mit Geschichte sind, ob reversibel oder nicht. Meine Physiker-Antwort, dass sie natiirhch nicht-reversibel sind, weil sie bei der Arbeit warm werden, also Energie dissipieren, hat mich dann selbst nicht befriedigt, und so stellte sich die Frage, welche Arten von Entwicklung, welche Gesetzmafiigkeiten oder Zufalligkeiten benennbar sind, die der digitalen Informationstechnik einen Zeitpfeil, ein Jetzt, ein Zuvor und ein Danach geben.
Berechenbarkeit und Kontingenz
Turing ging es um etwas ganz anderes als Geschichte, als er 1936/37 sein Geschichte machendes Papier schrieb. Er hatte zwar eine Maschinen-metapher benutzt, aber er wollte keine Maschine bauen. Und auch seine so genannten »Bomben« von Bletchley Park, bei denen es ganz wesent-lich auf Geschwindigkeit ankam - schlieiSlich wollte er den Funkspruch entschliisselt haben, bevor das deutsche U-Boot die britische Fregatte versenkt hatte - , seine dann spater tatsachlich betriebenen Dechiffrier-Maschinen funktionierten nicht so wie seine beriihmteste, die nach ihm benannt wurde. Die Turing-Maschine hatte er erfunden, um klaren zu konnen, was berechenbar sei und was eben gerade nicht. Berechenbar nicht urspriinglich von einer Maschine, hier war eher an Menschen ge-dacht, die als Prozessoren, als Computoren, als Manifestationen einer Theorie gedacht wurden, die die Grundlagen der Mathematik zu klaren hatten: Was ist formalisierbar, was nicht?
Sein Ergebnis ist bekannt: Es gibt eine Grenze der Berechenbarkeit, jenseits deren formale Verfahren unbrauchbar werden. Und dabei spielt die Geschwindigkeit des Prozessors, und hier ist mit vollem Recht eher die weibliche Form zu wahlen: die Geschwindigkeit der Prozessorin, keine Rolle. Die Grenze ist absolut, keine noch so schnelle Rechnerin, kein noch so flinker Rechner wird sie jemals iiberwinden konnen.
Mithin bleibt, so der erste Blick, nur der Maschinentakt selbst, der in die Rechnerzeit eine Skala bringt. Heute nennen wir sie invers ganz ausschliefilich mannlich Prozessortaktfrequenz, und diese verdoppelt sich alle achtzehn Monate, so jedenfalls wollte es Gerald Moore, einer

Synthese Mimesis Emergenz JJ
der Intel-Griinder, und darum heifit das Gesetz auch das Mooresche. Nun haben wir Geschwindigkeit im Rechnergeschaft. Alles wird immer schneller berechenbar, nur das Nicht-Berechenbare, das Kontingente, bleibt, wo es ist: jenseits seiner Grenze. Diese Grenze bleibt, wo sie ist. Zwar spielt algorithmische Komplexitat noch immer und wohl fiir immer eine gehorige RoUe, es kann also rechnerisches Terrain durch schnellere Rechner erobert werden. Aber: Ist das die einzige Entwick-lung, die bis heute stattfand? Es kamen nach der Turing-Maschine doch der Computer, der Personal Computer, das Internet, Chatrooms, Tele-fone, die eigentlich Computer sind, mit ihnen Smart Mobs und die Cy-ber-Generation.
Die Trias »Synthese, Mimesis, Emergenz«
Hier wird der Vorschlag gemacht, eine Phanomenologie der Computer-kultur in drei Phasen einzuteilen, die durch eine jeweils eigene Dynamik gekennzeichnet sind, um schliefilich zum Phanomen der Geschichtlich-keit des Computers zu kommen.
Die erste Phase erstreckt sich iiber die Zeitraume, in denen Computer-wie in Turings urspriinglichem Entwurf- in autistischer Abgeschie-denheit^ aus sich heraus, ohne Eingriff oder Storung von aufien, Daten produzieren. Diese Phase soil die synthetische heifien.
Wenn signifikante Einfliisse von aufierhalb der Turing-Maschine, also Informationen, verarbeitet werden, aufiert sich dies auf dem Feld des Asthetischen in nachahmenden Verfahren: Wie der Marionetten-spieler seine holzerne Puppe tanzen lasst, ahmen Animateure vor, was Beobachter dann als Nachahmung empfinden. Diese zweite Phase soil die mimetische heiiSen.
Im letzten Schritt gerat auch das Meister-Knecht-Verhaltnis aus den Fugen: In grofiem Stile vernetzt, kann niemand mehr kontroUieren, was zwischen Milliarden Menschen und Maschinen geschieht. Die vormals, in den synthetischen und mimetischen Phasen, noch sinnvoU als isolier-bare Elemente eines Prozesses beschreibbaren Bewusstseine und Auto-maten erzeugen mit starker Wechselwirkung unvorhersehbare Erschei-nungen, weshalb diese dritte Phase auch die Phase der Emergenzen heifien soil.
3 Martin Warnke, »Das Medium in Turings Maschine«, in: Warnke / Coy / Tholen (wie Anm. 2), S. 69-82; http://kulturinformatik.uni-lueneburg.de/texte/warnke_1997.pdf.

78 Martin Warnke
Bei alien drei Phasen lassen sich je spezifische Abgrenzungen zwi-schen Berechenbarkeit und Kontingenz vornehmen, es gibt zugehorige Techniken, Theorien, Stile, Artefakte und Formen des Medialen. Alle drei Phasen werden gebraucht, um die Vielfalt der Phanomene beschrei-ben zu konnen, die die Informationsgesellschaft ausmachen. Die Theo-rie der Berechenbarkeit, zentral und erschopfend fiir die erste Phase, ist unzureichend, um die Lebensechtheit des Clownsfisches Nemo zu erklaren, und auch eine Theorie der mimesischen KontroUe ist restlos iiberfordert, die Emergenz etwa von eBay oder des Gender Swapping in Chatrooms der dritten Phase vorherzusagen. Allerdings lasst sich mit einiger Berechtigung behaupten, dass die Hard Sciences, und zu diesen soil die Informatik auch gezahlt werden, diesen Sachverhalt noch nicht so recht in ihren Kanon eingebaut haben.
Und nun ist es an der Zeit, fiir diese Behauptungen einige Plausibi-litaten anzufiihren.
Synth ese
Zu Beginn seines Buches General System Theory beschreibt Ludwig von Bertalanffy die klassische Methode der exakten Wissenschaften - um ihr im Folgenden seine Systemtheorie als Erweiterung entgegenzustel-len - , er charakterisiert die Methode der Hard Sciences als eine analy-tische: Phanomene werden untersucht in Hinblick auf ihre elementaren Konstituenten und deren Wechselwirkungen, gesucht wird nach isolier-baren Kausalketten, und verstanden hat man die Phanomene dann, wenn sie sich vollstandig aus ihren Elementen und deren basalen Operationen ergeben.4
Uns interessiert hier nun die operative Umkehrung. Das, was Computer tun, wenn sie, nur auf sich selbst gestellt, ihre Elemente operativ nach der Vorschrift des abzuarbeitenden Algorithmus rekombinieren. Dieses Tun muss dann synthetisch genannt werden. Synthese, der Auf-bau des Ganzen aus seinen Teilen, des Komplexen aus dem Einfachen, ist die Sache und das Prinzip der Turing-Maschine. Von Bertalanffy nennt sie die moderne und verallgemeinerte Form der mechanistischen Auffassung.^ Alan Mathison Turing hat in seinem Text von 1936/37 moti-
4 Ludwig von Bertalanffy, General System Theory, New York 1969, S. 18. 5 Ebd., S. 27.

Synthese Mimesis Emergenz J^
viert und beschrieben, was als Prinzip und Technik der ersten und ur-spriinglichen, der synthetischen Phase der Computerkultur gelten soil: die strikte Beschrankung auf ein streng formal arbeitendes Verfahren, um anhand eines Maschinenmodells die Prazisierung dessen zu klaren, was Rechnen und Berechenbarkeit sei. Endlichkeit, Uberschaubarkeit, Ausschluss von Zufall und Intuition, von all dem, was in Abgrenzung vom Notwendig-so-Seienden als Kontingenz bezeichnet werden kann, ist dabei die Grundvoraussetzung. Die Elemente, die im Verlauf der Maschinenaktivitat ins Spiel gebracht werden, die Zeichen eines Alphabets, ihre Notate, die Operationen, die an ihnen vorgenommen werden, werden nur in strikter Isolation betrachtet, ganz im Sinne des von Ber-talanffyschen Diktums einer modernen Form der mechanistischen Auf-fassung.
Die Reinform der Aktivitat der Turing-Maschine besteht bekanntlich darin, sie auf einem leeren Band arbeiten zu lassen, sie nach Mafigabe ihres Programms eine Zeichenkette schreiben zu lassen, die dann als Stellenfolge einer Zahl interpretiert wird, der von ihr berechneten Zahl.
Von Kontingenz keine Spur, alles geschieht deterministisch, zwangs-laufig, eben berechnend. Der Gewinn dieser Beschrankung ist die Cha-rakterisierung der Menge aller Zahlen, die so als iiberhaupt berechenbar gelten konnen: Sie ist erstaunlich klein, viel kleiner als die Menge all der Zahlen, die definierbar sind. Alles kann die Maschine nicht, noch nicht einmal alle schreibbaren Zahlen schreiben.
Fiir die Grundlagen der Mathematik hiefi das: Der logische Pro-zess ist keinesfalls durch Formalisierung abschlieCbar, etwa durch das Schreiben eines letzhinnigen Mathematikbuches wie etwa die Principia Mathematica von Alfred North Whitehead und Bertrand Russell.^ Nein, der logische Prozess ist schopferisch,^ verlangt Intelligenz, Mathematik lasst sich nicht mechanisieren. Fiir eine mathematische Theorie wird Kontingenz als das nicht Berechenbare immer wieder erforderlich sein, dort, wo sie, die Theorie, um neue Begriffe und Verfahren zu erweitern ist, damit sie ihre eigenen Probleme losen kann. Das jedenfalls hat Kurt Godel mit seinem Theorem zum Ausdruck gebracht, das Turing mit seiner Maschine umformuliert hat.
Die praktische Kunst der Computerprogrammierung hat in Form
6 Alfred North Whitehead / Bertrand Russell, Principia Mathematica, Cambridge 1910.
7 Robin Gandy, »The Confluence of Ideas in 1936«, in: Rolf Herken (Hg.), The Universal Turing Machine: A Half Century Survey, Wien / New York 1994, S. 51-102.

8o Martin Warnke
des Software-Engineering aus der Austreibung der Intelligenz aus der Maschine den folgenden Schluss gezogen: Die Mechanisierung von Pro-blemlosungen lasst sich nicht wirklich in den Griff bekommen, sondern nur durch die strikteste Einhaltung synthetischer Prinzipien in Grenzen zahmen, namlich durch Modularisierung, Hierarchisierung, Redun-danzvermeidung, ganz in Ludwig von Bertalanffys Sinne: mechanisch durch Entkopplung von Wechselwirkungen.
Die synthetische Phase wird hier als die erste vorgeschlagen, weil sie auch historisch am Anfang stand. Ihre technische ReaHsierung fand sie mit den Computern, deren Arbeitsweise strikt auf den Dreischritt Ein-gabe, Verarbeitung, Ausgabe reduzierbar war. Verarbeitungsunterbre-chungen, um Teilergebnisse in Augenschein zu nehmen, gab es nicht, alles, auch wenn es asthetischen Zwecken dienen sollte, musste a priori durch einen Algorithmus festgelegt werden, konnte erst nach Fertig-stellung beurteilt werden. Anders als mit einer mathematisch formu-herten Theorie des Asthetischen war das nicht zu machen, also stiitzte man sich auf die schon vorher entwickelte »Informationsasthetik«.^ Mit ihr entstanden dann auch die Kunstwerke. Auf dem Felde des Bildne-rischen waren dies die Computergraphiken von Georg Nees, Frieder Nake, Michael Noll, Manfred Mohr und anderen, die auf riesigen Plot-tern, gesteuert durch Lochstreifen, angefertigt wurden.
Betrachtet man Beispiele dieser Phase asthetischer Produktion, dann drangt sich der Eindruck eines spezifischen Stils auf. Er bestand zu-nachst aus den Elementarformen, die mit der verwendeten Maschinerie erzeugbar waren, samt und sonders elementar im Sinne der Theorie der Berechenbarkeit, also aus Geradenstiicken, algebraischen Kurven nie-derer Ordnung, aber auch Pseudozufall.
Eine zeitliche Entwicklung lasst sich festmachen an der Einfiihrung von Farbe, hoherer Auflosung und aufwandigeren Verfahren, etwa der Berechnung und Darstellung von Fraktalen. Der Zeitpfeil bekommt seine Richtung und seinen Betrag durch Moores Gesetz, durch die Ver-kiirzung der Schaltzeiten der Computerbauteile.
Eine der neuesten Produktionen algorithmisch erzeugter Kunst wurde 2003 noch auf der Ars Electronica in Linz pramiert. Es han-
8 Siehe zum Beispiel George David Birkhoff, »A Mathematical Theory of Aesthetics and its AppUcation to Poetry and Musics«, in: The Rice Institute Pamphlet 3 (1932), S. 189; Abraham A. Moles, Informationstheorie und dsthetische Wahrnehmung, Koln 1971; Frieder Nake, Asthetik als Informationsverarbeitung, Wien / New York 1974; Frieder Nake / Diethelm StoWer, Algorithmus und Kunst: »Dieprdzisen VergnUgen«, Ausstel-lungskatalog, Hamburg 1993, S. 70.

Synthese Mimesis Emergenz 81
delt sich bei »gestalt« von Thorsten Fleisch um in Bewegung gesetzte Fraktale, unterlegt mit Klangen, die nach denselben Prinzipien erzeugt wurden.
Aufschluss iiber einen synthetischen Stil mogen auch Beispiele aus der Textproduktion und der Musik geben.
»Und ein Signal tanzt. Diese Funktion denkt und denkt. Wer einen kalten Leser befragt, ist ein Fehler. Gerausche zittern aus der Analyse. Motoren sprechen neben dem Motiv.«^
Fiir die Musik kann etwa die »Illiac-Suite« von Lejaren Hiller und Leonard Isaacson von 1956 stehen, die eine Stilstudie auf Grundlage statis-tischer Ansatze vornahm.
Verbindende Charakteristik all dieser asthetischen Produkte ist ihre absolute Sinnleere. Nichts fiihrt irgendwohin, es lassen sich keine Ent-wicklungslinien innerhalb eines Werkes oder Stiickes ausmachen, jede Anschlussoperation, also jeder Strich, der auf einen vorigen folgt, jeder Ton oder jede harmonische Figur ist so gut oder so schlecht wie jeder andere, alles gehorcht zwar einem durchgangigen Formprinzip, aber Sinn ist keiner zu entdecken; selbst heftigste Sinn und Gestalt suchende Bemiihung bringt nur etwa ein »Apfelmannchen« der fraktalen Geometric hervor, was bei der investierten Rechnerleistung nicht eben viel ist.
Mimesis
Lassen Sic uns nun das Dispositiv und den Blick weiten. Die Kontin-genz soil nun ihren Platz bekommen. Sic muss von aufien hinzugefiigt werden, denn die Turing-Maschine kann nicht produzieren, was nicht berechenbar ware. Bei den hier interessierenden Formen kultureller Produktion bricht die Kontingenz in Form des gestaltenden mensch-lichen Eingriffs in das System ein. Technisch lasst sich das dadurch rea-lisieren, dass der Dreischritt aus Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe unterbrochen und der Computer damit interaktiv bedienbar wird.
Das geiibte Auge erkennt hier sofort die Riickkopplungsschleife. Sie wurde von Norbert Wiener als der Kern seiner Kybernetik identifiziert
9 Gerhard Stickel, »Autopoem« (1967), zit. nach Moles (wie Anm. 8), S. 35.

82 Martin Warnke
und iiberall dort ausgemacht, w o Signale kontrolliert Effekte zeitigen soUten:
»We thus see that for effective action on the outer world [und diese aufiere Welt ist in unserem Falle aus Sicht des Menschen der zu kontrol-lierende Computer, also fiir effektive Aktion] it is not only essential that we possess good effectors, but that the perfomance of these effectors be properly monitored back to the central nervous system, and that the readings of these monitors be properly combined with the other information coming in from the sense organs to produce a properly proportioned output to the effectors. [...] Note that in this system there is a human link in the chain of the transmission and return of information: in what we shall from now on call the chain of feedback.«^°
Wir warden nun nicht verfolgen, wie auch der Mensch und sein Zentral-
nervensystem durch Maschinerie ersetzt werden sollen, was Sache der
Artificial Intelligence ist, sondern wir interessieren uns fiir den Men
schen als Quelle der Kontingenz: Er sorgt fiir den Ausgleich des Man
gels, der ansonsten den Ou tpu t der rechnenden Maschine auf die allzu
diirftige Menge der berechenbaren Zahlen beschrankte. Der Mensch und
sein Bewusstsein fiihren dem System die notigen Informationen zu, da-
mit dieses iiberraschende, vielleicht sogar lebensechte Formen auspragt,
damit Sinn entsteht.
Technisch geschieht das mit der Einfiihrung der Interaktion, im Time-
Sharing-Betrieb oder auf dem personlichen Computer in der Main
Event Loop, die standig Eingriffe seitens der Benutzer erwartet und
verarbeitet.
All die lustigen kleinen Spielzeugwelten, die Papierkorbe, Akten-
ordner, Schieberegler, die Kaufmannsladen und Puppenstuben der Kon-
troUe, mit denen die Benutzungsoberflachen mobliert werden, sind
Ausdruck des mimetischen Griffs der Benutzer durch die Oberflache,
das Interface, die Trennflache zwischen Berechenbarkeit und Kontin
genz. Mit magischen Gesten ahmen die User vor, was ihre virtuellen
Maschinen nachzuahmen haben: den Pinselstrich, den Anschlag der
Schreibmaschine, die Funkt ionen des Zettelkastens.
Auf dem Feld des Asthetischen finden wir hier vor allcm die C o m -
puteranimation und die interaktive Medienkunst, Spiele wie etwa Flug-
simulatoren. Virtual Reality und in Echtzeit zu spielende Synthesizer.
Nehmen wir uns die Computeranimation vor, die schon in ihrem
10 Norbert Wiener, Cybernetics (1948), Cambridge MA 2000, S. <)6.

Synthese Mimesis Emergenz 83
Namen tragt, was sie vorhat: dem allzu beschrankten Compute r Seele
einzuhauchen, den O d e m des Lebens, den er selbst zu produzieren
nicht im Stande ist. Zwar hat es schon einige semiotisch begriindete
Versuche^^ gegeben, Gestik und Mimik quasi lexikografisch aufzahlend
kontingenzfrei zu symbolisieren, doch gehen die Profis alle anders vor:
Ein Mensch ahmt vor, was die Maschine nachzuahmen instruiert wird.
Dabei verlasst man sich bei Gestik und Mimik auf Motion Tracking
oder auf cartoonhaft vorgezeichnete Gestalten, in keinem Falle jedoch
gelingt durch Ausfiihrung eines Algorithmus allein ein hinreichend
liberzeugendes Ergebnis. Entweder per Motion Tracking erhobene
Daten direkt vom Korper oder nach zeichnerischer Vorlage durch Stell-
regler iibertragene Bewegungen werden am Computerbi ldschirm in-
stantan beurteilt und nachgeregelt.
»Der griechische Begriff >Mimesis< wird haufig mit >Nachahmung< iiber-setzt. [...] Sie funktioniert auf der Grundlage einer gewissen Ahnlichkeit [...] zwischen der realen und der fiktiven Welt [...]. Die >mimetische< Darstellung hat zur Folge, dafi sich der Zuschauer im Theater [...] in eine Handlung einfiihlen kann. Er empfindet gemeinsam mit den dar-gesteUten Figuren >Furcht und Mitleid< und wird dadurch von solchen Gefiihlen >gelautert<.«^^
So definiert die Literaturwissenschaft die Mimesis. Fiir unsere Zwecke
ist die Version von Dietmar Kamper passender, der aus der Nach- die
Vorahmung macht und damit prazise die Steuerung des Rechners durch
den Menschen beschreibt, wenngleich er speziell diesen Vorgang in sei
ner Schrift nicht gemeint hat:
»Das Wort >Mimesis< stammt aus dem Griechischen [...]. Es bezeichnet das Vermogen, mittels einer korperUchen Geste eine gewiinschte Wirkung zu erzielen. Mimesis heifit nicht Nachahmung, sondern Vorahmung, wah-rend >Simulation<, ein lateinisches Wort, das technische Herstellen von Bildern meint, die einer Reahtat tauschend ahnHch sind. [...] Es gibt bis-her keine hinreichende, keine triftige Unterscheidung zwischen beidem [...]. Man konnte sie durchaus magische Praktiken nennen, [...] Zaube-rei. [...] Mimetisch, mit hohem Einsatz, wird ein Fundament gelegt. Und dieses Spiel wird akzeptiert. Die Menschen wissen, dass es eine Erfin-dung ist oder eine Illusion. [...] Auf der anderen Seite will die Simulation
11 Peter B0gh Andersen, »Katastrophen und Computer«, in: Zeitschrift flir Semiotik 16/1-2 (1994): »2eit der Hypermedien«, hg. von Martin Warnke und Peter B0gh Andersen, S. 39, 12 http://www.uni-essen.de/literaturwissenschaft-aktiv/Vorlesungen/epik/mimesis. htm (30. Dezember 2003).

84 Martin Warnke
eine kiinstliche Doublette herstellen, die sich nicht unterscheiden soil vom Original. [...] Simulation verlauft in Automation. [...] Demgegen-iiber gehort Mimesis zur Kunst, die das Ahnliche als Ahnliches setzt, die Fiktion als Fiktion betreibt und die Illusion als Illusion inszeniert. [...] Die ideale Form der Simulation will eine vollige Identitat von Bild und Wirklichkeit erreichen, wahrend in der Mimesis eine Differenz zum Ausdruck kommt, die auch fiir die Beteiligten nie verschwindet.«^^
Gerade die Unterscheidung zwischen Simulation und Mimesis bei kul-tureller Produktion muss hervorgehoben werden: Zwar stiitzen sich die mimetischen Verfahren auf solche der Simulation, in der Computerani-mation etwa auf die unterschiedlichen Methoden, fotorealistische Sze-nen zu erzeugen, doch bleibt das Fiktive der Mimesis das entscheidende Moment fiir die Kunst. Hiermit verkniipft ist auch die Einfiihrung von Sinn. Menschliches Bewusstsein kann ohne Sinn nicht operieren, und durch mimetische Vorahmung tritt Sinn durch Uberschreitung der Grenze zwischen Berechenbarkeit und Kontingenz in die Feedback-Schleife mit dem Computer.
Der Zeitpfeil erhalt seinen Vortrieb wiederum durch Moores Gesetz, denn die verwendeten Algorithmen unterscheiden sich erheblich durch ihre rechnerische Komplexitat. Neu jedoch ist nun die Herausbildung von Stilen, die einander ablosen. An diesen Stilen, die oft solche der gerade machbaren Effekte sind, lassen sich Computeranimationen datie-ren, horen geiibte Ohren die jeweiligen Generationen der Sound erzeu-genden Maschinen.
Emergenz
Der entscheidende nachste Schritt besteht nun darin, die Systemgrenzen ein zweites Mai zu weiten, die Komplexitat dadurch zu erhohen, dass nicht mehr nur ein Mensch mit einem Computer interagiert, sondern viele Menschen und viele Automaten miteinander verschaltet werden.
Die Bedienoberflachen schaffen es nicht mehr, Kontrolle vorzugau-keln, die Grenze zwischen Berechenbarkeit und Kontingenz ist nicht mehr als Trennflache zu lokalisieren, sie ist eher mit den Blasen eines Schaums vergleichbar: Unzahlige Membranen erlauben an ebenso un-
13 Dietmar Kamper, »Mimesis und Simulation*, in: Kunstforum International 114 (JuH/August 1991), S. 86-94, S. 86 f.

Synthese Mimesis Emergenz 8 5
zahlig vielen Benutzungsoberflachen Eingriffe und Riickmeldungen, so dass das Ganze insgesamt weder zu kontrollieren noch in seinen Pha-nomenen vorherzusagen ware. Aus der Feme wirkt das Ganze ver-schwommen und unscharf: Einzelne Phanomene lassen sich nicht mehr einzelnen Menschen oder isolierbaren Automaten zurechnen.
Die Phanomene emergieren, lassen sich nicht aus der Beschaffenheit der vernetzten Konstituenten ableiten, wenngleich unverdrossene Mo-delHerer das noch immer versuchen. So etwa John H. Holland, auch wenn er in seinem Buch Emergence: From Chaos to Order^"^ anfanglich zugesteht, dass schon die kommunikative Situation zweier Brettspieler von einer doppelten Kontingenz bestimmt ist, wie Luhmann^^ es ge-nannt hatte, die selbst in einer so stark geregelten Konfiguration wie etwa beim Damespiel jede Vorhersage unmoglich macht:
»Each player has decided what to do in each contingency, but each player has no idea what particular contingencies will arise because of the other player's actions. So the individual player cannot predict the final outcome [...]. For each player the game will take unexpected twists and turns. « ^
Doch stark ist der Glaube an die analytische Kraft der exakten Wissen-schaft, und selbst unter den in diesem Abschnitt skizzierten Umstanden, die die Zahl der Interaktionspartner explodieren lasst, scheint nur der Weg bottom-up, von den atomaren Bestandteilen des Systems und ihren Interaktionen bis hin zur Vielfalt der daraus sich ergebenden emergen-ten Phanomene, aussichtsreich und in den Hard Sciences erlaubt:
»A well-conceived model will exhibit the complexity, and emergent phenomena, of the system being modeled, but with much of the detail sheared away.«^7
Hollands Methode ist die der Constrained Generating Procedures (CGP), die, an Zellularautomaten erinnernd, komplexe Phanomene aus einfachen Bausteinen und Regeln erzeugen. Der Anspruch an seine CGPs am Ende ist erheblich:
»For the cgp framework, or something similar, to acquire the status of a full-blown theory of emergence, it would have to be refined to yield suf-
14 John H. Holland, Emergence: From Chaos to Order, Oxford / New York 1998. 15 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Band I, Frankfurt am Main 1997, S. 212. 16 Holland (wie Anm. 14), S. 40. 17 Ebd., S. 12.

86 Martin Warnke
ficient conditions for emergence. We would have to prove that emergent phenomena will occur when these sufficient conditions are present.«^^
»Viel Gliick dabei!«, ist man geneigt, dem Manne zuzurufen, denn viel
Gliick wird er brauchen.
Dies fiihrt uns zur systemtheoretischen Gretchenfrage, wie emer-
gente Phanomene am besten zu beschreiben sind, bottom-up als Kon-
sequenz der Beschaffenheit eines Systems niederer Stufe, kontroUierbar
und erzeugbar durch die Manipulation und das unwahrscheinliche Ar
rangement seiner Elemente, oder auf Grund der Autopoiesis eines sich
iiber diesem elementaren, hoheren sich bildenden System, das fiir die
Beobachter undurchschaubar bleibt und fiir dessen emergente Phano
mene die Bedingungen niemals hinreichend, sondern eben immer nur
notwendig sein konnen: Moglichkeitsbedingungen, eben gerade keine
auslosenden Momente. Bekannterweise hat zum Beispiel Niklas Luh-
mann vehement fiir Letzteres votiert:
»Theoretisch umstritten scheint zu sein, ob die Einheit eines Elements als Emergenz >von unten< oder durch Konstitution >von oben< zu erkla-ren sei. Wir optieren entschieden fiir die zuletzt genannte Auffassung. Elemente sind Elemente nur fiir die Systeme, die sie als Einheit verwen-den, und sie sind es nur durch diese Systeme. Das ist mit dem Konzept der Autopoiesis formuliert. Eine der wichtigsten Konsequenzen ist: dafi Systeme hoherer (emergenter) Ordnung von geringerer Komplexitat sein konnen als Systeme niederer Ordnung, da sie Einheit und Zahl der Elemente, aus denen sie bestehen, selbst bestimmen, also in ihrer Eigen-komplexitat unabhangig sind von ihrem Realitatsunterbau. [...] Emergenz ist demnach nicht einfach Akkumulation von Komplexitat, sondern Unterbrechung und Neubeginn des Aufbaus von Komplexitat.«^^
Folgte man dieser Auffassung, dann liefien sich emergente Phanomene,
an denen zum Beispiel Computer beteiligt sind, niemals durch deren
Bauweise und Software erklaren. Diese waren dann eventuell sogar aus-
tauschbar, weil lediglich materieller Trager einer Ordnung hoherer Stufe,
die ihren eigenen Strukturen verpflichtet ist: sozialen, kulturellen, eben
kontingenten, aus Sicht der Informatik.
U n d tatsachlich sieht die Informatik, so stark der Wunsch nach M o -
dellierbarkeit auch immer sein mag, sich mit einer Situation konfron-
tiert, in der die sie angehenden Phanomene unvorhersehbar sind, in der
i8 Ebd.,S. 239. 19 Niklas Luhmann, Soziale Systeme: Grundrifl einer allgemeinen Theoriey Frankfurt am Main 1994, S. 43 f.

Synthese Mimesis Emergenz 87
bereits wahrend jeder noch so ausgetiiftelten Modellierungsphase sich die Spielregeln, die Elemente, die Randbedingungen, vielleicht sogar die Ziele unter der Hand emergent andern konnen, damit jede Planung, jedes Modell zunichte machend. Es ist, wie wenn der Bosewicht den Saloon betritt und jede Gewinnstrategie eines regelgeleiteten Spiels da-durch obsolet macht, dass er seinen daran teilnehmenden Widersacher kurzerhand iiber den Haufen schiefit. »Ja, mach nur einen Plan / sei nur ein grofies Licht / und mach dann noch 'nen zweiten Plan / gehn tun sie beide nicht.« (Bertolt Brecht, Dreigroschenoper) Es ist mit allem zu rechnen, vor allem mit dem nicht Berechenbaren.
Neben der gerade bemiihten Saloon-Szene hat der Wilde Westen noch ein weiteres Beispiel zu unserer Fragestellung und Untersuchung des Emergenten in der Informatik beizusteuern, und zwar in Gestalt der beriihmten Essay-Sammlung von David Lorge Parnas^° zum SDI-Programm - alias »Krieg der Sterne«. Der ansonsten Riistungsauftragen nicht abgeneigte Parnas beschreibt, warum die Software fiir die satelli-tengestiitzten Raketenabwehrwaffen nicht wiirde funktionieren konnen, und zog sich aus dem Beraterstab des Prasidenten Reagan zuriick. Seine Argumente mogen Systementwickler an ihre eigenen Probleme erinnern, selbst wenn sie nicht so hoch hinauf und hinaus wollen wie damals die Systementwickler beim SDI, aber die Konsequenzen sind dieselben. Parnas beschrieb die Systemanforderungen an die satelliten-gestiitzte Raketenabwehr unter anderem wie folgt:
»i. The system will be required to identify, track, and direct weapons toward targets whose ballistic characteristics cannot be known with certainty before the moment of battle. It must distinguish these targets from decoys [Attrappen], whose characteristics are also unknown. 2. The computing will be done by a network of computers connected to sensors, weapons, and each other, by channels whose behavior, at the time the system is invoked, cannot be predicted because of possible countermeasures by an attacker. [...] 6. The weapon system will include a large variety of sensors and weapons, most of which will themselves require a large and complex software system. The suite of weapons and sensors is likely to grow during development and after deployment. The characteristics of weapons and sensors are not yet known and are likely to remain fluid for many years after deployment. [...] The components of that system will be subject to independent modification.«
20 David Lorge Parnas, »Software Aspects of Strategic Defense Systems*, in: Communications of the ACM 28/12 (1985), S. 1326-1335, 1328.

88 Martin Warnke
Ein System, das unter diesen Anforderungen kontroUierbar funktio-
niert, hielt nicht nur er fiir unmoglich. Was an Phanomenen wahrend
des Betriebs eines solchen Systems emergieren wiirde, ist auch von den
besten Modellierern nicht abzuleiten.
Der nachste Kronzeuge in Sachen Emergenz sei nun Howard Rhein-
gold. Der Autor von Virtual Reality^^ hat vor kurzem seinen neuesten
Bestseller vorgelegt, der in diesem Kapitel zur Emergenz zum Tragen
kommt. Er zeigt Phanomene, die alle auf digitale Kommunikationstech-
niken griinden, aus den Tiefen individueller Anonymitat auftauchende
Smart Mobs, emergierende soziale Ordnungen. Er beschreibt, wie Tech-
nik zu Zwecken genutzt wird, die niemand vorhersagen konnte, die aus
den Bauprinzipien der zum Einsatz kommenden technischen Medien
nicht ableitbar sind.
»They enable people to act together in new ways and in situations where collective action was not possible before.«"
Vor allem Mobiltelefone stellen eine Kommunikationstechnik zur Verfii-
gung, die iiberraschende Phanomene zeitigt. Das »Texting«, das Schrei-
ben und Empfangen von SMS, macht dabei Geschichte - hier beim Sturz
des philippinischen Prasidenten Estrada im Jahr 2001:
»The >People Power II< demonstrations of 2001 broke out when the impeachment trial of President Estrada was suddenly ended by senators linked to Estrada. Opposition leaders broadcast text messages, and within seventy-five minutes of the abrupt halt of the impeachment proceedings, 20000 people converged on Edsa [ein Boulevard in Manila]. Over four days, more than a million people showed up. The military withdrew support from the regime: the Estrada government fell [...].«^^
Rheingold zieht das Fazit:
»The computer and the Internet were designed, but the ways people used them were not designed in either technology, nor were the most world-shifting uses of these tools anticipated by their designers or vendors. Word processing and virtual communities, eBay and ecommerce, Google and weblogs [...] emerged. Smart mobs are an unpredictable but at least partially describable emergent property that I see surfacing as more people use mobile telephones, more chips communicate with each other, more computers know where they are located, more technology
21 Howard Rheingold, Virtual Reality, New York 1991. 22 Ders., Smart Mobs, Cambridge MA 2003, S. xviii. 23 Ebd., S. 160.

Synthese Mimesis Emergenz 89
becomes wearable, more people start using these new media to invent new forms of sex, commerce, entertainment, communion, and, as always, conflict. « '
Das Internet, besonders mit seinen Diensten E-Mail und World Wide
Web, stellt eine besonders reichhaltige Sammlung emergenter Phano-
mene zur Verfiigung. Dabei spielt die Tatsache, dass es wachst und nicht
nach Fertigstellung in Betrieb genommen wurde, seine interessanteste
und markanteste Eigenschaft dar. Albert-Laszlo Barabasi bezeichnet es
in seinem atemberaubenden Buch Linked zur momentan entstehenden
Theorie der skalenfreien Ne tze sogar als
»success desaster, the design of a new function that escapes into the real world and multiplies at an unseen rate before the design is fully in place. Today the Internet is used almost exclusively for accessing the World Wide Web and e-mail. Had its original creators foreseen this, they would have designed a very different infrastructure, resulting in a much smoother experience. [...] Until the mid-nineties all research concentrated on designing new protocols and components. Lately, however, an increasing number of researchers are asking an unexpected question: What exactly did we create?«^^
Diese Frage bringt den interessantesten und fiir unser Thema auf schluss-
reichsten Aspekt dieses erfolgreichsten aller modernen technischen
Artefakte zum Ausdruck: sein Designprinzip auf der Grundlage von
Kontrollverzicht. Die Protokolle und Gerate, die die Infrastruktur des
Internet ausmachen, sind offenbar so offen konzipiert, dass iiber die
damit zu realisierenden Funkt ionen nur sehr wenig festgelegt wird. Das
N e t z entwickelte sich zudem anders, als seine Designer urspriinglich
intendiert hatten. Weiter Barabasi:
»While entirely of human design, the Internet lives a life on its own. It has all the characteristics of a complex evolving system, making it more similar to a cell than a computer chip. [...] What neither computer scientists nor biologists know is how the large-scale structure emerges once we put the pieces together.«^^
U n d ein wenig weiter unten:
»Most of the Web's truly important features and emerging properties derive from its large-scale self-organized topology. [...] the science of
24 Ebd., S. 182. 25 Albert-Laszlo Barabasi, Linked^ New York 2003, S. 149. 16 Ebd., S. 150 f.

90 Martin Warnke
the Web increasingly proves that this architecture represents a higher level of organization than the code.«^7
Das Internet als prominentestes Beispiel einer Vernetzung von Bewusst-seinen und Computern in grofiem Stile demonstriert, worauf die Infor-matik sich einzustellen hat: auf bewussten Verzicht auf KontroUe, auf das Gewahrenlassen emergenter Prozesse, auf Selbstorganisation, auf Netz-Topologien, die in der Technik wie in der Biologie oder Sozio-logie zwar einem angebbaren Gesetz folgen, dem der Skalenfreiheit, aber dennoch in ihrer Entwicklung im Detail nicht modellierbar sein konnen.
Die Hard Sciences traditionellen Zuschnitts fordern Determinismus und Kausalitat, die Formulierung von hinreichenden Kriterien, miissen aber sprachlos bleiben bei Phanomenen wie Leben, Gesellschaft, Kon-tingenz. Will Informatik Informationsgesellschaft beschreiben konnen, muss sie sich einlassen auf bislang fiir sie wissenschaftsfremde Begriffe: Autopoiesis, Selbstorganisation, Emergenz, Moglichkeitsbedingung. Das Internet - vielleicht die digitalen Medien iiberhaupt - als dasjenige technische Artefakt, das mittels Kontrollaufgabe unsere Gesellschaft am nachhaltigsten verandert hat, hat es uns vorgemacht: den Kontroll-verlust als Prinzip, die Moglichkeitsbedingung als Design-Richtlinie.
Asthetische Produktionen, die der Phase der Emergenz zuzurechnen sind, thematisieren vorzugsw^eise das Internet, das World Wide Web, und vor allem auch mobile Technologic. Die Arbeit »Can you see me now?« von Blast Theory konnte hier als Beispiel dienen. Sie wurde auf der Ars Electronica 2003 in der Rubrik »Interactive Art« pramiert, einer eigentlich unpassenden Kategorie, aber in diesem Jahr, 2004, wird eine neue eingefiihrt, »Digital Communities*, in die diese Arbeit schon im Jahr zuvor gehort hatte.
Das Raster
Lassen Sie uns kurz zusammenfassen. Die Unterteilung der Compu-terkultur in Phasen soil durch die Bezeichnungen »Synthese«, »Mime-sis« und »Emergenz« erfolgen. Diesen Phasen konnen nun Attribute zugeordnet werden, etwa: welche Modelle und Theorien einschlagig sind, wie die Kontingenz ins Spiel kommt, wie die Grenze zwischen
27 Ebd., S. 174 f.

Synthese Mimesis Emergenz 91
Berechenbarkeit und Kontingenz aussieht und noch weitere. Sie sind in folgender Tabelle zusammengetragen:
Rechnertechnik
Modelle
Theorien
Beispiele
Operationsweise
Grenzen der Berechenbarkeit
Zeitskala
Kontingenz
Kopplung media-ler Elemente
Begriffe
Synthese (Berechnung)
Batch
Turing-Maschine
Berechenbarkeit, Informations-asthetik
friihe Computer-graphik
selbstreferenziell
TM|
Moores Law
nicht vorhanden
durch Berechnung
berechenbare Zahl
Mimesis (Kontrolle)
Interaktion (Time Sharing, PC)
Eingabe -Verarbeitung -Ausgabe
Kybernetik
Computeranima-tion, interaktive Medienkunst
selbst- und fremd-referenziell
TM 1 Bewusstsein
Moores Law, Effekt -St i l -Abfolge
importiert
durch Steuerung, einfach kontin-gent
Feedback
Emergenz (Erscheinung)
Vernetzung, Internet
Netz
Systemtheorie, Kybernetik 2, Ordnung, Netz-theorie, Rhizom
OnHne-Games, Netzkunst, eBay, Digital Rights Management, Smart Mobs
autopoietisch
Schaum
historisch-emer-gent. Deformation von Raum- und Zeitstrukturen (Globahsierung, Beschleunigung)
emergent
kommunikativ, doppelt kontin-gent
Kontingenz
Es ergeben sich Konsequenzen aus dieser Sichtweise. So scheint es mir beispielsweise angebracht, den Begriffskanon der Informatik zu erwei-tern um Konzepte wie doppelte Kontingenz, Emergenz, Design unter Kontrollverzicht, Gesellschaft und Kultur. Es ware verheerend, wenn die Wissenschaft, deren Gegenstand durch Hard- und Software automa-

92 Martin Warnke
tisierbare gesellschaftliche Teilprozesse sind, wenn eine solche Wissen-schaft nicht in ihr ureigenstes Kalkiil ziehen wiirde, dass Kalkiile allein keine Beschreibung ihrer Funktion und Wirkung in der Gesellschaft abgeben konnen. Die Gesellschaftswissenschaften haben sich hier und dort gegeniiber der Informatik geoffnet, es ist wohl an der Zeit, dass die Informatik sich den Gesellschafts- und Kulturwissenschaften gegeniiber aufgeschlossen zeigt, um den heute bereits bestehenden Anforde-rungen noch gerecht werden zu konnen.

Albrecht Koschorke
Staaten und ihre Feinde Ein Versuch iiher das Imagindre der Politik
Man hatte die Bilder schon gesehen: den Feuerball iiber Downtown, ein-stiirzende Wolkenkratzer, Prasidentendarsteller, die an das patriotische Wir-Gefiihl ihrer Landsleute appellieren. So sehr die Kommentatoren das Unvergleichliche der entsetzlichen Ereignisse des i i . September 2001 betonten - immer und immer wieder die gleiche Einspielung des Flugzeugs, das in den Turm rast - , so wenig kam man von einem Gefiihl unwirklicher Wiedererinnerung frei. Sogar den unmittelbar Betroffenen ging es so. »Es ist wie in Godzilla«, rief einer derjenigen, die in Manhattan vor dem Steinhagel und dem Staub der zerstorten Twin Towers flohen, und er hatte noch an viele andere Untergangsfilme denken kon-nen, die in Amerika entstanden sind: erst die Schwemme der dooms-day-Filme im Zeichen des Kalten Krieges und dann, als der poUtische Feind verschwunden war, die Wiederbelebung kosmischer Angste. Wer Independence Day (1996), Godzilla (1998), Armageddon (1998) oder sonst einen der Science-Fiction-Thriller dieses Typs kannte, war langst daran gewohnt, die Skyline von Manhattan in sich zusammensinken zu sehen.
Der Terrorangriff des 11. September gehorchte keiner strategischen, sondern einer symbolischen Logik. Die Terroristen wollten die repra-sentativen Zentren der Supermacht attackieren und hatten damit Erfolg. Noch schwerer wiegt, dass es ihnen gelungen ist, ins Herz der phantas-matischen Ordnung Amerikas einzudringen. Nur dass sie dort, anders als auf der Ebene des geheimdienstlichen Nachrichtenverkehrs, bereits erwartet wurden: Die Bilder waren schon da. Sie sind in Erfiillung ge-gangen. Fact came after fiction.
Uber diesen Effekt des deja-vu angesichts der Anschlage auf das
93

94 Albrecht Koschorke
World Trade Center sind viele Betrachtungen angestellt worden. Nicht nur Cineasten hatten den spontanen Eindruck, die Bilder des Grauens wiirden sich passgenau in das Gedachtnis des amerikanischen Kinos und sein Gesetz der Serie fiigen. Bekanntlich musste nach dem i i . September eine ganze Reihe von langst geplanten Kinoproduktionen abge-andert oder eingestellt werden, weil die Filmhandlung dem faktischen Geschehen zu nahe gekommen ware. Ahnliches gilt fiir andere Pop-Sparten: Die Musikgruppe The Coup hatte im Oktober ihr Album »PartyMusic« mit einer Fotomontage der brennenden Twin Towers ausliefern woUen; ein Werbespot dazu lief am 9. September an. Es gibt erstaunlich viele derartige Anekdoten. Auf die im Freudschen Sinn un-heimlichste hat Philipp Sarasin in seinem wichtigen »Anthrax«-Buch hingewiesen: Auch die Tater des Columbine High School Massacre von 2000 hatten »uber das bei Videospielen bis ins Detail trainierte shooting hinaus geplant, ein Flugzeug zu entfiihren, um damit das Empire State Building und sich selbst zu zerstoren«/
Schon bald nach dem Anschlag verlagerte sich jedoch der Fokus der Aufmerksamkeit von den Pop-Phantasien starker auf die phantasmati-schen Planspiele der Tater, und der theatralische Charakter des Terrors, sein Kalkiil mit den Medien traten in den Vordergrund.^ Man las viele Analysen dariiber, dass der Terrorangriff auf Manhattan selbst schon kaltbliitig als reality show konzipiert worden sei." Einmal mehr scheint sich Politik hier in einen Krieg der Bilder aufzulosen, und einmal mehr scheint die Grenze zwischen der Wirklichkeit, in der Menschen ster-ben, und jener Bilderwelt, die durch die Massenmedien wirkungsvoll aufbereitet, wenn nicht allererst erzeugt wird, zu verschwimmen.
1 Nach Christoph Tiircke, Fundamentalismus - maskierter Nihilismus^ Springe 2003, S. 8, unter Verweis auf einen Artikel von Mark Siemens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 10. September 2002. Tiircke kommentiert: »Unsinn also, dass am 11. September ein unvorstellbares Verbrechen geschah. Die vielfaltigen Vorstellungen davon waren langst in Filmbildern geronnen.« 2 Philipp Sarasin, »Anthrax«: Bioterrorals Phantasma, Frankfurt am Main 2004, S. 29 f. Sarasin kommentiert: »Man kann sich zumindest die Frage stellen, ob der Einschlag der American-Airline-Jets in die beiden Tiirme nicht gerade deshalb als so unheimlich emp-funden wurde, weil seine Form weit weniger etwas Unerhortes, Nie-fiir-moglich-Gehal-tenes darstellte, als vielmehr etwas >dem Seelenleben von alters her Vertrautes<: Freud bemerkt, daf5 es >unheimlich wirkt, wenn die Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit verwischt wird, wenn etwas real vor uns hintritt, was wir bisher fiir phantastisch gehalten haben<.« 3 So schon bei Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence, Berkeley u. a. 2000, Kap. 7 »Theater of Terror«, S. 199 ff. 4 Vgl. Tiircke (wie Anm. i), S. 12.

Staaten und ihre Feinde 9 5
Aber ich frage mich, ob solche allgemeinen Feststellungen ausrei-chen, um dem zutiefst unheimlichen Charakter dieses deja-vu bei-zukommen. Wenn es richtig ist, dass politische Macht in wachsendem Mafi Verfiigungsgewalt iiber Bilder bedeutet, dann muss Machtanalyse zu einem gewichtigen Teil politische Analyse der Bilder sein. Das heifit in einem erweiterten Sinn: politische Analyse des Imaginaren, also der Funktionsregeln unserer sozialen Vorstellungswelt iiberhaupt. Mit der Kritik an den Medien und ihrem wachsenden Einfluss auf den Imagi-nationshaushalt der Menschen ist es dabei nicht getan. Auch die Unter-scheidung (beziehungsweise die Klage iiber den Verlust der Unter-scheidbarkeit) zwischen dem Illusionismus der Medienwelt und der »wirklichen Wirklichkeit« greift zu kurz, weil selbst eine solche »wirk-liche Wirklichkeit« nicht existieren wiirde ohne das Zutun der kollekti-ven Einbildungskraft und damit des Imaginaren.
Gesellschaften konnen nur dann entstehen und sich organisieren, wenn sie sich die eigene Welt sinnhaft machen. Und sie tun dies, indem sie Bilder von sich als Ganzheit entwerfen, indem sie von derartigen Bil-dern (etwa der Idee der Nation) ausgehend Institutionen schaffen und Techniken politischer Reprasentation ersinnen, die imaginar im strikten Verstandnis des Wortes sind, weil die sichtbaren Reprasentanten das unsichtbare soziale Ganze verkorpern und so gleichsam ins Bild heben soUen. Unliebsame Kehrseite dieser kiinsthchen Herstellung von Ganzheit sind Phantasmen des Anderen, des Ausgeschlossenen, a la limite des Feindes. Gleichwohl ist diese imaginare Konstitution von Welt, ob sie nun die Wahrnehmung des Eigenen oder des Fremden betrifft, unhintergehbar. Ohne Operationen im Imaginaren gabe es keine poli-tischen Orte, keine Adressaten, keine Stellvertretung, kein Handeln, das auf Subjekte zuschreibbar ist, und damit letztlich keine Politik. Das macht den Begriff des Imaginaren zweideutig und problematisch, weil er einerseits universelle Geltung beansprucht, wahrend man doch andererseits mit ihm die Erwartung verbindet, dass er eine Grenze zieht und Trennscharfe erzeugt - wie etwa der Begriff der Ideologic, der ja letztlich nur vom Standpunkt eines »wahren Bewusstseins« aus sinn-voU verwendbar ist und folglich das Versprechen seiner eigenen Uber-windung in sich tragt. Vom Imaginaren ist ein solcher Ausgang in die Wirklichkeit »als solche« nicht zu erhoffen; aus der Welt der Bilder und sozialen Reprasentanzen kommen wir niemals heraus. Was keineswegs daran hindert, aus der Einsicht in die Funktionsweise imaginarer Pro-zesse sehr wohl praktische Konsequenzen zu ziehen.

96 Albrecht Koschorke
Was kann vor diesem Hintergrund eine politische Analyse der Bilder des II. September erbringen? Ich denke, sie muss sich nach wie vor, trotz aller inzwischen geleisteten Analysen, von der Tatsache verstoren lassen, dass islamischer Terror und Hollywood sich in exakt dem glei-chen symbolischen Feld treffen konnten. Das bedeutet zunachst, dass sie sich im Modus der Gleichzeitigkeit begegnen. Der Terror der Isla-misten und das amerikanische Kino gehoren der gleichen Zeitsphare an, und was sollte das fiir eine Zeit sein, wenn nicht die Gegenwart?
Eine Weile noch wurde versucht, mit Hinweis auf den Atavismus der Taliban dem fundamentalistischen Islam einen Platz in der Vorzeit der Moderne zuzuweisen. Mit diesem Trick wollte man ein Narrativ ret-ten, das fiir unsere liberale Weltsicht unentbehrlich zu sein scheint und selbst noch den industriellen Staatsterror des 20. Jahrhunderts erstaun-lich unbeschadet iiberstanden hat: namlich jenen grofien westlichen Mythos von der Moderne als Endphase eines Prozesses der Aufklarung und Zivilisierung. Doch es ist leicht, sich von den Kennern des Orients dariiber unterrichten zu lassen, dass der islamische Fundamentalismus mit und in der Moderne, und zwar genauer: in der kolonialen Moderne entstand, um in der Ara des so genannten Postkolonialismus zu einer Massenbewegung zu werden.
Die Attentater des 11. September entsprangen nicht irgendwelchen randstandigen Stammeskulturen, sondern »verfugten«, mit den Worten Navid Kermanis, »uber moderne, stadtische Biographien aus den wohl-habenderen Standen ihrer Heimatlander, einem schmalen Segment ara-bischer Gesellschaften, wenn sie nicht ohnehin im Westen aufgewachsen sind«.5 Diejenigen unter ihnen, die als so genannte Schlafer in Deutsch-land gelebt haben, »schienen geradezu Modellfalle einer gelungenen Integration abzugeben, intelligent, erfolgreich, von hoher sozialer und kultureller Kompetenz«.^ In einem bestimmten, sehr beunruhigenden Sinn waren sie »auf der Hohe der Zeit«. Im Ubrigen ist hier vielleicht nicht der falsche Ort, um daran zu erinnern, in welchen Institutionen die kleinen Terrorzellen besonders gut gediehen: in den Hochschulen (Hamburg-Harburg war nur eine davon).
Es niitzt nichts, den Begriff des Fundamentalismus, unter dem man ja fast immer den Fundamentalismus der anderen versteht, als einen von
5 Navid Kermani, Dynamit des Geistes: Martyrium, Islam und Nihilismus, Gottingen 2002, S. 29 f.
6 Ebd., S. 28. Zu den »Schlafern« hat Thomas Hauschild einen erhellenden Text verfasst: Thomas Hauschild, »Sleepers and Dreamers«, unveroffenthchtes Manuskript, 2003.

Staaten und ihre Feinde ^J
mehreren moglichen »Alterierungsdiskursen«7 (Werner Schiffauer) in Stellung zu bringen und ihm etwa ein Bekenntnis zu kultureller Hybri-ditat entgegenzusetzen. Der islamistische Terror mag versuchen, die Welt in harte Dichotomien von Heil und Unheil, Freund und Feind aufzuteilen, er bleibt dabei seinerseits ein Produkt extremer Hybriditat. Er kommt uns nicht aus der Wiiste Arabiens und aus der Reinheit wei-6er Beduinengewander, sondern aus der Postmoderne entgegen. Und so hat er auch nichts mit dem Fortbestand islamischer Traditionen zu tun, sondern, ganz postmodern, mit der Erfindung einer solchen Tradition. Statt ihn traditionalistisch zu missdeuten, muss man ihn - ich zitiere noch einmal Kermani - als »Amalgam aus Kapitalismuskritik, Martyrer-kult, Drittweltrhetorik, totalitarer Ideologie und Science Fiction« be-trachten.^ Der grofite Teil dieser Ingredienzen stammt aus dem Westen oder hat sich im kulturellen Austausch mit dem Westen geformt.^
»Science-Fiction« gibt das Stichwort, um nach dieser Abschweifung zu den Interferenzen zwischen Kino und Terror zuriickzukehren. Wenn ich eben deren Gleichzeitigkeit betont habe, so war damit nicht nur gemeint, dass auch Islamisten westlich leben, Freundinnen haben und amerikanische Videos konsumieren konnen. Es geht um eine tiefere Art von Zeitgenossenschaft und Verbundenheit. Denn die angegriffene Kultur hat dem Angreifer ja sozusagen das Drehbuch fiir seine Attacke an die Hand gegeben. Mit einer massenwirksamen und entsprechend gewinntrachtigen Angstlust haben zahllose Science-Fiction-Romane, Filme, Computerspiele, music clips feindliche Attacken auf das mo-derne Amerika ausphantasiert; sie haben die Weichstelle, den Punkt der grofiten Verwundbarkeit ins Bild geriickt; ja, sie haben eine Art Ge-
7 Werner Schiffauer, Die Gottesmdnner. Turkische Islamisten in Deutschland: Eine Stu-die zur Herstellung religioser Evidenz, Frankfurt am Main 2000, S. 316. Aus nicht naher erlauterten Griinden setzt Schiffauer diesen Begriff allerdings in Anfiihrungszeichen. 8 Kermani (wie Anm. 5), S. 41. 9 Reinhard Schulze beschreibt den islamischen FundamentaHsmus insgesamt gleichsam als Revers von Diskursen der kolonialen Moderne im 20. Jahrhundert. Der »europaische Monopolanspruch auf die Moderne« habe dem Islam konsequent die Zeitgenossenschaft verweigert und ihm fehlende Aufklarung und Sakularisierung vorgehalten. »Das Typi-sche der kolonialen Situation war, dafi diese europaische Interpretation der islamischen Geschichte als Teil des europaischen Diskurses in der islamischen Welt institutionalisiert und rezipiert worden ist. Dies kann als die eigentliche Geburtsstunde des sogenannten islamischen FundamentaHsmus angesehen werden. Da jede Geschichte, welche die Selbst-befreiung des Menschen zum Thema hat, als Ausflufi europaischer Identitat angesehen wurde, blieb den islamischen Intellektuellen nur die historische Retrospektive [...].« (Reinhard Schulze, Geschichte der islamischen Welt im 20. Jahrhundert, Miinchen 2002, S.i4f.)

98 Albrecht Koschorke
brauchsanweisung fiir die grofitmogliche Traumatisierung Amerikas geliefert. Und genau so wurden sie offenbar rezipiert. Keine kulturelle Disparitat, keine uniiberwindliche Fremdheit der Bildersprache hat die Planer von Al Qaida daran gehindert, die Botschaft der Pop-Industrie gewissermafien wortlich zu nehmen und ihr Attentat zu einer T^e-Insze-nierung amerikanischer Kino-Angste vor laufenden Fernsehkameras werden zu lassen.
Das Unheimliche am Hass ist nicht sein Anderssein, sondern sein Vermogen zur Einfiihlung in den Feind. Welche geradezu psychotisch anmutende Einfiihlungsgabe die Terroristen besitzen (oder von den Medien zugeschrieben bekommen), zeigt eine Meldung, die im Marz 2004 durch die Nachrichten ging: Al Qaida habe auch einen Anschlag auf Pearl Harbor geplant.
Der japanische tJberfall auf Pearl Harbor hatte den US-Amerikanern im 20. Jahrhundert zum ersten Mai ihre Verletzlichkeit vor Augen ge-fiihrt und war eine ahnlich traumatische Erfahrung wie die Zerstorung des World Trade Center zum Auftakt des 21. Jahrhunderts. Wie dies bei nationalen Traumata haufig der Fall ist, spielen die Ereignisse von 1941 in der Heldenmythologie des Landes eine herausragende Rolle; noch heute kann man in den USA Autos sehen, die ausweislich des Num-mernschildes von einem Uberlebenden des japanischen Luftschlages, der 3500 Opfer forderte, gefahren werden.
Auch ein Anschlag auf Pearl Harbor hatte rein militarisch keinen Sinn ergeben. Seine psychologische Wirkung ware aber wohl verhee-rend gewesen, und es hatte sich wohl kaum ein anderes Ziel ausdenken lassen, das in ahnlicher Weise amerikanische Urangste geweckt hatte. Der Terrorplan deutet insofern auf ein paradoxes Moment von »Nahe« zwischen potenziell Angegriffenen und Aggressoren. In der Tat miissen sich ja selbst Todfeinde auf irgendeiner Ebene »verstehen«, um sich zu bekriegen. Die Terroristen, die das World Trade Center zerstorten, ha-ben die Angste und Traume der Amerikaner »verstanden«, sonst hatten sie ihren Nerv nicht so empfindlich treffen konnen. Die Amerikaner ihrerseits haben die Herausforderung spontan angenommen - auf mili-tarischem ebenso wie auf religiosem Terrain - , namlich als Herausforderung zu einem Endkampf von heilsgeschichtlicher Dimension.^°
10 Schon im ersten Irak-Krieg standen sich mit George Bush sen. und Saddam Hussein zwei PoHtiker gegeniiber, die vom Begriffsarsenal des HeiUgen Krieges Gebrauch mach-ten. Vgl. Carsten Colpe, Der »Heilige Krieg«: Benennung und WirkUchkeit, Begriindung und Widerstreit, Bodenheim 1994. »An dem Tag, an dem Prasident Bush den Befehl zu

Staaten und ihre Feinde ^^
In den neunziger Jahren ist viel dariiber geschrieben worden, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion den Amerikanern ihr Feindbild abhanden gekommen sei. (Und es mag richtig sein, dass zur kulturellen Identitat Amerikas eine Beimischung von Paranoia gehort - wie es Michael Moores in Europa so erfolgreicher Film Bowling for Columbine von 2002 nahe legte.) Die US-Filmindustrie antwortete nach 1989 darauf, indem sie in ihren Szenarien das Feindbild verallgemeinerte und die Aggression zum Werk anonymer, von einem ratselhaften Zer-storungstrieb beherrschter Krafte werden liefi. Das Kino demobilisierte seinen mehr oder minder offenen Antikommunismus und lenkte seine Verschworungsphantasien stattdessen verstarkt auf Aliens oder andere extraterrestrische Machte um (die Angst vor islamischem Terror blieb auch nach dem ersten Bombenanschlag auf das World Trade Center von 1993 vorerst Episode). An den Erzahlmustern anderte sich dadurch wenig - aufier dass man mit immer teureren special effects arbeiten musste, um ihren Mangel an Suggestivkraft zu iiberdecken.
Das ist mit dem 11. September schlagartig anders geworden. An die-sem Tag war namlich genau ein solcher Feind auferstanden und nahm die Liicke im leer gelaufenen paranoiden Planspiel ein: ein staatenloser, die internationale Ordnung missachtender, stummer Feind, der im In-kognito operiert, sich jeder Art von Dialog entzieht und aus politisch-kulturellen Beweggriinden handelt, die dem Westen im Tiefsten uner-klarlich scheinen. Ein Feind, der in einer morderischen Paradoxic genau die Angste sich bewahrheiten liefi, die stets die Kehrseite des amerika-nischen Traums bildeten.
Dieses zutiefst unbehagliche »Einverstandnis« zwischen dem Dispo-sitiv einer Erwartungsangst einerseits und der terroristischen Organisa-tionsweise und Phantasie auf der anderen Seite reicht womoglich sogar bis in die Motivation der Anschlage hinein. Sie lassen bis heute viele Mutmafiungen zu: Jeweils mit einer gewissen Plausibilitat ist behauptet worden, sie seien auf den Westen als Ganzes gerichtet gewesen, auf den globalen Kapitalismus, der sich in den beiden Tiirmen sein Wahrzeichen geschaffen habe, oder auf die Weltmachtrolle der USA. Auch das sind
Angriffshandlungen amerikanischer Truppen gegen Irak unterzeichnete (Mittwoch, 9. Januar 1991), umgab er sich im Weifien Haus mit Geistlichen, alien voran dem groEten Evangelisten der Gegenwart, Billy Graham, um mit ihnen fiir das Heil der Nation zu beten. Danach liefi er keine offentliche Aufierung aus, um zu versichern, Gott sei auf der amerikanischen Seite, und es handele sich um einen Kampf des Guten gegen das Bose [...]. Prasident Saddam Hussein aktualisierte denselben ewigen Gegensatz zwischen Licht und Finsternis.« (S. 27 f.)

100 Albrecht Koschorke
schon alles imaginare Zuschreibungen, ob sie nun von der einen oder der anderen Seite erfolgen. Man kann solche Zuschreibungen aber auch konkreter, dinglicher fassen und etwa iiber einen alten (anti)kulturellen Affekt gegen Turmbau und Tiirme spekulieren, wie es Manfred Schneider in einem sehr lesenswerten Essay getan hat. ^ Ich habe bei anderer Gelegenheit die These vertreten, die Zerstorung des WTC Hefie sich als Angriff auf die »Stadt« deuten, in der Tradition einer kriegerischen FeindseHgkeit gegen Stadte, wie sie besonders im 20. Jahrhundert zum Durchbruch kam/^
Die Kriege des 20. Jahrhunderts sind ja vor allem Kriegsziige gegen die Stadte gewesen. Das hat nicht allein mihtarische Griinde, sondern nahrt sich - so meine Vermutung - aus einem Anti-Urbanismus, einem tiefen Widerwillen gegen die ungeordnete Exzessivitat moderner Stadte und gegen urbane Kultur iiberhaupt/^ der sich in vielen Landern, die unter den Druck beschleunigter Modernisierung geraten, beobachten lasst. Hitler-Deutschland, das Kambodscha der Roten Khmer und der Krieg der Serben gegen die muhiethnischen jugoslawischen Stadte sind, bei alien Unterschieden, herausragende Beispiele dafiir.
Doch auch die virtuellen Kriegsspiele der US-Unterhaltungsindus-trie leben unverkennbar einen Affekt gegen die Stadt aus. Fast regel-mafiig verbinden sie die phantasierte Zerstorung stadtischer Raume mit Motiven der Apokalypse. Apokalypsen sind Erzahlungen, die vom Strafgericht Gottes iiber eine gottverlassene Welt handeln. Der Hollywood-Film der vergangenen Jahrzehnte war bibelfest und puritanisch genug, um diesem Aspekt Geltung zu verschaffen. Da kommen im An-gesicht des Jiingsten Tages die verdorbenen und liisternen Menschen um, wahrend die Familienbande zwischen den guten sich fester ziehen; da wird das postatomare Las Vegas von riesigen Killer-Kakerlaken be-volkert; und nicht umsonst sind es die Riesenstadte mit ihren in den Himmel ragenden Bauten, die sich wie einst die Hure Babylon als Ziel besonders schwelgerischer Zerstorungsphantasien anbieten. Die Kultur des christlichen Amerika baut auf einer religiosen Grundschicht auf, in der sich vor- und gegenmoderne moralische Reflexe konservieren, die
11 Manfred Schneider, »Das Pathos der Turme«, in: Transkriptionen 2 (Juh 2003), S. 10-13. 12 Vgl. hierzu meinen Artikel »Grofie Hure Babylon«, in: Siiddeutsche Zeitung (14. September 2001), der allerdings von der Redaktion zum Teil sinnentstellend gekiirzt wurde. 13 Vgl. Christian Thomas, »Schwert und Flugzeug: Die Stadt als Ziel des Hasses und Raum der Erinnerung«, in: Frankfurter Rundschau (26. September 2001).

Staaten und ihre Feinde IOI
in den Popularmythen der Unterhaltungsindustrie lebendig geblieben sind. (Man denke nur an den Erfolg der techno-apokalyptischen Serie Left Behind unter den fundamentalistischen Christen in den USA.^4)
Nun zahlt auch der Islam die Bibel zu seinen heiligen Schriften, und den Islamisten, die Amerika als Grofien Satan verteufeln, ist die baby-lonische Gleichsetzung von Stadt, Siinde, Schmutz und Moderne ver-traut. Es macht den unsichtbaren Feind voUends unheimlich, dass sich in seinem Handeln Elemente der eigenen kulturellen Matrix auffinden lassen. Es sieht ja so aus, als wiirde der gegen Amerika gerichtete Fun-damentalismus untergriindig mit Tendenzen des weifien Mainstream-Amerika kommunizieren. Und diese mentale »Verwandtschaft« fiihrt wohl dazu, dass sich der Terrorangriff auf die beiden Hauptstadte der USA so exakt in die Bildvorlagen einfiigt, die iiber den kommerziellen US-Film weltweit ein Massenpublikum erreicht haben.
Ich fiige hierzu nur einen letzten Beleg fiir die geradezu psychoti-sche Intensitat der Kommunikation zwischen den Todfeinden an. In einem Video, das Osama bin Laden nach dem i i . September im Kreis anderer Scheichs zeigt, kommen Traume aus der Zeit der geheimen An-schlagsplanungen zur Sprache. Bin Laden sagt ausweislich des im Internet veroffentlichten Transkripts:
»We were at a camp of one of the brother's guards in Qandahar. This brother belonged to the majority of the group. He came close and told me that he saw, in a dream, a tall building in America, and in the same dream he saw Mukhtar teaching them how to play karate. At that point, I was worr ied that maybe the secret would be revealed if everyone starts
seeing it in their dream. So I closed the subject. I told him if he sees an
other dream, not to tell anybody [...].«^^
Die Suche nach den Motiven, die hinter dem Anschlag auf das World Trade Center stehen, lauft unvermeidlich auf Spekulationen hinaus
14 Vgl. Susan Neiman, »Rechts und fromm: Eine religiose Erweckungsbewegung rollt durch die USA, und viele Amerikaner bezeichnen sich als Fundamentalisten. Die Sprache des Glaubens halt die Politik fest im Griff«, in: Die Zeit (7. Oktober 2004), S. 42 f. 15 http://www.cnn.com/2001/us/12/13/tape.transcript/index.html. Das Transkript geht weiter: »(Another person's voice can be heard recounting his dream about two planes hitting a big building).« Hauschild (wie Anm. 6) verkniipft dieses Zitat mit erhel-lenden Bemerkungen iiber bin Laden »as a kind of dream master or dream patron of his subjects* in schamanistischer Tradition.

102 Albrecht Koschorke
- unter anderem aus dem schlichten Grund, dass die Attentater kein Manifest hinterlassen haben, das Aufschluss dariiber gabe, wie sie ihre Tat verstanden wissen woUen/^ Gleich auf doppelte Weise kiindet die-ser neue, globalisierte Terror den Pakt auf, der bisher sogar zwischen Kriegsparteien bestand. Erstens dadurch, dass der Einsatz total ist - wer sein Leben wegwirft, hat nichts mehr zu verlieren, und es gibt mit ihm keinen Verhandlungsgegenstand mehr. Zweitens dadurch, dass keine pohtische und ideologische Zielsetzung zum Ausdruck gebracht wird, der die Tat zurechenbar ist. Die Erwartung nach nachvollziehbarer Zweckrationahtat wird enttauscht, und genau das gehort zum Wir-kungskalkiil. Die Zurechenbarkeit zu bestimmten Absichten hatte ja geradezu etwas Trosthches, weil sie den Aggressor als ein Gegeniiber konturiert, mit dem man, wie auch immer, in Kommunikation treten kann. Der totale Terror liberschreitet die alten Regeln des feindUchen Tausches, die immerhin noch ein Element von Dialog in sich trugen; er stellt kein Ultimatum, fordert nichts und bietet nichts an.
Kermani und andere^^ haben sich dadurch dazu bewegen lassen, die Aktionen von Al Qaida gewissermafien mit Nietzsche zu lesen und in den Zusammenhang eines modernen Nihilismus zu riicken. Ich frage mich, ob das nicht zu weit geht und das politische Kalkiil des islamisti-schen Terrors unterschatzt; aber das will ich hier nicht im Einzelnen dis-kutieren. Meine Uberlegungen kreisen um das Element der feindlichen »Kooperation« zwischen den Widersachern. Wird deren untergriindige Kommunikation aufgekiindigt, wenn der Feind als ein ganz Anderer auftritt, wenn er sich kein Gesicht und keine Stimme gibt, wenn er seiner Tat kein Programm unterlegt und keinen noch so kruden Sinn
i6 »Es gehort zu den bemerkenswertesten, bis jetzt nicht hinreichend reflektierten Umstanden des i i . Septembers, daE er voUig ohne ein Bekenntnis ausgekommen ist«, heifit es bei Kermani (wie Anm. 5), S. 32. »Nichts reprasentiert diese neue Dimension des Terrorismus genauer als die jeweils fehlenden Bekennerschreiben. Wenn in der Vergan-genheit die Rote Armee Fraktion, die PKK, die tamihschen Befreiungstiger, der agypti-sche Dschihad, radikale Palastinenser oder jiidische Siedler Anschlage begingen, haben sie sich nicht nur voller Stolz dazu bekannt, sie verfolgten mit der Gewak vor allem kon-krete und identifizierbare pohtische Ziele. Verbunden waren diese Ziele fast immer mit einer verlangten, zu verteidigenden oder zu verandernden Staathchkeit - aber hier? Man beeike sich, von einer >Kriegserklarung< zu sprechen, und weii^ bis heute nicht einmal, wer genau am 11. September den Krieg erklart hat - und wem.« (S. 35) 17 Unter anderem Tiircke (wie Anm. i). Seit langem argumentiert Hans Magnus En-zensberger in einer ahnhchen Richtung, wenn er von einem abstrakten, pohtisch nicht rationahsierbaren Destruktions- und Opfertrieb der Tater spricht. Vgl. den Artikel »Die Wiederkehr des Menschenopfers: Der Angriff kam nicht von auEen und nicht aus dem Islam«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (18. September 2001).

Staaten und ihre Feinde 103
zu verleihen versucht? Kann es in einem solchen Fall iiberhaupt noch irgendeine imaginare Bezugnahme auf ihn geben?
Unmittelbar nach den Anschlagen auf die USA sprach man standig davon, dass deren Urheber krank oder wahnsinnig gewesen sein miiss-ten, in jedem Fall aus vollkommen unerklarbaren Motiven gehandelt hatten. Der Terror, der ins Zentrum des eigenen Kulturkreises gedrun-gen war, wurde durch Metaphern des absolut Fremden wenigstens auf symbolischer Ebene fern gehalten. Aber das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite war namlich auch die Stelle des beziehungslos Ande-ren im phantasmatischen Planspiel vorgesehen. Selbst die Nichtkom-munikation mit dem Angreifer wurde schon kommuniziert, bevor das Ereignis eintrat.
Ich bitte um Nachsicht, wenn ich das an einem eher trivialen und von dem Entsetzen der wirklichen Ereignisse weit entfernten Beispiel illustriere. Es gibt eine lange Tradition in der Science-Fiction, die Be-gegnung mit dem Anderen als Begegnung zwischen Menschen und Aliens darzustellen. Das macht sich auch Roland Emmerichs Independence Day von 1996 zu Nutze, in dem feindliche Aufierirdische sich in mehreren riesigen Raumschiffen der Erde nahern, ohne indessen mit den Erdbewohnern irgendeinen Kontakt aufzunehmen. Es handelt sich um eine stumme, unerklarte, scheinbar grundlose Invasion. New York, Washington, Los Angeles und andere Millionenstadte weltweit werden in Schutt und Asche gelegt, bevor endlich ein Kampfflieger, der aus dem robusten landlichen Amerika stammt, dem Spuk ein Ende bereitet. In den grofien Jubel iiber die Erlosung der Menschheit stimmen alle Natio-nen mit ein; sogar die Buschmanner tanzen vor Freude.
Der Film feiert american leadership angesichts einer kosmischen Be-drohung. Es ist aber auffallig, wie wenig sich diese Bedrohung in einem Gegeniiber personifiziert. Die Aufierirdischen richten keine Forderun-gen an die Menschen, sie werden in keinem Zweikampf gezeigt, man erfahrt so gut wie nichts iiber sie. Dass der Gegner derart gestaltlos bleibt und in keinerlei Verhandlung eintritt, zieht selbst aus den Action-Sequenzen des Filmes die Spannung heraus. Bezeichnenderweise gelingt es einzig dem Prasidenten, mit einem gefangenen Alien Kontakt aufzunehmen - durch einen vor den anderen verborgenen telepathischen Verkehr.
Rein optisch besteht zwischen den Aliens im Film und den Atten-tatern des 11. September wenig Gemeinsamkeit. Strukturell sind aber durchaus gewisse Parallelen erkennbar. In beiden Fallen zieht der myste-

104 Albrecht Koschorke
riose Angriff eine moralische und militarische Generalmobilmachung Amerikas nach sich, das die gesamte Welt hinter sich zu sammeln ver-sucht, und kommt damit einem bereits vorher virulenten Bediirfnis nach patriotischer Erneuerung des Landes entgegen. In beiden Fallen lauft die Konfrontation auf die Person des Prasidenten zu - mehr noch, es ist allein der Prasident, der so etwas wie eine Vision von dem todlichen Begehren des Feindes empfangt. Man kann die in Formalin eingeleg-ten Aliens im Labor ja als eine Art von Schlafern (sleepers) betrachten. Umso auffalliger ist es, dass der Prasident mit der fremden Spezies, der-gegeniiber die Sprachbarriere total ist, auf so exklusive und geradezu intime Weise in Rapport tritt.
Ich will diesen aufierordentlich heiklen Vergleich nicht zu weit trei-ben. Aber wenn man davon ausgehen kann, dass Filme wie Independence Day die Phantasien ihres Massenpublikums zu befriedigen versuchen, dann muss man der Frage nach der Wunschdynamik der Terroristen die Frage nach der Wunschdisposition des zum Gegner erkorenen Landes zur Seite stellen. Denn offensichtlich war dieses Land schon vor dem Zeitpunkt der Attentate auf einen gesichtslosen Feind, und das heifit: auf einen Diskurs totaler Alterisierung, eingestellt. Und offensichtlich war es moglich gewesen, aus der totalen Alterisierung des Feindes, jedenfalls nach dem Wunschskript von Independence Day, nationale Identitat zu gewinnen. »Anscheinend braucht man gerade in Zeiten, in denen die Selbstverstandlichkeit des Eigenen verlorengegangen ist, einen derartigen Gegenspieler zur Selbstvergewisserung«, schrieb Werner Schiffauer schon im Jahr 2000 iiber die Islamismus-Debatte im Westen, und er verband damit den Appell, den Blick nicht immer nur vom Standpunkt der eigenen auf die fremde Kultur zu richten, son-dern in symmetrischer Weise und mit den gleichen Beschreibungskate-gorien auf die Herkunftskultur zuriickzulenken/^ Was nicht weniger bedeutet, als dass wir uns mit der wechselseitigen Abhangigkeit, ja sogar »Symbiose« zweier entgegengesetzter Perspektiven auseinander zu setzen haben.
18 Werner Schiffauer, »Zur Kritik von Fundamentalismustheorien«, in: Schiffauer (wie Anm. 7), S. 315 ff., 316. Schiffauer wendet sich gegen ein Konzept von Fundamentahs-mus, das dessen Anhangern ein psychisches, soziales oder kulturelles Defizit unterstellt, und setzt als methodische Maxime dagegen, dass die »Wirkhchkeitskonstruktion« eines westhchen Beobachters »im Prinzip genauso beschreibbar« sein miisse »wie die von ihm Untersuchten (Prinzip der Symmetrie)«. (S. 318) Eine Untersuchung des wesdichen Fundamentahsmus in Form der Fortschrittsrehgion bietet John Gray, Al Qaeda and What It Means to Be Modern, London 2003.

Staaten und ihre Feinde IO 5
Es ist eine bekannte Paradoxic, dass Feinde sich in ihren Positionen wechselseitig stabilisieren. Daraus leitet sich das paradoxe Interesse bei-der Partcien ab, dass der jewcilige Gegner dcm Bild ahnlich wird, das sic sich von ihm machen - und sei es durch aktive MaiSnahmcn, die ihn zwingen, so zu scin, wie man denkt, dass er sei. Dieser Mechanismus im Imaginaren tut das Seine, um einen einmal aufgekommencn Konflikt sich verselbststandigen und eskaheren zu lassen. Auch cine Angsterwar-tung sucht nach Bestatigung, so negativ ihr Inhalt scin mag. Nur aus die-sem imaginaren Mechanismus heraus ist die poUtische Geschichte der letzten Jahre halbwegs adaquat zu erklaren. Der erste Schritt bestand darin, dcm Feind - in einem Literaturwissenschaftlern als Prosopopoiia bekannten Verfahren - das Gesicht zu geben, das er verborgen hatte; der zweite war, ihm einen Ort, ein Territorium, ja cine Staatsform zuzu-weisen. Die Identifikation Osama bin Ladens als Staatsfeind der USA und die Niederschlagung der TaHban haben dazu nicht gercicht, und so ist bckannthch der Irak zur Brutstatte des islamistischen Terrors erklart worden.
Wie wir alle in den Nachrichten verfolgen konnten, wurden durch den Irak-Krieg mit fataler Konsequenz eben die Verhaltnisse erzeugt, die ihn als Feindbildvorlage hatten Icgitimicrcn soUcn. In gewisser Weise haben die USA den Feind, den sic im Visier hatten, militarisch iiberhaupt erst hervorgebracht. Ich fasse mich kurz, weil die Auswirkungen dieser Paradoxic ja in den politischen Kommentaren ausgiebig diskutiert wurden: Der Krieg gegen den islamistischen Terror richtete sich gegen das urspriinglich am starksten sakularc Regime im Mittleren Osten - das jetzt moglichcrweisc auf dcm Weg zu einer islamischcn Staatsordnung ist; er ging falschlichcr Weise von einer Verbindung zwischen dcm Irak und Al Qaida aus - die sich inzwischen hergestellt hat; er wurde von der Sorge vor dcm terroristischen Einsatz von Massenvernichtungswaffen beseelt - der durch eben diese militarische Konfrontation wahrschein-licher geworden ist. Die phantasmatische Ortung des Terrors im Irak hat dazu gefiihrt, dass dieser Terror dort wirklich ein Aufmarschgebiet gefunden hat und alle Angste sich jetzt, nachtraglich, bewahrheiten. Man wird kaum sagen konnen, dass dies im objektiven Interesse der Krieg fiihrenden Staaten und ihrer Verbundeten liegt. Und doch ge-horcht es, auf aufierst unwillkommene Weise, jenem Mechanismus der imaginaren Stabilisierung der feindlichen wie der eigenen Seite.

106 Albrecht Koschorke
3
Ich will ein Resiimee versuchen, bevor ich noch einen Schritt weitergehe. Mein Vortrag ging bisher eher impressionistisch von der oft bemerkten Ahnlichkeit zwischen den Bildern des Terrors und Spielfilmszenen aus und kniipfte daran Beobachtungen an, die auf einen untergriindigen imaginaren Rapport zwischen den feindlichen Akteuren schliefien las-sen. Ein solcher Rapport ist nur moglich, wenn beide Seiten sich trotz oder vielmehr gerade in ihrer todlichen Feindseligkeit im gleichen kul-turellen und religiosen Symbolsystem bewegen. Das gilt sogar fiir die Strategic wechselseitiger totaler Alterisierung (»Anders-Machung«), in der jede Kommunikationsmoglichkeit zwischen den Antagonisten ab-geschnitten zu sein scheint - cine Strategic, die sich doch ihrerseits in ein Dialogschema von Aggression und Angsterwartung fiigt. Welche realpolitischen Folgen diese imaginare »Verstandigung« hat, die sich ja unabsichtlich und gewissermafien hinter dem Riicken der Beteiligten abspielt, und zu welchen Effekten der self fulfilling prophecy sic fiihren kann - etwa im Hinblick auf den Versuch, das anonyme, staatenlose Netzwerk des Terrors politisch dingfest zu machen und in Gestalt von Schurkenstaaten zu tcrritorialisicrcn^^ - , habe ich am Beispiel des Irak-Krieges kurz zu umreifien versucht.
Aber die Brisanz des Themas ist damit bei weitem nicht ausgeschopft. Das feindliche Zusammenspiel zwischen Staatsmacht und Terror riihrt an Fragen, die nicht nur massenmediale Bildahnlichkeiten und nicht nur den Einfluss von Feindbildern auf militarische Zielplanungen, sondern den Charakter des Staates im Allgemeinen betreffen. Um das greifbar zu machen, mochte ich noch einmal von einem Bild ausgehen - genauer, von einer Karikatur. Sie stammt von dem amerikanischen Karikaturis-ten Pat Oliphant und brachte das Dilemma des wehrhaften Staates be-reits im November 2001 auf den Punkt.
Oliphant setzte dem Justizminister der USA, John Ashcroft, einen Turban auf und liefi ihn, versehen mit richterlichem Talar und Ham-merchen, vor einem Gericht prasidieren. »Mullah Ashcroft - der neue Taliban« steht rechts auf der Zeichnung, und links ist zu lesen: »Ich kann dich 7 Tage ohne Anklage gefangen halten. - Ich kann deine Ge-sprache mit dem Verteidiger abhoren. - Ich kann sogar verhindern,
19 ^gl- Jacques Derrida, Schurken: 2wei Essays iiher die Vernunft, Frankfurt am Main 2003.

Staaten und ihre Feinde 107
dass du iiberhaupt einen Verteidiger hast. - Ich kann dir Heimlich den Prozess machen und dich verurteilen. - Ich kann dich ohne Berufung hinrichten.« Ganz unten in der Ecke eine Sprechblase: »Aber das macht nichts - es gilt nur fiir Auslander.«
In den Reaktionen auf die Anschlage vom 11. September hatte ein Mittel im Diskurs der Alterisierung darin bestanden, wieder und wie-der den absoluten Gegensatz von rechtsstaatlicher Gewalt und terroris-tischer Gewaltausiibung zu behaupten. Die Grenze zwischen beiden schien ganz und gar unpassierbar. Oliphants Portrat des »Mullah Ash-croft« kreuzt genau diese Grenze und bringt die Gegensatze dazu, in-einander zu stiirzen. Es fiihrt den Justizminister des Landes, das sich die erste moderne demokratische Verfassung zugute halt und auf seine Freiheitsrechte stolz ist, dem Publikum als einen Fanatiker vor, der wesentliche Grundrechte missachtet. Die Karikatur lasst eine geradezu spiegelbildliche Beziehung entstehen: Wahrend die muslimischen Fun-damentalisten auf westliche Auslander zielen, richtet sich der »Funda-mentalismus« der US-amerikanischen Justiz exakt umgekehrt auf Auslander, namlich staatsfeindliche Muslime. Beide Seiten bedrohen sich gegenseitig mit dem Tod, die einen durch Terror, die anderen mit den Mitteln der Justiz. Recht und Gewalt stehen einander plotzlich in sym-metrischer Feindschaft gegeniiber. Und wo Symmetric herrscht, ist Ahnlichkeit.
Was sich seither politisch ereignet hat, nahrt die Skepsis, die sich in Oliphants Zeichnung manifestiert. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland und anderen westlichen Landern wird die rechtliche Schaf-fung rechtsfreier Raume in einem Ausmafi vorangetrieben, das vor dem Aufkommen des islamistischen Terrors unvorstellbar gewesen ware.^° Justizminister Ashcroft war es auch, der es der amerikanischen Regie-rung ausdriicklich vorbehielt, aus eigener Machtvollkommenheit zu entscheiden, ob die Al-Qaida-Gefangenen der kubanischen Gefangnis-enklave Guantanamo nach den Genfer Konventionen behandelt werden soUten. Wieder bestatigt sich eine prekare Symmetric: Einem aufierrecht-lich agierenden Netzwerk von Terroristen stellt sich ein aufierrechtlich handelnder Souveran entgegen, der im Besitz aller institutionellen und apparativen Machtmittel des Staates ist.
20 Zu Deutschland: Burkhard Hirsch, »Abschied vom Grundgesetz: Otto Schilys Weg zum Uberwachungsstaat«, in: Suddeutsche Zeitung (2. November 2001), als ein Beispiel aus einer Flut von Artikeln.

IO 8 Albrecht Koschorke
Reicht es, all dies nur auf eine unvermeidliche Polarisierung in Kriegs-zeiten zuriickzufuhren? Oder auf den schon erorterten fatalen Mecha-nismus, dass Feindschaft zwischen den Kontrahenten immer auch Ahn-lichkeit stiftet? Ich glaube, die paradoxe Nahe zwischen Polarisierung und Mimesis bietet fiir sich genommen noch keine zureichende Erkla-rung fiir den RoUentausch, den Pat Oliphant ins Bild setzt, wenn er den Schutzherrn der US-Justiz als seinen eigenen Feind portratiert. Was hier auf dem Spiel steht, ist eine tiefere und noch unbehaglichere Ver-wandtschaft, die Gesetz und Gewalt bei aller Wesensverschiedenheit unsichtbar miteinander verbindet. Damit kommt eine genealogische Dimension in den Blick, ohne die eine Analyse des politischen Imagi-naren unzulanglich bliebe.
Wenn man namlich die Geschichte der Differenz zwischen Recht und Gewalt Revue passieren lasst, dann stellt man fest, dass Staatsbil-dung in alien ihren Entwicklungsstadien begleitet war von einer kom-plementaren Geschichte der outlaws, die sich in einer Zone jenseits der Staatsordnung bewegten. Offenbar war der Souveran des Gesetzes schon in seinen wie immer rudimentaren Vorformen nicht zu denken, ohne als sein Gegeniiber und als seinen Intimfeind den Gesetzlosen, den aufierhalb des Gesetzes Gestellten zu denken. Der Souveran, der das Recht setzte, spiegelte sich stets in einem Widersacher, der im Zu-stand gewalttatiger Rechtlosigkeit verblieb. Und er gewann Legitimitat dadurch, dass er dieses Alter Ego bekampfte.
Es lohnt sich deshalb, der Genealogie des Verhaltnisses zwischen dem Souveran und seinem Widersacher nachzuspiiren - und sei es nur, um auf unsere politische Gegenwart einen hinreichend fremden Blick werfen zu konnen. Ich will das nicht durch Rekonstruktion realhistori-scher Vorgange tun, sondern einmal mehr indem ich nach dem Imagina-ren, namlich nach der imaginaren Grundlegung von Staatlichkeit frage. Das lenkt den BHck auf die Fiille von Erzahlungen, die um den Moment der Instituierung des Staates und um die Figur des Staatsgriinders krei-sen. Dabei erstaunt es, dass der Staat, mit dem man ja gern Ordnung, Rechtlichkeit und Frieden assoziiert, in einer langen, von der Antike bis zu den neuzeitlichen Staatsdenkern Bodin, Hobbes und Rousseau reichenden Tradition, in aller Regel von gewalttatigen, ja rauberischen Schwellenheroen errichtet wurde. Ein friiher biblischer Gewahrsmann fiir diese Auffassung ist Nimrod, sagenhafter Stifter des assyrischen Grofireiches und zugleich sprichwortlich geworden als »gewaltiger Jager vor Jahwe«, was im Hebraischen soviel wie Rauber bedeutet.

Staaten und ihre Feinde 109
Thukydides, der erste grofie Historiograph des Staatswesens, beginnt sein Werk iiber den Peloponnesischen Krieg mit der Schilderung der Verhaltnisse im archaischen Griechenland:^^ Alle Manner seien bewaff-net gewesen, und wahrend die einen friedlichen Handel betrieben, hat-ten andere ihren Lebensunterhalt durch Uberfalle und Pliinderungen bestritten. Wo jemand landete, stellte man ihm deshalb sogleich die Frage, ob er friedhch oder ein Seerauber sei. Merkwiirdigerweise konnte nun aber der Gast auf die ihm gestellte Frage beide Antworten geben. Denn die eine wie die andere Daseinsform, so berichtet jedenfalls Thukydides, hatte auf ihre Weise als ruhmvoll gegolten. Man durfte Handler und Rauber sein, sich auf die Seite des einvernehmlichen Tausches oder der gewaltsamen Aneignung schlagen, ohne seinen sozialen Kredit einzubiifien. Beide Optionen schlossen sich gegenseitig nicht aus und waren wohl auch nicht immer eindeutig voneinander zu sondern.
Dieser standige Grenzverkehr zwischen Tausch und Raub wurde im Prozess der politischen Formierung Griechenlands nach und nach unter-bunden. Thukydides schreibt diese Leistung dem legendaren Konig Minos von Kreta zu. Minos habe als Erster eine grofie Flotte geschaffen. Er bekampfte die Rauberei, um den rechtschaffenen Handel zu fordern, und machte damit dem Hin und Her zwischen beiden Erwerbsformen ein Ende. Mit anderen Worten, Minos fiihrte im Bereich der agaischen Kiistenschifffahrt so etwas wie die Friihform eines staatlichen Gewalt-monopols ein. Thukydides erzahlt also nichts weniger als eine Fabel iiber den Ursprung des Staates. Konig Minos wird von ihm, wie von vielen anderen griechischen Autoren, zum ersten grofien Gesetzgeber und Staatengriinder erhoben. Es ist jedoch bemerkenswert, mit welchen Worten dies geschieht. Denn der Staatsmann Minos handelt in dieser Urszene der Politik keineswegs uneigenniitzig. »Auch das Seerauber-unwesen«, schreibt Thukydides iiber den kretischen Herrscher, »be-seitigte er, wie leicht zu vermuten, nach Kraften in weiten Teilen des Meeres, um seine Einkiinfte zu erhohen.«^^
»Um seine Einkiinfte zu erhohen.« Konig Minos begriindet die staatliche Ordnung, indem er eine scharfe Trennlinie zwischen rechts-formiger Staatsmacht und rauberischer Gewaltsamkeit zieht und Ver-stofie gegen diese Trennung bestraft. Das Recht, das er setzt, ist nicht mehr die eine Seite im Spiel zweier Krafte, sondern behauptet sich
21 Thukydides, Der Peloponnesische Krieg, hg. von Helmut Vretska und Werner Rin-ner, Stuttgart 2000, i. Buch, S. 11 ff. 22 Ebd., S. II.

n o Albrecht Koschorke
durch seine Asymmetrie: insofern es namlich die andere Seite nicht nur bekampft, sondern entrechtet. Wer sich fortan dem Staat widersetzt, bewegt sich in einem aufierrechtlichen Raum. Er bekommt die Gewalt des Staates zu spiiren, die fiir sich beansprucht, eine andere Form der Gewalt zu sein als jene rauberische Gewalttatigkeit. Minos macht sich also zum Herrn der von ihm aufgerichteten Unterscheidung, und er behauptet auch gleich die Definitionsmacht iiber diese Unterscheidung fiir sich. Aber Thukydides lasst ihn mit einem eleganten Halbsatz iiber seine eigene Pratention stolpern. Er lasst ja durchblicken, dass man den Staatsgriinder Minos, der die AUeinherrschaft iiber den Kiistenhandel anstrebt, schlicht als den grofiten Rauber unter den Raubern des agai-schen Meeres ansehen konne. Was bedeuten wiirde, dass er mit seiner den Staat begriindenden Unterscheidung seinerseits nicht auf die Seite des Rechts, sondern der Rauberei und damit des Unrechts fiele.
In der Antike war der Gedanke vertraut, dass zwischen dem Staat und seinem Feind, dem Gewalttater aufierhalb gesetzlicher Bindung, eine fatale Zwillingsbeziehung besteht, dass die Staatsgriindung selbst eine doppelgesichtige Angelegenheit ist, die sich ihrerseits in einer In-differenzzone vor der Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht ab-spielt. Augustinus, der kategorisch zwischen civitas terrena und civitas del trennt, fiihrt den irdischen Staat auf Kain zuriick, betrachtet ihn also als Vermachtnis eines Brudermorders/^ Es lag nahe, die Parallele zum Griindungsmythos der Stadt Rom zu ziehen, dessen Herzstiick auch ein Brudermord bildet: Bekanntlich hat ja Romulus seinen Zwilling Remus erschlagen, weil dieser iiber die Demarkationslinie sprang, durch die der Verlauf der kiinftigen Stadtmauer von Rom festgelegt werden sollte - ein Handlungszug, der auf mehrfache und paradox verschrankte Weise das Problem der Grenzziehung zwischen Innen und Aufien, poli-tischem Territorium und Wildnis, Recht und Gewalt vor Augen fiihrt.
Will man solche Doppeldeutigkeiten allein auf die Rechnung mytho-logischer Fabuliererei setzen, dann erstaunt es umso mehr, dass der
23 Augustinus, Vom Gottesstaat (De civitate del), iibers. von Wilhelm Thimme, 2 Bande, Miinchen " 1997, Band 2, 15. Buch, 5. Kap., S. 218 f. Das Kapitel tragt die Uber-schrift »Kain und Abel, Romulus und Remus« und beginnt mit dem Satz: »Der erste Griinder des irdischen Staates [Kain] also war ein Brudermorder, denn er totete, von Neid iibermannt, seinen Bruder [Abel], der als Burger des ewigen Staates auf dieser Erde ein Fremdling war. So ist es kein Wunder, daE lange hernach bei Griindung der Stadt, die das Haupt des irdischen Staates, von dem wir reden, werden und iiber so viele Volker herrschen sollte, diesem ersten Vorbild und Archetyp, wie die Griechen es nennen, das Abbild in seiner Art entsprach.« (S. 218)

Staaten und ihre Feinde I I I
Begriinder der modernen Souveranitatslehre, Jean Bodin (i529-1596), auf dem Niveau einer ausgearbeiteten Rechtssystematik unter ausdriick-lichem Bezug auf die Gestalt des gewaltigen Jagers Nimrod ganz ahn-lich argumentiert. Gleich zu Beginn seiner Epoche machenden Sechs Bucher iiber den Staat kennzeichnet Bodin den Staat als eine »am Recht orientierte Regierung. Dadurch unterscheiden sich Staaten von Rauber-und Piratenbanden.«^4 Auch die Ausgangsdifferenz des neuzeitlichen Staatsdenkens ist also: staatlicher Souveran versus Rauber. Das hat be-deutsame Folgen, denn wahrend Staaten untereinander Vertrage schlie-iSen und sich sogar im Konfliktfall gewisse Rechtsgarantien einraumen, sind Rauber und Piraten fiir Bodin keine rechtmafiigen Gegner, sondern Feinde in einem totalen Sinn, weil sie den Untergang der Staatsordnung anstreben und von dieser entsprechend riicksichtslos eHminiert wer-den miissen. Solche Feinde, meint Bodin (Ex-Justizminister Ashcroft konnte ihn fast Wort fiir Wort zitieren), »durfen nicht in den Genuss des Kriegsrechts kommen, das alien Volkern gemein ist, und auch nicht die Giiltigkeit jener Gesetze fiir sich beanspruchen, die Sieger den Be-siegten zu geben pflegen«/5 Mit Raubern tauscht man nicht, und das heifit, man geht auch keine juristischen Verpflichtungen mit ihnen ein.
Nun sind aber, das wusste auch Bodin, Staatsoberhaupter nur allzu oft mit Raubern im Bunde gewesen, sei es zur wechselseitigen Nutznie-fierschaft, sei es, weil Sippenriicksichten, Ehrenpflichten oder andere Verbindlichkeiten Briicken zwischen der innerstaatlichen Ordnung und jener Wildnis jenseits der Grenzlinie der Staatlichkeit schlugen. In der politischen Wirklichkeit seines Jahrhunderts, in dem der Ubergang zwischen Condottieri, Banditen und Fiirsten fliefiend war, konnte Bodin zu seinem Axiom, Staatsbildung und organisiertes Verbrechen hatten von Anbeginn an nichts miteinander zu schaffen, eine Fiille von schlagenden Gegenbeispielen finden. Fiir den pessimistischen Realisten, der er war, musste dadurch die grundlegende Unterscheidung zwischen Recht und Rechtlosigkeit als Ganzes ungewiss werden. Unter Bezugnahme auf die Geschichtsschreiber der griechischen Antike gelangt Bodin jedenfalls zu der niichternen Einsicht, »dass Macht und Gewalt der Anfang und Ursprung der Staaten gewesen sind«.^^
24 Jean Bodin, Sechs Bucher iiher den Staat, hg. von Peter Cornelius Mayer-Tasch, 2 Bande, Miinchen 1981 und 1986, Band i: Buch I-III, i. Buch, i. Kap., S. 98. 25 Ebd., S. ^9. 16 Ebd., I. Buch, 6. Kap., S. 159. Das Zitat in voller Lange: »Vernunft und Einsicht las-sen uns vermuten, dafi Macht und Gewalt der Anfang und Ursprung der Staaten gewesen

112 Albrecht Koschorke
Folgt man dieser Tradition des Staatsdenkens, dann sind Staat und Rauberei gleichen Ursprungs. Dann konstituiert sich der Souveran, in-dem er sozusagen iiber die Schwelle der Indifferenz zwischen Rauber-gewalt und Staatsgewalt tritt. Sobald er dies tut, »vergisst« er, dass er auch einmal Rauber, namlich Usurpator der Macht, war. Er grenzt alle, die sich seinem Machtmonopol nicht bedingungslos unterwerfen, aus der Rechtsordnung aus. Er kiindigt die alte Briiderschaft mit den Jagern und Raubern auf und stellt sich ihnen unter Aufbietung aller ihm zur Verfiigung stehenden Gewaltmittel entgegen. Der Konstanzer Soziologe Bernhard Giesen hat diesen Mechanismus einmal als »Urver-drangung« der Gewalt durch den Staat beschrieben. Die »Geschichte der Staatsgewalt« (Wolfgang Reinhard) ist voll von solchen Abspaltun-gen staatsfeindlicher Krafte von dem wachsenden, sich ausbreitenden, immer umfassendere Anspriiche stellenden Staat/^ Die Entwicklung pohtischer Legitimitat im Innern der Ordnung geht mit einer Serie von Ausschliissen einher - ob dies nun unbeugsame Adlige auf ihren Burgen, fiir vogelfrei erklarte Banditen, Freischarler, Revolutionare, schliefilich Widerstandskampfer und Partisanen des 20. Jahrhunderts betrifft. Und oft genug haben einerseits offene Feindschaft auf Leben und Tod, ande-rerseits ein heimlicher Dialog, wenn nicht gar Positionstausch, zwischen den Herren auf der einen und auf der anderen Seite bestanden.
Weil Inklusion in den Staat offenbar ohne einen riickwartigen Akt der Exklusion nicht zu haben ist, bringt der historische Triumphzug des Staates stets wieder neue und zeitgemafie Gegnerschaften hervor. Diese Gegner verkorpern jeweils die Kehrseite des Staates, der Zivilisa-
sind. Wiirde uns dies nicht schon die Vernunft sagen, so liefie sich im Folgenden anhand des liber jeden Zweifel erhabenen Zeugnisses der hervorragendsten Geschichtsschreiber, als da sind Thukydides, Plutarch und Caesar, und auch anhand der solonischen Gesetze beweisen, dafi die ersten Menschen keine grofiere Ehre und Tugend kannten, als, um mit Plutarch zu sprechen, Menschen umzubringen, zu massakrieren, auszurauben oder zu unterwerfen. Aufierdem verfiigen wir iiber das Zeugnis der biblischen Geschichte, in der es heifit, Chams Neffe Nimrod sei der erste Mensch gewesen, der mit Macht und Gewalt die Menschen unterwerfen habe, als er seine Fiirstenherrschaft im assyrischen Kand errichtete. Man hat ihn deshalb auch >den grofien Jager< genannt, was im Hebraischen soviel wie Rauber oder Dieb bedeutet.« 27 Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt: Eine vergleichende Verfassungs-geschichte Europas von den Anfdngen bis zur Gegenwart, Miinchen ^2000. Zum Aus-tausch zwischen organisierter Kriminalitat und nation building im Europa der Friihen Neuzeit vgl. auch die materiale Studie von Charles Tilly, »War Making and State Making as Organized Crime«, in: Peter B. Evans u. a. (Hgg.), Bringing the State Back In, Cambridge 1985, S. 169-191. Tilly spricht unter Berufung auf Fernard Braudel von der »long love-hate affair between aspiring state makers and pirates or bandits«. (S. 173)

Staaten und ihre Feinde 113
tion, des Friedens, des Rechts und werden demgemafi perhorresziert. Und dock verdeckt die Rhetorik des Staatsfeindes als des unbegreiflich Anderen nur allzu leicht, dass beide Seiten von der gleichen mythischen Substanz zehren. Man muss kein romantisch verfalschendes Bild vom heldenhaften Kampf des Einzelnen gegen die Staatsmacht entwerfen, um festzustellen, dass auf lange Sicht noch jedes Mai der Staat als Sieger aus solchen Auseinandersetzungen hervorging. Auf welcher histo-rischen Stufe auch immer, die Mobilmachung des Staates gegen seine jeweiligen Widersacher hatte langfristig den Effekt, die Staatsgewalt zu vermehren.
Die letzte Figur in dieser Reihe, die sich der Heranbildung einer staat-lichen Souveranitat im Weltmafistab entgegenstellt, ist der global ope-rierende Terrorist. Das Entsetzen liber die begangenen Terroranschlage haben die Machtfiille des Staates und die Hoffnung auf ihn weiter ge-starkt. Er gilt mehr denn je als Garant fiir das Leben und die Unversehrt-heit seiner Burger, als einziger verlasslicher Schopfer von Gerechtigkeit. Gegeniiber dieser neuen Evidenz des Staatsvertrauens wirkt die Erinne-rung daran, dass das eben erst zu Ende gegangene 20. Jahrhundert das Jahrhundert einer Staatskriminalitat unvorstellbaren Ausmafies war, merkwiirdig blass. Noch heute fordert weltweit der Terrorismus von Staaten weitaus mehr Opfer als der Terrorismus einzelner Gruppen, und es ist vor diesem Hintergrund aufierst fraglich, ob die Organisa-tionsform staatlicher Herrschaft als solche eine natiirliche Nahe zur Gerechtigkeit hat. In die AUianz gegen den Terror, die 2001 von den USA ins Leben gerufen wurde, haben Lander wie Russland und China Auf-nahme gefunden, die einen erbitterten, teilweise terroristischen Krieg gegen ihre ethnischen Minoritaten fiihren. Laut amnesty international verbirgt das Etikett »Kampf gegen den Terrorismus« »eine sprunghafte Zunahme weltweiter Menschenrechtsverletzungen«.^^ Nicht weniger fliefiend sind auf der anderen Seite die Ubergange zwischen politischem Freiheitskampf, organisierter Kriminalitat und Terror. Wo die Fronten zwischen legitimer und illegitimer Gewalt verlaufen, ist oft nur eine Frage der Partei und der Perspektive. Wie bei alien Unterscheidungen muss man auch hier fragen: Wer unterscheidet? Und von welcher Seite der Alternative aus operiert die Unterscheidung? Denn wo eine Unter-scheidung getroffen wird und uniiberwindlich scheinende Grenzen ein-zieht, hat vorher eine Verbindung bestanden.
28 Tiircke (wie Anm. i), S. 10.

114 Albrecht Koschorke
4
Es ist diese Verbindung in ihrer ganzen Unheimlichkeit, die uns beschaf-tigen soUte. Wenn wir Ernst machen woUen mit der von Bruno Latour erhobenen Forderung nach einer »symmetrischen Anthropologie«,^^ dann miissen wir konsequenter als bisher in zwei Richtungen denken. Erstens muss man, so schwer das fallt, auch dem islamistischen Terror so etwas wie eine subjektive Handlungsrationalitat zubilligen. Statt ihn zu mystifizieren - und schon der Gebrauch des Singulars stellt in diesem Zusammenhang eine Mystifizierung dar - , muss man die Frage riskieren: Auf welches Problem gibt er eine Antwort, die in den Augen der Akteure und der wachsenden Zahl von Rekruten folgerichtig er-scheint? Kann man so weit gehen, rational choice-Ycrhhren auf Terro-risten anzuwenden? (Man kommt auf jeden Fall weiter, wenn man von der schrecklichen Rationalitat und nicht vom puren Irrationalen des Terrors ausgeht.)
Zweitens muss man lernen, auf die Politik westlicher Staaten aus der Erfahrung der anderen Seite zu sehen. In meinen Augen ist das bisher kaum erfolgt - oder entsprechende Versuche haben kaum Nachhall im offentlichen Bewusstsein gehabt. Wenn Robert McNamara in dem Dokumentarfilm Fog of War (2003) konstatiert, im Vietnam-Krieg sei es im Gegensatz zur Kuba-Krise nicht gelungen, sich in die Person des Feindes zu versetzen, dann gilt dies umso mehr in der Konfrontation mit den islamischen Fundamentalisten. Aufier der kleinen Zahl iiblicher Allgemeinplatze finden sich in den westlichen Staaten meines Wissens nur unvollkommene Ansatze dazu. Es gibt keine kulturelle oder politi-sche Briicke zwischen »dem« Westen und »den« Islamisten, iiber die man gehen konnte, um wenigstens versuchsweise die Blickrichtung zu wechseln. Die einzige Kommunikation lauft, wie dargestellt, iiber das vom Christentum wie vom Islam bereitgestellte apokalyptische Register.
Aber ich denke, wir diirfen es uns weder politisch noch intellektuell leisten, nach den Gewohnheiten einer kolonialen, eurozentrischen Tradition nur in der einen Blickrichtung, namlich vom Eigenen her, das Andere als rein Anderes anzusehen. Auch und gerade Feindschaft be-ruht auf einer Art nervoser Interdependenz, und dazu gehoren jener
29 Bruno Latour, Wir sind nie modern gewesen: Versuch einer symmetrischen Anthro-pologie, Frankfurt am Main 1998.

Stauten und ihre Feinde 11 5
befremdliche Bilderverkehr und die Spiegelungen in feindlicher Bruder-schaft, wie sie in die Mythologie des Staates von alters her eingeschrie-ben sind - jenes Oszillieren im Imaginaren.
Es ist eine vielleicht ohnmachtige Hoffnung, dass ein erster und wichtiger Schritt zur Steuerung dieser Interdependenz darin besteht, sie zu durchschauen.

Lorraine Daston
Bilder der Wahrheity Bilder der Ohjektivitdt
Einfiihrung: Eine Geschichte der Epistemologie in Bildern
Betrachten wir die beiden folgenden botanischen Bilder von Blattern: Das erste ist ein undatiertes Aquarell des osterreichischen Kiinstlers Franz Bauer, der im spaten i8. und friihen 19. Jahrhundert fiir seine Orchideengemalde beriihrnt war (ABB. I); das andere ist ein Naturselbst-druck von Alois Auer, einem anderen Osterreicher, aus dem Jahr 1853 (ABB. 2). Das Bauersche Aquarell zeigt Blatter, die kein menschliches Auge je gesehen hat noch jemals sehen wird. Beachten Sie die latei-nischen Bildunterschriften: cordata (herzformig), sagittata (gezackt), triloba (dreiblattrig). Trotz ihrer lebhaften Farben und erlesenen Schat-tierungen zeigen diese Bilder lediglich Typen von Blattern, nicht indivi-duelle Exemplare oder gar Arten. Die Unterschriften beziehen sich auf das Linnesche Klassifikationsschema fiir Pflanzen, erstmals dargestellt im Hortus Cliffortianus (1737), illustriert von Georg Dionysius Ehret, gestochen von Jan Wandelaer. Im Gegensatz dazu sind die Naturselbst-drucke, wie der Name nahe legt, die Abdrucke wirklicher Blatter mit all ihren individuellen Eigenheiten. Ahnlich wie die Photographie und eine ganze Reihe anderer wissenschaftlicher Bildgebungsverfahren des mittleren 19. Jahrhunderts zielte der Prozess des Naturselbstdrucks darauf ab, die Natur ihr eigenes Portrait zeichnen zu lassen, wobei der Wissenschaftler oder Kiinstler so wenig wie moglich eingreifen sollte. Das Aquarell und der Naturselbstdruck sind Embleme zweier verschiedener und gelegentlich entgegengesetzter epistemischer Qua-litaten: Wahrheit und Objektivitat. Sie sind auch Beispiele fiir zwei unterschiedliche Herangehensweisen an die Frage wissenschaftlicher Reprasentation. Ziel meines Essays ist es, den Unterschied zwischen
117

118 Lorraine Daston
einer Wissenschaft, die nach Wahrheit strebt, gegeniiber einer, die auf Objektivitat abzielt, anhand von historischen Beispielen zu erklaren und zu verdeutlichen, wie diese Unterschiede ihre Spuren in wissen-schaftlichen Bildern hinterlassen.
Was sind epistemische Tugenden? Und wie sinnvoU ist die Aussage, dass sie eine Geschichte haben? Wahrend moralische Tugenden das Gute fordern, sind epistemische Tugenden diejenigen Ideale und Prak-tiken, die Wissen und Erkenntnis vorantreiben. Und genauso wie wir eine ganze Reihe moralischer Tugenden aufzahlen konnen (Gerechtig-keit, Nachstenliebe, Tapferkeit, Giite, Ehrlichkeit), gibt es auch nicht nur eine, sondern mehrere epistemische Tugenden: Der Begriff umfasst nicht nur Wahrheit und Objektivitat, sondern beispielsweise auch Ge-wissheit, Genauigkeit, Verlasshchkeit, Konsistenz und bestimmt noch andere. Keine menscWiche Gemeinschaft kann ohne einen Code mora-hscher Tugenden iiberleben, und keine wissenschafthche Gemeinschaft kann ohne gewisse epistemische Tugenden bestehen. Aber ebenso wie verschiedene Kulturen sich darin unterscheiden mogen, was als mora-hsche Tugend gilt (oder in welcher Hierarchic die morahschen Tugenden ihrer Wichtigkeit nach angeordnet sind), standen wissenschafthche Gemeinschaften historisch gesehen unter der Leitung unterschiedhcher Codes epistemischer Tugenden. Gewissheit war unter den scholasti-schen Naturphilosophen des Mittelahers eine Kardinaltugend, ebenso fiir Descartes: Was nicht durch logische oder mathematische Beweisfiih-rung bewiesen werden konnte, gait in diesem Schema nicht als wahres Wissen. Moderne Wissenschaftler verlangen keine Gewissheit der Be-weisfiihrung mehr; sie sind mit probabilistischer Kausalitat zufrieden. Auch Koharenz im Erklarungsansatz ist ihnen weniger wichtig als ihren mittelalterlichen Vorgangern, die vom Wachstum einer Eiche bis hin zu den Planetenbahnen alles anhand der vier aristotelischen Griinde erklaren konnten. Stattdessen legen heutige Wissenschaftler grofien Wert auf Genauigkeit und Verlasslichkeit der Vorhersage - beides epistemische Tugenden, die man friiher nicht gekannt hatte.
Diese Beispiele mogen einem einleuchten: Vielleicht gab es einmal eine Zeit, in der Wissen ohne Genauigkeit auskommen konnte, genauso wie es einmal eine Zeit gab, in der das moralisch Gute ohne Grofiziigig-keit auskommen konnte. Aber man konnte weiterfragen, ob es nicht einige Tugenden gibt, die so grundlegend sind, dass man sich eine epistemische oder moralische Ordnung ohne sie nicht vorstellen kann? Ge-nauer gefragt, kann man sich Wissen ohne Wahrheit und Objektivitat

Bilder der Wahrheit, Bilder der Ohjektivitdt 119
vorstellen? Meine vorsichtige Antwort auf diese Frage geht in die Rich-tung, dass Wahrheit tatsachhch eine uralte und vielleicht sogar essen-zielle epistemische Tugend ist, die Objektivitat jedoch im Gegensatz dazu ein NeuankommUng. Es gab Wissen, sogar wissenschaftUches Wissen, lange bevor es Objektivitat gab.
Objektivitat hat eine Geschichte, und zudem eine relativ kurze. Als epistemische Tugend entsteht sie erstmals in der Wissenschaft des mitt-leren 19. Jahrhunderts. Auf den ersten BHck erscheint diese Behauptung unwahrscheinhch, ja paradox. Wie kann es Wissenschaft ohne Objektivitat geben? Welche Definition von Objektivitat wiirde die Beitrage eines Archimedes, eines VesaHus, eines GaHleo oder einer langen Reihe anderer grofier Naturforscher ausschUefien? Und wie kann Objektivitat sich zeithch entwickeln? Liegt es nicht in der Natur von Objektivitat, dass sie einheitUch ist und mit einer Stimme spricht, im Gegensatz zu den vielen widerspriichUchen Stimmen der Subjektivitat? Um die spe-zifisch historischen Behauptungen meines Essays auch nur verstandhch zu machen - und es ist am Leser, auf der Grundlage der folgenden Bei-spiele zu beurteilen, ob sie auch einleuchtend sind - , muss ich zuerst versuchen, diese allgemeinen Fragen zur Idee einer Geschichte der Objektivitat zu beantworten.
Beginnen wir mit dem Wort »Objektivitat«, das selbst eine kom-plexe und iiberraschende Geschichte gehabt hat. Seine verwandten Formen in europaischen Sprachen leiten sich von der lateinischen Adverbial- oder Adjektivform objectivus/objective ab, die im 14. Jahrhun-dert von scholastischen Philosophen wie Duns Scotus und WiUiam von Occam eingefiihrt wurde. Von Anfang an war der Begriff immer mit subjectivus/subjective gekoppelt, aber urspriinghch bedeutete er fast genau das Gegenteil von dem, was er heute bedeutet. »Objektiv« bezog sich auf die Dinge, wie sie im Bewusstsein reflektiert werden, wahrend »subjektiv« sich auf die Dinge an sich bezog.^ Die Worte »objektiv« und »subjektiv« wurden im 17. und 18. Jahrhundert obsolet; nur gele-genthch wurden sie von Metaphysikern und Logikern als Termini tech-nici benutzt.^ Es war Kant, der die muffige scholastische Terminologie
1 Siehe beispielsweise die Texte, die im Oxford English Dictionary (Oxford 1989) unter dem Eintrag »objective« angefiihrt werden. 2 Wenn man auf der Grundlage von Worterbucheintragen urteilt, scheinen das Wort »objektiv« und seine Entsprechungen seit dem spaten 17. Jahrhundert meist zur Be-schreibung von MikroskopHnsen benutzt worden zu sein. Seit 1755 definiert Samuel Johnsons Dictionary of the English Language (London) eine Bedeutung von »objective« als »zu einem Objekt gehorend, in einem Objekt enthalten«, eine Definition, die mit

120 Lorraine Daston
von »objektiv« und »subjektiv« entstaubte und diesen Begriffen neues Leben und eine neue Bedeutung einhauchte. Erst in den iSzoer und i83oer Jahren begannen Worterbucheintrage, zunachst auf Deutsch, dann auch auf Franzosisch und spater auf Englisch, die Worte »Ob-jektivitat« und »Subjektivitat« in einem uns heute vertrauteren Sinn zu definieren, oft mit einem Hinweis auf die Kantsche Philosophie. 1820 beispielsweise definiert ein deutsches Worterbuch objektiv als »die Be-ziehung auf ein aufieres Objekt« und subjektiv als »personlich, inner-lich, uns innewohnend, im Gegensatz zu objektiv«; noch 1863 nennt ein franzosisches Worterbuch dies die »neue Bedeutung« (in direktem Gegensatz zur alten, scholastischen Bedeutung) des Wortes objectif und schreibt die Neuerung der »Philosophie Kants« zu. Als Thomas De Quincey 1856 die zweite Ausgabe seiner «Confessions of an English Opium Eater» veroffentlichte, zoUte er dem kometenhaften Aufstieg des neuen Begriffs objective in einer Fufinote Tribut:
»Dieses Wort, das 1821 [dem Jahr der ersten Ausgabe] nahezu unverstand-lich, ziemlich scholastisch und daher, umgeben von vertrauten Wortern der Umgangssprache, so pedantisch erschien und das dock fiir genaues und weites Denken so unabdingbar ist, ist seit 1821 so allgemein verbrei-tet, dass es keiner weiteren Entschuldigung oder Erklarung bedarf.«^
Irgendwann um 1850 war die neue Bedeutung von »Objektivitat« in den grofien europaischen Sprachen angekommen, immer noch als Paar mit dem alten Gegensatz »Subjektivitat« auftretend, aber inzwischen hatte sich beider Bedeutung um 180 Grad gewendet.
Dieser Parforceritt durch die Geschichte des Wortes »Objektivitat« ist suggestiv, aber natiirlich kein hinreichender Beweis dafiir, dass die Sache, auf die sich das Wort heute bezieht, nicht lange vor dem Voka-
ihrem Belegzitat aus Isaac Watts' Logick (London 1724), bis weit ins 19. Jahrhundert hinein wiederholt wird; beispielsweise »Objective«, in John Ogilvie, The Imperial Dictionary, Band 2, London 1850, S. 257. Eine ahnliche Bedeutungsverschiebung findet sich in C, A. Crusius' Unterscheidung zwischen ohjektivischer oder metaphysischer und sub-jektivischer oder logikalischer Wahrheit in seinem »Weg zur Zuverlassigkeit und Ge-wiftheit der menschHchen Erkenntnis« (1747), in: G. TonelH (Hg.), Die philosophischen Hauptwerke, Band 3, Hildesheim 1965, S, 95. 3 Thomas De Quincey, »The Confessions of an EngHsh Opium Eater« (1821, 1856), in: ders., Works, 15 Bande, Band i, Edinburgh ^1863, S. 265. Ironischerweise erinnert De Quinceys Verwendung des Wortes eher an die scholastische Bedeutung: »Diese Traume von Wasser verfolgten mich so sehr, dass ich schon fiirchtete, ein wassersiichtiger Zu-stand oder eine solche Neigung des Gehirns konne sich (um einen metaphysischen Aus-druck zu verwenden) objektivieren und das Organ der Empfindungen sich als sein eige-nes Objekt projizieren.«

Bilder der Wahrheit, Bilder der Ohjektivitdt 121
bular existierte, das spater gepragt wurde, um sie zu identifizieren und iiber sie zu sprechen. Um darzulegen, dass Objektivitat als Sache wie auch als Wort eine Neuerung des 19. Jahrhunderts war, muss ich mich spezifischen historischen Beispielen aus der Wissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts zuwenden. Meine Hauptquelle wird der wissenschaft-hche Atlas sein. Seit dem 16. Jahrhundert wurden in den Wissenschaften des Auges Ausgaben der von ihnen bezeichneten Phanomene in Form von Atlanten angefertigt,^ reich illustrierten Banden von sorgfaltig aus-gewahlten Beobachtungsgegenstanden - Korperorgane, Sternbilder, bliihende Pflanzen, Instrumentenanzeigen - , abgebildet aus sorgfaltig ausgewahlten Perspektiven. Der Atlas intendiert, die Natur fiir die Wissenschaft erfassbar zu machen: die unmittelbare Erfahrung (die zu-fallige, kontingente Erfahrung des spezifischen, individuellen Objekts) durch verarbeitete Erfahrung (das Wesentliche, Notwendige, Univer-selle) zu ersetzen. Alle Wissenschaften miissen sich mit diesem Problem der Auswahl und Konstitution von »Arbeitsobjekten« im Gegensatz zu den allzu zahlreichen und allzu unterschiedlichen natiirlichen Objekten befassen. Atlanten liefern den Wissenschaften des Auges Arbeitsobjekte. Anhand von Bildern aus wissenschaftlichen Atlanten beider Epochen werde ich versuchen, den Kontrast zwischen den Wissenschaften, die sich der Wahrheit, und denen, die sich der Objektivitat verschrieben haben, lebendig zu machen.
Bilder der Wahrheit
Wenden wir uns wieder Linnes Hortus Cliffortianus zu, einer reichen Flora von Pflanzen aus dem bestens bestiickten Garten des Amster-damer Bankiers George Clifford, des Direktors der Dutch East India Company. Es handelt sich um einen der opulentesten wissenschaftlichen Atlanten des 18. Jahrhunderts.^ Linnes reiche Mazene hatten keine Kos-ten gescheut, um das Buch ebenso schon wie niitzlich zu gestalten. Alle,
4 Das Wort »Atlas« wurde erstmals 1595 von Gerard Mercator fiir seine Wekkarte be-nutzt; siehe Gerard Mcreator's Map of the World, mit einer Einfiihrung von B. Van 'T Hoff, Rotterdam / 'sGravenhage 1961 (= Publicaties van het Maritiem Museum Prins Hendrik 6), S. 17. 5 Carl Linnaeus, Hortus Cliffortianus: Plantas exhibens quas in hortis tarn vivis quam siccis, Hartecampi in Hollandia, coluit vir nobilissimus & generosissimus Georgius Clifford, juris utriusque doctor, reductis Varietatibus ad Species, Speciebus ad Genera, Genera ad Classes, Amsterdam o.J, [1737].

122 Lorraine Daston
die an dem Unternehmen beteiligt waren - Mazene, Naturforscher und Illustratoren - , waren gleichermafien bestrebt, ein Werk von epochaler Bedeutung fiir die Geschichte der Botanik zu schaffen. Das Buch be-gann selbstreflexiv mit einer Bibliographie aller wichtigen botanischen Werke seit Theophrast und implizierte damit, selbst der Hohepunkt dieser Entwicklung zu sein. Weniger bombastisch, dafiir aber einfluss-reicher war die Tatsache, dass die Arbeit am Hortus Cliffortianus und der Zugang zu Cliffords reicher botanischer Bibliothek sowie zu sei-nem Garten und Gewachshaus Linne eine praktische Basis fiir seine weiteren Publikationen zur botanischen Nomenklatur, Klassifikation, Beschreibung und Illustration boten, welche ihrerseits die Entwicklung der botanischen Wissenschaft seither gepragt haben/
Man kann jedoch Linnes Beschreibungen und die Illustrationen, die er fiir den Hortus Cliffortianus in Auftrag gab und genau iiberwachte, nicht objektiv nennen. Und es geht hier nicht um historische Spitz-findigkeiten gegeniiber Anachronismen, nicht um knifflige Einwande gegen die Verwendung eines Begriffs, den Linne und seine Zeitgenossen des mittleren 17. Jahrhunderts als merkwiirdig scholastisch empfunden hatten, wenn sie ihn denn iiberhaupt sinngemafi verstanden hatten. Es geht auch nicht darum, zu behaupten, Linnes Werk sei »unwissen-schafthch« und mit dem Makel von Vorurteil, Unwissenheit oder In-kompetenz behaftet, also »subjektiv« im pejorativen Sinn des Wortes. Aber der Begriff, den Linne und andere Gelehrte der Aufklarung als wissenschaftlichen Standard hochhielten, war »Wahrheit«, nicht »Ob-jektivitat«.
Linnes Methode, Pflanzen zu betrachten, zu beschreiben, abzubilden und zu klassifizieren, war offen, ja geradezu aggressiv selektiv: Botani-ker mussten sich darin schulen, sich auf die »konstanten, sicheren und organischen« Charakteristika zu konzentrieren; sie durften sich nicht von den irrelevanten Details im Erscheinungsbild einer Pflanze ablen-ken lassen und dadurch die Anzahl der Arten unnotig vermehren; sie mussten ihre Illustratoren davon abhalten, zufallige Merkmale wie etwa Farben wiederzugeben, statt sich auf die wesentlichen wie Zahl, Form, Proportion und Stellung zu beschranken. »Wie viele Bande hast du mit
6 Carl Linnaeus, »The Preparation of the Species Plantarum and the Introduction of Binomial Nomenclature*, in: ders.. Species Plantarum, A Facsimile of the First Edition of 1753, mit einer Einfiihrung von W. T. Stearn, 2 Bande, London 1957, S. 65-74. Der gegenwartig giiltige International Code of Botanical Nomenclature (Saint Louis 1999) datiert den Anfang offiziell akzeptierter botanischer Nomenklatur immer noch auf die Pubhkation von Linnes Species plantarum (1753), Kap. IV, Sect. 2, Art. 13.4-5.

Bilder der Wahrheit, Bilder der Ohjektivitdt 123
Namen vollgeschrieben, die sich von Farben ableiten? Wie viele Ton-nen Kupfer hast du mit der Herstellung unnotiger Druckstocke ver-geudet?«7 Ebenso wenig strebte Linne die Selbstverleugnung spaterer Wissenschaftler an. Botaniker des 19. Jahrhunderts empfanden seine Ausspriiche als zu papstlich gegeniiber der »Selbst-Verneinung«, die sie sich selbst abverlangten.^ Den Vorschlag, dass wissenschafdiche Fakten ohne die Vermittlung des Wissenschaftlers wiedergegeben werden soil-ten, hatte er unverantwortlich gefunden und die Vorstellung, dass die er-strebenswerteste Art wissenschaftlicher Kenntnis diejenige sei, welche am wenigsten von den personlichen Merkmalen des Suchers abhangt, absurd. Nur der scharfste und erfahrenste Beobachter, der wie Linne Tausende verschiedener Exemplare begutachtet hatte, war qualifiziert, eine echte Art von einer blofien Varietat zu unterscheiden, den wah-ren, der Pflanze eingepragten spezifischen Charakter zu identifizieren und die zufalligen von den wesentlichen Merkmalen zu unterscheiden. Linne war der Wahrheit seiner genera (und sogar der Wahrheit der spezifischen Namen) vehement verpflichtet, aber nicht ihrer Objektivitat, noch nicht einmal avant la lettre.
Linnes Ansichten teilte nicht nur die Mehrzahl der Botaniker des 18. Jahrhunderts, sondern auch die zeitgenossischen Praktiker ande-rer beschreibender Wissenschaften wie Anatomic, Muschelkunde, In-sektenkunde. Anthropologic und Geodasie. Es handelte sich um die Wissenschaften des geschulten Auges, das in Jahren der Erfahrung die Gewohnheit erworben hatte, das Wesenthche vom Zufalligen zu unterscheiden, das Normale vom Pathologischen, das Typische vom Anoma-len, das Variable vom Konstanten. Die platonischen Untertone in dieser Rede von einer Wahrheit unter den Erscheinungen, von Noumena hin-ter den Phaenomena, sind natiirlich uniiberhorbar. Die Rede von einer verborgenen Einfachheit hinter der manifesten Komplexitat passte auf die Wissenschaft der Sterne und Kristalle ebenso wie auf die der Pflan-zen und Insekten. Aber die Naturforscher konnten sich zusatzlich noch auf die Aristotelische Redeweise von der organischen Form als etwas Realem oder zumindest etwas Realerem als dem beobachtbaren Indi-viduum dieser oder jener Art von Orchidee oder Motte beziehen. Es
7 Carl Linnaeus, The >Critica Botanica< of Linnaeus, iibers. von Sir Arthur Hort, iiber-arb. von Miss M.L. Green, mit einer Einfiihrung von Sir Arthur W. Hill, London 1938, Aphorismen 256, 259, 266, 282, S. 116, 122, 139, 161. Die Critica Botanica wurde erstmals 1737 veroffentlicht. 8 Alphonse de Candolle, La Phytographie, Paris 1880, S. 238, 242.

124 Lorraine Daston
handelte sich dabei um eine Wahrheit, die sich nicht aus dem Bezug auf Kurven und mathematische Gleichungen offenbaren wiirde; es war vielmehr die Wahrheit einer synthetischen Wahrnehmung, der Fahig-keit, eine gemeinsame Form zu entdecken, die in sich viele Einzelexem-plare einer Art vereinte. In seinen morphologischen und methodischen Schriften nannte Goethe solche Wahrheiten Archetypen oder reine Phanomene:
»Es gibt, wie ich besonders in dem Fache, das ich bearbeite, oft bemer-ken kann, viele empirische Briiche, die man wegwerfen muE, um ein rei-nes konstantes Phanomen zu erhalten [...]. Es kann niemals isoliert sein, sondern es zeigt sich in einer stetigen Folge der Erscheinungen. Um es darzustellen bestimmt der menschHche Geist das empirisch Wankende, schliei t das Zufallige aus, sondert das Unreine, entwickelt das Verwor-rene, ja entdeckt das Unbekannte.«^
Tausende von weniger kontemplativ eingesteUten Naturforschern des 18. Jahrhunderts praktizierten, was Goethe theoretisierte: Sie strebten die Verdichtung und Integration einer Fiille individueller Eindriicke zu einer »wahren« Reprasentation der jeweihgen natiirhchen Art an, und zwar in Worten wie in Bildern. Idealerweise sollten nicht nur die Auto-ren der Atlanten, sondern auch ihre Kiinstler mit einer grofien Band-breite von Exemplaren vertraut sein, so dass jedes Bild das Destillat nicht nur eines, sondern vieler verschiedener, sorgfakig beobachteter Exemplare war. Naturforscher und Kiinstler gelangten zu solchen Des-tillaten auf ahnliche Weise, welche in beiden Fallen als Anspruch auf Genialitat gait, als das Vermogen synthetischer Wahrnehmung, welches den Meister iiber die blofien Amateure oder Kunsthandwerker erhob. Von Andreas Vesalius im mittleren 16. bis hin zu Samuel Soemmerring im friihen 19. Jahrhundert waren Anatomen stolz auf ihre Reprasen-tationen des »kanonischen« Korpers - ein Begriff, den man bis Galen zuriickverfolgen kann, welcher ihn wiederum von dem klassischen Bildhauer Policleitus abgeleitet hatte.^° Albrecht von Haller, der Got-tinger Anatom des 18. Jahrhunderts, beklagte sich iiber die »unendliche Miihe«, die es koste, die labyrinthische Vielfalt der Arterien nachzu-zeichnen, nachdem es in zahllosen Sezierungen nicht gelungen war,
9 Johann Wolfgang Goethe, »Erfahrung und Wissenschaft«, in: ders., Werke (»Ham-burger Ausgabe«), 14 Bande, Band 13: »Naturwissenschaftliche Schriften I«, hg. von Dorothea Kuhn und Rike Wankmiiller, Miinchen ^1994, S. 23 f. 10 Sachiko Kusukawa, »From Counterfeit to Canon: Picturing the Human Body, Especially by Andreas Vesalius«, Max-Planck-Institut fiir Wissenschaftsgeschichte, Berlin, Preprint 281, 2004.

Bilder der Wahrheit, Bilder der Ohjektivitdt 12 5
ein klares Muster aufzudecken. Aus diesem Grund miissten die Leser
dieses Teils seiner Icones anatomicae (1756) mehr auf den Text als auf
die Bilder achten, da die Letzteren moglicherweise nicht dem typi-
schen Fall entsprachen.^^ Man erzahlt sich von Haller, dass er Spezimen
bestimmter anatomischer Bereiche bis zu fiinfzig Mai anfertigte, um
sicherzustellen, dass der Kiinstler kein anomales, sondern ein reprasen-
tatives Modell vorliegen habe, das in charakteristischen Bedingungen
ausgestellt werden sollte/^
Das erfolgreiche synthetische Bild wurde von dem Kiinstler Sir
Joshua Reynolds in seinen Discourses fiir Kunststudenten der Royal
Academy in London 1769 beschrieben.
»Durch lange Beobachtung der Individuen einer Art erwirbt der Kiinstler eine zutreffende Vorstellung der schonen Form; er korrigiert die Na-tur durch sie selbst: ihren unvoUkommenen Zustand durch ihren voll-kommenen.«
Naturforscher und Maler strebten gleichermafien die »unveranderliche,
allgemeine Form« an, in der sich das Schone und das Wahre verbinden
sollten.
»So sind keine zwei Grashalme oder Blatter eines Baumes genau gleich, und doch ist ihre allgemeine Form unveranderlich: Bevor ein Naturforscher sich fiir eine Form entscheidet, muss er viele untersuchen, denn wenn er die erstbeste wahlt, dann konnte es sich um einen Zufall han-deln oder sonst um eine Form, die man kaum als dieser Art zugehorig erkennen wiirde; wie der Maler wahlt er die schonste, und das heisst: die allgemeinste Form der Natur.«^^
Anatomen und Naturforscher iiberwachten ihre Kiinstler und Kupfer-
stecher in der Regel sehr genau, damit nicht der Naturalismus - die
Abbildung eines individuellen Exemplars in all seinen Besonderheiten,
genauso wie es sich dem Auge bot - den Realismus der Art ausstach.
Einige Naturforscher gingen so weit, dass sie von ihren Kiinstlern als
»Werkzeugen« sprachen, deren Pinselstriche im Interesse wissenschaft-
licher Genauigkeit einzeln iiberwacht und korrigiert werden mussten.
O b w o h l einige Naturforscher gefeierte Kiinstler als Illustratoren be-
schaftigten - wie etwa der Oxforder Botaniker John Sibthorp fiir seine
11 Albrecht von Haller, Icones anatomicae, 2 Bande, Band 2, Gottingen 1743-1781, fascicule V, sig. A2.r-v. 12 Hans-Konrad Schmutz, »Barocke und klassizistische Elemente in der anatomischen Abbildung«, in: Gesnerus 35 (1978), S. 54-65, 61. 13 Joshua Reynolds, Sir Joshua Reynolds' Discourses, hg. von Helen Zimmern, London 1887, S. 29, 280.

126 Lorraine Daston
Flora Graeca (1806) Ferdinand Bauer (den Bruder von Franz Bauer) einstellte - , so war es doch iiblicher, dass die Beziehung zwischen Naturforscher und Kiinstler eher der zwischen Herr und Hausdiener ahnelte. Einige Naturforscher begannen mit der Ausbildung ihrer eige-nen Kiinstler noch in deren Kindesalter, urn deren Stil ganzUch in Uber-einstimmung mit den von Naturforschern verlangten Standards zu formen. Der engHsche Muschelforscher Thomas Martyn empfahl auf Grund ihrer Beeinflussbarkeit und ihres geringen Preises Jungen aus der Unterschicht als Kiinstler; 4 Jej- franzosische Insektenkundler Rene Antoine Reaumur beherbergte einen jungen Mann »chez moi« und unterwies ihn eigens in der Kunst, Insektenexemplare zu zeichnen/^
Wenn man die Beschreibungen der unendlichen Miihen liest, die diese Naturforscher auf sich nahmen, um ihre Kiinstler zur rechten Disziplin zu erziehen, von der Sorgfalt, die sie auf die Auswahl ihrer Exemplare verwendeten, um hochste Naturtreue zu garantieren, macht man die Erfahrung einer Schwindel erregenden Doppelsicht, in der zwei Bilder nicht ganz miteinander iibereinzustimmen scheinen. Einerseits findet man endlose Beteuerungen von Genauigkeit und Naturtreue, Versicherungen, dass jede mogliche Vorkehrung getroffen worden sei, um die Exaktheit selbst des kleinsten Details sicherzustellen. Anderer-seits findet man - im nachsten Satz, vom selben Autor - Versicherungen, dass die Illustrationen vom wachsamen Naturforscher selbst ange-messen korrigiert, ja perfektioniert worden seien, um der bedauerlichen Tendenz der Kiinstler, genau das zu zeichnen, was sie sehen, entgegen-zuwirken. Sehen wir uns beispielsweise den Fall des Leidener Anato-men Bernhard Albinus an. In seinen bemerkenswerten Tabulae sceletti et musculorum corporis humani (1747) scheute Albinus weder Kosten noch Miihen, um die voUige Integritat seiner ganzseitigen Kupferstiche des menschlichen Baus zu garantieren. Er verpflichtete den bekannten Kiinstler Jan Wandelaer (der die Kupfer fiir Linnes Hortus Cliffortia-nus gestochen hatte), nicht nur wegen dessen stilistischer Eleganz, son-dern auch weil er sowohl zeichnen als auch stechen konnte und damit das Risiko von Kopierfehlern minimierte. Trotz seiner Hochachtung fiir die Fahigkeiten des Kiinstlers versichert Albinus, dass Wandelaer »ganzlich von mir instruiert, beaufsichtigt und iiberwacht wurde als ob
14 Thomas Martyn, Le Conchyliologiste universel (1784-1787), rev. J. C. Chenu, Paris 1845,5. 8 f. 15 Rene Antoine Ferchault de Reaumur, Memoires pour servir a Vhistoire des insectes, 6 Bande, Band i, Paris 1734-1742, S. 54.

Bilder der Wahrheit, Bilder der Ohjektivitdt 127
er ein Werkzeug in meiner Hand sei und ich die Figuren selbst gefer-tigt hatte«. Albinus richtete ein System mit zwei Gittern ein, das eine zu vierzig rheinischen Fufi, das andere zu vier, so dass Wandelaer das Skelett Quadrat fiir Quadrat zeichnen und damit die Proportionen jedes Teils in Bezug auf das Ganze genau einhalten konnte. Doch diese detaillierte Sorgfalt und Genauigkeit stand fiir Albinus in keinem Wider-spruch zu seiner Auswahl von Vorzeigeexemplaren - »mannliclien Ge-schlechts, mittlerer Grosse, wohl proportioniert« - , die er dann in den lUustrationen weiter verbesserte:
»Denn wie der Maler, wenn er ein hiibsches Gesicht zeichnet und sich darin ein Makel finden sollte, er diesem im Bilde wohl abhelfen wollte, damit das Portrait umso schoner zu gestalten, so wurden auch in den Figuren Dinge, die weniger als vollkommen waren, verbessert und in einer solchen Weise ausgefiihrt, dass sie vollkommenere Muster aufwie-sen. Gleichzeitig wurde sorgfaltig darauf geachtet, dass sie durchaus genau seien.«^^ (ABB. 3)
Fiir den Leser des 21. (oder auch des spaten 19.) Jahrhunderts klingt dies so verwirrend, als hatte Albinus die Fakten seiner Materie zugleich ehrfiirchtig respektiert und schamlos manipuliert. Ich behaupte, dass die Schwankungen dieser Doppelsicht fiir die Distanz zwischen einem Regime der Wahrheit und einem Regime der Objektivitat bezeichnend sind. Albinus perfektionierte seine Skelette im Dienst der Wahrheit, aber unter Missachtung dessen, was spatere Wissenschaftler (darunter auch Anatomen) Objektivitat nennen wiirden. Fiir Albinus und seine Zeitge-nossen enthiillte sich die Wahrheit der Natur nicht nur durch nahe, son-dern auch durch vielfache Beobachtung. In der Anatomic, Botanik oder Insektenkunde war das definitive Bild nicht die naturalistische Wieder-gabe eines beliebigen Exemplars, sondern ein zusammengesetztes Bild, das auf zahlreichen Beobachtungen derselben natiirlichen Art beruhte, nicht jedoch mechanisch aus ihnen abgeleitet war. Die metaphysische Grundlage solcher Beschreibungs- und Reprasentationspraktiken war eine Mischung aus platonischem Idealismus, den natiirlichen Arten des Aristoteles und einer starken Dosis Naturtheologie. Aber fiir die Ideale und Praktiken der auf Wahrheit verpf lichteten Naturf orscher war Meta-physik weniger wichtig als die personlichen Qualifikationen des Natur-forschers. Sinnesscharfe, gutes Gedachtnis und vor allem ein sicheres
16 Bernhard Siegfried Albinus, Tables of the Skeleton and Muscles of the Human Body (1747), libers, aus dem Lateinischen, London 1749, »An Account of the Work«, sigs. a-c.

128 Lorraine Daston
Urteil machten den bedeutenden Naturforscher aus. Urteilsvermogen unterschied das Charakteristische vom Abnormen, setzte eine Vielzahl von Eindriicken zu einem Bild zusammen und erreichte die Wahrheit der Natur. Falschheit entstand aus Unerfahrenheit und unreifem Urteil - so wie beispielsweise Linne den franzosischen Botanikern vorwarf, die Zahl von Blumenarten unnotig vermehrt zu haben: »93 Tulpen (wo es nur eine gibt) und 63 Hyazinthen (wo es nur zwei gibt).« ^ Die Person des Naturforschers ahnelte der des Weisen, gereift durch lange Erfah-rung und geachtet auf Grund seiner sicheren Urteilsfahigkeit. Innerhalb des Regimes der Naturwahrheit war das brillante Wunderkind unter den Naturforschern so rar wie das Monster unter den Archetypen.
Bilder der Objektivitdt
Bilder der Wahrheit konnten freihandig oder mit Hilfe einer Camera obscura gezeichnet werden; sie konnten wie im Fall der Skelette von Albinus off en idealisiert oder wie im Fall der Gladiolen von Linne ledig-lich schematisiert werden. Was sie als Bilder der Wahrheit kennzeich-nete, war weniger, wie sie betrachtet, als vielmehr, wie sie hergestellt wurden, insbesondere aber von wem sie hergestellt wurden. Der Naturforscher musste umfangreiche Erfahrung haben, ein aufnahmefahiges und genaues Gedachtnis und vor allem die Fahigkeit, die Eindriicke vieler Exemplare oder Phanomene zu einem einzigen Bild zu syntheti-sieren, das fiir eine ganze Klasse stehen konnte - Goethes reines Phano-men. Wie Goethe betonte, sah der Beobachter das reine Phanomen mit dem Auge des Geistes, nicht des Korpers. Es entsprach einer tieferen Wahrheit als der der »unbestimmten und schwankenden« sichtbaren Phanomene. Es handelte sich um einen wissenschaftlichen (und oft kiinstlerischen) Realismus, der in direktem Gegensatz zum Naturalis-mus stand, welcher das Gesehene exakt abbildete. Bilder der Wahrheit folgten selten, wenn iiberhaupt jemals, einer sklavischen Mimesis. Die Intervention des Naturforschers war entscheidend fiir die Herstellung von Bildern der Wahrheit; Gelehrte in dieser Tradition waren stolz auf ihre Fahigkeiten im Auswahlen, Synthetisieren und Urteilen. Ihre wissenschaftlichen Personlichkeiten dominierten stolz iiber die Kiinstler und ihre Bilder.
17 Linnaeus (wie Anm. 7), Aphorism 259, S. 122.

rordoto itvoitttitti
r e f u l o r n i m .
pan t lu r . r t f» r i ! i (<
ABB. I

- IfttirsellbstirMk. .iw4trfc.l.«»F-MiStaaiankw«iuWiM. IMS.
ABB. 2

ABB. 3

ICONOGRAPHIE PHOTOGRAPHIQUE
DBS CENTRES NERVEOX
fbotogr. pjkT Lx D* tXYS.
Public p v J.B- RAil.uiB» et P t u , i Parts.
ABB. 4

ABB. 5

ABB. 6

FiORiDA CORALS
ABB. 7

^ t.*jt§s-..vr4ci-
' K i t t , * f l ^ | . ^ ,^ l i i#!^ : : | # * ; f ^a
ABB. 8

ABB. ^

Types polyo^siens, d'apres une photographic rapportee par M. le commandant Miot.
A B B . 1 0

2j^ji^ Keimes^eschichte des Aiitlitzes. (j^iomSSMf
MMeiisSt. r.lMi»iiiaiis ICKatee. aSchaaf.
ABB. I I

140
A bbildungsverzeichnis
ABB. i: Franz Bauer, »Aquarell verschiedener Blattarten«; Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Manuskriptabteilung der Staats- und Universitats-bibliothek Gottingen.
ABB. 2: Alois Auer, »Die Entdeckung des Naturselbstdruckes«, in: Denk-schriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften: Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe, 5 Bande, Wien 1853, i. Abt., S. io7-iio,Tafel VI.
ABB. 3: Bernhard Albinus, Tabulae sceleti et mHsculorum corporis humani, Leyden 1747, Tab. VII; Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Staats- und Universitatsbibliothek Gottingen.
ABB. 4: »Fibres convergentes des regions cerebrales moyennes«, in: J. Luys, Iconographie photographique des centres nerveuXy Paris 1873, PL XXV.
ABB. 5: »Baccillen im Blute einer an Septicamie gestorbenen Maus«, in: Robert Koch, »2ur Untersuchung von pathogenen Organismen«, in: Mittheilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte i (1881), S. 1-48, Tab. VI, Fig. 41.
ABB. 6: »Criminal Type«, in: Francis Galton, »Composite Portraits*, in: Nature 18 (1878), S. 97-100.
ABB. 7: »Maldrepora palmata Lamarck«, Lithographic von August Sonrel, Druck von A. Meisel, in: Louis Agassiz, Report on the Florida Coral Reefs, Cambridge MA 1880, PL XVII, Fig. i.
ABB. 8: »Echinocidarispunctulata DESML«, Albert process photograph, in: Alexander Agassiz, Application of Photography to Illustrations of Natural History, o. O. 1871 (= Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 3), S.47f-
ABB. 9: »Retuschirpult fiir Negativs, erfunden von Alois v. Anreiter«, in: Photographische Correspondenz 2 (1865), S. 17 f.
ABB. 10: E. Hamy, »Les Polynesiens et leur extinction*, Holzschnitt nach einer Photographic, in: La Nature 3 (1875), S. 161.
ABB. 11: »Keimesgeschichte des Antlitzes: Mensch, Schaf, Fledermaus, Katze«, in: Ernst Haeckel, Anthropogenic oder Entwicklungsgeschichte des Menschen, 2 Bande, Band i, Leipzig 1891, Tafel XX.

Bilder der Wahrheit, Bilder der Ohjektivitdt 141
Wenn wir uns, die dazwischen liegende Zeit iiberspringend, ins mitt-lere 19. Jahrhundert begeben, begegnen wir unter den Herstellern wis-senschaftlicher Atlanten einem ganzlich anderen Ethos. Wenden wir uns beispielsweise dem franzosischen Neurologen J. Luys zu, der 1873 eine Iconographie photographique des centres nerveux veroffentlichte. Es war nicht Luys erstes Werk zum Thema Nervenzentren. Aber er gab zu, dass Kritiker seiner friiheren Publikationen »einen Autor vermutet hatten, der zu sehr von seinem Thema erfiillt war« und seine eigenen Vorurteile den neurologischen ReaUtaten iibergestiilpt hatte. Von diesen Vorwiirfen getroffen, hatte Luys beschlossen, »sich der wunderbaren Ressourcen zu bedienen, die uns durch die Photographie zugangUch gemacht werden. Ich beschloss daher, unter ganzhcher Selbstverleug-nung und indem ich fiir meine eigene PersonUchkeit [ma propre per-sonnalite] die Aktionen des Lichts einsetzte, eine ebenso unpersonUche wie authentische Reproduktion der wichtigsten anatomischen Details zu erlangen.« (ABB. 4)
Solche Ambitionen waren fiir einen Linne oder Albinus schockie-rend gewesen, aber unter den wissenschaftUchen Atlasherstellern des mittleren 19. Jahrhunderts waren Luys und seine Versuche, »ebenso unpersonhche wie authentische« Bilder zu erlangen, nichts Ungewohn-liches. Der Bakteriologe Robert Koch wandte sich in seinem Versuch, subjektive Projektionen auszurotten, der Photographie zu. Obwohl er zugab, dass Photographien von unter dem Mikroskop betrachteten Objekten deren dreidimensionale Charakteristika verzerrten, da sie auf die zweidimensionale Ebene reduziert wurden, beharrte Koch darauf, dass Photographien selbst den genauesten Zeichnungen vorzuziehen seien. Eine Zeichnung sei »immer schoner als das Original« und werde »unwillkurlich schon im Sinne der subjectiven Anschauung des Autors angefertigt«. Statt ein reines Phanomen zu einem Bild zu synthetisieren, das dem Leser dann als Typus des fraglichen Objekts prasentiert wurde, »begiebt sich« der gewissenhafte Bakteriologe, der ein Foto publiziert, »damit jedes subjectiven Einflusses auf die Abbildung seines Prapara-tes, er legt gewissermassen das Untersuchungsobject selbst dem Publi-kum vor und lasst letzteres unmittelbar an seiner Beobachtung theil-nehmen«.^^ (ABB. 5)
In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts wiesen wissenschaft-liche Atlanten, die nahezu alles, von Schneeflocken bis zu Neuronen,
18 Robert Koch, »2ur Untersuchung von pathogenen Organismen«, in: Mittheilungen aus dem Kaiser lichen Gesundheitsamte i (1881), S. 1-48, 11 f.

142 Lorraine Daston
von Fossilien bis zu Bakterien abbildeten, altere, idealisierende Bilder von Wahrheit zu Gunsten von Bildern der Objektivitat zuriick. Da sich viele dieser Atlashersteller, wie im Fall von Luys und Koch, der Photographic zuwandten, um diese Bilder im neuen Stil herzustellen, liegt die Versuchung nahe, diese bemerkenswerte Verschiebung unter Riickgriff auf die Erfindung der Photographic zu erklaren. Sicher ist es zutreffend, dass die Photographic in der Rhetorik der Objektivitat eine grofie Rolle spielt, allerdings mehr metaphorisch als substanziell. Der angebliche Automatismus des photographischen Vorgangs, in dem »die Natur sich selbst malt«, war insbesondere fiir Wissenschaftier, die jede menschliche Intervention unterdriicken wollten, sehr attraktiv, um ein »von Menschenhand unberiihrtes Bild« zu produzieren. Doch wie jeder professionelle Photograph weifi, bedarf es vieler geschickter Inter-ventionen, um ein klares und deuthches Bild zu erzeugen; Artefakte wie Schatten, Kratzer auf der Linse oder Uberbelichtung waren ein standiges Problem, und Retusche war nicht nur eine Moglichkeit, son-dern (zumindest in der kommerziellen Photographic) Routine. Zudem konnte die Photographic auch dazu genutzt werden, genau jene Art von synthctischen Bildern zu erzeugen, welchc friihcrc Atlashersteller angestrebt hatten, wie beispielsweise der britische Universalgelehrte Francis Galton photographische Negative individueller Krimineller iibereinander legte, um ein Bild des kriminellen »Typus« zu erzeugen (ABB. 6).
Umgekehrt iibertrumpften manche Stile in der Malerei die Schwarz-weifiphotographie in ihrem Eifer, die kleinsten Details von Landschaf-ten und Naturalien in naturgetreuer Farbigkeit wiederzugeben, »ohne etwas auszuwahlen, ohne etwas auszulassen«, wie es John Ruskins beriihmter Ausspruch formulierte. Nichts im Medium selbst prades-tinierte entweder Zeichnen und Malen einerseits oder die Photographic andererscits dazu, unterschicdlichcn epistemischen Tugenden zu dienen.
Die Allianz zwischen wissenschaftlicher Objektivitat und Photographic verlangt daher nach weitcrer Erklarung. Die wissenschaftlichc Photographic war nur cine Variante der Photographic des 19. Jahrhun-derts, und objektive Photographic war ihrerscits nur cine Variante wissenschaftlicher Photographic. Angefangen mit den Experimenten des Astronomen John Hcrschel mit ultraviolettem Licht, wurdc Photographic geschickt cingesctzt, um andcrnfalls unsichtbare Phanomene fiir das menschliche Auge sichtbar zu machcn: polarisiertcs Licht, durch

Bilder der Wahrheit, Bilder der Ohjektivitdt 143
die Luft pfeifende Kugeln, Vogelflug, zerstaubende Tropfen.^^ In diesen Fallen war Photographie ebenso sehr ein Instrument wissenschaftlicher Entdeckungen wie ein Bildgebungsverfahren. Photographie konnte auch dazu genutzt werden, aufiergewohnliche Detaildichte zu erzielen, insbesondere in der Naturgeschichte. Die aufwandig detaillierten und polierten Lithographien des Illustrators August Sonrel wurden zum anerkannten Standard fiir naturgeschichtliche Illustrationen, die im mittleren 19. Jahrhundert sowohl in Europa wie auch in den Vereinigten Staaten stilistisch zunehmend homogen wurden/° (ABB. 7) Als Sonrel 1863 in Boston ein Photographiestudio eroffnete, schien das die logi-sche Fortfiihrung eines Programms wissenschaftlicher Illustration zu sein, das bereits in einem anderen Medium angestofien worden war (ABB. 8). Im Dienst von Entdeckungen oder Detailgenauigkeit musste wissenschaftliche Photographie nicht unbedingt Objektivitat behaup-ten; manchmal konnte sie ebenso gut den Zielen subjektiver Kunst dienen.
Bei seiner sensationellen offentlichen Prasentation von Jacques Da-guerres Erfindung in einer gemeinsamen offentlichen Sitzung der Academic des Sciences und der Academic des Beaux-Arts am 19. August 1839 in Paris begeisterte sich der franzosische Astronom Francois Arago fiir die Moglichkeiten, die das neue Medium als wissenschaftliches Auf-zeichnungsgerat und Lichtdetektor bot, aber er sah, den Maler Paul Delaroche zitierend, Photographie auch als Perfektionierung »gewisser Bedingungen der Kunst, so dass Photographien selbst fiir die kliigs-ten Maler ein Gegenstand der Beobachtung und Betrachtung werden«. Die urspriinglichen Griinde fiir die Begeisterung fiir Photographie als wissenschaftliches wie auch als kiinstlerisches Medium waren ahnlich, namlich die Moglichkeit, miihelos jedes und selbst das kleinste Detail einzufangen. Der Wissenschaftler Arago stellte sich vor, wie niitzlich die neue Erfindung fiir die napoleonische Expedition nach Agypten ge-wesen ware, um »die Millionen und Abermillionen von Hieroglyphen« aufzuzeichnen, welche die Tempel in Theben, Khartoum und Memphis
19 Joel Snyder, »Visualization and Visibility*, in: Caroline A. Jones / Peter Galison (Hgg.), Picturing Science, Producing Art, New York 1998, S. 379-397; Theresa Levitt, »Arago's Paper and Biot's Plates: Photographic Practice and the Transparency of Repre-sentation«, in: Isis 94 (2003), S. 256-276; Peter Geimer, »Picturing the Black Box: On Blanks in Nineteenth-Century Paintings and Photographs*, in: Science in Context 17/4 (2004), S. 467-501. 20 Ann Shelby Blum, Picturing Nature: American Nineteenth-Century Zoological Illustration, Princeton 1993, S. 181-209, ^75~^7^'

144 Lorraine Daston
bedeckten, wahrend der Kiinstler Delaroche sich an der »unvorstellbar exquisiten Ausfuhrung« der Daguerreotypien entziickte/^
Da die Photographic zunachst als Alternative zum Zeichnen und Stechen gedacht war, bewunderte man in erster Linie, wie viel kiinst-lerische Arbeit sich dadurch einsparen hefi. Rczenscnten von WiUiam Fox Talbots Pencil of Nature (i 844-1846) vergUchen einc seiner Kalo-typien mit einem niederlandischen Gemalde einer haushchen Szene aus dem 17. Jahrhundert. Anscheinend um moghchen Skeptikern zu begeg-nen, Uefi Talbot in einige Exemplare des Buchs Zettel einlegen, die dem Leser versicherten:
»Die Tafeln in diesem Buch wurden einzig durch die Kraft des Lichtes gewonnen, ohne jegliche Hilfe durch den Pinsel des Kiinstlers. Es sind Sonnenbilder und nicht, wie manche meinten, Imitationen in Kupfersti-chen.«^^
Die Fahigkeit, nahezu endlose Details unter vernachlassigbarem Ar-beitsaufwand einzufrieren, blieb ein Thema beim Einsatz der Photographic fiir wissenschaftlichc Zwecke im 19. Jahrhundert - als Mittcl der Reproduktion von Kunstwerken rivalisicrte sic aber auch Kupferstich und Lithographic/^
Bald jedoch wurdc ein andercs Argument zu Gunsten der Photographic als cines spezifisch wisscnschaftlichen Mediums angefiihrt: Der Automatismus des photographischen Prozesscs schien ein Bild zu versprechen, das frei von jeglicher menschlicher Interpretation ein so genanntes »objektives« Bild sein wiirde. Die verschiedenen Erfinder photographischer Techniken hatten alle die wundersame Spontaneitat der Bilder betont, die, wie Talbot sagte, »von der Hand der Natur ge-pragt« waren. Die Natur als Handelnde stand so stark im Vordergrund, dass die Begriffe »Erfindung« und »Entdeckung« in ihrer Anwendung aufphotographische Techniken oft austauschbar waren, als ob die Photographic selbst, wie der Sauerstoff oder die Monde des Jupiter, ein Teil der Natur ware/'^ In einem der ersten wisscnschaftlichen Atlantcn, die
21 Francois Arago, »Le Daguerreotype«, in: Annales de Chimie 71 (1839), S. 313-339,
22 William Fox Talbot, The Pencil of Nature (i 844-1846), New Introduction by Beaumont Newhall, New York 1969, Introduction o.J. Die Kalotypie, um die es hier ging, war »The Open Door«, im Vergleich mit einem Gemalde von Philips Wouverman. 23 Stephen Bann, »Photography, Printmaking, and the Visual Economy in Nineteenth-Century France«, in: History of Photography 16 (2002), S. 16-2$. 24 Mary Warner Marien, Photography: A Cultural History, London 2002, S. 23.

Bilder der Wahrheit, Bilder der Ohjektivitdt 14 5
sich der Verwendung photographischer Bilder riihraten - dem Cours de microscopie complementaire des etudes medicates (1844, Atlas 1845) des Pariser Medizinprofessors Alfred Donne - , konvergierten die Argu-mente, die sich aus der Detailliertheit ableiteten, mit denen, die sich auf Objektivitat beriefen. Neben Zeichnungen der mikroskopischen An-sichten von Blut, Milch, Samen und anderen Korperfliissigkeiten zeigte Donne mit Hilfe seines Assistenten Leon Foucault auch Photographien der kompliziertesten und komplexesten Strukturen:
»Um die Details bemerkbarer zu machen, zeige ich auch andere Abbil-dungen, welche die Objekte genau so, wie sie erscheinen, unabhangig von jeglicher Interpretation, abbilden; in der Verfolgung dieses Ziels wollte ich weder meiner eigenen Hand noch gar der eines Zeichners trauen, der immer mehr oder weniger von den theoretischen Ideen des Autors beeinflusst sein wird; dank der wundersamen Erfindung der Da-guerreotypie werden durch das photographische Verfahren die Objekte mit einer rigorosen Naturgetreue reproduziert, wie man sie bislang nicht kannte.«
Donne hoffte, dass diese neue Art von Bildern die oft gehorten Einwande seiner medizinischen Kollegen, dass das Mikroskop nur »Illusionen« zeige, zunichte machen wiirde. Wer wiirde sich der Bev^eiskraft eines ebenso spontanen wie detaillierten Objektes verschliefien konnen, das »sich selbst gemalt hat, sich selbst ohne kiinstliches Zutun auf die Tafel gebannt hat, ohne die geringste Beihilfe von Menschenhand, einzig durch die Wirkung des Lichtes, und stets bis ins letzte Detail identisch...«^5
Im Gegensatz zum Argument von der Detailliertheit unterminierte das Argument der Objektivitat die kiinstlerischen Anspriiche der Photographic. Der Salon von 1859 war die erste offizielle Pariser Kunstaus-stellung, die auch Photographien zeigte und damit die Kritik spaltete. Charles Baudelaire schimpfte iiber sklavisch naturalistische Landschaf-ten und die noch sklavischeren Kunstphotographien, wobei er seine scharfsten Spitzen einer Kunst vorbehielt, die so wenig Selbstrespekt zeige, dass sie sich »vor der aufieren Wirklichkeit niederwerfe«. »Die Natur kopieren« hiefi, nicht nur Phantasie, sondern auch Individualitat aufzugeben, welche fiir Baudelaire und andere Kritiker der Roman-tik ein wesentlicher Bestandteil grofier Kunst war. »Der Kiinstler, der wahre Kiinstler, [...] darf nur so darstellen, wie er sieht und wie er fiihlt. Er muss seiner eigenen Natur wirklich treu sein.« Photographic mochte
25 Alfred Donne, Cours de microscopie complementaire des etudes medicates: Anatomic microscopique etphysiologic desfluides de I'economie, Paris 1844 (Atlas 1845), S. 36 f.

1^6 Lorraine Daston
zwar in der Hand des Naturforschers oder des Astronomen ein be-wundernswertes Werkzeug sein, aber genau jene »absolute materielle Genauigkeit«, die die Wissenschaften suchten, war der Kunst feind-lich.^^ Als Rezensent derselben Ausstellung verteidigte Louis Figuier die Photographie als echte Kunst, indem er den individuellen Stil des Photographen und die »Empfindung, die ihn unterscheidet und be-lebt«, anfiihrte. Figuier war sich sicher, dass niemand je die vollbliitigen Arbeiten eines franzosischen Photographen mit den bleichen Produktio-nen seines engHschen Gegeniibers verwechseln konne. Wie sollte sich eine solche OriginaHtat auf einen »blossen Mechanismus« reduzieren lassen?^7
So sehr Baudelaire und Figuier in Bezug auf die Verdienste der Photographie als Kunst gegensatzhcher Meinung waren, so sehr waren sie sich in ihren Kriterien einig: Echte Kunst musste den Stempel der Individualitat und der phantasievoUen Interpretation des Kiinstlers tra-gen; eine »mechanische« Kopie der Natur kame keinesfalls in Frage. Es handelte sich um dieselben Kriterien, mit denen Wissenschaftler kiinstlerische von wissenschaftlichen Bildern unterschieden, jedoch mit umgekehrter Bewertung. In seinen Bemerkungen zu den Alpen-Pano-ramafotos des Geologen Aime Civiale hatte ein Komitee der Pariser Academic des Sciences Miihe, kiinstlerische Landschaftsbilder dessel-ben pittoresken Gipfels, welche »erfordern, dass zu einem gewissen Grad eine Personlichkeit interveniere«, von dem unnachsichtigen »Rea-lismus« zu unterscheiden, den die Wissenschaft fordert, und zwar bis in die kleinsten Zufalligkeiten in der Oberflachenstruktur des Gletschers hinein/^ In den i86oer Jahren biirgerte sich der Begriff »mechanische Photographie« im Gegensatz zur »asthetischen Photographie« ein, bei-spielsweise in der Portratphotographie.^^ Wahrend die professionellen
26 Charles Baudelaire, »Salon de i859«, in: ders., Curiosites esthetiques: UArt roman-tique et autres oeuvres critiques, hg. von Henri Lemaitre, Paris 1962, S. 319-321. Hervor-hebung im Original. 27 Louis Figuier, »La Photographie au Salon de 1859* (i860), in: La Photographie au Salon de 18^9 / La Photographie & le stereoscope. New York 1979, S. 6. 28 Aime Civiale, »Orographie: Note sur Tapplication de la photographie a la geographie physique et a la geologie«, in: Comptes rendus hehdomadaires des seances de VAcademic des Sciences 50 (i860), S. 827-829; »Orographie: Rapport relatif a des etudes photogra-phiques sur les Alpes, faites au point de vu de I'orographie et de la geographie physique, par M. Aime Civiale«, in: Comptes rendus hehdomadaires des seances de VAcademic des Sciences 61 (1866), S. 873-881, S. 873. 29 Beaumont Newhall, The History of Photography, iiberarb. Aufl., London 1982, S. 105.

Bilder der Wahrheit, Bilder der Objektivitdt 147
Photographie-Zeitschriften und -Handbiicher voller Ratschlage waren, wie man Fotos retuschierte und wie man am besten Copyright-Schutz fiir kiinstlerisches Eigentum erlangte,^° mied die bewusst »mechani-sche« Photographic solche asthetischen Raffinessen und Anspriiche (ABB. 9). Das mechanische, objektive Foto war angebUch vom »Pin-sel der Natur« allein gezeichnet worden, und die Natur kannte keine Kiinsdichkeit.
Waren solche Behauptungen jcmals mchr als blofie rhetorische Aus-schmiickungen? Photographiehistoriker weisen auf die betrachtUche GeschickUchkeit und Urteilsfahigkeit hin, die bei der Herstellung eines Fotos erforderhch waren; die Natur malt sich gewiss nicht selbst, zu-mindest nicht von alleine.^^ Kunsthistoriker weisen auf den asthetischen Kontext hin, der die Herstellung und die Rezeption von Pho-tographien pragt, selbst im Zusammenhang wissenschaftlicher und medizinischer lUustrationen.^^ Wissenschaftshistoriker bemerken, dass Photographen, Wissenschaftler und Publikum des 19. Jahrhunderts sich wohl bewusst waren, dass Fotos gefalscht, retuschiert oder anderweitig manipuliert werden konnten.^^ Und doch blieb die Mythologie eines von Menschenhand unberiihrten Bildes, das nicht von Gott, sondern von der Natur gemacht ist, machtig. Selbst ein so gewiefter Kritiker wie Roland Barthes, der seinerseits in seinen Analysen der modernen Mythologies^"^ bereitwilligst darlegte, wie Kultur sich als Natur verklei-det, liefi sich von der Photographic in den Bann schlagen: In einer Passage liber das Foto eines ehemaligen Sklaven, das er als Kind gesehen hatte, schreibt er die Wirkung des Bildes nicht der »Genauigkeit, sondern der Realitat« zu: »Nicht mehr durch den Historiker vermittelt, war Sklaverei hier unvermittelt gegeben, die Tatsache wurde ohne Methode etabliert.«^^ Die wissenschaftliche Photographic des 19. Jahrhunderts,
30 Siehe beispielsweise Ludwig Schrank, »Negative-Retouche«, in: Photographische Correspondenz 3 (Marz 1866), S. 152-154; Anton Martin, Handhuch der gesammten Photographie, Wien ^1865, S. 443-468. 31 Joel Snyder, »Res ipsa loquitur«, in: Lorraine Daston (Hg.), Things that Talk: Object Lessons from Art and Science, New York 2004, S. 194-221. 32 Martin Kemp, »>A Perfect and Faithful Record<: Mind and Body in medical Photography before i9oo«, in: Ann Thomas (Hg.), Beauty of Another Order: Photography in Science, New Haven / London 1997, S. 120-149. 33 Jennifer Tucker,»Photography as Witness, Detective, and Imposter: Visual Representation in Victorian Science«, in: Bernard Lightman, (Hg.), Victorian Science in Context, Chicago / London 1997, S. 378-408. 34 Roland Barthes, Mythologies, Paris 1957. 35 Ders., La Chambre claire: Note sur la photographie, Paris 1980, S. 125.

148 Lorraine Daston
inklusive der sich als mechanisch und objektiv gebenden Photographic, als methodenlos und unvermittelt zu bezeichnen, ist entweder naiv oder eine Beleidigung. Fast jeder Artikel des 19. Jahrhunderts zur Produk-tion von Photographien fiir wissenschaftHche Zwecke gibt seitenweise detailherte Anleitungen, was genau zu tun und wie zu verfahren sei; es erforderte viel Zeit, Miihe und Kunstfertigkeit, die Natur zu iiberreden, ihr Bild auf der photographischen Platte zu hinterlassen. In welchem Sinn konnten diese Bilder demnach als objektiv und mechanisch be-schrieben werden?
Wenn die Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts objektive Photographien forderten, um subjektive Zeichnungen zu erganzen, zu korrigie-ren oder zu ersetzen, dann nicht in erster Linie aus Furcht vor Schwindel oder Betrug, aufier vielleicht in solchen Fallen wie etwa spiritistischen Untersuchungen. Es ging ihnen vielmehr um eine weitaus subtilere Feh-lerquelle, die authentischer subjektiv und spezifischer wissenschaftlich war: um die Projektion ihrer eigenen Vorurteile und Theorien in schwie-rig zu erlangende und noch schwieriger zu interpretierende Daten und Bilder. Daher war die Tatsache, dass fiir Photographien gegebenenfalls Filter, spezielle Objektive, besondere Praparationen am Objekt, lange Belichtungszeiten und Manipulationen in der Dunkelkammer erforder-lich waren, irrelevant fiir die Frage der Objektivitat, solange keine die-ser Operationen dem Wunschdenken des Wissenschaftlers in die Hand arbeitete. Oft wurde als Vorsichtsmafinahme eine Arbeitsteilung vor-geschlagen, bei der Techniker, die angeblich von den theoretischen Im-plikationen keine Ahnung hatten, die Fotos machten und entwickelten. Selbst nachdem im spaten 19. Jahrhundert die Photogravurtechnik eine billige und genaue Reproduktion von Fotos moglich gemacht hatte, waren Photographien kein Ersatz fiir Zeichnungen in der wissenschaft-lichen Illustration. Fotos zog man bei Themen vor, die auf Skepsis stolen wiirden, sei es auf Grund ihrer Raritat oder weil sic spektakular oder kontrovers waren. Handbiicher der wissenschaftlichen Photographic empfahlen dem Ethnographen, die Erscheinung exotischer Stamme per Photographic aufzuzeichnen (oder mittels Holzstichen auf der Grund-lage von Photographien, da bis in die i88ocr Jahre hinein die Kosten der Massenreproduktion von Fotos untragbar waren), jcdcnfalls aber nicht mit Zeichnungen, da europaische kiinstlerische Konventionen ansons-ten zu Verzcrrungen nichteuropaischer Korper fiihren konnten. »Was auch immer die sonstigen Talente des Zeichners gewesen sein mogen, schen konnte er nicht, und so zeichnete er stets Menschen weisser Rasse,

Bilder der Wahrheit, Bilder der Ohjektivitdt 149
die er dann schwarz oder rot anmalte.«^^ (ABB. 10) Die hartnackigen visuellen Zweideutigkeiten der Mikroskopie legten die Verwendung photographischer lUustrationen ebenfalls nahe, um der Tendenz des Gelehrten, »unwillkurlich seine hypothetischen Erklarungen in die Ab-bildung einzubringen«, vorzubeugen.^^ Die Photographie hielt man fiir wissenschaftlich objektiv, weil sie einer spezifisch wissenschaftlichen Subjektivitat entgegenwirkte.
Die Subjektivitat, um die es hier ging, war die bewusste oder unbe-wusste Uberblendung der Natur mit dem, was der Wissenschaftler er-wartete oder erhoffte. Dies war ein neues epistemisches Laster, welches das Gewissen der Naturforscher des 18. Jahrhunderts nicht belastet hatte, und es erforderte eine neue epistemische Tugend: Objektivitat be-ziehungsweise die Selbstdisziplin, bei der Produktion von Bildern nicht zu interpretieren oder zu intervenieren. Daher stammte die unwider-stehhche Attraktion von Wendungen wie »Selbstportrat der Natur« oder »ein von Menschenhand unberiihrtes Bild«, so sehr diese Beschrei-bungen auch von dem tatsachHchen Herstellungsvorgang von Photo-graphien abweichen mochten. Und daher stammte auch die Bereitwil-hgkeit von Wissenschaftlern, gelegentUch genaue Bilder fiir objektive Bilder zu opfern, wie im Fall von Kochs fehlerhaften und irrefiihren-den Bildern: »Dennoch sind mir diese unvollkommenen Photographien immer noch unendlich mehr werth, als die schonste Zeichnung.«^^
Die neue epistemische Tugend der Objektivitat ersetzte jedoch nicht die altere Tugend der Wahrheit, und Konflikte zwischen beiden waren unvermeidlich, insbesondere in Gebieten wie Anatomic und Botanik, in denen Bilder der Wahrheit eine alte und gewichtige Tradition hatten. Ein Beispiel muss geniigen, um die Scharfe dieser Kollision zwischen Bildern der Wahrheit und Bildern der Objektivitat zu illustrieren. In den iS/oer Jahren unternahm der Leipziger Embryologe Wilhelm His eine Reihe von Angriffen auf Ernst Haeckels Verwendung embryo-logischer Belege, insbesondere von Zeichnungen der Entwicklung des Embryos, zur Unterstiitzung von Haeckels These, dass die Ontogenese die Phylogenese wiederhole (ABB. I I ) . His warf Haeckel vor, seine theo-retischen Vorurteile in die lUustrationen einzuschmuggeln, welche die Kontinuitat embryologischer Formen iiber die Gattungsgrenzen hinweg aufzeigen soUten und die His als »theils hochst ungetreu, theils geradezu
36 Eugene Trutat, La Photographie appliquee a Vhistoire natnrelle, Paris 1884, S. VI. 37 Martin (wie Anm. 30), S. 429. 38 Koch (wie Anm. 18), S. 13.

150 Lorraine Daston
erfunden« bezeichnete. Fast nannte er ihn geradeheraus einen Liigner: »Ich selbst bin im Glauben aufgewachsen, dass unter alien Qualifica-tionen eines Naturforschers Zuverlassigkeit und unbedingte Achtung von der thatsachlichen Wahrheit die einzige ist, welche nicht entbehrt werden kann.«^^ Haeckel reagierte explosiv und wies darauf bin, dass es sich bei seinen Illustrationen nicht um »>exacte und vollkommen natur-getreue Abbildungen<, wie sie His verlangt«, handle, sondern vielmehr um »sogenannte >Diagramme oder schematische Figuren<, das heifit Abbildungen, welche nur das Wesentliche des Gegenstandes zeigen und das Unwesentliche fortlassen«. Solche Illustrationen Erfindungen oder gar Liigen zu nennen, hiefie, Haeckel zufolge, jeghche Idee aus der Wis-senschaft zu vertreiben und nur Fakten und Photographien stehen zu lassen: »Vollig tadelfrei und tugendrein ist nach His (und vielen ande-ren >exacten< Pedanten) demgemass nur der Photograph, oder derjenige >Physiograph<, der gleich letzterem die Natur gedankenlos copirt.«'^°
In seiner Emporung iibertrieb Haeckel His' Besessenheit fiir blofie Fakten; His erkannte vielmehr die Niitzlichkeit von Zeichnungen wie von Photographien zu Zwecken wissenschaftlicher Illustration an. Aber er meinte, dass Zeichnungen immer ein »subjektives Element« enthielten, das manchmal von Vorteil sei und manchmal nicht, wohin-gegen das Foto ein Objekt mit all seinen Idiosynkrasien reproduziere, »auch den zufallig vorhandenen«. Aufschlussreicher als seine direkte Gegeniiberstellung von Zeichnung und Photographic war His' kom-plexe Methode, Zeichnungen zu erstellen, wobei er ein Zeichenprisma und ein Stereoskop verwendete, um ein Bild auf die Zeichenflache zu projizieren, welches dann nachgezeichnet wurde. Diese Nachzeich-nungen mikroskopischer Schnitte wurden dann in einem aufwandigen Verfahren miteinander und mit feinliniertem Graphikpapier abgegli-chen, um die Genauigkeit der Proportionen sicherzustellen. Jegliche Verbesserung oder Idealisierung der Zeichnungen oder Modelle, die in diesem System vielfaltiger Kontrollen erstellt wurden, etwa im Stil eines Albinus, hielt His fiir »bewusste Pfuscherei«.4^ Wo Albinus und seine Zeitgenossen es fiir ihre wissenschaftliche Pflicht hielten, Zeichnungen zu verbessern, die unter den strikten Vorschriften empirischer Genauig-
39 Wilhelm His, Unsere Korperform und das physiologische Problem ihrer Entstehung, Leipzig 1874, S. 171. 40 Ernst Haeckel, Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen (1874), 2 Bande, Leipzig ^iSpi), S. 858-860. 41 Wilhelm His, Anatomie menschlicher Embryonen, Leipzig 1880, S. 6-12.

Bilder der Wahrheit, Bilder der Objektivitdt 151
keit angefertigt worden waren, verdammte His jegliche derartige Intervention als gleichbedeutend mit Schwindelei. Wahrend Haeckel dem alteren Brauch folgte, wenn er seine Zeichnungen dazu nutzte, »das Wesentliche« oder das, was er fiir die wahre Idee unter den falschen Erscheinungen hielt, zu extrahieren, klagte His ihn der Versiindigung an der Objektivitat an. Es geht hier nicht darum, die wissenschaftliche Kontroverse zwischen Haeckel und His zu klaren - spatere Forschung bestatigt und korrigiert beide in einzelnen Punkten -, sondern vielmehr darum, den Konflikt zwischen dem Regime der Wahrheit und dem Regime der Objektivitat auf der Ebene wissenschaftUcher Praxis - Frei-handzeichnung versus peinhch genaue Nachzeichnung beziehungs-weise Photographic - und wissenschafthcher Ideale aufzuzeigen.
Schluss: Der Preis des Fortschritts
Die Konfrontation von Haeckel und His legt den Schluss nahe, dass das Regime der Objektivitat dasjenige der Wahrheit nicht vernichtet hat. Aber Ton und Intensitat der Kontroverse, in der es beiden Seiten um ihre personliche und professionelle Integritat ging, zeigen an, wie unbe-haglich beide Regime in derselben Forschungsgemeinschaft koexistier-ten. Und diese Spannungen waren nicht auf die Naturwissenschaften beschrankt. Erinnern wir uns an Friedrich Nietzsches Tirade gegen die »Objektivitat« in der Geschichte, seine Gegeniiberstellung zwischen Objektivitat einerseits und Gerechtigkeit und Wahrheit andererseits. Nietzsche spottete iiber die »historischen virtuosi« (womit er sicher Leopold Ranke und seine Gefolgsleute meinte), die dem Aberglauben der Objektivitat anhingen: »Sollten sich in jenem Momentum die Dinge gleichsam durch ihre eigene Tatigkeit auf einem reinen Passivum ab-zeichnen, abkonterfeien, abphotographieren?«4^ Die Vehemenz im Ton von Nietzsche und Haeckel lasst vermuten, dass sie in einer Schlacht kampften, die sie fiirchteten, bereits verloren zu haben.
Wie kam es dazu, dass das Regime der Objektivitat in der Wissen-schaft des mittleren 19. Jahrhunderts dem Regime der Wahrheit Kon-kurrenz zu machen begann und es nahezu abloste? Die Ansprache des Physiologen Rudolf Virchow anlasslich des 50. Jahrestages der Versamm-
42 Friederich Nietzsche, »Vom Nutzen und Nachteil der Historie fiir das Leben« (1874), in: Unzeitgemdfie Betrachtungen (i873-1876), hg. von Peter Piitz, Miinchen 1992, S. I l l f.

1^1 Lorraine Daston
lung Deutscher Naturforscher und Arzte im Jahr 1872 bietet einige
Hinweise. Virchow unterscheidet strikt zwischen der »Freiheit der
Wissenschaft« und der »Freiheit der wissenschaftlichen Lehre«, wobei
er fiir Letztere strenge Standards anlegt. Obwoh l Forscher frei sein
soUten, ihren dunkelsten Ahnungen und wildesten Spekulationen nach-
zugehen, miisse die im Horsaal gelehrte wissenschaftliche Lehre hochs-
ten Beweisstandards geniigen. Vorschnelle Synthesen, Analogieschliisse
und selbst Induktionen aus Fallen hatten unter den Lehrsatzen im Hor
saal keinen Platz. Der Wissenschaftler qua Lehrer miisse bestrebt sein,
den Anteil des »Objektiven« gegeniiber dem »Subjektiven« in seinen
Vorlesungen zu erhohen. Virchow gab zu, dass das harte Arbeit erfor-
dere und dass voUstandiger Erfolg wahrscheinlich unmoglich sei:
»Ich gehore jetzt so ziemlich zu den altesten Professoren der Medizin, ich lehre jetzt mehr als 30 Jahre meine Wissenschaft, und ich darf sagen, ich habe in diesen 30 Jahren ehrlich an mir gearbeitet, um immer mehr von dem subjectiven Wesen abzuthun und mich immer mehr in das objective Fahrwasser zu bringen. Nichts desto weniger bekenne ich of fen, dass es mir nicht moglich ist, mich ganz zu entsubjectiviren. Mit jedem Jahr sehe ich immer wieder von Neuem, dass ich selbst an solchen Stel-len, wo ich geglaubt hatte, schon ganz objectiv zu sein, immer noch ein grosses Stiick subjectiver Vorstellungen bewahrt habe. Ich gehe nicht so weit, die unmenschliche Forderung zu stellen, dass jemand iiberhaupt ohne irgend eine subjective Ader sich aussern solle, aber ich sage, wir miissen uns die Aufgabe stellen, in erster Linie das eigentlich thatsach-liche Wissen zu iiberliefern, und wir miissen den Lernenden jedesmal sagen, wenn wir weitergehen, >dieses ist aber nicht bewiesen, sondern das ist meine Meinung, meine Vorstellung, meine Theorie, meine Spe-culation<.«43
Diese Selbstdisziplin, die Virchow »Resignation« nannte, wiirde, so
hoffte er, die Wissenschaft vor offentlicher Skepsis schiitzen. Obwoh l
Virchows unmittelbare Zielscheibe Haeckels Spekulationen iiber be-
seelte Atome und Carl Friederich Naegelis Theorien spontaner Entste-
hung waren, ging es ihm auch um die Lektionen aus der Wissenschafts-
geschichte, insbesondere in der jiingeren Naturwissenschaft, in der eine
hochplausible und empirisch wohl begriindete wissenschaftliche Theo
rie nach der anderen von Rivalen gestiirzt worden war. Die Offent-
lichkeit hatte begonnen, ihr Vertrauen in die Wissenschaft zu verlieren,
43 Rudolf Virchow, »Die Freiheit der Wissenschaften im modernen Staatsleben« (1872), in: Amtlicher Bericht iiber die Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte 50(1877), S. 65-77, 74 f.

Bilder der Wahrheit, Bilder der Objektivitdt 15 3
und wendete sich gegen die Wissenschaftler: »Da beginnen dann die Vorwiirfe; ihr seid ja selbst nicht sicher; eure Lehre, die heute Wahrheit heisst, ist morgen Luge.«44 Virchow predigte wissenschaftUche Zuriick-hahung, um wissenschaftUche Autoritat zu schiitzen.
Virchow war nicht der Einzige, der sich iiber die ephemere Natur angebhcher wissenschaftUcher Gewissheiten Sorgen machte. Wenn viele Wissenschaftler des spaten 19. Jahrhunderts ihre Uberzeugung aufgege-ben hatten, dass ihre Theorien tiefen Wahrheiten iiber die Natur ent-sprachen oder auch nur dass ihre Theorien letztUch in einer solchen Wahrheit konvergieren wiirden, dann lag dies daran, dass sie gesehen hatten, wie diese Theorien einander in geradezu unanstandig kurzen Intervallen folgten. Theorien umfassten immer mehr Phanomene, die Prazision der Vorhersagen wurde bestandig verscharft, wissenschafts-basierte Technologien florierten und expandierten, aber die aufeinan-der folgenden Einsichten in die Tiefenstruktur der Natur mochten sich ebenso gut widersprechen wie ineinander konvergieren. Wie der oster-reichische Physiker Ernst Mach bemerkte, lehrte die Wissenschafts-geschichte Heraklits Lektion des panta rhei, denn die Revolutionen der Wissenschaft waren nicht mehr dauerhaft, sondern fanden unablassig statt:
»Die Versuche, den schonen Augenblick durch Lehrbiicher festzuhalten, sind stets vergebliche gewesen. Man gewohne sich also bei Zeiten daran, dass die Wissenschaft unfertig, veranderlich sei.«' ^
In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts war das Tempo wissenschaft-lichen Fortschritts Schwindel erregend geworden, und die Wissenschaftler konnten nicht mehr erwarten, dass die Wahrheiten ihrer Studenten-tage bis zu ihrer ersten Berufung auf eine Professorenstelle iiberleben wiirden. Der Aufstieg des Regimes der Objektivitat kann als verzwei-felter Versuch gesehen werden, einen kleinen, aber dauerhaften Kern von Fakten vor der Flut wissenschaftlichen Fortschritts zu retten: Objektivitat ist nicht nur etwas anderes als Wahrheit: sie ist Riickzug von der Wahrheit.
(Aus dem Englischen von Benjamin Marius Schmidt)
44 Ebd., S. 73. 45 Ernst Mach, Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Kraft (1872), Leipzig ^1879, S. 3.

Horst Bredekamp
Die Zeichnende Denkkraft Uberlegungen zur Bildkunst
der Naturwissenschaften
I Mentale Moglichkeiten der Zeichnung
I. Konstruktive Erkenntnis: Galilei
Zeichnungen als anachronistisch abzutun, kommt einer Absage an das Denkvermogen gleich. Sie sind gerade auch in den Naturwissenschaften der Beleg dafiir, dass es keine Verdrangung ohne Wiederganger gibt. Galten naturwissenschaftliche Zeichnungen im 19. Jahrhundert als Aus-biinde menschUcher Willkiir, wahrend die Photographic cine mechani-sche Objektivitat zu gewahrleisten schien/ so feiern sie allein schon in Form gezeichneter anatomischer Atlanten, die den einzelnen Gegen-stand scharfer und beispielhafter herauszupraparieren vermogen als Photographien, immer wieder Urstande.
Neu ist aber, dass Zeichnungen gegen digitale Visualisierungen aus-gespielt werden. Uberaus bezeichnend war ein bildkritischer Artikel in der Zeitschrift Nature aus dem Jahre 2003, der mit Blick auf die rapide Aufriistung der visuellen Mittel der Naturwissenschaften dazu aufrief, in der Verwendung von Bildern sorgfaltiger vorzugehen, den Realitats-charakter zu beachten und alle iiberfliissigen Effekte zu vermeiden.^ In der Tat haben die ehemals von protestantischer Askese gepragten Publi-kationen der Naturwissenschaften in den letzten zwanzig Jahren die
1 Lorraine Daston / Peter Galison, »Das Bild der Objektivitat«, in: Peter Geimer (Hg.), Ordnungen der Sichtbarkeit: Fotografie in Wissenschaft, Kunst und Technologie, Frankfurt am Main 2002, S. 29-99; Horst Bredekamp / Franziska Brons, »Fotografie als Medium der Wissenschaft: Kunstgeschichte, Biologie und das Elend der Illustration«, in: Christa Maar / Hubert Burda (Hgg.), Iconic Turn: Die neue Macht der Bilder, Koln 2004, S. 365-381. 2 Julio M. Ottino, »Is a picture worth 1,000 words?«, in: Nature 421 (30. Januar 2003),
s. 474-476-

1^6 Horst Bredekamp
Farbenpracht und Eleganz von Kunstzeitschriften eingeholt oder gar ausgestochen.^ Aus diesem Grund machen derartige Gebilde einen Kern dessen aus, was mit dem Begriff des viel beschworenen iconic turn ver-sehen worden ist."
Angesichts dieser Entwicklung spricht der Kritiker des Nature-Arti-kels von computergenerierten Bildern insofern mit Recht als »beautiful drawings«, als diese den konstruktiven Gesetzen der Malerei und nicht etwa den indexikalischen Regeln der Photographie unterworfen sind.^ Angesichts der vielfaltigen Konstruktionsmoglichkeiten digitaler Bilder, deren Realitatsverweis mit einem ungeheuren Aufwand an Algorithmen hergestellt werden muss, entbehrt es nicht der Ironic, wenn der Autor jene Aquarelle des Mondes, die Galileo Galilei im Jahre 1609 gezeichnet hat, als Hort der wissenschaftlichen Objektivitat anfiihrt.^ Die »klassische« Zeichnung wird zum Modell der Objektivitat digitaler »drawings«.
Mit diesen Aquarellen ist jedoch ein Ensemble angesprochen, das weitaus mehr reprasentiert als nur cine getreue Wiedergabe von Natur-phanomenen. Ludovico Cigoli, der Malerfreund Galileis seit den ge-meinsamen Tagen an der Florentiner Kunstakademie, hat betont, dass die Zeichnung cine Bedingung nicht allein der Wiedergabe der Natur, sondern auch des Denkens und des Sehens sei. Cigoli zufolge ist »ein Mathematiker, moge er so grofi sein wie er wolle, ohne die Fahigkeit des Zeichnens nicht nur ein halber Mathematiker, sondern auch ein Mensch ohne Augen«7 Das Zeichnen ist fiir Cigoli die Grundlage jedweder Er-kenntnis.
Galilei war ein geiibter Zeichner.^ Er hat nach seinem abgebrochenen Medizinstudium an der Florentiner Kunstakademie studiert und dort
3 Martin Kemp, Bilderwissen: Die Anschaulichkeit naturwissenschaftlicher Phdnomene, Koln 2003, S. 260-266. 4 Der Begriff wurde gepragt durch Gottfried Boehm, »Die Wiederkehr der Bilder«, in: ders. (Hg.), Was ist ein Bildf, Miinchen 1994, S. 11-38. 5 Lev Manovich, The Language of New Media, Cambridge MA / London 2000. 6 Ottino (wie Anm. 2), S. 474. 7 Lodovico Cigoli, »Brief an Galilei, 11.8.1611«, in: Galileo Galilei, »Le Opere«, Edi-zione Nazionale, hg. von Antonio Favaro, 20 Bande, Band XI, Florenz 1890-1909, S. 168; vgl. Samuel Y. Edgerton, The Heritage of Giotto's Geometry: Art and Science on the Eve of the Scientific Revolution, Ithaca / London 1991, S. 253, Anm. 41. 8 So finden sich unter den Manuskripten der Florentiner BibUoteca Nazionale Cen-trale zwischen den Kalkulationsreihen der Jupiter-Monde lassig hingeworfene Skizzen von Flusslandschaften, die in ihrem sicher und modern wirkenden Charakter und ihrer spontanen, unaufwandigen Form iiberzeugen; vgl. Horst Bredekamp, »Gazing Hands and Blind Spots: Galileo as Draftsman*, in: Jiirgen Renn (Hg.), Galileo in Context, Cambridge 2001, S. 153-192.

Die Zeichnende Denkkraft 15 7
gelernt, unebene Oberflachen perspektivisch zu erfassen.^ Dies hat ihn in die Lage versetzt, bei seinem Blick durch das auf den Mond gerichtete Fernrohr am 30. November 1609 zu erkennen, dass die Oberflache des Planeten gegen alle Regeln der Kosmologie nicht eben, sondern ebenso zerkliiftet ist wie die der Erde. Seine geschulte Fahigkeit, aus dem Schat-tenwurf auf die Hohe beziehungsweise Tief e der zugehorigen Gebilde zu schliefien, hat es ihm ermoghcht, ausgehend von den Effekten von Licht und Schatten die Plastizitat der Mondoberflache in seinen Zeichnungen wiederzugeben. In den Tupfern und Abstufungen der mit hochster Sen-sibiUtat eingetragenen ersten Einschattierungen auf der Sonnenseite der Mondoberflache ist gleichsam noch die Gedankenarbeit spiirbar, in der GaHlei seine MondbUcke auf Papier gebracht und dann aquareUiert hat. Es waren diese Zeichnungen, die das platonische Bild des Kosmos mit seinen vollendet runden Sternen zum Einsturz brachten.^° Diese Fahigkeit hatte Cigoh im Auge, als er der Zeichnung attestierte, dass sie das mathematische Denken begriinde und das Sehen schule. In dieser Kraft, Gedanken zu bilden, hegt das bezwingende Potenzial der Zeichnung,^^ das zunachst an Einzelbeispielen sowie abschhefiend an einer besonde-ren Form, der S-Linie, erortert werden soil.
2. Raptus: Leonardo und Bramante
Leonardo da Vinci hat das Vermogen von Zeichnungen, Gedanken zu pragen und zu ermoglichen, die wie durch einen aufieren Akt erzeugt werden, damit begriindet, dass Bilder, seien es Zeichnungen oder Ge-malde, den Betrachter in Gefangenschaft zu nehmen vermogen. Er be-
9 Samuel Y. Edgerton, »Florentine >Disegno<, and the >Strange Spottedness< of the Moon«, in: Art Journal i (1984), S. 225-232, 226 ff. 10 Gegeniiber der intellektuellen Feinheit der Zeichnungen fielen die Stiche, die im fol-genden Jahr 1610 in Venedig pubUziert wurden, quahtativ ab; vgl. Gahleo Gahlei, Side-reus Nuncius, Venedig 1610, zum Beispiel S. 8r. 11 Die Erschhe£ung dieser Dimension ist Teil des Projektes, das Bild nicht als Illustration und Wiedergabe, sondern als eine Instanz von »Bildakten« zu begreifen. In diesem Aufsatz versuche ich, die mafigeblichen Elemente aus einer Reihe von Vorarbei-ten und Vorhaben zu biindeln: Horst Bredekamp, »Der Sketchact: Dankrede«, in: Deutsche Akademie fur Sprache und Dichtung: Jahrhuch 2001, Darmstadt 2002, S. 168-172; ders., »Denkende Hande: Uberlegungen zur Bildkunst der Natutwissenschaften«, in: Von der Wahrnehmung zur Erkenntnis / From Reception to Understanding, Heidelberg 2005 (=Schering Foundation Workshop Supplement 12), S. 109-132. Weitere Verweise in den Anmerkungen.

158 Horst Bredekamp
zieht sich auf die Beobachtung, dass die freie Zeichnung in einem divi-nalen Gestus zu schopfen versteht. Im vollgiiltigen Wortsinn sei der Kiinstler in der Lage, seine Produkte zu »erschaffen«:
»Wenn der Maler Schonheiten sehen will, die imstande sind, ihn verliebt zu machen, ist er fahig, solche zu schaffen, und wenn er unheimliche Dinge sehen will, die ihn erschrecken, oder komische oder lacherliche oder wahrhaft mideiderregende, so kann er dies als Herr und Gott tun.« ^
Natiirlich ist dieses Vermogen zunachst eine Illusion, weil die dreidimen-sionale Wirklichkeit niemals in der Flache vollgiiltig wiedergegeben wer-den kann. In Leonardos fast delirierender Anrufung der Zerstorungs-krafte der Natur^^ kommt aber die Erkenntnis zum Ausdruck, dass es Krafte von einer solchen Gewalt gibt, dass sie mit den Sinnen nicht voU-standig erfasst werden konnen, wohl aber durch die Kunst/"^
Hierin liegt das bildtheoretische Problem. Leonardo attestiert den Bildern, weitaus mehr zu sein als nur die Illusion von Realprasenz; viel-mehr bilden sie eine Kraft, welche die Existenz und die Handlungen der Menschen so sehr bestimmt, dass diese gefangen werden. Kaum jemals ist diese Bildkraft imaginativer formuliert worden als in dem Satz, den Leonardo einem verhiillten Bild in den Mund legt. Dem sich nahernden Betrachter halt es die Warnung entgegen: »Enthulle mich nicht, wenn Dir die Freiheit lieb ist.«^^
Die starken Affekte, die von den Zeichnungen einer iibermachtig zer-storerischen Natur ausgehen, zielen nicht so sehr auf eine perfekte Wie-dergabe der Natur, sondern auf eine Wirkung beim Betrachter, die Be-wegung und daher einen »affektiven Raptus« schafft, der Wirklichkeit nicht nachahmt, sondern Realitat erzeugt. Er reprasentiert jene macht-vollen Bilder, die in Platos Staat verboten sind, weil sie mit den Bildern
12 Leonardo da Vinci, Treatise on Painting (Codex Urhinatus Latinus i2yo), Faksimile, hg. von Phillip McMahon, Band II, Princeton 1956, fol. 5r; hier zit. nach: Leonardo da Vinci, Sdmtliche Gemdlde und die Schriften zur Malerei, hg. von Andre Chastel, Miin-chen 1990, S. 156. 13 Leonardo 1956 (wie Anm. 12), fol. }6r; hier zit. nach Leonardo 1990 (wie Anm. 12), S. 166 f.; vgl, Leonardo, Trattato dellapittura, hg. von Ettore Camesasca, Mailand 1995, Nr. 65, S. 59 f. 14 Ernst H. Gombrich, »Leonardo's Method for Working out Compositions«, in: ders., Norm and Form, London / New York 1978, S. 85. 15 »Non iscoprire se liberta t'e cara«: / manoscritti e i disegni di Leonardo da Vinci, hg. von Reale Commissione Vinciana, Serie minore 1-5, Bande 1-5, Rom 1930 ff., hier: Band 3, lov; vgl. Frank Fehrenbach, Licht und Wasser: Zur Dynamik naturphilosophi-scher Leitbilder im Werk Leonardo da Vincis, Tubingen 1997, S. 325.

Die Zeichnende Denkkraft I 59
der tobenden Natur auch die ToUheit des Menschen hervorrufen.^^ Leonardos Sintflutbilder ahmen daher zwar, wie Frank Fehrenbach es in seiner Untersuchung dieser Bilder ausgedriickt hat, »ein (fiktives) Ge-schehen nach. Indem sie es aber mit einem Maximum an impeto wieder-geben, verwandeln sie sich unter der Hand in >Realitat<: in die Wirklich-keit eines unabschliefibar bewegten, keinen Halt findenden Sehens.«^^
Leonardos Theorie des mentalen Raptus attestiert Bildern, den Be-trachter in Gefangenschaft nehmen zu konnen, weil diese es verstehen, die Wirklichkeit imaginar neu zu gestalten. Diese Wirkungsweise hat sich vielleicht nirgends so deuthch gezeigt wie beim Neubau von St. Peter in Rom.
Onofrio Panvinio hat berichtet, wie Bramante Papst Juhus IL zu der nach wie vor unbegreiflichen Tat iiberredete, die alte BasiHka von St. Peter abzureifien: »Er zeigte dem Papst mal Grundrisse, mal andere Zeichnungen des Baues, redete unaufhorHch auf ihn ein und versicherte, das Unternehmen werde ihm zum hochsten Ruhm gereichen.«^^ Die Fiille von Zeichnungen und Grundrissen, die dem Hinweis auf das rhetorische Talent Bramantes vorausgehen, verdichtet sich im fakten-schaffenden Gestus der internen Uberlagerungen in der beriihmten Zeichnung »Uffizien 2oA«, in welche die Grundrisse der alten Basilika eingezeichnet sind. Bramantes Vierungspfeiler von Neu-St.-Peter elimi-nieren hier die Grundformen des Vorgangerbaus. Sie zeigen die Mecha-nik der Zeichnung, Undenkbares nicht nur zu denken, sondern als rea-Hsierbar zu erachten, indem es sich durch die Bewegungen der Augen iiber den vorgefundenen Zustand legt. Dies ist, was Panvinio ansprach. Aus diesem Urimpuls von Zeichnungen wie »Uffizien 2oA«, die mach-tiger waren als die ehrwiirdigste Kirche der Christenheit, entstand nach Jahrzehnten der Wirren schliefilich Michelangelos Neu-St.-Peter, das den Raptus der Zeichnung besiegelte.^^
16 Plato, Politeia, III, 396b; vgl. Fehrenbach (wie Anm. 15), S. 322 f. 17 Fehrenbach (wie Anm. 15), S. 330. 18 Onofrio Panvinio, »De rebus antiquis memorabihbus basihcae sancti Petri«, in: Christoph Luitpold Frommel, »Die Peterskirche unter Papst Juhus IL im Licht neuer Dokumente«, in: Romisches Jahrhuch fiir Kunstgeschichte XVI (1976), S. 57-136, 90 f. 19 Florst Bredekamp, Sankt Peter in Rom und das Prinzip der produktiven Zerstorung: Ban undAhhau von Bramante bis Bernini, Berhn 2000, S. 25-35.

160 Horst Bredekamp
3. Inversion: Michelangelo
Von Michelangelo stammen Zeichnungen, welche die in diesem Medium ermoglichten Denkoperationen auf eine unvergleichliche Weise sichtbar werden lassen. Es handelt sich um ein Konvolut von Blattern, das Michelangelo im Jahre 1528 angefertigt hat, um neue Festungen zur Ver-teidigung der Republik Florenz gegen die Truppen der Medici und des Kaisers zu errichten. Michelangelo zeigt die Fortifikationen in der Kegel von der Stadtmauer aus, also aus der Vogelsicht eines Verteidigers, der mit der Architektur in das Vorland dringt. So lasst er in der unteren Halfte von Blatt lyr vier dreieckige Zacken als Reihe spitzer Zahne her-aussto6en/° Bei der komplexen, vor die Toroffnung gesetzten Fortifika-tion ragen zwei grofiformatige Gebilde nach aufien, deren Mauern an den Aufienseiten in kompakten Kopfen enden. Die massive Rundung dieser Gebilde hat die Funktion, die Kasematten abzuschirmen/^ Weil diese golfschlagerartigen Bollwerke ihre Innenflanken den Kanonen-kugeln der Angreifer dargeboten hatten, hat Michelangelo zwei massive Sechsecke in das freie Feld gesetzt, die auf die anfliegenden Kugeln wie Brecher wirken soUten. Auch sie besitzen darin eine eigene Metapho-rik, dass Michelangelo durch sie die Angreifer in Termini einer Wasser-flut imaginiert.
Gerade die Inkonsistenz der zwei sich widersprechenden Prinzipien verdeutlicht, dass Michelangelo die Inkorporation der Psychologic des Feindes als Instrument der eigenen Kriegsfiihrung verwendet. Was als bizarrer Einfall wirken konnte, sucht nicht oder nicht allein die Beein-flussung des Kontrahenten, sondern die Nutzung der invertierten Fein-desgedanken zur Bestimmung der eigenen Bemiihungen.
Auf dem oberen Rand des grofiformatigen Blattes hat Michelangelo das eigene Verteidigungswerk aus der Position der Angreifer neu imaginiert. Die Umkehrung bedeutet zunachst nur einen mechanischen Nutzungsakt, aber die gestaffelte Besiedelung dieser Zone durch die seitlich vorspringenden Gebilde nimmt die Herausforderung des gegen-liberliegenden Gewaltpotenzials auf. Der Angreifer reflektiert die Mog-
20 William E. Wallace, »>Dal disegno alio spazio<: Michelangelo's Drawings for the Fortifications of Florence*, m: Journal of the Society of Architectural Historians 46 (1987), S. 119-134,121 f. und 124, Anm. i8;vgl. AmelioFara, »Michelangelo Architetto a Firenze e il fronte bastionato da Leonardo a Buontalenti«, in: Mitteilungen des kunsthistorischen Institutes in Florenz 2/3 (1999), S. 471-542. 21 Stanislaus von Moos, Turm und Bollwerk: Beitrdge zu einerpolitischen Ikonographie der italienischen Renaissancearchitektur, Zurich 1974, Abb. 144.

Die Zeichnende Denkkraft 161
lichkeiten des Verteidigers, in welche die fluide Gewalt seines Anren-nens bereits eingegangen ist. Blatt i / r darin bezeugt Michelangelos Imaginationsbewegung, indem es aus der sich jeweils im Gegeniiber reflektierenden Dynamik des angreifenden Eindringens und des vertei-digenden Ausgreifens seine wechselseitige Spannung bezieht.
Es handelt sich um eine Spirale der Einbindung potenzieller Mog-lichkeiten des Gegners in die Vorstellung dessen, was als Ausloser die-ser Ausdrucksgewalt konstruiert werden soil. Der Vorgang lebt von der Unmoglichkeit, ihn zu einem Ende zu fiihren. Hieraus resultiert Michelangelos Abneigung gegeniiber Festlegungen, wie sie in Modellen unabwendbar sind.^^ Diesen Zwiespalt bewahren die Zeichnungen, und durch die wechselseitige Energiezufuhr von Verteidigungs- und An-griffsperspektive reprasentieren sie ein Laboratorium von phantasierter Wirkung und invertierter Formpragung, die sich im Wechselspiel von Inspektion der Zeichnung und Inversion der Perspektiven abspielt.
4. Selbstanschauung: Machs Auge
In seinem jiingsten Buch sowie in einem in Nature publizierten Artikel hat Antonio Damasio die Frage nach dem Bewusstsein des Ich neu ge-stellt/^ Er trennt zwischen einem Beobachter des eigenen Korpers und einem Perzeptionsapparat, der die Aufienwelt wahrzunehmen in der Lage ist. Damit aber entsteht das Problem eines neuen Dualismus, der weniger dramatisch ist als die kartesische Spaltung zwischen Vernunft und gleichsam maschinellem Korper, gleichfalls aber die Frage nach der Vermittlung zwischen Innen- und Aufienperspektive provoziert, die sich auch durch die Zeichnungen Michelangelos stellt.
In einer Antwort auf Damasio ist kiirzlich an Ernst Machs Darstel-lung des Ich von 1886 erinnert worden, welche die Grenzlinie zwischen Binnenkorper und Aufiensicht suggestiv inszeniert.^4 Von innen geht der Blick des auf einer Liege gelagerten Mach entlang den Randern der Augenhohle und dem Nasenriicken in den Raum. Man glaubt sich formlich auf der Grenze zwischen einem Blick, der expansiv den Raum
22 Horst Bredekamp, »Michelangelos Modellkritik«, in: Architekturmodelle der Renaissance: Die Harmonie des Bauens von Alberti his Michelangelo, hg. von Bernd Evers, Aus-stellungskatalog, Miinchen / New York 1995, S. 116-123. 23 Antonio Damasio, »The person within«, in: Nature 423 (15. Mai 2003), S. 227. 24 Karl Clausberg / Cornelius Weiller, »Mach dir ein Bild vom Hirn: Wie Denken aus-sieht«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 16 (31. Januar 2004), S. 31.

162 Horst Bredekamp
zu erschliefien vermag, und einer Sicht, die gleichsam einen Schritt zu-riicktritt und allein der Introspektion gewidmet ist.
Die unbeholf ene Vorzeichnung unterscheidet sich von dem Holzstich vor allem durch die Hande. In der Skizze halt die Linke eine Zigarette, wahrend die Rechte, die in der Illustration demonstrativ den Bleistift halt, fehlt/^ Auf einer weiteren Skizze, welche die Buchillustration vor-bereitet, hat sich Mach allerdings auf diesen Arm konzentriert und ihn nochmals auf der linken Seite seines Notizbuches wiederholt. Die zeich-nende Hand wirkt, als wolle Mach Cigolis Kommentar zu Galilei, dass das denkende Sehen und das zeichnende Denken zusammengehoren, seinerseits zeichnen: Die Hand skizziert die »Selbstschauung des Ich«/^ Erneut ist es die Zeichnung, welche die Dynamik des suchenden Begrei-fens zu erfassen vermag, und hierin kann diese als ein Symbol der be-schriebenen Moglichkeiten der Zeichnung gelten. In der zeichnenden Aufierung tritt dem Bewusstsein ein Gegeniiber entgegen, das ihn in eine Fixierung zwingt, die seine Intraspektion zu ungeahnten Horizon-ten offnet.
Ich habe in einem ersten Schritt zu zeigen versucht, dass die Zeichnung nicht nur die Darstellung von Gesehenem, sondern vor allem eine Entaufierung und Ubersteigerung erlaubt, die weit liber alles Perzep-tierte hinausgeht. Die Zeichnung ist das Instrument einer Fesselung, die iiber das Denkmogliche hinaustreibt. Sie vollzieht einen Raptus, weil sie Wirklichkeit nicht allein wiedergibt, sondern iibersteigt.
In einem zweiten Teil soil dieses Phanomen an einem einzigen Motiv verfolgt werden, das ein umso grofieres Ratsel aufgibt, je langer die Kette seiner Motivwanderung ausgezogen wird. Es handelt sich um die S-Linie, die sich seit dem 15. Jahrhundert als Metazeichnung aller Meta-morphosen und aller in Zeichnungen sich ereignender Denkvorgange etabliert hat/7
25 Karl Clausberg, Neuronale Kunstgeschichte: Selbstdarstellung als Gestaltungsprinzip, Wien / New York 1999, S. 11. 16 Ebd., S. 12 f., mit weiteren Deutungen. 27 Horst Bredekamp, »Die Uniiberschreitbarkeit der Schlangenlinie«, in: Christian Schneegass (Hg.), minimal - concept, Berlin 2001, S. 205-208.

Die Zeichnende Denkkraft 163
II Die S-Linie ah Metaieichnung
I. Von Alberti bis Lomazzo
In seinem Selbstportrat hat sich Leon Battista Alberti, Kiinstler und nicht minder begnadeter Naturwissenschaftler, mit einem Schopf von kurz geschnittenen Locken ausgestattet, obwohl er, wie ein anderes Por-trat zeigt, glattes Haar hatte. Der Grund liegt in der assoziativen Verbin-dung mit jenem Lowen, dessen Namen er programmatisch angenom-men hatte: »Leone«/^ Mit diesem in Kurven sich legenden Haar hat sich Alberti aber auch auf seine Beobachtung bezogen, dass die Bewegungen der Haare mit denen von Flammen und Schlangen zu vergleichen seien/^ Hier klingt erstmals die Uberlegung an, dass die andauernde Bewegung der Haare in Schlangen- und Flammenlinien verlaufe, die immer neue S-Formen ergaben. Die Suggestivitat dieser Metapher hat dazu gefiihrt, dass die Schlangenform gemeinsam mit der Feuerflamme als Linie der Schopfung auch zu einem Symbol phantasievoUer Belebung wurde.
Uber welche Wege sich diese Vorstellung in die Kopfe von Kiinstlern und Naturwissenschaftlern einnistete, wird schwerlich zu erschliefien sein. Was sich ergibt, ist aber zumindest die Oberflache einer erstaun-lichen Wanderschaft der S-Linie und deren spiralformigen Varianten. So zeigt eine der Randzeichnungen des nach 1475 geschaffenen Stunden-buches der Maria von Burgund eine von oben herabgezogene Gerade, die nach links in einen Kreis iibergeht und nach rechts als Pflanzenstan-gel fortgefiihrt wird, dessen S-formiges Ende im Schwung des Lowen-schwanzes eine Entsprechung findet.^° Dies ist keinesfalls ein Zufall. Al-brecht Diirer hat in seiner Unterweysung der Messung / mit dem Zirkel und Richtscheyt von 1525 bekraftigt, dass die Schlangenlinie die Dop-pelbestimmung der Zeichnung, sowohl auf die Natur zuzufiihren als auch die Innenbewegung des Gehirnes zu offenbaren, vollendet repra-
28 Horst Bredekamp, »Albertis Flug- und Flammenauge«, in: Die Beschworung des Kosmos: Enropdische Bronzen der Renaissance, hg. von Christoph Brockhaus und Gottlieb Leinz, Ausstellungskatalog, Duisburg 1994, S. 297-302, 297. 29 Leon Battista Alberti, Das Standbild - Die Malkunst - Grundlagen der Malerei, hg. und libers, von Oskar Batschmann u. a., Darmstadt 2000, »Die Malkunst«, 45, S. 278: »atque undent in aera flammas imitantes, modoque sub aliis crinibus sepant.« 30 Nicolaas Spierinc (zugeschr.), »Stundenbuch der Maria von Burgund«, nach 1475, (Osterreichische NationalbibHothek, Wien, »Codex Vindobonensis«, 1857, fol. 8r, in: Friedrich Teja Bach, Struktur und Erscheinung: Untersuchungen zu Dilrers graphischer Kunsty BerUn 1996, Abb. 302, S. 262.

164 Horst Bredekamp
sentiert: »darumb das sie hin und her gezogen mag werden / wie man will«.^^
Als der Bildhauer Benvenuto Cellini ca. 1564 ein Amtssiegel fiir die Florentiner Kunstakademie entwarf, imaginierte er eine vielbriistige, ephesische Diana als magna mater, der rechts der Florentiner Lowe und links eine sich windende Schlange assistieren.^^ Den Rhombus, in dem die gotdiche Verkorperung der Zeichnung erscheint, hat Cellini sodann in einen Streifen einschneiden lassen, in dem die Werkzeuge des Schaffens von der Zange bis zum Flaschenzug als mnemotechnisches Alphabet abgebildet sind. Das Ende des Werkzeugalphabetes bilden ein Flaschenzug und eine gedrehte Linie, die auf den ersten Blick als Orna-mentband wirkt, sich bei genauerer Betrachtung mit ihrem verdickten Kopfende aber als Schlange erweist. Es handelt sich um eine belebte Variation von Diirers S-Linie.
Diese Linie, die ein Symbol aller Zeichnungen darstellt, ist fiir Cellini jene Aufierungsform, die wie kein zweites Medium an die Denkbewe-gungen des Gehirnes heranreicht und die zugleich geeignet ist, diese in Handlungen zu iiberfiihren. Als das materiell feinstmogliche Produkt des Menschen verklammert die Zeichnung die Welt der Ideen und die der Modelle, und in dieser Doppelstellung wird sie zum Symbol und Medium aller schopferischen Tatigkeiten.^^
Die Darstellung der Hand des niederlandischen Kiinstlers Hendrick Goltzius ist dadurch ausgezeichnet, dass sie als Zeichnung die Druck-techniken der Radierung und des Kupferstiches simuliert und damit den umfassenden Anspruch, den Cellini der Zeichnung unter den anderen Medien zuerkannte, betont. Angesichts dieses Anspruches erscheint es nicht als zufallig, dass die Signatur in einer weit ausholenden Spiralform endet, wie Goltzius sie auch im Bild seines Verlegers Galle aus seinem Namen herauswachsen lasst. Beide zelebrieren in sich verschlungene Abfolgen zusammenhangender Schlangenlinien.^"^ Man kann sie als Be-
31 Albrecht Diirer, Unterweysung der Messung / mit dem Zirkel und Richtscheyt [.. J , Niirnberg 1525, S. A2. 32 Horst Bredekamp, »Kulturtechniken zwischen Mutter und Stiefmutter Natur«, in: Sybille Kramer / Horst Bredekamp (Hgg.), Bild - Schrift - Zahl, Miinchen 2003, S. 117-142. 33 »Che il disegno essendo veramente origine, e principio di tutte le azzioni dell'uomo.* Zit. nach Wolfgang Kemp, »Disegno: Beitrage zur Geschichte des Begriffs zwischen 1547 und i6o7«, in: Marhurger Jahrbuch fiir Kunstwissenschaft 19 (1974), S. 219-240, 223. 34 Hendrick Goltzius (ij^8-i6i/): Drawings, Prints and Paintings^ Ausstellungskata-log Rijksmuseum, Amsterdam u. a. 2003, S. 15, 244-246.

Die Zeichnende Denkkraft 16 5
siegelung einer handwerklichen Meisterschaft verstehen, als Ornament der kiinstlerischen Sicherheit. In der Tradition der semantischen Beset-zung der S-Linien aber liegt es nahe, hier einen kiinstlerischen Selbst-ausweis auch darin zu erkennen, dass Goltzius sich iiber diese Signatur-form die Schopfungslinie der Natur und der gedanklichen Kreation inkorporiert.
Die im Jahre 1584 publizierte Kunst- und Naturtheorie des Kiinstlers Giovanni Paolo Lomazzo hat jedenfalls die figura serpentinata (ge-schlangelte Linie) der Schlangen und der tanzenden Flammen in genau diesem Sinn in Form des S als Zeichen der idealen Naturbewegung wie auch der kiinstlerischen VoUendung definiert. Auf Wegen, die nicht ein-mal ansatzweise erschlossen sind, war es offenbar die geradezu hybride Intelligenz der Formulierungen Lomazzos, welche die S-Linie bis auf den heutigen Tag zum Symbol der Kreativitat in Natur und Kunst wer-den Hefi.35
2. Metamorphosen: Von Merian bis Kekule
Als ein Indiz konnen die atemberaubenden Zeichnungen der Natur-forscherin Sibylla Merian gelten, die sie um 1600 von ihrer Reise nach Sumatra mitbrachte. Angesichts der gleichsam gliihenden Realprasenz der gezeichneten Tiere und Pflanzen ist umso erstaunlicher, wie genau Sibylla Merian ihre Objekte auf dem Blatt komponiert. Die Pflanzen, Insekten und Reptilien sind in eine fein ausgewogene Ordnung ge-bracht, um das dichte Ambiente des Dschungels zu simulieren.^^ Fiir das Disjunktionsprinzip naturwissenschaftlicher Illustrationen, demzu-folge die Darstellungen umso kiinstUcher gestaltet sind, je natiirlicher sie wirken, ist Sibylla Merian ein herausragendes Beispiel.^^
35 Paolo Giovanni Lomazzo, Trattato deWarte de la pittura, Mailand 1584, Buch I.i, S. 22-24. Hierzu und zur Rezeption der Schlangenlinie als asthetisches Urelement vgl. Peter Gerlach, »Zur zeichnerischen Simulation von Natur und natiirlicher Lebendigkeit«, in: Zeitschrift fiir Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 34/2 (1989), S. 243-279. 36 Siehe zum Beispiel die ausgekliigelten Kompositionen in: Maria Sibylla Merian, Die St. Petersburger Aquarelley hg. von Eckhard Hollmann, mit naturkundlichen Erlauterun-gen von Wolf-Dietrich Beer, Miinchen / Berlin / London / New York 2003, Abb. 28,
47,117-37 Horst Bredekamp / Angela Fischel / Birgit Schneider / Gabriele Werner, »Bildwelten des Wissens«, in: Bildwelten des Wissens: Kunsthistorisches Jahrbuch fiir Bildkritik, Band 1,1: »Bilder in Prozessen«, hg. von Horst Bredekamp und Gabriele Werner, Berlin 2003, S. 9-20, 15.

166 Horst Bredekamp
Von besonderem Reiz ist jenes Blatt ihrer »Metamorphosis«-Serie, auf dem das Wolfsmilchgewachs Maniok mitsamt seinen rubenformigen Wurzeln und einer Falterraupe prasentiert wird. Die sich um den Stan-gel windende Riesenschlange verwirrt den Eindruck der Naturtreue, well sie mafistablich weit verkleinert wurde, um sich um die Pflanze rin-geln zu konnen. Kaum liegt ein Moment der »Verzierung« vor,^^ son-dern vielmehr die Inkorporation des schlangenformigen Zeichens aller natiirlichen Metamorphosen. Merian war eine viel zu gewissenhafte Be-obachterin, als dass ihr hier ein Irrtum hatte unterlaufen konnen.
Dasselbe gilt auch fiir den links in das Bild schiefienden Schwarmer, fiir dessen absonderlich in S- und Spiralformen gelegte Zunge es in der Natur keinen Anhaltspunkt gibt. Vielmehr hat die Naturforscherin offenbar im selben Sinn, in dem Goltzius seine Hand mit der Signatur des Schnorkels aller Naturbewegungen versah, die Formel der metamor-photischen Natur auch mit diesem Tier verbunden. Die aus S-Linien bestehende Spiralform erscheint als Signum sowohl der natura naturans wie auch als Symbol der kiinstlerisch geadelten Naturforscherin.
Diese Grundlinie aller Natur, aller Gedanken und aller Handlungen hat sich auf Wegen, die nicht zu rekonstruieren sind, bis in die Mathe-matik vermittelt. Leibniz, der mathematische Symbolbildnerp^r excel-lencCy hat sich sein Leben lang mit der von Francois Viete begriinde-ten Symbolisierung mathematischer Rechnungen beschaftigt.^^ Leibniz' Stolz auf seine Tatigkeit als malender Mathematiker bezog sich unter anderem auf seine Verwendung des schlangenhaften S der lateinischen Summa fiir das Integralzeichen, das seither giiltig geblieben ist.4°
Es ist nicht zu beweisen, dass Leibniz die Natur- und Kunsttheorie der S-Linie gekannt hat, aber er selbst hat einen solchen Zusammenhang nahe gelegt. Da die auf Unahnlichkeit beruhenden Reprasentationsfor-men der Mathematik die Freiheit zur Schonheit besitzen, sind diese ihm zufolge mit den Kunstwerken von Malern zu vergleichen. Im Jahre 1677 hat er den Gebrauch dieser Zeichen als Mittel beschrieben, um »die Gedanken zu malen«.4^
38 Merian (wie Anm. 36), Abb. 115, S. 144. 39 Florian Cajori, »Leibniz: The Master-Builder of Mathematical Notations*, in: his 3 (1925), S. 412-429, 418-428. 40 Hartmut Hecht, Gottfried Wilhelm Leibniz: Mathematik und Naturwissenschaften im Paradigma der Metaphysik, Leipzig 1992, S. 45-49. 41 »[...] de peindre non pas la parole [...], mais les pensees« - »Brief an Gallois, i6jj«, in: Gottfried Wilhelm Leibniz, Mathematische Schriften, hg. von Carl Immanuel Gerhardt, 7 Bande , Band I, Berlin / Halle 1855-1863 (Nachdruck: Hildesheim 1962), S. i8of.

Die Zeichnende Denkkraft 16"/
Wenn es je einen Philosophen und Naturforscher gab, der davon iiberzeugt war, dass sich jeder Gedanke iiber die Materialisierung auf dem Papier entwickeln und scharfen miisse, so war es Leibniz. Seine Manuskripte sind immer wieder von Kritzeleien bedeckt, die kaum mehr zu entschliisseln sind. Die Summe dieser zeichnenden Entfaltung von Gedanken aber ist nicht zufallig die S-Linie.
Unabweisbar wird dieser Zusammenhang im Werk des englischen Kiinstlers William S. Hogarth, der Lomazzos Schlangenlinie als Grund-element aller Schonheit und Bewegung begriff. Hogarths Analysis of Beauty von 1753 zeigt sie als Emblem der Variety, die als Zeichen der Summe aller Bewegungs- und Darstellungsformen gemeint war.' ^
Gut hundert Jahre nach Hogarths Bestimmung der S-Form als Linie der VoUendung hat der Chemiker August Kekule den kunsttheoreti-schen Topos von der Schlangenlinie als dem Bild der bewegungsfahigen Natur aktiviert. Seine Entdeckung der sechseckigen Anordnung der Benzolmolekiile beschrieb er als Produkt des Theaters seines geistigen Auges, also jenes inneren Bereiches, dessen unmittelbarer Ausdruck die Zeichnung darstellt. Im Halbschlaf das Kaminfeuer betrachtend, er-kannte er in den Flammen die Losung:
»Alles in Bewegung, schlangenartig sich windend und drehend. Und siehe, was war das? Eine der Schlangen erfasste den eigenen Schwanz, und hohnisch wirbelte das Gebilde vor meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl erwachte ich.«' ^
3. Wiederkehr der Linien: Klee bis Crick
Die Geltung der linea serpentinata ist nicht unangefochten geblieben, und es hat immer wieder Bestrebungen gegeben, die Kontur in die atmo-spharische Wirkung von Raum- und Spriihlichtzonen aufzulosen, wie dies beispielsweise im Impressionismus geschah. Da der konturlosen Kunstform jedoch die Doppelqualitat der Linie fehlt, als bewegter
42 David Bindman, Hogarth and his Times, Ausstellungskatalog, London 1997, S. 168 f. 43 Richard Anschiitz, August Kekule, 2 Bande, Band 2, Berlin 1929, S. 942. Jeder Chemiker kennt diese Geschichte, aber kaum jemand wird wissen, dass es sich um einen kunsttheoretischen Topos handelt, der die Natur an sich mit der Bewegung der Schlange gleichsetzt. Die sich in den Schwanz beifiende Schlange ist zudem das iiberkommene Symbol der sich im Verzehr erneuernden Zeit, des Ouroboros. Die Struktur des Benzol ist daher auch das Produkt einer in der Imagination des Gehirns gezeichneten Fassung des Symbols der Natur und der Zeit.

168 Horst Bredekamp
Punkt aufierst prazise zu sein und doch jede Freiheit zuzulassen, haben Kiinstler des Expressionismus und des Fauvismus, ganz zu schweigen von der Art Nouveau, die Konturlinie rehabilitiert. Paul Klee hat insbe-sondere die Schlangenlinie als Ausgangspunkt von Nebenlinien, Schraf-furen und Selbstdrehungen in den hochsten Rang motorischer Energie gesetzt:
»Eine aktive Linie, die sich frei ergeht, ein Spaziergang um seiner selbst willen, ohne Ziel. Das agens ist ein Punkt, der sich verschiebt.«' 4
An Klee ankniipfend, hat Gilles Deleuze die Faltungen des Barock und Klees Schlangenlinien als Essenz des schopferischen Denkens charak-terisiert/^ was einen immensen Einfluss auf die Architekturtheorie der neunziger Jahre hatte."^^ Dazwischen aber lag der Aufstieg der S-formi-gen Schlangenlinie zum Symbol der Perspektiven der Naturwissenschaf-ten. Die Hogarthsche S-Form der Natur taucht keinesfalls zufallig in der Struktur der Doppelhelix wieder auf, wie sie von Odile Crick fiir Nature gezeichnet wurde. Es erscheint ausgeschlossen, dass sie als Male-rin Hogarths VoUendungszeichen der Natur oder auch Paul Klees Pdda-gogisches Skizzenbuch, das ebenfalls die S-Linie als Schlangenlinie der Natur begriff, nicht gekannt hatte.47 Odile Crick hat eine Ikone der Naturwissenschaft dadurch geschaffen, dass sie das iiberkommene Sum-menzeichen des Denkens und der Natur mit dem Modell der Doppelhelix verschmolz. Um nicht den geringsten Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass hier nicht etwa die Natur an sich, sondern ein ihr ge-widmetes Modell abgebildet sei, besagt die Bildlegende, dass die Figur »purely diagrammatic« sei.^^
4. Momente der Wahrheit: Gehry bis Gehry
Frank Gehry, ein Architekt, der als Computerkiinstler gilt, der aber be-kennt, niemals langer als drei Minuten auf einen Bildschirm geblickt zu
44 Paul Klee, Pddagogisches Skizzenbuch, Miinchen 1925 (= Bauhausbiicher, Band 2), S.6. 45 Gilles Deleuze, Lepli: Leibniz et le baroque, Paris 1988, Kap. I. 46 Vgl. etwa Anthony Vidler, Warped Space: Art, Architecture and Anxiety in Modern Culture, Cambridge MA 2000, S. 219-233. 47 Klee (wie Anm. 44), S. 6. 48 James D. Watson / Francis H. Crick , »Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Desoxyribose Nucleic Acid«, in: Nature 25 (1953), S. 737 f.

Die Zeichnende Denkkraft 169
haben, soil mit seinen Zeichnungen das Schlusswort haben. Gehry zu-folge ist der Computer unerhort hilfreich, um Raume, die keine hand-betriebene Mathematik errechnen konne, zu klaren, aber die Imagination realisiere sich in Linien und Knetmasse. Als ihm im Jahre 1989 der Pritzker-Preis verliehen wurde, bekannte er:
»In trying to find the essence of my own expression, I fantasized the artist standing before the white canvas deciding what was the first move. I called it the moment of truth. «' ^
Seine Hommage an den initialen Strich benutzte mit dem Eintrag der ersten Linie auf eine weifie Flache eine der altesten Metaphern des schopferischen Prozesses, wie sie etwa in den 1633 in Madrid publizier-ten Dialogos de la pintura Vicente Carduchos beschrieben sind. Diese zeigen den Ansatz zu diesem entscheidenden ersten Strich.^°
Gehry zeichnet in der Regel mit schwarzem Filzstift auf diinnen weifien Pappen.^^ Seine kreisenden Handbewegungen schwingen ent-weder in sich eindrehende Endloslinien oder in immer neu ansetzende kurze S-Kurven. Beide Moglichkeiten, die wie eine Inkarnation der Moglichkeiten zeichnenden Denkens wirken, durchziehen Gehrys ge-samtes zeichnerisches CEuvre. So stellt eine der Skizzen der Walt Disney Concert Hall die S-Linie programmatisch frei, und so platziert eine weitere Zeichnung dieses Projektes die S-Form in die Mitte des Gebaudes, als ware sie zugleich ihr Herz und ihr federndes Scharnier. Schier endlos ware zu verfolgen, auf welche Weise ein Architekt, der ge-meinhin als architektonischer Bildhauer gilt, ein Nachfahre Albertis ist, der die S-Linien als Urstoff aller Bewegungen begriffen hatte.^^ Gehrys S-Linien wiederholen zudem Hogarths Symbol der Variety in immer neuen Varianten, und darin erfiillen sie das Geheimnis der Zeichnung, in ihren motorischen Selbstentaufierungen iiber den gegebenen Denkrah-men hinauszutreiben. Die sich eintragende Zeichnung ist als Emanation einer sich erst im Prozess der Gestaltung ermoglichenden Denkfigur mehr als sie selbst. Gehrys Verwunderung (iber diesen Vorgang kann als Motto fiir den hier vorgelegten Gedankensketch gelten:
49 The Pritzker Architecture Prize 1989, presented to Frank Owen Gehry, sponsored by the Hyatt Foundation, Los Angeles 1990, o. S. 50 Vicente Carducho, Dialogos de la pintura, Madrid 1633, Schlussbild; vgl. Victor I. Stoichita, Eine kurze Geschichte des Schattens, Miinchen 1999, S. 95-97. 51 Vgl. hierzu Horst Bredekamp, »Frank Gehry's Art of Drawings*, in: Mark Rappolt / Robert Violette (Hgg.), Gehry Draws, London 2005 (im Druck). 52 Vgl. ebd.

170 Horst Bredekamp
»Ich bin immer davon fasziniert, dafi ich diese Linien so absichtslos zeichnen kann. Ich schaue mir das Papier an und versuche, die Idee fiir die Form herauszuziehen; es ist, als wiirde jemand im Papier ertrinken. Und das ist auch der Grund, warum ich sie nie als Zeichnungen auffasse. Ich kann es nicht. Das tue ich erst danach, wenn ich sie anschaue.«^^
In ihrer S-Linie ist die Zeichnung Ausdruck und Ermoglicher von Ge-danken, die sich ohne die Materialisierung in der zeichnenden Denk-bewegung niemals hatten aufiern konnen. Es sind Zeichnungen und diagrammatische Linien, die auf der Grenze zwischen Gedanken und Materialisierung eine eigene, keiner anderen Aufierungsform zukom-mende Suggestivkraft entwickeln. Unabhangig von jeder kiinstlerischen Begabung verkorpert die Zeichnung als erste Spur des Korpers auf dem Papier das Denken in seiner sich selbst entfaltenden Unmittelbarkeit.
Schluss: Die falsche Alternative von Computerbild und Zeichnung
Computerbilder, die der Nature-KrXAktX angreift, werden weiterhin fiir die Wissenschaften unverzichtbar sein, sie bleiben unabdingbar fiir die Bewaltigung von Massen an Bildern, und sie sind auf dem Siegeszug im Bereich der Photographic. Zugleich aber zeigen sich allerorten Merk-male des Uberdrusses, der Riickwendung zu haptischen Gebilden, zum »reinen« Objekt, zum haptischen Gegenstand, und in der Photographic bildet sich gegenwartig jene Qualitatssekte hochprofessioneller Photo-graphen, die sich weigern, eine Digitalkamera auch nur zu beriihren. Es handelt sich um eine Art Roll-back des Haptischen in die Enttau-schungszonen digitaler Versprechungen.
Ich habe den Computer und seine bildintensiven Moglichkeiten von Beginn an als einen so brillanten wie abundanten Zuwachs angesehen, ohne eine Sekunde lang daran zu zweifeln, dass die iiberlieferten Bild-formen iiberdauern wiirden. Theorien des »Endes« der Malerei, des Portrats und der Zeichnung waren von Anbeginn Produkte eines falsch verstandenen Hegel.^^ ^gj- ^ber kein »Ende« befiirchtet, kann auch die
53 Coosje van Bruggen, Frank O. Gehry: Guggenheim Bilbao, New York 1998, S. 40; vgl. Marc Angelil / Anna Klingmann, »Militante Hermeneutik: Interpretation als Ent-wurfsmethode«, in: Daidalos 71 (1999), S. 72-79, 78 f. 54 Horst Bredekamp, »Metaphern des Endes im Zeitalter des Bildes«, in: Heinrich Klotz, Kunst der Gegenwart: Museum fiir Neue Kunst. ZKM/ Zentrum fUr Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Miinchen / New York 1997, S. 32-37.

Die Zeichnende Denkkraft 171
digitale Bildwelt in ihrem eigenen Bedingungs- und Moglichkeitsrah-men wertschatzen. Der in dem Nature-Artikel unterschwellig sich zei-gende Gestus verweist auf eine falsche Alternative. Ich habe zu zeigen versucht, dass die Zeichnung nicht darin ihre fundamentale Eigenart be-sitzt, dass sie naturgetreuer sein kann, als es die konstruktiven Bedingun-gen des Digitalen vorgeben, sondern dass ihre hybriden Moglichkeiten das Denken selbst generieren.

Sander L. Gilman
Glamour und Schonheit Die Idee von Glamour im Zeitalter
der Schonheitsoperationen
Angefangen hat alles im amerikanischen Talk-TV vor der Jahrtausend-wende. Nach endlosen Konfrontationen und Auseinandersetzungen in Shows, die sich wie bei Jerry Springer um Untreue und sexuelle Identi-tat drehten, schienen die Produzenten beschlossen zu haben, dass nun die Zeit fiir Wohlfiihlepisoden gekommen war. Frauen (und spater dann auch Manner) aus der Arbeiterschicht sollten von Designern, Friseuren und Kosmetikern einen neuen und glamourosen Look verpasst bekom-men, in der Hoffnung, dass damit auch die Shows einen Hauch von Klasse erhalten wiirden. Etwa um die gleiche Zeit wurden in den Ver-einigten Staaten und in Europa im Kabelfernsehen, beispielsweise auf dem Discovery Channel, Shows ausgestrahlt, in denen es um Menschen ging, die sich so genannten »geplanten Schonheitsoperationen« unter-zogen. Man folgte ihnen von ihrem ersten Beratungsgesprach iiber den eigentlichen Eingriff, der vor laufender Kamera stattfand, bis zur Ent-hiillung des neuen Gesichts oder Korpers Monate spater.
Das Jahr 2002 sah dann die Synthese dieser beiden Showtypen in der Form von »Extreme Makeover« der American Broadcasting Corporation: Neben dem Ublichen wie neuen Kleidern, Fitnessstudio, Frisur usw. bezahlten die Produzenten auch noch Schonheitschirurgen, die den Gesichtern und Korpern der Teilnehmer ein neues Aussehen geben sollten. Nasen wurden umgestaltet, Gesichter geliftet, Briiste vergrofiert, wabbelige Haut um den Bauch herum entfernt und die neuen Korper zur besten Sendezeit enthiillt. Das Erfolgsgeheimnis dieser Shows liegt in der Faszination, den Korper umgestalten zu konnen (und in dem Spektakel, einer realen Operation zusehen zu diirfen). Neben dem Original gibt es eine Reihe von Variationen wie die Show »The Swan« (Fox Network), in der bei einem Schonheitswettbewerb unter glamouros neu gestalteten »hasslichen Entlein« der Gewinner-»Schwan« gewahlt wird.
173

174 Sander L. Gilman
Von zentraler Bedeutung fiir die Konzeption dieser Shows ist nun aber, dass es nicht nur um die rein korperliche Neugestaltung geht - die Ver-kiirzung der Nase, die Akzentuierung des Haaransatzes, die Neufor-mung der Briiste usw. - , sondern um die Transformation der Ausstrah-lung von Armut (denn alle Kandidaten kommen aus der Arbeiterschicht) zu einem Image von mannlichem oder weiblichem Glamour, wie es die amerikanischen Vorstellungen von Oberschicht und Hollywood - beide Vorstellungen sind austauschbar in Hinsicht auf ihre Bedeutung im amerikanischen Mythos von Stil und Schonheit - dominiert. Diese Debii-tantenballe werden in exotischen Clubs aufwandig inszeniert, um eine »neue« und glamourose Person zu prasentieren. In diesen Sendungen gibt es keine profanen Arbeitswelten: Nur ein Kontext eleganter Partys und teurer Limousinen gibt einen angemessenen Rahmen fiir diese neu gestalteten Korper und Gesichter ab.
Nach iiber hundert Jahren moderner Schonheitschirurgie sollte dieser Schritt uns nicht erschrecken. Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben wir nach und nach die Aura von Geheimnis iiberwunden, von der die Schonheitsoperationen urspriinglich umgeben waren. (»Du siehst fan-tastisch aus! Warst du beim Friseur?« - vergleichbar der amerikanischen Fernsehwerbung fiir Mittel wie Viagra, die jenen anderen unaus-sprechlichen »Makel«, die sexuelle Impotenz des Mannes, beseitigen.) Heute kann man sich offentlich iiber solche kosmetischen Prozeduren auslassen, auch im Fernsehen oder Internet. Und das gilt nicht nur fiir die Vereinigten Staaten, sondern auch fiir andere Kulturen, in denen die Schonheitschirurgie einen hohen Stellenwert hat, wie Brasilien, Argen-tinien, Siidkorea, Japan und Grofibritannien - die Liste wird langer.
Angesichts unserer neu gewonnenen Fahigkeit, offentlich iiber solche Operationen zu sprechen, interessierten mich die zickigen Reaktionen vieler Kritiker auf diese Sendungen. Viele von ihnen sind anscheinend immer noch der Meinung, dass nur eitle und dumme Menschen Schonheitsoperationen durchfiihren lassen. Kosmetische Chirurgie halten sie fiir unnotig und wegen der Assoziation mit »Glamour« sogar fiir frivol. Die Operationen werden als Zeichen ziigelloser Eitelkeit oder auch eines »falschen Bewusstseins« gedeutet. Die Menschen, die sich operie-ren lassen, miissen, so nehmen sie an, durch soziales »Brainwashing« dazu gebracht worden sein, ihren Korper zu hassen. Die Fernsehkriti-kerin der New York Times, Caryn James, gehort eindeutig dieser Schule an. In ihrer Rezension der ersten Show beschreibt sie die Teilnehmer als Menschen aus der Arbeiterschicht, die mit ihrer hasslichen Nase oder

Glamour und Schonheit 17 5
ihrem vorspringenden Kinn tatsachlich eine Art von neuem Look notig hatten.^ Das war in Ordnung, da die Hasslichkeit offensichtlich und die Anderungen notwendig waren. Aber dann predigt sie: »Die Show fordert uns dazu auf, in der Identifikation mit diesen Alltagsmenschen ein Ersatzleben zu fiihren, aber wir werden nie mit ihnen warm, zum Teil auch deshalb, weil sie iiber das iibliche >Nase ab!< weit hinausgehen: Stephanie lasst sich aufierdem noch Brustimplantate machen und an Bauch und Hiiften das Fett absaugen. Luke holt sich eine neue Nase, die zu seinem flacheren Bauch passt. Stacey bekommt eine neue Nase, ein neues Kinn und einen neuen Korper. Wir alle haben die Fantasie, etwas zu verandern, aber diese Frankensteintraume sind gespenstisch.« Die Kritiker einer Reihe kanadischer, britischer und amerikanischer Zei-tungen teilen diese Meinung.
Sie sind gespenstisch genau deshalb, weil sie sich mit den »nicht-medizinischen« Aspekten der Operationen auseinander setzen. Einige Eingriffe sind in Ordnung, weil sie offensichtliche Probleme korrigieren (offensichtlich jedenfalls fiir Caryn James); andere sind rein ornamental, da sie nur aus Glamour-Griinden vorgenommen werden. Warum haben wir solche Angst davor, dass Menschen durch freiwillige Operationen die Kontrolle iiber ihren Korper ergreifen? Warum ist eine »hassliche Nase« ein einleuchtenderer Fall fiir Korrekturen als »zu kleine Briiste«? Vor hundertzehn Jahren liefien sich die Iren in New York »englische« Nasen machen, um Amerikaner zu werden, und die Juden in Berlin liefien sich »griechische« Nasen machen, um Deutsche zu werden. Fiir diese Operationen sparten sie ihre Pennys und mussten dann die Tat-sache verbergen, dass sie ihre Nase hatten neu gestalten lassen. Die nicht-irischstammigen Amerikaner beziehungsweise die nicht-jiidi-schen Deutschen, unter denen sie lebten, hielten diese Operationen fiir »Frankensteineingriffe«. Plotzlich waren sie nicht mehr in der Lage, zwischen ihren eigenen »authentischen« Nasen und diesen erst kiirzlich umgestalteten Nasen zu unterscheiden. Heute sagt Caryn James, dass Nasenoperationen in Ordnung seien - aber andere Operationen seien ein Zeichen von Eitelkeit. Und die Mehrzahl der Amerikaner, die sich heute fiir eine Schonheitsoperation entscheiden, sind nicht die Reichen, Beriihmten und Glamourosen, sondern Angehorige der Mittelschicht.
I Caryn James, »It's All in the Mix«, in: The New York Times ( i i . Dezember 2002).

I "jG Sander L. Gilman
Um einen Eindruck von der Bandbreite der Schonheitsoperationen und ihrer Klientel zu geben, fiihre ich im Folgenden einige Zahlen an. Im Jahre 2003 wurden 52% aller kosmetischen Eingriffe in Arztpraxen vorgenommen, 7% mehr als 2002. Die anderen Eingriffe wurden zu etwa gleichen Teilen in Krankenhausern (25 %) und freien chirurgischen Zentren (23%) durchgefiihrt. Amerikaner gaben 9,4 Milliarden Dollar fiir kosmetische Eingriffe aus; in dieser Summe sind die Gebiihren fixr die Operationssale, Maschinerie, Narkosemittel, medizinische Tests, Verschreibungen, Operationskittel und andere Operationsparapherna-lia nicht enthalten. 6,5 Milliarden Dollar davon wurden fiir operative und 2,9 Milliarden fiir nicht-operative Verfahren aufgewendet.
Die Mehrzahl der Klienten hatte ein Jahreseinkommen unter 50 000 Dollar. Dennoch wurden nahezu d^^ Millionen kosmetische Eingriffe operativer und nicht-operativer Art vorgenommen, so die bisher um-f angreichste Untersuchung bei Arzten und Chirurgen in den Vereinigten Staaten, durchgefiihrt von der »American Society for Aesthetic Plastic Surgery« (Asaps). Zwischen 1997 und 2002 nahm die Zahl der kosmetischen Eingriffe um 228% zu. Die fiinf haufigsten operativen Eingriffe im Jahre 2002 waren: Lipoplastik (Fettabsaugen), 372 831 (111% Anstieg gegeniiber 1997); Brustvergrofierung, 249641 (plus 147%); Operatio-nen am Augenlid, 229092 (44% Anstieg seit 1997); Rhinoplastik (Um-gestaltung der Nase), 156973 (plus 15%); Brustverkleinerung, 125 614 (plus 162%). Die fiinf haufigsten nicht-operativen Verfahren im Jahre 2002 waren: Botulin-Toxin-Injektion (Botox), 1658667 (4% Anstieg gegeniiber 2001; 2446% Anstieg gegeniiber 1997); Mikrodermabrasion, 1032417 (13% Anstieg gegeniiber 2001); Kollagen-Injektion, 783 120; Haarentfernung mit dem Laser, 736458; chemisches Peeling, 495 415.
Frauen liefien 6,1 Millionen kosmetische Eingriffe vornehmen, 88% von alien. Die fiinf haufigsten operativen Verfahren bei Frauen waren Lipoplastik, Brustvergrofierung, Augenlidoperationen, Brustverkleinerung und Rhinoplastik. Bei den Manner waren es iiber 800000 kosmetische Eingriffe, 12% der Gesamtzahl. Die fiinf haufigsten operativen Verfahren bei Mannern waren Lipoplastik, Rhinoplastik, Augenlidoperationen, Haartransplantationen und Otoplastik (Umgestaltung der Ohren). Menschen im Alter zwischen 35 und 50 Jahren hatten die meis-ten Eingriffe (44%). An 19- bis 34-Jahrigen wurden 25% der Eingriffe durchgefiihrt. In der Altersgruppe von 51 bis 64 Jahren waren es 23%. Die iiber 65-Jahrigen liefien 5%, die unter i8-Jahrigen 3% aller Schonheitsoperationen vornehmen.

Glamour und Schonheit I "JJ
19% aller kosmetischen Eingriffe wurden bei Angehorigen ethnischer Minderheiten ausgefiihrt: Lateinamerikaner 8%, Afroamerikaner 5%, Asiaten 4%, andere Nichtweifie 2%. Der Anteil der kosmetischen Eingriffe bei ethnischen Minderheiten stieg im Jahre 2001 um 2%.
TatsachUch werden mit der weiter zunehmenden Zahl asthetischer Verfahren (wie etwa Botox) in einem Jahrzehnt Menschen, die keinen solchen Eingriff durchfiihren hefien, die Ausnahme sein. Die ungleiche Verteilung der Eingriffe auf die Geschlechter wird beseitigt sein. Manner werden sich ebenso wie Frauen kosmetischen Eingriffen unterzie-hen. Schon jetzt kommen die Khenten aus alien sozialen Schichten und ethnischen Gruppen.
Was ist akzeptabel? Und warum? Die Grenze zwischen dem »Akzep-tablen« und dem »Eitlen« ist eine Funktion unserer personlichen Aus-einandersetzung mit dem eigenen Korper. »Extreme Makeover« ermog-licht uns ein Urteil dariiber, wie sehr wir die Wahrnehmung anderer Menschen von uns verandern wollen. Wie eine der Teilnehmerinnen in der ersten »Extreme Makeover«-Show sagte: »Ich bin ein netter Mensch, aber niemand sieht liber meine Nase und mein fliehendes Kinn hinaus.« Seit iiber hundert Jahren beginnen wir nach und nach zu verstehen, dass wir das Recht haben, die Wahrnehmung, die andere von uns haben, zu verandern. Das ist das grofie Versprechen des modernen Lebens: das Recht auf Selbsttransformation. Wir konnen in eine neue Wohnung Ziehen, einen anderen Job suchen, unseren Namen andern und beruflich andere Wege gehen als unsere Eltern und Grofieltern. Und w ir konnen verandern, wie wir wahrgenommen werden. Wir haben sogar das Recht, unser Potenzial zu solchen Veranderungen iiber Stellvertreter zu beob-achten, indem wir uns diese Operationen im Fernsehen anschauen. Der Glamour von »Extreme Makeover« ist lediglich ein anderer Name fiir das Leben im 21. Jahrhundert.
In jenem Klima von Nervositat, das die kulturellen Bedeutungen des Korpers umgibt, andert sich auch die Vorstellung von »Glamour«. »Glamour« schien urspriinglich ein Begriff zu sein, der die Vorstellung eines Zauberspruchs mit der Behauptung verband, dass er einen unfahig mache, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Traditionellerweise war der Begriff weiblich konnotiert. »Frauen haben Glamour« - und das wurde verstanden als die Kraft jener kiinstlichen Faszination, die den mannlichen Beobachter gegeniiber der Realitat des Gesehenen blind machte. Glamour gait als kiinstlich und erotisch, im Gegensatz zu authen-

1/8 Sander L. Gilman
tisch und sinnlich. Im Alltagsverstandnis wurde der Begriff daher be-nutzt, um erotische, aber nicht unbedingt pornographische Bilder von Frauen zu beschreiben, wie etwa beim britischen Ausdruck »glamour photography«. Von den Celebrity-Werbungen fiir »Pear Soap« in den i89oer Jahren iiber die Pin-ups der i94oer Jahre waren Frauen glamou-ros, wahrend der Ausdruck auf Manner anscheinend nicht angewandt wurde. Im Zeitalter der Metrosexuals ist es inzwischen aber moglich geworden, auch von Mannern zu sagen, dass sie Glamour haben, wobei das ja tatsachlich schon immer der Fall war. Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts wurden der Duke of Windsor (Edward VIII.) oder David Niven fiir ebenso glamouros angesehen wie Lili Langtry oder Audrey Hepburn. Ihre Portrats waren Glamour-Fotos und wurden als solche gesammelt. Vielleicht war George Byron »Beau« Brummel im England der Regency-Zeit der erste glamourose Mann - so jedenfalls John Harvey in Men in Black. Solche Manner waren sinnlich, ohne off en erotisch zu sein. Wahrend im goldenen Zeitalter des Studiofilms Glamour sorg-faltig fabriziert wurde, um einen banalen Hintergrund (Ethel Gumps Transformation zu Judy Garland) oder eine merkwiirdige Erscheinung (Clark Gables Ohren) zu maskieren, kann Glamour heute vom Schon-heitschirurgen konstruiert werden - als Attribut von Mannern wie von Frauen. Glamour ist nach wie vor etwas Kiinstliches, aber heute ist er ein korperliches Attribut.
Und doch sind wir besessen von der Frage, ob das angemessen sei. Ist die Moglichkeit, unsere Korper umzugestalten, ob zum Besseren oder Schlechteren, eine Analogic zur Moglichkeit, eine Abtreibung durch-fiihren zu lassen? Oder handelt es sich lediglich um eine Kapitulation vor jenen dunklen Machten (vor dem Patriarchat!), die unsere Korper als nicht glamouros genug etikettieren? Was geschieht in dieser Welt, wenn wir unseren Wunsch, das zu sein, was wir wollen, nicht erfiillen und stattdessen eine Glamour-Ikone werden? Die meisten Menschen, die kosmetische Eingriffe durchfiihren lassen und daftir bezahlen, tun dies aus begrenzten Motiven: zur Umgestaltung einer Nase, die sie als zu grofi (Juden) oder zu klein (Japaner) wahrnehmen, einer Brustform oder eines Haaransatzes, die als ungeniigend empfunden werden.
Und was ist mit jenen neueren Fallen von Menschen, deren chirur-gische Umgestaltung Teil eines Versuches ist, eine Vorstellung von Glamour einzuholen? Es gibt Menschen, die ein Simulacrum von Celebrity
2 John Harvey, Men in Black, London 1995.

Glamour und Schonheit 179
werden wollen. Einem Fernsehbericht von ABC News am 27. Marz 2002 zufolge gibt es in Los Angeles, und sicker auch anderswo auf der Welt, Menschen, die wie ihre glamourosen Vorbilder auf dem Fernsehschirm oder in der Popwelt aussehen wollen. Und so versuchen sie, die Nase von Nicole Kidman oder Edward Burns zu bekommen. Und doch »liegt in diesem Spiel, in diesem Kopieren der Gesichtsziige von >Celebritys<, eine gewisse Ironic: Das Kinn in jenem Film oder die hohen Wangen-knochen, die einem auf der Leinwand so gut gefallen haben, sind nicht immer ein Geschenk des Himmels. Auf der >Hot Body<-Liste sind viele Menschen, die nicht mit den spezifischen Gesichtsziigen geboren wur-den, von denen die Kunden sprechen, wenn sie zu uns kommen«, sagt der in Beverly Hills praktizierende Schonheitschirurg Dr. Richard Fleming. »Jeder, der in Hollywood alt genug ist, im Mickey-Mouse-Club gewesen zu sein, hat eine Schonheitsoperation gehabt.« Was geschieht in einer Welt, in der wir die Kopie einer Kopie kopieren, deren wahres Original vielleicht gar nicht existiert? Eine »Ruckkehr zum Glamour« ist von Mr. Bart, dem Direktor von IMG Models, prophezeit worden; er sieht in Laufsteg-Diven wie Gisele Biindchen »eine neue Schwanen-gattung«.^ Aber ist deren »leuchtende, filmstarahnliche Erscheinung« nicht ebenso ein Produkt der Chirurgenhand wie jene »schmollenden, toughen oder verlassen wirkenden« Gestalten, die sie ersetzen?
Cindy Jackson ist ein auffallendes Beispiel fiir die neuen Vorstellungen, die heute mit der Welt von Schonheitschirurgie und Glamour assoziiert werden. Sie verwandte »io Jahre, 20 kosmetische Operationen und 100 000 Dollar darauf, ihren Traum wahr werden zu lassen und wie eine Barbiepuppe auszusehen. Facelifting, Fettabsaugen, Nasenumgestal-tung - alles setzte sie daran, um sich von einem normalen Bauernmad-chen aus Ohio in eine glamourose Schonheit zu verwandeln.«4 Ihr Ziel ist klar: Sie will sich als ihr eigenes Produkt prasentieren. Inzwischen ist sie Mitte vierzig, und sie ist sich dessen bewusst, dass ihre vielen Operationen als eine Art psychischer Krankheit gesehen werden konn-ten. »Ich vermute, dass es Menschen gibt, die eine Abhangigkeit von Schonheitsoperationen entwickeln konnen, aber das hangt davon ab, was du brauchst. Ich bin nicht verriickt, und ich habe keine Korper-dismorphie. Ich guckte in den Spiegel und sah eine grofie Nase, diinne
3 Ruth La Ferla, »Old-Style Glamour Makes a Comeback«, in: New York Times (20. Juli 2004). 4 Cathy Stapells, in: Toronto Sun (5. Februar 1999).

180 Sander L. Gilman
Lippen und ein hangendes Kinn. Ich hatte mehr als nur ein Problem, und ich habe aus dem Rohmaterial, das mir zur Verfiigung stand, das Beste gemacht.«^ Stapell schreibt, dass »die Medien sie eine Barbie-puppe nannten (>blond, schlank und aus Plastik<), und Jackson gibt zu, dass sie ihren Korper veranderte, um das glamourose Barbieleben ihrer Kindheitsfantasien zu verwirklichen. >Nein, ich glaube nicht, dass ich eitel bin. Ich bin in WirUichkeit eher unsicher, weil ich wei6, dass ich nicht perfekt bin. Eitel sind Menschen, die meinen, dass sie perfekt sind.<« Und sie sieht ihre Transformation als Teil ihrer neuen nationalen Identitat als Englanderin. »Sie wurde, sagt sie, in den USA geboren, aber in Grofibritannien gemacht«.
Sie selbst sieht sich auch als eine neue Art von Feministin: »Cindy, Mitglied von Mensa [eine internationale Vereinigung fiir Menschen mit einem hohen IQ], berichtet, dass die Operationen ihr Leben verandert hatten. Die Menschen seien freundlicher zu ihr und schenkten ihr mehr Aufmerksamkeit. Sie sagt, dass sie sich in ihrer neuen Gestalt kraftiger und machtiger fiihle. >Fruher habe ich versucht, den Mannern zu gefal-len, jetzt versuchen die Manner, mir zu gefalien. Das ist die ultimative feministische Aussage. Ich lasse es nicht zu, dass die Natur iiber mein Schicksal entscheidet, nur weil ich in der genetischen Lotterie nicht ge-wonnen habe.<« Das ist ihre Antwort als selbst gestaltete, intelligente, moderne Frau (so die Beschreibung von Mensa) auf feministische Be-hauptungen, die der Schonheitschirurgie eine patriarchalische Einstel-lung und ein falsches Bewusstsein vorwerfen.
Bei einem Event in London hatte ich die Gelegenheit, mit Cindy Jackson auf derselben Biihne zu stehen, und es war deutlich, dass ihr Produkt sie selbst ist. Ihren Anspruch auf Ruhm begriindet sie mit ihrer Transformation vom »hasslichen Entlein« zur »Glamour-Queen« mit Hilfe der Chirurgie. Sie hatte im Jahr 2002 eine Reihe weiterer Operationen, um den Erfolg ihres Unternehmens, den Verkauf von Cindy Jackson, zu sichern. Bei ihren Auftritten geht sie mit ihrem Selbsthilfebuch iiber Schonheit (My Image and Cosmetic Surgery Secrets), ihrer Autobiographic (Living Doll) und ihrem Video (The Making of Cindy Jackson) hausieren. Sie verkauft sich selbst als glamourose Barbiepuppe.
Was ist dieses ideale Modell, nach dem Cindy Jackson sich selbst gestaltete? Wer oder was ist »Barbie«? Das Kinderspielzeug wurde von
5 Hier und im Folgenden: BBC-Sendung iiber Cindy Jackson, ausgestrahlt auf BBC News Online am 21. September 1998, 09:43 Uhr.

Glamour und Schonheit 181
der amerikanisch-judischen Designerin Ruth Handler erfunden, die zu-sammen mit ihrem Ehemann Elliot die Firma Mattel Toys griindete. In ihren Satiren »Je m'appelle Barbie«^ und »Goys and Dolls«^ gibt uns Rhonda Lieberman Einblicke in die Welt von »Barbie«. Liebermans Satiren beruhen auf der soliden Arbeit von M. J. Lord.^ Wie Lieberman schreibt, wurde Barbie mit ihrem blonden Haar und ihrer Stupsnase nach einer deutschen Pornographiepuppe der fiinfziger Jahre gestal-tet. Sie wurde zur Fantasiefigur der kleinen jiidischen Madchen, zum Ziel ihrer Wiinsche: »[...] als Barbie geboren wurde, entstand in einem Paralleluniversum eine andere Barbie [...]. Barbie - blond, jiidische Barbie - briinett oder dunkelblond; Barbie - keine Schenkel, jiidische Barbie - Schenkel; Barbie - stumm, jiidische Barbie - jammert standig iiber angebliche Ungerechtigkeiten. Die jiidische Barbie ist nicht bose, nur verdrangt [...].« Kein Wunder, das Ruth Handler sie nach ihrer Tochter Barbara nannte. Sie war die Antithese zum westlichen Fanta-siebild der Frau jiidischer Rasse, wie es seit dem 19. Jahrhundert exis-tierte. Barbie ist daher glamouros, oder zumindest sind es ihre Kleider. Kathy Flood schreibt zu Barbies 45. Geburtstag iiber ihre Garderobe: »Die Linie Fashion Originals (sowohl in den USA wie auch auf dem eleganteren europaischen Markt) war glamouros, ohne geschmacklos zu sein: Mantel aus reichem Brokat mit Umhangen aus Faux Hermelin, schwarze Spitze mit weifiem Satin und Farbtupfern fiir ausgelassenere Gelegenheiten.«9 Rassenstereotypen liefien es nicht zu, jiidische Frauen als glamouros wahrzunehmen.
Als Barbie einen romantischen Partner brauchte, wurde Ken erfunden. Er war der Inbegriff des weiCen, angelsachsisch-protestantischen Mannes, benannt nach Handlers Sohn Kenneth. Die sexuelle Anziehung zwischen den beiden Puppen war offensichtlich. Die feministische Zeit-schrift Wimmen's Comix^^ zeigte auf dem Cover ein »kleines Madchen« (so der Titel der Ausgabe), das eine Ken- und eine Barbiepuppe in den Handen halt. Barbie sagt zu Ken: »Hi, Ken! Freust du dich auf unser Blind Date?« Ken antwortet: »Vergiss das Date, Barbie! Zieh dich aus!«
6 In: Artforum (Marz 1995), S. 20 f. 7 In: Artforum (April 1995), S. 21 f. 8 M. G. Lord, Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll, New York
1994-9 Kathy Flood, »Celebrating 45th Birthday: Barbie still a Fashion Plate«, in: Chicago Tribune (20. August 2004), S. C2. 10 Wimmen's Comix 15 (1989).

182 Sander L. Gilman
Ein merkwiirdiges Ideal, und dock ein Ideal, das aus der Antithese zu einem Mangel an Glamour, oder besser: zu der Unmoglichkeit wah-ren Glamours, erschaffen wurde. Barbie ist glamouros, weil jiidische Frauen in den fiinfziger Jahren von einer mit Rassenvorurteilen behaf-teten Gesellschaft nicht als attraktiv angesehen wurden. Barbie wird ein Standard nicht nur fiir Schonheit, sondern auch fiir Glamour, mit einer grofien Auswahl an exotischen und teuren Designeroutfits, immer in Modellhausern und exklusiven Autos, spater in glamourosen Berufen wie Stewardess oder Arztin, niemals als Putzfrau oder beim Leeren von Nachttopfen. Aber sie ist bereits eine Kopie, fiir den amerikanischen Markt entsexualisiert. Auch Ken ist nach der entsexualisierten Fantasie des Spielzeugmarktes gestaltet.
Es ist klar, dass es auch einen Ken in der Wirklichkeit geben muss. Miles Kendall, ein arbeitsloser Brite in den Dreifiigern, ein starker Trin-ker und Raucher, sah Cindy Jackson 1999 in der britischen Talkshow »This Morning«. Es war fiir ihn ein Bekehrungserlebnis. Auf seiner Webseite schreibt er, dass er »ein glamouroseres Leben wollte, ahnlich dem Celebrity-Lifestyle von Ken und Barbie«. Aber er schreibt auch, dass er »entsetzt ware, wenn er wie ein Plastikspielzeug« aussahe.^^ Nachdem er Cindy gesehen und dann auch getroffen hatte, unterzog er sich bei seiner Suche nach dem »perfekten« Gesicht aufwandigen Ope-rationen, fiir die er iiber 48 000 Pfund bezahlte. Das Geld wurde von der Firma vorgestreckt, die Cindy Jackson und Miles Kendall gegriin-det hatten, um das Filmmaterial seiner Transformation zu vermarkten. Er begann mit Rhinoplastik, da er immer schon (so sagt er jedenfalls) mit der Form seiner Nase unzufrieden gewesen war, und liefi dann bei der nachsten Operation in seinem Gesicht eine Reihe weiterer Eingriffe vornehmen. Im August 2001 enthiillte er sein Gesicht in einem Foto-interview mit dem Boulevardblatt Sunday Mirror. Unnotig zu erwah-nen, dass sein Begehren nach einem idealen Ken-artigen Korper und Gesicht in der Zeit vor »Extreme Makeover«, als solche offentlichen Enthiillungen von Selbsttransformationen fiir die breite Offentlichkeit noch eine gewisse Faszination bargen, Stoff fiir einige Fernsehsendun-gen abgab. Kendall trat am 11. September 2001 in einer amerikanischen Talkshow auf, und ein Jahr spater sah man ihn schliefiHch in der Ricky Lake Show. Auch dort war sein »Hauptprodukt« seine Anwesenheit vor der Kamera als Beispiel seiner Fahigkeit, sich zum Bild des glamou-
II www.mileskendall.co.uk (2004).

Glamour und Schonheit 18 3
rosen Mannes zu transformieren. Wie Cindy ist er eine Celebrity einzig
auf Grund dessen, was er getan hat, um sein jetziges Aussehen zu erlan-
gen. Heute ist er der Meinung, dass Cindy und er »weltweit die Ersten
waren, die sich operativ einen radikal und extrem neuen Look verpass-
ten« (Sunday Mirror).
Solche extremen Umgestaltungen sind keineswegs ein ausschliefilich
westliches Phanomen. Beth Kapes schreibt in der Marzausgabe der Cos
metic Surgery Times^^:
»Ein internationaler Medienwirbel kreist um den so genannten Gipfel aller Marketingkampagnen in Sachen kosmetischer Chirurgie: Eine junge Frau erfahrt in ihrem Streben nach Perfektion eine ultimative Umgestakung, bei der Augen, Nase, Kinn, Briiste, Bauch, Po, Beine und Haut in einer Vielzahl von Verfahren verandert werden. Aber diese Veranderungen geschehen nicht vor den Kameras von »Extreme Make-over« in den USA, sondern in einem Krankenhaus auf der anderen Seite der Wek: im >Evercare Jianxiang Dreamworks Project< in Peking, wo die 24-jahrige Pressesprecherin Hao Lulu mit ihren kosmetischen Operatio-nen im Wert von mehr als 36000 Dollar letztes Jahr auf die Wiinsche der Bevolkerung aufmerksam machte. Wahrend Arzte und Beamte des Gesundheitswesens sich dariiber besorgt zeigten, dass die Operationen eine aufwandige PR-Ubung von Evercare zur Promotion der kosmetischen Chirurgie gewesen sein konnten, beharrt die Sprecherin des Krankenhauses, Bao Huai, darauf, dass das Projekt dazu beigetragen habe, >bei Millionen von chinesischen Frauen ein Schonheitsbewusstsein zu wecken<.«
Ebenfalls erwacht ist in China die Welt des Glamour-Marketings als
Teil der Verkaufsstrategie fiir den neuen chinesischen Korper. Im O k t o -
ber 2004 wurde in Peking ein »Miss Plastic Surgery«-Schonheitswett-
bewerb abgehalten, der »jeder Frau off en stand, die beweisen konnte,
dass ihre Schonheit von Menschenhand gemacht war«.^^ Zuvor waren
Frauen, die Schonheitsoperationen haben durchfiihren lassen, von den
in China seit kurzem erlaubten Schonheitswettbewerben ausgeschlos-
sen worden. Der Ausgangspunkt fiir diese Entwicklung war der Miss-
World-Wettbewerb 2003 in China gewesen, der von der China New
Times^"^ als »ein Hauch von Glamour« fiir Peking begriifit worden war.
Einige Monate spater stack Zhang Yinghua dreifiig Rivalen aus und
12 Beth Kapes, »China's Cosmetic Surgery Market Flourishes«, in: Cosmetic Surgery Times (Marz 2004). 13 BBC News (4. August 2004). 14 China New Times (12. Juni 2003).

184 Sander L. Gilman
wurde in einem Wettbewerb, der von der Shanghai Kinway Plastic and Cosmetic Surgery Chnic gesponsert wurde, als Shanghais erster »von Menschenhand gemachter gut aussehender Mann« gekiirt. Der gewon-nene Preis: mehrere Gesichtsoperationen; sein Ziel: »Model oder Schau-spieler« zu werden/^ Die Produktion von Glamour ist inzwischen ein Teil der neuen wirtschaftlichen Initiative in China geworden.
Wahrend Cindy Jackson und Miles Kendall auf krasse Weise Massen-medien und Popkultur als Mittel des Selbstmarketings nutzen, bedient sich die franzosische Performancekiinstlerin Orlan der hohen Kultur und der Welt der Galerien, so Duncan McCorquodale.^^ Lange bevor Jackson und Kendall daran dachten, war ihr Medium bereits die kosme-tische Chirurgie: »Ich bin die erste Kiinstlerin, die Chirurgie als Medium benutzte, und die erste, die den Zweck kosmetischer Chirurgie verandert hat: um besser auszusehen, um jung auszusehen. >Ich ist ein anderer< (>je est un autre<). Ich bin die Avantgarde der Konfrontation.«^7 Sie nennt ihr Projekt »Die Reinkarnation der Heiligen Orlan« und hat sich seit Mai 1987 einer Reihe kosmetischer Operationen unterzogen, um sich in ein neues Wesen mit einer neuen Identitat zu verwandeln. Dass Cindy Jackson sich argert, wenn sie mit Orlan verglichen wird, beschreibt die Kunsthistorikerin Tanya Augsburg von der Arizona State University: »Obwohl Orlan mir gegeniiber zum Ausdruck brachte, dass sie der Idee einer neuen Identitat gegeniiber aufgeschlossen sei, hat Jackson sich anders geaufiert. Sie versteht nicht, warum sie bestandig mit Orlan verglichen wird, da sie meint, mit der Kiinstlerin nichts gemeinsam zu haben. Ihrer Meinung nach hat sie selbst einerseits weit radikalere Operationen gehabt (einschliefilich dem Absagen ihres Kinns, das dann zuriickgeschoben und mit Titanbolzen wieder angeschraubt wurde), und andererseits entspricht ihr Aussehen dem gesellschaftlichen Ideal -im Unterschied zu Orlans unnatiirlichem, an Raumfahrt und an Science Fiction erinnerndem Aussehen. (Orlan hat sich Wangenimplantate in die Schlafen machen lassen, wodurch sie deutlich wahrnehmbare Beu-len hat, die aussehen, als ob ihr Antennen oder Horner wachsen.)«^^
15 Xu Xiaomin, »Artificial Dreams«, in: Shanghai Star (8.-14. April 2004), S. 21. 16 Duncan McCorquodale (Hg.), Orlan: This Is My Body ... This Is My Software, London 1996. 17 Ebd., S. 91. 18 Tanya Augsburg, »Orlan's Performative Transformations of Subjectivity«, in: The End(s) of Performance, hg. von Peggy Phelan und Jill Lane, New York 1998, S. 285-314.

Glamour und Schonheit 18 5
Der Unterschied liegt in der Einstellung der beiden Frauen zu Glamour. Sowohl Orlan wie auch Jackson wiinschen sich eine echte Metamorphose. Orlans Metamorphose soil ultrasichtbar sein in ihrer Zuriick-weisung des Glamours, wahrend Jacksons Metamorphose auf Glamour geradezu beruht. Das jedenfalls ist die Behauptung. Orlan hat Teile ihrer selbst nach dem Vorbild des asthetischen Ideals, wie es in der westlichen Kunst reprasentiert wird, umgestaltet. Sie hat jetzt buchstablich das Kinn der Venus von Botticelli, die Augen der Diana von Fontainebleau, die Lippen der Europa von Gustave Moreau, die Nase der Psyche von Gerome und die Augenbrauen von Leonardos Mona Lisa.
Orlans erste Schonheitsoperation fand am 30. Mai 1987 statt, ihrem 40. Geburtstag. Acht weitere folgten. Am 30. Mai 1990, an ihrem 43. Geburtstag, saugte Dr. Cheriff Kamel Zahar unter ortlicher Betau-bung Fett aus ihren Lippen und Schenkeln ab. »Ich habe meinen Kor-per der Kunst gegeben. Nach meinem Tod werde ich daher nicht der Wissenschaft, sondern einem Museum gehoren. Er wird das Zentrum einer Videoinstallation sein.«^9 Von dem ersten Eingriff wurden Video-aufnahmen und Fotos gemacht; per Uberwachungskamera wurde die Operation fiir ein Livepublikum iibertragen, sie wurde von Lesungen eingerahmt sowie (an anderen Orten) von Tanz begleitet. Nachdem beim zweiten Eingriff im Juli 1990 ein Kinnimplantat eingefiihrt wor-den war, gab es einen Wechsel im Chirurgenteam. Der Kunsthandler und kosmetische Chirurg Dr. Bernard Cornette de Saint-Cyr nahm den dritten Eingriff vor. Mit seiner Teilnahme verschwand die Grenze zwi-schen dem Chirurgen als Bildhauer und dem Produzenten eines Kunst-werkes.
Orlan unterzog ihren Korper zunehmend komplexeren asthetischen Veranderungen - trotz der offentlichen Diskussion iiber Brustimplan-tate hatte sie sich Silikonimplantate in ihre Schlafen einpflanzen lassen, um die Schwellungen im Gesicht von Leonardos Mona Lisa zu simulie-ren. Ihre Kunst vereinigt die westliche Besessenheit, den Korper durch Schonheitschirurgie zu »perfektionieren«, mit der modernen Liebes-affare mit der Kamera.^° Denn wie die Vorher-/Nachher-Fotos die wesentlichen epistemologischen Beweise dafiir sind, dass die Schonheitschirurgie dem Patienten die Passage in die Gesellschaft ermoglichte, so ist auch Orlans Kunst, eingefangen in Farbfotos und auf Videoband,
19 McCorquodale (wie Anm. 16), S. 93. 20 »Explorations: Suffering for Art«, in: The Economist (US-Ausgabe) (6. Juli 1996), S. 76.

186 Sander L. Gilman
Beweismaterial ihrer Transformation fiir den Betrachter kommender Zeiten. Ihre Transformation in die Mona Lisa fand im November 1993 durch die feministische Chirurgin Dr. Marjorie Cramer in New York City statt und wurde per Satellit fiir ein fasziniertes Publikum in Montreal, Banff und Paris iibertragen. Die Vorher-ZNachher-Portrats der Schonheitschirurgin sind Kunst geworden.
Ihren eigenen Erklarungen zufolge beabsichtigt Orlan nicht, die Kunstwerke, die sie evoziert, zu imitieren. Ihre Absicht ist es vielmehr, Teile der westlichen Asthetik zu nutzen, um den Effekt von Ubertrei-bung zu zeigen. Ihre neue Nase ist »die grofite Nase, die auf ihrem Gesicht technisch mogHch« war. Das Endprodukt der Performance ist konventioneller. Das konkrete Ergebnis ihrer Kunst besteht aus einer Reihe grofier Farbphotographien der Kiinstlerin: »Orlan, mit perfek-tem Make-up und makelloser Frisur, mit den >Hier schneiden<-Markie-rungen der Chirurgin auf dem Gesicht; Orlan mit einem Furcht einflo-fienden zweizinkigen Instrument in der blutigen Nase; Orlan mit einem Stiick Haut lose hinter dem Ohr; Orlan mit einer groCen Nadel in der Lippe. Zwei Bilder zeigen Orlan sechs Tage nach den Eingriffen der Arztin, mit blutunterlaufenen Augen, und Orlan lachelnd mit einem Straufi Narzissen.«^^ Das Ergebnis der Eingriffe ist deren zunehmende Sichtbarkeit, wobei die Operationsnarben zu Zeichen ihrer Kunst wer-den: »Dies ist Orlan!!! Eine Frau mit Macht und Privilegien. Sie hat mehrere kosmetische Operationen hinter sich, und sie hat das Kranken-haus mit echten Narben verlassen! Darf ich die Narben anfassen? Darf ich Sie anfassen, Orlan?«, ruft der bekannte Regisseur Richard Schech-ner nach dem Besuch ihrer neuesten Performance.^^
Orlan machte die Beobachtung: »Ich habe meinen Korper immer als privilegiertes Material fiir die Konstruktion meiner Arbeit angesehen. Man kann meine Arbeit als klassische Portratkunst betrachten.« Und sie fiigte hinzu: »Jede Operation ist wie ein rite de passage. Kunst muss unsere Gedanken unterbrechen. Sie ist nicht zum Trosten da. Sie muss Risiken eingehen und abweichen.«^^ Aber was kann bei einer Schon-heitsoperation wirklich Vorbild fiir den Eingriff sein? »Die Idee, das
21 Adrian Searle, »Changing Face of Modern Art: Orlan - Portfolio Gallery, Edin-burgh«, in: The Guardian (6. Juni 1996), S. 2. 22 »From Perform-1: The Future in Retrospect*; E-Mail messages about the First Annual Performance Studies Conference, gehalten im Marz 1995 an der New York University, in: TDR The Drama Revue 39 (22. Dezember 1995), S. 142. 23 Simon Holden, »Orlan Turns Cosmetic Surgery into an Art Form«, in: Press Association Newsfile (18. Marz 1996).

Glamour und Schonheit 18 7
Gesicht eines anderen zu benutzen, ist absurd. Man kann nicht die Augen von jemand anders nehmen und sie an Stelle der eigenen einset-zen«, so Orlan. »Was ich verwende, ist die Geschichte hinter der Figur, nicht das Gesicht.«^4 Ajj s sie evozieren mochte, ist die Geschichte der Figur, die Bedeutung, die dem Gesicht zugeschrieben wird.
Orlan macht die grandiose Behauptung, dass ihre Arbeit »ein >Kampf gegen die Natur und die Vorstellung von Gott< sei und auch eine Art, die Welt auf die Verbreitung der Genmanipulation vorzubereiten«.^^ Diese Aussage riickt Orlans Unternehmen in die Nahe der Vorstellungen von kosmetischer Chirurgie als Verbesserung der menschlichen Rasse. Die kosmetischen Operationen, denen Orlan sich seit 1987 unterzogen hat, haben ihr Aussehen mehr oder weniger verandert. Ihre Absicht ist es, letztlich eine neue Person zu erschaffen: »Ich werde eine Werbeagentur beauftragen, einen Nachnamen, einen Vornamen und einen Kiinstler-namen zu kreieren; dann werde ich einen Anwalt beauftragen, eine Petition an die Republik zu verfassen, dass meine neuen Identitaten mit meinem neuen Gesicht akzeptiert werden. Es ist eine Performance, die sich in das Gewebe der Gesellschaft einschreibt, eine Performance, die die Gesetzgebung herausfordert und sich in Richtung einer totalen Veranderung der Identitat bewegt.«^^ Mit der Fettabsaugung, der Pro-these im Kinn, den Silikonbeulen, die wie knospende Horner auf ihrer Stirn sitzen, und einer gigantischen prothetischen Nase, die an ihr Gesicht geschweifit, geschraubt oder mit anderen Mitteln angebracht ist, wiinscht sie sich, als neue Person mit neuem Charakter und neuer Geschichte durchzugehen. Sie hat ihre Operationen zu fernsehiiber-tragenen Hochglanzperformances gemacht, bei denen die wache, aber betaubte Kiinstlerin ihrem Publikum Texte vorliest, wahrend das Chi-rurgenteam seiner grausigen Arbeit nachgeht, gekleidet in Kittel, die von Issey Miyake, Paco Rabanne und anderen, weniger bekannten De-signern entworfen wurden.
Ist das Endziel von Orlans »Projekt« die voUige Selbsttransforma-tion? Ist es nicht ihr Wunsch, eine neue Frau zu erschaffen, die nach ihren eigenen Vorstellungen neu entworfen wurde - ein Gegenbild zur Kunst? Die neue Identitat, die sie an offizieller Stelle eintragen lassen mochte, wird diese neue Person sein. Sie wird die neue Frau geworden
24 Elizabeth Lenhard, »The Changing Face of Orlan«, in: The Atlanta Journal-Constitution (19. April 1994), S. 5. 25 The New York Times (13. September 1996). 16 McCorquodale (wie Anm. 16), S. 92.

18 8 Sander L. Gilman
sein. Sie vermarktet sich und ubernimmt damit die KontroUe iiber ihr Leben und ihren Korper - dies jedenfalls behauptete sie noch bei der grofien Retrospektive im Jahre 2004 im Centre national de la Photogra-phie im Hotel Solomon de Rothschild in Paris, bei der Arbeiten von ihr aus vierzig Jahren prasentiert wurden. Vielleicht hat Pierre Bourdieu Recht, wenn er schreibt, dass »das Subjekt kiinstlerischer Produktion und ihres Produktes nicht der Kiinstler ist, sondern eine ganze Reihe von Agenten, die mit Kunst zu tun haben, an Kunst interessiert sind, ein Interesse an Kunst und der Existenz von Kunst haben, die von und fiir die Kunst leben, die Produzenten von Werken, die als kiinstlerisch angesehen werden, ob grofi oder klein, beriihmt - das heifit >gefeiert< - oder unbekannt, die Kritiker, Zwischenhandler, Kuratoren, Kunsthis-toriker usw.«^7 Zu dieser Liste konnen wir nun Schonheitschirurgen und das Internet hinzufiigen, wo Echtzeitbilder von Orlans Operation verkauft werden.
Das Problem, das Cindy Jackson und Miles Kendall ebenso wie Orlan aufwerfen, ist das der Kopie von einer Kopie, oder vielleicht starker ausgedriickt: das Problem der Natur von Glamour im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Korpers. Walter Benjamin hatte Recht, als er 1936 in seinem Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« schrieb, dass sich die Bedeutung eines Kunstwerks mit dem Charakter seiner technischen Reproduzierbarkeit verandere. Die Photographic bewirkte, so Benjamin, eine radikale Ver-anderung der Bedeutung von Kunst gegeniiber der Tradition bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein, welche, so sein Argument, eine Aura angenommen hatte, die »authentische« (einzigartige) Kunstwerke mar-kierte und ihnen denselben Status zuschrieb wie religiosen Reliquien. Jedes Werk war ebenso unersetzbar wie die Hand des Genies, die es geschaffen hatte. Benjamin zeigte, wie die Aura der Authentizitat durch die Massenreproduktion, die von einem Handwerker statt von einem Kiinstler bewerkstelligt werden konnte, beseitigt wurde. Leser aus der Mittelschicht konnten sich solche Reproduktionen von Kunstwerken in Bildbanden, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts bereits weit ver-breitet waren, kaufen. Tatsachlich waren es solche Reproduktionen klassischer griechischer Skulpturen und deutscher Renaissancekunst,
27 Pierre Bourdieu, Sociology in Question, trans, by Richard Nice, London 1993, S. 148.

Glamour und Schonheit 189
die den ersten Schonheitschirurgen als Inspiration und Modell dienten.
Unter den bekanntesten Nu tze rn solcher Werke finden sich Namen
wie Jacques Joseph, der Berliner Chirurg und Zeitgenosse Benjamins,
der viele der kosmetischen Eingriffe an Gesicht und Korper erfand, die
heute noch vorgenommen werden, und Eugen Hollander, der »Vater
des Gesichtsliftings«.
Benjamin betonte, dass diese »Reproduktionen« nicht als geringere
Kopien verstanden werden sollten, sondern vielmehr ihre eigene Au-
thentizitat hatten. Die Aura der Authentizitat , die auf das einzigartige
Kunstwerk beschrankt war, so Benjamins Argument, entfernte das
Kunstwerk von den Massen. Die Chirurgen waren in den i89oer Jahren
mit ahnlichen asthetischen Fragen konfrontiert. Die Behauptung der
ganzlichen und gottlichen Einzigartigkeit eines gegebenen Korpers
wird durch die Fahigkeit des Chirurgen, diesen Korper zu verandern,
zerstort. Chirurgen nahmen Kunstwerke als Vorbilder fiir die gesell-
schaftlich akzeptierten N o r m e n von Schonheit und stellten aus inakzep-
tablen Nasen schone, unendlich reproduzierbare Nasen her. Das ist
nicht einfach nur meine eigene, vom 21. Jahrhundert gepragte Relektiire
der Beziehung zwischen Reproduzierbarkeit und Chirurgie. Benjamin
selbst ging dieser Parallele nicht aus dem Weg in seinem Versuch, Pho to
graphic und Malerei zu vergleichen:
»Hier haben wir die Frage zu stellen: wie verhalt sich der Operateur zum Maler? Zu ihrer Beantwortung sei die Hilfskonstruktion gestattet, die sich auf den Begriff des Operateurs stiitzt, welcher von der Chirurgie her gelaufig ist. Der Chirurg stellt den einen Pol einer Ordnung dar, an deren anderm der Magier steht. Die Haltung des Magiers, der einen Kranken durch Auflegen der Hand heilt, ist verschieden von der des Chirurgen, der einen Eingriff in den Kranken vornimmt. Der Magier erhalt die natiirliche Distanz zwischen sich und dem Behandelten auf-recht; genauer gesagt: wenn er sie - durch Auflegen der Hand - nur sehr wenig vermindert, er vermehrt sie - kraft seiner Autoritat - sehr. Der Chirurg verfahrt umgekehrt: er vermindert die Distanz zu dem Behandelten sehr - indem er in dessen Inneres dringt - , und er vermehrt sie nur wenig - durch die Behutsamkeit, mit der seine Hand sich unter den Organen bewegt. Mit einem Wort: zum Unterschied vom Magier (der auch noch im praktischen Arzt steckt) verzichtet der Chirurg im entscheidenden Augenblick darauf, seinem Kranken von Mensch zu Mensch sich gegeniiberzustellen; er dringt vielmehr operativ in ihn ein. - Magier und Chirurg verhalten sich wie Maler und Kameramann. Der Maler beobachtet in seiner Arbeit eine natiirliche Distanz zum Gegebe-

190 Sander L. Gilman
nen, der Kameramann dagegen dringt tief ins Gewebe der Gegebenheit ein. Die Bilder, die beide davontragen, sind ungeheuer verschieden. Das des Malers ist ein totales, das des Kameramanns ein vielfach zerstiickel-tes, dessen Teile sich nach einem neuen Gesetze zusammenfinden. So ist die filmische Darstellung der Realitat fiir den heutigen Menschen darum die unvergleichlich bedeutungsvollere, weil sie den apparatfreien Aspekt der Wirklichkeit, den er vom Kunstwerk zu fordern berechtigt ist, ge-rade auf Grund ihrer intensivsten Durchdringung mit der Apparatur gewahrt.«^^
In einer Fufinote zu dieser Passage bezieht Benjamin sich spezifisch auf
Schonheitschirurgie. Er zitiert dor t den franzosischen Schriftsteller und
Reisenden Luc Durtain:^^
»Die Kiihnheiten des Kameramanns sind in der Tat denen des chirur-gischen Operateurs vergleichbar. Luc Durtain fiihrt in einem Verzeich-nis spezifisch gestischer Kunststiicke der Technik diejenigen auf, >die in der Chirurgie bei gewissen schwierigen Eingriffen erforderUch sind. Ich wahle als Beispiel einen Fall aus der Oto-Rhino-Laryngologie; [...] ich meine das sogenannte endonasale Perspektiv-Verfahren [...]. Welch reine Stufenfolge subtilster Muskelakrobatik wird nicht von dem Mann gefor-dert, der den menschlichen Korper reparieren oder ihn retten will!<«
Gemeint ist Jacques Josephs Operat ion fiir die Umgestaltung der Nase
von innen, eine der grundlegenden Innovationen der i89oer Jahre. Es
ist auch heute noch das Standardverfahren fiir die Umgestaltung von
Nasen. Benjamin sieht im Schonheitschirurgen jemanden, der »vielfal-
tige Fragmente schafft, die unter einem neuen Gesetz wieder zusam-
mengefiigt werden« - die Grundlage, auf der die moderne Welt der
Schonheitschirurgie moglich wurde. Aber nicht nur die Technik, son-
dern auch die Fahigkeit, viele Kopien von einem Original herzustellen,
das es nie gab, definiert den Schonheitschirurgen.
Der Chirurg ist insof ern auch wie ein Photograph, da er viele Kopien
herstellen k a n n - j e d e zugegebenermafien etwas oder auch radikal anders
als das Original. Aber gibt es hier, in dieser Welt von Barbie und Ken bis
hin zu Diirer und Botticelli, jemals ein »Original«? Die Chirurgen des
19. Jahrhunderts hatten ein ahnliches Problem. Wenn man wie Jacques
Joseph ein Kunstwerk, zum Beispiel eine Zeichnung von Diirer, als M o -
dell fiir das perfekte Profil benutzt, was ist dann das »Original«? (Fiir
28 Walter Benjamin, »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbar-keit«, in: ders., Illuminationen, Frankfurt am Main 1961, S. 166 f. 29 Luc Durtain, »La technique et l'homme«, in: Vendredi 13 (1936), S. 19.

Glamour und Schonheit 191
seine medizinischen Publikationen reproduzierte Joseph solche Werke von Reproduktionen in Bildbanden.) Joseph wiirde sagen, die Frau, die Diirer Modell safi, sei das Original. Aber es besteht keine Garantie, dass es eine solche Frau jemals gab. Der Kiinstler kann Gesichtsziige auf der Grundlage seiner eigenen Auffassung von Glamour herstellen. Kopien solcher imaginierten Gesichter konnen dann immer wieder produziert werden - und das markiert und unterstreicht unsere Vorstellung, dass die Werke einer gegebenen Epoche in der Schonheitschirurgie die Asthe-tik und Politik ihrer Zeit reflektieren. Es braucht kein »Original« in diesem Sinn, sondern einfach ein Gefiihl fiir die Moglichkeit, Gesichter und Korper im Sinne der Asthetik eines gegebenen Augenblicks neu zu gestalten.
Hierin besteht also das zentrale Problem der Kultur der Schonheitschirurgie: Die kosmetischen Eingriffe verschonern das Aussehen der Menschen, sie tragen nicht zu ihrem besseren Funktionieren bei. Da-her werden kosmetische Operationen als Chirurgie der »Eitelkeit«, als Kommodifizierung von Schonheit und Glamour und nicht als medizi-nische Behandlung angesehen. Kann es fiir solche veranderten Korper in irgendeinem Sinn ein Original geben oder handelt es sich notwendi-gerweise um die Kreationen einer Glamour-Industrie, welche auf dem voUigen Fehlen jeder Art von Authentizitat beruht - selbst in der Welt der Reproduktionen? Wenn es kein Original geben kann, nur einen in-finiten Regress von Kopien, ist dann nicht das Fehlen von Authentizitat (ohne Benjamin zu nahe treten zu wollen) die Garantie fiir die moderne Natur unserer Korper? Jeder Korper iibt, wenn er von Chirurgen und von uns selbst geformt wird, eine Funktion aus, die auf einen gegebenen historischen Moment beschrankt ist. Ob wir auf Glamour oder ganz-liche Unsichtbarkeit abzielen, ist Teil dieser Funktion, so wie sie zu einem gegebenen Moment gebraucht und akzeptiert wird.
(Aus dem Englischen von Benjamin Marius Schmidt)

Doris Kolesch
Imperfekt Zur Asthetik anderer Korper auf der Biihne
Imperfekt - der Titel meines Beitrags ist in mehrfacher, polysemer Weise zu lesen, und diese Vielfalt der Bedeutungen und der Deutungsmoglich-keiten mochte ich nicht unterschlagen oder eindammen, sondern ganz im Gegenteil hervorheben, da sie den Horizont meiner nachfolgen-den, noch keineswegs abgeschlossenen oder an ein Ende gekommenen Uberlegungen bildet.
Zum einen verweist das Imperfekte auf nicht Perfektes, UnvoUkom-menes, Versehrtes, sich der Norm der Normalitat und der Idee der Perfektibilitat Entziehendes. Dabei stellt das Imperfekte kein blofies Gegenteil des Perfekten dar, sondern es kiindet vom Widerspruch, vom Widerstand gegen das Perfekte und unterlauft die Logik des Entweder-oder und des tertium non datur.
Zum Zweiten bezeichnet das Imperfekt in der Linguistik eine unab-geschlossene, unvollendete Vergangenheit. Dieses linguistische Konzept mochte ich auf die asthetische Erfahrung anderer, extremer, exponierter Korper auf den Biihnen (des Theaters, aber auch des Alltags) zu iiber-tragen suchen. In dieser Perspektive kommt das Imperfekt als eine Ge-schichte, ein Gewordensein, eine Kontextbezogenheit in den Bhck, die sich nicht einfach ausblenden oder ausradieren lasst, die eine tabula rasa verhindert. Imperfekt ware dann ein Vorher, ein Gestern, das - noch - andauert, ins Jetzt der Gegenwart hineinreicht und insofern auch die Zukunft zu tangieren, zu markieren vermag.
Im Perfekt - betone ich das Wort etwas anders, lasse ich eine kleine Pause zwischen im und Perfekt - komme ich schhefihch zur dritten Be-deutung des Wortes: Im Perfekt, also in der Vergangenheit, befindet sich jedes theatrale Ereignis, iiber das ich nachdenken und sprechen kann. Das fliichtige und transitorische Theatergeschehen ist immer nur im Verschwinden, im Entzug gegeben. Ich kann nicht - wie zum Beispiel
193

194 Doris Kolesch
im Falle der Literatur oder der Malerei - auf ein dauerhaft materialisier-tes Werk zuriickgreifen, das ich immer wieder lesen oder erneut sehen kann. Selbst wenn ich wahrend einer Theaterauffiihrung iiber einzelne gerade gesehene und gehorte Szenen, Bilder oder Klange nachdenke, sie zu ergriinden, zu deuten suche, sind diese mir nicht mehr in prasenti-scher Anschauung gegeben, sondern in meiner Erinnerung, im Modus des soeben Vergangenen. Doch was als Mangel erscheinen konnte, stellt zugleich eine besondere Chance dar, die insbesondere vom postdrama-tischen Theater und Tanz und der aktuellen Performance- und Installa-tionskunst vorgefiihrt, ja bisweilen gar massiv eingefordert wird: das selbstreflexive Ausstellen der prekaren Verfasstheit unserer Wahrneh-mung, das Auf merken auf die Verantwortung der eigenen Wahrnehmung ebenso wie auf die Verantwortung fiir die eigene Wahrnehmung. Theater inszeniert immer eine doppelt adressierte Wahrnehmung: Was ein Schauspieler tut oder sagt, richtet sich sowohl an seine Mitspieler auf der Biihne als auch an das Publikum, das gleichzeitig Adressat und Zeuge des Geschehens ist.
Wie in alien Zeitkiinsten kann ich zudem im Theater nicht einfach zuriickblattern, mir die Szene erneut vor Augen fiihren, zuriickspulen oder eine Pause einlegen, wenn ich etwas nicht richtig gesehen oder ver-standen habe, wenn mir etwas unklar bleibt oder wenn ich - auf Grund der zwangslaufigen Fokussierung meines Blickes auf einen bestimmten Biihnenausschnitt - plotzlich den Eindruck habe, dass mir an einem an-deren Ort des Geschehens etwas entgangen ist. Diese Verfasstheit asthe-tischer Wahrnehmung zwingt zu einer Antwort, zu einem Bezug, der weniger intentional als vielmehr responsiv ware und dem eine ethische Dimension inharent ist:
»Echte Verantwortung gibt es nur, wo es wirkliches Antworten gibt. Antworten worauf ? Auf das, was einem widerfahrt, was man zu sehen, zu horen, zu spiiren bekommt. [...] Dem Augenblick antworten wir, aber wir antworten zugleich fiir ihn, wir verantworten ihn.«^
Das bislang Gesagte verdeutlicht gleich zu Beginn, dass meine Uber-legungen zum Imperfekt und zur Asthetik anderer Korper auf der Biihne von einer rezeptionsasthetischen Perspektive, von meiner Sicht als Theaterzuschauerin ausgehen. Ich versuche zu ergriinden, was da passiert - oder was da zumindest passieren kann -, und zwar mit mir,
I Martin Buber, »2wiegesprache«, in: Das dialogische Prinzip, Heidelberg 1973, S. 161-163.

Imperfekt 195
wenn auf der Biihne etwas geschieht, wenn sich dort ein Mensch dem Risiko der Sichtbarkeit, des Auffalligwerdens aussetzt. Die Betonung, dass mit mir, dass mit Zuschauern, Zuhorern im Theater etwas passiert, soil nicht die Subjektivitat von Wahrnehmung im Sinne eines mit ande-ren nicht teilbaren, nicht mitteilbaren Eindrucks unterstreichen, son-dern ganz im Gegenteil hervorheben, dass es sich hier um ein Geschehen handelt, das weder nur subjektiv noch nur objektiv, weder als blo6 passives Erleiden noch als blofi aktives Tun bestimmt werden kann. Asthe-tische Wahrnehmung ist Wahrnehmung als Passion fiir das Andere,^ ist Beriihrt-, Tangiertsein vom Fremden, Involviertsein ins Unbekannte. Sie ist ein Ineinander und Zugleich von Tun und Geschehenlassen. In dieser Sichtweise impliziert die Asthetik eine Ethik, nicht umgekehrt.
Vor diesem Hintergrund ist es besonders spannend, zu untersuchen, was passiert, wenn die sich zeigenden, sich zur Schau stellenden, sich exponierenden Korper gangigen Idealen und gesellschafthchen Normen von Schonheit, Jugendlichkeit, Gesundheit oder Vitalitat widerspre-chen. Unter historischen, soziologischen, moralischen und asthetischen Gesichtspunkten - asthetisch hier verstanden im Sinne der Lehre vom Kunstwerk und vom Schonen - mag dies als Ausnahme, als Sonderfall erscheinen. In einer Perspektive, die Asthetik als Aisthesis, als sinnliches Wahrnehmen und Erkennen versteht, ware dies gerade keine Ausnahme, kein Sonderfall von Wahrnehmung, sondern ihre Normalitat. Das Auf-falligwerden von Jemandem oder von Etwas hat immer zu tun mit dem Gewahren einer Differenz, eines Andersseins, einer Abweichung - das kann eine Verletzung oder eine Behinderung sein, ein besonders junger oder alter Korper, eine bemerkenswert schone oder hassliche Erschei-nung, eine bestimmte Korpergrofie, aber auch eine fremde Sprache, ein ungewohnter Dialekt oder Akzent, eine andere Hautfarbe oder eine gegengeschlechtliche Besetzung, so wenn Corinna Harfuch in Haupt-manns Teufels General den Protagonisten spielt.
Mich interessiert, wie andere, imperfekte Korper auf der Biihne das Imperfekt als unvollendete Vergangenheit, als gelebtes Leben in den pra-sentischen Moment der Szene einbringen und welche asthetischen Kon-sequenzen dies haben kann. Dabei mochte ich mich auf zwei Aspekte des
2 Vgl. auch Dietmar Kamper, »Normalitat auf dem Prufstand«, in: der [im-]perfekte mensch: vom recht auf unvollkommenheit, hg. von der Stiftung Deutsches Hygiene Museum und der Deutschen Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V., Ostfildern-Ruit 2001, S. 156.

1^6 Doris Kolesch
anderen Korpers konzentrieren, namlich auf den alten, gebrechlichen Korper sowie auf den verletzten, versehrten, abweichenden Korper. Die Frage nach der Asthetik des alten Korpers werde ich am Beispiel der fast neunzigjahrigen Marianne Hoppe in Heiner Miillers Quartett sowie am Beispiel des >Nederlans Dans Theater y, eines Ensembles fiir liber vierzigjahrige Tanzerinnen und Tanzer, thematisieren. Schon diese beiden recht unterschiedlichen Altersangaben zeigen an, dass es keine reale, gar natiirliche Grenze gibt, die alt von jung, gesund von krank, be-hindert von nicht-behindert oder schon von hasslich scheiden konnte. Ob und wie jemand alt oder Jung, gesund oder krank ist, hangt davon ab, wie eine Situation definiert, wie ein Tatigkeitsfeld strukturiert und eine Welt organisiert ist. Das Alter, in dem manche Tanzer an das Ende ihrer aktiven Tanzkarriere denken, mag fiir Schauspieler eben das Alter sein, in dem sie auf Grund der bislang erworbenen Erfahrung und Reife langsam in die Lage versetzt werden, grofie Schauspieler zu werden.
Hier kommt die Frage nach der Definitionsmacht und ihrem his-torischen, kulturellen Gewordensein in den Blick. Jede reale Grenze hat einen symbolischen Einschlag, selbst die so genannte natiirliche Grenze, die es im strengen Sinne, also als symbolunabhangige gar nicht gibt - selbst der Fluss als politische Landesgrenze oder der sexuelle Korper als vermeintliches Fundament des geschlechtlich differenzier-ten Korpers sind durch und durch symbolisch aufgeladen und gedeutet. Ebenso wenig wie es eine ausschliefilich natiirliche Grenze geben kann, gibt es eine rein ideale Grenze, denn die Etablierung von Grenzen muss immer auf Situierungen in Raum und Zeit, also auf Sinnliches, Materiel-les rekurrieren.^ Und wenn es zutrifft, dass die Etablierung von Kultur und Gesellschaft und alle damit verbundenen Phanomene und Werte wesentlich auf der Ziehung von Grenzen und auf Prozessen der Ein-und Ausgrenzung beruhen, dann kommt als eine Funktion asthetischer Arbeit und asthetischer Erfahrung in den Blick, dass wir dadurch mit dem moglichen Anderssein von Ordnungen konfrontiert werden kon-nen. Nicht dass Grenzen gezogen werden, sondern wie und wo dies geschieht, kommt als kontingente Praktik in den Blick und stellt mithin das gesamte Ordnungssystem in Frage. Oder, um es mit Dietmar Kam-per zu formulieren:
»Das System der Gedanken steht an der Stelle des Wahnsinns und kann nicht verhindern, dafi im Kern nach und nach genau das ausbricht, was
3 Vgl. Bernhard Waldenfels, Der Stachel des Fremden, Frankfurt am Main 1990, S. 37.

Imperfekt 19/
fiir immer ausgeschlossen werden sollte. Ahnlich ist die so genannte Alternative von Normalitat und Behinderung zu begreifen: als Differenz zweier einander entgegengesetzter Ausweglosigkeiten. Man mufi die De-finitionsmacht bestreiten, nicht das definitiv Definierte. Nur so lafit sich die in der Werbung umworbene, in den Medien massenhaft hochgeju-belte, aber rettungslos hohle Nufi der menschlichen Normalitat endlich knacken.«'
Was Kamper hier die »hohle Nufi der menschlichen Normalitat« nennt, ist in Bezug auf den Korper das Ideal und Phantasma des jungen, gesun-den, vitalen, formbaren und perfektionierbaren Korpers. Als Gegen-figur, als Gegenverkorperung werde ich nicht nur auf die alte Marianne Hoppe und die alteren Tanzerinnen und Tanzer des >Nederlans Dans Theater y eingehen, sondern auch auf die italienische Theatergruppe Societas Raffaello Sanzio, in deren Inszenierungen in vielfaltiger Weise von der Norm abweichende Korper auftreten.
Um mich diesen unterschiedlichen Spielarten anderer Korper zu nahern, muss ich zunachst noch einmal auf die Besonderheit asthetischer Wahr-nehmung und insbesondere auf die Verfasstheit asthetischer Wahrneh-mung in theatralen Zusammenhangen eingehen. Es ist fiir das Theater spatestens seit Lessing und fiir die Performance-Kunst spatestens seit Peggy Phelan zum Topos geworden, dass diese Kunst durch ihre Tran-sitorik charakterisiert ist, dass sie nur im Verschwinden existiert. Auch ich selbst habe diesen Topos eingangs aufgegriffen. Doch ich denke, er reprasentiert nur die halbe Wahrheit. Theater vergeht - sicherlich, daran kann kein ernsthafter Zweifel bestehen, alles wird in den unbarmherzi-gen, da unwiederholbaren Sog der (Theater-)Zeit gerissen. Doch Theater dauert auch an: als Eindruck, Nachhall, Verstorung, Faszination in mir - und bisweilen auch als ratloses Feststellen, dass nach einem Theaterabend kein Eindruck, keine Spur geblieben ist, was aber selbst noch in der Negation eine erinnernde Bezugnahme des Subjekts auf das Gesehene, Gehorte und Erlebte bedeutet, oder zumindest dessen Versuch. Insofern ist das Verschwinden nicht als Gegenteil, als Anderes des Bleibens, Bestehens, Bewahrens aufzufassen, sondern als dessen Er-moglichungsbedingung, als notwendiger Horizont, vor dem materielle wie immaterielle Spuren iiberhaupt erst einen Unterschied machen. Die transitorische Performance ist nicht einfach das Gegenteil des dauer-
4 Vgl. Kamper (wie Anm. 2), S. 154 f.

198 Doris Kolesch
haften, auf Dauer gestellten Archivs, sondern sie provoziert und ermog-licht andere, dynamische, korpergebundene Formen der Archivierung und des Erinnerns. Eben deshalb pragt die eingangs erwahnte Verant-wortung der Zeugenschaft, der Augen- und Ohrenzeugenschaft fiir das Gesehene und Gehorte die asthetische Rezeption im Theater. Das wahrnehmende Subjekt wird hier auf seine Subjektivitat verwiesen, da es in fundamentaler Weise darauf ankommt, was ich gesehen und ge-hort habe, und nicht darauf, was es da gab. Und das Subjekt erfahrt in dieser Beschaftigung eine eigentiimliche Spannung zwischen Vermo-gen und Unvermogen, zwischen Perfektion und Imperfektion: Es kann sich einzelne Szenen detaiUiert vor Augen fiihren, sie beschreiben und in ihrer formalen und rhythmischen ebenso wie in ihrer thematischen Beziehung zu vorangegangenen oder nachfolgenden Szenen erklaren. Doch in dieser Fahigkeit schwingt immer die Gefahr der Tauschung, des Vergessens, des Nicht- und Missverstehens mit. Die Erinnerung wird als zuverlassig und zugleich triigerisch erlebt, und man ist im Nachhinein oft unsicher, ob man eine Szene wirUich so erlebt hat, wie man sie erinnert. Erinnerung vollzieht sich - wie Wahrnehmung - nicht als ein reproduktiver Prozess, sondern als ein produktiver, sie ist eine schopferische Konstruktion. Damit stellen Abweichung, Veranderung, Umdeutung und Negation keine blofie Gefahr des Wahrnehmens wie Erinnerns dar, sondern einen konstitutiven Zug dieser Tatigkeiten.
Entsprechend pragt das Imperfekt als Figur des Unabschliefibaren in der eingangs genannten dreifachen Dimension unvollendeter und unvollendbarer Vergangenheit die Erfahrung theatraler Wahrnehmung. Von daher konnte man das Spezifikum asthetischer Erfahrung wie folgt fassen: Der Mensch erlebt darin ein unauflosbares, dynamisches Ineinander von sinnlicher Pragnanz und Entzug, von Verstehen und Nichtverstehen, von Wahrnehmungs-, Assoziations- und Deutungs-vermogen und deren Scheitern. Der asthetisch wahrnehmende Mensch ist weder perfekt noch imperfekt, weder verniinftig noch unverniinftig, weder gesund noch das blofie Gegenteil und auch keine Mischung von beidem, die ein Ganzes ergaben - er ist vielmehr ein klaffender Zwie-spalt; noch im Erfassen und vermeintlichen Verstehen des asthetischen Geschehens bleibt ein Rest, etwas Unverfiigbares, Un(be)greifbares.
Doch wenn vor diesem Hintergrund betont wiirde, dass Perfektion die falsche Norm sei, bewegten wir uns ausschliefilich auf der Ebene des Intellekts, blieben wir befangen in - wenn auch gut gemeinten - Appel-

Imperfekt 199
len und moralischen oder moralisierenden Anspriichen. Im schlimms-ten Falle kommt es zum vorauseilenden Gehorsam der political correctness, dem selbst auferlegten Denk- und Wahrnehmungsverbot, das die Chance einer nicht aneignenden Erfahrung von Alteritat von vornher-ein verunmoglicht.
Eben diesen kulturellen, sozialen und politischen Denk- und Wahr-nehmungsverboten setzt die Kunst Wahrnehmungsangebote, Wahrneh-mungsgebote entgegen. Das Theater ist etymologisch ein Schauplatz, ein Ort, von dem aus etwas angeschaut wird und an dem sich etwas zeigt. Im Theater darf das PubHkum nicht nur hinsehen, ja es soil und muss sogar hinschauen, darf starren, staunen, glotzen und anhimmeln.
Was im alltaglichen gesellschaftlichen Kontext schon den kleinen Kindern verboten wird, namlich bei Gebrechen, Behinderung, Abwei-chung ganz genau hinzuschauen, genau das wird im Theater und in theatralen Situationen provoziert. Dass damit auch die Gefahr einer blofi voyeuristischen Befriedigung von Neugier oder des exotistischen und sensationsliisternen Ausstellens von Freaks gegeben ist, muss nicht eigens erwahnt werden. Doch ich mochte im Folgenden die These vertre-ten, dass pauschale Aufierungen wie: »Das darf Theater nicht«^ meines Erachtens nur bezeugen, dass man sich eben nicht auf asthetische Wahr-nehmung einzulassen gewillt ist, sondern von vornherein ein vermeint-lich tolerantes und liberales Moralsystem ins Feld fiihrt, das gerade auf die Vermeidung von Erfahrung abzielt und die Existenz vermeintlich immaterieller, abstrakter Werte (wie Gleichheit, Gleichberechtigung etc.) betont. Denn eine solche Aussage reduziert Behinderte immer und iiberall auf ihr Behindertsein - so als diirfe ein junger, kinderloser Mann keinen Vater, eine alte Frau keine jiingere spielen oder eine Frau keinen Mann. Theater hat es aber gerade mit einem - immer auch utopischen - Spielraum menschlicher Moglichkeiten zu tun, es fiihrt uns vor, wie es auch sein konnte, es zeigt alternative Lebensentwiirfe, alternative Normen und Werte, und es kann dies auf Grund seiner Fahigkeit zur Transformation, zur Veranderung sowohl des Schauspielers und seines Korpers als auch des Zuschauers. Wer einmal den fiilligen, durchaus schwergewichtigen Josef Bierbichler auf der Biihne tanzen - ich mochte
5 Mit diesen und ahnlichen Formulierungen hat der Theaterkritiker Gerhard Stadel-meier mehrfach die Arbeit des behinderten Schauspielers Peter Radtke als »aufierhalb jeder Theaterkritik« stehend abgetan - und damit eine ernsthafte Auseinandersetzung von vornherein verweigert (vgl, Peter Radtke, M - wie Tabori: Erfahrungen eines behinderten Schauspielers, Zurich 1987, S. 155 ff.).

200 Doris Kolesch
fast sagen: schweben - sah, der hat einen Eindruck davon, wie der kon-krete sinnliche Vollzug einer Handlung oder einer Geste im Theater bestehende Denk- und Wahrnehmungsschemata, bestehende Katego-rien und KHschees aufbrechen, fiir einen Moment aufier Kraft setzen kann. Auch die Beispiele, auf die ich im Folgenden eingehen mochte, veranschauUchen, dass das Alter, die Behinderung, die Krankheit oder das Defekte kein blofi negatives Nicht-Erflillen einer ideaHsierten und fetischisierten Norm darstellen, sondern dass sie zugleich eine andere Ordnung, eine andere Korperhchkeit, RaumUchkeit und Plastizitat, ja auch eine andere Schonheit mit sich fiihren, die vom Theater aufgegrif-fen und gezeigt werden kann.
Dies wird im aktuellen Theater besonders virulent, weil es eine, wenn nicht die Basiskonvention moderner Kunst und modernen Theaters durchbricht: die Konvention der asthetischen Distanz, des interesse-losen Wohlgefallens, die eine Trennbarkeit, eine Abgrenzbarkeit von erfahrenem Kunstwerk und erfahrendem Subjekt suggeriert. Eben jene asthetische Distanz reifit die Kunst seit den Avantgarde-Bewegungen zu Beginn des letzten Jahrhunderts und verstarkt seit dem Zweiten Weltkrieg erbarmungslos ein. Hier spielt Chris Burden nicht, dass ihm in den Arm geschossen wiirde, sondern er lasst sich in den Arm schie-fien; korperliche Verletzungen und Versehrungen werden nicht blofi angedeutet, verbleiben nicht im Schein des Als-ob, sondern werden real ausgefiihrt. Kiinstlerinnen und Kiinstler peitschen, ritzen, verunstalten sich selbst. Und die Geschichten, die sie erzahlen, sind keine fiktiven Geschichten, die einen anderen Raum und eine andere Zeit denotieren, sondern es sind haufig Geschichten, die das Hier und Jetzt der Existenz ausstellen, in denen es um reale Lebenserfahrungen, um die Erfahrung von Ausgrenzung oder Krankheit, von Migration und Exil, um den Verlust geliebter Menschen durch Aids oder vergleichbar existenzielle Situationen und Konstellationen geht.
Es sind meines Erachtens diese umwalzenden asthetischen Entwick-lungen in den Kiinsten seit den sechziger Jahren, die neben und in enger Wechselwirkung mit gesellschaftlichen und politischen Emanzi-pationsbewegungen wie der Frauenbewegung, der schwul-lesbischen Bewegung, den Initiativen von Migranten ebenso wie den Aktivitaten von Behinderten und anderen so genannten Minderheiten die Voraus-setzung dafiir geschaffen haben, dass und wie heute (nicht nur korperliche) Abweichung, Krankheit, Verletzbarkeit oder Behinderung auf die Biihne kommen kann und dass und wie Behinderte heute auf Biihnen

Imperfekt 201
prasent sind. Denn wenn die Deformation des Korpers, die Verletzung und konkrete Verwandlung des Korpers zum kiinstlerischen Verfahren der Figuration, der Darstellung und Prasentation intensiver Szenen und Augenblicke wird, dann gewinnt auch der abweichende, behinderte, deformierte Korper als Medium und Material kiinstlerischer Gestal-tung einen neuen, veranderten Stellenwert.
So kann die Besetzung der Merteuil mit der fast neunzigjahrigen Marianne Hoppe in Heiner Miillers Quartett, einer Bearbeitung von Choderlos de Laclos' Gefdhrliche Liebschaften - die 1994 im Berliner Ensemble Premiere hatte und dort in den Jahren zwischen 1996 und 2000 zu sehen war - , nicht ohne den Bezug auf den gesellschaftlichen Impetus gesehen werden, der gerade Frauen auf Schonheit, Jugendlich-keit und Makellosigkeit verpflichtet. Zwar betrifft und terrorisiert der Jugendlichkeitswahn unserer Gesellschaft beide Geschlechter, doch dies nicht in gleichem Mafie und in gleicher Weise.^ Wahrend ein alterer Mann in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Diskursen haufiger mit Reife, Erfahrung oder auch Machtgewinn assoziiert werden kann, steht bei der alteren Frau eher die Vorstellung verlorener Attraktivitat, ver-bliihter Schonheit und unwiederbringlich vergangener Gelegenheiten im Vordergrund. Glaubt man den Diskursen von Werbung, Mode und Frauenzeitschriften, fangt die Frau an, ab zwanzig, spatestens jedoch ab dreifiig Jahren alt zu werden, und sie muss versuchen, mit Cremes, Diaten und modifizierten Verfuhrungskiinsten die damit unweigerlich verbundenen Gefahren aufzuhalten. Bei Mannern hingegen scheint das Alter eher zwischen sechzig und siebzig Jahren anzufangen. Wenn nun Marianne Hoppe die Figur der Merteuil, der grofien, souveranen Ver-fiihrerin der Manner verkorpert, die sich einen so strategisch-sportiven wie ernsten Kampf mit dem Verfiihrer Valmont liefert, in dem beider Verfiihrungswahn nur als wechselseitige Verfallenheit aufscheint, als Hassliebe, die unter keinen Umstanden gezeigt, zugegeben werden darf, dann ist das zum einen ein Bruch mit der unhinterfragten Konvention, die verfiihrerische Frau als jung, schon, vital darzustellen, zu verkor-pern und zu imaginieren. Zum anderen aber wird damit eine spezifi-sche Verbindung von Sinnlichkeit und Sinn konstelliert. Das Theater
6 Vgl. dazu auch Herbert Willems / York Kautt, »Theatralitat des Alters: Theoretische und empirisch-analytische Uberlegungen zur sozialen Konstruktion des Alters in der Werbung«, in: Ursula Dallinger / Klaus R. Schroeter (Hgg.), Theoretische Beitrdge zur Alternssoziologie, Opladen 2002, S. 81-112.

202 Doris Kolesch
fiihrt vor, dass Sinn immer inkarnierter Sinn ist, dass er in je spezifischer
Weise zeitlich und raumlich situiert, materialisiert und verkorpert war
den muss. So ergeben sich Korrespondenzen, Spannungen und Wider-
spriiche zwischen Gesehenem und Gehortem, so kommentiert und
konterkariert das Gezeigte bisweilen das Gesagte, beispielsweise wenn
Madame de Merteuil zu Beginn Valmont anspricht:
»Sie haben nicht vergessen, wie man umgeht mit dieser Maschine. Neh-men Sie Ihre Hand nicht weg. Nicht dafi ich fiir Sie etwas empfande. Es ist meine Haut, die sich erinnert. Oder vielleicht ist es ihr, ich rede von meiner Haut, Valmont, einfach gleichgiikig, wie? an welchem Tier das Instrument ihrer Wollust befestigt ist. Hand oder Klaue. Wenn ich die Augen schhefie, sind Sie schon, Valmont. Oder bucklig, wenn ich will. Das Privileg der Blinden. Sie haben das bessere Los in der Liebe. Die Komodie der Begleitumstande bleibt ihnen erspart: sie sehen was sie wollen. Das Ideal ware blind und taubstumm. Die Liebe der Steine. Habe ich Sie erschreckt, Valmont. Wie leicht Sie zu entmutigen sind. Ich kannte Sie so nicht. Hat Ihnen die Damenwelt Wunden geschlagen nach mir. Haben Sie ein Herz, Valmont. Seit wann. Oder hat Ihre Mannheit Schaden genommen, in meiner Nachfolge. Ihr Atem schmeckt nach Ein-samkeit. Hat die Nachfolgerin meiner Nachfolgerin Ihnen den Laufpafi gegeben. Der verlassene Liebhaber. Nein. Ziehen Sie Ihr zartes Angebot nicht zuriick, mein Herr. Ich kaufe. Ich kaufe in jedem Fall. Gefiihle sind nicht zu befiirchten. Warum sollte ich Sie hassen, ich habe Sie nicht geliebt. Reiben wir unsere Felle aneinander. Ah die Sklaverei der Leiber. Die Qual zu leben und nicht Gott zu sein. Ein Bewufitsein haben und keine Gewalt iiber die Materie. Ubereilen Sie sich nicht, Valmont. So ist es gut. Ja Ja Ja Ja. Das war gut gespielt, wie. Was geht mich die Lust mei-nes Korpers an. Ich bin keine Stallmagd. Mein Gehirn arbeitet normal. Ich bin ganz kalt, Valmont. Mein Leben Mein Tod mein Geliebter.«7
Hier eroffnen sich mehrere Biihnen der Aktion wie der Imagination,
die ineinander spielen, zusammengehoren, aber sich nicht decken.
Stolz und mit souveraner Gelassenheit sitzt Marianne H o p p e in ihrem
Stuhl und bewegt sich - zumal bei spateren Auffiihrungen - kaum
mehr iiber die Biihne. Damit erscheint ihr Spiel reduziert, beschrankt
auf Mimik, Gestik der Hande, Sitzhaltung und Sprechweisen. Biihnen-
arbeiter tragen die auf ihrem Sessel thronende H o p p e bei ihren Auf-
tritten beziehungsweise Abgangen herein und hinaus. Dieses Spiel als
ein reduziertes zu beschreiben, impliziert jedoch keine Einschrankung,
7 Heiner Miiller, »Quartett«, in: Drucksache 7, hg. vom Berliner Ensemble, Berlin 1994, S. 260 f.

Imperfekt 203
keine Abwertung, sondern eine Differenzierung: Das Spiel der Hoppe kann als eine Asthetik des Aufmerkens auf Randstandiges, Minimales, vermeintlich Nebensachliches prazisiert werden. Eine abfallige Hand-bewegung, ein leichter Augenaufschlag, eine unmerklich veranderte Intonation werden plotzlich auffallig, gewinnen asthetische Qualitat und Bedeutung. Dieses Aufmerken aufs Detail, das sich nicht umstandslos in Sinn iiberfiihren lasst, und die damit verbundene Asthetik des Nicht-Verstehens (Hans-Thies Lehmann) gewinnen aus einzelnen Szenen und Wahrnehmungsangeboten Spuren von Signifikanz, die kein klassisches Tableau des Sinns ergeben, die sich nicht in eine chrono-logisch geord-nete Geschichte fiigen, die jedoch Verkniipfungen, Verdichtungen, As-soziationen anstofien, in die das wahrnehmende Subjekt eingebunden ist, als deren Teil es sich erlebt. So riicken die zahllosen Falten im Ge-sicht der Hoppe als (un)erforschbare Landschaft des Lebens ins Blick-feld der Aufmerksamkeit, steht der eingeschrankt mobile, fragile Kor-per in seinem phanomenalen So-Sein als Bezeugung und Zeuge eines ganzen Jahrhunderts. Was die neunzigjahrige Marianne Hoppe in der Q^^rte^r-Inszenierung ausspielt, ist die Autoritat von Erfahrung, die Voraussetzung fiir das Spiel ist und dieses zugleich iibersteigt.
Auch das >Nederlans Dans Theater 3<, die Kompanie fiir altere Tanze-rinnen und Tanzer, spielt so souveran wie ironisch mit der Verganglich-keit und Sterblichkeit des menschlichen Korpers. Angesichts der Pro-fessionalitat und Leistungsdichte des heutigen Tanzes ist unbestreitbar, dass es Grenzen des Korpers und seiner Moglichkeiten gibt, die von den Tanzerinnen und Tanzern bestandig verschoben werden, die im Tanz zugleich aber auch besonders akzentuiert hervortreten. So sind beispielsweise extreme Sprung- und Hebefiguren oder auch langes Tan-zen auf der Spitze mit zunehmendem Alter zusehends schwieriger.
Auch hier suggeriert unsere auf Leistung, Muskelkraft und Perfek-tion getrimmte Gesellschaft, dass der Alterungsprozess sich einzig als Abfolge kleinerer oder grofierer Verluste darstellt, als Einschrankung und Verminderung des individuellen Bewegungsspektrums. Die Insze-nierungen des >Nederlans Dans Theater 3< verwerfen diese Sichtweise nicht grundlegend, doch sie thematisieren mittels ironischer Perspek-tivverschiebungen andere Dimensionen des Alterns und der damit ver-bundenen Veranderungen. So liegen in der Choreografie mit dem viel-deutigen Titel »A Way A Lone / to somebody no longer here« (1998) drei Tanzerinnen und Tanzer am Boden, vollfiihren mit Armen und

204 Doris Kolesch
Beinen Greif- und Springbewegungen, roUen und rutschen iiber den Boden. Dabei werden sie per Video von oben aufgenommen, und der Film wird so auf eine iiber der Biihne hangende Leinwand projiziert, dass man den Eindruck gewinnt, sie liefen plotzlich die Wande hoch und an der Decke entlang. Das ist natiirlich ein ironischer Kommentar auf den klassischen Tanz und sein Bestreben, die Gesetze der Schwer-kraft zu iiberwinden. Zugleich aber ist es eine Bestatigung und gewitzte Uberschreitung der Vorstellung des alten, an den Boden gefesselten, ein-geschrankten Korpers. Die Tanzerinnen und Tanzer liegen am Boden: nicht blofi Zeichen, sondern konkrete Vorfiihrung des schweren, erd-verbundenen, von zahlreichen Beschrankungen betroffenen Korpers; gleichzeitig aber sprengen sie korperliche Begrenzungen, iiberlisten sie Raum und Zeit, werden schwerelos - und zwar in einer Art, dass das Publikum bisweilen nicht mehr weifi, welches nun der videoprojizierte und welches der reale, leibhaftige Korper ist, was hier schattenhaft-ein-gebildete und was reale raumliche Grenzen sind.
Gegen beide hier nur kursorisch angefiihrten Beispiele konnte man ein-wenden, dass in ihnen Alter, Gebrechen oder korperliche Einschran-kungen durch individuelle Vermogen und spezifische Techniken wett-gemacht wiirden. Marianne Hoppe fasziniert und bannt den Blick durch Disziplin und personliche Ausstrahlung; >Nederlans Dans Theater y fiihrt die Lust an der Bewegung und die Uberlistung korperlicher Grenzen mittels einer gelungenen Interaktion von Korpertechnik und moderner Medientechnik vor. AbschlieiSen mochte ich daher mit dem italienischen Theaterensemble Societas Raffaello Sanzio, bei dessen In-szenierungen Einwande wie die oben angefiihrten - wie unzutreffend auch immer sie sein mogen - voUends ins Leere laufen.
Welche Korper haben bei den Auffiihrungen der Societas Raffaello Sanzio ihren Auftritt? Ein alter, dem Tode naher Mann, der nicht ge-brechlich wirkt, sondern wirklich gebrechlich ist, bewegt sich zitternd und tastend, gefiihrt von einem jiingeren, iiber die Biihne. Ein fettleibi-ger, schier iiberquellender Korper, der die menschliche Form hinter sich zu lassen scheint, sitzt nackt, nur ein Tuch iiber sein Geschlecht gelegt und eine Strumpfmaske iiber sein Gesicht gezogen, auf einem Schemel, der auf Grund der Korperfiille des Akteurs wie ein Kinderstiihlchen wirkt. Das Publikum sieht einen Korper in seinem gewaltigen, realen So-Sein und fiihlt sich unwillkiirlich an die Korperdarstellungen von Francis Bacon erinnert, in dessen Gemalden die Figuren ebenfalls aus

Imperfekt 20 5
den Bildern und aus dem Rahmen quellen. In der Orestea (1995) tritt ein Kleinwiichsiger als Konig Agamemnon auf, und Apoll, der Gott des Lichtes, der Reinheit und der Vollkommenheit, wird von einem Schauspieler verkorpert, der keine Arme hat und dessen Schultern in kurzen, hand- und fingerlosen Armstiimpfen auslaufen. Der lebendige Korper wirkt wie eine griechische Skulptur, wie ein »Archaischer Torso Apollos«,^ den nicht nur Rainer Maria Rilke als Inbegriff des Schonen, Mafivollen und zugleich mafilos EindringUchen besungen hat: »denn da ist keine Stelle, / die dich nicht sieht. Du mu6t dein Leben andern.« Die hyperbohsche Prasenz der Korper in den Inszenierungen der Societas Raffaello Sanzio drangt den Zuschauern ihren Schmerz, ihr Leid, ihre Anstrengung, ihre Versehrtheit und ihre je eigene, von der NormaUtat abweichende KorperHchkeit auf. Die schiere Physis fasziniert oder er-schreckt, wirkt anziehend oder auch abstofiend, noch bevor und lange nachdem mogUche Deutungs- und Erklarungsansatze den Schock die-ser Begegnung zu mildern suchten. Diese verstorenden Korper fiihren vor, dass nicht die perfekte Schonheit Gegenstand von Theater ist, son-dern die Schonheit des Scheiterns, die Tragik des ungliickhchen Helden, nicht des gliicUichen. Doch die Inszenierungen der Societas Raffaello Sanzio bieten nicht nur einen Rahmen, in dem die verstiimmelten, verletzten und versehrten Korper der (Laien-)Schauspielerinnen und Schauspieler vor Schonheit geradezu gliihen und blenden, in dem sie - vielleicht zum ersten Mai - als Korper wahrgenommen werden kon-nen, die nicht durch einen Mangel (an Schonheit, Funktionsfahigkeit, Gesundheit, Vitalitat etc.) gekennzeichnet sind, sondern durch einen Exzess an Korperlichkeit, ein Ubermafi von Sinnlichkeit.^ Die Inszenierungen fiihren auch gegen die Ideologic der totalen Machbarkeit und Formbarkeit den Index der Differenz, der Geschichtlichkeit und Sterblichkeit des Korpers mit sich. So spricht in Giulio Cesare (1997) ein kehlkopfoperierter Schauspieler den grofien Monolog des Anto-nius. An der Stelle des Kehlkopfs tragt der Akteur ein kleines punkt-formiges Mikrofon, ein schwarzes Mai, das seine aufierst miihsamen, fast stimmlosen Artikulationen scheppernd verstarkt. Die Tone, Gesten und Bilder einer Beschadigung, einer Verletzung und Verwundung des Korpers exponieren ein irritierendes Skandalon. Asthetische Fas-
8 Rainer Maria Rilke, »Der neuen Gedichte anderer Teil«, in: ders., Werke, Band I-2, Frankfurt am Main 1984, S. 313. 9 Vgl. hierzu auch Romeo Castellucci / Chiara Guidi / Claudia Castellucci, Epopea dellapolvere: II teatro della Societas Raffaello Sanzio 1992-1999, Mailand 2001.

2o6 Doris Kolesch
zination und korperliche Devianz, poetische Schonheit und leibliche Versehrtheit fliefien hier ineinander, erzeugen gleichermafien Szenerien des Alptraums wie des Traums und provozieren in ihrer januskopfigen Gebrochenheit Erfahrungen von sinnlicher Intensitat und Prasenz.
Gesteigert wird dieses Zusammenspiel von Sinnlichkeit und Sinn noch durch die beiden magersiichtigen Schauspielerinnen, die im zwei-ten Teil von Giulio Cesare Brutus und Cassius darstellen. Denn sie verkorpern eine Asthetik der anschaulichen, Fleisch gewordenen Para-doxie: Die magersiichtigen Korper, die nur noch eine Reduktion, ein Schatten der Idee von einem Korper zu sein scheinen, die sich im Wort-sinne im Verschwinden befinden, sich ihrer korperHchen Schwere ent-ledigen, tun dies auf spektakulare Weise, durch einen Exzess des Sicht-baren. Diese Korper fiihren das Unmoghche vor, namhch die Utopie, ebenso sehr und zugleich Fleisch wie Idee, Prasenz wie Reprasentation zu sein. Antonin Artaud hatte diesen Schauspielerinnen zweifellos einen bevorzugten Platz in seinem Theater der Grausamkeit eingeraumt, da sie - wie auch die anderen von mir erwahnten Schauspielerinnen und Schauspieler, Tanzerinnen und Tanzer - das Theater als Spielfeld des Moglichkeitssinns erkunden. Und entgegen der instrumentalisierenden Vereinnahmung des Moglichen in den Diskursen der Okonomie, der Werbung und der Massenmedien vergegenwartigen diese anderen Korper auf den Biihnen des Theaters, dass das Ausloten und Erweitern von Grenzen immer mit existenziellem Einsatz spielt. Als Bedingung so-wohl fiir die Sehnsucht nach Perfektion als auch fiir das konstitutive Imperfekt des Menschen kommen so seine Fragilitat und jegliche Norm Liigen strafende Diversitat, seine Sterblichkeit und Verganglichkeit in den Blick, die wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen zunehmend ausblenden, wegschieben und ignorieren beziehungsweise in eigens da-fiir geschaffenen Raumen ghettoisieren.

7.U den Autorlnnen
Horst Bredekamp, geb. 1947, Professor fiir Kunstgeschichte an der Humboldt-Universitat zu Berlin, leitet am Helmholtz-Zentrum fiir Kulturtechnik das Projekt »Das Technische Bild«. Veroffent-lichungen (Auswahl): Thomas Hobbes Visuelle Strategien. Der Leviathan: Das Urbild des modernen Staates, Berlin 1999. Sankt Peter in Rom und das Prinzip der produktiven Zerstorung: Ban und Abbau von Bramante bis Bernini, Berlin 2000. Die Fenster der Monaden: Gottfried Wilhelm Leibnizs Theater der Natur und Kunst, Berlin 2004. Herausgeber (mit Gabriele Werner) von Bildwelten des Wissens: Kunsthistorisches Jahrbuch der Bildkritik, Berlin 2003 ff.
Lorraine Daston, geb. 1951, Direktorin des Max-Planck-Instituts fiir Wissenschaftsgeschichte, Berlin, Honorarprofessorin am Seminar fiir Kulturwissenschaften, Humboldt-Universitat zu Berlin. Ver-offentlichungen (Auswahl): Wunder, Beweise und Tatsachen: 2ur Geschichte der Rationalitdt, Frankfurt am Main 2001. Bine kurze Geschichte der Aufmerksamkeit, Miinchen 2001. Mit Peter Gali-son, »Das Bild der Objektivitat«, in: Peter Geimer (Hg.), Ord-nungen der Sichtbarkeit: Fotografie in Wissenschaft, Kunst und Technologie, Frankfurt am Main 2002, S. 29-99.
Jose van Dijck, geb. i960. Professor of Media and Culture at the University of Amsterdam, chair of the Mediastudies department. Ver-offentlichungen (Auswahl): Manufacturing Babies and Public Consent^ New York 1995. ImagEnation: Popular Images of Genetics, New York 1998. The Transparent Body: A Cultural Analysis of Medical Imaging, Seattle 2004.
Sander L. Gilman, geb. 1944, Professor of the Liberal Arts and Medicine, Universitat IlUnois, Chicago, Gastprofessor fiir Vergleichende
207

208 7.U den Autorlnnen
Literaturwissenschaft an der Universitat Oxford und Honorar-professor der FU Berlin. Veroffentlichungen (Auswahl): Making The Body Beautiful: A Cultural History of Aesthetic Surgery, Princeton 1999. The Case ofSigmund Freud: Medicine and Identity at The Fin De Siecle, Baltimore 1993. Freud, Race and Gender, Princeton 1993.
Jorg Huber, geb. 1948, Professor fiir Kulturtheorie an der Hochschule fiir Gestaltung und Kunst Zurich, Leiter des Instituts fiir Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) sowie der Interventionen. Veroffentlichungen (Auswahl): »Gestaltung Nicht Verstehen: An-merkungen zur Design-Theorie«, in: Juerg Albrecht / Jorg Huber u. a. (Hgg.), Kultur Nicht Verstehen, Zurich / Wien / New York 2005 (= T:G 4). »Affekte und der schone Schein«, in: Herme-neutische Blatter 1/2 (2004). »Bilder zwischen Wissenschaft und Kunst«, in: Festschrift des Schweizerischen Instituts fiir Kunstwis-senschaft ZUrich, Zurich 2001.
Doris Kolesch, Professorin fiir Theaterwissenschaft an der FU Berlin. Veroffentlichungen (Auswahl): Herausgeberin (mit Sybille Kramer) von Stimme/n: Interdisziplindre Anndherung an ein Phdno-men, Frankfurt am Main (im Druck). Herausgeberin (mit Erika Fischer-Lichte und Matthias Wartstat) von Lexikon Theater-theorie, Stuttgart (im Druck). Buhnen des Begehrens: Studien zur Theatralitdt und Performativitdt von Emotionen (Habilitations-schrift, Drucklegung in Vorbereitung).
Albrecht Koschorke, geb. 1958, Professor fiir Deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Universitat Konstanz, Einrichtung der Forschungsstelle »Kulturtheorie und Theorie des politischen Imaginaren«. Veroffentlichungen (Auswahl): Kor-perstrome und Schriftverkehr, Miinchen 1999. Die Heilige Fami-lie und ihre Folgen, Frankfurt am Main 2000. Des Kaisers neue Kleider: Uber das Imagindre politischer Herrschaft, Frankfurt am Main 2002 (Mitverfasser).
Marie-Jose Mondzain, geb. 1942, Directrice de recherche au C.N.R.S., Groupe de Sociologie Politique et Morale. Veroffentlichungen (Auswahl): Uimagepeut-elle tuer?, Paris 2002. Le Commerce des Regards, Paris 2003. Voir Ensemble: Quelque voix autour dejean Toussaint Desanti, Paris 2003.
AnneNigten, geb. 1964, Kiinstlerin, Forscherin, Dozentin, Autorin; Lei-terin des V2_Lab, des aRt&Development Department der V2_

7.U den Autorlnnen 209
Organisation in Rotterdam; Content Manager des European Network for Cyber ART (EncART). Veroffentlichungen (Auswahl): »Tools and artistic software*, in: Andreas Broeckmann / Susanne Jaschko (Hgg.), Do it Yourself! Art and Digital Media: Software I Participation / Distribution, Berlin 2001. Schema's Diagrams and Flowcharts by Artists, Engineers and Computer Scientists: Proceedings I SEA 2002, nth International Symposium on Electronic Art, Nagoya 2002. Human Factors in Multi- and Interdiszi-plinary Collaborations: Good practice Guide, Radical Workshop, London 2003.
Martin Warnke, geb. 1955, Akademischer Direktor, Universitat Liine-burg, Rechen- und Medienzentrum, Each Kulturinformatik; Ar-beitsschwerpunkte: Digitale Medien, Dokumentation Bildender Kunst mit digitalen Medien, Mitveranstalter der »HyperKult«-Tagungsreihe. Veroffentlichungen (Auswahl): »Der Raum des Cyberspace«, in: Eriedrich Brandi-Hinnrichs u. a. (Hgg.), Rdume riskieren, Hamburg 2003, S. 271-294. »Bilder und Worte«, in: Wolfgang Ernst u.a. (Hgg.), Suchbilder, Berlin 2003, S. 57-60. »Virtualitat und Interaktivitat«, in: Ulrich Pfister (Hg.), Metzler Lexikon Kunstwissenschaft, Weimar 2003, S. 369-372.





![[Karl Jaspers (Auth.)] Psychologie Der Weltanschau](https://static.fdokument.com/doc/165x107/577c791a1a28abe05491735f/karl-jaspers-auth-psychologie-der-weltanschau.jpg)
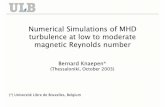






![[Camillo Sitte (Auth.)] Der Städte-Bau Nach Seine(BookZZ.org)](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5695d2df1a28ab9b029c086e/camillo-sitte-auth-der-staedte-bau-nach-seinebookzzorg.jpg)





