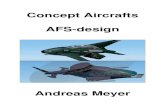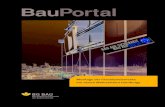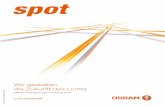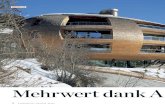Futuristische Brücke Von der Vision zur Realität Medienbrücke München 1.
Konstruktiver Holzbau – Futuristische „Gartenlaube“ · 2019-10-11 · BauPortal 7/2019...
Transcript of Konstruktiver Holzbau – Futuristische „Gartenlaube“ · 2019-10-11 · BauPortal 7/2019...

ISSN 1866-0207 6693 Oktober 2019 7
Straßenbautechnik – Die ASR A5.2 „Straßenbaustellen“ ist daBau digital – BIM im StraßenbauBaumaschinentechnik – „Stand der Technik bei der Verwendung“
– Die neue TRGS 554 „Abgase von Dieselmotoren“Arbeits- und – Neue Europäische PSA-VerordnungSchutzkleidung / PSA – Hautschutz in der Gebäudereinigung
Konstruktiver Holzbau –Futuristische „Gartenlaube“

Heft 7 • 131. Jahrgang • Oktober 2019Fachzeitschrift der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Titelbild:Der Aussichtsturm des Bauwerks auf dem ehemaligen Gelände des Hauptgüter- und Rangierbahnhofs imEuropaviertel Frankfurt/Main besteht ausHolz und ist wie der Rest des Gebä�udesmit einer Lä�rchenschalung versehen(Foto: Holzbau Kappler)
Inhalt:Konstruktiver Holzbau – Futuristische „Gartenlaube“ ........................................................ 2
Rund um die BG BAU ....................................................................................................................... 6
AKTUELLES• WorldSkills 2019 ........................................................................................................................... 8
Ingenieurbau / Bauorganisation• Ergebnisse Braunschweiger Baubetriebsseminar 2019 ................................................. 10• Kompetenz für eines der weltweit größten Brückenprojekte ...................................... 12• Gemeinsames Schalungskonzept überzeugte .................................................................. 14• Kalottenlager aus München für die 5 km lange Bogibil-Brücke .................................. 16
Straßenbautechnik• Geklebter Bypass – Kreisverkehrsplatz mit Klebebordsteinen realisiert ................... 17• Die ASR A5.2 „Straßenbaustellen“ ist da – und was jetzt? ............................................. 18• Innovativer Belag auf der B1 in Geltow ............................................................................... 22
Bau digital• BIM im Straßenbau – Drittes Positionspapier des HDB ................................................. 24• Wegweiser durch die komplexe BIM-Methode – Neue VDI-Richtlinie ...................... 25
Baumaschinentechnik (Bagger, Lader)• „Stand der Technik bei der Verwendung“ – Beschaffenheit von Maschinen .......... 26• Die Landesgartenschau 2020 entsteht ................................................................................ 29• Intelligente Assistenzsysteme für Radlader ....................................................................... 30• Die neue TRGS 554 „Abgase von Dieselmotoren“ – Was hat sich geändert? .......... 32
Verdichtungstechnik / Erdbau• Tiefenverdichtung für Dubais Hafen .................................................................................... 37• Arbeitsraumbreiten im Kanal- und Rohrleitungsbau ..................................................... 38• Verdichtungsprojekt in Kenia / Bahndammsanierung per MIP-Verfahren ............. 40
Abdichtungstechnik / Bautenschutz / Bauchemie• GISCODE für Beschichtungsstoffe ......................................................................................... 42• Schutz vor Einsturzgefahr – Verfüllbaustoff ...................................................................... 45• 30.000 m2 Tunnelflächen abgedichtet ................................................................................. 46• Luftdichtheit bei der Dachsanierung von außen .............................................................. 48
Arbeits- und Schutzkleidung / PSA• Möglichkeiten des orthopädischen Fußschutzes und der Kostenübernahme ...... 50• Neue Europäische PSA-Verordnung – Beispiel Gehörschutz ........................................ 53• Schutzhandschuhe – Änderungen durch neue europäische PSA-Verordnung ...... 54• Hautschutz in der Gebäudereinigung .................................................................................. 58
Über den Bauzaun geschaut• Wenn Uhren vorwärts und rückwärts zugleich gehen: Arbeitsschutz in Afrika ... 61
Recht• Brandschutz auf Baustellen – Vorschriften und Regelwerk .......................................... 65• Stichwort Recht – Verschiedene Gerichtsurteile ............................................................... 66
Fachbereich Bauwesen – Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test ...................... 68
Mitteilungen aus der Industrie ...................................................................................... 23, 31, 41
Veranstaltungen ............................................................................................................................... 69
Buchbesprechungen ....................................................................................................................... 70
Impressum .......................................................................................................................................... 72
www.bgbau.dewww.BauPortal-digital.deRedaktion: [email protected]
Erscheinungsweise:8 Ausgaben im Jahr 2019:1 (Januar) 5 (Juli)2 (März) 6 (September)3 (April) 7 (Oktober)4 (Juni) 8 (Dezember)
Beilagenhinweis:Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der id Verlags GmbH, 68161 Mannheim, bei.Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Ingenieurbau / Bauorganisation BauPortal 7/20192
Das Gebäude – ein kühner Entwurf desFrankfurter Architekten-Teams FrankenArchitekten – zeigt, wie flexibel der Sys -temholzbau ist und stellt eine willkom-mene Abwechslung zum konventionellenMassivbau dar. Das unkonventionell ge -baute Holzgebäude entstand am Randedes neu entwickelten Europagartens derFrankfurter City. Errichtet wurde das Bauwerk von der Manufaktur Kappler, Mitglied der deutschlandweit aktiven ZimmerMeisterHausGruppe.
Grundidee: Holzbauwerk mit drei Flügeln Das dreiflügelige Holzbauwerk zeigt eineknifflige Bauaufgabe, die den Holzbau in die Zukunft transportiert – spannendmit ausgefallenem Grundriss und extra-vaganter Höhe. Geschickt hat der verant-wortliche Architekt Prof. Bernhard Franken den multifunktionalen Pavillon als mo-derne Gartenlaube auf das 1.174 m2
große Grundstück geplant. Jeder Flügeldes 448 m2 großen Gebäudes bietet seineganz eigene Besonderheit: das Lauben-esszimmer, das Laubenwohnzimmer undden markanten Turm. Vor allem letzterersticht durch seine Form hervor. Die poly-
gonale Form des Turm-Baukörpers ist imGrundriss als Fünfeck ausgebildet undweist in seiner gesamten Ausgestaltungkeinen einzigen rechten Winkel auf. ImLauben esszimmer befindet sich der bar-rierefrei gestaltete Gastronomiebereich,die Tagungsräumlichkeiten sind im drittenGebäudeflügel untergebracht.
Hohe Ansprüche hinsichtlichBelastbarkeit und BauzeitDie Manufaktur Holzbau Kappler aus Gackenbach errichtete den Holzrohbaumit Restaurant, Terrasse und Aussichts-turm innerhalb von 4 Wochen. Mit derFachplanung betraute man die erfahrenen
Dieser außergewöhnliche Solitär, errichtet im Herzen von Frankfurt am Main, ist ein besonders beeindruckendes Beispiel für konstruktive individuelle Holzbauten. Das Gebäude mit unbehandelter Lärchenholz-Fassade und markantem16 m hohen Aussichtsturm prägt das wachsende Europaviertel auf dem ehemaligen Gelände des Hauptgüter- und Rangierbahnhofs. Im dreiflügeligen Bauwerk gibt es eine Tagungslounge und ein Restaurant. Mit einer futuristischenArchitektur geht der Holzbau hier neue Wege.
Abb. 1: Grundriss Erdgeschoss (Quelle: Franken Architekten)
Konstruktiver HolzbauFuturistische „Gartenlaube“ mit Ausdehnung im Horizontalen und Vertikalen
Eva Mittner, Isen

BauPortal 7/2019 Ingenieurbau / Bauorganisation 3
Holzingenieure von Pirmin Jung Deutsch-land GmbH. Der Aufbau dieses besonderen Bauwerkswar nicht einfach: Die Montage er folgtemit Hubsteigern – ohne Gerüste – in einerArbeitshöhe von 18 m. Entsprechend wich-tig war die passgenaue und präzise Vor-fertigung der Holzelemente. Dadurch, dass die Stahlbau-Werkstattplanung auchin der Zimmerei ausgeführt wurde undder Holzingenieur montagetaugliche An -schlussdetails berücksichtigte, gelang dieMontage ohne Nacharbeiten.Bei der aufgebauten Fassade handelt essich um eine sägeraue Keilstülpschalungaus unbehandelter heimischer Lärche. Diesonst unübliche Verwendung von schma-
len und breiten Brettern macht die Fas-sade feingliedriger, abwechslungsreicherund unterstützt die skulpturale Wirkungdes Gebäudes. Trotz anfänglicher Skepsiswaren die Beteiligten überrascht, welchepositive Wirkung durch diese einfacheVariante erzielt werden konnte.Die Außenwände sind in Holzständerbau-weise angelegt und wurden von außennach innen aufgebaut. Begonnen wurdemit der Keilstülpschalung, dann folgte dieLattung, die DWD-Platte und das Ständer-werk. Als Dampfbremse wurden OSB/4-Platten eingesetzt. Den Abschluss bildetenGipsfaserplatten. Der diffusionsoffene Wandaufbau schafftzusammen mit der Zellulose-Dämmung
ein hervorragendes Raumklima. Als tra-gende und aussteifende Beplankung desDaches und der Wände wurden die er -wähnten OSB/4-Platten verwendet. AlleAusbauarbeiten konnten ohne Risiko und zügig durchgeführt werden. Die Ge -samtstärke der Außenwand beträgt etwa415 mm.Wesentlich komplexer war hingegen dieAussteifung des Turms: Hier setzte manauf ein Zusammenspiel aus den geschlos-senen Holztafelelementen und den ge -schweißten Treppenläufen aus Stahl. InLängsrichtung übernehmen die Holztafel-wände die Aussteifung, in Querrichtungwurden zwischen die Holztafeln die ca.1,20 m hohen Handläufe als Fachwerk-träger dazwischengesetzt. Im Bereich derTreppenpodeste selbst baute man nochStahlrundrohrstreben ein, um ein Verwin-den des Turmes zu vermeiden.
Abb. 2: Querschnittder gesamten Anlage(Quelle: Franken Architekten)
Abb. 3: Vorgefertigte Holzbauelemente Abb. 4: Aufbau der Holzelemente mit Hubsteigern Abb. 5: Komplexe Turmaussteifung
Wandaufbau von außen nach innen auf einen Blick29/14 mm Keilstülpschalung40/60 mm Lattung, e = 62,5 cm16 mm dampfdiffusionsoffene undwinddichte Wand- und Dachplattenunterhalb der Konterlattung (DWD-Platten)Ständerwerk aus KVH, 240 mm Zellulose-Dämmung WLG 04015 mm OSB/4-Platte als Dampfbremse(OSB = oriented strand board bzw. oriented structural board = Grobspanplatte)40 mm Dämmung WLG 040 (Installationsebene) in 50 mm CW-Profil2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte

Ingenieurbau / Bauorganisation BauPortal 7/20194
Statische BesonderheitenDie Stromerzeugungs- und Küchenaggre-gate für das Restaurant ließ man platz-sparend auf dem Dach positionieren undverkleidete die gesamte Technik mit einerdurchlüfteten Leistenverschalung aus Lär-chenholz. Die robuste Verkleidung lässtsich in Einzelsegmenten jederzeit zur Revi-sion öffnen. Allerdings konnte erst vor Ortentschieden werden, wie die Geräte platz-sparend eingebaut werden. Das war nichtganz einfach zu lösen, weil das enormeGewicht der Geräte von insgesamt 1,5 tstark auf das schlanke Tragwerk einwirkt.Mit dem Kran wurden die Küchenaggre-gate auf das Dach gehoben. Dort musstenoch koordiniert werden, wo sie bezüg-lich der Statik positioniert werden sollen.Erst in der Detail-Abstimmung mit demStatiker konnte der beste Platz auf demDach gefunden und die Geräte endgültigplatziert werden. Durch die entsprechenddimensionierten Unterzüge in GL32c istsichergestellt, dass übermäßige Verfor-mungen die darunter liegende Konstruk-tion nicht beschädigen. Für das Restaurant und den Besprechungs-bereich errichteten die Experten massiveBrettstapeldecken. In regelmäßigen Ab -
ständen befinden sich in den Deckenzusätzliche Akustik-Elemente mit Reso-nanzhohlräumen.Basis ist die Betonsohle, auf der die Holz-wände mit konventionellen Ankern undSchweißteilen aus Stahl befestigt wurden,welche die Verbindung aller Holzteile mit-einander sicherstellen. Ein Teil des Beton-bodens kragt über den darunter befind-lichen U-Bahn-Schacht aus, damit keineLasten darauf einwirken können.
Warum Holzbau?Durch die Nachhaltigkeitsdebatte, dieFähigkeit komplexe Geometrien herzu-stellen, den Facharbeitermangel auf den Baustellen und die attraktiven Kosten hatdas Bauen mit Holz eine große Zukunft.Die modernen Holzbautechnologien, Ma -terialien und Planungsprozesse machenHolzbau zu einem leistungsfähigen Bau-sys tem. Denn beim Holzbau kann das spezielle System der Arbeitsvorbereitung zum Tragen kommen: So war die ZimmerMeisterHaus-Manufaktur Kappler für diegesamte Werkstattplanung verantwort-lich und gewährleistete eine exakte Ab -stimmung und Koordination zwischen
allen Planungsbeteiligten. Dabei waren dieKonstruktionspläne und Werkstattzeich-nungen wichtige Einzel-Bestandteile inder Kette des Planungs- und Herstellungs-prozesses für Holzbauwerke. Schon nach10 Wochen konstruktiver Detailplanungund anschließender Fertigung in derManufaktur konnte man den Plan für Logistik und Montage definieren. Alle Bau-elemente wurden in CAD/CAM-gestütz-ten Arbeitsprozessen und CNC-Anlagenhergestellt, welche die professionelle Kon-struktion und Fertigung der Bauteile ge -währleisten. Auf der Baustelle ließ sich soalles binnen sehr kurzer Zeit zusammen-fügen.
Das Vorelementieren von Bauteilen beimHolzbau verkürzt nicht nur die Bauzeit,sondern unterstützt durch die kurze Ein-bauzeit und das Entfallen von Arbeits-schritten auch ein sichereres Arbeitenbeim Bau.
Zudem bietet der Holzbau auch Vorteile inenergetischer Hinsicht. Der ausgeführteWandaufbau in diesem Holzgebäude trägtnicht nur ein gutes Raumklima, sondernauch zur Energieeffizienz bei. Der durch-schnittliche U-Wert der Gebäudehülleliegt bei 0,18 W/m2*k und liegt somit
Abb. 8: Das Restaurant ist barrierefrei zugänglich
Abb. 7: Das dreiflügelige Gebäude zeigt die Flexibilität des Holzbaus (Foto: © Eibe Sönnecken)
Abb. 9: Rahmen für Veranstaltungen: der Besprechungsbereich
Abb. 6: Haustechnische Leitungen befinden sich in derWandkonstruktion

BauPortal 7/2019 Ingenieurbau / Bauorganisation 5
deutlich unter der damaligen EnEV-An-forderung von 0,35 W/m2*k. Und letzt-endlich bindet das Gebäude als Holzkon-struktion dauerhaft CO2 und zeigt eine dervielen Möglichkeiten für das Bauen mitHolz im städtischen Umfeld. Die aktuelleEntwicklung zeigt, Holz in der Stadt ist auf dem Vormarsch und hat eine großeZukunft.
Passgenau arbeiten – Sicherheit beim Aufbau zählt Vor Baubeginn der Arbeiten wurde – wiebei allen Bauvorhaben dieser Art – eineausführliche Gefä�hrdungsbeurteilung vor-genommen sowie detaillierte Montage-anweisungen erstellt. Wichtig war es, zujeder Jahreszeit und für jeden Einsatzsicher aufbauen zu können.
Die Aufstellung erfolgte bei diesem Bau-vorhaben durch das ausführende Unter-nehmen Holzbau Kappler und mit Unter-stützung einer externen Firma für Arbeits-schutz.
Auf der Grundlage der Ergebnisse wurdezudem die Einhaltung staatlicher Regeln
zum Arbeitsschutz und zu den berufsge-nossenschaftlichen Unfallverhü�tungsvor-schriften geprüft. Als Ergebnis sind ent-sprechende Schutzmaßnahmen festzu-legen. Sichere Standplätze, z.B. Arbeits- undSchutzgerüste für Dach- und Fassaden-arbeiten, wurden vor Montage der Holz-baukonstruktion aufgestellt sowie Sche-renarbeitsbühnen als bewegliche Schutz-einrichtungen vorgehalten. So konnten diebeteiligten Experten trotz der enormenHöhe sicher und zügig arbeiten.
Ein großer Vorteil für die bevorstehendenArbeiten war, dass die kompletten Holz-bau-Elemente bei Holzbau Kappler bzw.die Fenster im Werk vorelementiert wur-den. Verschiedene Gefahrensituationenkonnten somit gar nicht erst entstehen –da sich die Aufbauzeiten enorm verkürzen.
Alle nicht anders gekennzeichneten Abbildungen: Holzbau Kappler
Autorin: Eva MittnerFreie Baufachjournalistin
Abb. 13: Spektakuläre Architektur in Holz
Abb. 10: Aussichtsturm, Tagungs-Lounge und Restaurant
Abb. 12: Ausblicke auf die City gibt es von vielen Stellen aus
Abb. 11: Von jeder Warte aus betrachtet: Nicht alltäglich
ZimmerMeisterHausDie ZimmerMeisterHausGruppe® ist eine Vereinigung von bundesweit mehr als 100 Holzbau-Manufakturen. Regional selbstständig und unabhängig realisieren die ZimmerMeisterHaus-Manufakturen jährlichmehr als 2.000 Bauprojekte im Bereich Neubau und Anbau sowie Aufstockung und Objektbau. Seit der Gründung 1987 wurden mehr als30.000 Häuser gebaut. Mehr Informationen gibt es unter www.zmh.com und www.holzbau-kappler.de

Seite 3
Rund um die BG BAU
Die BG BAU informiert BauPortal 7/20196
Das Thema „Absturzsicherheit“ geht jedenetwas an. Während der Planungs- undBauphase spielt es ebenso eine tragendeRolle wie im Betrieb des Gebäudes. Vorallem Planer, Bauunternehmer, Handwer-ker und Facility Manager sind angespro-chen, sich mit diesem (lebens-)wichtigenThema auseinanderzusetzen. Abstürzesind die Ursache für knapp die Hälfte allertödlichen Arbeitsunfälle in der Bauwirt-schaft. Insgesamt verloren 2018 88 Men-schen bei der Arbeit ihr Leben.
Der 4. Deutsche Fachkongress für Absturz-sicherheit bietet dementsprechend wich-tige Antworten und Denkanstöße zu fol-genden Themen: Planung der Absturz-sicherung, Absturzsicherung in der Be -triebs praxis, Services von Herstellern, Pro-dukte für Handwerker, Systeme auf derBaustelle sowie rechtliche Rahmenbedin-gungen.Der Kongress findet am 10. und 11.Dezember 2019 im Hotel Grand ElyséeHamburg statt. Die BG BAU unterstütztauch in diesem Jahr die Veranstaltung alsPartner und Impulsgeber. Prof. Dr. Marco Einhaus, Leiter des Sach-gebiets Hochbau bei der DeutschenGesetzlichen Unfallversicherung und des
4. Deutscher Fachkongress für AbsturzsicherheitDer Kongress für die ganzheitliche Betrachtung der Absturzsicherheit: Planung – Ausführung – Betrieb
Per Drohne den Dachstuhl inspizieren oderin der virtuellen Realität erleben, wie derArbeitsschutz von morgen aussieht: Beider „DACH + HOLZ INTERNATIONAL 2020“in Stuttgart präsentiert die Berufsgenos-senschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)neue Wege der Prävention und gibt denBesuchern die Möglichkeit, digital in dieWelt des Arbeitsschutzes einzutauchen.Vom 28. bis zum 31. Januar dreht sich beider Leitmesse für Holzbau und Ausbau,Dach und Wand alles um das Thema „Mit Sicherheit in die Zukunft“. Dabei setztdie BG BAU ganz auf digitalen Arbeits-schutz: Interessierte können mithilfe einerVirtual-Reality-Brille brenzlige Situatio-nen auf Baustellen hautnah erleben, Bild-schirme übermitteln das gerade Erlebtelive am Messestand. Neu entwickeltebranchenspezifische Apps zeigen, wieGefährdungsbeurteilung schnell und miteinfachen Mitteln funktionieren kann.Arbeitsschutz – digital und unkompliziert.Inhaltlich steht das Thema Absturz imFokus: Allein 2018 kam es zu 7.496 melde-pflichtigen Absturzunfällen, sie sind damitdie häufigste Ursache für schwere undschwerste Arbeitsunfälle. Um Unterneh-mer und Versicherte auf ihrem Messe-stand für sicheres und gesundes Arbeiten
zu sensibilisieren, setzt die BG BAU daherauch auf Interaktion: Anschauliche Show-Elemente demonstrieren den Besuchernlive, wie sicheres und gesundes Arbeitenan hoch gelegenen Arbeitsplätzen funktio-niert, Fachexperten geben Auskunft zuThemen rund um spannende und präven-tive Angebote. Darüber hinaus bieten sog.„Speaker Corner“ Plattformen, auf denenThemen präsentiert und neue Impulse dis-kutiert werden können. Das Ziel: mehr
Digitaler Arbeitsschutz mit Erlebnischarakter Gemeinschaftsstand von BG BAU, Holzbau Deutschland und Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks auf der DACH + HOLZ INTERNATIONAL 2020
Wissenstransfer, mehr Miteinander undmehr Interaktivität.
Die BG BAU präsentiert sich auf der DACH+ HOLZ INTERNATIONAL auf einem ge -mein samen Stand mit dem Zentralver-band des Deutschen Dachdeckerhand-werks und Holzbau Deutschland, Halle 9,Stand 323.
Weitere Informationen zur Messe:www.dach-holz.com
Foto: BG BAU/Kolja Matzke
gleichnamigen Referats bei der BG BAU,wird in seiner Eröffnungsrede in dasThema einführen. Unter anderem wird erüber die Neuerungen der Technischen
Regel für Be triebs-sicherheit (TRBS) 2121 und deren Um setzung bei Leitern und Ge-rüs ten sprechen.
Weitere Infor-mationen und das komplette Programm: www.kongress-absturzsicherheit.de

10:41 Uhr Seite 3
Rund um die BG BAU
BauPortal 7/2019 Die BG BAU informiert 7
Die BG BAU informierte vom 24. bis zum27. September 2019 auf der Messe „CMSBerlin – Cleaning.Management.Services.“über Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit. Bei der inter-nationalen Fachmes-se dreht sich alles umReinigungssysteme,G e b ä u d e m a n a g e -ment und Dienstleis -tungen. Am Standder BG BAU warendie lebenswichtigenRegeln und ihre ge -werke spezifischen Er -gänzungen zentralesThema. Unter demMotto: „Spiel hier, und nicht mit DeinemLeben“ konnten Messebesucher bei derMitmachaktion testen, wie sicher sie imUmgang mit den Regeln in typischenArbeitssituationen bei der Gebäudereini-gung sind. Begleitend zur Messe CMS Ber-lin gab es ein umfangreiches Rahmenpro-gramm „CMS-Praxisforum“, an dem auchdie BG BAU beteiligt war.
Vortrag „Die neue Branchenregel Gebäudereinigung“Karsten Oetke von der BG BAU Präventionstellte in einem Vortrag Aufbau und Inhaltder neuen DGUV Regel Gebäudereinigungvor, die konkrete Hilfestellungen bei derFestlegung von Arbeitsschutzmaßnahmenfür die Gebäudereinigungsbranche bie-tet. Sie wird daher auch „Branchenregel“ge nannt. Die Branchenregel Gebäuderei-nigung um fasst die wichtigsten Präven-tionsmaßnahmen, um die gesetzlich vor-geschriebenen Schutzziele für die Unter-nehmen und die Belegschaft zu erreichen.Sie wurde von Fachleuten der gesetzlichenUnfallversicherung, u.a. von der BG BAU,und Experten aus der Reinigungsbrancheverfasst. In erster Linie richtet sie sich an Unternehmer, bietet durch den hohenPraxisbezug aber auch großen Nutzen fürweitere Akteure in Unternehmen, etwadem Personal- und Betriebsrat, den Fach-kräften für Arbeitssicherheit, Betriebsärz-tinnen und -ärzten sowie den Sicherheits-beauftragten. Die Regel ist inzwischen inhaltlich verab-schiedet worden und wird für die Druck-legung vorbereitet. Mit der Veröffent-
lichung ist noch im Herbst 2019 zu rech-nen.
Podiumsdiskussion „Neue Anforderungen beim Einsatz von Leitern“Des Weiteren gab es eine Podiumsdiskus-sion zum Thema „Neue Anforderungenbeim Einsatz von Leitern“, die BernhardArenz, Leiter der Abteilung Prävention beider BG BAU, mit einem Eingangsstate-ment über die aktuellen Änderungen derTRBS 2121-2 eröffnete. Aufgrund desUnfallgeschehens, insbesondere durch Ab -stürze von Leitern, seien die Neuerungendringend notwendig geworden. DieseStandpunkte wurden unter den Teilneh-menden der Diskussionsrunde teilweisekontrovers kommentiert.
Bernhard Arenz betonte, dass Arbeiten vonLeitern nur in Sonder- also in Einzelfällenstattfinden sollten. Dies ergäbe sich ausdem STOP-Prinzip, welches die Substitu-tion in der Rangfolge vor technische, orga-nisatorische und persönliche Maßnahmen
Die BG BAU auf der CMS Berlin 2019
stellt. Auch die Forderung „Stufe stattSprosse“ folge der Notwendigkeit, Arbeits-plätze nach ergonomischen Anforderun-gen zu gestalten. Damit könnten Unter-nehmen außerdem auf eine Arbeitsweltreagieren, die angesichts des demografi-schen Wandels alternsgerecht sein sollte.Unterstützung dabei bietet die BG BAUmit ihren Arbeitsschutzprämien. Unteranderem wird die Anschaffung einer Stu-fen-Glasreinigerleiter mit 50 % der An -schaffungskosten, maximal 300 € geför-dert.
Begeisterung beim Mitmachspiel,
das am Stand der BG BAU
angeboten wurde
Karsten Oetke stellt die Branchen-regel Gebäudereinigung vor
Podiumsdiskussion: Horst Keen (Piepenbrock Unternehmensgruppe), Bernhard Arenz (BG BAU), Moderatorin Christine Sudhop (Bundesinnungs-verband des Gebäudereiniger-Handwerks), Uwe Holicka (Sachverständigerfür Steiggeräte) sowie Hartmut Lechner (ILLER LEITER) (v.l.n.r.)
Stufen-Glasreiniger-
leitern werden
als Arbeits-schutz-
prämie von der BG BAU
gefördert

Straßenbautechnik BauPortal 7/201918
Die ASR A5.2 „Straßenbaustellen“ ist da – und was jetzt?Dipl.-Ing. Horst Leisering, Neumünster
Zielstellung und AnwendungsbereichDie ASR A5.2 gilt für das Einrichten, Be-treiben und den Abbau von Arbeitsplät-zen und Verkehrswegen auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr, bei denen durch den fließenden VerkehrGefährdungen für die Beschäftigten ent-stehen können.Sie findet auch Anwendung für die dazu-gehörenden Verkehrssicherungsarbeitenund soll in allen Planungsphasen berück-sichtigt werden. Sie findet nur in den Zei-ten Anwendung, in denen Beschäftigte imGrenzbereich zum Straßenverkehr tätigwerden. Die ASR A5.2 gilt nicht für die Pannen- und Unfallhilfe sowie für Bergungs- undAbschlepparbeiten. So wie die „Richtlinien für die Sicherungvon Arbeitsstellen an Straßen“ (RSA) aus-schließlich verkehrsrechtliche Maßnah-men zur Verkehrslenkung auf Grund-lage der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)regeln, beschränkt sich die ASR A5.2 aus-schließlich auf den Schutz der Beschäftig-ten im Grenzbereich zum Straßenverkehr.
Einrichten von Arbeitsplätzenund Verkehrswegen auf StraßenbaustellenDie ASR A5.2 beschreibt, wie die Gefähr-dungen durch den fließenden Straßenver-kehr vermieden werden können (z.B. durcheine Vollsperrung) oder, wenn das nichtmöglich ist, wie diese Gefährdungen beiEinsatz von z.B. Transportablen Schutz-einrichtungen (TSE) oder Leitbaken mini-miert werden können. Dazu wird der erfor-derliche Platzbedarf der Beschäftigten(Mindestbreite „BM“) für Arbeitsplätze und Verkehrswege in verschiedenen Stan-dardsituationen beschrieben. In Abhän-gigkeit der gewählten Schutzeinrichtung(Verkehrssicherung) und der zulässigenHöchstgeschwindigkeit werden Sicher-heitsabstände (SQ, in Querrichtung zumvorbeifließenden Verkehr und SL in Längs-richtung zum ankommenden Verkehr) be -schrieben. Die Bezugslinien der Maße sindeindeutig beschrieben und somit planbar.
Können diese Mindestmaße nicht einge-halten werden, sind als Ergebnis einerdokumentierten GefährdungsbeurteilungSchutzmaßnahmen festzulegen, die min-
destens die gleiche Sicherheit und dengleichen Gesundheitsschutz für die Be -schäftigten erreichen. Wären dabei beson-dere Gefährdungen für die Verkehrsteil-nehmer infolge erheblicher Behinderun-gen bzw. erheblicher Verkehrsbelastungenzu erwarten, sind in Abstimmung mit denfür den Arbeitsschutz und den für denStraßenverkehr zuständigen Behördenstattdessen die Schutzmaßnahmen fest-zulegen, die für Beschäftigte auf Straßen-baustellen und für Verkehrsteilnehmergleichermaßen die größtmögliche Sicher-heit gewährleisten.
Da es sich bei der ASR A5.2 um eine staat-liche Regel handelt, sind mit den unterPunkt 4.3 (4) der ASR A5.2 beschriebenenfür den Arbeitsschutz zuständigen Behör-den zunächst die staatlichen Arbeits-schutzbehörden gemeint. Aufgrund desdualen Systems in Deutschland wird derArbeitsschutz aber sowohl von staatlichenBehörden als auch von den Unfallversiche-rungsträgern (Unfallkassen der öffent-lichen Hand und Berufsgenossenschaften)vollzogen. Aus diesem Grund kommt indiesem Zusammenhang den zuständigenUnfallversicherungsträgern eine gleiche
Im Dezember 2018 wurde die Technische Regel für Arbeitsstätten „Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswegeauf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr – Straßenbaustellen“ ASR A5.2 im gemeinsamen Ministerialblatt(GMBl) bekannt gemacht und damit in Kraft gesetzt. Sie ist auf der Internetseite der BAuA veröffentlicht und für alle frei zugänglich. Die ASR A5.2 konkretisiert die Arbeitsstättenverordnung beim Einrichten und Betreiben von Straßen-baustellen. Mit der vorgenommenen Bekanntmachung im GMBI entfaltet sie die Vermutungswirkung zur Einhaltung derArbStättV. Sie gilt ab sofort, es gibt keine Übergangsfristen. Gegenüber der Vorveröffentlichung vom 2.4.2014 haben sichdie Abschnitte 4.2.1, 4.3.4 und die Tabelle 3 geändert.
Abb. 1: Unzulässige Gefährdung der Beschäftigten durch fehlenden Sicherheitsabstand zum vorbeifließenden Verkehr (Quelle: BG BAU)
Abb. 2: Straßenbaustelle im fließenden Verkehr (Quelle: BG BAU)

BauPortal 7/2019 Straßenbautechnik 19
Bedeutung zu wie den für den Arbeits-schutz zuständigen Behörden. Sie sinddeshalb an derartigen Abstimmungsge-sprächen zu beteiligen.Darüber hinaus ist zu empfehlen, auchden Koordinator nach Baustellenverord-nung, Vertreter des Bauherrn sowie ge-gebenenfalls die ausführende Firma ein-zubeziehen. Hierdurch können sowohltechnische Rahmenbedingungen und Aus-wirkungen auf Koordinierungsverpflich-tungen nach Baustellenverordnung be -rück sichtigt werden.
Was ändert sich?Eigentlich nichts! Die ASR A5.2 konkreti-siert lediglich die seit Jahrzehnten gelten-den Forderungen der Arbeitsstättenver-ordnung (ArbStättV) und beinhaltet keineneuen Sachverhalte. Sie unterstützt durchMaße und Grafiken alle am Bau Beteilig-ten bei der Wahl der Schutzmaßnahmen,der Bemessung der freien Bewegungs-fläche und der Sicherheitsabstände sowieder Auswahl von Schutzvorrichtungen.
Entwurf der Handlungshilfefür das Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSAAm 27.6.2019 wurde der Entwurf der„Handlungshilfe für das Zusammenwirkenvon ASR A5.2 und RSA bei der Planung vonStraßenbaustellen im Grenzbereich zumStraßenverkehr“ auf der Internetseite derBundesanstalt für Straßenwesen (BASt)und des DGUV-Sachgebietes Tiefbau vor-veröffentlicht. Dieser Entwurf wurde ineinem Betreuerkreis, bestehend aus Ver-tretern von Straßenbau- und Verkehrsver-waltungen sowie des Arbeitsschutzes undder Bauwirtschaft, einvernehmlich verab-schiedet. Die Vorveröffentlichung gilt vor-behaltlich der noch durchzuführendenAnhörung der Straßenbau- und Straßen-verkehrsbehörden sowie der Arbeits-schutzbehörden.Der Entwurf der Handlungshilfe nimmtBezug auf die im Dezember 2018 einge-führte ASR A5.2. Ziel der Handlungshilfe ist es, die Regelun-gen der ASR A5.2 im Zusammenwirkenmit den „Richtlinien für die Sicherung vonArbeitsstellen an Straßen“ (RSA) nicht nurzu erläutern, sondern allen BeteiligtenLösungen für kritische Grenzfälle nach ASR A5.2 Kapitel 4.3 Absätze (3) und (4)aufzuzeigen, mit denen die größtmöglicheSicherheit für die Beschäftigten auf Stra-ßenbaustellen und für die Verkehrsteil-nehmer gleichermaßen gewährleistetwerden kann. Die Handlungshilfe ist da-
rauf ausgelegt, alle an der Planung, Aus-schreibung, Ausführung und Überwa-chung befassten Personenkreise bereits in der Planungsphase zu unterstützen.Die Vorveröffentlichung des Entwurfes derHandlungshilfe soll der Information bzw.der Diskussion in der Fachöffentlichkeit imVorgriff auf die geplante Länderanhörungdienen. Die BG BAU und das DGUV-SachgebietTiefbau empfehlen, den Entwurf derHandlungshilfe insbesondere für die Beur-teilung kritischer Grenzfälle nach ASR A5.2Kapitel 4.3 Absätze (3) und (4) zu berück-sichtigen.
Die Handlungshilfe besteht aus dem• Teil A: Grundlagen und Vorbemerkungen sowie dem
• Teil B: Maßnahmen und Beispiele
Im Teil A werden zunächst wesentlicherechtlichen Grundlagen zum Arbeits-schutz wie Arbeitsstättenverordnung, Be -triebssicherheitsverordnung und Baustel-lenverordnung sowie die dazugehörigenTechnischen Regeln erläutert. Es werdendie Adressaten und die Aufgaben des Bau-herrn beschrieben. Des Weiteren werdendie Gefährdungsbeurteilung und die Maß-nahmenhierarchie in Bezug auf Sicherheitund Gesundheitsschutz dargestellt.
10:27:54

Straßenbautechnik BauPortal 7/201920
Als zentraler Grundsatz wird dann deutlichgemacht, dass bei der Planung einer Stra-ßenbaumaßnahme eine Gesamtbetrach-tung der möglichen Gefährdungen, Be-lange und Interessen (z.B. Verkehrssicher-heit, Arbeitsschutz, Lärmschutz, Umwelt-,Natur- und Artenschutz, Geeignetheit undAngemessenheit von Umleitungsstrecken)zu erfolgen hat.Des Weiteren wird beschrieben, welcherelevanten Maße und Bestimmungen ausden RSA, der ASR A5.2, der StVO, der StVZOund anderen Rechtsnormen für die Bei-spiele und Vorschläge der Handlungshilfezugrunde gelegt sind. Weitere wichtigePunkte sind die Randbedingungen für dieAbwägung von Maßnahmen bei vollsper-rungsbedingt besonderen Gefährdungenfür die Verkehrsteilnehmer sowie die Vor-aussetzungen für die Nutzung von Flä-chen durch bestimmte Verkehrsarten beiTeilsperrungen.Insbesondere für Arbeiten des Straßen-betriebsdienstes auf bzw. neben der Fahr-bahn finden sich im Teil A wichtige Er-läuterungen, z.B. in Zusammenhang mit
der Anwendung von Sonderrechten gem.StVO oder zur Gefährdungsbeurteilung beiArbeitsstellen kürzerer Dauer.Zum Schluss werden die Voraussetzun-gen erläutert, unter denen es im Einzel-fall möglich sein kann, den SQ zu vermin-dern. Notwendig ist dabei immer, dass dieUmstände/Besonderheiten des fließendenVerkehrs (z.B. Verkehrsaufkommen, Lkw-Anteil, zul. Höchstgeschwindigkeit) unddie ergänzenden Schutzmaßnahmen ge -währleisten, dass stets ein ausreichenderAbstand zwischen der freien Bewegungs-fläche des Beschäftigten und den äußerenBegrenzungen der vorbeifahrenden Fahr-zeuge (insbesondere Spiegel, Ladung etc.bei Lkw) gewahrt bleibt.Im Teil B werden zunächst typische ver-kehrlichen Randbedingungen bzw. Ein-schränkungen systematisch gegliedertund strukturiert und zu sog. Verkehrs-führungstypen zusammengefasst. An -schließend werden für die jeweiligen Ver-kehrsführungstypen Lösungsbausteine be -schrieben, die auch bei schmaleren ein-bahnig zweistreifigen Straßen Verkehrs-
führungen an der Baustelle/Arbeitsstellevorbei ermöglichen.
Diese umfassen i.d.R. verkehrstechnischeÄnderungen bzw. temporäre Anpassungender Verkehrsführung. Abschließend wer-den die Lösungsbausteine in einer Ver-kehrsführungstypenmatrix den einzelnenVerkehrsführungstypen zugeordnet. DieseDarstellungsweise soll helfen, für be -stimmte verkehrliche Randbedingungenund Einschränkungen schnell Lösungs-varianten aufgezeigt zu bekommen, beidenen der Verkehr mit gewissen Ein-schränkungen an der Baustelle vorbei-geführt werden kann. In sog. „Steckbrie-fen“ werden Lösungsvarianten auf einemBlatt zusammengefasst.
Im weiteren Verlauf der Handlungshilfewerden• beispielhaft ausgewählte Baustellen-situationen beschrieben,
• in einem Ausblick technische Innovationen angeregt und
• eine Empfehlung für eine Anpassung der StVO gegeben.
0.12
5 m
0.10
m X
s3.00 m 3.225 m
0.25 m0.25 m 2.98 m 2.98 m6.45 m
m521
Xs
m01
m00.3
1.01.0 m522.3
m52.0 m89.2
m89.2m54.6
m52.0
Abb. 4: Straßenbaustellen kürzerer Dauer –Markierungsarbeiten in Fahrtrichtung (Quelle: Entwurf Handlungshilfe)
0.10
m X
s
3.00 m3.225 m 0.12
5 m
2.98 m 2.98 m6.45 m
0.25 m 0.25 m
m5223
Xs
m01. m003
m521.
m
m522.3
0 m00.30
m
m89.2m52.0
m89.2m54.6
m52.0
Abb. 5: Straßenbaustellen kürzerer Dauer –Markierungsarbeiten entgegen der Fahrtrichtung (Quelle: Entwurf Handlungshilfe)
Entw
urf
���� ����5������ ������ �1������A�1
������������ ������������������ �� ��������� �1����������������������� �� ��� C�C�� ,�������� C�$�� ��" �>����� ���(&��
��������
��������
������������������ ����������������������'�������&� ����������&(���� =�������9�������������&(���� ,������B�969�������)�����5������������ ��������* �� �������%����+�� � ��,�����, * �� ����������+�� � ��,�����,
���������������������������� �������
!�� ��"&#'(!#$"#%"
��������&(���� ��-�������2�8��=�����������,��������:����,�������1�����������������&��,�������%�1�������������6������������� ��� ������ ��������������� ,��������&����������������96C���,����� ����1�����������=�� ����������������,���������������,��������:����,��������������������&��,�������������������/0���� ����1���� ���������������1������
'�&%�����������30��� �,��������3���5��*��%� ���:����1���� ��������������� �;������3���2��+��1�������������,���@���� �� 3������*��%� ���������������@%���������������?������(��������'� ���� �,��������'� ���� �,��������������1����� ���&����� ��������>
Entw
urf
Abb. 3: Steckbrief für einen speziellen Verkehrsführungstyp (Quelle: Entwurf Handlungshilfe)

BauPortal 7/2019 Straßenbautechnik 21
ZusammenfassungSpätestens nach der offiziellen Einführungder ASR A5.2 mussten sich alle, die Verant-wortung bei Straßenbaumaßnahmen undUnterhaltungsarbeiten tragen, mit demThema „Gefährdung von Beschäftigten imGrenzbereich zum fließenden Verkehr“aktiv auseinandersetzen. Hierbei zeigtesich, dass diejenigen, welche die 5 Jahreder Vorveröffentlichung der ASR A5.2bereits genutzt und sich in dieser Zeit mitder Umsetzung konstruktiv beschäftigthatten, mit der offiziellen Einführung nurwenig Probleme hatten.Bei Unsicherheiten bezüglich der Umset-zung der ASR A5.2 in bestimmten Ge-werken, wie z.B. bei Fahrbahnmarkierernoder Straßenbetriebsdienstlern, wurden in kurzfristig anberaumten Terminen mitVertretern der betroffenen Berufsgruppendie Probleme diskutiert. Hierbei bestanddas Ziel darin, kurzfristig für Klarheit zusorgen und Lösungsvorschläge anzubie-ten. Diese wurden dann, soweit möglichund sinnvoll, in die Handlungshilfe einge-arbeitet.Die folgenden Aussagen ergeben die „vier Eckpfeiler des sicheren Straßenbaus“: • Bei allen Arbeiten, bei denen sowohl die Verkehrsteilnehmer als auch die
Beschäftigten durch die Tätigkeiten amfließenden Verkehr gefährdet werdenkönnen, müssen immer beide Belange,also Verkehrssicherheit und Arbeits-sicherheit berücksichtigt werden.
• Die Sicherheitsabstände SQ unddie freien Bewegungsflächen BM derASR A5.2 sind nur dann anzuwenden,wenn Personen im Grenzbereich zumvorbeifließenden Verkehr arbeiten.Arbeitet dort niemand, kann ganz normal nach StVO und RSA abgesichertwerden. Die ASR A5.2 ist somit ein flexibles Instrument, welches Möglich-keiten bietet, die Einschränkungen für den Verkehr nur auf diese kurzenZeitfenster zu begrenzen. In dem Entwurf der Handlungshilfe werdendiese Möglichkeiten mit Beispielen und Erläuterungen unterlegt.
• Ein wichtiges Element ist in diesemZusammenhang ein verbessertes Baustellenmanagement, bei dem dieverkehrlichen Einschränkungen vonzeitgleich durchgeführten Straßen-baumaßnahmen durch bessere Koordination minimiert wird.
• Für Verständnis bei den Bürgern undVerkehrsteilnehmern werben: Bauenbedeutet Werterhalt und Aufrecht-
erhaltung der Infrastruktur für die Bürger. Dies ist etwas Positives. Zu erwarten, dass dies ohne zeitweiseEinschränkungen des Verkehrsflussesmöglich ist, ist unrealistisch.
Die ASR A5.2 und die zur Zeit noch im Entwurfsstadium befindliche Handlungs-hilfe liefern in Verbindung mit den RSAden am Straßenbau und -unterhalt Betei-ligten die erforderlichen Informationen,um die Baumaßnahmen und Arbeiten sozu gestalten, dass sie sowohl für die Be -schäftigten als auch für die Verkehrs-teilnehmer sicher sind. Dies setzt voraus,dass alle am Straßenbau und -unterhaltBeteiligten die Inhalte und Möglichkeitender ASR A5.2 kennen und auch intelligenteinsetzen. Durch die 5 Jahre dauernde Zeitder Vorveröffentlichung hatten alle Betei-ligten ausreichend Zeit, sich mit demThema auseinanderzusetzen. Grundsätz-lich gilt: Je früher die ASR A5.2 bei der Planung einer Baustelle oder einer Arbeitberücksichtigt wird, umso einfacher ge -staltet sich später die Umsetzung.
Autor:Dipl.-Ing. Horst LeiseringLeiter Referat TiefbauBG BAU Prävention

Bau digital BauPortal 7/201924
BIM im StraßenbauDrittes Positionspapier des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie e.V. setzt auf ein Umdenken
Nach „BIM im Spezialtiefbau“ und „BIM imHochbau“ (siehe BauPortal 5/2019) hatder Hauptverband der Deutschen Bau-industrie e.V. (HDB) nun das Positions-papier „Building Information Modeling(BIM) im Straßenbau“ vorgelegt. Mit dieser Positionierung bezieht der HDB in einer weiteren Bausparte Stellungzur Digitalisierung am Bau. Diese Bau-sparte ist durch besondere Rahmenbedin-gungen bestimmt: Straßenbau wird inDeutschland fast ausschließlich für öffent-liche Bauherren abgewickelt und das Auf-tragsvolumen ist hier besonders groß. Mit rund 13,7 Mrd. € entfiel 2018 fast die Hälfte aller öffentlichen Bauaufträgeauf den Straßenbau – mit steigender Ten-denz: Der sich über Jahrzehnte aufge-staute Investitionsbedarf im Straßenbauist bei weitem noch nicht zufriedenstel-lend abgearbeitet und die Kostenentwick-lung für Rohstoffe und Energie sowie nicht zuletzt die knappen Personalressour-cen fordern von allen Beteiligten größteAnstrengungen für eine anforderungs-und termingerechte sowie wirtschaft-liche Bauausschreibung und -abwicklung.Die Bundesregierung hat diesem Um-stand u.a. mit dem 2015 vorgelegten BIM-Stufenplan „Digitales Planen undBauen“ Rechnung getragen, dessen Zieldie Umsetzung des digitalisierten Bauensbis 2021 ist. Das vorliegende Positionspapier stellt dieaktuellen technischen Möglichkeiten derBauindustrie für bestimmte Vertrags- undProjektkonstellationen bei der Umsetzungvon BIM im Rahmen dieses Stufenplansdar. Konkret werden Wege zur durch-gängigen Nutzung von Daten für alle imStraßenbau üblichen Vertragsformen be -schrieben. Darüber hinaus formuliert es aber auchForderungen der Bauindustrie an Bauher-ren und weitere Projektbeteiligte für eineBIM-basierte Abwicklung von Straßenbau-maßnahmen. Auf diesem Weg müssenalle Beteiligten (insbesondere Fach- undFührungskräfte) mitgenommen werden,um Vorbehalte abzubauen sowie pragma-tische Lösungen im Straßenbau sicherzu-stellen. Die BIM-Methodik soll in der Ein-führungsphase hauptsächlich bei Straßen-Neubauprojekten ihre Anwendung finden.Die aus diesen Projekten gesammeltenErfahrungen können dann auf Projekte imBestand übertragen werden.
Die Bedeutung digitaler Daten Durch die durchgängige Nutzung struktu-rierter, digitaler Daten und die inhaltlichewie zeitliche Verzahnung der Prozesseergibt sich ein kooperatives Arbeiten alleram Bau Beteiligten. Zusätzlicher Nutzenkann so ab der Entwurfs- und erst recht in der Angebots- und Bauphase realisiertwerden. Dies kann bereits heute, durcheine konsequente Übergabe digitaler Pro-jektdaten in der Angebotsphase an dieBieter umgesetzt werden. In der späterenPhase der Digitalisierung werden dannalle relevanten Informationen mit den 3D-Bauwerksmodelldaten ausgetauscht,dadurch werden Fehler reduziert und Re-dundanzen vermieden. Digitale Planungs-/Ausführungsdaten sindbereits heute, auch ohne BIM, vorhanden.Es gibt auch seit langem Standards zurRegelung für die Elektronische Bauabrech-nung (REB) sowie zum Datenaustauschetwa vom Gemeinsamen Ausschuss fürElektronik im Bauwesen (GAEB). Zurzeitwerden die Daten überwiegend analogoder digital reduziert als PDF übergebenund damit Informationsverluste erzeugt.Zur Förderung des BIM-Gedankens sinddiese digitalen Daten sowohl bei der Ausschreibung als auch bei der Auftrags-vergabe jederzeit verpflichtend auszu-tauschen.
Herstellerneutrale DatenformateDie Detailtiefe der Modelldaten muss defi-niert werden, Daten müssen in herstel -lerneutralen offenen Formaten IndustryFoun dation Classes (IFC) austauschbarsein. Bis IFC die Inhalte von Straßenmodel-len vollständig überträgt, sind vorüber-gehend native Modellformate (z.B. CPIXML)zuzulassen. Hierfür wird erwartet, dass die bereits in der Umsetzung befindlichenErweiterungen des internationalen Stan-dards DIN EN ISO 16739 (IFC) durch buil-dingSMART zeitnah fertiggestellt werden.Eine leistungsfähige CDE ist durch denAuftraggeber für jedes BIM-Projekt bereit-zustellen. Alle Projektbeteiligten müssenvertraglich abgesichert für die benötigteDauer Zugriff auf die relevanten Datenhaben.
BIM-Baubeschreibung = AIA + BAPDie Auftraggeberinformationsanforderun-gen (AIA) zusammen mit dem BIM-Abwicklungsplan (BAP) bilden gemeinsam
die Baubeschreibung für BIM-Projekte. Der Auftraggeber hat genau festzulegen,welche Daten er wann benötigt. Dazugehören insbesondere Angaben, wann, in welcher Detailtiefe und in welchem Format die angeforderten Daten geliefertwerden sollen. Die AIA sind Teil der Aus-schreibungsunterlagen (BMVI, 2015). DerAuftraggeber definiert für alle digitalenLiefergegenstände gemäß den Anwen-dungsfällen der Bauindustrie die erforder-lichen Ausarbeitungsgrade, die durch denAuftragnehmer zu liefern sind. Hierbeisind keine nativen Datenformate oder Prozessdaten (wie z.B. Maschinendatenoder Fahrwege) zu fordern. Für ein besse-res Verständnis der Vorgaben ist eine zu -sätzliche, funktionale Beschreibung bei-zufügen. Diese Beschreibung muss voll-ständig, allumfänglich und verständlich(vgl. VOB A §7) sein. Die relevanten Anwen-dungsfälle (BIM4Infra2020) sind einzelnaufzuführen.Die nachfolgende Tabelle (Auszug) zeigt,wie die Datenübergabe aktuell und inZukunft funktioniert. Der BAP stellt den Fahrplan eines jedenBIM-Projekts bezüglich der Erstellung,Weitergabe und Verwaltung von Datendar. Der Prozess zur Herstellung der gefor-derten Daten ist unter Festlegung allerRollen, Funktionen, Abläufe, Schnittstellen,Interaktionen sowie der genutzten Tech-nologien in einem BIM-Abwicklungsplanzu definieren (BMVI, 2015). Aktuell ist dieVergabepraxis auf einen reinen Preiswett-bewerb ausgerichtet. Hierbei kommt nurselten der wirtschaftlichste Bieter zumAuftrag, sondern meist der Billigste. Dazusollte der technische Wettbewerb, hierbezüglich BIM-Leistungen, mehr zum Tra-
BIM IM STRASSENBAU POSITIONSPAPIER DER
ARBEITSGRUPPE STRASSENBAU IM
ARBEITSKREIS DIGITALISIERTES BAUEN
IM HAUPTVERBAND DER DEUTSCHEN
BAUINDUSTRIE E.V.
JUNI 2019

BauPortal 7/2019 Bau digital 25
Wegweiser durch die komplexe BIM-MethodeNeue VDI-Richtlinie liefert einen Ansatz für die Implementierung von Building Information Modeling
Die Erkenntnis, dass Building InformationModeling (BIM) die ganze Bau- und Immo-bilienbranche erreichen und verändernwird, stellt inzwischen niemand mehr inFrage. Wie das geschehen wird, ist jedochin vielen Bereichen noch nicht geklärt. Für einen handhabbaren und erfolgrei-chen Ablauf eines BIM-Projekts sind eineinheitliches Verständnis von Begriffen,Prozessen und Methoden sowie verläss-liche normative Vorgaben unabdingbar.Verschiedene institutionelle Akteure derBaubranche beziehen derzeit mit Grund-lagenpublikationen und White Papers zu den offenen Fragen Stellung undmachen Vorschläge für Prozesse und Stan-dards.
Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI)widmet dem Thema BIM in seinen renom-mierten Richtlinien mit der Ausgabe VDI2552 eine ganze Reihe. Sie wendet sich
vor allem an Bauherren, Planer, alle amBau Beteiligten sowie schließlich jene, die den fertigen Bau schließlich betreibenund instandhalten. Damit folgt der VDI der vielfach anerkannten Einsicht, dass der große Mehrwert von BIM in der Abbil-dung des vollständigen Baulebenszyklusliegt.
Den Auftakt macht das kürzlich erschie-nene VDI 2552 Blatt 1 „Building Infor-mation Modeling – Grundlagen“. Diesesals Einstieg gedachte Papier gibt der kom-plexen Thematik eine Ordnung und istWegweiser zu den weiterführenden Rege-lungen für die weitgehend noch in derEntstehung befindlichen Blätter der Richt-linienreihe VDI 2552. Die Richtlinie be-rücksichtigt nationale und internationaleStandards und Spezifikationen sowie Best-Practice-Erfahrungen und stellt insbeson-dere den Bezug zur Erstellung und Nut-
zung von Bauwerksinformationen wäh-rend des Planens und Bauens eines Bau-werks her. Der VDI räumt Außenstehenden die Mög-lichkeit zur inhaltlichen Mitgestaltung sei-ner Richtlinien für einen befristeten Zeit-raum ein. Mit Stellungnahmen über daselektronische Einspruchsportal oder durchschriftliche Mitteilung an die herausge-bende Gesellschaft ([email protected]) sind Ein-gaben möglich. Die Einspruchsfrist für dasvorliegende Blatt 1 der Richtlinie VDI 2552endete am 30.9.2019.Das Blatt 1 „Building Information Mode-ling – Begriffe“ kann elektronisch bestelltwerden (www.vdi.de/richtlinien). VDI-Richtlinien können auch in vielen öffent-lichen Auslegestellen kostenfrei einge-sehen werden.
Stephan ImhofRedaktion BauPortal
gen kommen. Der öffentliche Auftrag-geber wird aufgefordert, die Angebote vonBIM-Leistungen zu bewerten. Die Bewer-tungskriterien müssen transparent undnachprüfbar gestaltet werden, um einenfairen Wettbewerb zu ermöglichen.
FazitBIM wird gelingen, wenn Wertschätzungund gegenseitiges Vertrauen der Projekt-partner zukünftig wieder die Zusammen-arbeit im Projekt bestimmen. Neben derkulturellen „Einstellung“ der Projektbetei-ligten sind organisatorische und techni-sche Rahmenbedingungen wichtig. Mitdem vorliegenden Papier hat die DeutscheBauindustrie daher zusätzlich zu thema-tischen Erläuterungen und Stellungnah-men einen Vorschlag für Anforderungenan Datenaustauschformate und Modell-inhalte erarbeitet.
Das Positionspapier „BIM im Straßenbau“wurde durch ein Redaktionsteam von BIM-Experten der Straßenbauindustrie imArbeitskreis Digitalisiertes Bauen (AKDB)des Hauptverbandes der Deutschen Bau-industrie erstellt. Der AKDB vernetzt dieDigitalisierungsexperten der Mitglieds-firmen des Bauindustrieverbandes.
Das Positionspapier kann unter www.bauindustrie.de/publikationen/ herunter-geladen werden.
BIM ANWENDUNGSFÄLLEBMVI STUFENPLAN 2020
„HEUTE“ (GEM. TABELLE A)
DATENAUSTAUSCH
„MORGEN“
AwF 01.
AwF 02.
AwF 03.
AwF 04.
AwF 05.
AwF 06.
AwF 07.
AwF 08.
AwF 09.
AwF 10.
AuftraggeberBeschreibung
BestandserfassungErfassen wesentlicher Aspekte des Bestandes durch geeignetes Aufmaß und Überführung in eine 3D Ansicht. Eingangsdaten können aus bestehenden Unterlagen, Vermessungen, 3D Scans, Photogrammmetrie oder einer Kombina-tion daraus entnommen werden.
Planungsvariantenuntersuchung
VisualisierungBedarfsgerechtes Visualisieren des 3D-Modells als Basis für Projektbesprechungen sowie für die Öffentlichkeitsarbeit.
Bemessung und Nachweisführung
Koordination der FachgewerkeZusammenführen der Fachmodelle in einem Ko-ordinationsmodell, mit anschließender automa-tisierter Kollisionsprüfung und systematischer Konfliktbehebung
Fortschrittskontrolle der Planung
Erstellung Entwurfs- und GenehmigungsplanungAbleitung der wesentlichen Teile der Entwurfs-, Genehmigungs- bzw. Ausführungspläne aus dem Modell
Arbeits- und GesundheitsschutzDarstellen sicherheitsrelevanter Aspekte (z.B. Sperrzonen, Zugangsbeschränkungen, Flucht-wege, Brandbekämpfung, Betriebsabläufe, usw.) im Modell, ggfs. mit zeitlicher Auswirkung temporärer Bauzustände oder Einrichtungen.
Planungsfreigabe
Kostenschätzung und Berechnung
Auftragnehmer AuftragnehmerAuftraggeber
X X
X X
X
X X
Übergabe gemäß AIA und BAP gem. Kapitel 2a
XÜbergabe gemäß Austauschformate Tabelle A
X
X
B
X
B
XÜbergabe gemäß aktuell vorhandener Austauschformate, z.B. REB 66 etc.
Übergabe gemäß AIA und BAP

Baumaschinentechnik (Bagger, Lader) BauPortal 7/201926
„Stand der Technik bei der Verwendung“ – Anforderungen an die Beschaffenheit von MaschinenDipl.-Ing. Martin Hackmann, Berlin
Welche Faktoren bestimmendie Anforderungen an die Beschaffenheit?Grund für die Unsicherheiten bzw. Diskus-sionen ist die zum Teil unscharfe Abgren-zung zwischen den Beschaffenheitsan-forderungen an Maschinen, die sich ausden Regelungen zur Inverkehrbringungvon Produkten innerhalb des europäischenMarktes ergeben und den Schutzmaß-nahmen, die ein Arbeitgeber als „Verwen-der von Arbeitsmitteln“ im Rahmen derGefährdungsbeurteilung ermitteln undumsetzen muss. Im Folgenden soll ver-sucht werden darzustellen, welche Anfor-derungen sich für die Beschaffenheit vonMaschinen aus der Produktsicherheit, denMindestanforderungen für die Verwen-dung und den Schutzmaßnahmen aus derGefährdungsbeurteilung ergeben.
ProduktsicherheitGrundgedanke des Art. 114 des Vertragesüber die Arbeitsweise der EuropäischenUnion ist, dass es vor dem Hintergrundeines freien Warenverkehrs innerhalbEuropas grundsätzlich über die europäi-schen Regelungen hinaus keine speziel-leren nationalen Anforderungen an dieBeschaffenheit von Produkten geben darf.Für Maschinen werden diese Anforde-rungen an Hersteller bzw. Inverkehrbrin-ger in Deutschland durch das Produkt-sicherheitsgesetz (ProdSG) bzw. der Ma -schinenverordnung umgesetzt. Diese setztdie europäische Richtlinie 2006/42/EG(Maschinenrichtlinie) in staatliches Rechtum und legt den Stand der Technik hin-sichtlich der Beschaffenheit für Maschinenfest. Wenn ein Hersteller (europaweit) har-
monisierte Normen anwendet, kann erdavon ausgehen, dass das Produkt „aus-reichend sicher“ (Vermutungswirkung) ist. Zuständig für die Einhaltung der Anforde-rungen an die Maschinensicherheit ist dieMarktüberwachung, welche in Deutsch-land von den Bundesländern wahrgenom-men wird. Das Produktsicherheitsgesetzstellt der Marktüberwachung diverseInstrumente zur Verfügung, damit gegenunsichere bzw. gefährliche Maschinen vor-gegangen werden kann. Die Bundesan-stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin(BAuA) veröffentlicht in ihrer Datenbank„Gefährliche Produkte“ ihr bekannt gewor-dene Produktrückrufe, Produktwarnungen,Untersagungsverfügungen und sonstigeInformationen zu gefährlichen Einzel-produkten. In diesem Kontrollsystem fürdie Sicherheit von Maschinen sind dieUnfallversicherungsträger nicht bzw. nurmit beratender Funktion (z.B. im Rahmeneiner Messekommission) vorgesehen.Unfallverhütungsvorschriften, die früherBeschaf fenheitsanforderungen an Maschi-nen ge regelt haben (z.B. § 3 „Bau und Ausrüs tung“), wurden inzwischen zurück-gezogen. Die Betriebsvorschriften fürMaschinen aus diversen berufsgenossen-schaftlichen Vorschriften wurden dabei in die BGR 500 „Betreiben von Arbeits-mitteln“ überführt. Für den Verwender/Betreiber von Maschi-nen ergeben sich aus der Produktsicher-heit deutliche Vereinfachungen. Maschi-nen, die nach den Regelungen des Euro-päischen Marktes „in Verkehr gebracht“wurden und im Rahmen der vom Herstel-ler vorgesehenen bestimmungsgemäßenVerwendung eingesetzt werden, könnenbzgl. der Beschaffenheit grundsätzlich als
„ausreichend sicher“ betrachtet werden.Diese häufig kontrovers diskutierte Aus-sage wird in der BetrSichV in den §§ 3 und 5 klargestellt. In diesen wird festge-legt, dass: • ein Arbeitsmittel den zum Zeitpunkt
des Bereitstellens auf dem Markt (nicht dem Zeitpunkt der Verwendung)geltenden Anforderungen entsprechenmuss,
• Informationen aus Gebrauchs- undBetriebsanleitungen des Herstellerszutreffend sind und die gegebenenfallsvom Hersteller erstellten Gefährdungs-beurteilungen übernommen werdenkönnen, sofern nicht andere Erkenntnisse vorliegen,
• vorhandene Gefährdungsbeurtei-lungen oder gleichwertige Unterlagenvom Hersteller oder Inverkehrbringerbzgl. der Festlegung von Schutzmaß-nahmen übernommen werden können.
Durch die vereinfachte Vorgehensweise (§ 7) der BetrSichV kommt es zu weiterenVereinfachungen. Ein Verwender kann da -von ausgehen, dass die Mindestanforde-rungen an die Beschaffenheit von Maschi-nen (§ 8 und 9 der BetrSichV) eingehaltensind, wenn eine Maschine:• den zum Zeitpunkt der Verwendung
(nicht der Bereitstellung auf demMarkt) existierenden Anforderungenzum Bereitstellen auf dem Markt (z.B. aktuelle CE-Normen) entspricht,
• ausschließlich bestimmungsgemäßentsprechend den Vorgaben des Herstellers verwendet wird und eskeine zusätzlichen Gefährdungen derBeschäftigten unter Berücksichtigung
Der Begriff „Stand der Technik“ führt häufig zur Verunsicherung bei Verwendern von Arbeitsmitteln bzw. zu kontro-versen Diskussionen im Rahmen des Überwachungs- und Beratungsauftrag der Unfallversicherungsträger. Definiert wird der Begriff in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) als „Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme oder Vorgehensweise zum Schutz derGesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten (...) gesichert erscheinen lässt“. Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) fordert, dass der Stand der Technik bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu berücksichtigen ist. Die BetrSichV legt fest,dass die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung getroffenen Maßnahmen dem Stand der Technik entsprechen müssen.Bedeuten diese Forderungen nun, dass Arbeitsmittel an den Stand der Technik anzupassen sind? Gibt es eine Nachrüst-oder Neubeschaffungspflicht, wenn neue, zum Teil sicherere Maschinen, auf dem Markt bereitgestellt werden oder neue Produktnormen veröffentlicht werden?

BauPortal 7/2019 Baumaschinentechnik (Bagger, Lader) 27
der Arbeitsumgebung, der Arbeits-gegenstände, der Arbeitsabläufe sowie der Dauer und der zeitlichenLage der Arbeitszeit auftreten,
• instandgesetzt ist und die notwendigen Prüfungen durchgeführt worden sind.
Bei Einhaltung dieser Voraussetzungenreicht es für die Dokumentation der Ge -fährdungsbeurteilung aus, dass die o.g.Voraussetzungen und die gegebenenfallsgetroffenen Schutzmaßnahmen angege-ben werden.
Mindestanforderungen an MaschinenDie Maschinen müssen nicht nur die zum Zeitpunkt des Bereitstellens auf demMarkt geltenden Anforderungen erfüllen,sondern auch die in der BetrSichV fest-gelegten Mindestanforderungen an dieBeschaffenheit. Werden diese nicht einge-halten, muss die Maschine nachgerüstetwerden. Gegebenenfalls kann sogar eineNeubeschaffung erforderlich werden. DieMindestanforderungen betreffen z.B. dieForderungen nach Schutzmaßnahmengegen Gefährdung durch bewegliche Teile,das Einfordern von Notbefehlseinrichtun-gen zum sicheren Stillsetzen („Not-Aus“)oder Schutzeinrichtungen gegen heraus-
schleudernde Gegenstände. Im Anhang 1der BetrSichV werden weitere Beschaffen-heitsanforderungen an mobile Arbeits-mittel (z.B. Beleuchtungsanlagen beimEinsatz bei Dunkelheit) aufgeführt. Da dieAnforderungen, die sich aus der Inverkehr-bringung auf dem Europäischen Marktergeben, meist höher sind als diese Min-destanforderungen, sind i.d.R. nur Alt-maschinen, d.h. Maschinen, die vor 1995 inVerkehr gebracht wurden, von einer Nach-rüstpflicht betroffen. Die Forderungen nach der Einhaltung die-ser Mindestanforderungen sind nicht neu.In der Novellierung der BetrSichV im Jahr2015 wurden sie aus dem Anhang 1 derBetrSichV (2002) übernommen. Vor 2002wurden sie in der Arbeitsmittelbenut-zungsverordnung gefordert. Eine Um- bzw.Nachrüstung einer Maschine, z.B. einerKreissäge ohne Abdeckung des Sägeblattsoder die Nachrüstung eines Beckengurtesan einem Gabelstapler, hätte damit schonvor Jahren erfolgen müssen. Bei der Diskussion über die Sicherheit vonMaschinen sollte darauf geachtet werden,dass von einer „Nachrüstverpflichtung“nur gesprochen wird, wenn es dafür einerechtliche Grundlage gibt. Diese ist z.B. bei den oben beschriebenen Beispielen
Kreissäge und Gabelstapler sowie bei der Forderung nach einem Zweiwege-Kommunikationssystem für Aufzüge (Frist: 31. Dezember 2020) der Fall.
SchutzmaßnahmenAbzugrenzen von der Produktsicherheitund den Mindestanforderungen sind dieSchutzmaßnahmen, die im Rahmen derGefährdungsbeurteilung vom Verwendergegebenenfalls festzulegen und umzuset-zen sind. Diese betreffen in erster LinieBetriebsvorschriften wie z.B. Vorgaben fürdie Verwendung, Unterweisungsinhalte,Prüfungen oder den Schutz von beson-deren Personengruppen (Jugendliche,Schwangere). Weiterhin müssen gegebe-nenfalls zusätzliche Maßnahmen getrof-fen werden, wenn es Gefährdungen gibt,die der Hersteller nicht berücksichtigt hat. Diese Gefährdungen können sich z.B.aus der Arbeitsumgebung (z.B. Einsatzeiner Maschine im Ex-Bereich), desArbeitsgegenstandes (z.B. Freisetzung vomquarzhaltigen Staub bei Fräsarbeiten), beiEigenbau oder bei der Änderung vonMaschinen durch den Arbeitgeber er-geben. Nur für diese Maßnahmen gilt dieForderung an den Verwender, dass derStand der Technik eingehalten und die

Baumaschinentechnik (Bagger, Lader) BauPortal 7/201928
Rangfolge der Schutzmaßnahmen (tech-nisch, organisatorisch und personenbezo-gen) eingehalten werden muss. Wird derStand der Technik für die Maßnahmendabei z.B. durch eine TRBS, vorgegeben,muss der Verwender dieses Sicherheits-niveau einhalten. Wie er das Niveau er -reicht, bleibt ihm überlassen.
Ausnahmen: Technische Anpassung oder Neubeschaffung In Ausnahmefällen ist es möglich, dass alsErgebnis der Gefährdungsbeurteilung nurdie technische Anpassung oder die Neu-beschaffung eines Arbeitsmittels in Be -tracht kommt. Eine Gefährdungsbeurtei-lung ist aktuell zu halten und regelmäßigzu überprüfen. Anlässe zur Überprüfungder Gefährdungsbeurteilung sind z.B. neueErkenntnisse aus dem Unfallgeschehen,überarbeitete Technische Regeln oderwenn sich der Stand der Technik beimBereitstellen auf dem Markt (z.B. durchneue Normen) geändert hat. Im Unter-schied zu den oben beschriebenen Min-destanforderungen bzw. Nachrüstver-pflichtungen hat der Verwender bei derFestlegung von Maßnahmen jedoch einenHandlungsspielraum. Er entscheidet imEinzelfall und kann dabei auch Kriterienwie z.B. Verwendungsdauer und -häufig-keit, Einsatzort, Qualifikation des Nutzersberücksichtigen. Sogar die Verhältnis-
mäßigkeit einer Maßnahme („Was kostetdiese?“, „Wann ist die nächste Neube-schaffung geplant?“) kann er dabei be -rücksichtigen.
Beispiel technische AnpassungIm Frühjahr 2019 wurde die TRBS 2111 Teil 1 „Mechanische Gefährdungen – Maß-nahmen zum Schutz vor Gefährdungenbeim Verwenden von mobilen Arbeits-mitteln“ veröffentlicht. Als Beispiel wirdein Arbeitsprozess beschrieben, bei demein Bagger beim Ausheben eines Grabensden rückwärtig hinter ihm stehenden Lkw beladen soll. Als unfallbegünstigendeUmstände werden aufgeführt, dass:• die Arbeitsaufgabe des Baggerfahrers
eine hohe Konzentration auf die Baggerschaufel erfordert,
• der Lkw-Fahrer bei der Beladung desFahrzeugs eine Ladungskontrolledurchführen und ggf. Reinigungs-arbeiten am Heck durchführen muss,
• die direkte Kommunikation zwischenLkw-Fahrer und Baggerfahrer durchMaschinen- oder Baustellenlärm eingeschränkt sein kann.
• der Lkw-Fahrer nicht immer mit denspezifischen Gefährdungen des Baustellenbetriebs vertraut ist.
Als einzig mögliche technische Maß-nahme wird in der TRBS für diesen Arbeits-prozess ein Kamera-Monitor-System alsLösung gesehen. Für diesen Einzelfall mitden oben beschriebenen Rahmenbedin-
gungen ist somit der Handlungsspiel-raum für den Verwender stark einge-schränkt. Ergebnis der Gefährdungsbe-urteilung kann nur der Einsatz einesKamera-Monitor Systems sein, um das inder TRBS be schriebene Sicherheitsniveauzu erreichen.
Beispiel Neubeschaffung Bei Eintreibgeräten (Druckluftnagler) ohneEinzelschusssicherung hat sich der Standder Technik weiterentwickelt. AktualisierteNormen fordern inzwischen eine Einzel-schusssicherung. Auf Baustellen, wo imRegelfall mehrere beteiligte Personen aufengem Raum arbeiten, die Eintreibgeräteoftmals auf Höhenarbeitsplätzen einge-setzt werden und die Arbeitsprozesse häu-fig nicht detailliert umfassend geplantwerden können, kann die Gefährdungs-beurteilung nur zu dem Ergebnis führen,dass eine Nachrüstung mit einer Einzel-auslösung mit Sicherungsfolge erforder-lich ist. Da eine Nachrüstung i.d.R. nichtmöglich ist, kann das Ergebnis der Ge-fährdungsbeurteilung nur die Neube-schaffung eines Eintreibgerätes sein (vgl.auch Empfehlungen zur Betriebssicherheit„Anpassung an den Stand der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln“(EmpfBS 1114).
FazitDer „Stand der Technik bei der Verwen-dung von Arbeitsmittel“ setzt sich aus derProduktsicherheit und den aus der Gefähr-dungsbeurteilung abgeleiteten Schutz-maßnahmen zusammen. Eine Nachrüst-verpflichtung für Maschinen gibt es imRegelfall nur für Altmaschinen, die vor1995 in Verkehr gebracht wurden. Bei denSchutzmaßnahmen hat der Verwendereinen Handlungsspielraum. Nur in Einzel-fällen, z. B. wenn der „Stand der Technik beider Verwendung“ durch eine TRBS vorge-geben wird, kann es dazu kommen, dassein Verwender im Handlungsspielraumzur Auswahl der geeigneten Maßnahmeneingeschränkt wird. Dann sind von ihmergänzende technische Schutzmaßnah-men umzusetzen bzw. eine Neubeschaf-fung durchzuführen. Eine Nachrüstpflichtfür Arbeitsmittel, die nach den Regelun-gen des europäischen Marktes in Verkehrgebracht wurden, lässt sich damit abernicht begründen. Darum gibt es auchkeine rechtliche Grundlage, dass der„Stand der Technik“ für ein Arbeitsmitteleingefordert wird.
Autor:Dipl.-Ing. Martin HackmannBG BAU Prävention

Baumaschinentechnik (Bagger, Lader) – Gefahrstoffe BauPortal 7/201932
Die neue TRGS 554 „Abgase von Dieselmotoren“ – Was hat sich geändert?Dipl.-Ing. (FH) Corinne Ziegler, KarlsruheDipl.-Ing. Ulf Spod, Frankfurt am Main
Struktur und Inhalte der neuen TRGS 554Neben den inhaltlichen Änderungenwurde die TRGS 554 [1] auch neu struktu-riert. Sie besteht jetzt aus 5 statt 4 Ab -schnitten, wobei der Abschnitt „Arbeits-medizinische Prävention“ neu dazugekom-men ist, und die Anzahl der Anlagen redu-zierte sich von 5 auf 3.
Anwendungsbereich undBegriffsbestimmungenDie neue TRGS 554 gilt jetzt nicht nur fürTätigkeiten in ganz oder teilweise ge -schlos senen Arbeitsbereichen, sondernauch für Tätigkeiten im Freien. In diesemZusammenhang wurde – aufgrund derunterschiedlichen Auslegungen in der Praxis – der Begriff „teilweise geschlosseneArbeitsbereiche“ genauer definiert. EinArbeitsbereich gilt jetzt als teilweise ge -schlossen, sobald ein Dach bzw. eineDecke und mindestens zwei Wände (auchmit Öffnungen wie Türen/Tore, Fenster/Dachreiter) vorhanden sind. Für Bauarbei-ten im Freien gibt es in der Anlage 1 einezusätzliche Hilfestellung.Der Begriff „Dieselrußpartikel“ wird ge -mäß der Definition nach TRGS 900 [2] neueingeführt, da die bisherige Bezeichnung„Dieselmotoremissionen“ etwas irrefüh-rend war. Bei der Bewertung der Gefähr-dung durch Abgase von Dieselmotorenrücken gegenüber der alten TRGS dieStickoxide (NO und NO2) aufgrund der imJahr 2016 abgesenkten Arbeitsplatzgrenz-werte (AGW) mehr in den Vordergrund.Neben dem bereits in der Vorgänger-version enthaltenen Dieselpartikelfilter(DPF) wurde die neue TRGS mit den sog.
DeNOx-Systemen ergänzt. Dabei handeltes sich um Abgasnachbehandlungssys-teme zur Verminderung der Emissionenvon Stickoxiden.
Einstufung und KennzeichnungAbgase von Dieselmotoren stellen einkomplexes Gemisch aus gas- und partikel-förmigen Anteilen dar. Die Gase besteheninsbesondere aus Stickstoffmonoxid (NO),Stickstoffdioxid (NO2), Kohlenmonoxid(CO) und Kohlendioxid (CO2). Daneben bil-den sich Dieselrußpartikel aus unlöslichenKernen elementaren Kohlenstoffs (kurz EC)und daran angelagerten weiteren Sub-stanzen (organischer Kohlenstoff, kurz OC). Aus toxikologischer Sicht kommt denStickoxiden und den Dieselrußpartikelneine besondere Bedeutung zu. Stickoxideaus Abgasen von Dieselmotoren wirkenatemwegsreizend und die Dieselrußparti-kel sind krebserzeugend. Untersuchungenan mit Abgasen von Dieselmotoren expo-nierten Ratten zeigten, dass beim Krebs-entstehungsmechanismus der Partikel-effekt des Rußkerns im Vordergrund steht,während der Beitrag der daran angelager-ten Stoffe vernachlässigbar ist. Als kriti-scher Gesundheitseffekt gilt eine partikel-bedingte chronische Entzündung in derLunge, die zu Tumoren führen kann. Wirdjedoch eine solche Entzündung vermieden,ist nicht mit einem Krebsrisiko zu rechnen.Wie in einem ausführlichen Begründungs-papier [3] dargelegt, wird die Entstehungvon Lungenkrebs bei Einhaltung desArbeitsplatzgrenzwertes für Dieselrußpar-tikel von 0,05 mg/m3 verhindert. Eine dies-bezügliche Anpassung der TRGS 906 [4] istvorgesehen.
Wird der AGW für Dieselrußpartikel über-schritten oder liegen keine Informationenüber die Expositionshöhe vor, sind dieexponierten Beschäftigten in einem Expo-sitionsverzeichnis [5] zu führen. Beim Auftreten von Kohlenstoffmonoxid(CO) kann eine fruchtschädigende Wir-kung auch bei Konzentrationen unterhalbdes AGW [2] nicht ausgeschlossen werden.Dies ist unter Beachtung des Mutter-schutzgesetzes in der Gefährdungsbeur-teilung zu berücksichtigen. Das heißt, diearbeitsbedingte Exposition gegenüberKohlenmonoxid für werdende Mütter darfnicht höher als die Hintergrundbelastungsein („unverantwortbare Gefährdung“nach Mutterschutzgesetz).
SchutzmaßnahmenDas Kapitel Schutzmaßnahmen wurde inder Neufassung der TRGS nach dem STOP-Prinzip (S = Substitution, T = Technische, O = Organisatorische und P = PersönlicheSchutzmaßnahmen) neu strukturiert.
DeNox-SystemZur Reduzierung der Stickoxide haben sichselektive katalytische Reduktionssysteme(kurz SCR) als technische Lösung durch-gesetzt. Dabei erfolgt die Stickoxide-Um -wandlung in Stickstoff mithilfe von wäss-riger Harnstofflösung, die als „AdBlue“bezeichnet wird. Außerdem wird bei denaktuellen Systemen eine Abgastemperaturoberhalb von ca. 230 °C benötigt.
DieselpartikelfilterZur wirksamen Reduzierung von Diesel-rußpartikeln sind weiterhin DPF einzuset-zen. Um die Anforderungen der europäi-schen Emissionsgesetzgebung für mobile
Der Einsatz von dieselbetriebenen Fahrzeugen und Maschinen ist auf Baustellen weit verbreitet. Der Dieselmotor wirdmobil oder stationär, im Freien, in Hallen oder im Tunnelbau unter ganz unterschiedlichen Einsatzbedingungen und mit verschiedenen Leistungen eingesetzt. In der alten Fassung der TRGS 554 von 2008 standen bei der Gefährdungs-beurteilung „die krebserzeugenden Dieselmotoremissionen“ und bei den Schutzmaßnahmen „das Minimierungsgebot“im Mittelpunkt. Durch die Veröffentlichung von neuen Arbeitsplatzgrenzwerten für Stickoxide und für die nach wie vorkrebserzeugenden Dieselmotoremissionen wurde eine Überarbeitung der TRGS 554 erforderlich. Auch die Weiter-entwicklung in der Motorentechnik und der Abgasnachbehandlung wurde in der neuen TRGS berücksichtigt. In diesem Beitrag werden die Änderungen der neuen TRGS 554, die für die Ausführung von Bauarbeiten relevant sind, vorgestellt.

BauPortal 7/2019 Baumaschinentechnik (Bagger, Lader) – Gefahrstoffe 33
Maschinen einzuhalten, können dieselbe-triebene Maschinen – abhängig von derEmissionsstufe – bereits ab 19 kW Leis -tung mit einem DPF ab Werk ausgerüstetsein. Diese sind i.d.R. selbstregenerierend,d.h. der Abbrand des auf der DPF-Ober-fläche abgeschiedenen Dieselrußes erfolgtwährend des Betriebs der Maschine auto-matisch durch aktive oder passive Rege-neration. Der DPF muss dann noch von der bei der Regeneration zurückbleiben-den Asche in regelmäßigen Abständennach Herstellerangeben gereinigt werden.Diese Filterreinigung kann unter Beach-tung der gesetzlich vorgeschriebenenUmwelt- und Arbeitsschutzbedingungenauch mit einfachen Hilfsmitteln wieeinem Hochdruckreiniger oder mittelsDruckluft erfolgen. Bei der Nachrüstung von Maschinen (Abb. 1), die nicht ab Werk mit einem DPFausgestattet sind, ist grundsätzlich daraufzu achten, dass keine neuen Gefahren-quellen, wie Sichteinschränkungen, heißeOberflächen, oder Schwächung von tra-genden Teilen der Maschine, wie demÜberrollschutz (ROPS), geschaffen werden.Je nach Anwendungsfall kommen ent-weder aktiv oder passiv selbstregenerie-rende oder extern zu regenerierende DPFzum Einsatz. Bei den extern zu regenerierenden Diesel-partikelfiltern (auch Wechselfilter ge -nannt) kommen für die Regeneration i.d.R.folgende Varianten in Frage:• Brennofen• Reinigungskabinen• Einschicken des Filters zum Hersteller oder Anbieter von Dieselpartikelfilterregeneration.
Zwar sind hierbei ggf. auch Hochdruck-reiniger oder der Einsatz von Druckluft an der Regeneration beteiligt, dann aber
i.d.R. in geschlossenen Kabinen, die dasSchmutz wasser, die verunreinigte Luftbzw. die Ablagerungen auffangen.
Hinweise wie • „Einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger“,
• „Bei der Reinigung mittels Hochdruck-reiniger wird der auf dem Filter gesammelte Ruß abgespült“ oder
• „Filtereinsatz kann einfach per Hochdruckreiniger gereinigt werden“
können dabei schnell den falschen Ein-druck erwecken und suggerieren, dass dieFiltereinsätze im Freien oder in der Werk-statt am Waschplatz mit Ölabscheideroffen mittels Hochdruckreiniger regene-riert werden können. Bei einer unsachge-mäß ausgeführten Regeneration könnenaber Umwelt und Beschäftigte schnellgefährdet und der Filtereinsatz beschädigtwerden. Die in der TRGS 554 geforderteAbscheiderate von über 90 % wird voneinem beschädigten DPF nicht mehr ein-gehalten.
Also muss festgehalten werden, dassBetreiber von Nachrüstfiltern sich sehrdetailliert über den Typ des verbauten Fil-ters und die vom Hersteller vorgegebenenWartungsanleitungen informieren müs-sen. Pauschale Regenerationshinweise –z.B. auf Rechnungen oder Lieferscheinen –sind nicht ausreichend. Ungeachtet des-sen sind die Anforderungen an denUmwelt- und Arbeitsschutz zwingend ein-zuhalten.
Mitgliedsbetriebe der BG BAU erhalten bei der Nachrüstung von Maschinen miteinem selbstregenerierenden DPF einenZuschuss von bis zu 2.000 €. Weitere Infor-mationen zu dieser Förderung sind unterwww.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien/dieselpartikelfilter zu finden.
Wartungs- und Überwachungs-konzept für DieselmotorenGrundsätzlich sind Dieselmotoren vonMaschinen und Fahrzeugen nach den Vor-gaben des Herstellers zu warten. Maschi-nen mit DPF, die in ganz oder teilweisegeschlossenen Arbeitsbereichen einge-setzt werden, müssen zudem in vorgege-benen Abständen einer Abgasmessungunterzogen werden. Für die Wirksamkeits-prüfung des eingebauten Partikelfilterskann sowohl die Schwärzungszahl alsauch die Trübungsmessung angewendetwerden. Nähere Informationen dazu sindim Anhang 2 und Anhang 1 Nr. 3.3 Abs. 5zu finden.
Betriebsanweisung und Unterweisung, Betrieb von DieselmotorenAn der Verpflichtung des Arbeitgebers,eine arbeitsplatzbezogene schriftliche Be -triebsanweisung in verständlicher Formund Sprache zu erstellen und anhand derBetriebsanweisung über auftretende Ge -fährdungen und entsprechende Schutz-maßnahmen mündlich zu unterweisen,hat sich nichts geändert. In WINGIS online[6] sind Betriebsanweisungsentwürfeauch zu Abgasen von Dieselmotoren zufinden. Vorgaben zu Verhaltensweisen beim Be -trieb von Dieselmotoren, wie z.B. dasUnterlassen von unnötigem Fahr- undLeerlaufbetrieb sowie starkem Beschleu-nigen, sind in der neuen TRGS 554 auchwieder enthalten.
Persönliche SchutzausrüstungEine abgestufte, expositionsabhängigeVerwendung von Atemschutz, wird in derneuen TRGS 554 nicht mehr vorgesehen,da es nun AGW für die Abgaskomponen-ten gibt. Danach dürfen Tätigkeiten ober-halb des AGW für Dieselrußpartikel nurunter Verwendung von Atemschutz mitPartikelfilter durchgeführt werden. Fürden Schutz gegen Stickoxide (auch nitroseGase genannt) gibt es zwar Gasfilter, diese haben jedoch nur eine kurze Stand-zeit von 20 Min. und danach müssen sieausgetauscht werden. Daher ist der Ein-satz von Atemschutz mit Gasfilter gegennitrose Gase für Baustellen ungeeignet.Die Alternative wären Atemschutzgerätemit umgebungsluftunabhängiger Luftver-sorgung, die genauso untauglich für denBaubetrieb sind. Als Folge daraus mussdaher bei einer Überschreitung der AGWdie Stickoxidexposition der Beschäftigtenauf Baustellen durch technische Schutz-maßnahmen wie Abgasnachbehandlungund/oder technische Lüftung reduziertwerden.
Abb. 1: Mit DPF nachgerüsteteHubarbeitsbühne

Baumaschinentechnik (Bagger, Lader) – Gefahrstoffe BauPortal 7/201934
Arbeitsmedizinische VorsorgeDie TRGS 554 erhielt einen neuen Ab -schnitt zur arbeitsmedizinischen Präven-tion. Er umfasst in 3 Kapiteln die Beteili-gung des Betriebsarztes an der Gefähr-dungsbeurteilung und Erkenntnisse ausder arbeitsmedizinischen Vorsorge, diearbeitsmedizinisch-toxikologische Bera-tung im Rahmen der Unterweisung sowiedie arbeitsmedizinische Vorsorge. Eine arbeitsmedizinische Vorsorge mussbei Einhaltung des AGW für Kohlenmono -xid sowie bei Überschreitung des AGW für Dieselrußpartikel angeboten werden.Arbeitsplatzmessungen der BG BAU habenergeben, dass beim Einsatz von Diesel-motoren in ganz oder teilweise geschlos-senen Arbeitsbereichen der AGW von Koh-lenmonoxid eingehalten wird. Der AGWfür Dieselrußpartikel wird bei Beachtungder im Anhang 1 Nr. 3 aufgeführten Maß-nahmen ebenfalls eingehalten.
Die Anlagen zur TRGS 554Die alten Anlagen „Verzeichnis betrieb-licher Arbeitsbereiche mit Abgasen vonDieselmotoren“ und „DME-Konzentratio-nen – Messergebnisse für Arbeitsbereiche“wurden in der neuen TRGS gestrichen. DieBerechnungen der DME-Konzentration imBergbau und beim Einsatz von Gabelstap-lern in Hallen sind auch nicht mehr enthal-ten, da die Konzentrationen von Stick-oxiden nicht sicher zu berechnen sind.Werden Beschäftigte Abgasen von Diesel-motoren ausgesetzt, müssen bei derGefährdungsbeurteilung das Ausmaß die-ser Belastungen sowie die erforderlichenSchutzmaßnahmen ermittelt und doku-mentiert werden. Für Bauarbeiten sind inNummer 3 des neuen Anhanges 1 Schutz-maßnahmenkonzepte zu finden, bei derenUmsetzung davon auszugehen ist, dassder Schutz der Beschäftigten gewährleis -tet wird. Dieselbetriebene Maschinen und Fahr-zeuge werden auf zahlreichen Baustellenim Freien, aber auch in ganz oder teilweisegeschlossenen Arbeitsbereichen, wie Hal-len, Tiefgaragen, oder Tunneln eingesetzt.Ohne diese Maschinen und Fahrzeugewären viele Arbeiten auf Baustellen nichtzu bewältigen.Im Tunnelbau, der zu den Bauarbeitenunter Tage zählt, ist es schon seit vielenJahren Stand der Technik, dass die diesel-betriebenen Maschinen und Fahrzeugemit einem DPF ausgestattet sein müssen.Bis vor wenigen Jahren war dagegen dieNotwendigkeit des Einsatzes von Maschi-nen und Fahrzeugen mit DPF bei Arbeitenin Hallen oder Tiefgaragen völlig unbe-kannt.
Ein Grund hierfür war sicherlich, dass imAnhang der alten Fassung der TRGS ledig-lich konkrete Schutzmaßnahmen bei Tun-nelbauarbeiten beschrieben waren. DerAnhang 1 der neuen TRGS behandelt nundie Bauarbeiten in kompletter Breite. Hierwird zuerst genau definiert, was unterBauarbeiten in ganz oder teilweise ge -schlossenen Arbeitsbereichen verstandenwird (Abb. 2) und welche Schutzmaßnah-men zur Einhaltung der AGW für Diesel-rußpartikel und Stickoxide getroffen wer-den müssen.Erstmalig werden in der Neufassung derTRGS auch Bauarbeiten im Freien be -schrieben (Abb. 3), bei denen aufgrund derEinhaltung der AGW keine weiterenSchutzmaßnahmen erforderlich sind.Die BG BAU hat zahlreiche Messungen beiBetonierarbeiten in Hallen und Tunneln
durchgeführt, bei denen ausschließlichstraßenzugelassene Betonmischer mitEURO-V-Motoren eingesetzt wurden. Kameine dieselbetriebene Betonpumpe ohneEURO-V-Motor zum Einsatz, wurden danndie Abgase direkt am Auspuff mit einerAbsaugung erfasst und ins Freie abgeleitet(Abb. 4).Die Ergebnisse der Messungen zeigen,dass – obwohl die Fahrzeuge keine Diesel-partikelfilter haben – der AGW für Diesel-rußpartikel eingehalten wird. Das ist vorallem der Tatsache geschuldet, dass die bei Bauarbeiten eingesetzten Fahrzeuge –anders als z.B. eine Erdbaumaschine –nicht über längere Zeit unter Volllast be -trieben werden, sondern diese nur zumBe- und Entladen in Hallen oder Tunnelneingesetzt werden. Daher sind bei Bau-arbeiten in ganz oder teilweise geschlos-
Abb. 2: Definition von ganz oder teilweise geschlossenen Arbeitsbereichen in Anhang 1 Nr. 3.2 der TRGS 554
Abb. 4: Betonpumpe in einer Halle
mit Absaugung am Auspuff
(1) Bauarbeiten in ganz oder teilweise geschlossenen Arbeitsbereichen im Sinne diesesAbschnitts dieser TRGS sind Arbeiten, die
1. in Hallen, die ein Dach bzw. eine Decke und mindes tens zwei Außenwände (auch mitÖffnungen, wie Türen/Tore, Fenster/Dachreiter) haben,
2. in Tiefgaragen oder anderen unter Erdgleiche befindlichen Räumen, die nicht als Bau-arbeiten unter Tage gelten,
3. in Zelten und Einhausungen, die ein Dach und mindes tens zwei Außenwände haben,
4. in fertiggestellten Tunnelbauwerken,
5. in Schächten oder Baugruben mit einer Grundfläche < 100 m2,
6. in Gräben und grabenähnlichen Arbeitsräumen, die mehr als schultertief sind oder
7. in Räumen
durchgeführt werden.
Abb. 3: Definition von Bauarbeiten im Freien in Anhang 1 Nr. 3.1 der TRGS 554
(1) Bauarbeiten im Freien im Sinne dieser TRGS sind Arbeiten, die
1. nicht in ganz oder teilweise geschlossenen Arbeitsbereichen,
2. in Schächten oder Baugruben mit einer Grundfläche > 100 m2, oder
3. in Gräben und grabenähnlichen Arbeitsräumen, die weniger als schultertief sind
durchgeführt werden.

BauPortal 7/2019 Baumaschinentechnik (Bagger, Lader) – Gefahrstoffe 35
senen Arbeitsbereichen straßenzugelas-sene Fahrzeuge mit EURO-V-Motoren auchohne DPF zulässig. Die Fahrzeuge mitMotoren der derzeit gültigen AbgasstufeEURO VI erfüllen die Forderungen derTRGS 554 ohnehin, da diese bereits abWerk, neben der SCR-Anlage zur Reduktionder Stickoxide, auch mit einem DPF ausge-stattet sind.Eine Einhaltung des AGW für Dieselruß-partikel zeigen auch die Messungen beimEinsatz von Maschinen und Fahrzeugenohne DPF ebenerdig im Freien. Bei der Aus-führung von Bauarbeiten im Freien sinddaher keine weiteren Schutzmaßnahmenim Hinblick auf die Gefährdungen durchAbgase von Dieselmotoren erforderlich(Abb. 5).Messungen in nach oben offenen Bau-gruben und Schächten im Freien zeigen,dass bei einer Grundfläche größer 100 m2
beim Einsatz von Baumaschinen ohne DPFder AGW für Dieselrußpartikel eingehal-ten wird. Baumaschinen können daher inBaugruben und Schächten über 100 m2
Grundfläche ohne DPF eingesetzt werden(Abb. 6); unter 100 m2 sind DPF erforder-lich.Bei simulierten Verdichtungsarbeiten mitdieselbetriebenen Rüttelplatten ohne DPFin einem 1,5 m breiten, 2 m tiefen und 15 m langen Graben im Freien wurdedagegen der AGW für Dieselrußpartikelüberschritten. Wenn die Rüttelplattennicht mit einem DPF nachgerüstet sind, istbeim Einsatz dieser Rüttelplatten in mehrals schultertiefen Gräben Atemschutz mitPartikelfilter zu tragen.Des Weiteren hat die BG BAU umfang-reiche Messungen der Stickoxidexpositio-nen auf Tunnelbaustellen durchgeführt.Aus den Ergebnissen konnten für den kon-ventionellen Tunnelbau die Rahmenbedin-
gungen für eine langfristige Einhaltungder AGW für die Stickoxide festgelegt wer-den. Bei Arbeiten auf anderen Baustellen,wie in Hallen oder Tiefgaragen, liegennoch nicht genügend Messungen vor, umeine Aussage über die Höhe der Stickoxid-exposition zu machen.Die Ergebnisse der bisher durchgeführtenMessungen von Dieselrußpartikeln undStickoxiden sowie die ggf. erforderlichenSchutzmaßnahmen sind in verschiedenenExpositionsbeschreibungen beschrieben[7]. In der Neufassung der TRGS 554 wirdin der Anlage 1 darauf verwiesen.Für den Einsatz von Maschinen der Abgas-stufe IV ohne DPF in ganz oder teilweisegeschlossenen Arbeitsbereichen könnenaufgrund fehlender Messungen keine Aus-sagen getroffen werden. Der Einsatz sol-cher Maschinen ist daher nur erlaubt,wenn der Nachweis zur Einhaltung desAGW für Dieselrußpartikel vor dem Beginnder Arbeiten erbracht werden kann. Mittlerweile bieten die Baumaschinenher-steller immer mehr Maschinen mit emis-sionsfreiem Antrieb – also mit Elektro-
motoren – an. Diese sind vor allem in be -engten und schlecht belüfteten Arbeits-bereichen wie in Räumen, Tiefgaragen vor-zugsweise einzusetzen. Gasmotoren zäh-len zu den emissionsarmen Antriebstech-niken.Eine technische Lüftung als alleinigeSchutzmaßnahme, um auf DPF zu verzich-ten, ist auf Baustellen i.d.R. nicht aus-reichend. Auf Tunnel- und Gleisbaustellenist eine technische Lüftung immer alsergänzende Maßnahme zum DPF erforder-lich (Abb. 7). Die entsprechenden Schutz-maßnahmenkonzepte für diese Bauarbei-ten werden im Anhang 1 der TRGS 554 inden Nummern 3.3 und 3.4 beschrieben.
ZusammenfassungDie neue TRGS 554 „Abgase von Diesel-motoren“ weist eine Reihe von Änderun-gen gegenüber der Fassung von 2008 auf. Der etwas missverständliche Begriff„Dieselmotoremissionen“ wurde durch„Dieselrußpartikel“ ersetzt und der Begriff„teilweise geschlossenen Arbeitsbereiche“,
Abb. 7: Belüftung einer Tunnelbaustelle
Abb. 6: Einsatz einer dieselbetriebenen Baumaschine in einem großen SchachtAbb. 5: Bei Bauarbeiten im Freien sind i.d.R. keine Schutzmaßnahmen gegen Abgasevon Dieselmotoren erforderlich

Baumaschinentechnik (Bagger, Lader) – Gefahrstoffe BauPortal 7/201936
der in der Praxis immer wieder zu unter-schiedlichen Interpretationen geführt hat,wurde jetzt eindeutig definiert. Bei derGefährdungsbeurteilung sind neben denDieselrußpartikeln nun auch die Stickoxidezu berücksichtigen. Ganz neu hinzu ge -kom men ist der Anhang 1 in dem Ab -schnitt 3 zu Bauarbeiten, wo die Maß-nahmen bei Bauarbeiten im Freien, inganz oder teilweise geschlossenenArbeitsbereichen, unter Tage sowie beiGleisbauarbeiten in fertiggestellten Tun-nelbauwerken nun konkret beschriebenwerden.
Literatur[1] Technische Regel für Gefahrstoffe:
Abgase von Dieselmotoren (TRGS 554).GMBl 2019 S. 88–104 [Nr. 6] (v. 18.3.2019)
[2] Technische Regel für Gefahrstoffe:Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900).BArBl. Heft 1/2006 S. 41–55, Zuletztgeändert und ergänzt: GMBl 2019 S. 117–119 [Nr. 7] (v. 29.3.2019)
[3] Begründung des AGW für Diesel-motoremissionen (DME) in TRGS 900(Fassung v. 26.9.2017) https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/900/900-dieselmotorenemissionen-dme-russpartikel-als-ec.pdf?__blob=publicationFile&v=5
[4] Technische Regel für Gefahrstoffe: Ver-zeichnis krebserzeugender Tätigkeitenoder Verfahren nach § 3 Abs. 2 Nr. 3GefStoffV (TRGS 906) BArbBl. Heft7/2005 S. 79–80. Zuletzt geändert und ergänzt GMBl 2007 S. 514 [Nr. 24](v. 27.4.2007)
[5] Technische Regel für Gefahrstoffe:Expositionsverzeichnis bei Gefährdunggegenüber krebserzeugenden oderkeimzellmutagenen Gefahrstoffen derKategorien 1A oder 1B (TRGS 410).GMBl 2015 S. 587-595 [Nr. 30] (v. 5.8.2015)
[6] Berufsgenossenschaft der Bauwirt-schaft: WINGIS online, https://www.wingisonline.de/
[7] Berufsgenossenschaft der Bauwirt-schaft: Expositionsbeschreibungen,https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/gefahrstoffe/gisbau/expositionsbeschreibungen/
Autoren:Dipl. Ing. (FH) Corinne ZieglerReferat GefahrstoffeBG BAU Prävention Dipl.-Ing. Ulf Spod, Referat TiefbauBG BAU Prävention
Mit der Betrieblichen Erklärung verpflichten sich Betriebsleitung und Beschäftigte, sich in ihrem Betrieb
für sichere Arbeitsbedingungen einzusetzen.Sie möchten mitmachen oder sich weiter zur
Betrieblichen Erklärung informieren? Besuchen Sie uns auf www.bau-auf-sicherheit.de oder schreiben
Sie uns an: [email protected]
IHRE UNTERSCHRIFT KANN LEBEN RETTEN.
16:49

Verdichtungstechnik / Erdbau BauPortal 7/201938
Der Arbeitsraum. Unendliche Breiten?Ermittlung und Festlegung von Arbeitsraumbreiten im Kanal- und Rohrleitungsbau in besonderen Situationen
Dipl.-Ing. Volker Münch, Berlin
Die Anforderungen an die Arbeitsraum-breiten resultieren aus dem Arbeitsschutz-gesetz (ArbSchG), der nachgeordnetenArbeitsstättenverordnung (ArbStättV) undden Technischen Regeln für Arbeitsstät-ten (ASR), hier insbesondere der ASR A1.2„Raumabmessungen und Bewegungsflä-chen“.
Arbeitsräume müssen eine ausreichendeGrundfläche und eine, in Abhängigkeit vonder Größe der Grundfläche der Räume,ausreichende lichte Höhe aufweisen, sodass die Beschäftigten ohne Beeinträch-tigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheitoder ihres Wohlbefindens ihre Arbeit ver-richten können. Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss dabei so be -messen sein, dass sich die Beschäftigtenbei ihrer Tätigkeit ungehindert bewegenkönnen (ArbStättV). Bei der Bemessungdieser Räume werden die Körpermaße desMenschen zugrunde gelegt. Hinzu kom-men notwendige Räume z.B. für die Hand-habung von Arbeitsmitteln.
Der Unternehmer ist gehalten, sich bei der Bemessung dieser Arbeitsräume u.a.am Stand der Technik zu orientieren. Die-ser ist bezogen auf die Arbeitsraumbrei-ten im Kanal- und Rohrleitungsbau in den Normen DIN 4124 „Baugruben undGräben – Böschungen, Verbau, Arbeits-raumbreiten“ und DIN EN 1610 „Einbauund Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“ beschrieben. Die Normen gebenkonkrete Werte für die Arbeitsraumbreitenvor, in Abhängigkeit des äußeren Rohr-schaftdurchmessers bzw. der Grabentiefe.Dabei wurden in der Norm übliche Verfah-ren zum Zusammenfügen und Verdich-ten der Rohrleitung zugrunde gelegt. Dielichte Arbeitsraumbreite wird dabei i.d.R.zwischen den Verbauplatten gemessen.
Kommen nun andere Verfahren zum Ein-satz, kann es sein, dass dadurch der vorhandene Arbeitsraum weiter einge-schränkt wird. In solchen Fällen muss auch
der Arbeitsraum angepasst werden. Ab-bildung 1 zeigt eine Abwasserleitung DN 1200 aus Grauguss. Die einzelnenRohre werden mit Hilfe von Kettenzügenzusammengezogen. In den Muffen ist eineDichtung eingelegt (Abb. 2), die für dieMontage mit Klammern (Abb. 3) fixiertwerden muss.
Die Kettenzüge liegen vor der Rohrleitung.Der Abstand der Ketten bestimmt sichdurch den Überstand der Muffe bzw.durch die des Hebelzugs. In diesen Berei-chen müssen notwendige Arbeiten vor-genommen werden. Zum einen das An-ziehen der Ketten, zum anderen das Ent-
fernen der Montagesicherungen rings umdie Muffe herum. Der dabei notwendigePlatzbedarf ergibt sich aus den Körper-maßen des Menschen (s.o.) und den beidieser Tätigkeit notwendigen Bewegungs-abläufen. Dabei kann herauskommen,dass mehr Platz benötigt wird, als es dieo.g. Normen vorgeben.
Im vorliegenden Beispiel ergibt sich nachTabelle 1 der DIN EN 1610 (Abb. 4) beieinem äußeren Rohrdurchmesser vonODh = 1,26 m eine Mindestgrabenbreitevon 2,11 m, was einem Arbeitsraum von43 cm links und rechts des Rohrschaftesentspricht. Bei der Simulation der Tätig-
Der innerstädtische Kanal- und Rohrleitungsbau ist verschiedenen Zwängen unterworfen. Knapp bemessene Bauzeiten,räumliche Enge und eine Verdichtung des Straßenverkehrs erfordern einen hohen Aufwand an Planung und Steuerungder Baumaßnahme. Neben den technischen Anforderungen an eine solche Baumaßnahme müssen auch die Anforderun-gen des Arbeitsschutzes beachtet werden. Gerade die räumliche Enge der Baustellen kann dazu führen, dass die für dieBeschäftigten benötigten Arbeitsräume nicht zur Verfügung stehen, insbesondere dann, wenn Bauverfahren eingesetztwerden, die eigentlich größere Arbeitsräume erforderlich machen.
Abb. 1: Rohrleitung mit Kettenzug zusammengezogen Abb. 2: Montage des Dichtungsrings zur Simulationder Arbeitsraumbreite außerhalb des Grabens
Abb. 3: Klammern zur Fixierung des Dichtrings –diese müssen nach der Rohrmontage auch wieder entfernt werden

BauPortal 7/2019 Verdichtungstechnik / Erdbau 39
keiten außerhalb des Grabens wurde fest-gestellt, dass mit einem Arbeitsraum vonca. 50 cm, gemessen von der Muffe, dieArbeiten sinnvoll ausgeführt werden kön-nen. Der Außendurchmesser des Rohresbeträgt an den Muffen 1,42 m. Darausergibt sich eine erforderliche Grabenbreitevon 2,42 m also rund 30 cm mehr als nachTabelle 1. Die Arbeiten werden bei jedemeinzelnen Rohrelement, auf beiden Seitender Rohrleitung, durchgeführt. Das be-deutet, dass der Arbeitsraum über die ge -samte Länge der Baumaßnahme benötigtwird. Bei einer mittleren Grabentiefe von2,5 m ergibt sich damit ein Mehraushubvon ca. 0,75 m3 je Meter Graben.
In der Praxis sollte der Unternehmer dieseÜberlegungen im Vorfeld anstellen unddie Arbeiten wie gezeigt simulieren. Sokann der tatsächliche Platzbedarf ermit-telt werden. Der Graben kann in der ent-sprechenden Breite angelegt werden.
In diesem Zusammenhang ergibt sich dieFrage, wer die Kosten für den Mehraushubträgt. Das lässt sich pauschal so nichtbeantworten, da hier das Arbeitsschutz-recht und die individuelle Vertragsgestal-tung berücksichtigt werden müssen.
Das Arbeitsschutzrecht richtet sich inerster Linie an den Unternehmer. Dieser istfür die Einhaltung der Vorgaben verant-wortlich und kann haftbar gemacht wer-den, wenn Mängel bestehen. Der Unter-nehmer muss also dafür sorgen, dass dieoben beschriebenen Regelungen zu denArbeitsraumbreiten eingehalten werden.
Das Arbeitsschutzrecht richtet sich mit derBaustellenverordnung aber auch an denBauherrn. Dieser ist nach § 2 der Baustel-lenverordnung (BaustellV) verpflichtet, dieallgemeinen Grundsätze des § 4 ArbSchGbereits in der Planung des Bauvorhabenszu berücksichtigen. Das bedeutet, dass u.a. die Arbeit so zu gestalten ist, dassGefährdungen für die physische Gesund-
heit möglichst vermieden werden und derStand von Technik und ArbeitsmedizinBerücksichtigung findet. Das gilt insbe-sondere für bauliche Gegebenheiten, aufdie das ausführende Unternehmen nurbegrenzten oder gar keinen Einfluss hat.Das betrifft im beschriebenen Beispiel z.B. die Leitungsführung und die vorge-gebenen Baustoffe (Rohrleitung) und diedaraus resultierenden Verfahren zum Ein-bau. Überlässt der Bauherr in der Ausschrei-bung dem ausführenden Unternehmendie Wahl des Arbeitsverfahrens undschreibt das Anlegen des Grabens nur mitden Minimalbreiten nach Norm aus, dannläuft er Gefahr, dass es mit dem Auftrag-nehmer zu Auseinandersetzungen überdie Vergütung kommt. Es bleibt dannunklar, ob der Auftragnehmer das Arbeits-verfahren (ggf. gibt es alternative Möglich-keiten) an die Mindestgrabenbreiten nachDIN anpassen muss oder ob die vorge-gebenen Grabenbreiten an das gewählteVerfahren anzupassen sind.Es ist somit für beide Parteien sinnvoll,wenn der Bauherr in der Ausschreibungdas Arbeitsverfahren vorgibt, und die not-wendigen Arbeitsraumbreiten für dieses
Verfahren selbst bestimmt. Er kann danndie Ausschreibung entsprechend gestaltenund ist dann sicher vor Bauverzögerungenund Nachträgen. Die unternehmerischeFreiheit, das Arbeitsverfahren selbst zuwählen wird dadurch nur unwesentlicheingeschränkt. Es steht dem Unternehmerfrei, ein Nebenangebot mit einem anderenVerfahren abzugeben.
FazitAuch im Kanal- und Rohrleitungsbau können sich Arbeitsraumbreiten ergeben,die über das in den einschlägigen Nor-men beschriebene Maß hinausgehen. DieGrundlage ist die Beurteilung des für denEinbau der Rohrleitung gewählten Arbeits-verfahrens und die daraus resultierendenArbeitsschritte bzw. die dabei entstehen-den Bewegungsabläufe. Wird dieses Ver-fahren bereits in der Ausschreibung be -schrieben, können im Nachgang Verzöge-rungen und Streitigkeiten vermieden wer-den.
Dipl.-Ing. Volker MünchReferat Tiefbau
BG BAU Prävention
Abb. 4: Tabelle 1 aus DIN EN 1610

Abdichtungstechnik / Bautenschutz / Bauchemie BauPortal 7/201942
GISCODE für Beschichtungsstoffe Über WINGIS können komfortabel und schnell Gefahrstoffinformationen zu diesen Produktgruppen abgerufen werden
Mögliche Gefahren beim VerarbeitenBei der Verarbeitung von wasserbasiertenProdukten besteht eine Gefährdung durchAugen- und Hautkontakt. Einige Produktekönnen allergische Reaktionen hervorru-fen. Bei der Verarbeitung von lösemittel-haltigen Produkten besteht neben derGefährdung durch Augen- und Hautkon-takt auch die durch Einatmen und Brand-und Explosionsgefährdungen. Es ist zubeachten, dass Lösemitteldämpfe schwe-rer als Luft sind und sich am Boden und inHohlräumen anreichern und in benach-barte Bereiche vordringen können.
GISBAUGISBAU, das Gefahrstoffinformationssys -tem der BG BAU, erstellt seit vielen JahrenInformationen zur sicheren Verarbeitungvon Gefahrstoffen beim Bauen, Renovie-ren und Reinigen. Dabei wird besonde-rer Wert auf einfache und verständlicheSprache der Informationen gelegt. Hierzuwurde die Software WINGIS entwickelt.Grundlage dieser Informationen sind u.a.die Sicherheitsdatenblätter und die Tech-nischen Merkblätter.
ProduktgruppenDa über eine große Vielzahl von sich imEinsatz befindlichen bauchemischen Pro-dukten informiert wird, hat es sich be -währt, Produkte mit ähnlicher chemischerZu sammensetzung und ähnlichem Ein-satzzweck zu Produktgruppen zusammen-zufassen. Von den Produkten einer Gruppegehen vergleichbare Gesundheitsgefahrenaus, sodass auch die Schutzmaßnahmenund Verhaltensregeln für alle Produktedieser Gruppe zutreffend sind. Die Beurtei-lung jedes Einzelproduktes kann entfallen.So ergibt sich die Möglichkeit, Informatio-nen in einer überschaubaren Anzahl zurVerfügung zu stellen.Für viele Bereiche in der Bauwirtschaftgibt es bereits solche Produktgruppen.Einen Bereich stellen hierbei die Farbenund Lacke bzw. die Beschichtungsstoffedar. Über diese Produkte wurde von 1993
bis 2016 über den Produkt-Code für Far-ben und Lacke informiert (M-Codes, be-stehend aus 40 Produktgruppen inkl. derAbbeizer). Rezepturänderungen und derWunsch, die Anzahl der Produktgruppenin diesem Bereich zu verringern, machteeine Überarbeitung bzw. einen Neustartnotwendig. Seit 2017 werden die Farbenund Lacke den Produktgruppen des GISCO-DEs für Beschichtungsstoffe (z.B. BSW10oder BSL10, insgesamt 12 Produktgruppenohne Abbeizer und Verdünnungsmittel)zugeordnet. Beide Codes laufen noch füreine Übergangszeit parallel, sodass beideCodierungen noch gültig sind. Für dieAbbeizer und Verdünnungsmittel sindneue Produktgruppen sowie GISCODEs inVorbereitung.
GISCODE für BeschichtungsstoffeDer GISCODE für Beschichtungsstoffe be -steht aus einem wasserbasierten und löse-mittelbasierten Teil. Darin enthalten sind
zurzeit jeweils 6 Produktgruppen (sieheunten). Innerhalb der Produktgruppenkönnen Produkte mit einer geringerenGefährdung leicht erkannt werden, da mitder Größe der Zahl im GISCODE auch dieGefährdung steigt.Die Zuordnung der Produkte in die ent-sprechende Produktgruppe mit dem zuge-hörigen GISCODE erfolgt über die Krite-rien des Einstufungskatalogs, welche imInternet heruntergeladen werden können.Vorgenommen wird dies i.d.R. durch dieHersteller der Produkte. Die Hersteller von Beschichtungsstoffensetzen in ihren Produkten vereinbarungs-gemäß keine krebserzeugenden, erbgut-verändernden oder fortpflanzungsgefähr-denden (fruchtbarkeits- und entwick-lungsschädigenden) Stoffe der Kategorien1a, 1b und 2 oberhalb der Berücksich-tigungsgrenzen (i.d.R. 0,1 %) ein. Aus-nahmen bilden Formaldehyd (-abspalter),Sikkative und Oxime wie Butanonoxim
Beschichtungsstoffe sind Farben und Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis. Sie sind sehr komplex zusammengesetztund bestehen oft aus Dutzenden von Einzelstoffen (Lösemittel, Bindemittel, Additive, Pigmente und Füllstoffe). Sie können durch Handanstrich oder im Sprüh- oder Spritzverfahren aufgetragen werden. In diesem Artikel wird auf dieeinkomponentigen Beschichtungsstoffe eingegangen. Zweikomponentige Beschichtungsstoffe wie Epoxidharze undPolyurethanharze werden hier nicht beschrieben.
GISCODE Produktgruppen
BSW10 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, konservierungsmittelarm
BSW20 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert
BSW30 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, lösemittelhaltig
BSW40 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, alkalisch
BSW50 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, lösemittelhaltig, filmgeschützt
BSW60 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, alkalisch, ätzend
GISCODE Produktgruppen
BSL10 Beschichtungsstoffe, lösemittelbasiert, aromatenfrei
BSL20 Beschichtungsstoffe, lösemittelbasiert, aromatenfrei, gekennzeichnet
BSL30 Beschichtungsstoffe, lösemittelbasiert, aromatenhaltig, gekennzeichnet
BSL40 Beschichtungsstoffe, stark lösemittelbasiert, aromatenfrei, gekennzeichnet
BSL50 Beschichtungsstoffe, stark lösemittelbasiert, aromatenhaltig, gekennzeichnet
BSL60 Beschichtungsstoffe, lösemittelbasiert, krebsverdächtige Inhaltsstoffe, gekennzeichnet

BauPortal 7/2019 Abdichtungstechnik / Bautenschutz / Bauchemie 43
und Acetonoxim. Als Lösemittel werdenaromatenfreie und aromatenhaltige Koh-lenwasserstoffgemische verwendet. Da-neben werden noch andere Lösemittel (z.B. Alkohole, Glykole usw.) in einer Kon-zentration < 10 % (Gewichts-% bezogenauf das Produkt) eingesetzt. Liegt der Aromatengehalt im Produkt unter 1 %,erfolgt eine Einstufung in die Gruppen„aromatenfrei“, ab 1 % sind die Produktein die Gruppen „aromatenhaltig“ zuzu-ordnen. Beschichtungsstoffe mit Niedrig-siedern wie Aceton können nicht codiertwerden.Die Hersteller ordnen ihre Produkte eigen-verantwortlich den jeweiligen Produkt-gruppen zu. Wichtig in diesem Zusam-menhang ist auch die Übermittlung derSicherheitsdatenblätter aller Farben undLacke für den Bausektor an GISBAU.
GISCODE im Sicherheitsdatenblatt und auf dem GebindeGISBAU überprüft die Zuordnung unddanach kann der entsprechende GISCODEim Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 7 oder15), im Technischem Merkblatt und ins-besondere auch auf dem Gebinde des Produkts angegeben werden. Über denGISCODE ist so eine einfache Zuordnungdes Produkts zu den Informationen zumArbeits- und Gesundheitsschutz gegeben.Mit der Software WINGIS der BG BAU lassen sich ausführliche Informationenund entsprechende Betriebsanweisungenanzeigen und bearbeiten. Für viele wei-tere Bereiche neben dem GISCODE fürBeschichtungsstoffe ist diese Vorgehens-weise bereits umgesetzt. Einige Beispiele:• Kleber und Vorstriche• Beschichtungsstoffe• Epoxidharze• Polyurethanharze • MMA – Systeme• Zementhaltige Zubereitungen• Parkettsiegel• Reiniger • Holzschutzmittel • Betontrenn-/Zusatzmittel• Bitumenhaltige Produkte• Säureschutzbau
WINGISWINGIS, die Gefahrstoffsoftware der BG BAU, bietet neben den Informationenzur sicheren Verarbeitung von Gefahr-stoffen beim Bauen, Renovieren und Reini-gen auch verschiedene Module zur Hilfe-stellung beim Gefahrstoffmanagement.WINGIS unterstützt kostenfrei bei derGefährdungsbeurteilung und bietet Be -triebsanweisungsentwürfe in mehreren
Sprachen an. Darüber hinaus bietet dasProgramm auch ein Modul an, mit demBetriebsanweisungen selbst erstellt wer-den können.Für die Suche nach den Informationenbzw. der Betriebsanweisung wird in WINGIS im Feld „Gefahrstoffsuche“ der(Produktname, GISCODE etc.) eingegeben.In der Ergebnisliste (Abb. 3) kann dann die gewünschte Information ausgewähltund anschließend über die Kachel Be -
triebs anweisung angezeigt werden. VieleBetriebsanweisungen werden zudem noch nach der Verarbeitungsart und demVerarbeitungsort unterschieden angebo-ten.Die Betriebsanweisung erscheint stan-dardmäßig in deutscher Sprache (Abb. 4),steht jedoch auch in 15 weiteren Sprachenzur Verfügung.Ein vorhandener Betriebsanweisungsent-wurf kann nach Übergabe als Word-Datei
Abb. 1: GISCODE auf dem Gebinde eine Lackdose
Abb. 3: Suchergebnis
Abb. 2: Startseite WINGIS mit Sucheingabefeld

Abdichtungstechnik / Bautenschutz / Bauchemie BauPortal 7/201944
durch geringfügige Änderungen ange-passt werden. So besteht eine einfacheMöglichkeit, auch für Produkte, die nicht in WINGIS vorhanden sind, eine Betriebs-anweisung zu generieren.Die Betriebsanweisung muss noch arbeits-platzbezogen ergänzt werden.Für die komplett eigenständige Erstel-lung einer Betriebsanweisung gibt es alsBe standteil von WINGIS das Modul„Betriebsanweisung erstellen“. Ein nütz-liches Werkzeug für das Erstellen undGestalten einer Betriebsanweisung. DiesesModul bietet zu jedem Kapitel eine pas-sende Auswahl von unterschiedlichenStandardsätzen, mit denen sich die Be -triebsanweisung leicht aufbauen lässt.Diese Betriebsanweisungen stehen dannauch direkt in 16 Sprachen zur Verfü-gung. Selbstverständlich kann auch eige-ner Text eingetragen werden sowie eineVielzahl von Symbolen und Piktogrammengenutzt werden.
Links – weitere Informationenwww.wingis.de – alles zum Thema (WINGIS online, Handbuch, Downloads, etc.)www.wingismobile.de – WINGIS für Smartphones
LiteraturEinstufungskatalog für Beschichtungsstoffe, Farben und Lacke (www.gisbau.de)
Jörg GalloReferat GISBAU
BG BAU Prävention
Abb. 4: Entwurf Betriebsanweisung
Abb. 5: Betriebsanweisung selbst erstellen
Sicher ist sicher!Kompendium Arbeitsschutz –Die Toolbox der BG BAU
Das Kompendium Arbeitsschutz ist aus schließlich zu beziehen über:Jedermann-Verlag GmbH, Postfach 10 31 40, 69021 Heidelberg, Tel.:06221/1451-0, Fax: 06221/27870,E-Mail: [email protected] DVD ist für Mitgliedsbetriebe der BG BAU zum Preis von nur 47,– € erhältlich (Update 30,– €). Der Preis für andere Interes sentenbeträgt 200,– € (Update 95,– €).Die ange gebenen Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versand -kosten, die Update-Ermäßigung gilt nur für die jeweilige Vorversion.Netzwerkfassung und Schulungslizenzen auf Anfrage.www.jedermann.de/download/BG-BAU-Wegweiser19-Demo.exe
• Vorschriften und Regelwerke mit Berufs-genossenschaftlichen und staatlichen Regeln, inkl. Bausteinen, Muster-Betriebs-anweisungen, Unterweisungshilfen, Formularen, Prüflisten.
• Symbolbibliothekmit Symbolen aus den Bereichen Arbeitsschutz, Brandschutz undStVO. Aus Unfällen lernen mit Unfall-schilderungen zum Zusammenstellen von Präsentationen. E-Learning Software zur Fortbildung im Kanalbau und von befähig-ten Personen für die Gerüstbenutzung.
Ihre „Werkzeugkiste“ für die Arbeitsschutz-organisation in Unternehmen der Bauwirtschaft als Einzelplatz- oder Netzwerkfassung.
• BG BAU-Wegweisermit Arbeitsschutz-Organisation inkl. Verwaltung von Schulungen und Unterweisungen, Vorsorgenund Eignungsuntersuchungen, Arbeits-mitteln und PSA, Gefahrstoffkataster, Gefährdungsbeurteilung, SIGE-Plan, Unter-lage für spätere Arbeiten, Terminerinnerung,Unfallstatistik, AMS-BAU, SCC-Mitarbeiter-fragenkatalog u.v.m.

Arbeits- und Schutzkleidung / PSA BauPortal 7/201950
Fußschutz gehört zur persönlichen Schutz-ausrüstung (PSA) und muss das CE-Zei-chen tragen: Vor der Auswahl und derBenutzung des Fußschutzes hat derArbeitgeber eine Beurteilung der Arbeits-und Einsatzbedingungen durchzuführen.Also eine Gefährdungsbeurteilung. Sie be -steht aus der Gefährdungsermittlung undder Bewertung des Risikos. Die Gefähr-dungsbeurteilung beinhaltet Art und Um -fang der Gefährdungen, die Gefährdungs-dauer sowie persönliche Voraussetzungendes Beschäftigten und letztendlich dieausgewählte Schutzmaßnahme.Eine Gefährdung ist immer dann vorhan-den, wenn Verletzungen durch Ausrut-schen möglich sind oder wenn mit Fußver-letzungen zu rechnen ist. Insbesonderedurch Stoßen, Einklemmen, umfallende,herabfallende oder abrollende Gegen-stände, Hineintreten in spitze Gegen-stände, Hitze oder Kälte sowie Chemika-lien. Ergibt die Gefährdungsbeurteilung,
dass bei der Arbeit eine der genanntenGefahren für die Füße besteht, dann mussseitens des Arbeitgebers ein entsprechen-der Fußschutz zur Verfügung gestellt undvom Arbeitnehmer auch getragen werden.Das Gebotsschild „Fußschutz benutzen“weist alle Beschäftigten unmissverständ-lich auf diese Pflicht hin.In der Europäischen Union werden auf-grund unterschiedlicher Normen für dengewerblichen Einsatz drei verschiedeneSchuharten unterschieden, nämlich Be -rufs schuh, Schutzschuhe und Sicherheits-schuhe. In Deutschland sind nur Berufs-schuhe und Sicherheitsschuhe von Bedeu-tung. Schutzschuhe, die ein geringeresSchutzniveau als Sicherheitsschuhe auf-weisen, finden sich so gut wie gar nicht im Markt. Berufsschuhe tragen die Kurz-bezeichnung „O“. Sie verfügen zwar überein oder mehrere schützende Bestand-teile, jedoch über keine Zehenschutzkappe.Sicherheitsschuhe tragen die Kurzbezeich-
nung „S“ und sind mit einer Zehenschutz-kappe für hohe Belastungen ausgestattet.Über die Grundanforderungen hinaus sindsicherheitstechnische Zusatzanforderun-gen möglich. Für Sicherheitsschuhe (DINEN ISO 20345) und Berufsschuhe (DIN ENISO 20347) wurden die meistbenutztenKombinationen der Grund- und sicher-heitsrelevanten Zusatzanforderungen zu -sammengefasst und Kategorien für derenKennzeichnung vergeben. Die Kurzzeichenbestehen aus einer Kombination vonBuch staben bzw. von Buchstabe(-n) undZiffer. Anhand der Kennzeichnung könnenso die Schutzfunktionen erkannt und dergeeignete Schuh ausgewählt werden.Darüber hinaus gibt es aber noch wei-tere Sonderschuharten, wie z.B. Schnitt-schutzstiefel, Strahlerstiefel oder Schwei-ßerschuhe.
Einzelanfertigung oder ZurichtungFerner gilt es, eine orthopädische Ver-sorgung mit Fußschutz zu ermöglichen.Hierunter ist ein spezieller Fußschutz zuverstehen, der jedoch ebenso die erfor-derlichen Prüfungen und Zertifizierun-gen durchlaufen muss. Zu Beginn mussein Orthopäde aufgrund der medizi-nischen Erfordernisse die Indikation fest-legen. Die handwerkliche Umsetzungerfolgt dann später durch entsprechendautorisierte Fachkräfte (z.B. Orthopädie- schuh macher/in). Beim orthopädischen Fußschutz ist grund-sätzlich zu unterscheiden, ob es sich umdie handwerkliche Herstellung eines Maß-schuhes (Einzelanfertigung auf Grund-lage eines individuellen Leistens) oder umdie individuelle orthopädische Zurichtung(Änderung) eines industriell gefertigtenSchuhes handelt. Es gibt eine Vielzahl vonindustriell gefertigtem Fußschutz, welcherentsprechend den individuellen orthopä-
Abb. 1: Der Einsatz von Fußschutz ist erforderlich, wenn die Gefährdungsbeurteilung es ergibt(Foto: Boris Zerwann Fotolia)
Möglichkeiten des orthopädischen Fußschutzes und der KostenübernahmeDipl.-Ing. Andreas Vogt, Berlin
Wenn sowohl Fußschutz als auch eine orthopädische Versorgung bei Beschäf-tigten gewährleistet sein sollen, ist eine Baumusterprüfung für die Schuhe, die orthopädischen Fußschutz bieten – also beides kombinieren – notwendig. Die Anpassung oder Anfertigung von orthopädischem Fußschutz ist meist mithöheren Kosten verbunden. Einen Teil der Kosten zahlt das jeweilige Unter-nehmen, für den anderen Teil können bei anderen Kostenträgern Anträgegestellt werden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.
(Grafik
: H.ZW
EI.S)

BauPortal 7/2019 Arbeits- und Schutzkleidung / PSA 51
dischen Erfordernissen angepasst, sprichzugerichtet werden kann. Bei der Zurich-tung kommen zum einen die unterschied-lichen Arten der Absatz-, Sohlen- und Soh-lenranderhöhungen sowie Abrollhilfen,zum anderen die individuelle Versorgungmit orthopädischen Einlagen in Betracht.Auch das Zusammenstellen eines Schuhsim Baukastensystem kann zur Anwen-dung kommen.
Die Zurichtung industriell gefertigterSchuhe bietet eine Vielzahl von Vorteilenwie z.B. ein großes Auswahlspektrum hinsichtlich sicherheitstechnischer Eigen-schaften, eine höhere individuelle Aus-wahlmöglichkeit hinsichtlich Weite undGröße, eine schnelle Verfügbarkeit/Ver-sorgung, da die Schuhe i.d.R. lagerseitigvorhanden sind sowie eine vielfach höhereWirtschaftlichkeit gegenüber Maßschu-hen. Auch bei orthopädischem Fußschutzist die Bereitstellung eines zweiten Paaressinnvoll.
Bei der Auswahl des geeigneten ortho-pädischen Fußschutzes sind auf derGrundlage der medizinischen Erforder-nisse selbstverständlich auch wirtschaft-liche Aspekte zu berücksichtigen. Dennnicht jede Sohlenerhöhung oder ortho-
pädische Einlage erfordert die Anfertigungorthopädischer Maßschuhe. Nur wenn das Rehabilitations- oder Teilhabeziel nichtmit konfektioniertem oder semikonfek-tioniertem Schuhwerk zu erreichen ist,besteht die Indikation für orthopädischeMaßschuhe. Weil derartige Schuhe indivi-duell anzupassen sind, entstehen gegen-über den üblichen Sicherheitsschuhenerhöhte Kosten, ferner dauert die Bereit-stellung länger.
Gefährdungsbeurteilung als Basis für FußschutzmaßnahmenDa an das Sachgebiet Fußschutz im Fach-bereich Persönliche Schutzausrüstungender DGUV zunehmend Anfragen zur The-matik „Orthopädischer Fußschutz“ gestelltwerden, hat man eine Gesamtbetrach-tung der Thematik vorgenommen, in derauch mögliche Kostenträger benannt wer-den. Ist im Ergebnis der Gefährdungsbe-urteilung die Benutzung von Fußschutzerforderlich und liegt die entsprechendemedizinische Indikation vor, finden dienachstehenden Ausführungen für dieBereitstellung von orthopädischem Fuß-schutz Anwendung.
Baumusterprüfung sowohl für Schuh als auch für orthopädische EinlageFußschutz (z.B. Berufs-, Schutz- oder Sicher- heitsschuhe) gehört mindestens der Zerti-fizierungskategorie II an. Dies geht auchaus der neuen EU-VERORDNUNG 2016/425 vom 9. März 2016 über persönlicheSchutzausrüstungen hervor, welche diePSA-Richtlinie aufhob.
Diese Forderung gilt auch für orthopä-dischen Fußschutz. Für jeden orthopä-dischen Fußschutz muss zwingend eineEU-Baumusterprüfbescheinigung vorlie-gen. Schuh und orthopädische Einlagemüssen in Kombination die Baumuster-prüfung positiv durchlaufen. Die sicher-heitstechnisch relevanten Prüfungen erfol-gen dabei grundsätzlich am/im verbautenSchuh.
Nur auf dieser Grundlage können dieSchuhe, die gemäß der Fertigungsanlei-tung zugerichtet oder gefertigt wurden,mit dem CE-Zeichen vor dem Inverkehr-bringen gekennzeichnet werden. Inver-kehrbringer können z.B. Hersteller vonorthopädischen Schuhen (z.B. Orthopä-dieschuhmachermeister/-in) sein. Dem
Arbeitsschutzprämien
Die BG BAU fördert den Arbeitsschutz durch Zuschüsse und Prämien
• Ihre Investitionen in ausgewählte unfallverhütendeProdukte oder gesundheitserhaltende Maßnahmenbelohnen wir mit Prämien von bis zu 3.000 EUR.
• Das lohnt sich doppelt für Sie: Arbeitsunfälle, Berufs-krankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahrenkönnen in Ihrem Betrieb weiter reduziert werden.
Wer ist antragsberechtigt?• Antragsberechtigt sind gewerbliche Mitgliedsunter-
nehmen der BG BAU ab einem Beschäftigten undeinem BG-Beitrag von mindestens 100 EUR pro Jahr.
• Einzelunternehmer (ohne Beschäftigte) mit freiwilligerVersicherung sind ebenfalls antragsberechtigt.Me r Informationen und alle Arbeitsschutzprämienfinden Sie unter www.bgbau.de/praemien.
Bis zu 3.000 EUR
Wol
�lse
r – F
otol
ia

Arbeits- und Schutzkleidung / PSA BauPortal 7/201952
Notwendigkeitsbescheinigung, die aufden Ergebnissen der Gefährdungsbeurtei-lung basiert. Orthopädischer Fußschutz ist leistungs-rechtlich dem Bereich der beruflichenReha bilitation zuzuordnen. Die Kosten-übernahme erfolgt nach positiver Prüfungdes Antrags durch den entsprechendenTräger der beruflichen Rehabilitation undTeilhabe behinderter Menschen amArbeitsleben. Das Unternehmen muss grundsätzlich vonden Gesamtkosten nur den Betrag auf-wenden, den es für einen Fußschutz ohneorthopädische Veränderung aufgewendethätte. Vor einer Auftragsvergabe mussjedoch eine Zusage des Kostenträgers vorliegen. Kostenträger können beispiels-weise die gesetzlichen Unfallversicherun-gen wie die BG BAU sein, wenn die Fuß-schädigung als Folge eines Arbeitsunfallseinschließlich eines Unfalles auf demWege von und zur Arbeit oder einerBerufs krankheit eingeordnet wird. Oben-stehende Liste zeigt eine Auswahl der inFrage kommenden Träger, Voraussetzun-
gen zur Kostenübernahme und die jeweilsgültigen Rechtsgrundlagen der Kostenträ-ger. Die Entscheidung über die Zuständig-keit ist an die Reihenfolge gebunden.
Die Liste erhebt nicht den Anspruch aufVollständigkeit. Nicht gelistete Kosten-träger (Leistungsträger) müssen direktangefragt werden.
Autor:Dipl.-Ing. Andreas VogtBG BAU PräventionLeitung Sachgebiet Fußschutz im Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen der DGUV
Sachgebiet sind keine orthopädischen Einlagen bekannt, die rechtskonform injedem x-beliebigen Sicherheits-, Schutz-oder Berufsschuh eingebaut werden kön-nen.
Das „4-Stufen-Modell“ für baumustergeprüften FußschutzDas Sachgebiet „Fußschutz“ favorisiert das nachfolgend aufgeführte „4-Stufen-Modell“ für baumustergeprüften Fuß-schutz. • Stufe 1 –
Sohlenerhöhung bis zu 3 cm, Zehenkappenvergrößerung
• Stufe 2 –Orthopädische Einlagenversorgung
• Stufe 3 –Spezielle Fertigungsweise/Bausätze für orthopädische Zurichtungen
• Stufe 4 –Orthopädische Maßschuhe
Leistungsspektrum der Schuhhersteller Welche Variante ist jedoch für den jewei-ligen Einzelfall die richtige und welcherSchuhhersteller kann was liefern? DieSchwierigkeit für den Anwender bestehtbekanntlich darin, dass nicht jeder Schuh-hersteller alle Varianten und Ausführun-gen von orthopädischem Fußschutz an-bietet. Deshalb hat das Sachgebiet „Fuß-schutz“ online unter www.dguv.de/fb-psa/sachgebiete/sachgebiet-fussschutz/orthopaedischer-fussschutz Schuhherstel-lern die Möglichkeit gegeben, auf freiwil-liger Basis ihr Leistungsspektrum zu bau-mustergeprüftem orthopädischem Fuß-schutz zu präsentieren. Der jeweilige Her-steller ist für die Richtigkeit und Aktualitätder Angaben zu seinen Produkten ver-antwortlich. Eine qualitative Bewertungder aufgeführten Produkte durch denFach bereich PSA/Sachgebiet Fußschutzfindet nicht statt.
Regelungen zur Kostenübernahme für orthopädischen Fußschutz Da derartige Schuhe individuell angepasstwerden müssen, entstehen z.B. gegen-über üblichen Sicherheitsschuhen erhöhteKosten, die vom Unternehmen nicht alleinübernommen werden müssen. Wichtig ist,dass die zu versorgende Person bei derbetrieblichen Tätigkeit auf das Tragen vonFußschutz angewiesen ist. Dies belegt dasUnternehmen durch eine entsprechende
Kostenträger (Leistungsträger) Voraussetzungen
1. Gesetzliche Unfallversicherungsträger, z. B.:
− Gewerbliche Berufsgenossenschaften,
− Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft,
− Gemeindeunfallversicherungsverbände,
− Unfallversicherung Bund und Bahn
− Unfallkassen
� Fußschädigung als Folge eines Arbeitsunfalls einschließ-
lich eines Unfalles auf dem Wege von und zur Arbeit oder
einer Berufskrankheit.
Rechtsgrundlage: §§ 26, 35 SGB VII - Gesetzliche Unfallversi-
cherung
2. Träger der Kriegsopferversorgung
und –fürsorge
(Hauptfürsorgestellen, Landesversorgungsämter und
Versorgungsämter sowie örtliche Fürsorgestellen)
� Kein Anspruch auf Leistungen nach Nr. 1.
� Fußschädigung durch militärische oder militärähnliche
Dienstverrichtungen, durch Kriegseinwirkung, Kriegsge-
fangenschaft oder Internierung, durch Ausübung des
Wehrdienstes oder des Zivildienstes.
Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 1, § 25a Abs. 1, § 26 Abs. 1 Bun-
desversorgungsgesetz (BVG).
3. Gesetzliche Rentenversicherung
− Deutsche Rentenversicherung Bund,
− Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft - Bahn – See,
− Regionalträger.
� Kein Anspruch auf Leistungen nach Nr. 1 und 2.
� Erwerbstätigkeit ist wegen körperlicher Behinderung er-
heblich gefährdet oder gemindert und kann durch die Re-
habilitationsleistung erhalten werden.
� Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit kann abge-
wendet werden.
� Weitere versicherungsrechtliche Voraussetzungen:
Eine Wartezeit von 15 Jahren bei Antragstellung ist erfüllt
oder eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
wird bezogen.
Rechtsgrundlage: §§ 9, 10, 11, 16 SGB VI (2. Kapitel,
1. Abschnitt) - Gesetzliche Rentenversicherung
4. Bundesagentur für Arbeit
Zu beantragen sind Hilfsmittel (z. B. orthopädischer
Fußschutz) bei der Arbeits-agentur, in deren Bezirk
der Antragsteller wohnt.
� Kein Anspruch auf Leistungen nach Nr.1 bis 3.
� Angeborene oder erworbene Fußbehinderung.
Rechtsgrundlage: §§ 5, 6, 33, 34 SGB IX – Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen (Teil 1)
5. Träger der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben
Integrationsämter der Bundesländer, die aber selbst
keine Rehabilitationsträger sind.
Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger
Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit
und den Trägern der Rehabilitation durchgeführt.
� Kein Anspruch auf Leistungen nach Nr. 1 bis 4.
� Anerkennung als Schwerbehinderter.
� Angeborene oder erworbene Fußbehinderung.
Rechtsgrundlage: § 102 SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen - (Teil 2 Schwerbehindertenrecht)
6. Träger der Sozialhilfe
− überörtliche Träger (nach jeweiligem Landes-
recht entweder staatliche Behörden oder höhere
Kommunalverbände)
− örtliche Träger
(Kreise und kreisfreie Städte).
� Kein Anspruch auf Leistungen nach Nr. 1 bis 5.
� Nicht nur vorübergehende Fußbehinderung, angeboren
oder erworben.
Rechtsgrundlage: §§ 8, 53, 54 SGB XII – Sozialhilfe, § 8, § 9
und § 10 Eingliederungshilfe-Verordnung
N
Zeigen Sie Profil.
Auch auf dem Arbeitsweg
in Herbst und Winter.

BauPortal 7/2019 Arbeits- und Schutzkleidung / PSA 53
Einstufung von ProduktenDie Einstufung von einigen Produkten alsPSA ändert sich. Es gibt drei Kategorien,denen unterschiedliche Prüfanforderun-gen zugeordnet sind. Produkte wie z.B.Gehörschutz, Rettungswesten oder PSAzum Schutz gegen Kettensägenschnittefallen jetzt unter die Kategorie III. Damitunterliegen sie einer Produktionskon-trolle durch eine notifizierte Stelle. FürSchutzausrüstung der Kategorie III gilt inDeutschland die Pflicht zu einer prak-tischen Unterweisung der Beschäftigten.Hier sind die Unternehmen jetzt gefragt,ihre Unterweisungen entsprechend anzu-passen.
KonformitätserklärungHersteller müssen künftig die sog. Konfor-mitätserklärung jedem einzelnen Produktbeifügen oder über das Internet zur Ver-fügung stellen. Die Erklärung bestätigt,dass das Produkt den Anforderungen derVerordnung entspricht. Bislang reichte esaus, die Konformitätserklärung „auf Ver-langen“ vorlegen zu können.
Geltungsbereich und Fristen Der Geltungsbereich der Verordnung istumfassender als zuvor. Sie nimmt künftigalle Wirtschaftsakteure in die Pflicht –auch Händler und Importeure. Des Wei-teren haben sich die Fristen für Bau-musterprüfungen geändert. Bislang gal-ten EG-Baumusterprüfungen unbegrenzt.Gemäß der neuen Verordnung werden EU-Baumusterprüfbescheinigungen nurnoch für längstens 5 Jahre ausgestellt.
Beispiel GehörschutzAb dem 21. April 2019 dürfen persönlicheSchutzausrüstungen (PSA) vom Herstellernur noch in Verkehr gebracht werden,wenn sie der Verordnung (EU) 2016/425(PSA-Verordnung) entsprechen. Das be -trifft auch den Gehörschutz. Denn lautdieser Verordnung wird Gehörschutz neuals PSA der Kategorie III eingestuft. Diese
Kategorie umfasst PSA gegen tödliche undirreversible Schäden. Für die Produktionund den Einsatz von PSA der Kategorie IIIgelten höhere Anforderungen als für PSAder Kategorie II. Das hat zum einen Aus-wirkungen für die Hersteller, zum ande-ren aber auch für die Anwender – also dieUnternehmen, die Gehörschutzproduktebenutzen.
Jährliche Unterweisung verpflichtendWenn eine PSA der Kategorie III zum Ein-satz kommt, sind für die Benutzerinnenund Benutzer dieser PSA Unterweisungenmit Übungen durchzuführen. Grundlagedafür ist die DGUV Vorschrift 1, § 31, diesich auf PSA bezieht, die gegen tödlicheGefahren oder bleibende Gesundheits-schäden schützen soll. Die Unterweisun-gen sind einmal jährlich durchzuführen.Vorlagen und Empfehlungen für Art undUmfang der Übungen dafür sind noch inder Erarbeitung. Hinweise liefert die„Unterweisungsrichtlinie zur qualifizier-ten Benutzung von Gehörschutz“ (An-hang 6 der DGUV Regel 112-194). Darinsind Themen und Aspekte beschrieben, die bei der Benutzung von Gehörschutzkritisch sein können und möglicherweisedie Schutzwirkung reduzieren. Insbeson-dere das richtige Einsetzen von Gehör-schutzstöpseln aus Schaumstoff erfordertSorgfalt und Training. Genau dies solldurch die Unterweisung für PSA der Kate-gorie III erreicht werden.
Ablauf der Unterweisung Die Person, die auch die Unterweisung vor-nimmt, sollte die praktischen Übungenanleiten und beaufsichtigen. Diese Personsollte in der Lage sein, die korrekte Benut-zung von Gehörschutz zu demonstrierenund typische Fehler bei der Benutzungdurch die Beschäftigten zu erkennen. Inder Regel ist dies der Unternehmer oderdie Unternehmerin bzw. der oder die Vor-gesetzte (DGUV Vorschrift 1, § 4), dem
oder der jedoch die DGUV Regel 112-194soweit bekannt sein muss, dass er oder siedie Anweisungen zu den praktischenÜbungen entsprechend dem Anhang 6geben und deren Ausführung beurteilenkann. Es bestehen zurzeit keine formalenAnforderungen an die Qualifikation desUnterweisenden zur Benutzung von Ge -hörschutz. Eine Dokumentation der Unter-weisung ist immer erforderlich. Im Sach-gebiet Gehörschutz ist beabsichtigt, dieQualität der Ausbildung zukünftig durchE-Learning-Verfahren zu unterstützen
Unterschied zur qualifizierten BenutzungDie jährliche Unterweisung mit Übungennach DGUV Vorschrift 1 ist allerdings nichtgleichbedeutend mit der qualifiziertenBenutzung, auf die sich Anhang 6 derDGUV Regel 112-194 und die TechnischeRegel zur Lärm- und Vibrations-Arbeits-schutzverordnung (TRLV) – kurz TRVL Lärm,Teil 3, Abschnitt 6.3.3 beziehen. Bei der qualifizierten Benutzung kann aufdie Anwendung der Praxisabschläge ver-zichtet werden, weil man davon ausgeht,dass die Schalldämmwerte aus der Bau-musterprüfung durch sorgfältiges Ein-setzen tatsächlich erreicht werden. Dafürsind aber die entsprechenden Übungenviermal pro Jahr durchzuführen und zudokumentieren. Dieses Verfahren ist nachTRLV Lärm, Teil 3, für Tages-Lärmexposi-tionspegel ab 110 dB(A) vorgeschriebenund sollte auch auf solche Extremfällebeschränkt bleiben, da der Aufwand großist.
Mehr Information unter www.dguv.deDGUV Regel 112-194 Webcode d33266DGUV Vorschrift 1 Webcode d943798
Neue Europäische PSA-VerordnungDie geänderte Einstufung von Produkten als PSA – Auswirkungen auf die Unterweisung am Beispiel Gehörschutz
(Grafik
en: H
.ZWEI.S)
Seit dem 21. April 2019 – dem Ende der Übergangsfrist – muss die Verordnungder EU über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) umgesetzt werden. Die wichtigsten Neuerungen aus Sicht des Arbeitsschutzes seien hier kurz vorgestellt.

Arbeits- und Schutzkleidung / PSA BauPortal 7/201954
Die letzten Jahre waren geprägt durchneue Regelungen und Normen im Bereichder Persönlichen Schutzausrüstungen. EinHöhepunkt war das Inkrafttreten derneuen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 am20. April 2016 [1]. Im Frühjahr 2019 führ-ten nun Meldungen über das Ende derÜbergangsfrist am 21. April 2019 bei Ver-wendern von PSA zu Unsicherheiten. Es wurden sogar Fragen gestellt, ob mannun neue Chemikalienschutzhandschuhebenötige oder ob man Lagerbestände vonPSA überhaupt noch aufbrauchen dürfe.Diese Verunsicherung zeigte deutlich, dasseine der Kernforderungen der neuen Ver-ordnung, dass Anleitungen und Sicher-heitsinformationen sowie Kennzeichnun-gen klar verständlich und eindeutig seinmüssen, weder beim Text der Verordnungnoch in den Berichten über das Inkraft-treten wirklich beachtet wurden. Der ein-fache Verwender von PSA hat schonSchwierigkeiten Begriffe wie „Inverkehr-bringen“ und „Bereitstellen auf demMarkt“ zu unterscheiden. Auch fällt esschwer, die Unterschiede in der Numme-rierung der beiden Richtlinien 89/656/EWG und 89/686/EWG zu erkennen. Auchwerden die europäische PSA-Verordnungund die deutsche PSA-Benutzungsverord-nung häufig verwechselt.
Handlungsbedarf durch neue PSA-Verordnung?In Europa wurde der Bereich der persön-lichen Schutzausrüstungen seit 1989durch zwei Richtlinien geregelt, einerseitsdurch die Hersteller-Richtlinie 89/686/EWG und andererseits durch die Benut-zungsrichtlinie 89/656/EWG. Da europäi-sche Richtlinien nur Mindeststandardsbeschreiben, müssen sie in den Mitglieds-staaten in nationale Vorschriften umge-setzt werden. In Deutschland wurdendiese beiden Richtlinien durch die 8. Ver-ordnung zum Produktsicherheitsgesetz(ProdSV) – der Verordnung über die Bereit-stellung von persönlicher Schutzausrüs -tung auf dem Markt und die PSA-Benut-zungsverordnung (PSA-BV) umgesetzt. DieHersteller-Richtlinie 89/686/EWG wurdenun durch die europäische PSA-Verord-nung ersetzt.
Eine europäische Verordnung ist in denMitgliedstaaten unmittelbar gültig, diedeutsche 8. Verordnung zum Produkt-sicherheitsgesetz ist daher außer Kraftgesetzt worden. Die europäische Benut-zungsrichtlinie 89/656/EWG wie auch diedeutsche PSA-BV sind dagegen weiterhinin Kraft. Dadurch wird schon erkennbar,dass die Änderungen im Wesentlichen nur
die Hersteller und Händler von PSA be-treffen, die Benutzer sind nur mittelbarbetroffen. Der Handlungsbedarf für dieMitgliedsbetriebe der BG BAU ist daherüberschaubar.Das Ende der Übergangsfrist am 21. April2019 betraf die Möglichkeit der Herstel-ler, PSA-Produkte, die nach der bisherigenHersteller-Richtlinie zertifiziert wurden, inVerkehr zu bringen. Nach PSA-Verordnungbedeutet aber „Inverkehrbringen“ die erst-malige Bereitstellung einer PSA auf demMarkt der EU. Es betrifft also nur neue Produkte, die nicht zuvor bereits ein Zer-tifikat erhalten haben. Der Verkauf vonfrüher „inverkehrgebrachten“ Produkten –(Be reitstellung auf dem Markt bedeutetzum Verkauf anbieten) – wird dadurchnicht behindert. Baumusterprüfbeschei-nigungen, die gemäß der alten PSA-Richt-linie ausgestellt wurden, verlieren erst am21. April 2023 ihre Gültigkeit. Die Herstel-ler dürfen also ihre bereits eingeführtenProdukte weiterhin verkaufen und könnenin Ruhe eine neue Zertifizierung nach PSA-Verordnung vorbereiten. Dies ist auchsinnvoll, um auch den Prüf- und Zertifizie-rungsstellen Zeit für die Ausstellung vonneuen Zertifikaten zu geben.Auf dem Markt findet man deshalb zurzeitPSA-Produkte, die schon nach PSA-Verord-
Neue Regelungen verunsichern Anwender von SchutzhandschuhenÄnderungen durch neue europäische PSA-Verordnung erweisen sich als überschaubar
Dipl.-Chem. Rainer Dörr, Wuppertal
Berichte über neue Regelungen und geänderte Normen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) habenunter den Benutzern von PSA und ihren Arbeitgebern zum Teil zu Verunsicherungen geführt. Das zeigen einige Anfragen an den Fachbereich PSA der DGUV sowie Diskussionen in den Schulungsstätten der BG BAU. Bei Betrieben derBauwirtschaft und der Gebäudereinigung betreffen diese Fragen häufiger den Schutz der Hände bei mechanischenGefährdungen sowie bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Die Fragen betreffen auch die geänderten Kennzeichnungen vonSchutzhandschuhen in den Normen für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken (EN 388) und gegen gefährlicheChemikalien (EN 374). Ebenso gibt es Unsicherheit darüber, ob die neue europäische PSA-Verordnung für die Benutzervon Schutzhandschuhen neue Pflichten bedeutet. Was hat sich also geändert?

BauPortal 7/2019 Arbeits- und Schutzkleidung / PSA 55
nung zertifiziert wurden, als auch Pro-dukte, die früher geprüft wurden. Daranist auch nichts auszusetzen, da diese ver-meintlich „älteren“ Produkte auch auf ihreSchutzwirkung geprüft worden sind. Esgibt also keinen Grund für Verwender von PSA, auf ein bewährtes Produkt zu ver-zichten, nur weil noch kein neues Zertifi-kat ausgestellt wurde. Bei gelagerten Pro-dukten gelten die üblichen Empfehlungen,vor der Verwendung sollte geprüft wer-den, ob der Hersteller Hinweise auf einVerfallsdatum gemacht hat. Durch eineSichtprüfung muss weiterhin untersuchtwerden, ob Veränderungen sichtbar sind.Schutzhandschuhe aus Kunststoffmateria-lien können sich beispielsweise durch Feh-ler bei der Lagerung verändern. Werdendiese Handschuhe offen ans Fenster ge -legt, so kann Sonnenlicht innerhalb vonwenigen Wochen dazu führen, dass dieseMaterialien spröde und brüchig werden.Die Hersteller weisen in ihren Informa-tionen darauf hin, dass Licht und WärmeOxidationsprozesse auslösen können unddie Reißfestigkeit verringern. Aus diesemGrund müssen Handschuhe vor Licht undWärme geschützt aufbewahrt werden.Verwender von Schutzhandschuhen müs-sen sich also durch die PSA-Verordnungi.d.R. nicht umstellen. Für die Auswahl von PSA können sich aber Veränderungendurch die konkreten Normen ergeben.
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der NormenParallel zur Einführung der PSA-Verord-nung wurden auch viele Normen imBereich der PSA überarbeitet, erweitertund verändert. Diese Normen beschreibenAnforderungen an die Hersteller, für dieAnwender sollen sie einen einfachen Pro-duktvergleich ermöglichen.Bei den Änderungen der letzten Jahre istder allgemeine Trend zu beobachten, dassaus nationalen Normen (DIN) europäischeNormen (EN) werden, die schließlich ininternationalen Standards (ISO) münden.Damit verbunden ist öfter auch eine Ände-rung der Nummerierung, aus einer be -kannten dreistelligen DIN EN wird dadurchschnell eine fünfstellige DIN EN ISO. Eingutes Beispiel ist die DIN EN 420 Schutz-handschuhe – Allgemeine Anforderun-gen und Prüfverfahren. Als übergreifendeGrundnorm legt sie die für alle Schutz-handschuhe anzuwendenden relevantenPrüfverfahren und die allgemeinen An-forderungen zu Gestaltungsgrundsätzen,Handschuhkonfektionierung, Widerstanddes Handschuhmaterials gegen Wasser-durchdringung, Unschädlichkeit, Komfortund Leistungsvermögen sowie die vom
Hersteller vorzunehmende Kennzeichnungund vom Hersteller zu liefernden Infor-mationen fest. Die schützenden Eigen-schaften von Handschuhen werden in derDIN EN 420 nicht beschrieben, sie istdaher nie alleine anzuwenden, sondernimmer nur mit den jeweiligen spezifischenNormen, die bestimmte Risiken behan-deln. Die Überarbeitung der DIN EN 420 ist inArbeit, ein Norm-Entwurf als DIN EN ISO21420 liegt vor. Unter anderem wurde derAbschnitt zur Unschädlichkeit von Schutz-handschuhen überarbeitet und ein neuerAnhang zur Größe und zur Vermessungvon Händen aufgenommen. Für den An -wender werden die Änderungen kaumAuswirkungen haben. Experten erhoffensich mehr praxisrelevante Benutzerinfor-mationen. In der Praxis wird man aber mit dem Satz „Bei Risiken und Nebenwir-kungen fragen Sie Ihren Verkäufer undHersteller“ besser bedient sein. Der Kaufim Fachhandel ist daher immer zu emp-fehlen.
Schutzhandschuhe gegen mechanische RisikenMechanische Gefährdungen für die Händeentstehen durch die Handhabung vonrauen, spitzen oder scharfkantigen Mate-rialien. Häufige Verletzungen sind Schnitte,Stiche oder Hautabschürfungen, die ge-rade in der Bauwirtschaft eine große Rollespielen. Während früher der Lederhand-schuh als der klassische Arbeitshandschuhdes Bauarbeiters angesehen wurde, wer-den heute nahezu alle denkbaren Materia-lien (Baumwolle, unterschiedlichste Kunst-
stofffasern, aber auch rostfreier Stahl alsMetallringgeflecht) für die Herstellungvon Schutzhandschuhen verwendet. DieAnforderungen an derartige Schutzhand-schuhe werden in der EN 388 beschrieben,dazu gehören auch Prüfverfahren und dieKennzeichnung der Handschuhe.Bisher waren Handschuhe zum Schutz vor mechanischer Gefährdung am Pikto-gramm „Hammer“ sowie an den 4 Code-ziffern erkennbar.Diese 4 Ziffern standen für eine bei derPrüfung erreichte LeistungsstufeZiffer 1 (0–4) AbriebfestigkeitZiffer 2 (0–5) Schnittfestigkeit (Coup-Test)Ziffer 3 (0–4) WeiterreißfestigkeitZiffer 4 (0–4) Durchstichfestigkeit
Die Prüfung gilt als bestanden, wenn beimindestens einem Kriterium die Leis -tungsstufe 1 erreicht wurde. Die in derAbbildung 1 dargestellte Leistungsstufen3233 werden in der DGUV-Information205-014 für den Einsatz von Feuerwehrenund Hilfsorganisationen empfohlen, wenn
Abb. 1: Bisherige Kennzeichnung nach EN 388

Arbeits- und Schutzkleidung / PSA BauPortal 7/201956
im Einsatz thermische Gefährdungen aus-geschlossen werden können. Die BG BAUempfiehlt im Gefahrstoffinformations-system WINGIS für Arbeiten mit Zement-produkten (GISCODE: ZP1) NitrilgetränkteBaumwollhandschuhe. Bei diesen Arbei-ten ist die Abriebfestigkeit vorrangig, dieempfohlenen Handschuhprodukte solltendaher mindestens mit den Leistungsstu-fen 2111 gekennzeichnet sein. Seit einigen Jahren gab es Kritik an denPrüfmethoden der EN 388, insbesonderewurde die Bestimmung der Schnittfestig-keit beanstandet. Bei harten Fasern (anor-ganische Fasern, z.B. Glas, Metall) undFasern mit derartigen Bestandteilen wür-den keine reproduzierbaren Werte erhal-ten [2]. 2017 wurde daher ein zusätzlicherTest in die EN 388 aufgenommen, bei dem TDM-Test nach ISO 13997 wird statteiner Anzahl von Testzyklen der erforder-liche Druck beim Verschneiden des Hand-schuhes bestimmt. In der Kennzeichnungwurde dazu eine 5. Ziffer ergänzt, dieBuchstaben A–F weisen das Ergebnis derPrüfung aus. Wird der Buchstabe X ver-merkt, wurde der betreffende Test nichtdurchgeführt. Wurde ein Handschuh bis-her z.B. mit 3233 gekennzeichnet, so erge-ben sich nun mehrere Möglichkeiten:• 3233X (der neue TDM-Test wurde nicht durchgeführt)
• 3X33B (der neue Test hat den bishe-rigen Coup-Test ersetzt, Ergebnis B)
• 3233B (beide Schnittprüfungen wurden durchgeführt)
Zusätzlich wurde in die EN 388 einezusätzliche Prüfung zum Schutz vor Stoß-einwirkungen im Handrücken eingeführt.Dieser Test ist aber nur optional, wurde er bestanden wird als 6. Ziffer der Buch-stabe P (passed – bestanden) angegeben.Ein Hersteller wirbt nun schon mit dieserneuen Schnittprüfung und kommt dabeizu der Aussage, dass nur bei Handschuhenaus seinem Material die Schnittfestigkeit
bestätigt wurde. Handschuhe aus anderenMaterialien würden nun niedriger einge-stuft. Für die Bauwirtschaft ergibt sichdadurch i.d.R. aber kein Handlungsbedarf,da von dieser Änderung nur Handschuheder höchsten Schnittschutzklassen betrof-fen sein dürften. Derartige Handschuhewerden beispielsweise in der Fleischwirt-schaft beim Zerteilen von Fleischstückeneingesetzt. Eine weitere Schwierigkeitbesteht auch darin, dass es so gut wiekeine Empfehlung für praktische Tätig-keiten gibt, wann welche Leistungsstufeerforderlich sein könnte. Der Arbeitgeber,der nach der Gefährdungsbeurteilungeinen Handschuh gegen mechanischeRisiken ausgewählt hat, ist daher gut be-raten, diese Auswahl bei der Wirksamkeits-überprüfung zu reflektieren. Eine Befra-gung der Mitarbeiter kann Hinweise lie-fern, ob sich der Handschuh in der Praxisbewährt hat. Gibt es Hinweise auf Pro-bleme oder ist es sogar zu Unfällen ge -kommen, muss überprüft werden, ob esbesser geeignete Produkte gibt.
Neue Kennzeichnung für Chemikalien-schutzhandschuheDie Anforderungen an Chemikalienschutz-handschuhe werden in mehreren Teilender EN 374 beschrieben. Diese Norm be -stand zwischenzeitlich aus 5 Teilen. Teil 1liegt als DIN EN ISO 374-1 vor und enthältdie Terminologie und Leistungsanforde-rungen für chemische Risiken. Die Ände-rungen werden auch für den normalenAnwender sichtbar, da sich die Pikto-gramme auf den Handschuhen ändernkönnen. Bisher galt, dass ein Handschuh als be -ständig gegen Chemikalien angesehenwird, wenn er in einer Laborprüfung eineMindestdurchbruchzeit von 30 min odermehr gegen 3 von 12 Prüfchemikalien(Schutzindex Klasse 2) erzielt. Wurde
diese Prüfung erfüllt, dann konnte derSchutzhandschuh mit dem Piktogramm„Erlenmeyerkolben“ gekennzeichnet wer-den. Wurde die Prüfung nicht bestan-den, aber bei einer Prüfchemikalie min-destens die Klasse 1 (10 min) erreicht,wurde der Schutzhandschuh als „wasser-dicht“ angesehen und konnte mit dem Piktogramm „Becherglas“ gekennzeichnetwerden (Abb. 2).
In der neuen Version der Norm ist das Piktogramm Becherglas nicht mehr vor-handen, dafür werden jetzt 3 Handschuh-typen genannt, die alle mit dem Erlen-meyerkolben gekennzeichnet werden.
• Typ A: Handschuh ist mindestens jeweils 30 min beständig gegen 6 Prüfchemikalien
• Typ B: Handschuh ist mindestens jeweils 30 min beständig gegen 3 Prüfchemikalien
• Typ C: Handschuh ist mindestens jeweils 10 min beständig gegen 1 Prüfchemikalie
Bei den Typen A und B wird auf dem Hand-schuh und der Verpackung unter dem Piktogramm Erlenmeyerkolben mit 6 oder3 Kennbuchstaben auf die erfolgreichePrüfung hingewiesen (Abb. 3). Beim Typ Cmuss kein Kennbuchstabe angegebenwerden.
Die Liste der Prüfchemikalien wurde in der Norm von 12 auf 18 Stoffe erweitert (Tabelle 1). Diese Prüfchemikalien dienenals Modellsubstanzen für jeweils eineStoffklasse, als kleinster Vertreter dieserKlasse wird vermutet, dass alle größe-ren Moleküle langsamer durch ein Hand-schuhmaterial wandern und somit einehöhere Durchbruchszeit benötigen. DiePrüfung mit diesen Modellsubstanzen istsomit ein „worst-case“-Szenario. Es mussaber betont werden, dass diese Prüfungunter Laborbedingungen mit Einzelsub-stanzen durchgeführt wird. Mischungenvon Chemikalien können zu anderenErgebnissen führen.
Abb. 2: Bisherige Kennzeichnung nach EN 374 (Quelle: DGUV-I 212-007 Chemikalienschutzhandschuhe)
Abb. 3: Beispiel einer Kennzeichnung nach EN 374 Typ A

BauPortal 7/2019 Arbeits- und Schutzkleidung / PSA 57
Durch den Entfall des Piktogramms„Becherglas“ für Handschuhe mit einemeingeschränkten Schutz gegen Chemi-kalien wird sich in erster Linie die Kenn-zeichnung von dünnen Einweghandschu-hen ändern. Ob das Auswirkungen in derPraxis beim Einsatz von Chemikalien-schutzhandschuhen haben wird, ist frag-lich. Experten bezweifeln ohnehin, dasssich Laien bei der Auswahl von Piktogram-men leiten lassen. Weiterhin benötigen dieBetriebe bei Tätigkeiten mit GefahrstoffenUnterstützung von Experten. Neben ge -naueren Angaben in den Sicherheitsda-tenblättern der Gefahrstoffhersteller sindhier die Fachkräfte für Arbeitssicherheit,die Fachhändler für PSA-Produkte aberauch die Fachexperten der Unfallversiche-rungsträger gefragt. Darüber hinaus ist eserforderlich, diese Änderungen in Fach-informationen für die Betriebe einzuarbei-ten. Die BG BAU hat mit der WINGIS Hand-schuh-Datenbank (https://wingisonline.de/handschuhdb/) Voraussetzungen ge -schaffen, um Betriebe bei der konkre-ten Auswahl von Chemikalienschutzhand-schuhen zu beraten.
Bei der gegenwärtigen Überarbeitung der TRGS 401 „Gefährdung durch Haut-kontakt“ wurde diese neue Kennzeich-nung von Chemikalienschutzhandschuhenbereits berücksichtigt. Diese überarbeiteteFassung der TRGS soll voraussichtlichAnfang 2021 veröffentlicht werden.
Teil 2 der EN 374 legt ein Prüfverfahren fürdie Bestimmung des Widerstandes gegen
Penetration von Handschuhen fest. Pene-tration beruht auf Fehlstellen (Löcher) imHandschuhmaterial. Ein neuer Norm-Ent-wurf liegt seit 2018 als DIN EN ISO 374-2vor.Der Teil 3 der EN 374 enthielt Angaben zur Bestimmung des Widerstandes gegenPermeation von Chemikalien. Die Per-meation bezeichnet einen molekularenProzess der Durchdringung eines Materi-als (Diffusion) durch Wanderung vonMolekülen. Dieser Teil 3 wurde zurück-gezogen und durch die DIN EN 16523-1ersetzt. Sie legt ein Prüfverfahren für dieBestimmung des Widerstands von Schutz-kleidungsmaterial, Schutzhandschuh- undFußschutzmaterial gegen die Permeationdurch potenziell gefährliche flüssige Che-mikalien unter Dauerkontakt fest. Für gasförmige Chemikalien gilt die DIN EN16523-2.Der Teil 4 der EN 374 legt das Prüfverfah-ren für die Bestimmung des Widerstandsvon Werkstoffen für Schutzhandschuhegegen Degradation von Chemikalien beiständigem Kontakt fest. Degradationbezeichnet den Abbau oder Zerfall desKunststoffes während oder nach einemKontakt mit einer Chemikalie, dieser uner-wünschte Prozess ist meistens mit Quel-lung, Versprödung oder Rissbildung ver-bunden. Ein neuer Norm-Entwurf liegt seit2018 als DIN EN ISO 374-4 vor.Teil 5 liegt seit 2017 als DIN EN ISO 374-5vor, diese Norm legt die Anforderungenund Prüfverfahren für Schutzhandschuhe
fest, die den Anwender gegen Mikroorga-nismen schützen sollen.
FazitDurch die neue europäische PSA-Verord-nung und die Änderungen in vielen Nor-men gab es und gibt es umfassendenAnpassungsbedarf für die Hersteller vonPSA-Produkten. Für Benutzer von Schutz-handschuhen sind die Änderungen da-gegen überschaubar und geben keinenAnlass für eine Verunsicherung oder sogarhektische Reaktionen. Bewährte Produktekönnen weiterhin eingesetzt werden,denn die Prüfung von persönlicher Schutz-ausrüstung hat in den letzten Jahrzehntenin Europa gut funktioniert. Die Verände-rungen werden vermutlich zu weiterenVerbesserungen der Produkte führen, abergenau so funktioniert Fortschritt.
Literatur[1] Liedtke, M.: Alles Wichtige für Betriebs-
praktiker. Sicherheitsingenieur (2018)Nr. 1, S. 26–30
[2] Zuther, F.: EN 388 – zeitgemäß undgeeignet? Sicherheitsingenieur (2011)Nr. 6, S. 18–22
Autor:Dipl.-Chem. Rainer DörrReferat Gefahrstoffe BG BAU PräventionSachgebiet Schutzkleidung im Fachbereich PSA der DGUV
Tabelle 1: Katalog der Prüfchemikalien nach EN 374
Kennbuchstabe Prüfchemikalien CAS-Nr. Stoffklasse
A Methanol 67-56-1 Primärer Alkohol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitril 75-05-8 Nitril
D Dichlormethan 75-09-2 Chlorierter Kohlenwasserstoff
E Schwefelkohlenstoff 75-15-0 Schwefelhaltige organische Verbindung
F Toluol 108-88-3 Aromatischer Kohlenwasserstoff
G Diethylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterozyklische und Ätherverbindungen
I Ethylacetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-82-5 Aliphatischer Kohlenwasserstoff
K Natriumhydroxid (40 %) 1310-73-2 Anorganische Base
L Schwefelsäure (96 %) 7664-93-9 Anorganische Mineralsäure, oxidierend
NEU M Salpetersäure (65 %) 7697-37-2 Anorganische Mineralsäure, oxidierend
NEU N Essigsäure (99 %) 64-19-7 Organische Säure
NEU O Ammoniumhydroxid (25 %) 1336-21-6 Organische Base
NEU P Wasserstoffperoxid (30 %) 7722-84-1 Peroxid
NEU S Flusssäure (40 %) 7664-39-3 Anorganische Mineralsäure
NEU T Formaldehyd (37 %) 50-00-0 Aldehyd

Arbeits- und Schutzkleidung / PSA BauPortal 7/201958
Das Gebäudereiniger-Handwerk hat sichin Deutschland zu einem der beschäfti-gungsstärksten Handwerke entwickelt. Da viele dieser Betriebe heute kompletteDienstleistungspakete im Sinne eines Facility Managements anbieten, ist nichtimmer nachvollziehbar, wo noch Reini-gungstätigkeiten stattfinden. Das Leis -tungsspektrum der Betriebe geht daherheute weit über einfache Reinigungsarbei-ten hinaus. Neben der Unterhaltsreini-gung in Gebäuden kommen beispiels-weise die Glas- und Fassadenreinigung,die Anlagenreinigung in der Industrie, dieReinigung und Desinfektion in Kranken-häusern und Pflegeeinrichtungen bis hinzur Reinigung von Verkehrsmitteln (Busund Bahnen) einschließlich der Entfernungvon Graffiti hinzu.
Hände sind am meistenGefahrstoffen ausgesetztBei fast allen dieser Reinigungstätigkeitenbenutzen die Beschäftigten eine Vielzahl
von Gefahrstoffen. Die Palette reicht vonätzenden Sanitärreinigern über Desinfek-tionsreiniger mit teilweise sensibilisieren-den Inhaltsstoffen bis hin zu unterschied-lichsten Lösemitteln in der Anlagenreini-gung oder beim Abbeizen von Graffiti-verschmutzungen. In der Unterhalts- undGlasreinigung werden dagegen eherunproblematische Mittel eingesetzt, diezudem i.d.R. als stark verdünnte Anwen-dungslösung benutzt werden. Kennzeichnend für diese Tätigkeiten ist,dass überwiegend die Hände zum Reini-gen benutzt werden, der Einsatz von Reini-gungsmaschinen ist nur teilweise mög-lich. Daher müssen die Reinigungskräftevor dem direkten Kontakt mit den Stoffengeschützt werden.Während in der allgemeinen Bauwirt-schaft der weiße Hautkrebs mit 2.944 Fäl-len inzwischen die häufigste angezeigteBerufskrankheit darstellt, sind Gebäude-reiniger in vielen Fällen vor der direktenUV-Strahlung durch die Sonne geschützt.Zu den Ausnahmen zählen die Glas- und
Fassadenreiniger, die aufgrund von Spie-gelungen der Glasflächen sogar extremeExpositionen haben können. Da bei Rei-nigungsarbeiten vor allem die Hände der Feuchtigkeit durch Wasser und denReinigungsmitteln ausgesetzt sind, ste-hen Hauterkrankungen im Fokus. Diesestanden im Jahr 2015 mit 97 % an derSpitze der beruflich verursachten Erkran-kungen. Hauterkrankungen beeinträchtigen häufigauch das psychosoziale Wohlempfindenund die Lebensqualität, Mitarbeiter be-richten bei sichtbaren Hautveränderungenvon Hemmungen, anderen Menschen dieHand zu geben. Im Extremfall könnenHauterkrankungen sogar zur Berufsauf-gabe führen, wenn eine wiederholt rück-fällige Hauterkrankung vorliegt und da -durch eine Weiterführung der Tätigkeitnicht möglich wird.
Gefahrstoffe in ReinigungsmittelnViele Reinigungsmittel enthalten haut-gefährdende Stoffe wie Tenside, Säuren,Laugen oder organische Lösemittel. Pro-dukte mit stark saurer oder alkalischerWirkung können zu akuten Reizungenoder Verätzungen der Haut führen. Aberauch der länger dauernde oder wieder-holte Kontakt mit verdünnten Reinigernund sogar der ständige Umgang mit Was-ser können die Haut schädigen. Die Auf-gabe der Haut, den Körper vor zu großemWasserverlust zu schützen und bis zueinem gewissen Maße das Eindringen vonKrankheitserregern zu verhindern, kanndann nicht mehr gewährleistet werden.Aber auch der regelmäßige Kontakt mitweniger aggressiven oder stark verdünn-ten Reinigungsmitteln belastet die Hautund kann Abnutzungserscheinungen undReizungen erzeugen. Auch der Kontakt zuWasser erfolgt selten in sauberer Form,meist ist Wasser verschmutzt oder schondurch andere Stoffe belastet. Hinzu kommen bei manchen Tätigkeitengefährliche Bakterien, Viren oder Pilze.Bakterien und Viren können zu Infek-tionen der Haut führen. Dies spielt vorallem in der Krankenhausreinigung oderbei Reinigungsarbeiten in Pflegeheimenetc. eine Rolle.
Hautschutz in der GebäudereinigungAllgemeine und besondere Gefährdungen erkennen und mit geeigneter PSA vermeiden
Dipl.-Biol. Janett Khosravie-Hohn und Dipl.-Chem. Rainer Dörr, Wuppertal
(Foto: Wolfgang Bellwinkel, DGUV)

BauPortal 7/2019 Arbeits- und Schutzkleidung / PSA 59
Bei der Arbeit können Gefahrstoffe undbiologische Arbeitsstoffe auf mehrereWege in den Körper gelangen. Zum einennatürlich über die Haut, zum anderenauch über die Atemwege, also über Naseund Mund und durch Verschlucken.
Problem Feuchtarbeit Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in derGebäudereinigung werden die Stoffe inerster Linie über die Haut aufgenommen.Hinzu kommt die Problematik der Feucht-arbeit. Nach Definition der TRGS 401„Gefährdung durch Hautkontakt“ gehörenzur Feuchtarbeit Tätigkeiten, bei denen dieBeschäftigten einen erheblichen Teil ihrerArbeitszeit Arbeiten im feuchten Milieuausführen oder flüssigkeitsdichte Hand-schuhe tragen oder häufig oder intensivihre Hände reinigen. Als erheblichen Teilsind Arbeitszeiten zur beurteilen, wenn die Beschäftigten regelmäßig mehr als 2 Stunden pro Tag unter diesen Bedingun-gen arbeiten.Allein der Kontakt zu Wasser führt zueinem Aufquellen der Haut. Geschieht dashäufiger über einen längeren Zeitraum,kann die Barrierewirkung der Haut ge -schwächt werden. Wirken gleichzeitig ent-fettende Stoffe (Wasch-, Reinigungs- oderDesinfektionsmittel) ein, werden die haut-eigenen Fette ausgespült und die Haut-barriere ist geschädigt.
Hauterkrankungen wie Ekzeme und Allergien Ist ein solcher Zustand der Haut erreicht,entsteht leicht ein Abnutzungsekzem mitHautverdickung, Schuppung, Einrissenund unangenehmer Juckreiz. Die Haut hatnun ihre Schutzfunktion verloren, schädi-gende Stoffe können leichter in die Hauteindringen und eine Sensibilisierung her-vorrufen. Daraus kann ein allergischesEkzem resultieren. Darüber hinaus sind hautresorptive undhautsensibilisierende Gefahrstoffe in ver-schiedenen Reinigungs- und Desinfek-tionsmitteln zu finden. HautresorptiveStoffe gelangen leicht über die Haut inden Körper und verursachen gesundheit-liche Schäden. Hautsensibilisierende Ge -fahrstoffe können allergische Kontakt-ekzeme auslösen. Besonders einige in Des-infektionsreinigungsmitteln enthalteneWirkstoffe wie Aldehyde (insbesondereGlutardialdehyd) oder Benzalkoniumchlo-rid treten häufig als Allergene in Erschei-nung. Aber auch die in Reinigungsmittelnweit verbreiteten Duftstoffe und Konser-vierungsmittel können bei den Beschäftig-ten Allergien auslösen. Ist eine Sensibilisie-rung einmal erworben, wird sie i.d.R. einLeben lang bestehen bleiben.
Maßnahmen zum HautschutzUm wirksame Schutzmaßnahmen zu entwickeln, hat der Arbeitgeber bereits im Rahmen der Gefährdungsbeurteilungmögliche Gefährdungen für die Haut zu ermitteln und zu beurteilen. Enthält ein Reinigungsmittel gefährliche Inhalts-stoffe, so wäre die wirksamste Schutzmaß-nahme, dieses Reinigungsmittel durch einanderes Produkt mit weniger gefährlichenInhaltsstoffen zu ersetzen. Hierzu hat dieBG BAU eine Branchenlösung mit Unter-stützung von allen beteiligten Kreisen ent-wickelt – die sog. Produktcodes für Reini-gungs- und Pflegemittel. Die immense An -zahl der Produkte konnte in etwa 50 Pro-duktgruppen zusammengefasst werden.Diese Gruppen orientieren sich nicht nuran den Gefährdungen, die von den zuge-ordneten Produkten ausgehen, sondernauch am Einsatzzweck der Produkte. Diese sind abrufbar im Gefahrstoff-Infor-mationssystem GISBAU der BG BAU.
Für jeden Einsatzzweck können leicht Pro-dukte gefunden werden, von denen gerin-gere Risiken ausgehen. Diese Substitu-tionsprüfung erfordert in der Gebäude-reinigung häufig eine Abstimmung mitdem Auftraggeber. So liegt die Entschei-dung, ob und welche Desinfektionsmittelbei Reinigungsarbeiten in Krankenhäuserneingesetzt werden, bei der Hygienefach-kraft. Wenn aus übergeordneten Grün-den bestimmte Gefahrstoffe nicht ersetztwerden können, muss geprüft werden, obtechnische Lösungen zu einer Verringe-rung des Hautkontakts führen können.Durch den Einsatz von Dosieranlagen wirddas Anmischen von gebrauchsfertigenLösungen erleichtert. Bei der Reinigungvon Fußböden haben sich Reinigungs-
maschinen bewährt. Auch durch den Einsatz von vorgetränkten Mopps oderTüchern kann der direkte Hautkontakt ver-ringert werden.
Auswahl von SchutzhandschuhenDa der Einsatz von Maschinen oder ande-ren technischen Maßnahmen bei vielenTätigkeiten nicht möglich ist, besteht wei-terhin bei vielen händischen Tätigkeiteneine Gefährdung durch Hautkontakt.Daher bieten Schutzhandschuhe den wirk-samsten Schutz vor hautschädigendenStoffen. Sie müssen daher nicht nur beimAnsetzen der Anwendungslösung (Flotte),sondern in den meisten Fällen währenddes gesamten Reinigungsvorganges ge-tragen werden. Aber auch beim Tragen von Handschuhen ist zu beachten, dassdie Tragedauer auf ein Mindestmaß zubeschränken ist. Das Tragen von feuchtig-keitsdichten Schutzhandschuhen kannzudem zu Aufweichungen der Haut füh-ren, daher müssen auch diese Bedingun-gen bei der Gefährdungsbeurteilung be -rücksichtigt werden. Optimal ist ein Wech-sel von Feucht- und Trockenarbeit. Auchwenn Schutzhandschuhe für den Haut-schutz entscheidend sind, muss dochbeachtet werden, dass es keinen Hand-schuh gibt, der gegen alle gebräuchlichenReinigungsmittel schützt. Unterstützung bei der Auswahl des rich-tigen Schutzhandschuhes finden die Be -triebe in der Handschuhdatenbank im Pro-gramm WINGIS der BG BAU. Beschriebenwird, welche Fabrikate geeignet sind undwie lang die empfohlene Tragedauer ist.Dabei wird unterschieden, ob mit Konzen-traten oder verdünnten Lösungen gearbei-tet wird. Diese Empfehlungen basieren aufdem Produktcode für Reinigungs- undPflegemittel.
(Urheber: oscity –stock.adobe.com)

Arbeits- und Schutzkleidung / PSA BauPortal 7/201960
Hautschutzplan aufstellenZusätzlich wird häufig die Aufstellungeines Hautschutzplans empfohlen. DieserPlan basiert auf einem Konzept von Haut-schutz, Hautreinigung und Hautpflege.Beachtet werden sollte dabei, dass auchdie besten Hautschutzmittel immer einengeringeren Schutz bieten als selbst ein-fache Schutzhandschuhe. Die Auswahleines geeigneten Schutzhandschuhs hatdaher immer Vorrang. Im negativen Fallkann ein Hautschutzmittel sogar dasMaterial der Schutzhandschuhe angreifen.Eine Kombination von Hautschutzmittelnund Schutzhandschuhen kann daher nichtempfohlen werden. Sinnvoll dagegen sind schonende Pro-dukte zur Hautreinigung sowie geeig-nete Produkte zur Hautpflege. Die Reini-gungs- und Pflegemittel unterstützen dieRegeneration (Wiederaufbau) der Hautund dienen der Prävention von Abnut-zungsekzemen.
Arbeitsmedizinische VorsorgeEine wichtige Maßnahme zur Früherken-nung von Hauterkrankungen ist diearbeitsmedizinische Vorsorge durch denBetriebsarzt. Den Mitarbeitern ist einAngebot zur Vorsorge zu machen – ab
regelmäßig mehr als zwei Stunden pro TagFeuchtarbeit. Bei Feuchtarbeit ab vierStunden pro Tag besteht sogar die Pflichtzur Vorsorge. Manche Betriebe versuchennun durch eine minutengenaue Erfassungder Zeiten, in denen ein Kontakt zu Feuch-tigkeit bzw. zu hautgefährdenden Stoffenbesteht oder flüssigkeitsdichte Schutz-handschutz getragen werden, zu belegen,dass die Mitarbeiter nicht zur Vorsorgegeschickt werden müssen. Das ist aberkontraproduktiv, die Zeitangaben zurUnterscheidung, ob nur ein Angebot zurVorsorge gemacht werden muss oder obdie Mitarbeiter an der Vorsorge teilneh-men müssen, dienen nur zur grobenAbschätzung des Risikos der Tätigkeit.Dabei ist aber immer die gesamte Tätig-keit zu beurteilen. Betriebe, denen dasWohl ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt,haben das erkannt und legen deshalbWert auf eine regelmäßige Vorsorge durchden Betriebsarzt. Im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vor-sorge besteht die Chance, während desBeratungsgesprächs erste Hautverände-rungen festzustellen und Gegenmaßnah-men zu entwickeln. Die Mitarbeiter erfah-ren dabei auch, wie sie durch eine aktiveMithilfe unterstützend mithelfen können.Viele wird es dadurch bewusst, wie wich-
tig das konsequente Tragen von Schutz-handschuhen oder die Benutzung der zurVerfügung gestellten Hautschutzprodukteam Ende der täglichen Arbeitszeit ist.
FazitIm Gebäudereiniger-Handwerk spielt derHautschutz eine zentrale Rolle. Sowohl derArbeitgeber als auch der Beschäftigte tra-gen zur Umsetzung und zum Erfolg desHautschutzes im Betrieb bei. Die Gefähr-dungen der Haut und der mögliche Er -werb einer Hauterkrankung sind in diesemGewerk stets präsent, lassen sich jedochdurch wirksame Schutzmaßnahmen ein-dämmen. Die Festlegung der Maßnah-men nach dem sog. „STOP“-Prinzip: Substi-tution, Technische und OrganisatorischeMaßnahmen sowie Persönliche Schutz-ausrüstung legt die Hierarchie der Schutz-maßnahmen fest und ist für den Arbeit-geber bei der Erstellung der Gefährdungs-beurteilung verpflichtend.
Autoren:Dipl.-Biol. Janett Khosravie-Hohn Abteilung GesundheitBG BAU PräventionDipl.-Chem. Rainer DörrReferat Gefahrstoffe BG BAU Prävention
Haut und HautgefährdungenDie Haut (Cutis) ist das größte und vielseitigste Organder Menschen. Sie bedeckt die gesamte äußere Ober-fläche des Körpers und grenzt den Organismus gegendie Außenwelt ab. Sie hat dabei sehr viele lebens-wichtige Aufgaben und schützt den Körper in ersterLinie vor zu großem Wasserverlust. Eine intakte Hautverhindert bis zu einem gewissen Maße das Eindrin-gen von Krankheitserregern und vielen weiterenschädlichen Einflüssen, denen wir jeden Tag ausge-setzt sind. Beim Menschen besteht die Haut aus dreiSchichten und ist 1,5 bis 4 mm dick. Mit einer Flächevon durchschnittlich 1,5–2 m2 gehört sie zu den größ-ten Organen, dabei wiegt sie 10–14 kg (ohne Fett-gewebe). Die drei Hautschichten haben unterschied-liche Aufgaben und Funktionen:
Die erste Schicht, Epidermis (Oberhaut) besteht überwiegendaus einer Hornschicht, aus speziellen Zellen, die an der Ober-fläche verhornen und sich jeden Tag erneuern. Die Epidermisist gefäßfrei und besitzt keine Nerven.
Die zweite Schicht, Dermis (Lederhaut) besteht aus straffemBindegewebe. Sie verankert die Epidermis und liefert ihr Nähr-stoffe. In der Dermis befinden sich die Talg- und Schweiß-drüsen, Haarfollikel, Gefäße und Nerven sowie Muskelzellen.
Die dritte Schicht, Subcutis (Unterhaut) besteht aus locke-rem Bindegewebe und Fettzellen. Die Bindegewebskammernregeln das Einlagern oder den Abbau der Fettzellen.
Die Haut hat nicht nur eine schützende und regulierendeFunktion, sie lässt uns auch fühlen, z.B. Temperatur, Druck undSchmerz. Beim Abwaschen zu Hause oder auch beim Schwim-men im Schwimmbad wird die Haut zwar auch etwas bean-sprucht, i.d.R. braucht die gesunde Haut dafür aber keinenbesonderen Schutz, der Mensch ist daran gewöhnt. Anderssieht es bei den beruflichen Tätigkeiten wie etwa in derGebäudereinigung aus. Viele Reinigungsmittel enthaltenhautgefährdende Stoffe wie Tenside, Säuren, Laugen oderorganische Lösemittel. Produkte mit stark saurer oder alka-lischer Wirkung können zu akuten Reizungen oder Verätzun-gen der Haut führen. Ungeschützt wäre die Haut täglich demdirekten Kontakt dieser Chemikalien ausgesetzt.
(Urheber: bilderzwerg – stock.adobe.com)

BauPortal 7/2019 Recht 65
Brandschutz auf Baustellen – Vorschriften und RegelwerkJedes Jahr geschehen ca. 1.000 melde-pflichtige Arbeitsunfälle und ca. 2 bis 3tödliche Arbeitsunfälle in der Bauwirt-schaft im Zusammenhang mit Brand undExplosion. Unfallursachen sind dabei u.a.Brände bei Feuerarbeiten auf dem Dach(heißes Bitumen, Propangasbrenner),Schweiß-/Trennarbeiten mit Funkenflugoder Explosion durch ausströmendes Gas. Auf Baustellen liegen – aus brandschutz-technischer Sicht – besondere Rahmen-bedingungen vor, denn oft werden feuer-gefährliche Arbeiten ausgeführt, sind eineVielzahl von brennbaren Baustoffen vor-handen, sind die geplanten brandschutz-technischen Maßnahmen bzw. Einrichtun-gen noch nicht eingebaut bzw. noch nichtbrandschutztechnisch wirksam. Deshalbmuss vor, während und nach Durchführungvon Bauarbeiten neben dem vorbeugen-den baulichen und abwehrenden Brand-schutz insbesondere auch der organisato-rische Brandschutz berücksichtigt werden.
Gefährdungsbeurteilung und UnterweisungBrand- und Explosionsgefährdungen mussder Arbeitgeber im Rahmen seiner Gefähr-dungsbeurteilung berücksichtigen. Zu denMaßnahmen, die aus der Gefährdungs-beurteilung abgeleitet werden können,zählen u.a.:• Reduzierung der Menge
brennbarer Gefahrstoffe,• Räumliche Trennung
z.B. Sicherheits- oder Schutzabstände,• Regelmäßige Prüfungen
von Arbeitsmitteln,• Anwendung von
Arbeitsfreigabeverfahren (z.B. bei Tätigkeiten mit offener Flamme,Arbeiten mit reinem Sauerstoff),
• Benennung eines Aufsichtführenden,• Verbot von Feuer und
offenem Licht/Rauchverbot,• Grundausstattung mit Feuerlöschern, • Freihalten von Flucht-
und Rettungswegen,• Durchführung von
Evakuierungsübungen.Der Arbeitgeber hat die Umsetzung dero.g. Maßnahmen sicherzustellen. Alle aufBaustellen beschäftigten Mitarbeiter sindhinsichtlich der Brandgefährdungen undden abgeleiteten Maßnahmen mindes -tens einmal jährlich zu unterweisen. Diesmuss auch dokumentiert werden.
Zusammenhang mit Brand und Explosionsind dabei insbesondere Prüfungen von• Arbeitsmitteln, die in explosionsgefähr-
deten Bereichen eingesetzt werden und eine potenzielle Zündquelle sind,
• Lüftungsanlagen,• Gaswarneinrichtungen und• Flüssiggasanlagen von Bedeutung.
Technischen Regeln für Arbeitsstätten(ASR)Die ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“gilt für das Einrichten und Betreiben vonArbeitsstätten mit Feuerlöscheinrichtun-gen sowie für weitere Maßnahmen zurErkennung, Alarmierung und Bekämpfungvon Entstehungsbränden. Der Arbeitgeberhat gemäß Punkt 7.3 eine ausreichendeAnzahl von Beschäftigten durch Unterwei-sung und Übung im Umgang mit Feuer-löscheinrichtungen zur Bekämpfung vonEntstehungsbränden vertraut zu machen.Die Anzahl der Brandschutzhelfer ergibtsich aus der Gefährdungsbeurteilung desUnternehmers. Wenn diese nichts anderesergibt, ist die Anzahl von 5 % der Beschäf-tigten als ausreichend anzusehen. DieseAnforderungen gelten nicht für Baustel-len, sondern nur für stationäre Baustellen-einrichtungen wie Bauleitungs- bzw. Büro-container auf Baustellen. Man spricht hiervon der sog. „Büroähnlichen Nutzung“.
DGUV Information 205-023Die Ausbildung der Brandschutzhelferwird in der DGUV Information 205-023„Brandschutzhelfer – Ausbildung undBefähigung“ geregelt.
Für Baustellen, bei denen feuergefährlicheArbeiten mit erhöhter Brandgefährdung(z.B. Schweißen, Brennschneiden, Trenn-schleifen, Löten) durchgeführt werden, istentsprechend der Brandklasse ein Feuer-löscher mit mindestens 6 Löschmittelein-heiten (LE) in unmittelbarer Nähe bereit-zustellen (beispielsweise ein 6 kg ABC Pul-verlöscher). Die Personen, die diese vor-genannten Arbeiten ausführen, sind imUmgang mit Handfeuerlöschern theore-tisch und praktisch sowie über die Brand-gefährdungen und die entsprechendenorganisatorischen Maßnahmen zu unter-weisen.
Dr. Kerstin RathmannFrank Trunz
Martin HackmannBG BAU Prävention
Welche rechtlichen Grundlagen kommen zum Tragen?Die Forderung, dass bereits in der Planungund dem Betrieb von Baustellen sowie bei der Durchführung von kleineren Bau-,Umbau-, Reparatur- und Sanierungsmaß-nahmen brandschutztechnische Vorkeh-rungen berücksichtigt werden müssen,ergibt sich aus zahlreichen Gesetzen,Regelwerken und Verordnungen, z.B. Bau-stellen- und Gefahrstoffverordnung. Tech-nische Regeln, Richtlinien und Merkblätterergänzen und konkretisieren die Anforde-rungen.
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und Baustellenverordnung (BaustellenV) Der Unternehmer hat laut Arbeitsschutz-gesetz § 10 „Erste Hilfe und sonstige Not-fallmaßnahmen“ entsprechend der Art derArbeitsstätte und der Tätigkeiten, Maß-nahmen zu treffen, die zur Brandbekämp-fung und Evakuierung erforderlich sind,sowie Beschäftigte zu benennen, welcheAufgaben der Brandbekämpfung und Eva-kuierung übernehmen. Im Rahmen der Ge -fährdungsbeurteilung sind u.a. die Brand-gefährdungen zu ermitteln und die Maß-nahmen des Arbeitsschutzes festzulegen.Werden Beschäftigte mehrerer Arbeit-geber auf der Baustelle tätig, sind dieArbeitgeber gemäß § 8 „Zusammenarbeitmehrerer Arbeitgeber“ Arbeitsschutzge-setz verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheitsbestimmungen zusammen-zuarbeiten. Die Schutzmaßnahmen sindabzustimmen und gemäß Baustellenver-ordnung ist mindestens ein Koordinatorzu bestellen. Werden besonders gefähr-liche Arbeiten wie z.B. Tätigkeiten mitextrem und/oder leicht entzündbarenStoffen ausgeführt, ist ein Sicherheits- undGesundheitsschutzplan zu erstellen.
DGUV VorschriftNach der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätzeder Prävention“ § 22 „Notfallmaßnahmen“hat der Unternehmer Maßnahmen für denFall des Entstehens von Bränden undExplosionen zu planen, zu treffen und zuüberwachen. Eine ausreichende Anzahlvon Beschäftigten sind durch Unterwei-sung und Übung mit Feuerlöscheinrich-tungen zur Bekämpfung von Entstehungs-bränden vertraut zu machen.
Betriebssicherheitsverordnung Die BetrSichV regelt u.a., dass Arbeitsmit-tel regelmäßig geprüft werden müssen. Im

Stichwort Recht BauPortal 7/201966
Reicht die Einhaltung der Herstellervorgaben für Mangelfreiheit aus?1. Die Einhaltung der Herstellervorgaben
stellt keinen Mangel dar, wenn die allgemein anerkannten Regeln derTechnik keine höheren Anforderungenan das Werk stellen als die Hersteller-vorgaben.
2. Ein Mangel kann vorliegen, wenn dieHerstellervorgaben zwar eingehaltensind, das Werk aber nicht den allge-mein anerkannten Regeln der Technikentspricht. Ein Mangel kann auchbestehen, wenn die Anforderungen der Herstellervorgaben über die allgemein anerkannten Regeln derTechnik hinausgehen und diese nichteingehalten werden.
OLG Hamm, Urt. v. 9.11.2018 – 12 U 20/18
Sachverhalt:Der Bauherr beauftragte den Auftragneh-mer (AN) mit der Erstellung des Rohbaus.Zum Auftragsumfang gehörte, den Kellerdes Gebäudes mittels einer zweilagigenBitumendickbeschichtung mit Gewebe-einlagen gegen Feuchtigkeit abzudichten.Die erdberührten Kellerwände sollten mitextrudierten Polystyrol-Hartschaumplat-ten in einer Stärke von 120 mm gedämmtwerden. Die Perimeterdämmung wurdeim Punktverfahren geklebt. Der Rohbauwurde mit WU-Beton errichtet. Die Ab-nahme fand durch Bezug des Hauses statt.Nach einiger Zeit kam es zu Feuchtigkeits-problemen im Keller. Der Bauherr behaup-
tet, dass die Leistung des AN mangelhaftwar, da er die anerkannten Regeln derTechnik nicht eingehalten und sich ledig-lich auf die Herstellervorgaben verlassenhabe, als er die Dämmplatten verklebte.Das Landgericht schloss sich dieser Auf-fassung an und verurteilte den AN zurZahlung von Schadensersatz. Der AN legtehiergegen Berufung ein.
Entscheidung:Mit Erfolg! Der Schadensersatzanspruchnach § 13 Abs. 7 Nr. 3 Satz 1 VOB/B seinicht begründet. Der Bauherr hätte denMangel nicht bewiesen. Ein Abweichenvon den anerkannten Regeln der Technikdurch die Verklebung der Perimeterdäm-mung auf der gewebearmierten Bitu-mendickbeschichtung konnte vom Gerichtnicht festgestellt werden. Die Verklebungstelle insbesondere keinen Verstoß gegenDIN 18195 dar. Auch die Herstellervor-gaben würden ein Verkleben empfehlen,um die Dämmplatten vor einem Verschie-ben zu sichern. Die Einhaltung der Herstel-lervorgaben stelle dann keinen Mangeldar, wenn die allgemein anerkanntenRegeln der Technik keine höheren Anfor-derungen an das Werk stellen als die Her-stellervorgaben. Ein Mangel könnte zumeinen vorliegen, wenn die Herstellervor-gaben zwar eingehalten seien, das Werkaber nicht den allgemein anerkanntenRegeln der Technik entspräche. Zum ande-ren könne ein Mangel vorliegen, wenn dieAnforderungen der Herstellervorgabenüber die allgemein anerkannten Regelnder Technik hinausgingen, um ein be -stimmtes Risiko abzuwenden, und diese
nicht eingehalten worden seien. Ein Man-gel bestünde trotz Verstoß gegen die aner-kannten Regeln der Technik nicht, weil dieGefahr, vor dem die Einhaltung der aner-kannten Regeln der Technik schützen soll,bei Einhaltung der hiervon abweichendenHerstellervorgaben ebenfalls nicht eintre-ten könne.
Praxishinweis:Das Einhalten der Herstellervorgabenreicht also nicht in jedem Fall aus. Der ANsollte darauf achten, dass die Hersteller-vorgaben auch den anerkannten Regelnder Technik entsprechen und diese zumin-dest nicht unterschreiten.
RA Frederic JürgensMELCHERS Rechtsanwälte
Unverhältnismäßige Mängelbeseitigung im Straßenbau1. Hat der Auftraggeber ein objektiv
berechtigtes Interesse an einer ordnungsgemäßen Vertragserfüllung,kann der Auftragnehmer regelmäßignicht wegen Unverhältnismäßigkeitdie Nacherfüllung verweigern.
2. Bei Mängeln eines Straßenbelagsbesteht grundsätzlich ein objektivberechtigtes Interesse des Auftrag-gebers an der Mängelbeseitigung,wenn die Mangelhaftigkeit das Risiko einer nachhaltigen Funktions-beeinträchtigung beinhaltet. Etwasanderes gilt nur, wenn der Auftrag-nehmer nachweisen kann, dass sich
Stichwort Recht
MIT IHRER HILFE RETTET ÄRZTE OHNE GRENZEN LEBEN.WIE DAS DER KLEINEN ALLERE FREDERICA AUS DEM TSCHAD: Das Mädchen ist plötzlich schwach und nicht mehr ansprechbar. Sie schläft zwar unter einem Moskitonetz. Dennoch zeigt der Schnelltest, dass sie Malaria hat – die von Mücken übertragene Krankheit ist hier eine der häufi gsten Todesursachen bei kleinen Kindern. ärzte ohne grenzen behandelt die Zweijährige, bis sie wieder gesund ist und nach Hause kann. Wir hören nicht auf zu helfen. Hören Sie nicht auf zu spenden.
WWW.AERZTE-OHNE-GRENZEN.DE / SPENDEN
SPENDENKONTO:BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFTIBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00BIC: BFSWDE33XXX
© S
ebas
tian
Bol
esch

BauPortal 7/2019 Stichwort Recht 67
dieses Risiko aller Voraussicht nach erst kurz vor Ende der üblichen Nutzungsdauer verwirklicht.
OLG München, Urt. v. 27.2.2018 – 9 U 3595/16 Bau
Sachverhalt:Der Auftragnehmer (AN) wurde vom Auf-traggeber (AG) mit der Herstellung einesStreckenabschnitts der Bundesautobahnbeauftragt. Der Auftrag umfasste u.a. auchdie Herstellung einer Binderschicht ausAsphaltbinder. Kurz vor Verjährungseintrittder Mängelbeseitigungsansprüche rügteder AG großflächige Schäden an der Fahr-bahndecke in Form von Netz-, Quer- undLängsrissen. Ein Gutachter stellte fest, dassdiese durch Inhomogenitäten der Binder-schicht aufgrund Entmischung (= sehrungleiche Verteilung von Grobkorn undMörtel und damit auch ungleiche Hohl-raumverteilung) verursacht wurden. DerAG verlangt vom AN den Ersatz der zuerwartenden Mängelbeseitigungskostenvon ca. 8,5 Mio. €. Der AN weigert sich die Kosten zu tragen, bevor der AG eineZuschusspflicht in Höhe von 90 % derErtüchtigungskosten anerkennt. Zudemhält der AN den Mängelbeseitigungsauf-wand für unverhältnismäßig. Das Land-gericht gab dem AG Recht und verurteilteden AN zur Zahlung der Mängelbeseiti-gungskosten. Hiergegen ging der AN inBerufung.
Entscheidung:Ohne Erfolg! Auch das Berufungsgerichthält den Anspruch des AG für gerecht-fertigt. Die Fahrbahndecke sei mangel-haft. Geschuldet sei ein rissefreies Ge-werk, das ein jahrelanges, sanierungsfreiesund problemloses Befahren der beauftrag-ten Streckenabschnitte ermögliche. DieseFunktion erfülle das Werk des AN nicht.Der AN könne auch nicht die Zahlung der Kosten zurückhalten, bis der AG eine Zuschusspflicht von 90 % anerkennt.Sind sich die Parteien über eine Beteili-gungspflicht des AG nicht einig, könne der AN vorweg keine Zusage eines Kos-tenzuschusses verlangen, sondern ledig-lich Sicherheitsleistung in angemessenerHöhe. Schließlich könne der AN auch nichtdie Mängelbeseitigung wegen Unverhält-nismäßigkeit verweigern. Dies wäre nurmöglich, wenn einem objektiv geringenInteresse des AG an einer mangelfreienVertragsleistung ein ganz erheblicher unddeshalb vergleichsweise unangemessenerAufwand gegenüberstünde. Bei Mängelneines Straßenbelags bestehe aber grund-sätzlich ein objektiv berechtigtes Interessedes AG an der Mängelbeseitigung, wenndie Mangelhaftigkeit das Risiko einernachhaltigen Funktionsbeeinträchtigung
beinhalte. Etwas anderes gelte nur, wennder AN nachweisen könne, dass sich diesesRisiko aller Voraussicht nach erst kurz vorEnde der üblichen Nutzungsdauer ver-wirkliche. Dies habe der AN nicht gekonnt,da die Risiken sich schon sehr frühzeitigrealisiert hätten.
Praxishinweis:Trotz zum Teil hoher Kosten der Mängel-beseitigung hat der Bundesgerichtshof die „Messlatte“ für ein Recht zur Verwei-gerung der Mängelbeseitigung wegenUnverhältnismäßigkeit im Straßenbaurecht hoch gelegt. Grundsätzlich reichtbereits das Risiko einer nachhaltigen Funk-tionsbeeinträchtigung aus. Ob eine solchevorliegt, kann aber nur durch eine Gesamt-schau der Umstände im Einzelfall ent-schieden werden.
RA Nikolas Bauer
Gutes Hören auf Baustellen wichtig 1. Ein schwerhöriger Projektleiter, der
für die Bauüberwachung von Groß-baustellen zuständig ist, hat zur Sicherstellung seiner ErwerbsfähigkeitAnspruch auf Hörgeräte, die sich automatisch wechselnden Geräusch-kulissen anpassen.
2. Während im Privatleben Situationen, in denen es auf ein gutes Hörverstehenankommt, von Menschen mit Behinde-rungen beeinflussbar sind, fehlen imBerufsalltag, z.B. auf Baustellen, regel-mäßig die Möglichkeiten des Einzelnen,auf Lärmpegel und Umgebungs-geräusche mindernd einzuwirken.
Hessisches Landessozialgericht, Urt. v. 13.9.2018 – L 1 KR 229/17
Sachverhalt:Der Techniker und Projektleiter (P) ineinem Ingenieurbüro für Versorgungstech-nik leidet an einer Schwerhörigkeit. 2008hatte die Deutsche RentenversicherungBund (RV) Hörgeräte als Leistungen zurTeilhabe am Arbeitsleben bewilligt. 2014beantragt P eine Hörhilfe des Premium-segments: Er müsse in größeren Gruppenoder in Telefonkonferenzen kommunizie-ren; im Rahmen von Bauleitung und Bau-überwachung habe er regelmäßig an Bau-besprechungen teilzunehmen und sei da -bei auf ein exaktes Hörverständnis vonZahlen und Fakten angewiesen. Bei Ter-minen auf Baustellen komme es auswechselnden Richtungen zu störendenHintergrundgeräuschen durch Transport-fahrzeuge, Bagger, Presslufthammer u.ä.Diese Anforderungen an sein Hörvermö-gen erfülle am besten die von ihm ge -wählte Hörgeräteversorgung. P’s Chef be -
stätigt, dass es unerlässlich sei, schnellund ohne Probleme allen Gesprächen fol-gen zu können. Fehlinformationen auf-grund eines geminderten Hörvermögenskönnten die Projektabwicklung erschwe-ren, den Kunden schädigen und Gefahrenauf den Baustellen auch für Dritte zurFolge haben. RV leitet den Antrag an den Krankenver-sicherungsträger (KV) weiter. KV hält dieVersorgung mit Hörhilfen, die zu Fest-beträgen erhältlich sind, für ausreichendund lehnt die Übernahme der Mehrkostenfür die von P ausgewählten Hörgeräte ab.Auch RV ist der Meinung, dass ein berufs-bedingter Mehrbedarf für eine höherwer-tige Hörgeräteversorgung nicht bestehe.
Entscheidung:In zwei Instanzen der Sozialgerichtsbar-keit bekommt P Recht! Im Vergleich zunormaler Bürotätigkeit bestünden in sei-nem Berufsfeld besondere Anforderungenan das Hörvermögen, insbesondere beiBaubesprechungen auf Baustellen mitwechselnden Geräuschkulissen und einemGrundpegel an Lärm. P’s Erwerbsfähigkeitkönne durch das hochwertige Hörgeräte-system sichergestellt werden, das sich inBesprechungen wie auch bei Hintergrund-störgeräuschen und bei sich veränderndenGeräuschkulissen automatisch anpassenund Störgeräusche unterdrücken könneund ohne zeitliche Verzögerung ermög-liche, einem Gespräch mit der erforder-lichen Genauigkeit zu folgen. P sei auf eingutes Hörvermögen angewiesen. Mit Rich-tungshören und Hören im Störfeld ohneregelmäßig notwendige manuelle Anpas-sungen biete das von P favorisierte Hör-gerät im Vergleich zu den herkömmlichenden Festbetragsregeln unterfallenden Hör-geräten einen arbeitsplatzspezifischen Ge -brauchsvorteil. Der durch Schwerhörigkeiteingeschränkte P benötige zur Sicherstel-lung seiner Erwerbsfähigkeit das Hörgerätin der Premiumausführung.
Praxishinweis:Dass KV verurteilt wurde, die Kosten fürdas höherwertige Hörgerät, immerhin ca. 5.900,00 €, zu übernehmen und nichtRV, ist einer besonderen Konstellationgeschuldet: Der Leistungsantrag warursprünglich bei RV eingegangen. Von dortwar der Antrag jedoch an KV weiterge-leitet worden. So musste KV als zweit-angegangener Leistungsträger entschei-den. Diese Entscheidung erwies sich alsnicht rechtens und KV wurde verurteilt, –auf Grundlage der für die Rentenversiche-rung geltenden Vorschriften – die Leistungzu erbringen.
Dr. Sabine Müller-PetzerStabsabteilung Geschäftsführung BG BAU

Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test BauPortal 7/201968
Liebherr-France SAS68005 Colmar Cedex / FRANKREICHHydraulikbagger R924Hydraulikbagger R922
Takeuchi France SAS95310 Saint-Quen-l‘Aumône / FRANKREICHHydraulikbagger TB 235-2
StraßenbaumaschinenWirtgen GmbH53578 WindhagenStraßenfräse 2320 -W210FiKaltrecycler 09WR - WR-200iKaltrecycler 04CR-W240CRi/W380CRi, TIER V
HAMM AG95643 TirschenreuthSchemelgelenkte TandemwalzeH 246 DV+90i, EU Stage
ErdbaumaschinenLiebherr-Hydraulikbagger GmbH88457 Kirchdorf Hydraulikbagger A 914 mit Hubgestell LHC 255
Von der Prüf- und Zertifizierungsstelle wurden folgendeMaschinen hinsichtlich der Ar beits sicher heitgeprüft und auf Grundlage der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bzw. des ProdSG zertifiziert.Datenbank für geprüfte Produkte:www.dguv.de/dguv-test/produkte
Fachbereich BauwesenPrüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV TestEuropäisch notifizierte Stelle, Kenn-Nummer 0515Zertifizierung von Maschinen, Geräten und Sicherheitsbauteilen sowie QM-Systemen

BauPortal 7/2019 Veranstaltungen 69
� BIM im TiefbauDas IKT – Institut für Unterirdische InfrastrukturgGmbH, Exterbruch 1, 45886 Gelsenkirchen führtvom 3. bis 5. Dezember 2019 in Gelsenkirchen den ersten offiziellen Lehrgang zum Thema „BIMIM TIEFBAU“ – deutschlandweit durch. Das InstitutIKT hat diesen Lehrgang gemeinsam mit der Bergischen Universität Wuppertal konzipiert undfür Interessierte aus dem Tiefbau-Bereich maß-geschneidert. Die fachlichen Kompetenzen undExpertisen beider Partner werden ab Dezember imRahmen eines dreitägigen Lehrgangs gebündelt.Dort lernen die Teilnehmer die fachlichen BIM-Grundlagen und werden gleichzeitig fit gemachtfür die BIM-Arbeit im Tiefbau. Fokus des Lehrgangsliegt nicht nur auf der frontalen Vermittlung desBIM-Wissens, sondern auf der Einbindung der Teil-nehmer. Deren Fragen, deren Projekte und vorallem ihr Tiefbau-Know-how sollen in die Veran-staltung einfließen.
Anmeldung und Information:Sonja Kaltenborn, Tel. 0209/[email protected]
DWA-Seminar � Kanalbau in offener BauweiseDie Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,Abwasser und Abfall e.V. (DWA) führt am 13. und14. November 2019 das Seminar „Kanalbau in offe-ner Bauweise gemäß DIN EN 1610 und DWA-A 139sowie DWA-M 135-1 in Duisburg durch.
In diesem Seminar stellt der zuständige Fachaus-schuss das überarbeitete Arbeitsblatt DWA-A 139in Kombination mit der DIN EN 1610 vor und wid-met sich somit dem Thema Einbau und Prüfungvon Abwasserleitungen und -kanälen. Als Ergän-zung wird im Detail auf das Thema Dichtheit beineuen und bestehenden Kanälen eingegangen.Zusätzlich vertieft werden die Themen „Anforde-rungen an die Bauausführung anhand der ZTV“,sowie die Planung und Ausführung der Baugru-benverfüllung mit Flüssigboden.
Weitere Informationen: Christina Holz, Tel. 02242/872-229, [email protected]
Fachforum für Akustik und Schallschutz –� Tag des Donners
Lärm nervt. Er lenkt ab, beeinträchtigt die Lebens-qualität und macht manchmal sogar krank. Wereinmal in einem schlecht schallgeschützten Raumleben oder arbeiten musste, weiß um die Beein-trächtigungen, die daraus entstehen. Dem Schall-schutz in Neubau und auch Bestand fällt dahereine besondere Bedeutung zu – Grund genug, umden Trends dieser Branche einen Thementag zuwidmen.
Am 21. November 2019 laden die Aachen BuildingExperts zum „Tag des Donners“ im Tivoli Aachen,Krefelderstr. 205, 52072 Aachen ein. Ziel der Vor-tragsveranstaltung ist, Planer über aktuelle Ent-wicklungen in Sachen Schallschutz und Raum-akustik zu informieren.
www.tag-des-donners.de
Veranstaltungen
� bautec 2020Die „bautec 2020“ findet vom 18. bis 21. Februar2020 im Berlin ExpoCenter City, Messedamm 22,14055 Berlin, unter der Schirmherrschaft von Bun-desinnenminister Horst Seehofer statt. Das Bun-desministerium des Innern, für Bau und Heimatwird im neuen Bereich up#Berlin mit einem Standsowie vielfältigen Veranstaltungen und Präsenta-tionen vertreten sein. Unter dem Leitthema „DasBauen von Morgen“ stehen die Digitalisierung desBauwesens, Architektur und Klima, Wohnungsbau,Quartiere sowie innovative und nachhaltige Mate-rialien im Fokus des Vortragsprogramms.
www.bautec.com
Workshop –Risse an Gebäuden –� Schadenanalyse und Sanierung
Trotz aller Wissensvermittlung hat sich das Pro-blem der Bauschäden bis heute gehalten. Nichtoder nicht ausreichend untersuchter Baugrund,missverständliche Planung mit entsprechenderBauausführung, Einwirkungen von außen – dieListe möglicher Schadenursachen lässt sich nochfortsetzen. Das Ergebnis: Gebäude, die entspre-chende Rissbilder zeigen, und deren Tragfähigkeitunter Umständen sogar bedroht ist.
Im Mittelpunkt dieses Seminarkonzepts stehenvon den Teilnehmern mitgebrachte Schadenfälle.Anhand konkreter Schadensbilder werden gemein-sam die Risse „gelesen“, Schadenursachen ergrün-det und Sanierungsmöglichkeiten erörtert.
URETEK Deutschland, Weseler Str. 110, 45478 Mül-heim an der Ruhr, Tel. 0800/3773250, Fax 0208/37732510, [email protected], veranstaltet diesenWorkshop an folgenden Terminen:
1.10.19 Ratingen, 29.10.19 Suhl, 30.10.19 Kassel,12.11.19 Weingarten, 14.11.19 Zweibrücken,20.11.19 Bremen, 21.11.19 Braunschweig
www.uretek.de
28. Kranfachtagung –Kran 4.0: � Potenziale der Digitalisierung
Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,Institut für Logistik und Materialflusstechnik, Lehr-stuhl Förder- und Materialflusstechnik, führt am 5. März 2020 die 28. Internationale Kranfach-tagung im Hotel Ratswaage in Magdeburg durch.
Die Kranfachtagung wird von den Universitäten inBochum, Dresden und Magdeburg wissenschaft-lich getragen und bietet sowohl für Hersteller,Betreiber und Dienstleister als auch die Vertreterder wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen,die sich dem breiten Feld der Krananlagen und ent-sprechenden Komponenten widmen, ein Forumdes Erfahrungsaustausches. Den Faden der bishe-rigen Tagungen aufgreifend, soll über Forschungs-ergebnisse, Entwicklungspotenziale und aktuelleHerausforderungen in Krantechnik und -betrieb imSpannungsfeld von Digitalisierung, KünstlicherIntelligenz und 5G diskutiert werden.
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, FMB-ILM, Dipl.-Ing. Dagmar Pfeiffer, Tel. 0391/67-58780www.ilm.ovgu.de
� TÜV Nord Akademie HannoverMit einem neuen Schulungskonzept will das Bun-desamt für Sicherheit in der Informationstechnik(BSI), Deutsche Unternehmen in Sachen IT-Sicher-heit, informieren. Der „IT-Grundschutz-Praktiker“löst das alte Seminar „IT-Grundschutz-Experte“ abund erweitert es um das Aufbauseminar zum „IT-Grundschutz-Berater“. Die Umstrukturierungsoll nicht nur Behörden, sondern jetzt auch Unter-nehmen die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter er -leichtern.
Der TÜV Nord Group, Am TÜV 1, 30519 Hannover,Tel. 0511/99861971, führt nachstehend aufge-führte Seminare durch:
IT-Grundschutz-Praktiker:11.11.19 Bielefeld und Dresden, 25.11.19 Berlin, 16.12.19 Köln, 20.1.20 München
IT-Grundschutz-Berater:2.12.19 Berlin29.1.20 München
www.tuev-nord-group.com
� 18. Deutscher Fassadentag Wie sieht die Gebäudehülle der Zukunft aus? Wiesmart und digital ist die Bauwirtschaft schonunter wegs? Und wo befinden wir uns auf der facade roadmap? Diese und andere Fragen zurIndustrialisierung und Digitalisierung des Planenund Bauens im Fassadenbereich werden am 21. November 2019 auf dem 18. Deutschen Fassa-dentag auf dem GLS Campus, Kastanienallee 82 in Berlin-Prenzlauer Berg, diskutiert. Das Vortrags-programm, der alle zwei Jahre vom FVHF initiier-ten Veranstaltung, steht in diesem Jahr unter derÜberschrift „Multifunktional und intelligent: VHF –Die Fassade mit Mehrwert“.
Anfragen und Anmeldung: Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V. (FVHF), Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin-Schöneberg, Tel. 030/21286281, [email protected]
VDI Wissensforum –� BIM im Infrastrukturbau Am 3. und 4. Dezember 2019, veranstaltet das VDI-Wissensforum die Fachkonferenz „BIM im Infra-strukturbau“ in Düsseldorf. Die VDI-Konferenzbefasst sich mit den Chancen und Herausforderun-gen beim Einsatz von Building Information Mode-ling (BIM) im Infrastrukturbau für Schiene, Straße,Brücke und Tunnel. Im Mittelpunkt der Konferenzstehen die Themen Digitalisierung, Datenaus-tausch und Schnittstellen sowie der effizienteUmgang mit großen Datenmengen. Zudem erhältman Informationen über die gesetzlichen und juristischen Vorgaben mit BIM, BIM-technischerUmgang mit Linienbauwerken über mehrere Kilo-meter u.v.m.
VDI-Wissensforum GmbH, VDI-Platz 1, 40468 Düsseldorf, Tel. 0211/6214-201, [email protected]

Buchbesprechungen BauPortal 7/201970
� Abbruch 2020Der Deutsche Abbruchverband e.V. führt am 28. Februar 2020 die Fachtagung Abbruch 2020mit begleitender Ausstellung in STATION-Berlin,Luckenwalder Str. 4–6, 10963 Berlin, durch.
Mehr als 1.000 Teilnehmer und 116 Ausstellermachen die Fachtagung Abbruch zu einem jähr-lichen Branchenevent. Ausgewiesene Fachleuteund Praktiker als Referenten berichten in rund 20Vorträgen über Aktuelles und Neues aus Technik,Schadstoffsanierung, Recycling, Arbeitsschutz undinteressante Baustellenberichte. Die begleitendeFachausstellung bildet eine wertvolle fachlicheErgänzung.
www.fachtagung-abbruch.de
� 14. GUEP PlanertagInstandhaltung von Betonbauwerken gehört zuden besonders anspruchsvollen Bauaufgaben,deren Bewältigung Fachkenntnisse und umfang-reiche Erfahrungen voraussetzt. Als Plattform fürden Erfahrungsaustausch dazu dient der bereitszum 14. Mal stattfindende GUEP-Planertag. DasSpektrum reicht von der derzeitigen Regelwerk-situation über Aspekte der Digitalisierung vonBestandsbauwerken im Zuge der Ist-Zustandsauf-nahme bis hin zur Darstellung von Möglichkeitenund Grenzen experimentell gestützter Tragsicher-heitsnachweise an Stahlbeton- und Spannbeton-bauwerken im Hoch- und Ingenieurbau. Im Fokus
Schlauch liner“ in Kombination mit dem neuenDWA-M 144-3 „ZTV für vor Ort härtende Schlauch-liner“).
Auskunft und Anmeldung: Petra Heinrichs, Tel. 02242/872-222,[email protected]
Zeitgemäßes Bauen –Wiederkehrende Probleme, � zukunftsfähige Lösungsansätze
In der Diskussion um zeitgemäßes Bauen fallenschnell die Begriffe wie „modern“, aber vor allem„nachhaltig“ und „qualitativ“. Gefragt sind heuteBauten, die architektonische Qualität mit einerentsprechenden Ökobilanz und ökonomischerWirtschaftlichkeit verbinden. Immer wichtigerbeim Bauen wird aber, die sich zunehmend ver-ändernden Umwelteinflüsse zu berücksichtigen.
In diesem neuen Seminarkonzept geht es um die(unvermeidbaren) Risse und wann, bzw. ob ein Risseinen Mangel darstellt. Und es geht um Schad-stoffe im Baugrund, wobei Radon eine besondereBetrachtung verdient (Radon stellt den größtennatürlichen Beitrag zur Strahlenbelastung dar). Wiegewohnt, hat die Praxisnähe großen Raum und eswird viele Fallbeispiele geben.
URETEK Deutschland, Weseler Str. 110, 45478 Mül-heim an der Ruhr, Tel. 0800/3773250, Fax 0208/37732510, [email protected] veranstaltet diesenWorkshop an folgenden Terminen:
30.10.19 Kassel, 31.10.19 Münster,12.11.19 Weingarten, 13.11.19 Neu-Ulm
www.uretek.de
stehen außerdem die neue Vorgehensweise bei derQualitätssicherung von Instandsetzungsproduktenunbekannter Zusammensetzung im Geschäftsbe-reich des Verkehrswasserbaus und die Planung undAusführung von Bauteil-/Bauwerkssegmentfugenund Arbeitsfugen im Zuge von Betoninstandhal-tungsarbeiten.
Die Gütegemeinschaft Planung der Instandhal-tung von Betonbauwerken e.V. veranstaltet den 14. GUEP Planertag am 26. November 2019 imMaternushaus, Kardinal-Frings-Str. 1, 50668 Köln.
www.guep.de
DWA-Seminar –Kanalinspektion und � Kanalsanierung von A bis Z
Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,Abwasser und Abfall e.V. (DWA) führt vom 5. bis 7. November 2019 das Seminar „Kanalinspektionund Kanalsanierung von A bis Z“ im Melia TrypDortmund Hotel, Emil-Figge-Str. 41, 44227 Dort-mund durch.
Diese Kombiveranstaltung aus der Reihe „Von A bis Z“ bietet eine kompakte Darstellung derZustandserfassung, -beurteilung und der Aus-schreibung von Kanalinspektions- und Kanalsanie-rungsmaßnahmen. Basierend auf der Zustands-beurteilung der Entwässerungssysteme, werdendie möglichen Verfahren zur Sanierung vorge-stellt und die Auswahlkriterien diskutiert. Hierbeisteht die praktische Handhabung der Regelwerkeim Vordergrund. In diesem Seminar wird die Merk- und Arbeitsblattreihe DWA-A 143 vorgestelltund behandelt (DWA-A 143-3 „Vor Ort härtende
Buchbesprechungen
Moralische Verantwortung � von BauingenieurenProblemstellungen – Perspektiven – Handlungsbedarf
Michael Scheffler
2019, 262 Seiten, SoftcoverISBN 978-3-658-25205-2Buch + eBook € 18,00eBook € 12,99
Springer Verlag, Heidelberg
Im „goldenen Zeitalter der Ingenieurkunst“ von1850 bis 1950 und auch noch in der Zeit des Wie-deraufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg stand dertechnische Fortschritt beim Bauen im Einklang mitgesellschaftlichen Werten wie der Mehrung vonSicherheit, Wohlstand, Freiheit und Entfaltung.Daran hat sich bis heute kaum etwas verändert:Was technisch hergestellt werden kann, wirdgebaut. Der technische Fortschritt aber ist heuteauch Bedrohung, denn soziale Auswirkungen tre-ten genauso in Erscheinung wie Beeinträchtigun-gen der natürlichen Umwelt.
Dort, wo es vor 20, 30 oder 40 Jahren noch Felderoder Wiesen gab, zerschneiden heute Verkehrsanla-gen, Gewerbegebiete, S-Bahnnetze, Supermärkteoder ganze Stadtteile die Landschaft. Schien dieAufnahmekapazität von Wasser, Luft und Boden fürSchadstoffe und Abfälle aller Art anfangs noch
unbegrenzt, müssen wir uns jetzt eingestehen,dass wir es mit dem ebenso hoffnungsfrohen wiesorglosen Glauben an Fortschritt durch Technikwohl zu weit getrieben haben.
Das Sachbuch erörtert Grundsatzfragen des Han-delns im Alltag von Bauingenieuren insbesondereim Hinblick auf den derzeitigen Stellenwert unddie Wahrnehmung moralischer Verantwortung,diskutiert bestehende Störungen und Problem-stellungen und zeigt vordringlichen Handlungs-bedarf auf.
Erneuerung von Abwasserleitungen und -kanälen � durch Berstverfahren
DWA Regelwerk – Arbeitsblatt DWA-A 143-15
Herausgeber: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Hennef
2019, Arbeitsblatt, 38 SeitenISBN 978-3-88721-828-7€ 58,50 (DWA-Mitglieder € 46,80)
Das Arbeitsblatt ergänzt DIN EN 752 „Entwässe-rungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanal-management“ hinsichtlich der baulichen Sanie-rung. Es befasst sich mit der grabenlosen Erneue-rung von erdverlegten Abwasserleitungen und -kanälen DN 50 bis üblicherweise DN 1200 mit
dem Berstverfahren. Mit diesem Verfahren könnengenerell Rohre aus allen gängigen Werkstoffen mitAusnahme von Spannbeton mit den nachfolgendaufgelisteten Schäden erneuert werden, sofernsich das Berstgestänge bzw. das Windenseil in dasAltrohr einbringen lassen: Rohrbruch, Korrosion,Abflusshindernisse, Lageabweichungen, Verfor-mung, Risse, Undichtheiten, mechanischer Ver-schleiß und nicht fachgerecht ausgeführte Kanal-sanierungsmaßnahmen.
Größere Lageabweichungen in Form von Unter-,Über- und seitlichen Bögen können im Allgemei-nen nur teilweise ausgeglichen werden. Beton-bettungen und Teil- oder Vollummantelungen mitBeton können einen Einsatz des Verfahrens ver-hindern. Für den Einbau mittels Berstverfahren eignen sich Rohre aller gängigen Rohrwerkstoffe.Die eingesetzten Rohre müssen für das Verfahrengeeignet sein. Bei zu erneuernden Leitungen, dieunterhalb des Grundwasserspiegels liegen, sindgegebenenfalls besondere Maßnahmen erforder-lich.
Das Arbeitsblatt wurde von der DWA-Arbeits-gruppe ES-8.11 „Erneuerung von Abwasserleitun-gen und -kanälen durch Berstverfahren“ im Auftragdes DWA-Hauptausschusses „Entwässerungs-systeme“ (HA ES) im Fachausschuss ES-8 „Zu -standserfassung und Sanierung“ erarbeitet. Mitdem Erscheinen des Arbeitsblatts DWA-A 143-15(6/2019) wird das Merkblatt DWA-M 143-15(11/2005) zurückgezogen.

Buchbesprechungen BauPortal 7/201972
Heft 7 • 131. Jahrgang • Oktober 2019Herausgeber:Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)www.bgbau.de • www.BauPortal-digital.deISSN: 1866-0207Verantwortlich:Klaus-Richard Bergmann, Hauptgeschäftsführer(V.i.S.d.P.)Dipl.-Ing. Bernhard Arenz, Leiter Prävention der BG BAU(fachlich verantwortlich)Redaktion:Meike Nohlen (Chefredaktion),Anke Templiner, Stephan Imhof,Jessica Mena de Lipinski, Angelika Kriwanek,Hildegardstraße 29/30, 10715 Berlin, Telefon (030) 857 81-354, Fax 0800 6686 6883 8180,[email protected] mit Namen oder Initialen gezeichneten Beiträgeentsprechen nicht in jedem Fall der Meinung der BG BAU. Für sie trägt die BG BAU lediglich die allgemeine pressegesetzliche Verantwortung.Verlag:Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG,Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin,Telefon (030) 25 00 85-0, Fax (030) 25 00 85-305,[email protected], www.ESV.infoVertrieb:Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin,Telefon (030) 25 00 85-228, Fax (030) 25 00 85-275, [email protected]: Berliner Bank AG Kto.-Nr. 512 203 101 (BLZ 100 708 48)IBAN: DE 31 1007 0848 0512 2031 01BIC(SWIFT): DEUTDEDB110Bezugsbedingungen:Bezugsgebühren im Jahresabonnement€ 42,–/sfr 60,– für in Aus bildung be findliche Bezieher jährlich(gegen Vorlage einer Studien- bzw. Ausbildungs- bescheinigung)€ 21,20/sfr 24,–Einzelbezug je Heft€ 6,–/sfr 5,– ( jeweils einschl. 7 % MwSt, zzgl. Versand kosten). Die Bezugs gebühr wird jährlich im Voraus er hoben. Abbestellungen sind mit einer Frist von 2 Monatenzum 1.1. jeden Jahres möglich. Bei den Mitgliedsbetrieben der BG BAU ist der Bezugs preis im Mit glieds beitrag enthalten.Preise für gebundene Ausgaben früherer Jahrgängeauf Anfrage. Die Zeitschrift ist auch als eJournal erhältlich, weitere Informationen unter www.BauPortal-digital.deAnzeigen:Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin,Telefon (030) 25 00 85-628/-626/-629, Fax (030) 25 00 85-630, [email protected]: Farsad ChireuginEs gilt Anzeigenpreisliste Nr. 54 vom 1. Januar 2019, die unter http://mediadaten.BauPortal-digital.de bereit steht oder auf Wunsch zugeschickt wird.Der Anzeigenteil ist außer Verantwortung derSchriftleitung.Gesamtherstellung:PC-Print GmbH, Balanstraße 73 / Haus 09, 81541 München
IVW-geprüfte Auflage
ImpressumDas Praxisbuch zur Umsetzung der aktuellen BAFA-Richtlinie � an Vor-Ort-Energieberatungen
Bernd Söllner
2019, 121 Seiten, BroschurISBN 978-3-8007-4556-2€ 26,00
VDE Verlag, Berlin
Steht eine energetische Sanierung eines Gebäudesan, ist die Mitwirkung eines Energieberaters vonVorteil. Energieberatungen sind Pflicht für fast alleenergetischen Gebäudesanierungen mit KfW-För-dermitteln. Die Mindestanforderungen an eine Vor-Ort-Energieberatung hält eine Richtlinie des Bun-desamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle(BAFA) fest. Wie diese Vor-Ort-Energieberatung inder Praxis aussehen kann, wird in dem Buch über-sichtlich beschrieben. Ein komplettes Gutachteneines Einfamilienhauses rundet den Inhalt ab. Neu: Mit Erläuterungen zum Umgang mit dem„Individuellen Sanierungsfahrplan“ des BMWi.
Beton. Die beste Wahl. � Ein FaktencheckHerausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH, Erkrath
2019, 44 Seiten, BroschüreKostenfreie Bestellung unter www.betonshop.de
www.beton.org
Modernes Bauen ist eine komplexe Aufgabe mitvielfältigen Anforderungen an Stabilität, Dauerhaf-tigkeit, Ökonomie und Ökologie. Wer baut, brauchtdaher einen Baustoff, dem er vertrauen kann. DasVertrauen, das Beton auf der ganzen Welt ent-gegengebracht wird, hat gute Gründe. Das Infor-mationsZentrum Beton hat deshalb diese Fakten ineiner Broschüre zusammengestellt. Denn es gibteinen gesellschaftlichen Bedarf für eine gebauteUmwelt, für die Beton als nachhaltiger Baustoffprädestiniert ist.
Die Broschüre belegt das anhand von zahlreichenFakten und erläutert auch die Vorteile gegenüberanderen Baustoffen. Zum Beispiel werden rund 25 % der CO2-Emissionen der Zementherstellungdurch die Carbonatisierung von Beton und Mörtelim Laufe ihrer Lebensdauer gebunden. Ein Fakt, derbisher in der Berechnung von Klimabilanzen nichtberücksichtigt wurde. Ein Beispiel von vielen, dieaufzeigen, wie groß das Potenzial von Beton alsBaustoff der Zukunft ist.
Abdichtungssysteme � für BetonbrückenSIKA Detaillösungen
Herausgeber: Sika Deutschland GmbH, Stuttgart
2019, Broschüre, kostenloses Download unter www.sika.de/bruecke
Technische Aufgaben wie Randanschlüsse, Fugen-ausbildungen oder Verankerungen von Brücken derBundesfernstraßen sind in den Richtzeichnungenfür Ingenieurbauten (RIZ-ING) bundeseinheitlichbeschrieben. In einer neuen Broschüre hat Sikajetzt die wichtigsten Detaillösungen für Beton-brücken ausgewählt und grafisch aufbereitet in dieRichtzeichnungen integriert. Das Unternehmengibt dem Baugewerbe damit praxisnahe Informa-tionen über die fachgerechte Ausbildung mitgeprüften Systemen für alle Details auf Beton-brücken an die Hand.
Streifzüge zum Bauhaus und � zur Architektur der 1920er Jahre
H.-C. Feldmann, S. Lucas2019, 128 Seiten, 17,5 x 23 cm, wattierter FesteinbandISBN 978-3-86795-150-0€ 24,80Verlag Monumente Publikationen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), Bonn Rechtzeitig zur Bauhaus-Triennale im September2019 ist der Band „Streifzüge zum Bauhaus“ er -schienen. Das jüngste Buch der Streifzüge-Reihemöchte einen eigenen Beitrag zum 100-Jahre-Jubi-läum des Bauhauses leisten. Der gut illustrierteBand zeichnet die verschiedenen Stationen der seinerzeit revolutionären Kunst- und Bauakademiein Weimar, Dessau und Berlin nach. In den nur 14 Jahren seines Bestehens von 1919 bis 1933avancierte das Bauhaus zu einer stilbildendenInstitution, deren Effekte bis heute nachwirken.Dabei verfolgten die verschiedenen Direktorenunterschiedliche Ziele und verliehen dem Bauhausdadurch eine jeweils persönliche Prägung.
Auch dieser Band der „Streifzüge“ verbindet um-fassend allgemeine Information mit detailreicherPräsentation von Förderprojekten der DeutschenStiftung Denkmalschutz, von Bauhaus-Objektenalso, bei deren Rettung und Bewahrung die DSDmitgeholfen hat. Am Ende des Buches befindensich umfangreiche Adressen und Öffnungszeiten.Wie seine Vorgänger möchte auch dieses Buch Reiseanregungen geben. Aufgrund seiner fundier-ten Texte verspricht es aber auch gut auf dem Sofadaheim eine anregende Lektüre, gerade wegen der über 100 Architekturfotos, die auch ungewöhn-liche Perspektiven ins rechte Licht setzen.
� Dresdens Tor zum HimmelDie erste aerodynamisch geformte Luftschiffhalleund ihr Einfluss auf die Baugeschichte Roland Fuhrmann 2019, 536 Seiten, 30 x 21,5 cm, KartoniertISBN: 978-3-95908-482-6€ 79,80Thelem, Universitätsverlag und Buchhandel, DresdenDas grö�ßte stü�tzenfrei umbaute Raumvolumen derStadt Dresden ist aus dem Baugeschichtsbewusst-sein verschwunden – zu Unrecht. Das vorliegendeBuch rekonstruiert minutiö�s und packend erzähltdie spannungsreiche Baugeschichte der stä�dti-schen Dresdner Luftschiffhalle von 1913, illustriertmit bisher unverö�ffentlichtem Bildmaterial. Aus-gehend von diesem Pionierbau entfaltet sich einPanorama des Luftschiffhallenbaus im 20. Jahrhun-dert, begleitet vom wachsenden Erkenntnisstandder Aerodynamik. Dabei interagiert der Dresdner„Kokon fü�r Luftschiffe“ mit der Zeppelin-Luftschiff-fahrt sowie mit der Kultur- und Architekturge-schichte an der Schwelle zur Moderne und Stream-line-Moderne. Erst nach seinem erzwungenen Ab -bruch 1921 und dem Wissenstransfer seiner Kon-struktion in die USA mit bis heute bestehendenAdaptionen in Ohio, Kalifornien und North Carolinawird der stromlinienfö�rmige Luftschiffhallentyp alssolcher erkannt und Standard im Großluftschiff-hallenbau. Der Schö�pfer dieser neuen Bauform ist dabei vö�llig in Vergessenheit geraten: Zivil-ingenieur Ernst Meier in Berlin. Sein bahnbrechen-des Schaffen wird hier erstmals umfassend ge -wü�rdigt.

BauPortal, die Fachzeitschri� der BG BAU, erscheint ab 2020 quartalsweise und in einer
neuen, leserfreundlichen Gestaltung. Die Themenvielfalt rund um Bau und Arbeitssicherheit wird noch fokussierter abgebildet – von relevanten Neuigkeiten, über fundierte Fachartikel bis zu umfangreichen Serviceangeboten – und zusätzlich durch ein neues Webmagazin begleitet.
Alles Neue auf einen Blick. Ab 2020 gibt es BauPortal:
• Viermal jährlich, immer zur Quartalsmitte• Mit dem bewährten Themenmix -> News, Trends und Projekte aus der Bauindustrie, der Gebäudereinigung und dem Facility Management, Wichtiges rund um Sicherheit und Gesund- heit bei der Arbeit auf dem Bau, Aktuelles aus dem Baurecht sowie Empfehlungen für Fach- medien und Veranstaltungen• Mit einem begleitenden, neuen Webmagazin -> hier können sowohl alle Themen der Print- version als auch viele weitere Beiträge online gelesen werden• Wie gewohnt kostenfrei für Mitgliedsunternehmen und Fachkrä�e für Arbeitssicherheit (Sifa) -> ein kostenpflichtiges Abonnement wird nicht mehr angeboten
Die Gesamtausgabe sowie einzelne Beiträge können dann jederzeit kostenlos von unserer
Website (www.bgbau.de) heruntergeladen werden.
Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie uns unter: [email protected]
Frisch, fokussiert, fachkompetent: BauPortal im neuen Look

![Dokument 22: [Ohne Namen] - Bauportal-Deutschland · 2017. 1. 26. · sind aus Aluminium. Im Erdgeschoss befinden sich Umkleiden, Sanitärräume, Werkstatt und ein Raum für Gerät](https://static.fdokument.com/doc/165x107/60c59b733aa04d1dab74e8f6/dokument-22-ohne-namen-bauportal-2017-1-26-sind-aus-aluminium-im-erdgeschoss.jpg)