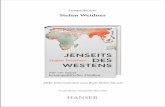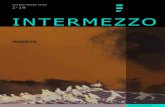Kurzes Intermezzo der Dentisten
Transcript of Kurzes Intermezzo der Dentisten

report34
DFZ 2 · 2014
Zwischen Medizin und Technik
Kurzes Intermezzo der DentistenIn Frankreich geht man noch heute „chez le dentiste“. Und im englischsprachigen Raum ist „the dentist“ ebenfalls der Zahnarzt – der mit Studium und vielleicht sogar einem Doktortitel. In Deutschland allerdings werden Zahnärzte nicht gern als Dentisten bezeichnet. Denn hierzulande waren Dentisten lange Zeit keine approbierten Zahnärzte, sondern eher handwerklich orientier-te Dienstleister am Patienten. Das prägte den Begriff mit einer gewissen Geringschätzung, die sich bis heute gehalten hat. Dabei war der Dentist ein ehrenwerter Beruf – irgendwo zwischen Zahnarzt und Zahntechniker. Doch genau dieses Dasein zwischen Baum und Borke, zwischen Arzt und Tech-niker wurde ihm zum Verhängnis. Die Historie des Dentisten gleicht deshalb eher einer Randnotiz in der langen Geschichte der Zahnmedizin.
Zahnschmerzen gibt es, solange es Menschen gibt. Jüngste wis-senscha�liche Funde lassen sogar vermuten, dass bereits Stein-zeitmenschen Karies hatten. Behandelt wurden Schmerzen und Zahnleiden allerdings durch die Jahrtausende hindurch sehr unterschiedlich. Lange Zeit blieb dabei die Ausbildung von Spe-zialisten, also echten Zahnärzten, die medizinisch und hand-werklich ausgebildet waren, eine Randerscheinung. Denn die Behandlung der allseits verbreiteten Karies oder von eitrigen Abszessen blieb Badern, Zahnbrechern, Barbieren oder ande-ren fahrenden Heilern überlassen. Auch Zahnersatz war von je her ein großes �ema, an dem durch die Jahrhunderte hinweg viel getü�elt wurde.
Goldenes Zeitalter für ZahnkünstlerEs gab zwar bereits im 18. Jahrhundert akademisch ausgebildete Zahnärzte, die aus der Humanmedizin hervorgegangen waren, aber es waren so wenige, dass sie kaum die brennenden Leiden der Bevölkerung, die von Zahnhygiene nichts wusste, mildern konnten. Zahnärzte hatten es zudem nicht leicht. Eine spezielle universitäre Ausbildung gab es lange Zeit nicht, und das geringe Ansehen der Zahnheilkunde als eigenständiges Studienfach an
den deutschen Universitäten sorgte noch bis ins 20. Jahrhundert für recht wenig praktizierende Zahnärzte.
Dann war 1869 das Jahr, das Tür und Tor für alle „Zahnprak-tiker“ ohne spezielle medizinische oder zahntechnische Aus-bildung ö�nete. Die sogenannte Kurierfreiheit wurde einge-führt, was so viel bedeutete wie: Jeder Laie, der sich dazu beru-fen fühlte, dur�e Patienten behandeln, wenn die das denn zulie-ßen. Neben den universitär ausgebildeten Zahnärzten entstand so eine zweite, sehr viel größere Berufsgruppe: Zahnkünstler, Zahnartisten, Zahntechniker, Gebissarbeiter oder eben Dentis-ten nannten sie sich. Vorschri�en zur Ausübung ihres Berufs gab es keine. Eine Approbation brauchten sie nicht, solange sie sich nicht als „Arzt“ bezeichneten.
Doch viele dieser Praktiker überzeugten durch ihr Können. Aus dem munteren Haufen an Bezeichnungen der Zahnheilkun-digen, die tatsächlich über ein großes handwerkliches Geschick verfügten, entstanden um 1900 herum der eigentliche Dentist und mit ihm der Ausbildungsberuf. Gerade in ländlichen Gegen-den und bei ärmeren Menschen standen die Dentisten hoch im Kurs. Denn studierte Zahnärzte gab es auf dem Land kaum, und leisten konnten ihn sich dann auch nur die Wohlhabenderen.
© iS
tock
/ th
inks
tock
phot
os.c
om

report 35
DFZ 2 · 2014
Image-P�ege durch QualitätDie Dentisten bemühten sich um – wie man das neudeutsch sagen würde – eine Qualitätso�ensive: Image-P�ege durch Können. Ab 1910 durften sie dann auf Kosten der damaligen Krankenkassen behandeln, was den Kassen sicherlich entgegenkam, weil Dentisten günstigere Preise veranschlagten als studierte Zahn-mediziner. Wobei die Preise im heutigen Licht ein wenig abenteuerlich anmuten. Fürs Zähneziehen gab es sogar Mengen-rabatt: Eine Reichsmark kostete der erste Zahn, jeder weitere 50 Pfennig, wie aus einer schleswig-holsteinischen Gebüh-renordnung von 1904 hervorgeht. Im Jahr 1920, nachdem es Zahnmedizinern möglich geworden war, in ihrem Fach zu promovieren, wurde die Dentistenausbil-dung dann auch staatlich anerkannt. Und die war keineswegs schmalspurig. Sechs Jahre dauerte die Lehrzeit insgesamt, die hauptsächlich bei einem praktizierenden Dentisten und ein Jahr lang in der Pro-thetik stattfand. Zwar blieb das medizi-nische Wissen in der zweijährigen Fach-schullehre etwas auf der Strecke, doch die praktische Ausbildung war vorbildlich. In Deutschland waren damals doppelt so viele Dentisten wie Zahnärzte tätig.
Doch im Laufe des 20. Jahrhunderts kristallisierten sich dann immer mehr zwei unterschiedliche Berufsbilder her-aus: das des akademischen Zahnarztes und das des handwerklich orientierten Zahntechnikers. Der Dentist war weder das eine noch das andere richtig. Die wis-senscha�liche Ausrichtung der Zahnheil-kunde, gekoppelt mit allgemeinmedizini-schen Kenntnissen, wurde immer stär-ker. Und so tat sich eine Klu� auf, in die der praktisch orientierte Zahnheilkun-dige �el.
Trennung zwischen Medizin und TechnikNach dem Zweiten Weltkrieg dauerte es dann nicht mehr lange, bis das Berufs-bild des Dentisten abgeschafft wurde. Die Trennung zwischen demjenigen, der Patienten behandelt und Diagnosen stellt, und demjenigen, der den Zahnersatz her-stellt, sollte endgültig zementiert und geklärt werden. Im Jahr 1952 wurden die 15.000 damals in Westdeutschland tätigen Dentisten in den zahnärztlichen Berufs-stand aufgenommen. Zuvor mussten sie einen 60-stündigen Crashkurs in den Fächern Mund- und Kieferkrankheiten, zahnärztliche Chirurgie und Arzneimit-
tellehre absolvieren. Nach dieser Fortbil-dung erhielten sie ihre Anerkennung als Zahnärzte – ohne weitere Prüfung. Für viele studierte Zahnärzte war dies ein A�ront, denn sie hatten sich durch die hohen Zulassungsanforderungen für ein Zahnmedizinstudium und mindestens sieben Semester Universität gequält. Um sich von den „Schmalspurmedizinern“, wie die ehemaligen Dentisten o� genannt wurden, abzugrenzen, promovierten vie-le Uni-Zahnärzte. Denn der Doktortitel war die letzte Bastion, um zu zeigen, wer die wahren Akademiker sind. Im Osten der Republik war der Wechsel vom Den-tisten zum Zahnarzt oder Stomatologen schon 1949 in ähnlicher Weise vollzogen worden. Ende 1953 hatte das kurze Inter-mezzo des deutschen Dentisten ein Ende gefunden. Nur noch studierten Zahnärz-ten war es nun erlaubt, Patienten zahn-medizinisch zu versorgen.
Der letzte Dentist arbeitete bis 1993Überall in Deutschland? Zumindest fast. Der schleswig-holsteinische Dentist Oskar Freudentheil ging sogar bis zum Bundesverfassungsgericht, um auch nach dem Stichtag weiterhin Patienten behan-deln zu dürfen. Er hatte als Angestellter lange bei seinem Vater, einem erfahre-nen Dentisten, in der Praxis gearbeitet, selbst aber weder die Dentistenprüfung abgelegt noch den notwendigen Lehrgang zum Zahnarzt absolviert. Als sein Vater starb, kam Freudentheil in die Bredouil-le. Doch er wollte weiterarbeiten. Sein Klientel waren hauptsächlich Bauern aus der Umgebung, die gern kamen. Er ging einige Umwege, die damals noch mög-lich waren, extrahierte Zähne kostenlos, rechnete Prothetik direkt mit den priva-ten Kassen ab, doch mit der Einführung der Landwirtscha�lichen Krankenkasse als P�ichtkasse stand er vor dem wirt-scha�lichen Aus. Er klagte und gelang-te ans Verfassungsgericht, das entschied: Wer vor 1952 die Zahnheilkunde ausge-übt hat, darf sie in bisherigem Umfang weiterausüben. In ganz Deutschland sollen es so etwa 300 Dentisten gewesen sein, die noch einige Jahre ihre Patien-ten behandelten, ohne eine zahnärztliche Aus- oder Fortbildung erhalten zu haben. Freudentheil schloss seine Praxis 1993. Seitdem ist der Beruf des Dentisten in Deutschland ausgestorben.
Sabine Schmittfreie Journalistin