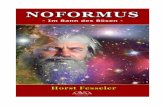Leseprobe BankArchiv - ÖBA - Heft 4 2012
-
Upload
linde-verlag-gmbh -
Category
Documents
-
view
253 -
download
10
description
Transcript of Leseprobe BankArchiv - ÖBA - Heft 4 2012

Aus dem Inhalt
Performance- vergleich fonds vs. flv„glückliche Banken“
Österreichs kreditinstitute im Jahr 2011
Öcgk fassung Jänner 2012aufklärungsPflicht
der Bank
April 201260. Jahrgang
Herausgegeben von der
ÖsterreicHiscHen bankwissenscHaftlicHen gesellscHaft
Zeitschrift für das gesamte
Bank- und Börsenwesen
BankVerlag

Sie
find
en s
ich
z.B
.in
fol
gend
er S
itua
tion
:
■Si
e fü
rcht
en, d
ass
Ihr b
osni
sche
r A
bneh
mer
die
gel
iefe
rte
Anla
ge
nich
t be
zahl
t.
■U
nsic
herh
eite
n im
ukr
aini
sche
n R
echt
ssys
tem
gef
ährd
en Ih
re D
irekt
inve
stiti
on.
■Si
e zö
gern
auf
grun
d vo
n po
litis
chen
Uns
iche
rhei
ten
ein
Ersa
tzte
illag
er in
Nig
eria
zu
erric
hten
.
■Ih
r Kun
de v
erla
ngt e
ine
Anz
ahlu
ngsg
aran
tie,
abe
r Ihr
Ava
lrah
men
bei
Ihre
r
Hau
sban
k is
t aus
gesc
höpf
t.
■Si
e m
öcht
en Ih
rem
Abn
ehm
er e
ine
güns
tige
, lan
gfri
stig
e Fi
nanz
ieru
ng a
nbie
ten.
■Si
e ha
ben
lauf
ende
For
deru
ngen
aus
zum
eist
kur
zfris
tig z
ahlb
aren
Ges
chäf
ten
mit
Abn
ehm
ern
in a
ller
Wel
t?
■U
nd S
ie w
olle
n di
ese
Ford
erun
gen
ganz
ein
fach
im P
aket
ver
sich
ern?
■Zu
r Fin
anzi
erun
g Ih
rer E
xpor
tfor
deru
ngen
und
Exp
orta
uftr
äge
brau
chen
Sie
eine
n gü
nsti
gen
Rahm
enkr
edit
.
■Si
e pl
anen
ein
e In
vest
ition
in A
lban
ien
mit
entw
ickl
ungs
polit
isch
pos
itiv
en
Aus
wir
kung
en. Z
usät
zlic
h be
nötig
t das
alb
anis
che
Unt
erne
hmen
ein
e la
ngfr
isti
ge
Fina
nzie
rung
, die
übe
r die
Mög
lichk
eite
n ei
ner K
omm
erzb
ank
hina
usge
ht.
http
://g
rupp
e.oe
kb.a
t
Uns
ere
Fina
nzse
rvic
es fü
r KM
U.
SCHUBA
Sie
find
en
das
pass
ende
Inst
itut
:
Oes
terr
eich
isch
e K
on
tro
llban
k A
G
Oes
terr
eich
isch
e E
ntw
ickl
ungs
ban
k A
G
ww
w.o
ekb.
at
ww
w.o
ekbv
ersi
cher
ung.
atw
ww
.pris
ma-
kred
it.co
m
ww
w.e
xpor
tfon
ds.a
t
ww
w.o
e-eb
.at
Sie
find
endi
e pa
ssen
den
Prod
ukte
:
■Bu
ndes
gara
ntie
■W
echs
elbü
rgsc
haft
■Ex
port
finan
zier
ungs
-
verf
ahre
n
■Pa
usch
alve
rsic
heru
ng
■Ra
hmen
vers
iche
rung
■Ei
nzel
vers
iche
rung
■Ex
port
fond
s-
Rahm
enkr
edit
■Kr
edit
➞ ➞ ➞ ➞
> OeKB-Anz_KMU_Bankarchiv_A4_210-297_10.2.2012_OeKB-Anz_KMU 10.02.12 18:32 Seite 1

Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen
Journal of Banking and financial researchbegründet von em. o. Univ-Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Krasensky
herausgegeben von Prof. (FH) Mag. Otto Lucius
60. Jahrgang april 2012
inhaltsverzeichnis
Berichte und analysen
„Glückliche Banken“: Ein Plädoyer für mehr Qualität in der Beratung – auch und vor allem im RetailsegmentMichael Gschwind _________________________________________________________ 201
Der Österreichische Corporate Governance Kodex in der Fassung Jänner 2012Richard Schenz / Michael Eberhartinger ________________________________________ 207
Österreichs Kreditinstitute im Jahr 2011Nikolaus Böck / Wolfgang Fleischhacker / Lukas Simhandl __________________________ 211
aBhandlungen
Vergleichende Analyse von Fondsdirektinvestments mit fondsgebundenen LebensversicherungenAndrea Ruth Gauper / Roland Mestel / Stefan Palan ________________________________ 218
Zur Aufklärungspflicht der Bank bei Einschaltung eines weiteren Finanzdienst- leisters – Gleichzeitig ein Beitrag zur Auslegung des § 27 WAG 2007 Georg Graf ________________________________________________________________ 229
Neues in KürzeSylvia Stock ________________________________________________________________ 199
rechtsprechung des Ogh
1796. Zu Treasury-Geschäften eines Sozialversicherungsträgers.OGH 24. 10. 2011, 8 Ob 11/11t (mit Anm von A. Vonkilch) _________________________ 2411797. Wiederholungsgefahr nach § 28 KSchG bei Finanzierungsleasing-AGB.OGH 12. 10. 2011, 7 Ob 68/11t (mit Anm von H. Koziol) ___________________________ 2491798. Zur Haftung für mangelhafte Anlageberatung.OGH 29. 9. 2010, 7 Ob 106/10d _______________________________________________ 2521799. Zur „Teilanfechtung“ der Einverleibung eines Belastungs- und Veräußerungsverbots.OGH 8. 11. 2011, 3 Ob 181/11f ________________________________________________ 2551800. Zum Ersatz der Kosten für die Bewerbung der zu versteigernden Liegenschaft.OGH 12. 4. 2011, 4 Ob 53/11i _________________________________________________ 2571801. Zum Rücktrittsrecht nach § 5 KMG.OGH 8. 11. 2011, 3 Ob 195/11i ________________________________________________ 258
Relevanz und Ranking: Der feine UnterschiedClaus Raidl _________________________________________________________________ 197
Panta Rhei – Veränderung und Bewahrung: Verlagswechsel beim BankArchivOtto Lucius _________________________________________________________________ 195

In diesem Heft inserieren: BankVerlagWien, S. 196; BAWAG, U3; OeKB, U2; RZB, S. 227; LindeVerlagWien, S. 198, S. 228.
Die Inhalte des Österreichischen BankArchivs sind in folgenden Fachdatenbanken verfügbar: LexisNexis® Online – www.lexisnexis.at (Beiträge und Rsp als Volltext ab 2002); RDB Rechtsdatenbank – www.rdb.at (Beiträge und Rsp als Volltext ab 2003); RIDA Rechts-Index-Datenbank – www.rida.at (Beiträge und Rsp als Volltext ab 2003).
vOrschau heft 5/2012
Monika Rosen:Die internationalen Aktienmärkte im 1. Quartal 2012Manfred Moschner:Österreichs M&A-Markt 2011Friedrich Thießen:Staatsmoratorien als ökonomisches oder politisches Problem? – Historische Erfahrungen mit StaatsschuldenGeorg Weissel:Zur Anwendung von § 7 VKrG
WeiterBildung ___________________________________________________________ 264
erkenntnisse des vfgh31. Stabilitätsabgabe für Banken ist verfassungskonform.VfGH 14. 12. 2011, B 886/11 (mit Anm von K. Stöger) ____________________________ 259
impressum
Das Bank-Archiv ist eine unabhängige Fachzeitschrift für das gesamte Geld-, Bank- und Börsewesen mit dem Ziel der Veröffentlichung einschlägiger Informationen für Wissenschaft und Praxis. Es wurde 1953 von o. Univ.-Prof. Dr. h.c. Dr. Hans Krasensky als Österreichisches Bank-Archiv begründet und wird seit 1988 als Bank-Archiv geführt (Zitierweise ÖBA). Für den Inhalt der einzelnen Beiträge tragen ausschließlich die Autoren die wissenschaftliche Verantwortung. Das Bank-Archiv veröffentlicht ausschließlich Originalmanuskripte. Manuskripte sind an die Redaktion, Eßlingg. 17/5, A 1010 Wien, zu senden. Die Autoren verpflichten sich mit der Einsendung der Manuskripte, diese bis zur Entscheidung über die Annahme nicht anderweitig zur Veröffentlichung anzubieten. Für unaufgefordert eingereichte Manuskripte wird keine Gewähr übernommen. Für die Manuskriptrichtlinien siehe http://www.bwg.at > Publikationen > ÖBA > Autoren-Richtlinien – Als Abhandlungen gekennzeichnete Beiträge unterliegen ausnahmslos international üblichen Double-Blind-Review-Verfahren.Eigentümer und Herausgeber: Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft, Eßlinggasse 17/5, A 1010 Wien, Tel.: +431 / 533 50 50, Fax: +431 / 533 50 50 33, e-mail: [email protected] – Herausgeber: Prof. (FH) Mag. Otto Lucius – Mitherausgeber: Univ.-Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch; RA Univ.-Prof. Dr. Raimund Bollenberger; Univ.-Prof. Dr. Peter Bydlinski; ao. Univ.-Prof. Dr. Markus Dellinger; Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss; Univ.-Prof. Dr. Stefan Pichler; Univ.-Prof. Dr. Peter Steiner; Univ.-Prof. Dr. Helmut Uhlir – Herausgeberbeirat: Univ.-Prof. Dr. Matthias Bank, CFA; Hofrätin des OGH Dr. Wilma Dehn; Präsidentin des OGH i.R. Hon.-Prof. Dr. Irmgard Griss; Dir. Univ.-Prof. Dr. Andreas Grünbichler; o. Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. Helmut Koziol; Univ.-Prof. Dr. Brigitta Lurger; Univ.-Prof. Dr. Stephan Paul; Univ.-Prof. Dr. Karl Stöger.Verleger: LINDE VERLAG WIEN Ges.m.b.H., Scheydgasse 24, A-1210 Wien, Tel.: +431 24 630 Serie / BankVerlagWien, Eßlinggasse 17/5, A-1010 Wien. Tel.: +431 533 50 50 – Herstellung: Satz: Dipl.-HTL-Ing. Franz König, Niederreiterberggasse 13/2/1, A-1230 Wien, Tel.: 01/887 22 71; Druck: novographic Druck GmbH., Walter-Jurmann-Gasse 9, A-1230 Wien, Tel.: 01/888 26 73.Bestellinformation: ISSN 1015-1516. Erscheinungsweise: monatlich. Bestellungen nehmen jede Buchhandlung oder der Linde Verlag entgegen. Jahresabonnement 2012: € 170,50 inkl. 10% Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten. Unterbleibt die Abbestellung, so läuft das Abonnement automatisch zu den jeweils gültigen Konditionen auf ein Jahr weiter. Abbestellungen sind nur zum Ende eines Jahrganges möglich und müssen bis jeweils spätestens 30. November schriftlich erfolgen. Der Bezugspreis ist im Voraus zahlbar. Anzeigenaufträge werden vom Linde Verlag, Fr. Hladik, Tel.: +431 24 630-19, E-Mail: [email protected], entgegengenommen.Urheberrechte: Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe insbesondere durch Vortrag, Funk- und Fernsehsendungen, im Magnettonverfahren oder auf elektronischem, digitalem oder ähnlichem Wege bleiben vorbehalten. Für den Fall der Annahme und Veröffentlichung des eingereichten Manuskriptes geht das zeitlich und räumlich unbeschränkte, ausschließliche Werknutzungsrecht für alle Sprachen vom Autor/von den Autoren an den Verlag über. Dies gilt insbesondere für das Recht auf Vervielfältigung in allen technischen Verfahren, der Verbreitung, öffentlichen Wiedergabe und Verwertung in jedweder, auch elektronischer Form. Letztere schließt insbesondere das Recht der Speicherung in Datenbanken, der Vervielfältigung auf Speichermedien aller Art, der Ausgabe aus Datenbanken in allen Formen einschließlich der Sendung sowie der Verbreitung von Vervielfältigungsstücken an die Benutzer von Datenbanken ein. Die Einreichung des Manuskriptes gilt als diesbezügliche Erklärung des Einverständnisses zur Einräumung sämtlicher Rechte durch den Autor/die Autoren. Bei Beiträgen von Arbeitsgruppen wird vorausgesetzt, dass die Publikation von allen beteiligten Autoren genehmigt wurde und dass alle mit der Einräumung sämtlicher Rechte an den Verlag einverstanden sind.Mit dem für Artikel und druckfertige Entscheidungen an den/die Verfasser zu vom Eigentümer und Herausgeber festgesetzten Sätzen geleisteten Honorar ist die Übertragung sämtlicher Rechte abgegolten. Zugleich erlischt damit die Ausschließlichkeit des eingeräumten Verlagsrechts nicht mit Ablauf des dem Jahr des Erscheinens des Beitrags folgenden Kalenderjahres. Dieser Zeitraum gilt keinesfalls für die Verwertung durch Datenbanken.Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Verlages, des Herausgebers oder der Autoren ausgeschlossen ist. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Waren- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benützt werden dürften.

AbhAndlungen Banken & klimawandel
Liebe Leserinnen und Leser!
Üblicherweise ist es ja der Mai, der alles neu machen soll. In unserer schnellebigen Zeit genügt bereits der Jänner bzw. dann der März. Wenn Sie sich fragen sollten, was sich hin-ter dieser kryptischen Anmerkung verbirgt, die Lösung ist einfach: Das ÖBA hat einen neuen Verlagspartner.
Seit 60 Jahren besteht nun unser ÖBA, wie es liebevoll genannt wird. Seit 60 Jahren bemühen wir uns, aktuelle und inhaltlich hochstehende Information für unsere Leserschaft zu produzieren. Wir haben uns in all den Jahren bemüht, Bewährtes zu bewahren und doch ansprechend auf-zubereiten. Allein die Tatsache, dass das ÖBA nicht nur existiert, sondern auch floriert, ist Beleg dafür, dass dies dem Herausgeberteam und allen Autorinnen und Autoren auch ge-lungen ist. Dafür möchte ich als Herausgeber, stellvertretend für alle Leserinnen und Leser, herzlich Dank sagen.
60 Jahre sind eine lange Zeitspan-ne, in der es unweigerlich zu Verände-rungen kommt. Seit 10 Jahren wurden wir von Springer Österreich betreut. Der Springer-Konzern hat allerdings recht kurzfristig entschieden, dass das deutschsprachige rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Pro-gramm in der strategischen Ausrich-tung nicht zu den Kernkompetenzen des Konzerns gehört. Folgerichtig wurde das Österreich-Programm per 1.1.2012 verkauft, und zwar an den Verlag Österreich – vorbehaltlich
der kartellrechtlichen Genehmigung. Mit 18. Jänner 2012 ist die Bank-wissenschaftliche Gesellschaft als Eigentümer und Herausgeber davon unterrichtet worden.
Als Geschäftsführer der BWG und Herausgeber des ÖBA bin ich für ein Periodikum verantwortlich, dass pünktlich jeden Monat erschei-nen muss. Nachdem wir wegen ei-ner künftigen Zusammenarbeit nicht weiter kontaktiert worden sind, hat die BWG Verhandlungen mit meh-reren Verlagen in Österreich geführt und sich sehr rasch für den Linde Verlag entschieden. Diese neue Zu-sammenarbeit erstreckt sich auch auf das Buchprogramm des BankVerlag Wien.
Naturgemäß waren weder Springer noch Verlag Österreich von dieser Entscheidung sehr angetan, es konnte aber mit Springer letztlich eine kon-sensuale Lösung gefunden werden. Das Heft 4 des ÖBA, also das Heft, welches Sie jetzt, leider mit kleiner Verspätung, in Händen halten, ist bereits bei Linde erschienen. Alle zuvor ausgesendeten gedruckten Bro-schüren und sonstigen Informationen, die anders lauten, entbehren jeder Grundlage.
Wir sind sicher, mit Linde einen verlässlichen Partner für die Zukunft gefunden zu haben und freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit zum Wohle unserer Leserinnen und Leser! ◆
anta Rhei – Veränderung und BewahrungVerlagswechsel beim BankArchiv
P
EditorialPh
oto:
Pho
tost
udio
Hug
er
Prof. (FH) Mag. Otto Lucius ist Geschäftsführer der Österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft und Heraus-geber des Österreichischen BankArchivs;
e-mail: [email protected]
ÖBA 4/12 195

In jeder Buchhandlung – oder direkt beim Verlag: SpringerWienNewYork, A-1201 Wien, P.O. Box 89,
T: +43 1 330 24 15-0, F: +43 1 330 24 26, E: [email protected]
Bernhard Raschauer (Hrsg.)
Aktuelles Bankaufsichtsrecht
Die Umsetzung von „Basel III“ wirft ihre Schatten voraus. Die Lage des österreichischen Bankauf-sichtsrechts und die vorhersehbaren Änderungen rechtfertigen eine Zwischenbilanz. Der vorlie-gende Band vereint die Vorträge, die von Spitzen- juristen aus FMA, Banken und Vereinigungen am 27. September 2011 zu dieser Thematik im Rahmen eines wissenschaftlichen Symposiums an der Universität Wien gehalten wurden.Bernhard Raschauer (Hrsg.)
Aktuelles Bankaufsichtsrecht
Wien, April 2012
168 Seiten, € 48,--
ISBN 978-3-85136-099-8
Aktuelles BankaufsichtsrechtBernhard Raschauer (Hrsg.)
Die Umsetzung von „Basel III“ wirft ihre Schatten voraus. Die Lage des österreichischen Bankaufsichtsrechts und die vorhersehbaren Änderun-gen rechtfertigen eine Zwischenbilanz. Der vorliegende Band vereint die Vorträge, die von Spitzenjuristen aus FMA, Banken und Vereinigungen am 27. September 2011 zu dieser Thematik im Rahmen eines wissen-schaftlichen Symposiums an der Universität Wien gehalten wurden.
ISBN 978-3-85136-099-8
Akt
uell
es B
anka
ufsi
chts
rech
t
Bernhard Raschauer (Hrsg.)
Aktuelles Bankaufsichtsrecht
BankVerlag
Der Herausgeber, o. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Raschauer, leitet die Abteilung Öffentliches Wirtschaftsrecht am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien.
Preis: € (A) 48,–
www.bankverlagwien.at
Bankrecht
Der Herausgeber, o Univ.-Prof. Dr. Bernhard Raschauer, leitet die Abteilung Öffentliches Wirtschaftsrecht am Institut für Staats- und Ver-waltungsrecht der Universität Wien
BankVerlag

GastbeitraG AbhAndlungen banken & klimawandel
ÖBA 4/12 197
An negativen Nachrichten herrscht kein Mangel. Permanent wird die eine oder andere Krise beschworen, werden ganze Länder in den Abgrund geschrie-ben oder es wird das nahende Ende wenn schon nicht der Welt, dann zumindest der europäischen Währung prophezeit.
In seiner jüngsten Analyse [1] befasst sich BrandEins-Autor Wolf Lotter mit dem allerorts zu beobachtenden Phäno-men, dass Menschen sich heutzutage auf die Erzeugung von Wichtigkeiten verlegt und damit einer Ranking-Kultur unter-worfen haben. Etwas abhandengekom-men ist darüber allerdings die Antwort auf die Frage: wichtig für wen? Benchmarks haben zwar den Vorteil, dass sie Kom-plexität reduzieren. Doch die negative Kehrseite ist, dass der Vergleich von den eigenen Zielen und Prioritäten ablenkt. Das ist der feine Unterschied zwischen Relevanz und Ranking-Kultur.
Auch in der Beurteilung der wirtschaft-lichen Situation Österreichs werden die Schlagzeilen von den Einschätzungen der Rating-Agenturen Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch dominiert. Wohl und Wehe der Nation wird ausschließlich danach bewertet, ob Österreich sein Triple-A-Ranking behält oder verliert. Jetzt haben die Ratings dieser Agentu-ren durchaus greifbare Auswirkungen, etwa auf die Finanzierungskosten eines Staates. Doch um Österreich in seiner Gesamtheit als Wirtschaftsstandort zu beurteilen, reichen diese Rankings nicht aus. Sie repräsentieren nur einen Teil der Wirklichkeit bzw. oft nicht einmal die Realität, sondern eine Erwartungshaltung der jeweiligen Analysten.
Negativen Grundtenor übertönenIn diesem Kanon aus Krisengeschrei
und Katastrophenmeldungen fehlt es an positiven Nachrichten aus und über Österreich. Um hörbar zu werden, be-darf es hier koordinierter und konzer-tierter Bemühungen – anders ist der negative Grundtenor kaum zu übertönen. Aus diesem Grund wurde die Initiative „21st Austria“ von 17 österreichischen Unternehmen gemeinsam mit der Wie-ner Börse und der Oesterreichischen Nationalbank im Spätherbst 2011 ins Leben gerufen. Die Mitglieder dieser pri-vatwirtschaftlich organisierten Initiative verbindet ein gemeinsames Anliegen: die (positive) Wahrnehmung Österreichs als Wirtschaftsstandort zu stärken und einen kontinuierlichen Dialog mit Mei-nungsbildnern im Ausland zu etablie-
ren, um verzerrten Wahrnehmungen und Klischees entgegenzuwirken.
Kritische Geister könnten nun sagen, dass es genügend Institutionen gäbe, die genau dies zur Aufgabe hätten, wie etwa die Wirtschaftskammer oder Aus-tria Business Agency. Die Initiative „21st Austria“ versteht sich aber explizit nicht als Gegenangebot zu den Bemü-hungen dieser Institutionen, sondern als Ergänzung auf Unternehmensseite – eben um die Wahrnehmung eines differen-zierten Österreich-Bildes zu erleichtern. Darüber hinaus erhebt „21st Austria“ auch nicht den Anspruch, Österreich und die Welt abzudecken, sondern fokussiert derzeit die Bemühungen auf den US-amerikanischen und den britischen Markt.
Relevante FaktenAuch wenn man es selten hört, gibt es
über Österreich viel Positives zu erzählen. Als fünftreichstes Land der Europäischen Union (Kaufkraftstandard gemessen am BIP pro Kopf) spielt Österreich in der Oberliga der EU-Mitgliedstaaten. Nicht nur in Sachen Wohlstand, auch beim BIP-Wachstum liegt Österreich in den vergangenen zehn Jahren in schöner Regelmäßigkeit deutlich besser als der Durchschnitt der 17 Euro-Länder. Mit einer Arbeitslosenrate von nur 4% belegt Österreich Platz 1 innerhalb der EU – der EU-Durchschnitt liegt bei etwas über 9% und damit mehr als doppelt so hoch. Gerade in etwas turbulenteren Zeiten wie diesen sind solche solide Fundamental-daten alles andere als selbstverständlich.
Heimische Politiker und Wirtschafts-treibende haben völlig zu Recht in den vergangenen Jahren Österreichs besonde-re Rolle als Brückenkopf nach Osteuropa herausgestrichen. Was allerdings zu wenig kommuniziert wurde, ist, dass sich Öster-reichs Rolle gewandelt hat – sie ist größer geworden. Österreichische Unternehmen haben sich durch ihr starkes Engagement im Osten zu „transformation agents“ entwickelt, die wesentlich zur Europäi-sierung dieser Länder beitragen und hel-fen, Wirtschaftsstrukturen zu etablieren, die europäischen Standards entsprechen. Dies gilt für den Bankensektor ebenso wie etwa für den Bereich eGovernment. Auch
elevanz und Ranking: Der feine UnterschiedR
GastbeitragPh
oto:
priv
at
Dr. Claus Raidl, Präsident der Oesterreichischen Nationalbank und Sprecher der Initiative „21st Austria“, plädiert für einen verstärk-ten Fokus auf positive Nachrichten über Österreich – im eigenen Interesse von österreichischen Unter-nehmen.
[1] BrandEins, „Entscheiden, was wichtig ist“, Ausgabe März 2012

GastbeitraG
198 ÖBA 4/12
zahlreiche Weltmarktführer, die allerdings häufig nicht die allgemeine Bekanntheit genießen, die ihnen gebühren würde.
Ziele statt Probleme
Früher einigte man sich auf Ziele. Heu-te muss man schon dankbar sein, wenn wir uns auf ein Problem geeinigt haben. Im eigenen Interesse sollten wir diese Prioritätensetzung wieder umkehren. Als durch und durch globalisiertes Land im Sinne der wirtschaftlichen Verflechtung mit der Welt muss es unser Ziel sein, dass Österreich im Ausland eine hohe Reputation genießt. Dafür ist es notwen-dig, positive Fakten über unser Land zu vermitteln und so an einer differenzier-teren Imagebildung – über Mozartkugeln hinaus – beizutragen. Das bedeutet konti-nuierliche Überzeugungsarbeit, durchaus vergleichbar mit dem „Bohren harter Bretter“. Auch etwas „Leidenschaft und Augenmaß“, so wie die ursprüngliche Empfehlung von Max Weber lautete, wird es dazu brauchen. Die Initiative „21st Austria“ steht allen österreichischen Unternehmen offen – Mitkämpfer und Multiplikatoren sind herzlich willkom-men. ◆
demographische Herausforderungen wie Überalterung zu bewältigen sein werden, Urbanisierung und Mobilität der Men-schen zunehmen und das Internet sowie die weltweite Vernetzung gravierende Einflüsse auf Arbeitswelt und Konsum-verhalten haben werden.
Megatrends eignen sich exzellent dazu, die Zukunftsfähigkeit eines Wirtschafts-standortes zu überprüfen: Produzieren wir die Güter und Dienstleistungen, die in Zukunft gefragt sein werden? Haben wir die richtig ausgebildeten Fachkräfte? Haben unsere Unternehmen genug Inno-vationskraft?
Die Antwort für Österreich – gerade auch in Hinblick auf die oben erwähnten Megatrends – lautet ganz eindeutig: ja.
Österreichische Unternehmen sind prädestiniert dazu, den Bedarf zu befriedigen, der durch Megatrends ent-steht, wie dies – in dieser Dichte und Viel-falt – wohl kaum in einem anderen Land zu finden ist. Von der Nutzung alternativer Energieressourcen über Medizin-Tech-nologie bis zu intelligenten Verkehrssy-stemen und innovativen HiTech-Entwick-lungen stellen Österreichs Unternehmen schon jetzt in ihren jeweiligen Branchen
der regionale Einfluss geht inzwischen deutlich über Osteuropa hinaus und um-fasst mittlerweile auch Südosteuropa und reicht Richtung Osten über die Ukraine und die Türkei bis nach Russland.
Die enge Verflechtung österreichischer Unternehmen mit dieser „erweiterten“ Region birgt nach wie vor enormes Potential: Mit einer Bevölkerung von insgesamt 420 Millionen Menschen, die mehrheitlich einen westeuropäischen Lebensstandard anstreben, bietet dieser Markt überdurchschnittliche und lang-fristige Wachstumschancen. Das spiegelt sich auch in der Prognose der Oesterrei-chischen Nationalbank für diese Region mit einem kumulierten Wachstum von 20% bis 2016 wider – das damit deutlich höher liegt als die Vergleichsdaten für die USA (15%) und die Euro-Zone (8%).
Relevanz für die Zukunft
Es bedarf keiner hellseherischen Qua-litäten, um einige der großen globalen Entwicklungen und ihre Auswirkungen vorherzusehen. Sämtliche Zukunftsfor-scher sind sich darin einig, dass Ressour-cen knapper werden, die Weltbevölke-rung nicht nur wächst, sondern auch
Der Schutzbrief für Aufsichtsräte
www.lindeverlag.at
■ Frühzeitige Information■ Relevante Judikatur■ Diskussion und Experten-Analyse■ 6x jährlich
Jahresabonnement 2012 EUR 121,–(exkl. MwSt. und Versandspesen)

ÖBA 4/12 199
Regierungsvorlage zum Stabilitäts-gesetz 2012
Am 6.3.2012 passierte die Regierungs-vorlage zum Stabilitätsgesetz 2012 den Ministerrat und wurde der parlamentari-schen Behandlung zugewiesen. Mit dem Stabilitätsgesetz soll unter anderem das Stabilitätsabgabegesetz novelliert wer-den, das Kreditinstitute seit 1.1.2011 zu einer Stabilitätsabgabe („Bankensteuer“) verpflichtet. Die Gesamtlast setzt sich zu-sammen aus einem bilanzsummenabhän-gigen Teil sowie einer Stabilitätsabgabe auf Derivate, deren Höhe sich nach dem Geschäftsvolumen aller Derivate im Han-delsbuch bemisst. Gemäß Regierungs-vorlage soll die Abgabe in den Jahren 2012 bis 2017 noch um einen 25%-igen Sonderbeitrag erhöht werden. Das Stabili-tätsgesetz 2012 tritt mit 1.4.2012 in Kraft.
Quelle:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01680/fname_245673.pdf
FMA veröffentlicht Bandbreiten für marktübliche Entgelte und Gebühren von Wertpapierunternehmen, Emitten-ten sowie Depotbanken
Am 13.2.2012 veröffentlichte die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) gemäß § 75 Abs 8 WAG 2007 die Bandbreiten für marktübliche Entgelte und Gebühren von Wertpapierunterneh-men, Emittenten sowie Depotbanken.
Seit der ersten Erhebung im Jahr 2010 wurden lediglich die Bandbreiten der Beratungshonorare (0,5 bis 1,5% des ver-anlagten Vermögens per anno) sowie der erfolgsabhängigen Vergütungen (10 bis 25% des Erfolges per anno) geringfügig vergrößert. Neben Beratungshonoraren und erfolgsabhängigen Vergütungen pub-liziert die FMA auch die Marktüblichkeit von Entgelten wie Managementgebühren, Ausgabeaufschlägen, Innenspesen, De-potgebühren, etc.
Die Veröffentlichung der Bandbrei-ten für marktübliche Entgelte soll als Orientierungshilfe für Kunden bei der Inanspruchnahme der Wertpapierdienst-leitungen dienen. Die Anbieter müssen ihre Kunden auf die Veröffentlichung der
Neues in Kürze – Aufsichtsrecht und Risikomanagement
Sylvia Stock
national
international
FMA hinweisen, jedoch können sie davon abweichende Entgelte verrechnen.
Die Datengrundlage für die Ver- öffentlichungen der FMA ist von der gesetzlichen Interessensvertretung der Finanzdienstleister (Fachverband Finanz-dienstleister der Wirtschaftskammer Österreich) regelmäßig zu erheben.
Quelle:
http://www.fma.gv.at/de/ueber-die-fma/pres-se/pressemitteilungen/pressemitteilungen-detail/article/fma-veroeffentlicht-marktuebli-che-entgelte-und-gebuehren-von-wertpapier-unternehmen-emittenten-sowie.html
delländerungen und soll die Institute bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung eigener Risikomodelle durch möglichst transparente und effiziente Verfahren und klare Kommunikation zwischen Institut und Aufsicht unterstützen.
Quelle:
http://www.bafin.de/cln_117/nn_721290/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Merkbla-etter/mb__120131__modellaenderung__ama,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/mb_120131_modellaenderung_ama.pdf
Europäische Kommission veröf-fentlicht Richtlinienentwurf für das Wertpapier-Settlement
Die Europäische Kommission ver-öffentlichte am 7.3.2012 einen Entwurf für eine Richtlinie für das Settlement von Wertpapiertransaktionen. Mit diesem Richtlinienentwurf will die Kommission ihre Regulierungsbestrebungen im Be-reich Wertpapier-Infrastruktur vervoll-ständigen. Bis dato wurden in diesem Bereich mit MiFID II (betrifft ua Han-delsplattformen) und EMIR (betrifft das Clearing) zwei Initiativen gesetzt. Die neue Richtlinie soll sich vorwiegend an sogenannte Zentralverwahrer (CSDs) richten, enthält aber auch Regeln für Marktteilnehmer.
Wesentliche Inhalte des Richtlinienent-wurfs sind:
– Harmonisierte Settlementperiode von maximal 2 Tagen.
– Strafbestimmungen für die Nichtliefe-rung von Wertpapieren.
– Verpflichtende Dematerialisierung von Wertpapieren (dh Verwahrung und Übertrag von Wertpapieren durch Bucheintrag).
– Vorschriften für Organisation, Ge-schäftstätigkeit und und Aufsicht über Zentralverwahrer.
– Passporting für Zentralverwahrer.
Quelle:
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/COM_2012_73_en.pdf
BaFin und die Deutsche Bundesbank veröffentlichen ein Merkblatt zu Ände-rungen beim Advanced Measurement Approach (AMA)
Die Bundesanstalt für Finanzdienst-leistungsaufsicht und die Deutsche Bun-desbank haben am 31.1.2012 ein Merk-blatt zu Änderungen von Modellen bei Fortgeschrittenen Messansätzen (Advan-ced Measurement Approach – AMA) für das operationelle Risiko veröffentlicht.
Die Solvabilitätsverordnung (SolvV) ermöglicht Kreditinstituten nach der Zu-lassung durch die BaFin, eigene Risi-komodelle (AMA) zur Bestimmung der regulatorischen Eigenmittel für das ope-rationelle Risiko (OpRisk) zu verwenden. Dementsprechend sind bestimmte Anfor-derungen an das Risikomanagementsy-stem und an das quantitative Modell zu erfüllen. Um die jeweilige Risikostruktur möglichst klar zu erfassen, soll das eigene Risikomodell laufend an die Spezifika eines Instituts und sich verändernden Rah-menbedingungen anpasst werden. Dies gilt auch für jene Tochterunternehmen im Ausland, für die Kapital aus dem AMA allokiert wird.
Die Institute sind nach der SolvV verpflichtet, den fortgeschrittenen Mess-ansatz zu überprüfen und falls notwen-dig, anzupassen. Wesentliche Änderungen eines AMA sind mit der BaFin abzu-stimmen.
Das veröffentlichte Merkblatt be-schreibt Prinzipien für den Umgang mit wesentlichen und nicht wesentlichen Mo-

Neues iN Kürze
200 ÖBA 4/12
Antworten stellvertretend für EBA und EIOPA zentral.
Quellen:
ht tp : / /www.esma.europa.eu/sys tem/files/2012-95.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_dp_2012_01.pdf
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/abou-tus/News%20and%20Communications/EBA-DP-2012-01--Draft-discussion-paper-on-RTS-on-Article-12-3-EMIR-.pdf
Diese Rubrik bietet Ihnen einen Über-blick über wesentliche regulatorische Entwicklungen. Nähere Details und weit-ere Ausführungen finden Sie unter www.fsi-espresso.com.
Frau Mag. Sylvia Stock ist Head of Regulatory Advisory bei der Deloitte Financial Advisory GmbH; e-mail: [email protected]
Erste aggregierte Einschätzung der Kapitalpläne der Banken durch EBA
Die European Banking Authority (EBA) veröffentlichte ursprünglich am 8.12.2011 eine Empfehlung zur Stär-kung der Kapitalausstattung von Banken durch außerordentliche Kapitalpuffer. Finanzinstitute sollten dadurch gegen Wertminderungen staatlicher Schuldtitel abgesichert werden. Die Empfehlungen der EBA basieren auf einem europaweiten Bankenstresstest, in dessen Rahmen bei 65 Großbanken ein Shortfall von insge-samt 114,7 Milliarden ermittelt wurde, knapp 4 Milliarden davon bei heimischen Banken. Die betroffenen Institute hatten bis zum 20.1.2012 den jeweiligen natio-nalen Aufsichtsbehörden Rekapitalisie-rungspläne zu übermitteln. Am 9.2.2012 präsentierte die EBA schließlich ihre erste Einschätzung zu diesen Plänen.
Die zusätzlichen Kapitalerfordernisse iHv 114,7 Milliarden, die im Rahmen des Stresstests 2011 erhoben wurden, ergeben sich aus der Differenz des vorhandenen Kernkapitalvolumens (Kapital höchster Qualität; es handelt sich um eine eigene Definition, die als Mischung aus den Basel-II- und Basel-III-Kapitaldefini-tionen betrachtet werden kann) und dem Volumen zur Erreichung der ab Ende Juni 2012 zu erfüllenden 9%-Kernkapitalquo-te. Laut EBA wurden die Marktpreise vom 30.9.2011 zugrundegelegt. In Österreich waren laut Bericht vom 8.12.2011 Kapi-talunterdeckungen für die Erste Group Bank AG, die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG und die Österreichische Volksbank AG festgestellt worden. Eine detaillierte Auflistung der einzelnen Institute findet man auf der EBA-Home-page.
Im Rahmen der nun vorliegenden Vorabanalyse vom 9.2.2012 stellte die EBA fest, dass mit Hilfe der in den Rekapitalisierungsplänen beschriebenen Maßnahmen bei aggregierter Betrachtung die Kapitalfehlbeträge gedeckt werden könnten. Darüber hinaus könnte in Sum-me ein Puffer von etwa 26% aufgebaut werden. Die Kapitalpläne der Banken beinhalten vorwiegend direkte Kapital-maßnahmen (77%), insbesondere in Form von neuem Kapital (ua durch zusätz-liche Kapitalaufnahme und Bildung von Gewinnrücklagen aus 2011), Wandlung von Hybridkapital zu Tier 1-Kapital und geplanten Gewinnrücklagen des Jahres 2012. Zusätzlich werden Maßnahmen zur Beeinflussung der risikogewichteten Aktiva gesetzt.
Gegenwärtig werden die Rekapita-lisierungspläne von der EBA, den „col-leges of supervisors“ und den nationalen Aufsichtsbehörden einer detaillierten Analyse unterzogen. Dabei sollen die Glaubwürdigkeit der Pläne in Bezug auf die Prognosen von Gewinnrücklagen, die
Effektivität des Genehmigungsprozesses für neue fortgeschrittene Modelle zur Schätzung der risikogewichteten Aktiva und die Zuverlässigkeit der Annahmen, die dem geplanten Verkauf von Assets zugrundeliegen, untersucht werden.
Voraussichtlich im März 2012 erhalten die Banken von den nationalen Aufsichts-behörden klare Anweisungen bezüglich ihrer Kapitalpläne.
Quellen:
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/abou-tus/News%20and%20Communications/Over-view-of-the-Capital-Plans-following-the-EBA-Recommendation.pdf
http://stress-test.eba.europa.eu/capitalexer-cise/EBA%20BS%202011%20173%20Re-commendation%20FINAL.pdf
ESMA veröffentlicht zwei Dis- kussionspapiere zu EMIR
Die ESMA hat am 16.2. sowie am 6.3.2012 jeweils ein Diskussionspapier iZm der „European Market Infrastruc-ture Regulation“ (EMIR) veröffentlicht. Im Rahmen der Verordnung will die EU den Handel mit OTC-Derivaten strenger regulieren und dadurch Marktstabilität und Transparenz beim Derivatehandel verbessern. In diesem Zusammenhang ist es Aufgabe der europäischen Aufsichtsbe-hörden ESMA, EBA und EIOPA, techni-sche Durchführungs- und Regulierungs-maßnahmen für eine Reihe von Themen zu entwerfen, die in den gegenständlichen Papieren diskutiert werden. Ein entspre-chendes gemeinsames Konsultations-papier soll im Sommer 2012 erscheinen.
Grundsätzlich sieht EMIR vor, dass das Clearing von OTC-Derivaten zukünftig durch zentrale Gegenparteien zu erfolgen hat. Das Diskussionspapier vom 6.3., das von den drei Aufsichtsbehörden EBA, EIOPA und ESMA gemeinsam verfasst wurde, widmet sich insbesondere jenen Situationen, in denen die Voraussetzun-gen für zentrales Clearing nicht gegeben sind. Die betroffenen Kontrakte sollen speziellen Regeln zur Risikominimierung unterliegen. In den technischen Regulie-rungsstandards werden bspw Vorschriften zu Kapitalreserven und Sicherheiten ent-halten sein.
Unabhängig von den beiden erwähnten Diskussionspapieren hat die EBA am 6.3.2012 ein Konsultationspapier iZm EMIR veröffentlicht, das Vorschläge für Eigenkapitalanforderungen von zentralen Gegenparteien enthält.
Stellungnahmen zu allen drei Publi-kationen werden bis zum 2.4.2012 entge-gengenommen. Die ESMA sammelt die

Berichte und AnAlysen „Glückliche Banken“
ÖBA 4/12 201
lückliche Banken“:Ein Plädoyer für mehr Qualität in der Beratung – auch und vor allem im Retailsegment
Michael Gschwind
Private Banking und Retail Banking sind immer noch zwei verschiedene Welten. Darf sich der vermögende Privatkunde über eine fundierte Finanzberatung und persönliche Betreuung freuen, wird der Re-tailkunde mit Standardprodukten bedient, die kaum seinen Bedürf-nissen entsprechen. Die Folge sind Unzufriedenheit und Abkehr auf Seiten vieler Kunden. Es fehlt ihnen an Motivation zur Neuanla-ge oder generell am Vertrauen in ihren Berater. Dieser Entwicklung als Bank tatenlos zuzusehen oder als Reaktion den Fokus noch mehr auf das vermeintlich allein lukrative Private Banking zu richten, ist zu kurz gegriffen. Vielmehr gilt es, das Niveau im Massengeschäft deutlich zu steigern. Dabei haben geläufige Gegenargumente wie „kein Geld“, „keine Zeit“, „keine Qualifikation“ ausgedient. Wirtschaftliche Premi-umberatung ist auch im Retail Ban-king möglich.
Stichwörter: Image, Private Banking, Retail Banking, Premiumberatung, Standardberatung, neue Kundenorientierung, Qualitätssteigerung, Globalisierung, Individualisierung, Ganzheit-lichkeit, Cost Income Ratios, Kundentreue, Cross- und Upsellings, kompaktes Financial Planning, technische Problemlösung, Bera-tungssoftware, Kundendatenerfassung, Portfo-lioanalyse, Dokumentation, Produktbreite und -tiefe, Profitabilität, Wirtschaftlichkeit, Wachs-tumschancen.
JEL-Classification: D 14, G 21, L 14, M 21.
Private banking and retail banking are still worlds apart. May the wealthy private customer enjoy a profound financial advice and personal care, the retail banking customer is served with commodities, which hardly cor-respond with the clients’ wants or needs. As a result, many customers are dissatisfied and turn away from their consultant or financial institution. They lack motivation for investing in new assets or generally don’t believe
Michael Gschwind, Certified Estate and Foundation Planner (CFEP) und Diplom-Informatiker, ist Ge-schäftsführer der Gschwind Soft-ware GmbH, Aachen/Deutschland;e-mail:[email protected]
Phot
o: p
rivat
„G
in their consultant’s guidance. Stan-ding on the sidelines or focussing on the, as supposed, only profitable private banking anymore, cannot be the banker’s right strategy. It falls too short. Instead of this the branch should raise the level of consultancy in the mass market significantly. In doing so common refutations like “no money”, “no time”, “no qualificati-on” no longer remain valid. It is also possible in the retail banking to give premium advice efficiently.
Arme Banken: ihr Image ist schlecht! Kaum einer mag sie, doch jeder braucht sie – ein Spannungsverhältnis mit eigener Dynamik. Zwar ist die Spontanumfra-ge in den Internet-Business-Netzwerken Xing, Linkedin und Bankinnovation von Dr. Hansjörg Leichsenring, Finanzmarkt-experte aus Deutschland, Berater und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) [1] bereits mehr als ein Jahr her und nach Bekunden des Verfassers „sicher nicht repräsentativ“, doch spiegelt die Erhebung einen nach wie vor eindeutigen Trend wieder: 87 Prozent der befragten Bankkunden bewerteten den Ruf des Bank- bzw. allgemeinen Finanzdienst-leistungsgewerbes mit bestenfalls „neu-tral“ (42%), mit „negativ“ (21%) oder „sehr negativ“ (24%). Die Werturteile „po-sitiv“ (9%) und „sehr positiv“ (4%) fielen mit insgesamt 13 Prozent dagegen sehr gering aus. Auf die Frage, welches Wort den Umfrageteilnehmern spontan einfiele, wenn sie mit einer Bank zu tun hätten, standen „Abzocker“, „Parasiten“, „Ver-brecher“, „Besserwisser“, „Bankinter- esse vor Kundeninteresse“, „gleichgültig“ und „Einschränkungen beim Service“ weit vor „Regenschirm“ und „Vertrauen“, „Gewissenhaftigkeit“, „gutem Service“ und „Kundenorientierung“. Leichsenring geht davon aus, keinen fundamentalkriti-schen Kreis angesprochen zu haben und findet den von ihm ermittelten Negativ-trend in vielen anderen Studien namhaf-ter Institutionen betätigt [2]. Demnach
veröffentliche zum Beispiel die Unter-nehmensberatung Marketing Partner aus Wiesbaden, Deutschland, dass lediglich 23 Prozent einer Stichprobe aus Bank- und Sparkassenkunden der Ansicht seien, dass sich ihre Hausbank nach dem Hö-hepunkt der Finanzkrise intensiv darum kümmere, verlorenes Vertrauen zurückzu-erlangen. Über 50 Prozent der Befragten gäben an, dass ihre Hausbank dazu bisher sehr wenig (21%) oder nichts (30%) un-ternommen habe. Direkt bestätigt werde diese Erkenntnis, so Leichsenring, durch eine Umfrage deutscher Bankenverbände. „Niederschmetternd“ nennt der Berater das Ergebnis dann auch folgerichtig und beendet seine ernüchternden Ausführun-gen mit dem Zitat Friedrich von Schillers: „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“ – ob er will oder nicht.
Die „neue Kundenorientierung“
Doch was bedeutet eigentlich „mit der Zeit gehen“? Dass sich das Kun-denvertrauen im Bankgewerbe in einem mehr oder weniger desolaten Zustand befindet – und dies gilt für Österreich
[1] Quelle: www.der-bank-blog.de, Dr. Hansjörg Leichsenring, „Bankenimage bleibt schlecht“, Befragung auf Xing, LinkedIn und
Bankinnovation, publiziert am 21. Dezember 2010.
[2] Vgl. Studie.

Gschwind Berichte und AnAlysen
202 ÖBA 4/12
tung intensiv arbeitet, wird im Wettbewerb der Banken, Sparkassen und sonstigen Finanzdienstleister eindeutig „punkten“ können. Dabei beziehen sich die positi-ven Effekte auf Anbieterseite bei weitem nicht nur auf kurzfristige Gewinnchancen. Vielmehr geht mit hoher Beratungsquali-tät auch eine große Kundenzufriedenheit einher. Ist die Anlageberatung zudem langfristig ausgelegt, sollte sie auch dazu geeignet sein, das größtenteils verloren gegangene Vertrauen der Kunden Schritt für Schritt zurückzugewinnen.
Ab wann ist ein Kunde Individualität „wert“?
Doch müssen wir bei näherem Hin- sehen durchaus differenzieren: Anlage-beratung ist nicht gleich Anlageberatung und das Qualitätsniveau schwankt nicht nur von Anbieter zu Anbieter, sondern auch mit einem jeweiligen Kundenseg-ment enorm. Jede Bank macht für sich die Kosten-Nutzen-Rechnung. Sie bestimmt den „Kundenwert“, um danach zu ent-scheiden, ob sich eine „Qualitätsbera-tung“ lohnt oder nicht. Laut Oehler und Kohlert [4] ist ein „wertiger Kunde“ vor allem ein Anleger mit hohem Einkommen bzw. Vermögen. Hier winken attraktive Umsätze und Provisionen. Eine „teure“ individuelle Beratung – auch langfristig – scheint sich zu lohnen. Banker bzw. Finanzdienstleister fassen diese Klien-tel gemeinhin im Geschäftsbereich des Private Banking oder bei noch größeren Vermögen im Wealth Management res-pektive in der Individuellen Vermögens-verwaltung bis hin zum Family Office zusammen. Dabei sind die Grenzen der Eingruppierung fließend: Ergebnis einer empirischen Analyse unter Leitung von Universitäts-Professor Teodoro D. Cocca vom Lehrstuhl für Asset Management an der Johannes Kepler Universität Linz zum Thema „Private Banking in Österreich“ [5] ist, dass 90 Prozent der österreichi-schen Private-Banking-Anbieter bei ihren Kunden in jedem Fall ein Mindestvermö-gen voraussetzen. Erst auf dieser Basis könne eine Beratung mit „individuell angepassten Lösungen“ erfolgen. Die Studie ergab, dass ein Großteil dieser An-bieter (38%) ein monetäres Volumen von 200.000 bis 300.000 Euro fordert. Doch es gibt durchaus Institute, bei denen sich ein Anleger schon in der Größenordnung in Höhe von 100.000 Euro zu den Private-Banking-Kunden zählen darf oder sogar gar keine Vermögensgrenze beachten muss (in circa 10% aller Fälle). Auf der
mangelhaft. Darauf soll im Folgenden noch näher eingegangen werden. Jeder Finanzdienstleister muss für sich prüfen, inwieweit die Negativbeurteilungen auf ihn zutreffen. Und selbst wenn diese Prüfung ergibt, dass man vermeintlich alles richtig macht, steht dem doch der allgemein schlechte Nimbus entgegen. Da hilft nur, die „Flucht nach vorne“ anzutre-ten: Durch hervorragende Öffentlichkeits-arbeit, wenn bereits Spitzenleistungen erbracht werden. Reden Sie darüber – so oft wie möglich! Oder durch sachliche Kritik und zukunftsweisende neue Kon-zepte, wenn Defizite bestehen. Und derer kann es einige geben: Angefangen von der mangelnden Wirtschaftlichkeit der eige-nen Anlageberatung, in der Kundenpoten-ziale unzureichend erkannt, Cross- und Upsellings außer Acht gelassen werden. Weiter über karge Serviceleistungen, die bestehende Kunden abschrecken und schlimmstenfalls in die Arme der Wett-bewerber treiben. Bis hin zu schlecht aus-gebildeten oder auf ein Kundengespräch lückenhaft vorbereiteten Beratern, die wohl kaum für das Neu- und Bestands-kundengeschäft geeignet sein dürften. Die Anforderungen sind vielfältig. Die Möglichkeiten, sich im negativen Kontext positiv zu profilieren, sind es auch – auch und gerade jetzt.
Steigerung der inhaltlichen Beratungsqualität
Ein zentraler Schlüssel zum Erfolg ist eine hohe inhaltliche Qualität in der Anlageberatung. Denn anderenfalls können sowohl betriebs- als auch volk-wirtschaftlich große Schäden entstehen. Die Experten Universitäts-Professor Andreas Oehler, Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwirtschaft an der Universi-tät Bamberg/Deutschland, und Daniel Kohlert, ebenfalls Finanzwirtschaftler an der Universität Bamberg und Absol-vent des Studiums der Europäischen Wirtschaft, erhoben für den deutschen Finanzmarkt eine Schadenssumme von im Durchschnitt 20 Milliarden Euro pro Jahr, die durch fehlerhafte Anlagebera-tung entsteht [3]. Müßig ist es, im Detail analysieren zu wollen, wo genau sich diese monetären Einbußen manifestieren. Müßig ist es auch, diese Situation nur auf Deutschland zu beziehen. An die Größe des österreichischen Marktes angepasst, mag sich die Lage hier ähnlich darstellen. Die Botschaft, die aus dieser Erhebung hervorgeht, ist jedoch klar: Wer an der inhaltlichen Qualität seiner Anlagebera-
genauso wie für den oben beschrie-benen Finanzmarkt Deutschland oder die Märkte anderer europäischer und außereuropäischer Länder –, gibt Anlass zu grundlegenden Reformen. Und selbst-verständlich schwingen sich Kenner der Branche seit geraumer Zeit dazu auf und liefern Lösungsvorschläge, die samt und sonders unter dem Begriff der „neuen Kundenorientierung“ zusammengefasst werden können. Der Kunde solle nun ernster genommen werden, sich besser beraten und informiert fühlen. Indivi-dualität werde in der Geldanlage ebenso groß geschrieben wie Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit und Seriosität. Transpa-renz ist als Schlagwort ein Renner wie auch Qualität und Service. Es gelte, die Risikoaffinität eines Anlegers mit dessen Risikotragfähigkeit verantwortungsvoll abzugleichen und nichts zu empfehlen, was für den Anleger ruinöse Züge anneh-men könnte. Der Langfristigkeit einer Kundenbeziehung sei stets der Vorzug gegenüber dem „schnellen Geld“ zu ge-ben. Mit Verlaub: Dies klingt, als strenge sich die Branche an, eine Metamorphose „vom Saulus zum Paulus“ zu durchlaufen, und wird der Realität weder in die eine noch in die andere Richtung gerecht. Es gibt nämlich nicht nur Gut oder Schlecht, Schwarz oder Weiß, kriminellen Vorsatz oder selbstloses Gutmenschentum. Die meisten Banken, Sparkassen und freien Finanzdienstleister bewegen sich in Grau-schattierungen und tendieren mal mehr zum einen oder zum anderen Extrem. Und so gibt es Scharlatane, denen das Hand-werk gelegt werden muss, wie auch viele Berater, die seriös und vertrauenswürdig arbeiten – darunter auch echte Könner, die ihre Kunden seit vielen Jahren zuverlässig begleiten und dies zur größten Zufrieden-heit ihrer Anleger tun.
Kritik mit zukunftsweisenden Konzepten begegnen
Doch Achtung! Zum selbstzufriede-nen Zurücklehnen und Aufatmen ist es noch zu früh. Die beißende Kritik an den Praktiken der Banken ist nicht von der Hand zu weisen und sie ist mehr als ein Gefühl der Antipathie oder der diffu-sen Ablehnung von Seiten des Kunden. Abgesehen davon, dass vielen Beratern bzw. deren Arbeitgebern charakterliche Unzulänglichkeiten wie Egoismus oder Selbstbereicherung vorgeworfen werden, muss sich die Branche auch mit massiver inhaltlicher Kritik auseinandersetzen: Demnach sei auch die Beratungsqualität
[3] Quellen: Andreas Oehler, Daniel Koh-lert, „Guter Rat macht hilflos: Zur Qualität der Anlageberatung in Deutschland“, aus „Ver-triebssteuerung in der Finanzdienstleistungsin-dustrie“, Hrsg. von Heike Brost, Rainer Neske,
Wolfram Wrabetz, Frankfurt/Main, Frankfurt School Verlag 2008; Daniel Kohlert, „Anlage-beratung und Qualität – ein Widerspruch? Zur Utopie qualitativ hochwertiger Anlageberatung im Retail Banking“, Baden-Baden, Nomos
2009 (Schriftenreihe des Instituts für Europäi-sches Wirtschafts- und Verbraucherrecht e. V.).
[4] Quelle: siehe unter Punkt 3.[5] Quelle: Cocca, Private Banking in
Österreich – Empirische Analyse, Juni 2010.

Berichte und AnAlysen „Glückliche Banken“
ÖBA 4/12 203
werden sie sich in ihrer Relation kaum entscheidend geändert haben. Hier kann sich eine Bank, die das Private Banking lukrativ ausbauen will, nur mit massiver Wettbewerbsverdrängung oder im be-schriebenen Auslandsgeschäft mit seinen eigenen harten Regeln profilieren.
Abschied von Allgemeinplätzen
Ist nun im Umkehrschluss das Retail Banking das Banking der Wahl? Gerade das Geschäftsfeld, in dem angeblich „nicht viel zu holen“ ist? Nicht nur, son-dern auch – vor allem für die Anbieter, die ohnehin einen Großteil ihrer Kunden zum Retailsegment zählen! Denn auch wenn das gesamte österreichische Pri-vatvermögen, das auf 1,3 Billionen Euro geschätzt wird, zu drei Vierteln, das sind rund 884 Milliarden Euro, in Händen einer 10 Prozent zählenden, hoch attrak-tiven Minderheit liegt, verfügen doch 90 Prozent der Österreicher immer noch über ein Gesamtvermögen in Höhe von rund 416 Milliarden Euro [9]. Da lohnt es sich, genauer hinzuschauen! Und das von Kritikern geäußerte Argument, die Vertei-lung dieses Vermögens beziehungsweise die Menge der Kunden sei im Retailseg-ment bei weitem zu groß, um den Fokus auf jeden einzelnen zu richten, und die Erlössituation sei ohnehin vernichtend, kann eine moderne Bank nicht gelten las-sen. Diese Form der unternehmerischen Unzulänglichkeit ist nämlich oft haus-gemacht und kommt nur allzu gern unter dem Deckmäntelchen der allgemeinen Marktgegebenheiten daher. Der Königs-weg ist ein anderer: sich ganz bewusst und öffentlichkeitswirksam von diesen Allgemeinplätzen zu verabschieden.
Ganzheitliches Retail Banking als Investition in die Zukunft
Und so kehren wir zurück zur Quali-tät der Beratung. Sie muss nicht nur im Private Banking, sondern auch im Retail Banking hervorragend sein. Sie soll im Rahmen der Möglichkeiten und Gegeben-heiten eines Retailkunden ganzheitlich er-folgen, für jeden Anleger individuell, das heißt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. Ein fortschrittlicher Retailbanker wird kein Verkäufer von Standardprodukten mehr sein. Wie desillusionierend klingt die Definition des „Standardisierten Pri-vatkundengeschäfts“ als Übersetzung des Retail Banking, wie sie Wikipedia, die
tums hinterher. Eine andere Studie der Liechtensteiner Investmentgesellschaft Valluga AG und des österreichischen Un-ternehmensberaters Amadeus Consulting prognostizierte sogar eine außerordent-liche Zunahme der Chancen im Private Banking, weil allein im Jahr 2010 die Anzahl der vermögenden Österreicher um 7,2 Prozent gestiegen sei, meinte hiermit aber nicht nur die Superreichen [7]. Unter dem Strich jedoch herrsche, so Booz & Company, in Österreich im Private Ban-king ein Verdrängungswettbewerb, dem die Branche nur mit besonderer Effizienz begegnen könne: Die Rede ist von der Akquisition respektabler Millionäre oder Milliardäre in Zukunftsmärkten wie zum Beispiel in China, Indien oder im Nahen Osten und mittelfristig in Zentral- und Osteuropa. Zugleich sollen die Kosten in der Kundenberatung um 10 bis 15 Prozent gesenkt werden. Die Zukunft des Private Banking ist demnach international bezie-hungsweise global, wobei der durch die Wettbewerber erzeugte „Gegenwind“ an Schärfe zunimmt. Anders ausgedrückt: Das Geschäft mit dem vermögenden Privatkunden ist kein Hort der Glück-seligkeit.
Auftrag, den „Otto Normalbürger“ zu versorgen
Nun wird sich aber auch nicht jede österreichische Bank auf die Reichsten der Reichen konzentrieren können oder wollen. Je nach Provenienz wie zum Beispiel bei der Sparkasse oder Volks- und Raiffeisenbank hat ein Geldinstitut ohnehin zunächst einen anderen Auftrag: die Versorgung des „Otto Normalbür-ger“ – und zwar möglichst am Ort bzw. in der angestammten Region. Und je nach Bundesland ist die Private-Banking-Kli-entel ohnehin rar gesät. Wer nicht gerade in der Landeshauptstadt Wien tätig ist, auf die sich circa 43 Prozent der öster-reichischen und 34 Prozent der gesamten bei österreichischen Banken angelegten Vermögen konzentrieren, muss sich schon um hohe Asset-Volumina außerordentlich bemühen. Denn relativ weit abgeschlagen folgen Nieder- und Oberösterreich mit je 14 Prozent der österreichischen Gelder, gefolgt von Salzburg mit 8 Prozent, Vor-arlberg mit 7 Prozent, Tirol mit 5 Prozent, Burgenland, Kärnten und Steiermark mit je 4, 3 und 2 Prozent des österreichischen Vermögens [8]. Wenn auch diese Zahlen im Jahr 2008 veröffentlicht wurden,
anderen Seite beginnen manche Banken mit der auf den Kunden zugeschnittenen Arbeit erst bei Werten ab 400.000 oder 500.000 Euro. Wie auch immer: Im Schnitt muss nach Erkenntnis der univer-sitären Forschung ein österreichischer Anleger über 270.000 Euro Mindestver-mögen verfügen – sei es bei seiner Spar-kasse, Volksbank, Raiffeisenbank, Uni-versalbank oder klassischen Privatbank. Ansonsten wird er dem Retail-Segment seines Geldinstituts zugeordnet und kann – statt mit Individualität – mit einem, so Cocca, „Angebot von standardisierten Produkten“ rechnen. Und genau hier liegt das Problem!
Private Banking kein Hort der Glückseligkeit
Mit diesen „Standards“ sinkt automa-tisch die Beratungsqualität. Mit sinkender Qualität sinkt das Kundenvertrauen, mit abnehmendem Vertrauen die Bereitschaft auf Anlegerseite, sich überhaupt noch auf eine Finanzberatung einzulassen oder nicht doch lieber den „Sparstrumpf un-ters Bett zu legen“. Diese Abwärtsspirale bedarf keiner weiteren Erläuterung. Die Finanzkrise hat zur Genüge gezeigt, in welcher Schnelligkeit sie sich drehen kann. Nun mögen manche Marktakteure auf Seiten der Banken diese Entwicklung mit einem müden Lächeln quittieren, sind sie doch auf ganz andere Märkte als auf das Retail Banking konzentriert. Und auch in einer Studie wie der oben genannten aus Linz ist zu lesen, dass der Private-Banking-Markt in Österreich im Allgemeinen „mit viel Potenzial und guten Wachstumsaussichten“ bewertet wird. Gleichwohl tragen internationale Vergleiche dann doch zur ersten Relativie-rung bei: Eine Marktanalyse aus dem Jahr 2010 der global tätigen Strategieberatung Booz & Company [6], die sich der führen-den 15 Private-Banking-Märkte weltweit annahm – darunter in der Schweiz, in Großbritannien, Deutschland, den USA, in China und den Vereinigten Arabischen Emiraten –, ergab zwar, dass Österreich künftig mit einer wachsenden Anzahl seiner besonders vermögenden Privat-kunden, den High Net Worth Individuals (HNWI), in einer Größenordnung von 1,5 bis 2 Prozent rechnen dürfe. Damit könne die österreichische Finanzwirt-schaft in diesem Marktsegment wachsen. Allerdings hinke sie im weltweiten Ver-gleich eines tendenziell 4%igen Wachs-
[6] Quelle: Booz & Company Inc. via ikp Wien, „Die Zukunft des Private Banking in Österreich und im deutschsprachigen Raum: Konsolidierung, Regulierung und geringes Wachstum“, Pressemitteilung vom 29.4.2010.
[7] Quelle: APA, www.kleinezeitung.at, Artikel „Vermögenssteuer: 74.000 Millionäre
in Österreich“ vom 31.8.2011, Verweis auf Studie der Investmentgesellschaft Valluga AG, Liechtenstein, und Unternehmensberatung Amadeus Consulting, Österreich.
[8] Quelle: Cocca, Private Banking in Österreich – Empirische Analyse, Februar 2008.
[9] Quelle: Arbeiterkammer (AK) Ober-österreich, Linz, Broschüre „Verteilung der Vermögen in Österreich“ unter Bezugnahme auf den Sozialbericht 2003–2004, vorgestellt auf einer Pressekonferenz am 18.8.2011.

Gschwind Berichte und AnAlysen
204 ÖBA 4/12
freie Enzyklopädie, im Internet liefert! Und wie deutlich ruft sie zur Gegenwehr auf: „…ein produkt- oder produktions-orientiertes Massengeschäft mit Mengen-kunden…, die nur über ein niedriges bis gar kein Einkommen verfügen“ [10]? Wir erinnern uns an die durchschnittliche Min-destvermögensgrenze für das Private Ban-king in Österreich, die bei 270.000 Euro liegt. Ist alles, was darunter liegt, ein „niedriges bis gar kein Einkommen“? Wohl kaum! Und dabei vollkommen unbeachtet bleibt, dass sich dieses Ein-kommen im Laufe eines Anlegerlebens auch zum Positiven verändern kann, sei dies zum Beispiel durch beruflichen oder gesellschaftlichen Aufstieg oder schlicht durch eine Erbschaft, die aus einem klassischen Retailkunden ganz schnell einen Private-Banking-Kunden macht. Wem wird dieser Retailkunde dann wohl mehr vertrauen? Der Bank, die ihn bisher „links liegen ließ“ oder dem Berater, der ihn auch vor dem Vermögenszuwachs individuell und angemessen betreute? Ganzheitliches Retail Banking ist dem-nach weit mehr als dem Trend der Zeit zu folgen oder gar nur rechtlichen Auflagen Genüge zu tun. Es ist eine Investition in die Zukunft, die sich für eine Bank schon im Umstellungsprozess lohnen kann.
Defizit contra KundenverlustWidmen wir uns den Faktoren Kosten
und Zeit. Noch ist eine ganzheitliche Be-ratung im Retail Banking oft zu teuer, weil zu personal- und gegebenenfalls recher-cheaufwendig. Von Cost Income Ratios im Bereich von 100 Prozent und deutlich mehr ist die Rede, wonach der Aufwand den Ertrag bei weitem übersteigt. Eine gründliche Analyse der persönlichen und finanziellen Situation eines Retailkunden, die Erstellung eines adäquaten Finanz-plans und die Eigeninitiative des Beraters, die Erfüllung dieses Plans zu verfolgen und ihn gegebenenfalls neuen Gegeben-heiten anzupassen, münde in eine er- drückende Defizitsituation: Argumente wie diese sind nicht von der Hand zu weisen. Sie bedürfen aber auch einer detaillierten Betrachtung – und dann der Lösung des Problems. Denn was ist sonst die Folge? Im schlimmsten Fall der Kundenverlust. Auch der Retail-Banking-Markt ist durch eine hohe Wettbewerbsin-tensität gekennzeichnet – wenngleich sich Österreicher ihrem Geldinstitut gegen-über größtenteils loyal verhalten. So publiziert zum Beispiel die Unterneh-mensberatung A. T. Kearney, Wien, dass 82 Prozent der Kunden ihrer Hausbank treu bleiben [11]. Doch was ist mit den übrigen 18 Prozent, die vermutlich zuneh-men, weil Anleger informierter, kritischer und wechselwilliger werden? Und was ist mit dem vermeintlich „verlässlichen“ Kundenstamm, der nur unzureichend be-treut wird? Wird der Berater über dessen
Financial Planning wichtige Informa-tionen außer Acht zu lassen, vermag eine adäquate Technik elegant zu umgehen. Schließlich kann ein Berater nicht alles wissen und ist im Retail Banking zumeist nicht so detailliert ausgebildet wie im ge-hobenen Bankingsegment. Die Software wird ihn jedoch im Kundengespräch durch einen virtuellen „Eingabeassisten-ten“ so geschickt anleiten, dass er bei der Analyse und Planung nichts Wesentliches vergessen kann. Die Software wird dem Berater Formulierungshilfen zur Doku-mentation seines Beratungsgesprächs lie-fern oder sogar einen Report beziehungs-weise eine Expertise vollautomatisch generieren. Dabei ist diese Expertise trotz allem kundenindividuell. Eine ausgefeilte Software wird in der Lage sein, jeden Financial-Planning-Verlauf exakt zu do-kumentieren und nach dem Baukasten-system Standarddaten mit persönlichen Variablen zu kombinieren. Des Weiteren übernimmt eine gute Software nicht nur wichtige Kernfunktionen des Financial Plannings, sondern auch wertvolle Auf-gaben des Kundenmanagements. Sie führt die Daten einer Datenbank zu, erinnert den Berater an Fälligkeiten, ermöglicht die Filterung des Kundenstamms nach bestimmten Vertriebskriterien wie zum Beispiel Alter, Ausbildungs- und Fami-lienstand, Vermögensschwankungen und andere. Damit ist eine geeignete Software nicht nur ein Beratungs-, sondern auch ein Betreuungs- bzw. Marketinginstrument. Ein solches Tool ist im Idealfall an jedem Beraterarbeitsplatz installiert. Es amorti-siert sich innerhalb kurzer Zeit und umso schneller, je intensiver es genutzt wird.
Lösung dreier Kernprobleme
Doch wie kann eine praktikable Premi-umberatung im Retail Banking mit Hilfe einer Software im Detail aussehen? Dies sei hier am Beispiel der Lösung dreier Kernprobleme im Financial Planning skizziert. Diese Kernprobleme bringen Finanzberater in Bezug auf die Ganzheit-lichkeit immer wieder ins Straucheln. Problem Nummer 1: Die Erfassung der individuellen Kundendaten erfordert viel Zeit. Problem Nummer 2: Die Analyse der Kundensituation verlangt viel Fach- wissen. Problem Nummer 3: Das Erstellen einer individuellen Dokumentation eines Beratungsgesprächs ist sehr aufwendig.
Vermögenswerte, die vielleicht an anderer Stelle als bei der Hausbank deponiert sind, informiert? Wird er über Anlagepläne oder Eigeninitiativen des Kunden in Kenntnis gesetzt? Wahrscheinlich nicht! Die Voraussetzungen für ein nachhaltig erfolgreiches Banking sind aber Cross- und Upsellings sowie eine erfolgreiche Neukunden-Akquisition. In dem einen wie dem anderen Fall steht ein Finanz-dienstleister mit einem anerkannt hohen Beratungsniveau, das auch für das Retail Banking gilt, offensichtlich besser da.
Für „kompaktes“ Financial Planning Technik zu Hilfe nehmen
Wie erreicht ein Finanzdienstleister aber nun dieses hohe Niveau, ohne dabei wirtschaftlich zu kollabieren? Die Lösung klingt zunächst simpel: Indem er das Financial Planning im Private Banking in reduzierter Form auch auf das Retail Banking überträgt! Natürlich wird der Retailkunde nicht nur über ein niedrigeres Vermögen als sein wohlhabendes Pendant verfügen, er wird auch eine weitaus gerin-gere Komplexität seines Anlageportfolios aufweisen. Und genau darin liegt die Chance einer gründlichen Analyse und Beratung, die trotzdem kostensparend und damit effizient erfolgen kann. Relativ einfach und preiswert gelingt das „kom-pakte“ Financial Planning mit technischer Hilfe. So selbstverständlich der Compu-ter in alle möglichen Bereiche unseres Lebens Einzug gehalten hat, so sollte er zweifelsohne auch bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines Kundengesprächs genutzt werden. Der Berater kann eine Beratungssoftware verwenden, die ihm viele Arbeitschritte, die er ansonsten aufwendig selbst durch-laufen müsste, abnimmt. Diese Bera-tungssoftware ersetzt den papierbasierten Standard-Beratungsbogen! Warum? Weil erstere dynamisch ist, auf Kundenstamm- und Unternehmensdaten in einer Daten-bank schnell und reibungslos zugreifen kann, Berechnungen sofort durchführt und veranschaulicht, verschiedene Emp-fehlungsszenarien auf dem Bildschirm und im späteren Ausdruck für den Kunden darstellt – und dies alles alternativ am Arbeitsplatz oder mobil beim Kunden zuhause. Kurzum: Die Beratungssoftware stellt innerhalb kürzester Zeit so viele Informationen zur Verfügung bzw. verar-beitet sie auf den Kunden zugeschnitten, wie dies über eine papierbasierte Beratung nie möglich wäre. Die Zeitersparnis in der Kundenberatung, der Komfortgewinn und der enorme Qualitätszuwachs sind bei Anwendung einer Software überzeugend.
Beratungssoftware im Idealfall an jedem Beraterarbeitsplatz
Selbst die Gefahr, im manchmal hoch komplexen und damit unübersichtlichen
[10] www.wikipedia.de[11] Quelle: www.wu.ac.at, A. T. Kearney
Ges.m.b.H., Wien, Projekt “Innovative Bank-produkte für Studierende im Retail Banking”, Entrepreneurship & Innovation Management, Sommersemester 2008.

Berichte und AnAlysen „Glückliche Banken“
ÖBA 4/12 205
tation eines Beratungsgesprächs ist sehr aufwendig“: Im Anschluss an jeden Be-ratungsprozess erfolgt die Dokumentation eines Kundengesprächs und seiner Ergeb-nisse. Dies muss korrekt und möglichst vollständig geschehen. Eine Expertise, die dem Kunden ausgehändigt wird, soll-te darüber hinaus allgemeinverständlich formuliert sein. Diese Anforderungen an Umfang und Sprachqualität stellen viele Berater vor neue, große Heraus-forderungen. Entweder es fehlen ihnen die Daten, die Worte oder es mangelt an der erforderlichen Zeit zur detailgetreuen Wiedergabe. Demgegenüber stellt eine Beratungssoftware alle für einen Report erforderlichen Formulierungen und In-formationen prompt zur Verfügung – in Form von vordefinierten Textbausteinen und Grafiken. Je nach Kundensituation erscheint die jeweils passgenaue Darstel-lung. Individuelle Kundendaten wie zum Beispiel der Name, der Planungszeitraum,
Zeitliche Minimierung der Kundendatenerfassung
Lösung des Problems Nummer 1 „Die Erfassung der individuellen Kundendaten erfordert viel Zeit“: Um eine vollumfäng-liche und trotzdem schnelle Erfassung von Kundendaten zu erreichen, wird eine Beratungssoftware automatisch auf eine Datenbank im jeweiligen Geldinstitut zugreifen, um von dort bereits gespeicher-te Kundenstamm- und -vorgangsdaten in einen aktuellen Beratungsprozess zu importieren. Zeitraubende Mehrfachbe-fragungen ein und derselben Person fallen somit ersatzlos weg. Der Berater braucht nur noch Vermögenswerte zu erheben, die bei Fremdinstituten oder anderweitig deponiert sind, um sie in seine Planung zu integrieren. Lediglich bei Neukunden ist eine einmalige Initialbefragung zur Erfassung der persönlichen Basisdaten und zur Aufnahme des finanziellen Status quo erforderlich.
Sichere Portfolioanalyse trotz hoher Komplexität
Lösung des Problems Nummer 2 „Die Analyse der Kundensituation verlangt viel Fachwissen“: Zum Hintergrund: Bisher gehen viele Berater im Retail Banking produktbezogen vor. Sie sind nicht selten Spezialisten für bestimmte Anlageformen wie zum Beispiel Fonds, Bausparverträge oder Lebensversicherungen. Stehen sie aber vor der Herausforderung, ein Kun-denvermögen aus mehreren Assets zu beurteilen und Interdependenzen heraus-zufiltern, scheitern sie an ihrem mangeln-den Know-how. Ein gangbarer Weg ist die intensive Schulung dieser Berater – eine zunächst sehr kostenträchtige Vorgehens-weise mit mittel- bis langfristiger Erfolgs-perspektive. Die kurzfristig effizientere Lösung ist, dass eine Beratungssoftware die Analyse der Kundensituation weit-gehend eigenständig übernimmt. Dabei greift das Tool mittels programmatisch hinterlegter Logik auf sämtliche erforder-lichen Fakten zurück. Die Software gibt in Abhängigkeit von den Kundendaten sowie gemäß den individuellen Vorgaben eines Geldinstituts unterschiedliche Texte und Grafiken aus bzw. stellt sie auf dem Bildschirm anschaulich dar. Diese Texte und Grafiken dienen dem Berater als Argumentationsgrundlage für sein Gut-achten und als Formulierungs- respektive Demonstrationshilfe für neue Anlage-empfehlungen. Auf diese Weise erlangt auch der vergleichsweise ungeschulte Retailbanker ein Höchstmaß an Sicherheit bei der ganzheitlichen Beurteilung einer Kundensituation.
Mühelose und trotzdem individuelle Dokumentation
Lösung des Problems Nummer 3 „Das Erstellen einer individuellen Dokumen-
die Vermögensbestandteile und deren Werte werden mit Hilfe von Makros – kleinen Unterprogrammen – automatisch in die vordefinierten Module eingesetzt. Auf diese Weise erhält jede Dokumentati-on ihren eigenen, persönlichen Charakter. Der Aufwand für den Berater hält sich dabei in überschaubaren Grenzen.
Zusammenfassung und Ausblick
Private Banking und Retail Banking haben ihre ganz eigene Existenzberech-tigung und unterliegen verschiedenen Prämissen. Beiden gemein ist der An-spruch an eine neue Beratungsqualität. Wird das Private Banking immer mehr globalen Anforderungen genügen müssen, unterliegt das Retail Banking dem Gebot der Ganzheitlichkeit und Individualität. Dieser neuen Kundenorientierung im Retail Banking kann eine Bank vor allem mit Hilfe intelligenter Softwareunter-
Lösung dreier Kernproblemebei der Premiumberatung mit Hilfe einer
Beratungssoftware
Problem 1:
Lösung 1:
Die Erfassung der individuellen Kundendaten erfordert viel Zeit.
Vorhandene Daten werden über Schnittstellen automatisch importiert. Neue oder externe Daten werden über einen „Eingabeassistenten“ schnell und unkompliziert erfasst.
Problem 2:
Lösung 2:
Die Analyse der Kundensituation erfordert viel Fachwissen.
Die Analyse erfolgt weitgehend automatisiert mittels programmatisch hinterlegter Logik. Zum Zweck der Argumentation und Darstellung erfolgt die Ausgabe softwaregenerierter Texte und Grafiken, die derindividuellen Kundensituation sowie institutionellen Vorgaben entsprechen.
Problem 3:
Lösung 3:
Das Erstellen einer individuellen Dokumentation eines Beratungsgesprächs ist sehr aufwändig.
Vordefinierte Textbausteine und Grafiken werden unmittel-bar in einen Report importiert („Baukastenprinzip“). Die Individualisierung der Dokumentation für jeden Kunden erfolgt über Makros: Unterprogramme setzen persönliche Daten und Werte wie z. B. Name, Vermögensbestandteile, Planungszeitraum in die vordefinierten Textbausteine und Grafiken ein.
Abb. 1
Abb. 1: Lösung dreier Kernprobleme bei der Premiumberatung mit Hilfe einer Beratungs-software
Quelle: Gschwind Software GmbH, Aachen/D

Gschwind Berichte und AnAlysen
206 ÖBA 4/12
stützung wirkungsvoll begegnen. Eine auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse eines jeden einzelnen Kunden abgestimmte Beratung wird dabei durch den Einsatz eines modularen Systems realisiert: Je nach Kundenfall werden vom Berater einzelne Bausteine von hoher Qualität zu einer Premiumgesamtlösung kombiniert. Auf konventionellem Wege, also durch händische Recherche, Auswertung, Be-rechnung und Dokumentation, würde dies der Berater – und sei er noch so qua-lifiziert – kaum in akzeptabler Zeit und Qualität leisten können. Er bedient sich deshalb einer geeigneten Beratungssoft-ware, die ihm einen Großteil der Arbeit abnimmt. Keine Zeit, kein Geld, keine ausreichende Qualifikation dürften auf diese Weise bald keine Argumente mehr sein, mit denen sich Finanzdienstleister einer merklichen Erhöhung der Bera-tungsgüte im Retail Banking entziehen.
„Ganzheitlichkeit – die Zukunft in der Finanzberatung“: Noch titeln nati-onale und internationale Fachpublika-tionen und -veranstaltungen mit dieser Prognose. Besser wäre es, wenn bald von „Ganzheitlichkeit – die Realität in der Finanzberatung“ die Rede wäre. Denn was will der Kunde von heute, der aufge-klärte, „mündige“ Kunde, der auch beim Banking immer kritischer und wechsel-williger wird? Seriosität, überzeugende Konditionen und eine gute Beratung! Wer das als Finanzanbieter nicht leisten kann, muss sich fragen, wie lange er sich das noch leisten kann oder will. Deshalb ist es höchste Zeit, dass Banken ernst nehmen, was unabhängige Forscher herausfinden. Dazu sei hier abschließend aus der Publikation „QFZ Dialog – Das Magazin für die Zukunft der Finanzbe-ratung“ [12] zitiert. Die Initiative QFZ – Qualität formt Zukunft – aus Deutschland zieht aus einer Studie, die gemeinsam mit Christof Zwecker realisiert wurde, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover, außerdem Dozent, Prüfer und Zertifizierer deutscher Sparkassen- akademien, folgendes Resümee: „Wie die empirische Untersuchung gezeigt hat, wird die Bedeutung der Erfolgsfak-toren Qualität und Service von vielen Banken noch immer unterschätzt. Der Kunde darf erwarten, dass Bankberater die erforderliche Qualifikation mitbringen (Anm. des Autors: und/oder sich eines geeigneten Beratungstools bedienen), um eine objektive, bedarfsgerechte Beratung zu garantieren. Damit wird Qualifikation zu einem entscheidenden Wettbewerbs-vorteil, der ebenso bewertet, gepflegt, erweitert und verwaltet werden muss … Am stärksten müssen die Kommu-nikationsfähigkeiten (Anm. des Autors: sprachlicher und schriftlicher Ausdruck sowie aktives Herantreten an den Kunden)
Cocca, Teodoro, Private Banking in Österreich – Empirische Analyse, Uni-versität Linz, 2008.
Cocca, Teodoro, Private Banking in Österreich – Empirische Analyse, Uni-versität Linz, 2010.
A. T. Kearney, Innovative Bankpro-dukte für Studierende im Retail Banking, Entrepreneurship & Innovation Manage-ment, 2008.
Kohlert, Daniel, Anlageberatung und Qualität – ein Widerspruch? Zur Utopie qualitativ hochwertiger Anlageberatung im Retail Banking, aus: Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht e. V., Nomos 2009.
Leichsenring, Hansjörg, Bankenimage bleibt schlecht, www.der-bank-blog.de, 2010.
Oehler, Andreas / Kohlert, Daniel, Guter Rat macht hilflos: Zur Quali-tät der Anlageberatung in Deutschland, aus: Brost / Neske / Wrabetz (Hrsg.), Vertriebssteuerung in der Finanzdienst- leistungsindustrie, Frankfurt School, 2008.
QFZ Dialog – Das Magazin für die Zukunft der Finanzberatung, Was Kunden wünschen, von Zwecker (Autor) und QFZ Initiative (Hrsg.), 2008.
… sowie die Problemlösungsfähigkeiten (Anm. des Autors: auf den Kunden zuge-schnittene Finanzpläne) entwickelt wer-den … Außerdem haben sich strategische Potenziale hinsichtlich der Produkttiefe ergeben. Objektiv und unabhängig kann nur derjenige beraten, dessen Produktan-gebot sowohl in der Breite als auch in der Tiefe mannigfaltig ausgebaut ist (Anm. des Autors: und der den Überblick über dieses Produktangebot behält) … Retail Banking wird stets ‚people’s business’ bleiben (Anm. des Autors: mit allen da-raus entstehenden Wachstumschancen). Aus diesem Grund sollte der Kunde wie-der in den Fokus des Geschäfts gerückt werden. Gelingt dies durch Steigerung der Kundenorientierung, der Beratungs-qualität und der Produktvielfalt, werden Banken auch in Zukunft Ansprechpartner Nummer 1 in Sachen Geldanlage sein.“ Hoffen wir, dass es bald heißt: Glückliche Banken: ihr Image ist gut! Jeder mag sie, jeder schätzt sie. ◆
LiteraturverzeichnisAPA, Vermögenssteuer: 74.000 Mil-
lionäre in Österreich, aus: Studie der In-vestmentgesellschaft Valluga AG, Liech-tenstein, und Unternehmensberatung Amadeus Consulting, Österreich, 2011.
Arbeiterkammer Oberösterreich, Ver-teilung der Vermögen in Österreich, aus: Sozialbericht 2003–2004, vorgestellt 2011.
Booz & Company / ikp Wien, die Zu-kunft des Private Banking in Österreich und im deutschsprachigen Raum: Kon-solidierung, Regulierung und geringes Wachstum, Pressemitteilung, 2010.
Abb. 2: Professionelle Dokumentation per Mausklick: Eine gute Software stellt dem Finanz-berater alle für einen Report erforderlichen Formulierungen und Informationen prompt zur Verfügung. Die Darstellung ist übersichtlich, die Sprache allgemeinverständlich.
Quelle: Gschwind Software GmbH, Aachen/D
[12] Quelle: QFZ Dialog – Das Magazin für die Zukunft der Finanzberatung, 1. Jahr-gang 2008, Artikel „Was Kunden wünschen“, herausgegeben von der QFZ-Initiative, Han-nover/Deutschland; QFZ Stiftung – Qualität formt Zukunft –, Schwäbisch Hall/Deutsch-land.

Berichte und AnAlysen ÖCGK FassunG Jänner 2012
ÖBA 4/12 207
Richard Schenz / Michael Eberhartinger
Dr. Michael Eberhartinger ist Mitarbeiter des Büros des Ka-pitalmarktbeauftragten und der Wirtschaftskammer Österreich so-wie Mitglied des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Gover-nance; e-mail:[email protected]
Aufgrund nationaler und inter-nationaler Entwicklungen hat der Österreichische Arbeitskreis für Corporate Governance Änderungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex beschlossen. Schwerpunkte der Kodexrevision 2012 sind die Weiterentwicklung der Diversitätsregel sowie neue Regeln zur Verbesserung der Zu-sammenarbeit von Aufsichtsrat und Abschlussprüfer. Die große Dyna-mik der Fortentwicklung der Corpo-rate Governance Regeln durch den europäischen und den österreichi-schen Gesetzgeber wird schon bald weitere Kodexanpassungen erfor-derlich machen.
Stichwörter: Corporate Governance, Kapital-markt, Österreichischer Corporate Governance Kodex, Diversität, Prüfungsausschuss, Ab-schlussprüfer.JEL-Classification: G 34, K 20, K 22.
In the light of national and internatio-nal developments the Austrian Wor-king Group for Corporate Governance amended the Austrian Code of Cor-porate Governance. The focus of the 2012 revision of the Code is on the development of the diversity rule and the inclusion of new rules to improve cooperation between supervisory board and auditors. On account of the great dynamism in the development of Corporate Governance rules in Austria and Europe further adapta-tions of the Code will become ne-cessary in near future.
1. Einleitung
Im zehnten Jahr seines Bestehens wurde der Österreichische Corporate Governance Kodex (ÖCGK) zum sechs-ten Mal angepasst. Anstöße für diese Kodexrevision lieferten insbesondere die Entwicklungen im Bereich der Diversität auf nationaler Ebene und die einschlägi-gen Grünbücher der EU-Kommission auf internationaler Ebene.
Im März 2011 hat die österreichische Bundesregierung eine Selbstverpflich-
er Österreichische Corporate Governance Kodex in der Fassung Jänner 2012
Phot
o: p
rivat
D
Dr. Richard Schenz ist Vorsitzender des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance und Beauftragter der Finanzministerin für Corporate Governance und Kapitalmarktentwicklung;e-mail: [email protected]
Phot
o: W
ilke
tung zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten staatsnaher Unterneh-men beschlossen. Demnach sollen in Unternehmen, an denen der Bund mit 50 Prozent und mehr beteiligt ist, bis zum 31. Dezember 2013 25 Prozent der Aufsichtsräte Frauen sein, bis spätestens Ende 2018 soll ein Anteil von 35 Prozent (jeweils bezogen auf die Bundesquote im Aufsichtsgremium) erreicht werden.
Ebenso thematisiert das Grünbuch „Europäischer Corporate Governance Rahmen“ [1] die geschlechterspezifi-sche Diversität. Dort wird insbesondere gefragt, ob die Unternehmen ihre dies-bezüglichen Ziele (samt dazugehörende regelmäßige Fortschrittsberichte) offenle-gen sollen. Weitere Themen dieses Grün-buchs sind hinsichtlich des Aufsichts-rats die berufliche und internationale Diversität, die zeitliche Verfügbarkeit der Aufsichtsratsmitglieder, die externe
Evaluierung sowie das Risikomanage-ment. Der zweite Teil des Grünbuchs setzt sich mit der Rolle der Aktionäre auseinander. Hier sieht die Europäische Kommission Hinweise für schädliches kurzfristiges Denken und Passivität und stellt entsprechende Maßnahmen zur Dis-kussion. Regeln für Investoren stehen jedoch nicht im Fokus des ÖCGK, der als Verhaltensmaßstab für Emittenten zu ver-stehen ist. Der dritte Teil des Grünbuchs behandelt das „Comply or Explain“-Prinzip. In diesem Zusammenhang wird auf Basis einer Studie [2] kritisiert, dass die Qualität der Explains unzureichend ist und die Anwendung des Kodex durch die Mitgliedstaaten zu wenig überwacht wird. Grundsätzlich ist dazu festzuhalten, dass die Überwachung der Corporate-Governance-Erklärungen primär Aufgabe der Investoren bzw des Marktes sein sollte [3]. Daneben ist in Österreich die
[1] Europäische Kommission, Grünbuch Europäischer Corporate Governance Rahmen, KOM(2010) 561.
[2] Studie über die Praktiken bei der Überwachung und rechtlichen Durchsetzung der Corporate Governance in den Mitglied-staaten: http://ec.europa.eu/internal_market/
company/docs/ecgforum/studies/comply-or-explain-090923_en.pdf.
[3] Siehe Statement des Europäischen Corporate Governance Forums zum Com-ply or Explain Prinzip, http://ec.europa.eu/ internal_market/company/docs/ecgforum/ecgf-comply-explain_en.pdf.

sChenz / eberhartinGer Berichte und AnAlysen
208 ÖBA 4/12
2.2. Bekämpfung der Korruption
Gemäß der neuen C-Regel 18a hat der Vorstand dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich über die Vorkehrungen zur Bekämpfung von Korruption im Un-ternehmen zu berichten. Diese neue Regel sensibilisiert den Aufsichtsrat und fördert eine strukturierte Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Thema.
2.3. Hinaufstufung der Diversitäts-regel
Eine Diversitätsempfehlung wurde bereits mit der Kodexrevision 2009 als Recommendation [8] für den Nominie-rungsausschuss (R-Regel 42) eingeführt. Demnach sind bei der Unterbreitung von Vorschlägen zur Besetzung frei wer-dender Mandate im Aufsichtsrat auch Aspekte der Diversität des Aufsichtsrats im Hinblick auf die Internationalität der Mitglieder, die Vertretung beider Geschlechter und die Altersstruktur zu berücksichtigen. Zusammen mit der ge-setzlichen Verpflichtung des § 243b Abs 2 Z 2, die Maßnahmen zur Förderung von Frauen im Vorstand, im Aufsichtsrat und in leitenden Stellen im Corporate Gover-nance Bericht offen zu legen, hat diese Regel die Erhöhung des Frauenanteils in den Aufsichtsräten der ATX-Unterneh-men von 5,8% im Jahr 2008 auf 11,6% im Jahr 2011 maßgeblich unterstützt.
Inzwischen hat sich die politische Dis-kussion auf nationaler und europäischer in dieser Frage intensiviert und es wurden die in der Einleitung beschrieben Maß-nahmen umgesetzt. Ebenso wurden weite-re internationale Studien mit Nachweisen zu den positiven Effekten hinreichender Diversität in Aufsichtsräten veröffent-licht [9]. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen sowie im Interesse einer weiteren Förderung des Frauenanteils in den Aufsichtsräten österreichischer börsenotierter Unternehmen und zur ge-nerellen Steigerung der Effektivität der Aufsichtsratstätigkeit wurde daher die Verbindlichkeit der Diversitätsempfeh-lung des Kodex durch Hinaufstufung zu einer „Comply or Explain“-Regel erhöht. Eine Abweichung von der Regel muss nun erklärt und begründet werden, um ein kodexkonformes Verhalten zu erreichen. Für private börsenotierte Unternehmen wird die Festschreibung einer solchen Diversitätsregel im Wege der Selbstregu-lierung als geeignete und ausgewogene
An dieser Stelle sei auch die generell gute Einhaltung des Kodex durch die österreichischen börsenotierten Unterneh-men erwähnt [6]. 87,7% aller inländischen börsenotierten Unternehmen haben im Jahr 2010 eine Verpflichtungserklärung zum ÖCGK abgegeben. Im Gesamtmarkt kamen die Unternehmen im Durchschnitt 91,1% aller C-Regeln nach. Im Prime Market und im ATX sind die Befol-gungsquoten mit einer Einhaltung von im Durchschnitt 93,8% bzw 95,0% der C-Regeln noch höher.
Zurückkommend zur Bedeutung des Grünbuchs „Europäischer Corporate Governance Rahmen“ für den ÖCGK ist festzuhalten, dass hinsichtlich der weiteren Themen im Zusammenhang mit dem Aufsichtsrat und dem „Comply or Explain“-Prinzip allfällige Vorschläge der Kommission, die im Herbst 2012 erfol-gen sollen, abzuwarten sind. Ein anderes Grünbuch der Europäischen Kommission, nämlich jenes zur Abschlussprüfung [7] hat bereits bei der Kodexrevision 2012 insofern eine Rolle gespielt, als es den Anstoß für die Entwicklung neuer Ko-dexregeln zur Verbesserung der Zusam-menarbeit zwischen Abschlussprüfer und Aufsichtsrat/Prüfungsausschuss gegeben hat.
2. Die Kodexänderungen im Detail
Die C- und R-Regeln des Kodex in der Fassung Jänner 2012 gelten für Geschäfts-jahre, die nach dem 31.12.2011 beginnen.
2.1. Präambel
Die Präambel des Kodex wurde um eine Aussage zur Corporate Social Re-sponsibility (CSR) ergänzt. Es wird nun festgehalten, dass Unternehmen Ver-antwortung gegenüber der Gesellschaft tragen, und empfohlen, entsprechende geeignete freiwillige Maßnahmen und Initiativen umzusetzen. Als Beispiel her-vorgehoben werden Maßnahmen zur Ver-einbarkeit von Beruf und Familie. Damit wird einerseits die Bedeutung von CSR unterstrichen, gleichzeitig aber auch der den Ansatz unterstützt, die beiden wich-tigen Themen Corporate Governance und Corporate Social Responsibility getrennt zu behandeln und unterschiedlichen Re-gelwerken zu unterstellen.
Überprüfung der Corporate Governance-Berichte bereits auf mehreren Ebenen vorgesehen. Der Aufsichtsrat prüft den Corporate Governance Bericht gemäß § 96 Abs 1 AktG. Vom Austrian Finan-cial Reporting and Auditing Committee (AFRAC) wurde hierzu eine Stellung-nahme ausgearbeitet, die eine Richtlinie für Umfang und Intensität und Durch-führung dieser Prüfung darstellt [4]. Der Abschlussprüfer prüft gemäß § 269 Abs 1 UGB, ob ein Bericht aufgestellt worden ist. Die Wiener Börse prüft den Corporate-Governance-Bericht im Rahmen des Prime-Market-Regelwerks. Besonders ist auf die im Kodex vorge-sehene freiwillige externe Evaluierung der Kodexeinhaltung durch eine unab-hängige Institution hinzuweisen, bei der Österreich im europäischen Vergleich Vorreiter ist. Gemäß R-Regel 62 hat die Gesellschaft die Einhaltung der C- und R-Regeln des Kodex regelmäßig, mindestens alle drei Jahre durch eine externe Institution evaluieren zu lassen und darüber im Corporate-Governance-Bericht zu berichten. Als Hilfestellung für die freiwillige externe Evaluierung hat der Österreichische Arbeitskreis für Corporate Governance einen Fragebo-gen [5] entwickelt. Der Fragebogen soll größtmögliche Einheitlichkeit bei der freiwilligen externen Evaluierung sicherstellen und damit ein hohes Maß an Vergleichbarkeit der Evaluierungsergeb-nisse gewährleisten. Ziel der Evaluierung ist es, der Öffentlichkeit ein Bild über die Einhaltung der öffentlich erklär-ten Corporate-Governance-Grundsätze durch das Unternehmen zu geben. Mit dem Fragebogen wird auch geprüft, ob das Nichteinhalten einer C-Regel vom Unternehmen ausreichend und nachvoll-ziehbar begründet wurde. Der übersicht-lich und einfach gestaltete Fragebogen unterstützt ganz im Sinne der Erklärung des Europäischen Corporate Governance Forums zum Comply-or-Explain-Prinzip die Investoren bei der Beurteilung und der Prüfung der Corporate Governance des Unternehmens. Beantwortete Fragebögen sollen daher vom Unternehmen zu diesem Zweck veröffentlicht werden. Der Ansatz der freiwilligen externen Evaluierung hat sich bewährt und entspricht dem Prinzip der Selbstregulierung. Im ATX führen 75% der Unternehmen, im Prime Market von 55,3% der Unternehmen eine externe Evaluierung durch.
[4] Siehe www.afrac.at/download/AF-RAC_Pruefung_CG-Bericht_clean.pdf.
[5] Veröffentlicht auf www.corporate-governance.at.
[6] Siehe Aktienforum, Kodexbericht 2011, www.aktienforum.org.
[7] Grünbuch, Weiteres Vorgehen im Be-reich der Abschlussprüfung: Lehren aus der Krise, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_de.pdf.
[8] Zu den einzelnen Regelkategorien des
ÖCGK siehe Präambel des ÖCGK, www.corporate-governance.at.
[9] Siehe http://ec.europa.eu/justice/news-room/gender-equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf.

Berichte und AnAlysen ÖCGK FassunG Jänner 2012
ÖBA 4/12 209
Anleger und ein wesentliches Element der Corporate Governance. Dem Abschluss-prüfer kommt eine besondere Rolle bei der Unterstützung des Aufsichtsrats bei seiner Tätigkeit und vor allem bei der Verbesserung der Informationsversorgung des Aufsichtsrats zu. Auch das Grün-buch Abschlussprüfung stellt fest, dass zwischen dem Prüfungsausschuss und dem gesetzlichen Abschlussprüfer ein regelmäßiger Dialog gewährleistet sein muss [14].
Die neue C-Regel 81a bestimmt daher, dass der Abschlussprüfer zusätzlich zu den im Gesetz vorgesehenen Fällen zu einer weiteren Sitzung des Prüfungsaus-schusses einzuladen ist. Falls nicht mehr als zwei Sitzungen stattfinden wird ge-mäß den Interpretationen zum Kodex die Regel eingehalten, wenn der (Konzern-)Abschlussprüfer zu beiden Sitzungen eingeladen wird. In den Sitzungen mit dem Abschlussprüfer ist auch festzulegen, wie die wechselseitige Kommunikation zwischen (Konzern-)Abschlussprüfer und dem Prüfungsausschuss zu erfolgen hat. Weiters soll der (Konzern-)Abschluss-prüfer den Mitgliedern des Prüfungsaus-schusses einen Überblick über den ge-planten Umfang, die zeitliche Einteilung und die wesentlichen Elemente seiner Prüfung geben.
Diese Sitzung sollte auch dazu genutzt werden, dass der Prüfungsausschuss mit dem (Konzern-)Abschlussprüfer Themen bespricht, die nach Ansicht des Prü-fungsausschusses für die Durchführung der (Konzern-)Abschlussprüfung zweck-dienlich sind. Während des Zeitraums der Durchführung der Prüfung soll eine wechselseitige Kommunikation zwischen dem (Konzern-)Abschlussprüfer und Prü-fungsausschuss dazu dienen, dass sich die beiden Prüfinstanzen gegenseitig über wesentliche Erkenntnisse austauschen, die im Rahmen der jeweiligen Tätig-keit gewonnen wurden und die für die ordnungsmäßige und effiziente Erfül-lung der Aufgaben des Anderen relevant sind [15].
Regel 81a schreibt weiters vor, dass es im Rahmen dieser Sitzungen auch die Ge-legenheit zu geben hat, dass ein Austausch zwischen dem Prüfungsausschuss und dem (Konzern-) Abschlussprüfer ohne Beisein des Vorstandes stattfinden kann (sog executive session) [16]. Darüber hinaus lädt der Vorsitzende des Prüfungs-
sätze für den Aufsichtsrat einschließlich der angemessenen Berücksichtigung der Aspekte der Diversität in der Hauptver-sammlung oder in den Hauptversamm-lungsunterlagen hingewiesen wird [11].
2.4. Wechsel Vorstand in den Aufsichtsratsvorsitz
C-Regel 55 wurde insofern erweitert, als nun nicht mehr nur der sofortige Wechsel vom Vorstandsvorsitz in den Aufsichtsratsvorsitz untersagt wird, son-dern die Cooling-off-Periode von zwei Jahren nun auch für das einfache Vor-standsmitglied, welches zum Aufsichts-ratsvorsitzenden gewählt werden soll, gilt. Zweck der Regel ist, dass die bedeutende Position des Vorsitzes im Aufsichtsrat von einer gegenüber dem Vorstand und der Gesellschaft besonders unabhängigen Person besetzt wird. Als Gefahren, die mit einem solchen unmittelbaren Wechsel verbunden sein können, werden die Per-petuierung von als Vorstand getroffenen Entscheidungen und eine zu starke Einmi-schung in die operative Geschäftsführung genannt [12]. Dem gegenüber stehen das Fachwissen und die Erfahrung, die ein ehemaliges Vorstandsmitglied in den Aufsichtsrat einbringen kann. Dass das einfache Aufsichtsratsmitglied kein ehe-maliges Vorstandsmitglied (Cooling-off-Periode) ist, ist daher gemäß Anhang 1 des Kodex bloß ein Unabhängigkeitskriteri-um. Gemäß C-Regel 53 soll die Mehrheit der Aufsichtsräte diese Kriterien erfüllen.
Eine besondere Situation kann bei Fa-miliengesellschaften und Gesellschaften mit einem Kernaktionär gegeben sein. Hier kann ein direkter Wechsel vom Vor-stand in den Aufsichtsratsvorsitz durch die Aktionärsstruktur begründet sein. In den Interpretationen zum Kodex wird für derartige Fälle ausdrücklich festgehal-ten, dass es eine ausreichende Erklärung für die Nicht-Einhaltung der Regel ist, wenn das ehemalige Vorstandsmitglied die Unterstützung von mindestens 10% der Stimmrechte hat. Dies kann der Aufsichtsrat auf Basis der einzelnen Abstimmungsergebnisse in der Hauptver-sammlung feststellen [13].
2.5. Prüfungsausschuss und Abschlussprüfer
Die Abschlussprüfung ist eine wich-tige Voraussetzung für das Vertrauen der
Maßnahme gesehen. Eine gesetzliche Fixierung von starren Quoten stellt hinge-gen einen problematischen Eingriff in das Eigentumsrecht der Aktionäre dar.
Die gesamte Regel 42, gemäß der der Nominierungsausschuss oder der gesam-te Aufsichtsrat der Hauptversammlung Vorschläge zur Besetzung frei werdender Mandate im Aufsichtsrat zu unterbreiten hat, wird als C-Regel normiert. In Bezug auf die vorrangigen Bestellungsgrund-sätze der C-Regel 52, insbesondere die persönliche und fachliche Qualifikation der Mitglieder wird nun auch die fachlich ausgewogene Zusammensetzung expli-zit in Regel 42 angeführt. Weiters sind Aspekte der Diversität des Aufsichtsrats im Hinblick auf die Internationalität der Mitglieder, die Vertretung beider Geschlechter und die Altersstruktur an-gemessen zu berücksichtigen.
Entscheidend für die praktische An-wendung des Kodex ist, wann die Regel eingehalten ist und wann allenfalls eine begründete Erklärung einer Abweichung (Explain) abzugeben ist. Gemäß den Interpretationen zum Kodex ist die Regel eingehalten, wenn die Bestellungsgrund-sätze der Regel 52 und die angemesse-ne Berücksichtigung der Aspekte der Diversität Kriterien für die Vorschläge zur Besetzung frei werdender Aufsichts-ratsmandate sind und wenn darauf in der Begründung der Vorschläge des Nominie-rungsausschusses/Aufsichtsrats eingegan-gen wird [10].
Die Diversitätsregel des Kodex wurde ebenfalls in C-Regel 52, deren Adressat eigentlich die Hauptversammlung ist, eingefügt. Gemäß C-Regel 61 ist für die Einhaltung von Corporate Governance Grundsätzen jenes Organ verantwortlich, das Adressat der jeweiligen Regelung ist. Für den besonderen Fall der Regel 52 haben die Interpretationen schon bisher ausgeführt, dass damit keine direkte Bindung der Aktionäre bewirkt wird, es sollte aber die Einhaltung von Corporate-Governance-Grundsätzen im Unterneh-men insgesamt angestrebt werden. In diesem Sinne sollen die Organe (Vorstand, Aufsichtsrat) auf die Aktionäre zB durch Hinweise in der Hauptversammlung oder den veröffentlichten Unterlagen für die Hauptversammlung einwirken, damit die Regel umgesetzt wird.
Die neugefasste Regel wird daher ein-gehalten, wenn auf die Bestellungsgrund-
[10] Siehe Interpretationen zur Regel 42. Veröffentlicht unter www.corporate-gover-nance.at.
[11] Siehe Interpretationen zur Regel 52. Veröffentlicht unter www.corporate-gover-nance.at.
[12] Vgl Ringleb / Kremer / Lutter / v. Wer-der DCGK Kommentar Rz 1061.
[13] Siehe Interpretationen zur Regel 55. Veröffentlicht unter www.corporate-gover-nance.at.
[14] Siehe auch Erwägungsgrund 20 des Vorschlags für eine Verordnung über die spe-ziellen Anforderungen an die Abschlussprü-fung bei Unternehmen öffentlichen Interesses, KOM (2011) 779 endg.
[15] Siehe Interpretation zu Regel 81a. Veröffentlicht unter www.corporate-gover-nance.at.
[16] Bereits C-Regel 36 stellt klar, dass bei Bedarf Tagesordnungspunkte im Aufsichts-rat und seinen Ausschüssen ohne Teilnahme der Vorstandsmitglieder abgehandelt werden können.

sChenz / eberhartinGer Berichte und AnAlysen
210 ÖBA 4/12
und sollten keinesfalls als bloße Vorstufen von Gesetzen gesehen werden. Darüber hinaus sind Kodexbestimmungen keine Mindeststandards, sondern best practice Regeln, von denen gemäß dem „Comply or Explain“-Prinzip völlig kodexkonform abgewichen werden kann. Diese wichtige Flexibilität für die Unternehmen bieten gesetzliche Vorschriften in der Regel nicht. Andererseits kann argumentiert werden, dass im Fall der Übernahme von bereits länger bestehenden Kodexregeln, von Kapitalmarktteilnehmern entwickelte und praxiserprobte Vorschriften Eingang in das Gesetz finden. Für den ÖCGK bedeutet diese jüngste Entwicklung je-denfalls, dass weitere Anpassungen schon bald und früher als geplant erforderlich sein werden. ◆
Literaturverzeichnis:
AFRAC, Austrian Financial Reporting and Auditing Comittee Stellungnahme Prüfung des Corporate Governance Be-richts, Juni 2011, www.afrac.at.
Aktienforum, Kodexbericht 2011, Juli 2011, www.aktienforum.org.
Österreichischer Arbeitskreises für Corporate Governance, Interpretationen, www.corporate-governance.at.
Ringleb / Kremer / Lutter / v. Werder, Kommentar zum DCGK, 3. Aufl.
Schenz / Eberhartinger, Der Österrei-chische Corporate Governance Kodex in der Fassung Jänner 2006, ÖBA 2006, 168.
nämlich Diversität in der Zusammenset-zung des Aufsichtsrats und verbesserte Zusammenarbeit mit dem Abschlussprü-fer, rasch und ausgewogen umgesetzt.
Die Weiterentwicklung von Corporate Governance schreitet aber sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebe-ne mit nochmals gesteigerter Dynamik fort.
Die EU-Kommission hat soeben eine öffentliche Konsultation eingeleitet, um festzustellen, welche Maßnahmen ge-eignet sind, um die Geschlechterdiversi-tät in den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen in Europa zu verbessern [17]. Anschließend wird die Kommis-sion über die im weiteren Jahresverlauf erfolgenden Maßnahmen beschließen. Für Herbst ist ein gesellschaftsrechtlicher EU-Aktionsplan zu erwarten, der auch die Konsultationsergebnisse zum Grünbuch Europäischer Corporate Governance Rah-men berücksichtigen soll.
Auf nationaler Ebene wurden in die Regierungsvorlage zum Stabilitätsgesetz überraschend Teile der Kodexregeln be-treffend Vergütung, Vergütungstranspa-renz, Diversität und den Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat in das AktG bzw in das UGB übernommen. Diese Änderungen sollen mit 1.7.2012 in Kraft treten. Eine solche Übernahme von Soft-Law-Bestimmungen in Gesetze ist für den Ansatz der Selbstregulierung grundsätz-lich kritisch zu sehen [18]. Kodexregeln haben eine eigenständige Funktion in einem Corporate Governance System
ausschusses bei Bedarf den (Konzern-)Abschlussprüfer zu weiteren Sitzungen des Prüfungsausschusses ein.
Durch diese Intensivierung der Zusam-menarbeit zwischen Prüfungsausschuss und Abschlussprüfer, insbesondere die Erweiterung und Konkretisierung der wechselseitigen Kommunikation, ist die in den bisherigen Versionen des Kodex vorgesehene Erstellung und anschlie-ßende Behandlung eines „Management Letter“ im Prüfungsausschuss als C-Regel nicht mehr notwendig und wurde daher aufgehoben.
Gemäß der neuen C-Regel 82a hat der Vorstand dem Aufsichtsrat nach Ab-schluss der Konzernabschlussprüfung eine Aufstellung vorzulegen, aus der die gesamten Aufwendungen für die Prüfun-gen in sämtlichen Konzerngesellschaften ersichtlich sind, und zwar gesondert nach Aufwendungen für den Konzernab-schlussprüfer, für Mitglieder des Netz-werks, dem der Konzernabschlussprüfer angehört, und für andere im Konzern tätige Abschlussprüfer.
Um einen noch umfassenderen Über-blick über die gesetzlichen Vorschriften für den Abschlussprüfer zu geben, wurden schließlich auch die L-Regeln 78, 79, 80, 82 überarbeitet bzw. ergänzt.
3. Ausblick
Mit der Kodexrevision 2012 wurden wichtige Ansatzpunkte zur Stärkung der Effektivität der Aufsichtsratstätigkeit,
[17] http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm.
[18] Eine Übernahme von Kodexregeln in
das AktG ist auch schon durch das GesRÄG 2005 erfolgt. Siehe dazu Schenz/Eberhartin-ger, Der Österreichische Corporate Gover-
nance Kodex in der Fassung Jänner 2006, ÖBA 2006, 169.

Berichte und AnAlysen Österreichs Kreditinstitute im Jahr 2011
ÖBA 4/12 211
Nikolaus Böck / Wolfgang Fleischhacker / Lukas Simhandl
Der Stand der unkonsolidierten Bilanzsumme überstieg zum Jahres-endtermin wieder die 1 Billion EUR Grenze (1.014,28 Mrd. EUR). Aktiv-seitig trugen die Bilanzpositionen Forderungen an inländische KI (+8,79 Mrd. EUR) und Direktkredite an inl. Nichtbanken (+8,24 Mrd. EUR) zu dieser Entwicklung bei. Passivseitig waren die Bilanzposi-tionen Verbindlichkeiten gegen-über inländischen Kreditinstituten (+13,04 Mrd. EUR), Auslandsver-bindlichkeiten (+12,61 Mrd. EUR) und Einlagen von inländischen Nichtbanken (+8,10 Mrd. EUR) hauptverantwortlich. Insgesamt be-trug der Bilanzsummenanstieg 35,73 Mrd. EUR. Im Jahr 2011 war der Einlagenanstieg (+8,10 Mrd. EUR) im Kundenbereich mehrheit-lich auf den Zuwachs im Sichtein-lagensegment (+7,25 Mrd. EUR) zurückzuführen. Das Einlagenvolu-men von inländischen Nichtbanken (289,67 Mrd. EUR) verteilte sich zu 54,2% auf Spareinlagen, zu 33,5% auf Sichteinlagen und zu 12,3% auf Termineinlagen. Der Zuwachs im Auslandsgeschäft ging hauptsäch-lich auf das Kundengeschäft zu-rück. Der Stand der Auslandsforde-rungen erhöhte sich im Berichtsjahr 2011 um 0,6% bzw. 1,88 Mrd. EUR und die Auslandsverbindlichkeiten stiegen um 5,3% bzw. 12,61 Mrd. EUR. Das unkonsolidier-te Betriebsergebnis der in Öster-reich tätigen Kreditinstitute sank zur entsprechenden Vorjahresperi-ode auf 7,51 Mrd. EUR (–0,65 Mrd. EUR bzw. –7,9%). Die einzigen Anstiege im Bereich der Betriebser-träge konnten beim Nettozinsertrag (+0,50 Mrd. EUR) beobachtet wer-den. Die österreichischen Primär-banken [1] verzeichneten eine ge-ringfügige Zunahme des Betriebs-ergebnisses (+0,01 Mrd. EUR bzw. +0,9%). Die unkonsolidierte Cost-
sterreichs Kreditinstitute im Jahr 2011
Mag. Nikolaus Böck, Aufsichts-statistik, Abteilung für Aufsichts- und Monetärstatistik, Oesterreichi-sche Nationalbank;e-mail: [email protected]
Phot
o: p
rivat
Ö
Wolfgang Fleischhacker BA, Auf-sichtsstatistik, Abteilung für Auf-sichts- und Monetärstatistik, Oester-reichische Nationalbank; e-mail: [email protected]
Phot
o: p
rivat
Mag. Lukas Simhandl, Prozess-manager Monetärstatistik, Oester-reichische Nationalbank, Abteilung für Aufsichts- und Monetärstatistik;e-mail: [email protected]
Phot
o: p
rivat
Income-Ratio verschlechterte sich gegenüber der Vergleichsperiode 2010 auf 60,9%, die der Primärban-ken belief sich auf 67,4% (67,2% Ende 2010). Im Hinblick auf die von den Wirtschaftsprüfern geprüften Daten erwarten die österreichi-schen Kreditinstitute gegenüber Ende 2010 einen Rückgang des Jahresüberschusses auf 1,21 Mrd. EUR (–3,00 Mrd. EUR bzw. –71,3%). Zurückzuführen ist das unter ande-rem auf den deutlichen Anstieg des Wertberichtigungs- und Rückstel-lungsbedarfs (in Summe +2,38 Mrd. EUR auf 5,70 Mrd. EUR).
Stichwörter: Anzahl der Bankstellen, Bankstel-lendichte, Bilanzsumme, Fremdwährungskre-dite, Einlagenentwicklung, Auslandsbereich, Derivativgeschäfte, Eigenmittelausstattung in Prozent der Bemessungsgrundlage, Cost–In-come–Ratio, Nettozinsertrag, Erträge aus Wert-papieren und Beteiligungen, Saldo aus dem Provisionsgeschäft, Saldo aus Finanzgeschäf-
ten, Verwaltungsaufwendungen, erwarteter Jahresüberschuss.
JEL-Classification: G 21, L 89, N 20.
Der vorliegende Artikel spiegelt ausschließ-lich die persönliche Meinung der Autoren und nicht notwendigerweise jene der Oesterreichi-schen Nationalbank wider. Der vorliegende Bericht basiert auf Daten, die auf Grundlage der Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis-verordnung gemeldet wurden. In diesen Mel-dungen werden die Bilanz- und Ertragsdaten
der in Österreich tätigen Einzelkreditinstitute auf unkonsolidierter Basis erfasst.
[1] Der Primärbankensektor setzt sich zusammen aus bestimmten Aktienbanken, den Sparkassen ohne Erste Group Bank und Erste Bank, den Raiffeisenbanken ohne RZB, RBI, Landesbanken und Holding und den Volksban-ken ohne ÖVAG.

BÖcK / FleischhacKer / simhandl Berichte und AnAlysen
212 ÖBA 4/12
In 2011 banks operating in Austria expanded their balance sheets by 3.7 percent on average. While the volume of loans rose by 2.6 percent, foreign currency loans decreased with their share of total loans falling to 17.5 percent. Loan deposit ratio slightly decreased to 110.2 percent. Noteworthy is the fact that solven-cy ratio was at 18.5 percent, with 80 percent of all own funds being core capital. Earning situation wors-ened, while cost income ratio rose to 67.4 percent. In total banks are expecting an unconsolidated surplus being 71.3 percent below that of 2010. This is mainly due to extremely high loss provisions.
1. Anzahl und Struktur der Kreditinstitute in Österreich
Die Anzahl der Hauptanstalten verrin-gerte sich im Vergleich zum Jahresultimo 2010 um 19 von 843 auf 824. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Zweigstellen um 266, wodurch sich das österreichische Bank-stellennetz zum 31.12.2011 auf insgesamt 5.265 Standorte erhöhte. Dieser Zuwachs, welcher durch die Zweigstellenumstruk-turierung der BAWAG verursacht wurde, geht auf einen massiven Anstieg im Aktienbanken Sektor zurück. Der Rück-gang der Hauptanstalten ist auf mehrere Fusionen im Raiffeisensektor (9), sowie im Sparkassensektor (3) zurück zu führen. Weitere Umstrukturierungen gab es durch das Auslaufen von Konzessionen von sechs Wechselstuben im Sonderbanken-sektor und zwei Schließungen von Par. 9 Instituten.
Die Zahl der in Österreich tätigen Kre-ditinstitute, gegliedert nach Sektoren, zum 31.12.2010 bzw. 31.12.2011 und die in
Tab. 1: Anzahl der in Österreich tätigen Kreditinstitute
Aktien- Spar- Landes- Raiffeisen- Volks- Bau- Sonder- Par. banken kassen- Hypotheken- sektor banken- spar- banken 9-Institute Gesamt Summe und sektor banken sektor kassen lt. BWG Bankiers H Z H Z H Z H Z H Z H Z H Z F Z H Z H + Z31. 12. 2010 47 758 54 990 11 162 539 1.679 67 479 4 90 91 11 30 6 843 4.175 5.01830. 12. 2011 46 1.039 51 989 11 159 530 1.680 67 471 4 87 85 11 30 5 824 4.441 5.265
VAE*) –1 +281 –3 –1 0 –3 –9 +1 0 –8 0 –3 –6 0 0 –1 –19 +266 +247
H = Hauptanstalt; Z = Zweiganstalten und Wechselstuben; F = Filialen*) Die Veränderungen ergeben sich aus Aufnahme der Geschäftstätigkeit, Schließungen und Fusionen.
diesem Zeitraum erfolgten Veränderungen sind in der Tabelle 1 dargestellt.
Die Bankstellendichte [2] veränderte sich deutlich von 1.642 Einwohner pro Bankstelle zum Jahresultimo 2010 auf 1.603 zum 31.12.2011. Das dichteste Bankstellennetz wies nahezu unverändert der Raiffeisensektor mit einem Anteil von 42,0% am Gesamtbestand der Bank-stellen in Österreich auf, gefolgt von den Aktienbanken und den Sparkassen mit einem Anteil von 20,6% bzw. 19,8% und den Volksbanken mit 10,2%. Die verbleibenden 7,4% der österreichischen Bankstellen repräsentierten die Landes-Hypothekenbanken, Sonderbanken, Bau-sparkassen und Zweigstellen gem. § 9 BWG.
Die Gesamtanzahl der Auslands-standorte (Filialen, Repräsentanzen) der inländischen Kreditinstitute (197) er-höhte sich im Jahresverlauf gegenüber dem 31.12.2010 um 6 Standorte. Zum 31.12.2011 wurden im Ausland 153 Fi-lialen (+10) und 44 Repräsentanzen (–4) betrieben.
2. Geschäftsentwicklung der in Österreich tätigen Kredit-institute
2.1. BilanzsummeEnde Dezember 2011 belief sich die
unkonsolidierte Bilanzsumme der in Ös-terreich meldepflichtigen Kreditinstitute auf 1.014,28 Mrd. EUR. Im Berichtsjahr 2011 konnte ein leichter Anstieg von 35,73 Mrd. EUR (+3,7%) festgestellt werden.
Bei Betrachtung der aggregierten Bi-lanzsumme der einzelnen Banksektoren wiesen bis auf die Sektoren Landes-Hypothekenbanken (–3,08 Mrd. EUR),
Sonderbanken (–2,56 Mrd. EUR) und Volksbanken (–1,65 Mrd. EUR) alle anderen Bankensektoren Zuwächse auf. Diese reichten von 24,58 Mrd. EUR im Raiffeisensektor bis zu 0,46 Mrd. EUR bei den § 9 Zweigstellen.
Der Raiffeisensektor hielt Ende De-zember 2011 mit 30,5% (+1,4%-Punkte) Marktanteil gemessen an der Gesamt-bilanzsumme den ersten Platz. Dahinter folgten die Aktienbanken mit 25,2% (+0,3%-Punkte) vor den Sparkassen mit 16,6% (–0,1%-Punkte).
Die Primärbanken verzeichneten eine leichte Zunahme von 4,9%. Ihre Bi-lanzsumme belief sich Ende Dezember 2011 auf 232,80 Mrd. EUR. Der Markt-anteil der Top-Ten-Banken gemessen an der Bilanzsumme erreichte Ende Dezember 2011 ein Niveau von 50,8% (+0,8%-Punkte).
Die Bundesländer [3] Kärnten (–5,6%) und Tirol (–0,5%) wiesen Rückgänge auf. Zuwächse wurden aus den restlichen Bundesländern gemeldet: Wien (+5,4%), Oberösterreich (+4,4%), Burgenland (+3,9%), Vorarlberg (+2,2%), Salzburg (+1,2%), Steiermark (+1,0%) und Nie-derösterreich (+0,9%).
2.2. DirektkrediteDer Stand der Direktkredite war im
Vergleich zum Ultimo 2010 leicht anstei-gend und bezifferte sich Ende Dezember 2011 auf 319,32 Mrd. EUR (+2,6%). Bei den EUR-Krediten betrug die Be-standsveränderung +9,66 Mrd. EUR. Das Fremdwährungskreditgeschäft wies ein Minus von 1,43 Mrd. EUR auf, wechsel-kursbereinigt war jedoch ein Rückgang im Ausmaß von rund 3,31 Mrd. EUR erkenn-bar. Die EUR-Ausleihungen bezifferten sich auf 263,42 Mrd. EUR, die Fremd-währungsausleihungen auf 55,90 Mrd.
[2] Gemäß den Hochrechnungen der Be-völkerungsstatistik der Statistik Austria.
[3] Bundesländervergleiche sind insofern
nur bedingt aussagekräftig, als überregional tätige Kreditinstitute jeweils dem Standort der Hauptanstalt (wie z.B. die UniCredit Bank
Austria dem Bundesland Wien) zugerechnet werden.

Berichte und AnAlysen Österreichs Kreditinstitute im Jahr 2011
ÖBA 4/12 213
Tab. 2a: Geschäftsentwicklung der Kreditinstitute in Österreich
Stand Kumulative Veränderung 2011/12 2011 2010 in Mrd in Mrd in % in Mrd in %
Einlagen von inländischen Nichtbanken 289,66 +8,10 +2,88 +2,34 +0,84EUR-Einlagen 285,70 +8,33 +3,00 +1,51 +0,55Spareinlagen 157,01 +0,77 +0,49 –2,75 –1,73Eigene inl. Emissionen an Nichtbanken (EUR u. FW) 112,14 –4,38 –3,76 +1,08 +0,93Direktkredite an inländische Nichtbanken 319,32 +8,24 +2,65 +8,82 +2,92EUR-Direktkredite 263,42 +9,66 +3,81 +3,81 +1,53Fremdwährungs-Direktkredite 55,90 –1,43 –2,49 +5,01 +9,58Titrierte Kredite an inl. Nichtbanken (EUR u. FW) 30,84 +0,15 +0,48 +5,16 +20,21Auslandsaktiva 320,88 +1,88 +0,59 –18,58 –5,50Auslandspassiva 251,06 +12,62 +5,29 –10,93 –4,38Bilanzsumme 1.014,28 +35,72 +3,65 –50,49 –4,91Eigenmittel absolut*) 91,37 –0,81 –0,88 –1,09 –1,16hievon Kernkapital 72,89 –0,45 –0,61 +1,26 +1,75Eigenmittelquote (solvency ratio) in % 18,5
Tab. 2b: Ertragslage der österreichischen Kreditinstitute im Jahr 2011
Jahr 2011 Jahr 2010 Jahr 2009 Mrd % VJ1) Mrd % VJ1) Mrd % VJ1) 1. Zinsen und zinsähnliche Erträge 28,21 5,0 26,87 –18,0 32,75 –28,6 2. Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen 18,58 4,7 17,75 –26,0 23,98 –36,2 I. NETTOZINSERTRAG (1.–2.) 9,62 5,5 9,12 4,0 8,77 6,3 3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 3,66 –9,0 4,03 21,0 3,33 –53,7 4. Saldo Ertrag / Aufwand aus Provisionen 3,83 –2,9 3,95 9,6 3,61 –14,5 5. Saldo Ertrag / Aufwand aus Finanzgeschäften 0,33 –51,0 0,66 36,5 0,49 159,9 6. Sonstige betriebliche Erträge 1,79 –8,0 1,94 16,8 1,66 –2,4 II. BETRIEBSERTRÄGE (I. +3. +4. +5. +6.) 19,23 –2,4 19,71 10,4 17,85 –13,1 7. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 10,03 3,0 9,74 2,9 9,46 –2,7 hv. Personalaufwand 6,00 3,4 5,80 1,8 5,70 –1,4 hv. Sachaufwand 4,03 2,3 3,94 4,6 3,77 –4,7 8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 0,51 –8,0 0,55 –1,2 0,56 –12,8 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1,18 –5,8 1,25 18,4 1,06 1,0 III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN (7. +8. +9.) 11,72 1,5 11,55 4,2 11,08 –2,9 IV. BETRIEBSERGEBNIS (II.–III.) 7,51 –7,9 8,16 20,5 6,77 –25,9
QUARTALSWEISE AKTUALISIERTE VORSCHAUWERTE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
IV. ERWARTETES JAHRES-BETRIEBSERGEBNIS 7,42 –9,0 8,15 21,1 6,73 –26,2 10. Saldo aus Wertberichtigungen auf Forderungen und Zu- führungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlich- keiten und für Kreditrisken gegenüber den entsprechenden Erträgen aus deren Auflösung (exkl. Wertpapiere) 2,43 –13,4 2,80 –36,6 4,42 5,3 11. Saldo aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere und Beteiligungen gegenüber den entsprechenden Erträgen aus deren Auflösung 3,28 529,9 0,52 –87,3 4,09 46,0 V. ERWARTETES ERGEBNIS der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (IV. –10. –11.) 1,72 –64,5 4,83 371,2 –1,78 –184,2 12. Erwartetes a.o. Ergebnis (Ertrag + / Aufwand –) 0,45 2.546,3 –0,02 –100,8 2,23 8.595,9 13. Erwartete Steuern von Einkommen, Ertrag und sonstige Steuern 0,96 58,7 0,61 50,8 0,40 57,0 VI. ERWARTETER JAHRESÜBERSCHUSS (+) / – FEHLBETRAG (–) (V. +12. –13.) 1,21 –71,2 4,21 9.629,5 0,04 –97,7
1) Die Veränderungen wurden mit den Beträgen in Mio EUR errechnet und anschließend gerundet!
*) Betreffend jene Banken, die laut BWG zur Haltung von Eigenmitteln verpflichtet sind.

BÖcK / FleischhacKer / simhandl Berichte und AnAlysen
214 ÖBA 4/12
Abb. 1: Direktkredite an inländische Nichtbanken (Mia EUR) Abb. 2: Einlagen von inländischen Nichtbanken (Mia EUR)
Abb. 6: Bilanzsumme (Mia EUR)
Abb. 3: Titrierte Kredite an inländische Nichtbanken (Mia EUR) Abb. 4: Auslandsforderungen (Mia EUR)
Abb. 5: Auslandsverbindlichkeiten (Mia EUR)
EUR. Durch diese Entwicklung fiel der Anteil der Fremdwährungskredite an den Gesamtausleihungen um 0,9%-Punkte auf 17,5%.
Aufgrund einer ähnlichen Entwick-lung der Einlagenstände und der Di-rektkredite im Berichtsjahr 2011 fiel die unkonsolidierte Loan-Deposit ra-tio im Kundengeschäft nur leicht um 0,3%-Punkte auf 110,2%.
Bei volkswirtschaftlich-sektoraler Be-trachtung fällt auf, dass der Zuwachs der Forderungen hauptsächlich auf die beiden Sektoren Nichtfinanzielle Unternehmen (+3,61 Mrd. EUR) und Private Haus-
halte (+3,29 Mrd. EUR) zurückzuführen ist. Der Sektor Staat wies ebenfalls ein Wachstum von 2,78 Mrd. EUR auf, wäh-rend bei den Nichtbanken-Finanzinterme-diären ein Rückgang von 1,21 Mrd. EUR verzeichnet wurde.
Die Entwicklung des Standes der Wert-berichtigungen [4] seit 12/2010 stagnierte bei 15,03 Mrd. EUR. Das Verhältnis der Kundenforderungen zu den Wertberichti-gungen blieb mit 3,3% konstant.
Der Anteil der Top-Ten-Banken an allen Direktkrediten ging gegenüber dem Ultimo 2010 mit 42,9% leicht zurück (12/2010: 43,3%).
Die Primärbanken verzeichneten einen Zuwachs von 3,1% gegenüber dem Ulti-mo des Vorjahres und wiesen einen Stand von 108,86 Mrd. EUR auf.
Bei der Entwicklung der Direktkredite war der Raiffeisensektor mit einem Zu-wachs von 2,93 Mrd. EUR führend. Bis auf die Sonderbanken (–0,06 Mrd. EUR
[4] EWB + WB gem. § 57 Abs. 1 exklusive Pauschal- und Gruppenwertberichtigungen /(Forderungen an Kunden+ (EWB + WB gem. § 57 Abs. 1 exklusive Pauschal- und Gruppen-wertberichtigungen))

Berichte und AnAlysen Österreichs Kreditinstitute im Jahr 2011
ÖBA 4/12 215
Tab. 3: Die wichtigsten Bilanz-Kennzahlen im Überblick (in Prozent)
2011/12 2010/12 2009/12Anteil der Auslandsaktiva an der Bilanzsumme 31,6 32,6 32,8Anteil der Auslandspassiva an der Bilanzsumme 24,8 24,4 24,2Relation der Derivative zur Bilanzsumme 169,7 172,4 221,6Cost-Income-Ratio 60,9 58,6 62,1Relation Nettozinsertrag zu den Betriebserträgen 50,0 46,3 49,1Relation Saldo Provisionsgeschäft zu denBetriebserträgen 19,9 20,0 20,2
bzw. –0,9%) waren bei allen anderen Ban-kensektoren ebenfalls leichte Zunahmen erkennbar.
In allen Bundesländern außer Kärnten (–1,7%) war ein Wachstum ersichtlich: Salzburg (+7,0%), Burgenland (+6,0%), Niederösterreich (+4,4%), Oberöster-reich (+4,2%), Vorarlberg (+3,8%), Tirol (+2,2%), Wien (+1,8%) und Steiermark (+1,5%).
2.3. Verbriefte KrediteDer Stand der titrierten Kredite an in-
ländische Nichtbanken stieg um 0,15 Mrd. EUR (bzw. +0,5%) und wies in Summe ein Volumen von 30,85 Mrd. EUR auf. Die Schuldtitel öffentlicher Stellen kamen auf 16,36 Mrd. EUR (–1,0%), Schuldver-schreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere beliefen sich auf 7,50 Mrd. EUR (+3,3%), verbriefte Forderungen auf 3,68 Mrd. EUR (+4,9%) und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere auf 3,31 Mrd. EUR (–3,0%).
2.4. MittelaufkommenDie Gesamteinlagen aller in Öster-
reich meldepflichtigen Kreditinstitute nahmen gegenüber dem Jahresende 2010 um 2,9% (+8,10 Mrd. EUR) zu. Der Einlagenstand von 289,67 Mrd. EUR verteilte sich zu 54,2% auf Spareinla-gen (157,01 Mrd. EUR), zu 33,5% auf Sichteinlagen (96,90 Mrd. EUR) und zu 12,3% auf Termineinlagen (35,76 Mrd. EUR). Das Volumen der Sichteinlagen nahm kräftig um 7,25 Mrd. EUR zu. Die Spar- und Termineinlagen wiesen leichte Zuwächse im Ausmaß von 0,77 Mrd. EUR bzw. 0,09 Mrd. EUR auf.
Das Einlagenwachstum war sekto-ral mehrheitlich auf Private Haushalte (+3,94 Mrd. EUR) zurückzuführen. Auch die Sektoren Nichtbanken-Finanzinterme-diäre (u.a. Versicherungen und Pensions-kassen, +2,02 Mrd. EUR) und nichtfinan-zielle Unternehmen (+1,54 Mrd. EUR) wiesen Gesamt-Einlagenzuwächse auf.
Allgemein ging der Anteil der Top-Ten-Banken im Bereich der Einlagen leicht von 41,9% auf 41,5% zurück.
Die Einlagenentwicklung der Pri-märbanken (+1,4%) war im Gegensatz
zur Gesamtentwicklung (+2,9%) Ende Dezember 2011 nur halb so stark. Das Volumen der Einlagen, gehalten bei Pri-märbanken, belief sich auf 123,22 Mrd. EUR, hievon waren rund 70% Sparein-lagen. Bis auf die Volksbanken wurden in allen Banksektoren Zuwächse der Gesamteinlagen verzeichnet. Deutlich abheben konnten sich die Sektoren Akti-enbanken (+1,63 Mrd. EUR bzw. +1,9%), Raiffeisenbanken (+3,56 Mrd. EUR bzw. +4,3%) und Sparkassen (+1,43 Mrd. EUR bzw. +2,7%).
Im Bundesland Kärnten (–0,4%) wur-de ein leichter Rückgang verzeichnet, in den restlichen Bundesländern wurden durchgehend Anstiege gemeldet.
Das Volumen der eigenen Inlands-emissionen an Nichtbanken erreichte einen Stand von 112,14 Mrd. EUR und wies einen Rückgang von 3,8% auf.
2.5. AuslandDer Stand der Auslandsforderungen
erhöhte sich im Berichtsjahr 2011 um 0,6% bzw. 1,88 Mrd. EUR und jener der Auslandsverbindlichkeiten um 5,3% bzw. 12,61 Mrd. EUR. Diese Zuwächse gingen hauptsächlich auf das Kundengeschäft zu-rück. Die „Forderungen an ausländische Kunden“ stiegen um 6,07 Mrd. EUR und die „Verbindlichkeiten gegenüber aus-ländischen Kunden“ um 7,50 Mrd. EUR. Beim Interbankgeschäft war ein Anstieg von 4,63 Mrd. EUR (aktivseitig) bzw. 3,19 Mrd. EUR (passivseitig) erkennbar.
Durch die unterschiedlichen Wachs-tumsraten im Berichtsjahr 2011 ver-kleinerte sich die Nettoforderungs- position österreichischer Kreditinstitute gegen das Ausland auf 69,82 Mrd. EUR (–10,73 Mrd. EUR). Ende Dezember 2011 lag der Anteil der Auslandsaktiva (320,88 Mrd. EUR) an der Bilanzsumme bei 31,6% und jener der Auslandspassiva (251,06 Mrd. EUR) bei 24,8%.
Die Top-Ten-Banken im Auslandsge-schäft kamen auf einen Anteil von 65,8% gemessen am Auslandgeschäft, welcher gegenüber 12/2010 (65,4%) leicht an-stieg.
Im Bereich des Auslandsgeschäfts kamen die Primärbanken auf ein Volu-
men von 19,83 Mrd. EUR (–1,5% bzw. –0,30 Mrd. EUR).
Der Anstieg im Auslandsgeschäft war sehr stark von den Zuwächsen im Raiff-eisensektor (+10,6% bzw. +5,91 Mrd. EUR) und Aktienbanksektor (+7,7% bzw. +6,99 Mrd. EUR) geprägt. Deutliche Rückgänge wiesen die Sektoren Sonder-banken (–6,6% bzw. –2,44 Mrd. EUR) und Landes-Hypothekenbanken (–4,8% bzw. –1,90 Mrd. EUR) auf.
Auf regionaler Basis betrachtet war das Wachstum fast komplett auf das Bundes-land Wien zurückzuführen (+4,3% bzw. +8,52 Mrd. EUR).
2.6. Eigenmittel
Die nach den Bestimmungen von Basel II errechneten unkonsolidierten anrechen-baren Eigenmittel betrugen Ende De-zember 2011 91,37 Mrd. EUR, was einen leichten Rückgang um 0,81 Mrd. EUR bzw. 0,9% entsprach. Mit 72,89 Mrd. EUR entfielen rund 80% der Eigenmittel auf das Kernkapital. Die unkonsolidierte Eigenmittelausstattung in Prozent der Bemessungsgrundlage (solvency ratio) betrug 18,5%.
3. Ertragslage der in Österreich tätigen Kreditinstitute
3.1. Betriebsergebnis
Das unkonsolidierte Betriebsergebnis der in Österreich tätigen Kreditinstitute sank zur entsprechenden Vorjahresperio-de auf 7,51 Mrd. EUR (–0,65 Mrd. EUR bzw. –7,9%). Dabei stand einem Zuwachs der Betriebsaufwendungen (+0,17 Mrd. EUR bzw. +1,5%) ein Rückgang der Betriebserträge (–0,47 Mrd. EUR bzw. –2,4%) gegenüber. Auf Ebene der ös-terreichischen Primärbanken ergab sich 2011 ein Betriebsergebnis von 1,76 Mrd. EUR. Gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres stellte das einen Anstieg um 0,01 Mrd. EUR bzw. 0,9% dar.
Die unkonsolidierte Cost-Income-Ratio verschlechterte sich auf 60,9% (+2,3%-Punkte gegenüber der Vergleich-speriode 2010). Im sektoralen Vergleich wiesen die Sparkassen (52,5%) und die Raiffeisenbanken (54,2%) die nied-rigste Relation auf. Danach folgten die Landes-Hypothekenbanken (59,4%), die Aktienbanken (66,3%), die Volksbanken (67,3%), die Bausparkassen (71,7%), die Zweigstellen gem. § 9 BWG (72,1%) und die Sonderbanken (78,0%).
Auf Ebene der Primärbanken ergab sich eine Cost-Income-Ratio von 67,4%. In der gleichen Periode des Jahres 2010 belief sich diese auf 67,2%.

BÖcK / FleischhacKer / simhandl Berichte und AnAlysen
216 ÖBA 4/12
Abb. 7: Betriebsergebnis (Mio EUR)
Abb. 9: Nettoprovisionsertrag (Mio EUR)
Abb. 8: Nettozinsertrag (Mio EUR)
Abb. 10: Erwartetes Ergebnis der gewöhnlichenGeschäftstätigkeit (Mio EUR)
3.2. Betriebserträge und Betriebs-aufwendungen
Die unkonsolidierten Betriebserträge betrugen 19,23 Mrd. EUR und nahmen im Vergleich zum Jahr 2010 um 0,47 Mrd. EUR bzw. 2,4% ab. Bis auf den Netto-zinsertrag (+0,50 Mrd. EUR) waren sämt-liche Komponenten der Betriebserträge rückläufig.
Die unkonsolidierten Betriebsaufwen-dungen der in Österreich tätigen Kredit-institute erhöhten sich um 0,17 Mrd. EUR bzw. 1,5% auf 11,72 Mrd. EUR.
Die österreichischen Primärbanken verzeichneten im Vorjahresvergleich beim Zinsgeschäft (+0,21 Mrd. EUR) und bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (+0,02 Mrd. EUR) Zuwächse. Die Erträ-ge aus Wertpapieren und Beteiligungen sowie das Provisionsgeschäft nahmen ab (–0,14 Mrd. EUR bzw. –0,01 Mrd. EUR). Der Saldo aus dem Finanzgeschäft veränderte sich kaum. In Summe stiegen die unkonsolidierten Betriebserträge um 0,09 Mrd. EUR bzw. 1,6% auf 5,40 Mrd. EUR.
Die Betriebsaufwendungen der Pri-märbanken erhöhten sich im Vorjahres-vergleich nur geringfügig um 0,07 Mrd. EUR bzw. 2,0% auf 3,64 Mrd. EUR.
3.3. Nettozinsertrag
Der Nettozinsertrag wuchs um 0,50 Mrd. EUR bzw. 5,5% auf 9,62 Mrd. EUR an. Dies resultierte aus Zinserträ-gen, die mit +1,33 Mrd. EUR stärker zunahmen als die Zinsaufwendungen (+0,83 Mrd. EUR). Die stärksten Anstiege konnten im Bereich der Erträge aus EUR-Forderungen gegenüber Kunden beobach-tet werden. Bei den Zinsaufwendungen fielen vor allem die Zunahmen bei den Aufwendungen für EUR-Verbindlichkei-ten gegenüber inländischen Kunden, für verbriefte inländische EUR-Verbindlich-keiten und für EUR-Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Kreditinstituten auf. Das Zinsgeschäft stellt die Hauptein-nahmequelle der österreichischen Banken dar. Sein Anteil an den gesamten Betriebs-erträgen belief sich Ende 2011 auf 50,0%.
Sektoral betrachtet war der Anteil des Zinsgeschäfts im Jahr 2011 bei den Bau-sparkassen mit 68,3% am höchsten. Eben-falls bedeutender als bei den in Österreich tätigen Kreditinstituten insgesamt war der Nettozinsertrag bei den Landes-Hy-pothekenbanken (66,7%), Volksbanken (60,8%) und Aktienbanken (57,2%). Ge-ringeren Anteil an den gesamten Betriebs-erträgen hatte dieser Geschäftsbereich bei den Sparkassen (48,4%), Raiffeisenban-
ken (47,0%), Zweigstellen gem. § 9 BWG (33,9%) und Sonderbanken (20,0%).
Der Total Spread [5] erhöhte sich geringfügig. Gegenüber der Vergleichs-periode 2010 nahm diese Kennzahl um 0,09%-Punkte zu und belief sich Ende 2011 auf rund 1,00%.
3.4. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen
Absolut betrachtet sanken mit 0,36 Mrd. EUR (–9,0%) die Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen am stärksten von allen Bestandteilen der Betriebserträge. Deutlichen Anteil daran hatte der Rückgang der Erträge aus EUR-Anteilen an verbundenen inländischen Unternehmen (–0,27 Mrd. EUR)
3.5. Saldo aus dem Provisions-geschäft
Der Saldo aus dem Provisionsgeschäft sank um 0,12 Mrd. EUR bzw. 2,9%. Im Detail betrachtet fiel hier vor allem die Entwicklung des Wertpapierprovisions-geschäfts (–0,13 Mrd. EUR) auf.
3.6. Saldo aus FinanzgeschäftenBeim Saldo aus den Finanzgeschäf-
ten konnte die zweitgrößte Abnahme beobachtet werden (–0,34 Mrd. EUR
[5] Im Rahmen der Total Spread Be-rechnung werden sämtliche verzinste Aktiva mit den verzinsten Passiva verglichen. Die daraus resultierende Zinsspanne wird um
den „Endowment Effekt“ korrigiert (d.h. es werden unterschiedlich große Volumina auf der Aktiv- und Passivseite in der Berechnung berücksichtigt). Es ist darauf hinzuweisen, dass
bei dieser Methode die unterschiedlichen Lauf-zeitstrukturen auf der Aktiv- und Passivseite keine Berücksichtigung finden.

Berichte und AnAlysen Österreichs Kreditinstitute im Jahr 2011
ÖBA 4/12 217
2
Abb. 12: Cost-Income-Ratio (Mio EUR)
Abb. 13: Relation Nettozinsertrag zu den Betriebserträgen (Mio EUR)
2
Abb. 14: Relation Saldo Provisionsgeschäft zu den Betriebs-erträgen (Mio EUR)
2
Die Struktur der Betriebserträge
Abb. 11: Die Struktur der Betriebserträge
bzw. –51,0%). Der Rückgang fiel bei den Wertpapierfinanzgeschäften am stärksten aus (–0,29 Mrd. EUR).
3.7. Sonstige betriebliche ErträgeDie sonstigen betrieblichen Erträge
sanken um 0,16 Mrd. EUR bzw. 8,0% auf 1,79 Mrd. EUR. Diese Position setzt sich unter anderem aus internen Konzern-verrechnungen sowie Leasinggeschäften zusammen.
3.8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
Die unkonsolidierten Betriebsaufwen-dungen der in Österreich tätigen Kredit-institute erhöhten sich um 0,17 Mrd. EUR bzw. 1,5% auf 11,72 Mrd. EUR. Dieser Anstieg resultierte aus dem Anstieg der allgemeinen Verwaltungsaufwendungen (+0,29 Mrd. EUR bzw. +3,0%). Der Personalaufwand wuchs hierbei stärker (+0,20 Mrd. EUR) als der Sachaufwand (+0,09 Mrd. EUR).
3.9. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Bei den Abschreibungen auf Sachan-lagen und immaterielle Vermögensge-genstände konnte im Vorjahresvergleich
ein leichter Rückgang um 0,05 Mrd. EUR bzw. 8,1% auf 0,51 Mrd. EUR beobachtet werden. Hier war es auch in den Ver-gleichszeiträumen der Jahre davor immer zu geringfügigen Abnahmen gekommen.
3.10. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwen-dungen verringerten sich auf 1,18 Mrd. EUR (–0,07 Mrd. EUR bzw. –5,8%).
3.11. Erwartetes Jahres-Betriebsergebnis [6]
Die in Österreich tätigen Kredit- institute erwarten, dass sich das Jahres-Betriebsergebnis 2011 auf 7,42 Mrd. EUR belaufen wird, was im Vergleich zum Gesamtjahr 2010 einen Rückgang um 0,74 Mrd. EUR bzw. 9,0% darstellt. Der Wertberichtigungs- und Rückstellungsbe-darf steigt laut Prognosen um 2,38 Mrd. EUR bzw. 71,6% auf 5,70 Mrd. EUR an. Die in Österreich tätigen Kredit-institute gehen davon aus, dass sich der unkonsolidierte Jahresüberschuss 2011 auf 1,21 Mrd. EUR belaufen wird. Das bedeutet gegenüber dem Gesamtjahres-wert 2010 einen Rückgang um 3,00 Mrd. EUR bzw. 71,3%. Zusätzlich zu den oben erwähnten Entwicklungen wirkt sich hier
auch die Erhöhung der erwarteten sonsti-gen Steuern um 0,50 Mrd. EUR aus.
Auf Ebene der Primärbanken wird für das Gesamtjahr 2011 von einem Anstieg der Wertberichtigungen und Rückstel-lungen von 0,77 Mrd. EUR per Ultimo 2010 auf 0,93 Mrd. EUR ausgegangen. Somit ergibt sich unter Berücksichtigung des außerordentlichen Geschäfts und der Steuern ein erwarteter Jahresüberschuss von 0,58 Mrd. EUR (–0,11 Mrd. EUR). ◆
[6] Die Zahlen, die in diesem Teil behan-delt werden, stellen Prognosen betreffend die von den Wirtschaftsprüfern geprüften Jahres-abschlusszahlen dar.

Gauper / Mestel / palan AbhAndlungen
218 ÖBA 4/12
Andrea Ruth Gauper / Roland Mestel / Stefan Palan
Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 wurde die Systematik der Besteue-rung von Kapitalvermögen inklusive Substanzgewinnen in Österreich gänzlich neu geregelt. Dies betrifft auch die steuerliche Behandlung von Investmentfonds, während Versicherungsverträge von der Ver-mögenszuwachsbesteuerung ge-nerell ausgenommen bleiben, da diese bestimmte Risiken abdecken und daher keine Einkunftsquelle darstellen. Gerade fondsgebunde-ne Lebensversicherungen können durch diese steuerliche Besser-stellung für langfristig orientierte Investoren eine interessante Alter-native zu einer Direktveranlagung in Fondsanteilscheine darstellen. Die vorliegende Studie vergleicht daher die Performance von Fondsdirektin-vestments mit der von Investments in fondsgebundene Lebensver-sicherungen im Lichte der neuen steuerlichen Rahmenbedingungen und zeichnet ein nuanciertes Bild der Vor- und Nachteile verschiede-ner Veranlagungsstrategien.
Stichwörter: Fondsgebundene Lebensversiche-rung, Vermögenszuwachssteuer, Investment-fonds.
JEL-Classification: G 11, G 22, G 23, K 34.
The Budgetbegleitgesetz 2011 fun-damentally reformed the tax rules regarding capital gains in Austria. This applies among others to the tax treatment of investment funds. At the same time, insurance contracts are generally exempt from this new taxation, since they are considered to cover specific risks and are not taken to be a source of income. Fund-linked insurance contracts in particular profit from this preferred tax treatment and can constitute an interesting alternati-ve to a direct investment in an invest-ment fund. For this reason, the pre-sent study compares the performance
ergleichende Analyse von Fondsdirekt- investments mit fondsgebundenen Lebens- versicherungen
Mag. Andrea Ruth Gauper, Institut für Unternehmensrechnung und Steuerlehre, Karl-Franzens-Univer-sität Graz;e-mail: [email protected]
Phot
o: C
hris
toph
Ste
inba
uer
V
Ao. Univ.-Prof. Dr. Roland Mestel, Institut für Banken und Finan-zierung, Karl-Franzens-Universität Graz;e-mail: [email protected]
Phot
o: F
urgl
er
Ass.-Prof. Dr. Stefan Palan, Institut für Banken und Finanzierung, Karl-Franzens-Universität Graz;e-mail: [email protected]
Phot
o: C
hris
toph
Ste
inba
uer
of direct investments into investment funds to that in fund-linked life insu-rance products in light of the new tax regulation. It paints a nuanced picture of the advantages and disadvantages of various investment strategies.
1. Einleitung
Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 (BBG 2011) wurde die Besteuerung von Kapitalvermögen in Österreich aus-geweitet. Die wesentlichste Neuerung stellt dabei zweifelsohne die Einführung einer Vermögenszuwachssteuer dar, durch die von natürlichen Personen realisierte Wertsteigerungen aus der Veräußerung von Kapitalvermögen nunmehr mit 25% besteuert werden. Die Steuer ist dabei direkt von der inländischen depotfüh-renden oder auszahlenden Stelle einzu-behalten und an den Fiskus abzuführen. Der ursprünglich geplante Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vermögenszuwachsbe-steuerung (1.10.2011) wurde indes infolge des Antrages von zahlreichen Kredit- instituten vom VfGH als verfassungswid-rig erkannt. Mit dem Abgabenänderungs-gesetz 2011 (AbgÄG 2011) wurde so das Inkrafttreten auf 1.4.2012 verschoben.
Im Zusammenhang mit diesem Para-digmenwechsel in der steuerlichen Be-handlung von Kapitalvermögen wurde auch die Besteuerung von Kapitalerträgen und Substanzgewinnen im Investment-
fondsgesetz neu geregelt. Die Details zur Besteuerung von Investmentfonds sind auch weiterhin im Investmentfond-gesetz (InvFG 2011) geregelt, welches in der aktuellen Fassung mit 1.9.2011 in Kraft getreten ist. Dabei trat der § 40 f
Wir danken Mag. Hannes Dolzer, der die Daten zur Verfügung stellte.

AbhAndlungen perforManceverGleich fonds vs. flv
ÖBA 4/12 219
KESt-Abzug erfolgte dabei direkt durch die depotführende Bank. Somit waren im Fonds erzielte allfällige Substanzgewinne aus Anleihen sowie 80% der Substanzge-winne aus Aktien steuerfrei. Neben dieser Ermittlung der Steuerlast auf Fondsebene war der Verkauf von Anteilscheinen nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei.
Durch die Neuordnung der Besteu-erung von Kapitalvermögen erfolgt die Ermittlung der Steuerlast des Investors nunmehr in jedem Fall auf zwei Ebenen: Einerseits wie gehabt auf Fondsebene (Ausschüttungen bzw. ausschüttungs-gleiche Erträge), sowie andererseits auf Anteilscheinebene (Kursgewinne bei Veräußerung) [4]. Zur Vermeidung ei-ner Doppel- wie auch Nichtbesteuerung von Fondsertragsbestandteilen bestehen zwischen diesen beiden Ebenen jedoch unmittelbar enge Beziehungen, die in der Folge dargestellt werden.
2.1. Steuerermittlung auf Fonds-ebene
Im Hinblick auf die Besteuerung der vom Fonds erwirtschafteten ordentlichen Erträge (Erträge aus der Überlassung von Kapital, vor allem Zinsen und Di-videnden) hat sich die Rechtslage nicht verändert. Diese fließen – nach Abzug der Aufwendungen – zu 100% in die Be-messungsgrundlage ein [5]. Hinsichtlich der realisierten Wertsteigerungen aus Kapitalvermögen (vormals Substanzge-winne) und den Erträgen aus damit in Beziehung stehenden Derivaten wird die Bemessungsgrundlage bis 2014 sukzes-sive auf 60% angehoben [6]. Darüber hinaus werden für Fondsgeschäftsjahre, die nach dem 31.12.2012 beginnen, auch außerordentliche Erträge aus Anleihen und Anleihenderivaten in die Bemes-sungsgrundlage einbezogen. Eine Mel-dung der ausschüttungsgleichen Erträge des Fonds an die Oesterreichische Kon-trollbank AG muss ab dem 1.4.2012 nur noch einmal pro Geschäftsjahr erfolgen [7].
Im Gegenzug zur Erweiterung der Steuerbemessungsgrundlage wurden die Möglichkeiten der Verlustverrechnung im Fonds ausgeweitet. Konnten bislang Substanzverluste nur mit entsprechen-den Substanzgewinnen gegenverrechnet werden, ist zukünftig auch ein Ausgleich eines negativen Saldos aus realisierten
In der wissenschaftlichen Literatur wurde die skizzierte Fragestellung bis dato nicht behandelt. Der vorliegende Beitrag schließt diese Lücke durch eine Gegenüberstellung der beiden Veranla-gungsvarianten Fondsdirektinvestment und fondsgebundene Lebensversicherung unter Verwendung beispielhafter Daten. Dabei wird ausschließlich auf natür-liche Personen fokussiert, die Anteile an thesaurierenden Fonds im Privatver-mögen halten bzw. eine Fondspolizze abschließen. Ziel der Ausführungen ist ein Vergleich der Auszahlungsbeträge aus den beiden Veranlagungsvarianten zu Laufzeitende, in unterschiedlichen Szenarien, unter Berücksichtigung aller steuerlichen und Kostenkomponenten. Zu diesem Zweck untergliedert sich die Ar-beit in folgende Kapitel: Kapitel 2 führt in die steuerliche Behandlung inländischer Investmentfonds ein, wobei insbesondere auf die Steuerermittlung auf Fondsebene einerseits und jene auf Anteilscheinebene andererseits eingegangen wird. Kapitel 3 beschreibt das Produkt Fondsgebundene Lebensversicherung. In Kapitel 4 wird in weiterer Folge das Rechenmodell vorge-stellt, anhand dessen Fondsdirektinvest-ment und Lebensversicherungsinvestment mit einander verglichen werden. Kapitel 5 beinhaltet schließlich die Ergebnisse der Modellrechnungen und Kapitel 6 schließt.
2. Steuerliche Behandlung inländischer Investmentfonds
Der Investmentfonds selbst gilt nicht als Steuersubjekt. Besteuert werden da-her, gemäß dem Transparenzprinzip, nur die Anteilseigner, wobei die Fonds-buchhaltung jedoch die entsprechenden steuerpflichtigen Erträge zu ermitteln verpflichtet ist und der Fonds die darauf anfallende KESt auszuschütten hat. Im Gegensatz zu Direktanlagen wurden bei Investmentfonds schon bislang Teile der im Fonds erzielten Substanzgewinne – darunter versteht man durch den Verkauf erzielte Kursgewinne – aus Aktientiteln von der Gesetzgebung als Spekulations-erträge angesehen und mit KESt belegt. Als Bemessungsgrundlage wurden dabei 20% der entsprechenden außerordent-lichen Erträge des Fonds herangezogen und die Besteuerung erfolgte unabhängig von der Behaltedauer der Aktientitel im Fonds [3]. Der endbesteuerungswirksame
InvFG 1993 idF BBG 2011 gar nicht mehr in Kraft, sondern wurde direkt von den Regelungen des InvFG 2011 (§ 186 f) ersetzt. Zukünftig werden demnach auch realisierte Vermögenszuwächse bei An-teilscheinen von Investmentfonds der Kapitalertragsteuer (KESt) unterworfen.
Von dieser generellen Ausweitung der steuerlichen Bemessungsgrundlage bei Kapitalvermögen unmittelbar profitiert haben auf den Er- oder Er- und Ablebens-fall abgeschlossene Kapitalversicherun-gen einschließlich fondsgebundener Le-bensversicherungen. Weil diese ein Risiko versichern, gelten Unterschiedsbeträge zwischen der eingezahlten Versicherungs-prämie und der Versicherungsleistung nicht als Einkünfte aus der Überlassung von Kapital, weshalb die Vermögens-zuwachsbesteuerung bei Versicherungs-produkten nicht greift. Auch während der Laufzeit fallen weder KESt noch Einkommensteuer (ESt) an. Allerdings präzisiert die Gesetzgebung [1], dass die Ausnahme derartiger Versicherungs-verträge von der Steuerpflicht erlischt, wenn die Versicherung einen Einmalerlag vorsieht und die Versicherungslaufzeit weniger als 15 Jahre beträgt (für vor dem 1.1.2011 abgeschlossene Verträge beträgt diese Mindestlaufzeit 10 Jahre). In diesem Fall muss ein realisierter Kursgewinn vom Versicherungsnehmer im Wege der individuellen Veranlagung berücksichtigt werden [2].
Diese steuerlich unterschiedliche Be-handlung rückt unmittelbar die Frage in den Vordergrund, ob für langfristig orientierte Investoren eine Direktver-anlagung in Investmentfonds oder aber der Abschluss einer fondsgebundenen Lebensversicherung vorteilhaft ist. Bei Erfüllung oben genannter Kriterien er-scheint auf den ersten Blick eine Fonds-polizze die vorteilhafte Investitionsstra-tegie zu sein. Eine finale Beantwortung dieser Frage ist jedoch weder trivial noch eindeutig. Neben einem Vergleich der diesbezüglich relevanten steuerlichen Aspekte müssen nämlich vor allem auch die unterschiedlichen Kostenstruktu-ren von Fondsdirektveranlagungen und fondsgebundenen Lebensversicherungen berücksichtigt werden. Hier wird – vor allem seitens des Konsumentenschutzes – seit Jahren auf die hohen Versiche-rungskosten, insbesondere bei Vertragsab-schluss, hingewiesen (siehe Maier (2011), o.V. (2006), o.V. (2011a)).
[1] § 27 Abs 1 Z 6 EStG i.d.a.F. bzw. § 27 Abs 5 Z 3 EStG i.d.n.F.
[2] Vgl. Marschner (2011b).[3] § 43 InvFG i.d.a.F.[4] Vgl. Marschner (2011c) und § 186
Abs 2 Z 2 InvFG.[5] § 186 Abs 1 und 2 InvFG 2011.
[6] §§ 198 und 200 InvFG. Für Geschäfts-jahre, die nach dem 30.6.2011 beginnen, erhöht sich die Bemessungsgrundlage der steuerlich relevanten außerordentlichen Erträge von 20% auf 30%. Beginnt das Geschäftsjahr nach dem 31.12.2011, beläuft sich dieser Prozentsatz auf 40%. 50% aller realisierten außerordent-
lichen Erträge fließen in die Bemessungs-grundlage ein, wenn das Geschäftsjahr nach dem 31.12.2012 beginnt, bis schließlich für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2013 anfangen, der Zielwert von 60% erreicht ist.
[7] Vgl. Marschner (2011a).

Gauper / Mestel / palan AbhAndlungen
220 ÖBA 4/12
(= EUR 1,20) zusammen. Die KESt be-trägt somit EUR 0,80 und wird vom Fonds an die depotführende Bank ausbezahlt, die sie wiederum für den Investor an den Fiskus abführt.
Gleichzeitig meldet der steuerliche Vertreter des Fonds die Höhe und Be-messung der Kapitalertragsteuer, die Auf-gliederung der Zusammensetzung der Ausschüttungen und der ausschüttungs-gleichen Erträge sowie die notwendigen Änderungen der Anschaffungskosten an die Oesterreichische Kontrollbank [14]. Daraus ermittelt die depotführende Bank die adaptierten Anschaffungskosten in Höhe von EUR 102,40 (= 100 + 3,20 – 0,80). Diese fortgeführten Anschaffungs-kosten sind in weiterer Folge relevant für die Kursgewinnbesteuerung bei Veräu-ßerung des Anteilscheines. Diese beläuft sich auf EUR 1,90 und berechnet sich aus: (110 – 102,40) x 25%. Die Steuerge-samtbelastung beläuft sich demnach auf EUR 2,70, was 25% der gesamten Wert-steigerung von EUR 10,80 entspricht.
2.4. Ermittlung der steuerrelevan-ten Fondserträge und des Verlust-vortrages auf Fondsebene
Wie in Kapitel 2.1. ausgeführt, sind für die Ermittlung der Steuerbemes-sungsgrundlage auf Fondsebene eine Differenzierung zwischen den ordent-lichen und außerordentlichen Erträgen sowie die Frage des Verlustausgleiches wie -vortrages essentiell. Weil der in weiterer Folge vorgenommene Vergleich zwischen fondsgebundener Lebensver-sicherung und Fondsdirektinvestment zentral an der unterschiedlichen steuer-lichen Behandlung der beiden Veranla-gungsvarianten ansetzt, erfolgt an dieser Stelle eine ausführliche Diskussion dieser Punkte. Für die nachstehend behandelten Fallunterscheidungen werden folgende Symbole verwendet:Ot Ordentliche Erträge in Periode t
nach Abzug der diesen unmittelbar zuzurechnenden Aufwendungen;
Ots In die Steuerermittlung einfließender
Wert der ordentlichen Erträge in Periode t;
AOt Außerordentliche Erträge in Perio-de t nach Abzug der diesen unmittel-bar zuzurechnenden Aufwendungen;
AOts In die Steuerermittlung einfließender
Wert der außerordentlichen Erträge in Periode t (vor Multiplikation mit dem Faktor für den steuerpflichtigen Anteil);
hang zwischen der laufenden Besteuerung der Kapitalerträge einerseits und der Veräußerungsgewinnbesteuerung ande-rerseits wider. Dieses Vorgehen verhindert eine Doppel- wie auch Nichtbesteuerung von Fondserträgen. Dabei bewirken auf Fondsebene bereits versteuerte ausschüt-tungsgleiche Erträge eine Erhöhung, steuerfreie tatsächliche Ausschüttungen aus bereits versteuerten ausschüttungs-gleichen Erträge sowie Einlagenrückzah-lungen eine Reduktion der fortgeführten Anschaffungskosten. Die steuerliche Be-günstigung von Substanzgewinnen wur-de somit fast gänzlich aufgehoben. Es verbleibt nur noch eine Steuerstundung bis zum Veräußerungszeitpunkt für jene Teile der ausschüttungsgleichen Erträge, die nicht unmittelbar zum Zeitpunkt ihres Anfalles der Besteuerung unterliegen.
Entsteht im Privatvermögen bei Ver-kauf eines Fondsanteils durch Abzug der fortgeführten Anschaffungskosten vom Veräußerungserlös ein realisierter Wertverlust, kann ein isolierter Verlust-ausgleich innerhalb der Einkünfte aus Kapitalvermögen vorgenommen werden. Es ist keine Verrechnung mit Zinserträgen aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten und es ist kein Ausgleich eines negativen Sal-dos aus Einkünften aus Kapitalvermögen mit positiven Saldi aus anderen Einkunfts-arten (vertikales Verlustausgleichsverbot) möglich [12]. Ein verbleibender positiver Saldo wird dem besonderen Steuersatz gem. § 27a Abs 1 EStG unterworfen.
2.3. BeispielNachstehendes simplifiziertes Beispiel
dient der Veranschaulichung der Besteue-rung von laufenden Investmentfondserträ-gen und der Besteuerung bei Veräußerung der Anteilscheine [13]. Es wird angenom-men, dass ein Investor am 1.12.2011 einen Anteilschein an einem thesaurierenden Fonds zu einem Preis von EUR 100 (nach Abzug des Ausgabeaufschlags, der als Teil der Anschaffungsnebenkosten ange-sehen wird) erwirbt. Das Geschäftsjahr dieses Fonds endet am 30.6.2012. Am 30.9.2012 veräußert der Investor den An-teilschein zu einem Preis von EUR 110. In den 10 Monaten Behaltedauer erzielt der Fonds ordentliche Erträge in Höhe von EUR 2 sowie außerordentliche Erträge in Höhe von EUR 4.
Die ausschüttungsgleichen Erträge des Fonds belaufen sich im Betrachtungs-zeitraum auf EUR 3,20; sie setzen sich aus den ordentlichen Erträgen und einem Teil (30%) der außerordentlichen Erträge
Wertsteigerungen und Derivaten nach Abzug der diesen zuzurechnenden Auf-wendungen mit den ordentlichen Erträgen des Fonds möglich. Ist ein derartiger Ausgleich nicht zur Gänze möglich, weil ein Verlust verbleibt, kann dieser in das Folgejahr vorgetragen werden. Eine Ver-rechnung muss dabei vorrangig mit Erträ-gen aus realisierten Wertsteigerungen und Derivaten erfolgen. Diese Reihenfolge ist insofern einzuhalten, als Wertsteigerun-gen aus Kapitalvermögen und Derivaten im Jahr ihres Anfalls nur zum Teil in die Bemessungsgrundlage einfließen. Ein Verlustvortrag kann nur auf Ebene des Fonds erfolgen, da Verluste aus Speku-lationsgeschäften [8] bzw. Verluste aus Einkünften aus Kapitalvermögen [9] nicht mit anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden können und auch der Verlustvor-trag untersagt ist. In den veröffentlichten Werten ist daher ein Ausgleich bereits erfolgt. Auch diese erweiterte Verlustver-rechnung inkl. Verlustvortrag auf Fonds-ebene kann erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2012 beginnen, zur Anwendung gelangen.
Eine detaillierte Analyse hinsichtlich der Ermittlung der steuerpflichtigen Fondserträge wie auch des Verlustvortra-ges erfolgt in Kapitel 2.4.
2.2. Steuerermittlung auf Anteilscheinebene
Die auf vor dem 1.1.2011 angeschaffte Investmentfonds anwendbare Rechtsla-ge sieht eine Besteuerung auf Anteil-scheinebene nur im Zusammenhang mit der Haltedauer vor, wobei nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist eine Veräußerung der Fondsanteile steuerfrei bleibt. Diese Frist wurde für Anschaffun-gen nach dem 1.1.2011 gestrichen. Für Anschaffungen zwischen dem 1.1.2011 und dem 1.4.2012 gilt die verlängerte Spekulationsfrist [10]. Danach gilt die neue Vermögenszuwachsbesteuerung und es muss stattdessen von der depotfüh-renden Stelle der Wertzuwachs des An-teilscheines zum Veräußerungszeitpunkt ermittelt werden, auf den dann die KESt zu entrichten ist [11]. Dieser Wertzuwachs entspricht der Differenz aus dem erzielten Veräußerungserlös und den fortgeführten Anschaffungskosten. Letztere ergeben sich dabei aus den ursprünglichen An-schaffungskosten (excl. Anschaffungs- nebenkosten), adaptiert um die während der Haltedauer des Fonds bereits besteuer-ten ausschüttungsgleichen Erträge. Hierin spiegelt sich der unmittelbare Zusammen-
[8] § 30 Abs 4 letzter Satz EStG vor BBG 2011.
[9] § 27 Abs 8 EStG und 97 Abs 2 EStG nach BBG 2011.
[10] Es ist immer der § 30 EStG i.d.F. vor BBG 2011 anzuwenden.
[11] § 186 Abs 3 InvFG 2011.[12] § 27 Abs 8 EStG nach BBG 2011.
[13] Dieses Beispiel lehnt sich an o.V. (2011b) an.
[14] § 186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011 bzw. § 12 KMG.

AbhAndlungen perforManceverGleich fonds vs. flv
ÖBA 4/12 221
Kt Allgemeine Kosten in Periode t (zB Verwaltungskosten); diese sind zu-nächst von den ordentlichen Erträ-gen Ot und im Fall, dass sie diese übersteigen (Aufwandsüberhang), danach von den außerordentlichen Erträgen AOt in Abzug zu bringen;
VVt Verlustvortrag aus Periode t.In der Folge werden die interessie-
renden Größen für verschiedene Da-tenkonstellationen ermittelt, wobei die Abschnittsüberschriften die jeweilige Fallunterscheidung enthalten.
2.4.1. Positiver ordentlicher Ertrag: Ot > Kt
2.4.1.1. Positiver außerordentlicher Ertrag: AOt > 0
Im Falle eines positiven ordentlichen wie außerordentlichen Ertrages muss für die Ermittlung der steuerlichen Bemes-sungsgrundlage noch ein allfälliger Ver-lustvortrag VVt–1 berücksichtigt werden. Dieser ist – wie angeführt – zunächst mit dem Überschuss aus den außerordent-lichen Erträgen zu verrechnen.
Fall 1: VVt–1 < AOtIn diesem Fall ergeben sich die ge-
suchten Größen als: AOts = AOt – VVt–1;
Ots = Ot – Kt; und VVt = 0.Fall 2a: VVt–1 ≥ AOt und VVt–1 > AOt
+ (Ot – Kt)In diesem Fall sind sowohl der steu-
erpflichtige ordentliche wie auch der außerordentliche Ertrag gleich 0. Der Verlustvortrag beträgt: VVt = VVt–1 – (Ot – Kt) – AOt.
Fall 2b: VVt–1 ≥ AOt und VVt–1 ≤ AOt + (Ot – Kt)
In dieser Datenkonstellation gilt: AOt
s = 0; Ots = (Ot – Kt) – (VVt–1 – AOt);
VVt = 0.
2.4.1.2. Nicht-positiver außerordentlicher Ertrag: AOt ≤ 0
Für den Fall eines positiven ordent-lichen, jedoch nicht-positiven außeror-dentlichen Fondsertrages gilt es zu un-terscheiden, ob der Absolutbetrag des Substanzverlustes kleiner oder größer als der ordentliche Ertrag ist.
Fall 1a: |AOt| < (Ot – Kt) und VVt–1 > (Ot – Kt) – |AOt|
In diesem Fall sind sowohl der steu-erpflichtige ordentliche wie auch außer-ordentliche Ertrag gleich 0. Der Verlust-vortrag beträgt: VVt = VVt–1 – (Ot – Kt) + |AOt|.
Fall 1b: |AOt| < (Ot – Kt) und VVt–1 ≤ (Ot – Kt) – |AOt|
Hier ist der steuerpflichtige außeror-dentliche Ertrag 0. Für den steuerpflich-tigen ordentlichen Ertrag gilt: Ot
s = (Ot – Kt) – |AOt| – VVt–1. Der Verlustvortrag ist schließlich 0.
◆ im Falle des Erlebens oder des Rück-kaufs einer auf den Er- oder Er- und Ablebensfall abgeschlossenen Kapi-talversicherung (inkl. fondsgebunde-ner Lebensversicherung),
◆ im Falle der Kapitalabfindung oder des Rückkaufs einer Rentenversiche-rung, bei der der Beginn der Renten-zahlung vor Ablauf von 15 Jahren ab Vertragsabschluss vereinbart ist,
ausgezahlt wird [15].Ist keiner der aufgelisteten Sachver-
halte zutreffend, so erfährt eine fondsge-bundene Lebensversicherung lediglich dahingehend eine Besteuerung, dass die einbezahlte(n) Prämie(n) mit 4% Ver-sicherungssteuer belastet werden (an-dernfalls beträgt die Versicherungssteuer 11%).
Vor dem Hintergrund dieser bevor-rechteten steuerlichen Stellung ergibt sich die Überlegung, Direktfondsinvestments mit fondsgebundenen Lebensversiche-rungen zu vergleichen. Hierbei müssen jedoch neben den Unterschieden in der steuerlichen Behandlung auch die jewei-ligen Kostenstrukturen Berücksichtigung finden.
4. Das Rechenmodell
Das in diesem Abschnitt vorgestellte Rechenmodell vergleicht ein Direktin-vestment in Investmentfonds mit ei-ner vergleichbaren Veranlagung in eine fondsgebundene Lebensversicherung. Es bedient sich dazu einer Struktur, die die Bandbreite der untersuchbaren Szenarien deutlich erweitert: Der Investor kann ein Portefeuille aus zwei Investmentsfonds bilden, beziehungsweise eine Versiche-rung wählen, die in zwei Investment-fonds veranlagt. Durch diese Modellie-rung können Umschichtungen zwischen verschiedenen Investmentsfonds mit allen damit einhergehenden Auswirkungen hin-sichtlich Transaktionskosten und Steuern analysiert werden [16].
Um die Vergleichbarkeit der beiden Investitionsalternativen Fondsdirektin-vestment und Fondsgebundene Lebens-versicherung sicherzustellen, werden die in Tabelle 1 dargestellten Szenarien für beide Varianten gegenübergestellt. Die Einzahlungen erfolgen dabei jeweils zu Jahresbeginn.
4.1. FondsdirektinvestmentBeim Fondsdirektinvestment hat der
Investor die Wahl zwischen zwei Invest-
Fall 2: |AOt| ≥ (Ot – Kt)In diesem Fall ermitteln sich die inte-
ressierenden Größen ident wie in Fall 1a.
2.4.2. Aufwandsüberhang; Kosten kleiner als Gesamtertrag: Ot < Kt < Ot + AOt
2.4.2.1. Gesamtertrag übersteigt Verlustvortrag: AOt + (Ot – Kt) > VVt–1
In dieser Datenkonstellation entspricht der steuerpflichtige außerordentliche Er-trag dem Ausdruck: AOt
s = AOt + (Ot – Kt) – VVt–1. Die beiden übrigen interes-sierenden Größen sind jeweils 0.
2.4.2.2. Gesamtertrag übersteigt Verlustvortrag nicht: AOt + (Ot – Kt) ≤ VVt–1
Hier sind sowohl Ots als auch AOt
s gleich 0 und der Verlustvortrag beträgt: VVt = VVt–1 – (Ot – Kt) – AOt.
2.4.3. Aufwandsüberhang; Kosten größer als Gesamtertrag: Ot + AOt < Kt
2.4.3.1. Positiver außerordentlicher Ertrag: AOt > 0
Auch in diesem Fall sind der steuer-pflichtige ordentliche wie außerordent-liche Ertrag gleich 0 und der Verlustvor-trag der Vorperiode wird unverändert fortgeschrieben: VVt = VVt–1.
2.4.3.2. Nicht-positiver außerordentli-cher Ertrag: AOt ≤ 0
Diese Datenkonstellation entspricht hinsichtlich der interessierenden Größen den in 2.4.3.1. ausgewiesenen Ergeb- nissen, der Verlustvortrag erhöht sich jedoch noch um das außerordentliche Ergebnis: VVt = VVt–1 + |AOt|.
3. Fondsgebundene Lebens-versicherungen
Lebensversicherungen haben durch die Neuordnung der Besteuerung von Kapitalvermögen unmittelbar an Attrak- tivität gewonnen. Der Grund liegt da-rin, dass Versicherungsverträge von der Vermögenszuwachssteuer generell ausgenommen sind und somit Erträge steuerfrei vereinnahmt werden können. Auch während der Versicherungslaufzeit fällt keine Kapitalertragssteuer an. Dem progressiven Steuertarif unterliegt der Unterschiedsbetrag zwischen einbezahlter Versicherungsprämie und der Versiche-rungsleistung, wenn im Versicherungs-vertag keine laufenden Prämienzahlungen vereinbart wurden und die Behaltedauer des Versicherungsvertrages weniger als 15 Jahre beträgt sowie der Unterschieds-betrag
[15] § 27 Abs. 5 Z 3 EStG nach BBG 2011.[16] Wir danken Mag. Heinz Tanner für
diese Anregung.

Gauper / Mestel / palan AbhAndlungen
222 ÖBA 4/12
Rahmen der Einkommensteuererklärung möglich wäre, wird nicht modelliert.
4.2. Lebensversicherungs- investment
Die Modellierung der Wertentwick-lung eines Investments in eine Lebens-versicherung basiert zu weiten Teilen auf jener des Fondsdirektinvestments. Insbesondere wird von der Prämisse aus-gegangen, dass die Lebensversicherung ihrerseits ausschließlich in die beiden modellierten Investmentfonds investiert. Die Differenzen zwischen den beiden Ver-anlagungsvarianten entstehen einerseits aus den unterschiedlichen Kostenstruk-turen bei Fondsdirekt- und Lebensver- sicherungsinvestment und andererseits aus den in Abschnitt 2. beschriebenen Unterschieden in der steuerlichen Be-handlung.
Die berücksichtigten Kosten stammen aus Angeboten einer großen österreichi-schen Versicherungsgesellschaft [17]. Die Angebote wurden für einen 35jährigen Mann eingeholt, wobei der kleinstmög-liche Versicherungsschutz gewählt wurde, um die weitgehende Vergleichbarkeit zum Fondsinvestment sicherzustellen. Zur Er-mittlung der in Abschnitt 5. präsentier-ten Ergebnisse bei einer angenommenen Nettofondsperformance von 0%/3%/6% wurden dabei die aus dem Angebot ermittelbaren Kostenkomponenten bei eben diesen angenommenen Fondsrendi-ten – getrennt nach Einmal- und laufender Einzahlung – herangezogen. Um die Ab-schlusskosten bei Versicherungsbeginn von den laufenden Kosten des ersten Jahres trennen zu können wurde eine
mentfonds, deren jeweilige Gewichtung in jeder Periode frei gewählt werden kann (Leerverkäufe sind ausgeschlossen). Als Startwert einer Periode wird der Bestand im jeweiligen Fonds um die anteilige Prämieneinzahlung sowie eventuell vom jeweils anderen Fonds umgeschichtete Beträge erhöht. Ferner wird der Bestand um Beträge, die aus dem Fonds in den jeweils anderen umgeschichtet werden, verringert. Sowohl Einzahlungen als auch Umschichtungen werden bei Fonds- investments mit dem Ausgabeaufschlag jenes Fonds, in den diese erfolgen, belegt. Zusätzlich werden bei Umschichtungen von einem in den anderen Fonds die umgeschichteten Beträge mit der Ver-äußerungsgewinnsteuer belastet.
Innerhalb der Fonds wird die in Kapitel 2. beschriebene steuerliche Behandlung von ordentlichen Erträgen und realisierten Substanzgewinnen, die Abzugsfähigkeit von Verwaltungskos-ten sowie die Vortragsmöglichkeit von Substanzverlusten berücksichtigt. Da für die Versteuerung von realisierten Sub-stanzgewinnen in Fonds wie erwähnt eine Übergangsregelung gilt, kommt im ersten Jahr eine Versteuerung von 40% (entspricht der Situation im Jahr 2012), im zweiten Jahr 50% (entspricht 2013) und danach 60% (entspricht der Zeit ab 2014) der realisierten Substanzgewinne zur Anwendung.
Am Ende einer Periode wird der Wert des Fondsinvestments um die in der laufenden Periode anfallenden Fondsver-waltungskosten sowie die zu zahlenden Steuern reduziert. Die angenommene De-potgebühr von 0,24% p.a. berechnet sich sodann auf Basis des auf diese Weise er-mittelten Werts. Sie wird im Modell durch den Verkauf von Investmentfondsanteilen (des jeweils verursachenden Fonds) ge-deckt, wobei die Veräußerungsgewinn-besteuerung in diesem Fall vernachlässigt wird.
Am Ende der betrachteten Laufzeit von 15 bzw. 25 Jahren werden die im Fonds bisher nicht realisierten Substanzgewinne mit der Veräußerungsgewinnsteuer belegt, wobei die Möglichkeit der Saldierung von Substanzgewinnen und -verlusten durch den Privatinvestor für die Berech-nung der Höhe der Steuer berücksichtigt wird (innerhalb der Laufzeit kann es zu keiner solchen Saldierung kommen, da im beschriebenen Modell während der Laufzeit niemals Anteile beider Fonds gleichzeitig veräußert werden). Eine wei-tere Saldierung mit Erträgen/Verlusten aus anderen Finanzinvestitionen, die im
Regressionsrechnung der Kosten der Pe-rioden 2 bis 5 bei einer angenommenen Fondsperformance von 0% auf die Zeit durchgeführt und daraus die laufenden Kosten der ersten Periode extrapoliert. Die Differenz zwischen den Gesamt-kosten der ersten Periode und den so ermittelten laufenden Kosten der ersten Periode ergeben somit die anzusetzenden Abschlusskosten. Die gesamten Kosten enthalten bereits Positionen wie Depot- und Verwaltungskosten und werden in den Tabellen A1 und A2 im Anhang aus-gewiesen. Aus steuerlicher Hinsicht fällt bei Versicherungsinvestitionen mit einer Laufzeit von mehr als 15 Jahren, wie in Abschnitt beschrieben, nur die Versiche-rungssteuer (4%) an, die ebenfalls in den aufgelisteten Kosten enthalten ist.
5. Ergebnisse
Die Darstellung der Ergebnisse der Berechnungen erfolgt auf Basis von zwei Daten-Sets. Die in Tabelle 2 dargestell-ten Werte dienen als Daten-Set 1. Wie angeführt umfasst das Anlageuniversum vereinfacht zwei Fonds, die sich hinsicht-lich ihrer Kosten- wie Renditestruktur unterscheiden. Die Gesamtrendite eines Fonds (Summe der letzten drei Zeilen) ist als Rendite vor Berücksichtigung der Verwaltungskosten zu verstehen.
Das Daten-Set 2 dient zur Darstellung der Wertverläufe im Fall angenommener Fonds-Nettorenditen von 0%, 3% und 6%. Für Ergebnisse, die auf diesen an-genommenen Renditen basieren, wird davon ausgegangen, dass der Fonds je ein Drittel der angenommenen Gesamtren-
Einzahlungstyp Einzahlungshöhe Investitionszeitraum
Einmalig EUR 15.000 15 Jahre
Einmalig EUR 25.000 25 Jahre
Laufend (jährlich) EUR 1.000 15 Jahre
Laufend (jährlich) EUR 1.000 25 Jahre
Tabelle 1: Investitionsszenarien
Parameter Rentenfonds Aktienfonds
Ausgabeaufschlag 2,50% 4,00%
Verwaltungskosten p. a. 0,60% 1,65%
Rendite p. a. aus ordentlichen Erträgen 4,00% 2,50%
Rendite p. a. aus realisierten Substanzgewinnen 0,00% 2,50%
Rendite p. a. aus nicht realisierten Substanzgewinnen 0,00% 2,50%
Tabelle 2: Parameter von Daten-Set 1
[17] Die Kosten der für die Berechnun-gen herangezogenen Lebensversicherungs-Polizzen liegen im österreichischen Vergleich
im Mittelfeld. Die Verwendung von Polizzen anderer Anbieter (den Autoren liegen Angebote von 12 Anbietern vor) führt zu qualitativ ähn-
lichen Ergebnissen.

AbhAndlungen perforManceverGleich fonds vs. flv
ÖBA 4/12 223
dite in Form von ordentlichen Erträgen, von realisierten Substanzgewinnen und von nicht realisierten Substanzgewin-nen erwirtschaftet. Der angenommene Ausgabeaufschlag beträgt 4% und die Verwaltungskosten 0% [18].
In der Folge werden die vergleichen-den Berechnungen für drei Veranlagungs-strategien durchgeführt. Die erste Strate-gie – Buy-and-Hold – unterstellt, dass die Portefeuillezusammensetzung über den gesamten Betrachtungszeitraum (15 bzw. 25 Jahre) unverändert bleibt. Strategie zwei – Ablaufmanagement – zeichnet sich dadurch aus, dass in den jeweils letzten fünf Jahren eine Umschichtung von einer risikoreicheren in eine risiko-ärmere Veranlagung erfolgt. Strategie drei – Umschichtungen – ist schließlich dadurch gekennzeichnet, dass die Porte-feuillezusammensetzung in regelmäßigen Abständen gänzlich verändert wird, also von einer Veranlagungsvariante in eine andere gewechselt wird.
Bei den grafischen Darstellungen der Ergebnisse ist zu beachten, dass der vorletzte dargestellte Datenpunkt – Peri-ode 15 bzw. 25 – den Endwert vor der Ver-äußerungsgewinnbesteuerung am Lauf-zeitende und der letzte Datenpunkt – Pe-riode „16“ bzw. „26“ – den Endwert nach Veräußerungsgewinnbesteuerung (somit den Auszahlungsbetrag) am Laufzeiten-de darstellen. Der beim Fondsdirekt- investment am Ende häufig beobachtbare Wertrückgang („Knick“) entspricht der bei Veräußerung des Fonds am Laufzeit-ende anfallenden Steuerlast.
5.1. Ergebnisse Buy-and-HoldTabelle 3 zeigt die bei unterschied-
lichen Veranlagungsvarianten erzielba-ren Endwerte unter der Annahme einer Nettofondsperformance von 0%, 3% oder 6% (Daten-Set 2). Dabei wird davon ausgegangen, dass während der Laufzeit die anfangs getätigte Investi-tionsentscheidung umgesetzt und keine Umschichtungen oder ähnlichen Eingriffe vorgenommen werden. Sie zeigt für den Fall einer Einmalzahlung einen Vorteil der Versicherungsvariante bei zunehmender Fondsperformance. Bei laufender jähr-licher Einzahlung führen die relativ hohen Kosten des Lebensversicherungsprodukts zu einem niedrigeren als bei einem Fonds-direktinvestment erreichbaren Ergebnis, das erst bei 25jähriger Veranlagungsdauer und 6% Fondsperformance von den ge-ringeren Steuerzahlungen ausgeglichen wird.
falls vorzuziehen, wobei der Steuervorteil erneut insbesondere bei dem eine höhere Rendite erbringenden Aktienfonds ins Gewicht fällt. Bei laufender Einzahlung ist die Versicherung hingegen nur im Fall des Aktienfonds (knapp) überlegen.
5.2. Ergebnisse Ablauf-management
Abbildungen 3 und 4 zeigen ein in der Praxis häufig gewähltes Ablauf-management-Modell über die beiden betrachteten Zeiträume. Dabei wird in den letzten 5 Jahren vor Ende der Laufzeit schrittweise (hier 20 Prozentpunkte pro Jahr) von volatileren in stabilere Anla-geformen umgeschichtet. Dies wird in den vorliegenden Berechnungen durch eine Umschichtung vom Aktien- in den Rentenfonds des Daten-Sets 1 dargestellt.
Wie die grafischen Darstellungen deutlich machen, wirkt sich das Ab-laufmanagement bei Einmalzahlung und
Nachstehende Abbildungen 1 und 2 stellen Pendants zu Tabelle 3 unter Ver-wendung von Daten-Set 1 dar. Sie zeigen die Wertverläufe verschiedener Investi-tionsvarianten über 15 und 25 Jahre. Im Fall des kürzeren Zeitraums ist erkennbar, dass der Steuervorteil der Lebensver-sicherung bei laufender Einzahlung (LE) von den höheren Kosten aufgezehrt wird, sodass die Fondsdirektveranlagungen die höheren Auszahlungsbeträge aufweisen. Bei Einmaleinzahlung (EE) fällt die Dif-ferenz zwischen Direktinvestment und In-vestment in Form einer fondsgebundenen Lebensversicherung bereits zu Gunsten des Versicherungsprodukts aus, wobei besonders beim Aktienfonds der Effekt der Veräußerungsgewinnbesteuerung am Laufzeitende sehr klar ersichtlich ist.
Über den Zeitraum von 25 Jahren ist die Lebensversicherung dem Fonds-direktinvestment bei Einmaleinzahlung auf Basis der erzielten Endwerte jeden-
Einmaleinzahlung Laufende Einzahlung
Performance Fonds Versicherung Fonds Versicherung
15 J
ahre 0% € 14.035 € 12.770 € 14.274 € 12.456
3% € 19.726 € 19.984 € 17.264 € 15.743
6% € 27.850 € 30.761 € 20.949 € 20.050
25 J
ahre 0% € 22.836 € 20.693 € 23.508 € 21.123
3% € 40.546 € 43.327 € 32.115 € 30.483
6% € 73.118 € 88.813 € 45.023 € 45.251
Tabelle 3: Endwert bei angenommener Fondsperformance von 0%, 3% und 6%
Abbildung 1: Wertentwicklung bei verschiedenen Investitionsvarianten und einer Laufzeit von 15 Jahren
[18] Während die meisten Versicherungs-angebote die Endwerte bei einer angenom-menen Fondsperformance von 0%, 3% und 6% ausweisen, ist unklar, wie eine derartige Performanceannahme bei einem Fondsdirekt-investment zu interpretieren ist. Die getrof-
fene Annahme von 0% Verwaltungskosten führt zu einer vollen Steuerwirksamkeit der ordentlichen (und außerordentlichen) Erträge im Fonds. Eine Annahme höherer Verwal-tungskosten (bei gleichzeitig als konstant angenommener Fondsperformance nach Ver-
waltungskosten) führt daher immer zu einer besseren als der ausgewiesenen Performance des Direktinvestments. Die in weiterer Folge dargestellten Endwerte stellen somit im Fall des Direktinvestments eine Untergrenze der möglichen Endwerte dar.

Gauper / Mestel / palan AbhAndlungen
224 ÖBA 4/12
Fondsdirektinvestment besonders stark aus. Der Effekt einer Umschichtung aus dem Aktien- in den Rentenfonds bei Fondsdirektinvestment besteht dabei aus zwei Komponenten: Zum einen unter-liegen umgeschichtete Beträge – die ja einen Verkauf des Aktienfonds darstellen – der Veräußerungsgewinnbesteuerung auf noch nicht versteuerte Gewinne. Zum anderen fällt für die umgeschichteten Beträge – die ja einen Kauf des Renten-fonds darstellen – der Ausgabeaufschlag des Rentenfonds an. Beide Komponenten entfallen bei der Lebensversicherung. Der stärkere Effekt beim Direktinvestment und Einmalzahlung begründet sich in den über die Zeit angesammelten höheren nicht versteuerten Erträgen.
5.3. Ergebnisse UmschichtungenDie Abbildungen 5 und 6 stellen
schließlich die Wertverläufe unter der Annahme dar, dass das gesamte Vermö-gen alle 5 Jahre vom aktuellen in einen anderen Fonds umgeschichtet wird [19]. Dabei fallen beim Fondsdirektinvest-ment der Ausgabeaufschlag sowie die Veräußerungsgewinnbesteuerung an. Da viele Versicherungsanbieter ihren Kunden erlauben, kostenlos und ohne Abzug des Ausgabeaufschlags zwischen verschie-denen Fondsveranlagungen zu wechseln, fallen diese Kostenpositionen bei der Versicherungsvariante im Gegensatz zum Direktinvestment nicht an [20].
Um ferner einen reinen Vergleich des Effekts der Umschichtung unabhängig von der Performanceentwicklung im je-weils gewählten Fonds zu ermöglichen, werden in dieser Berechnung zwei iden-tische Fonds unterstellt, deren Parameter jenen des Aktienfonds aus Daten-Set 1 entsprechen. Die in den Abbildungen 5 und 6 dargestellten Wertverläufe unter-scheiden sich somit nur durch die Effekte der Umschichtung, nicht jedoch durch die angenommene Fondsperformance, von den Wertverläufen des Aktienfonds-Investments in den Abbildungen 1 und 2.
Es zeigt sich bereits bei nur 15jähri-ger Laufzeit der zu erwartende negative Effekt von Portefeuilleumschichtungen auf die Rendite des Fondsinvestments. Bei 25jähriger Laufzeit verstärkt sich dieser Effekt noch deutlich, sodass das Fondsdirektinvestment bei Einmalzah-lung nur noch eine Gesamtnettorendite von 3,46% p.a. im Vergleich zu 4,75% p.a. bei der Lebensversicherung erbringt.
Abbildung 2: Wertentwicklung bei verschiedenen Investitionsvarianten und einer Laufzeit von 25 Jahren
Abbildung 3: Wertentwicklung bei Ablaufmanagement und einer Laufzeit von 15 Jahren
Abbildung 4: Wertentwicklung bei Ablaufmanagement und einer Laufzeit von 25 Jahren
[19] Erfahrungswerte aus der Finanz-dienstleistungsbranche zeigen, dass Investoren ihre Portefeuilles recht häufig umschichten.
[20] In vielen Fällen ist ein kostenloser Wechsel zwischen den Veranlagungsprodukten einmal im Monat möglich.

AbhAndlungen perforManceverGleich fonds vs. flv
ÖBA 4/12 225
sen auf Wertpapiere deutlich erweitert, fondsgebundene Lebensversicherungen bei einer Laufzeit von über 15 Jahren jedoch davon ausnimmt, die Attraktivität von Investitionen in letztere deutlich erhöht hat. Diese Entwicklung rückt die Eignung der fondsgebundenen Le-
Selbst im Fall laufender Einzahlungen liegt das Ergebnis des Direktinvestments (Auszahlungsbetrag € 39.977) damit un-ter jenem der Lebensversicherung (Aus-zahlungsbetrag € 42.339).
Noch deutlicher wird der erläuterte Effekt von Veranlagungswechseln, wenn diese häufiger erfolgen. Tabelle 4 belegt den großen Einfluss, den die Umschich-tungshäufigkeit (alle 5 Jahre, alle 3 Jahre, jährlich) auf den Endwert der Investition nimmt. Da die Versicherungsproduk-te kostenlose Umschichtungen ermög-lichen, werden deren Ergebnisse von der Umschichtungshäufigkeit nicht beein-trächtigt.
6. Resumé und Ausblick
Die Gegenüberstellung der Auszah-lungsbeträge einer Investition in einen Investmentfonds mit jenen einer fonds-gebundenen Lebensversicherung unter besonderer Berücksichtigung der steuer-lichen Änderungen des Budgetbegleitge-setzes 2011 (BBG 2011) zeigt, dass die Ergebnisse stark von den Investitionsva-rianten, der Kostenstruktur und der Ver-anlagungsstrategie determiniert werden.
Hinsichtlich der Investitionsvarianten und der Kostenstrukturen erweist sich der Abschluss einer fondsgebundenen Lebensversicherung bei laufenden Ein-zahlungen gegenüber der Direktveran-lagung in einen Investmentfonds nahe-zu ausnahmslos als nachteilig. Dies ist ausschließlich auf die hohen Kosten der fondsgebundenen Lebensversicherung zurückzuführen. Andere Resultate liefert der Vergleich der beiden Investitionsvari-anten bei Einmalzahlung. Hier kommt es in den analysierten Szenarien zu einem Vorteil der fondsgebundenen Lebensver-sicherung gegenüber dem Fondsdirektin-vestment, welcher auf die weitgehende Steuerfreiheit von fondsgebundenen Le-bensversicherungen zurückzuführen ist.
Das in vielen Versicherungsverträgen vorgesehene (bzw. mögliche) Ablauf-management gegen Ende der Versiche-rungslaufzeit führt besonders bei Ein-malerlag zu einer Vorteilhaftigkeit der Versicherungsvariante gegenüber dem Direktinvestment. Dies beruht auf der Veräußerungsgewinnbesteuerung von noch nicht versteuerten Gewinnen und dem Ausgabeaufschlag, die bei Invest-mentfonds jeweils zu berücksichtigen sind. Auch andere Umschichtungsstrate-gien wirken sich bereits nach 15jähriger Laufzeit positiv auf die Vorteilhaftigkeit von fondsgebundenen Lebensversiche-rungen aus.
Insgesamt belegen die Ergebnisse der vorliegenden Analyse, dass der Gesetz-geber mit dem neuen BBG 2011, welches die Besteuerung von Vermögenszuwäch-
Einmaleinzahlung Laufende Einzahlung
Umschichtung Fonds Versicherung Fonds Versicherung
15 J
ahre jährlich € 16.866 € 30.094 €16.039 € 19.565
alle 3 Jahre € 23.420 € 30.094 € 19.071 € 19.565
alle 5 Jahre € 25.039 € 30.094 € 19.764 € 19.565
25 J
ahre jährlich € 30.560 € 84.292 € 27.910 € 42.339
alle 3 Jahre € 51.703 € 84.292 € 36.755 € 42.339
alle 5 Jahre € 59.048 € 84.292 € 39.977 € 42.339
Tabelle 4: Endwerte bei Umschichtungen zwischen zwei Aktienfonds
bensversicherung als Investitionsvehikel gegenüber dem Versicherungsgedanken stärker als in der Vergangenheit in den Vordergrund. Die Reaktion des Marktes wird zeigen, ob diese Änderung von den Anlegern erkannt und angenommen wird.
◆
Abbildung 5: Wertentwicklung bei Umschichtung alle fünf Jahre und einer Laufzeit von 15 Jahren
Abbildung 6: Wertentwicklung bei Umschichtung alle fünf Jahre und einer Laufzeit von 25 Jahren

Gauper / Mestel / palan AbhAndlungen
226 ÖBA 4/12
Angenommene Fondsperformance 0% 3% 6% 0% 3% 6%
Abschlusskosten 4,78% 4,78% 4,78% 10,08% 10,08% 10,08%Jahr 1 1,90% 2,05% 2,20% 21,92% 22,12% 22,22%Jahr 2 1,65% 1,61% 1,59% 18,21% 17,99% 17,80%Jahr 3 1,36% 1,31% 1,26% 12,34% 11,97% 11,65%Jahr 4 1,10% 1,04% 0,98% 9,06% 8,69% 8,30%Jahr 5 0,88% 0,82% 0,77% 6,97% 6,56% 6,21%Jahr 6 0,70% 0,64% 0,61% 5,55% 5,18% 4,79%Jahr 7 0,56% 0,51% 0,48% 4,52% 4,14% 3,80%Jahr 8 0,45% 0,42% 0,41% 3,74% 3,37% 3,06%Jahr 9 0,39% 0,36% 0,36% 3,12% 2,79% 2,47%
Jahr 10 0,35% 0,33% 0,34% 2,64% 2,31% 2,03%Jahr 11 0,35% 0,32% 0,33% 2,25% 1,95% 1,67%Jahr 12 0,35% 0,32% 0,33% 1,92% 1,64% 1,40%Jahr 13 0,35% 0,32% 0,33% 1,65% 1,40% 1,16%Jahr 14 0,36% 0,33% 0,33% 1,43% 1,19% 1,00%Jahr 15 0,37% 0,32% 0,33% 1,25% 1,02% 0,88%Jahr 16 0,38% 0,33% 0,33% 1,09% 0,88% 0,78%Jahr 17 0,40% 0,33% 0,33% 0,96% 0,79% 0,70%Jahr 18 0,41% 0,33% 0,33% 0,85% 0,71% 0,63%Jahr 19 0,42% 0,33% 0,33% 0,76% 0,66% 0,58%Jahr 20 0,43% 0,33% 0,33% 0,69% 0,61% 0,54%Jahr 21 0,45% 0,33% 0,33% 0,64% 0,57% 0,51%Jahr 22 0,47% 0,33% 0,33% 0,61% 0,54% 0,49%Jahr 23 0,49% 0,34% 0,33% 0,58% 0,51% 0,47%Jahr 24 0,51% 0,34% 0,33% 0,56% 0,50% 0,45%Jahr 25 0,52% 0,34% 0,33% 0,55% 0,48% 0,44%
Einmaleinzahlung Laufende Einzahlung
Angenommene Fondsperformance 0% 3% 6% 0% 3% 6%
Abschlusskosten 4,77% 4,77% 4,77% 10,42% 10,42% 10,42%Jahr 1 1,91% 2,06% 2,21% 20,08% 20,18% 20,38%Jahr 2 1,65% 1,62% 1,59% 16,40% 16,23% 15,99%Jahr 3 1,37% 1,30% 1,25% 10,43% 10,13% 9,88%Jahr 4 1,10% 1,04% 0,99% 7,20% 6,92% 6,60%Jahr 5 0,89% 0,82% 0,76% 5,21% 4,93% 4,68%Jahr 6 0,70% 0,64% 0,61% 3,91% 3,65% 3,41%Jahr 7 0,55% 0,51% 0,49% 3,01% 2,77% 2,56%Jahr 8 0,46% 0,42% 0,40% 2,37% 2,15% 1,94%Jahr 9 0,39% 0,36% 0,36% 1,90% 1,70% 1,53%
Jahr 10 0,35% 0,33% 0,33% 1,54% 1,37% 1,21%Jahr 11 0,34% 0,33% 0,33% 1,29% 1,13% 0,97%Jahr 12 0,36% 0,32% 0,33% 1,10% 0,94% 0,81%Jahr 13 0,36% 0,32% 0,33% 0,96% 0,81% 0,69%Jahr 14 0,37% 0,32% 0,33% 0,85% 0,72% 0,63%Jahr 15 0,37% 0,32% 0,33% 0,77% 0,64% 0,59%
Laufende EinzahlungEinmaleinzahlung Tabelle A1: Kostenverlauf der fondsgebun-denen Lebensversicherung in Abhängigkeit von der angenommenen Nettofondsperfor-mance bei 15jähriger Laufzeit
Tabelle A2: Kostenverlauf der fondsgebun-denen Lebensversicherung in Abhängigkeit von der angenommenen Nettofondsperfor-mance bei 25jähriger Laufzeit
Anhang

Das Umfeld ändert sich täglich.
Unsere Werte haben Bestand.
Als Spitzeninstitut der größten österreichischen Bankengruppe stehen wir zu unserer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt. Wir streben nach einer vernünftigen Balance von wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten. Weil wir überzeugt sind, dass nachhaltige Geschäftstätigkeit den Erfolg von morgen ausmacht. www.rzb.at
bankarchiv_frau_RZB_CR_180x250_4c_abf.indd 1 08.09.2011 09:17:02

Gauper / Mestel / palan AbhAndlungen
228 ÖBA 4/12
senen Gesetz, SWK-Heft 2, 2011b, S. 65–77.
Marschner, E.: Vermögenszuwachs-steuer – Neuregelung bei Investment-fonds, SWK-Heft 13, 2011c, S. 692–701.
o.V.: Fondsgebundene Lebensversi-cherungen - Bilanz, Konsument 8/2006, 2006, S. 32–33.
Literaturverzeichnis
Maier, M.: Fondsgebundene ausge-packt, Gewinn 4/11, 2011, S. 54–59.
Marschner, E.: Investmentfonds in Fallbeispielen, 2. Aufl., Linde, Wien, 2011a.
Marschner, E.: Vermögenszuwachs-steuer – erste Gedanken zum beschlos-
o.V.: Faule Fonds, Konsument 2/2011, 2011a, S. 10–12.
o.V.: Informationen zur Kursgewinn-besteuerung, http://www.voeig.at/voeig/internet_3.nsf/sysPages/A7CDCA69B4D36568C12577FB00445080/$file/V%C3%96IG-Homepage_Kursgewinnbesteu-erung05082011.pdf, VÖIG, 05.08.2011, 2011b.
www.lindeverlag.at
ALLE STEUERRECHTLICHEN LINDE-KOMMENTARE JETZT AUCH ONLINE ABRUFBAR

AbhAndlungen Aufklärungspflicht der BAnk
ÖBA 4/12 229
Georg Graf
Der Erwerb von Wertpapieren ge-staltet sich oftmals so, dass zwi-schen dem Anleger und der Bank, die die Papiere für ihn besorgt, ein weiterer Finanzdienstleister ein-geschaltet ist. Hierbei handelt es sich beispielsweise um einen Ver-mögensberater, der dem Kunden nicht nur nahelegt, die betreffenden Papiere zu kaufen, sondern ihn dann auch gleich mit der Bank in Kontakt bringt, bei der er die Papie-re ordern kann. Wenn der Kunde nun im Nachhinein entdeckt, dass das Investment nicht seinen Vor-stellungen entsprochen hat und er annimmt, dass er hinsichtlich der maßgeblichen Eigenschaften dieses Investments nicht korrekt infor-miert wurde, stellt sich die Frage, ob er Ansprüche auch gegenüber der Bank geltend machen kann. Sie steht im Mittelpunkt der folgenden Überlegungen.
Stichwörter: Aufklärungspflicht, Effektenge-schäft, Wertpapierhandel, Finanzdienstleister, Depotgeschäft, Bank, Kreditinstitut, Verhand-lungsgehilfe, Empfangsbote, Erklärungsbote, Angemessenheitsprüfung, Geeignetheitsprü-fung, WAG, ABGB.JEL-Classification: D 18, G 21, G 28, K 12, K 13, K 23.
Frequently in the course of the acqui-sition of securities there is another financial services provider, between the investor and the bank which pro-vides him with the securities. This could be, eg, an advisor who not only suggests to the client to purchase such securities but who also brings the client in contact with the bank where he can order the securities. If the client realizes in retrospect that the investment does not conform with his notions and assumes that he has not been correctly informed about material aspects of the investment, there is the issue whether he also can raise a claim against the bank. The bank is the focus of the following considerations.
ur Aufklärungspflicht der Bank bei Ein- schaltung eines weiteren FinanzdienstleistersGleichzeitig ein Beitrag zur Auslegung des § 27 WAG 2007
Univ.-Prof. Dr. Georg Graf, Fachbe-reich Privatrecht, Universität Salz-burg;e-mail: [email protected]
Phot
o: p
rivat
Z
1. Einleitung
Die Frage nach der Möglichkeit, An-sprüche gegen die Bank geltend machen zu können, stellt sich für den Anleger schon rein pragmatisch dann mit beson-derer Dringlichkeit, wenn die Geltend-machung von Ansprüchen gegen den Ver-mögensberater [1] mangels hinreichender Liquidität nicht erfolgversprechend ist. Von Bankenseite wird in derartigen Si-tuationen typischerweise argumentiert, es hätten keinerlei Aufklärungspflichten bestanden, weil der Kunde ja sowieso durch einen anderen Finanzdienstleister beraten gewesen sei. Schützenhilfe haben die Kreditinstitute in jüngster Zeit durch zwei Publikationen von Baum [2] und Knobl/Grafenhofer [3] erhalten, die einer Aufklärungspflicht der Banken in solchen Situationen eher kritisch gegenüber ste-hen. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass sich die rechtliche Lage doch ein wenig differenzierter verhält, als von den genannten Autoren dargestellt: Die Banken werden durch die Vorschaltung eines anderen Wertpapierdienstleisters keineswegs stets von wesentlichen, sie nach WAG oder allgemeinem Zivilrecht treffenden Pflichten befreit.
2. Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten
Beim Rechtsträger, der den Kontakt zum Kreditinstitut herstellt, handelt es sich entweder um eine Wertpapierfirma gem § 3 WAG [4] oder ein Wertpapier-dienstleistungsunternehmen im Sinn des § 4 WAG. Beide werden in eigenem Na-
men tätig [5]. Das Verhältnis zwischen der Bank und dem Rechtsträger kann auf ver-schiedene Weise gestaltet sein. So ist es denkbar, dass zwischen den beiden über-haupt keine vertragliche Vereinbarung besteht; dies wird dann der Fall sein, wenn die Auswahl der Bank auf einen Wunsch des Kunden, nicht aber des Rechtsträgers zurückzuführen ist. Auch bei Auswahl durch den Rechtsträger kann eine solche Situation bestehen. Führt ein Rechtsträ-ger einer Bank jedoch hinsichtlich eines bestimmten Wertpapiers häufiger Kunden zu, wird der Beziehung zwischen Bank und Rechtsträger typischerweise eine vertragliche Vereinbarung [6] zugrun-
[1] Die grundsätzliche Haftung des Ver-mögensberaters, der den Kunden nicht ent-sprechend aufgeklärt hat, wird idR nicht zweifelhaft sein.
[2] Baum, ÖBA 2010, 278;[3] GesRZ 2010, 27. Siehe auch Riedler,
ÖJZ 2010, 19; Vonkilch, RdW 2010, 324. [4] Wenn im Folgenden auf das WAG Be-
zug genommen wird, ist damit das WAG 2007 gemeint. Das WAG BGBl 753/1996 wird im Hinblick auf das Datum seines Inkrafttretens als „WAG 1997“ bezeichnet.
[5] Hiervon zu unterscheiden sind gebun-dene Vermittler im Sinn des § 1 Z 20 WAG und Wertpapiervermittler gem § 2 Abs 1 Z 15 WAG. (Bis zur Novelle 2011 firmierten die Wertpapiervermittler als Finanzdienstleitungs-
assistenten.) Vertraglich gebundene Vermittler und Wertpapiervermittler werden nicht im eigenen Namen, sondern im Namen und auf Rechnung einer Wertpapierfirma oder eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens tätig. Ihr Handeln wird ihrem Geschäftsherrn 1:1 zugerechnet. Sie sind Erfüllungsgehilfen des Geschäftsherrn, für die er nach § 1313a ABGB haftet. Da es in den folgenden Überlegungen um jene Probleme geht, die sich aus der Zwi-schenschaltung selbständiger Rechtsträger ergeben, können vertraglich gebundene Ver-mittler und Wertpapiervermittler im Folgenden außer Betracht bleiben.
[6] Vgl die detaillierten Hinweise bei Baum, ÖBA 2010, 282 f.

grAf AbhAndlungen
230 ÖBA 4/12
informationen stützen darf, die ihm vom ersten Rechtsträger weitergeleitet wurden. Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der weitergeleiteten Kun-deninformation trägt der Rechtsträger, der den Auftrag erteilt hat. Abs 2 betrifft ebenfalls den Fall, dass ein Rechtsträger einen Auftrag erhält, Wertpapierdienst-leistungen oder Nebendienstleistungen im Namen eines Kunden zu erbringen. Dieser Rechtsträger darf sich auf Empfehlungen in Bezug auf die Dienstleistung oder das Geschäft verlassen, die dem Kunden von dem anderen Rechtsträger gegeben wur-den. Die Verantwortung für die Eignung der Empfehlung oder Beratung für den Kunden trägt der Rechtsträger, der den Auftrag erteilt hat. Abs 3 stellt schließlich klar, dass der zweite Rechtsträger die Verantwortung für die von ihm zu erbrin-gende Dienstleistung oder den Abschluss des Geschäftes trägt.
3.2. § 27 Abs 1 WAG
Untersucht man, welche praktische Be-deutung § 27 Abs 1 WAG hat, zeigt sich, dass ihm nur ein eng definierter Rechts-folgenbereich zukommt. Die Bestimmung ist im Kontext des WAG zu interpretie-ren. Sie regelt jene Pflichten, die sich aus dem WAG ergeben. Eine Regelung von Pflichten, die beispielsweise aus dem ABGB oder hinsichtlich des Kommissi-onsgeschäfts aus dem UGB resultieren, wird von dieser Norm nicht angestrebt. Allerdings engt § 27 Abs 1 jene Wertpa-pierdienstleistung, mit deren Erbringung der kundenfernere Rechtsträger beauf-tragt wird, in keiner Weise ein. Es kommt somit jede der in § 1 Z 2 und Z 3 WAG genannten Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen in Frage. In den im vorliegenden Kontext relevanten Fällen geht es um die Annahme und Übermittlung von Aufträgen bzw die Ausführung von Aufträgen für Rechnung von Kunden. Die Bank soll bestimmte
3. Die Regelung des § 27 WAG
3.1. ÜberblickDie Frage, wie sich die Zwischen-
schaltung eines Finanzdienstleisters in einer solchen Situation auf die Pflichten der Bank auswirkt, ist für den Bereich des WAG, dh für die aus dem WAG resultierenden Pflichten in § 27 WAG geregelt [12].
§ 27 WAG enthält drei Regelungen. In allen Fällen geht es darum, dass ein Rechtsträger (der „zweite Rechtsträger“, die Bank) von einem anderen Rechts-träger (dem „ersten Rechtsträger“) den Auftrag erhält, Wertpapierdienstleistun-gen oder Nebendienstleistungen im Na-men eines Kunden zu erbringen. Diese Anknüpfung ist auslegungsbedürftig, da die Formulierung des Gesetzes auf einen Übersetzungsfehler zurückgeht: In der englischen Fassung wird der Passus „on behalf of the client“ verwendet, der die Sache zutreffend auf den Punkt bringt: Es geht nicht darum, ob der zweite Rechts-träger beauftragt wird, ein Geschäft als direkter Stellvertreter [13] für den Kunden abzuschließen, sondern vielmehr darum, ob er auf Rechnung des Kunden tätig werden soll [14]. Wesentlich für die An-wendung des § 27 WAG ist aber weiters, dass es zu einer vertraglichen Beziehung zwischen dem zweiten Rechtsträger und dem Kunden kommt – nur dann, wenn eine solche Vertragsbeziehung vorliegt, wird der Auftraggeber „Kunde“ des Rechtsträgers. Das bedeutet aber, dass der erste Rechtsträger gegenüber dem zweiten entweder als direkter Stellver-treter oder als Bote des Kunden auftreten muss; handelt er in eigenem Namen, wird er, aber nicht der Kunde Vertragspartner des zweiten Rechtsträgers, sodass § 27 WAG nicht zur Anwendung kommt [15].
§ 27 Abs 1 WAG sieht nun vor, dass sich der kundenfernere Rechtsträger in ei-ner solchen Konstellation auf die Kunden-
deliegen. Solche Situationen sollen im Mittelpunkt der hier angestellten Überle-gungen stehen.
Eine solche Vereinbarung bietet idR in Form von Provisionen, welche die Bank an den Vertriebspartner leistet, für diesen einen entsprechenden Anreiz, möglichst viele Papiere zu verkaufen. Der Finanzdienstleister erhält [7] nicht bloß entsprechendes Informationsmaterial, sondern ihm werden auch Vertragsunter-lagen für den vom akquirierten Kunden mit der Bank abzuschließenden Vertrag überlassen. Der Vertriebspartner lässt den Kunden diese Formulare ausfüllen und leitet sie sodann an die Bank weiter. Typischerweise handelt es sich hierbei um einen Antrag auf Eröffnung eines Depots sowie den Auftrag zum Erwerb der betreffenden Wertpapiere. Die Bank strebt an, mit dem Kunden in eine doppelte Rechtsbeziehung zu treten. Im Vordergrund steht dabei der Verkauf [8] der Papiere – zu diesem Zweck werden die Vertriebspartner engagiert. Sie sollen Käufer für Papiere akquirieren, für die Bank also Einnahmen aus dem Effekten-geschäft generieren [9].
Zu diesem Zielschuldverhältnis soll aber auch ein Dauerschuldverhältnis in Gestalt des Depotvertrages [10] treten, der für die Bank laufend Einnahmen generiert. Führt der Kunde das Depot mit den betreffenden Wertpapieren bei ihr, hat die Bank auch zumindest die abstrakte Möglichkeit, eine allfällige Verkaufsent-scheidung des Kunden zu beeinflussen [11]. In bestimmten Fällen ist die Bank an einer langen Behaltedauer auf Seiten des Kunden interessiert, nämlich wenn die Vertriebspartner Provisionen nicht bloß für den Verkauf der Wertpapiere bekom-men, sondern auch dafür, dass der Kunde während eines bestimmten Zeitraums die Papiere nicht verkauft. In diesem Fall spricht man von einer sogenannten Bestandsprovision.
[7] Baum, ÖBA 2010, 283. Wenn Baum schreibt, solches Informationsmaterial würde vom Institut „auf Nachfrage“ zur Verfügung gestellt, gibt das die Realität wohl nicht ganz wieder. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Bank, die diese Papiere ja in ihrem eigenen Interesse verkaufen möchte, ihre Vertriebspart-ner aus Eigenem mit entsprechenden Unterla-gen versorgt.
[8] Insoweit ist es irreführend, wenn Baum seinen Aufsatz mit dem Untertitel „Zur Verant-wortlichkeit im Verhältnis zwischen selbstän-digem Vertriebspartner und depotführendem Kreditinstitut“ versieht. Die Bank ist nicht bloß depotführendes Kreditinstitut. Sie darauf zu reduzieren würde bedeuten, ihr Verkaufsinter-esse gänzlich auszublenden. Gerade dieses Ver-kaufsinteresse ist aber das treibende Moment.
[9] Damit sind nicht jene Fälle gemeint, in
denen die Bank lediglich die üblichen Gebüh-ren für die Durchführung des Ankaufs und die Depotverwaltung lukriert, sondern jene Fälle, in denen die Bank ein Interesse daran hat, dass der Kunde ein bestimmtes Papier – zB eines mit der Bank irgendwie verbundenen Emittenten – erwirbt.
[10] Keines Depoteröffnungsvertrages be-darf es nur in jenen Fällen, in denen der Kunde bei der Bank oder bei einer anderen Bank bereits ein Depot hat. Dass die Banken die Vertriebspartner mit Depoteröffnungsverträgen ausstatten, könnte die Vermutung nahelegen, dass solche bereits anderweitig mit einem De-pot versorgte Kunden nicht zur primären Ziel-gruppe der Akquisitionsbemühungen gehören.
[11] So zB dann, wenn der Kunde in die Filiale kommt und einen Verkaufsauftrag ertei-len möchte; in einer solchen Situation kann die
Bank ihm Argumente auseinandersetzen, die für eine Aufschiebung des Verkaufs sprechen.
[12] Zur Rechtslage nach dem WAG 1997 siehe unten Abschnitt 4.
[13] Was eine Bank, die für einen Kunden Wertpapiere erwirbt, typischerweise auch nicht macht; sie wird vielmehr als Kommissionär im eigenen Namen tätig.
[14] Zutreffend Knobl/Grafenhofer, Ges-RZ 2010, 32. Dieses Übersetzungsproblem taucht öfter auf; vgl auch Graf in Gruber/N. Raschauer, WAG § 48 Rz 2.
[15] Knobl/Grafenhofer, GesRZ 2010, 32; vgl auch M. Harrer in Gruber/N. Raschauer, WAG § 27 Rz 11S für das dt Recht zutreffend Koller in Assmann/Schneider, WpHG5 § 31e Rz 2.

AbhAndlungen Aufklärungspflicht der BAnk
ÖBA 4/12 231
WAG befreit den Rechtsträger von jeg-licher Explorationspflicht bei Geschäften, die nur in der Ausführung oder Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen bestehen – vorausgesetzt freilich, dass die in § 46 WAG aufgezählten Bedingungen erfüllt sind. So darf es sich um kein kom-plexes Finanzinstrument [20] handeln, die Dienstleistung muss auf Veranlassung des Kunden erbracht werden und der Kunde muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass keine Angemessenheits-prüfung stattfindet. Bezüglich solcher Geschäfte führt die Vorschaltung eines anderen Rechtsträgers zu keiner Verän-derung der Pflichtenlage der Bank: Die in § 46 WAG vorgesehene Befreiung von der Angemessenheitsprüfung gilt mit oder ohne Einschaltung eines anderen Rechtsträgers.
3.3. § 27 Abs 2 WAGWeitergehende Rechtsfolgen sind in
§ 27 Abs 2 WAG enthalten, deren Ein-tritt freilich an engere Voraussetzungen geknüpft ist als der Eintritt der in Abs 1 angeordneten rechtlichen Konsequenzen. Nach § 27 Abs 2 WAG darf sich der nach-geschaltete Rechtsträger auf Empfehlun-gen verlassen, die dem Kunden von dem anderen Rechtsträger gegeben wurden. Durch die Bestimmung wird somit ein bestimmtes Vertrauen des kundenferne-ren Rechtsträgers geschützt. Gegenstand dieses Vertrauens sind Empfehlungen, die dem Kunden vom ersten Rechtsträger gegeben wurden. Erfasst ist hiermit offen-kundig der Fall, dass dem Kunden vom ersten Rechtsträger eine Anlageempfeh-lung gegeben wurde Die Anlageempfeh-lung ist typischerweise Gegenstand der Anlageberatung; erfasst ist aber auch die Vermögensverwaltung [21].
Erfasst sind aber nur solche Fälle, in denen dieser Umstand dem nachge-schalteten Rechtsträger bekannt ist, er also weiß, dass der an ihn weitergeleitete Auftrag auf eine Empfehlung des ersten Rechtsträgers zurückgeht [22]. Das ergibt sich eindeutig aus der Gesetzesformu-
stellungsrisiko der Willenserklärung des Kunden; wird er als Erklärungsbote des Kunden tätig, wird das Risiko hingegen vom Kunden getragen [18].
Eine Bank, die Kundenaufträge ent-gegennimmt, die sich nicht auf Anla-geberatung oder Vermögensverwaltung beziehen, muss nach § 45 WAG eine An-gemessenheitsprüfung durchführen. Sie muss also beurteilen, ob der Kunde in der Lage ist, die Risken im Zusammenhang mit dem gewünschten Produkt zu ver-stehen. Zu diesem Zweck muss sie seine Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Art von nachgefragtem Produkt in Erfahrung bringen. § 27 Abs 1 WAG führt dazu, dass die Bank, wenn sie diese Informationen hinsichtlich der Erfahrun-gen des Kunden vom ersten Rechtsträger erhält, von Zutreffen und Vollständigkeit dieser Informationen ausgehen kann. Die Bank wird also der Notwendigkeit entho-ben, selbst die Erfahrungen und Kennt-nisse des Kunden zu eruieren. Wovon sie freilich nicht befreit wird, ist – außer der kundennähere Rechtsträger erbringt die Dienstleistung der Anlageberatung oder Portfolioverwaltung – die Durchführung der Angemessenheitsprüfung. Sie muss also auf der Basis der vom Kunden dem ersten Rechtsträger zur Verfügung ge-stellten Information prüfen, ob das vom Kunden nachgefragte Produkt angemes-sen ist: Wird der Bank ein Kundenauftrag weitergeleitet und ergibt sich aus den Kundeninformationen, dass der Kunde bloß mit Pfandbriefen, aber noch nicht mit Aktien Erfahrungen gemacht hat, darf die Bank ihm daher keine Aktien verkaufen. Aus der ihr zur Verfügung stehenden In-formation ist ersichtlich, dass er nicht über die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die mit dem von ihm zu er-werbenden Produkt verbundenen Risiken zu verstehen – Aktien sind für den Kunden nicht angemessen [19].
Keine Angemessenheitsprüfung muss die Bank dann durchführen, wenn es sich um ein sogenanntes Execution-only-Geschäft iS § 46 WAG handelt. § 46
Papiere auf Rechnung des Kunden kau-fen. § 27 Abs 1 WAG führt dazu, dass der Rechtsträger seiner Auftragsdurch-führung jene Information hinsichtlich des Kunden [16] zugrundelegen darf, die ihm vom kundennäheren Rechtsträger übermittelt wurde.
Wenn das Gesetz anordnet, dass weder die Vollständigkeit noch die Richtigkeit der weitergeleiteten Kundeninformation geprüft werden muss, wirft das allerdings eine Auslegungsfrage auf, können sich Richtigkeit und Vollständigkeit doch auf zwei unterschiedliche Fakten beziehen. Zum einen kann gemeint sein, dass der erste Rechtsträger die ihm vom Kunden gegebene Information richtig und voll-ständig weiterleitet, zum anderen kann aber gemeint sein, dass diese Informa-tion selbst vollständig und richtig ist. Konsultiert man die englische Fassung des Art 20 der MiFID, der durch § 27 WAG umgesetzt wurde, spricht dies deut-lich für die zweite Variante. Die englische Fassung spricht klar von der accuracy der information transmitted. Es geht gerade nicht um die accuracy der trans-mission der Information, sondern um die accuracy der Information selbst. Legt man § 27 Abs 1 WAG diese Bedeutung bei, hat dies die Konsequenz, dass die Frage der Richtigkeit bzw der Vollständigkeit der Informationsweiterleitung im WAG selbst nicht geregelt ist, sondern hierfür allgemeine zivilrechtliche Grundsätze maßgebend sind.
Dies überrascht nicht, weil es sich bei dieser Frage um ein zivilrechtliches Problem handelt, das Gesetz sowie die MiFID aber primär öffentliches Auf-sichtsrecht darstellen [17]. Dass das WAG diese Frage der Korrektheit der Informationsweiterleitung nicht regelt, ist auch inhaltlich angemessen, weil die Risikoverteilung davon abhängt, in wel-cher Funktion der erste Rechtsträger tätig wird. Handelt er als Verhandlungsgehilfe und insbesondere als Empfangsbote für den zweiten Rechtsträger, so trägt dieser das Transport- und damit auch das Ent-
[16] Das österreichische Gesetz spricht von Kundeninformation. Die Richtlinie ver-wendet den Begriff client information; das deutsche Recht formuliert in § 31e WpHG deutlicher und spricht von „Kundenangaben und Kundenanweisungen“.
[17] Vgl in diesem Zusammenhang die E 6 Ob 24/10p = JBl 2010, 442: Hier hatte der Vermittler das Ankaufsformular falsch ausgefüllt, indem er einen unzutreffenden ISIN-Code einsetzte, sodass das falsche Wert-papier gekauft wurde. Der OGH betrachtete den Vermittler als Verhandlungsgehilfen der Bank und gab der gegen die Bank gerichteten Irrtumsanfechtung des Anlegers statt.
[18] Wiebe in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 862 a Rz 10.
[19] Möchte die Bank in dieser Situation die Aktien dennoch verkaufen, muss sie dem Kunden durch Information jenes Wissen ver-schaffen, das er benötigt, um die mit Aktien verbundenen Risiken zu verstehen.
[20] Der Vorschlag von Baum (ÖBA 2010, 286), § 46 WAG auch auf komplexe Finanz-instrumente anzuwenden, ist mit dem Gesetz und den europarechtlichen Vorgaben nicht vereinbar. Soweit ersichtlich, wurde das bisher auch von niemand anderem vertreten.
[21] Das ist nicht ganz selbstverständlich, da der Vermögensverwalter dem Kunden ja keine Produkte empfiehlt, sondern im Rahmen der vereinbarten Anlagerichtlinien Geschäfte auf Rechnung des Kunden tätigt. Das WAG geht aber offenkundig davon aus, dass auch
hier Empfehlungen vorliegen; vgl insb den Wortlaut des § 44 Abs 1 und Abs 5 WAG. Zur Problematik siehe Graf in Gruber/N. Raschau-er, WAG-Kommentar § 44 WAG Rz 47.
[22] Die Kenntnis vom Inhalt der Emp-fehlung ergibt sich typischerweise daraus, dass der Kunde das empfohlene Papier kauft; wesentlich ist aber, dass der Rechtsträger weiß, dass der Kaufwunsch das Ergebnis einer Emp-fehlung ist. Nur wenn ihm dieser Umstand bekannt ist, kann er davon ausgehen, dass die Geeignetheit des gewünschten Papiers vom vorgeschalteten Rechtsträger geprüft wurde; dieses Erfordernis findet bei Baum, ÖBA 2010, 284 keine hinreichende Berücksichtigung.

grAf AbhAndlungen
232 ÖBA 4/12
lierung, die dem Rechtsträger das Recht gibt, sich auf Empfehlungen zu verlassen. Ein solches Verlassen im Sinne von Ver-trauen setzt Kenntnis davon, dass eine Empfehlung erteilt wurde, voraus. Diese Interpretation legt auch der englische Text nahe, der von rely spricht.
Dieses Vertrauen auf die Empfeh-lung bedeutet, dass der nachgeschalte-te Rechtsträger davon ausgehen darf, dass das empfohlene Produkt geeignet ist. Wird eine Anlageempfehlung er-teilt, bedeutet dies, dass sie nach § 44 WAG geeignet ist. Wenn eine Wertpa-pierdienstleistung geeignet ist, dann ist sie gleichzeitig auch angemessen im Sinn des § 45 WAG. Das im Zuge der Angemessenheitsprüfung maßgebliche Kriterium, ob der Kunde die mit dem Produkt verbundenen Risken versteht, ist Teil der Geeignetheitsprüfung. Dieser Zusammenhang ist wesentlich, weil er dazu führt, dass ein Rechtsträger, der von einem anderen Rechtsträger einen Kun-denauftrag weitergeleitet und gleichzeitig die Information erhält, dass dieser Kun-denauftrag auf eine Empfehlung durch den ersten Rechtsträger zurückgeht, auch von der Verpflichtung entbunden ist, eine Angemessenheitsprüfung durchzu-führen. Dies ist also eine weitergehende Rechtsfolge, als sie in Abs 1 vorgesehen ist; das Erfordernis der Kenntnis der dem Anleger vom ersten Rechtsträger erteilten Empfehlung stellt aber eine auf der Tat-bestandsseite über Abs 1 hinausgehende Voraussetzung dar.
4. Die alte Rechtslage
4.1. Art 11 Abs 3 ISD
Durch das WAG 2007 bzw die vom WAG umgesetzte MiFID ist es in diesem Bereich zu einer Veränderung im Ver-gleich zur zuvor in Österreich bzw der EU geltenden Rechtslage gekommen. Im vom WAG 2007 abgelösten WAG 1997 war das Problem nicht geregelt gewesen; eine Regelung fand sich jedoch in der europa-rechtlichen Grundlage des WAG 1997, der Wertpapierdienstleistungsrichtlinie (im Folgenden „ISD“), deren Art 11 die Mitgliedstaaten zur Erlassung von Wohl-verhaltensregeln verpflichtete. Art 11 Abs 3 regelte den Fall, dass eine Wertpa-pierfirma einen Auftrag nicht direkt vom Anleger, sondern indirekt über eine vom Anleger eingeschaltete Wertpapierfirma erhielt. Für diesen Fall wurde angeordnet, dass sich das Kriterium der Professiona-lität des Anlegers der in Abs 1 des Artikels aufgestellten Regeln nach dem Anleger, von dem der Auftrag ausgeht, bestimmt. Es kam also nicht auf die Professionalität der vom Anleger zur Übermittlung seines Anlagewunsches eingeschalteten Wertpa-pierfirma an.
ihn in die Lage zu versetzen, die betref-fende Transaktion zu verstehen. Die Bank musste weiters prüfen, ob das Produkt den Anlagezielen des Kunden sowie seiner finanziellen Leistungsfähigkeit entsprach. Die Bank durfte nicht darauf vertrauen, dass der zwischengeschaltete Finanz-intermediär eine entsprechende Prüfung der Kenntnisse und Präferenzen des Anlegers vorgenommen hatte. Wäre ein solches Vertrauen möglich gewesen, so wäre es letztlich doch wieder auf die Pro-fessionalität des dazwischen geschalteten Finanzdienstleisters und nicht auf jene des Anlegers angekommen: Aufgrund seiner Professionalität hätte die den Auftrag durchführende Bank darauf vertrauen dürfen, dass er die Wohlverhaltensregeln gegenüber dem Anleger eingehalten hat.
Die Bank konnte sich für die Erfül-lung dieser sie selbst treffenden Pflich-ten durchaus der zwischengeschalteten Wertpapierfirma als Erfüllungsgehilfe bedienen. Für deren Verschulden haftete sie aber nach allgemeinen Grundsätzen wie für ihr eigenes Verschulden.
4.4. Kritik der Ansicht von Knobl/Grafenhofer
Knobl/Grafenhofer [24] versuchten jüngst zu argumentieren, diese Entschei-dungen wären nur für Konstellationen relevant, in denen die Bank den Auftrag über einen Finanzintermediär erhält, der als Vermittler tätig ist, nicht hingegen für Konstellationen, in denen es sich um ei-nen Anlageberater handelt. Dies wird von ihnen aus der Formulierung von Art 11 Abs 3 der ISD abgeleitet. Für den Fall, dass der Finanzintermediär gleichzeitig auch die Dienstleistung der Anlagebera-tung erbringt, sei diese Bestimmung nicht anwendbar.
Dieses Argument ist jedoch nicht überzeugend, weil es aus der Richtlinie ein Ergebnis ableitet, das sich aus ihr nicht ergibt. Art 11 Abs 2 der ISD [25] ordnet an, dass sich das Kriterium der Professionalität des Anlegers nach dem Anleger bestimmt, „unabhängig davon, ob (der Auftrag) direkt vom Anleger selbst oder indirekt über eine Wertpapierfirma, die die Dienstleistung gemäß Abschnitt A Nummer 1 Buchstabe a) des Anhangs anbietet, erteilt wird.“ Abschnitt A Nr 1 a) des Anhangs zur ISD betrifft die Anla-gevermittlung, also die „Annahme und Übermittlung – für Rechnung von An-legern – von Aufträgen, die eines oder
4.2. Die Rsp des OGHDer OGH hat diese europarechtlichen
Vorgaben der ISD als auch für das öster-reichische Recht maßgeblich anerkannt. Dies geschah in zwei Entscheidungen [23], in denen es genau um diese Prob-lematik der Einschaltung eines Rechts-trägers zwischen Bank und Kunde ging. In diesen Fällen war einer Bank ein Auftrag über einen Versicherungsberater weitergeleitet worden; der OGH erach-tete die Bank als weiter zur Einhaltung der Wohlverhaltensregeln verpflichtet. In beiden Fällen waren Bankkunden von einem Versicherungsberater beraten wor-den und hatten sodann über die beklagte Bank die ihnen im Rahmen der Beratung empfohlenen Papiere gekauft. Die Bank unterließ es zu überprüfen, ob die Kun-den aufklärungsbedürftig iS des WAG 1997 waren. Im von den Kunden gegen die Bank angestrengten Schadenersatz-prozess wandte sie ein, zu einer solchen Exploration der Kundenpräferenzen nicht verpflichtet gewesen zu sein, da die Kun-den sowieso beraten gewesen wären.
Der OGH stellte unter Anknüpfung an Art 11 Abs 3 der ISD klar, dass dieser Um-stand grundsätzlich nicht zum Entfall der Aufklärungspflicht der Bank gegenüber dem Kunden führt. Zwar sei bei der Be-stimmung des Umfangs von Aufklärungs-pflicht im Allgemeinen auf den Vertreter abzustellen; dies gelte aber nicht, wenn der Intermediär die Orders unter Offenle-gung der Identität des Kunden übermittelt. In derartigen Fällen bestimme sich das Kriterium der Professionalität nicht nach dem professionellen Stellvertreter oder Boten, sondern nach dem Endanleger. Ausdrücklich hielt der OGH fest, dass es nicht auf den Eindruck ankommen kann, den die Bank von der Professionalität des Versicherungsberaters gewonnen hat, sondern auf die Professionalität des End-anlegers in Bezug auf dessen Kenntnisse, Erfahrungen und Anlageziele.
4.3. Praktische AuswirkungenIn der Praxis hat dies bedeutet, dass
eine Bank trotz Zwischenschaltung einer Wertpapierfirma die sich aus den Wohl-verhaltensregeln ergebenden Verpflich-tungen gegenüber dem Kunden erfüllen musste. Ging es beispielsweise um den Erwerb eines mit bestimmten Risken verbundenen Papiers, durfte sich die Bank nicht darauf verlassen, dass der den Auftrag übermittelnde Wertpapierdienst-leister sowieso Erfahrung mit derartigen Aktien hatte und diese an seinen Kunden weitergegeben hatte. Die Bank musste vielmehr prüfen, ob der den Auftrag erteilende Kunde über die entspre-chenden Kenntnisse verfügte. Kam sie zum Ergebnis, dass dies nicht der Fall war, musste sie ihm jene Informationen übermitteln, die dazu notwendig waren,
[23] Vgl E 1 Ob 231/04h = ÖBA 2005, 719 und die E 5 Ob 106/05g = ÖBA 2006, 376.
[24] GesRZ 2010, 27, 38.[25] Zur Auslegung der RL siehe auch
Koller, ZBB 1996, 97.

AbhAndlungen Aufklärungspflicht der BAnk
ÖBA 4/12 233
Bank die geeignete Beratung sicherstellen kann. Dies ist daher ein Fall, den die ISD gar nicht anspricht. Sie betrifft vielmehr gerade Konstellationen, in denen ein den Vorschriften der RL unterliegender Rechtsträger eine vorgeschaltete Dienst-leistung erbringt. Nur in dieser Situation stellte sich die Frage, ob zusätzlich zu diesem Rechtsträger auch die nachge-schaltete Bank Pflichten nach der ISD treffen. Und diese Frage wurde von der ISD eindeutig im Sinn der Bejahung des Pflichtenbestandes beantwortet.
Die Unvereinbarkeit der Ansicht von Knobl/Grafenhofer mit den Vorgaben der ISD und damit den Vorgaben des WAG 1997 ist besonders deswegen hervorzu-heben, weil der OGH in zwei aktuellen Entscheidungen [27] den Eindruck er-weckt, als würde dieser beiden Autoren Meinung der hA und vor allem der bisherigen Rsp des OGH entsprechen. Das trifft schon deswegen nicht zu, weil die eigene Judikatur des OGH – die in diesen beiden Entscheidungen bemer-kenswerter Weise nicht einmal zitiert wird – der Ansicht von Knobl/Grafenhofer wi-derspricht. Die beiden anderen Autoren, Koziol [28] und Gumpoltsberger [29], auf die sich der OGH in diesen beiden E beruft, haben sich nicht mit dem allge-meinen Problem des Verhältnisses von Bank und vorgeschaltetem Dienstleister beschäftigt, sondern vielmehr mit der spezifischen Problematik der Aufklä-rung über Kick-Back-Zahlungen. Im Fall der Ausführungen von Koziol kommt hinzu, dass er sich überhaupt nicht mit der Anlageberatung, sondern mit exter-nen Vermögensverwaltern beschäftigt. Eine eigene Untersuchung, inwieweit die Bank allgemeine Aufklärungspflichten treffen bzw inwieweit das mit der Bank abgeschlossene Effektengeschäft wegen Irrtums angefochten werden kann, führen die beiden Autoren nicht durch.
Obwohl die beiden neuen E des OGH insoweit problematisch sind, als sie hin-sichtlich der vor dem WAG 2007 gege-benen Rechtslage die Pflichtenlage der Bank wohl zu eng fassen, sind sie für den vorliegenden Zusammenhang bedeutsam. Der OGH stellt in ihnen nämlich klar, dass die von ihm eingenommene restriktive Position nicht bedeutet, dass die Bank bei Vorschaltung eines anderen Rechts-trägers keineswegs von allen Aufklä-rungspflichten befreit ist. Auch in einem solchen Fall finden – so ausdrücklich das Höchstgericht – die Wohlverhaltensregeln
mehrere der in Abschnitt B genannten Instrumente zum Gegenstand haben.“
Wenn durch den Verweis auf diese Definition nur auf die Dienstleistung der Vermittlung abgestellt wird, hat das nicht den Grund, dass andere Fälle ausgeschlos-sen werden sollen, sondern vielmehr den, dass schlichtweg zwischen zwei Fällen differenziert werden soll, nämlich dem, in dem der Kunde selbst der Bank den Auftrag erteilt, und jenem, in dem dies durch Einschaltung eines Dritten, eben eines Vermittlers geschieht. Eine dritte Konstellation ist hier schon logisch gar nicht denkbar, kann der Kunde doch den Auftrag nur entweder selbst oder über Einschaltung einer dritten Person ertei-len. Diese dritte Person ist aber zwingend ein Vermittler – eben eine zwischen Kun-den und Bank tretende dritte Person. Die Differenzierung zwischen diesen beiden Konstellationen erfolgt deswegen, weil damit eindeutig zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die sich aus der ISD er-gebenden Pflichten gänzlich unabhängig davon sind, ob der Rechtsträger mit dem Kunden unmittelbar oder mittelbar in rechtsgeschäftliche Beziehung tritt.
Entgegen der Ansicht von Knobl/Gra-fenhofer hat die Bezugnahme des Art 11 Abs 3 der RL auf Abschnitt A Nr 1 a) des Anhangs nicht die Funktion, andere Fälle wie beispielsweise jene, in denen der Vermittler auch als Anlageberater tätig ist, auszuschließen. Eine diesbezügliche Anordnung lässt sich der ISD nicht ent-nehmen. Ganz im Gegenteil ist die ISD so zu verstehen, dass in allen Fällen, in denen ein Auftrag über einen Intermediär an den Rechtsträger weitergeleitet wird, den Rechtsträger dieselben Pflichten wie in jenen Fällen treffen, in denen der Kun-de selbst den Auftrag an die Bank erteilt. Dies ist ja offenkundig auch die Ansicht des OGH, fungierte in den beiden von ihm entschiedenen Fällen der Intermediär gerade nicht bloß als Vermittler, sondern als Anlageberater [26]!
Dies galt unabhängig davon, ob es sich beim vorgeschalteten Rechtsträger um ein konzessioniertes Wertpapierdienstleis-tungsunternehmen handelte oder nicht. Dass die Bank nicht von ihren sich aus dem WAG 1997 ergebenden Pflichten befreit wurde, wenn der Kunde zuvor von einem den Konzessionserfordernis-sen nicht entsprechenden Rechtsträger beraten wurde, versteht sich von selbst und bedarf im Grunde gar keiner Erörte-rung, da in einem solchen Fall ja nur die
der §§ 11 ff WAG 1997 Anwendung. Dies führt dazu, dass die Bank gegenüber dem Kunden aufklärungspflichtig werden kann. Das ist dann der Fall, wenn konkre-te Anhaltspunkte oder sogar positives Wissen dafür vorliegen, dass das kun-dennähere Unternehmen seinen Pflichten nicht nachgekommen ist. In einer solchen Konstellation ist die Bank verpflichtet, den Kunden hiervon in Kenntnis zu set-zen [30]. Dass in diesen Situationen eine Aufklärungspflicht besteht, wird auch von allen genannten Autoren vertreten. So nimmt Koziol [31] eine Pflicht der Bank zur Information des Kunden über allfällige Kick-Back-Zahlungen dann an, wenn ihr Verdachtsmomente vorliegen, dass der Vermögensverwalter den Kunden nicht darüber informiert hat. Auch Knobl/Grafenhofer [32] und Baum [33] betonen, dass die Bank dann aufklärungspflichtig wird, wenn sie aufgrund der konkreten Umstände Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit der vom vorgeschalteten Rechtsträger erbrachten Leistung haben muss. Es wird sich zeigen, dass die im Rahmen der hier angestellten Überle-gungen interessierenden Fälle gerade so beschaffen sind, dass selbst die von der restriktiven Sichtweise aufgestellten Voraussetzungen für die Bejahung einer Aufklärungspflicht erfüllt sind.
5. Zur Frage des Bestands von Aufklärungspflichten
5.1. Voraussetzungen einer Aufklärungspflicht
Auf der Basis der in den beiden voran-gehenden Abschnitten dargestellten Rege-lungen lässt sich nun prüfen, in welchem Umfang die Bank in den hier interessie-renden Fällen gegenüber dem Kunden Aufklärungspflichten treffen, um zu ver-hindern, dass der Kunde bei Abschluss des Vertrages über den Erwerb der Papiere in einem Irrtum befangen ist. Letztlich dient jede Aufklärungspflicht dazu, eine informierte und insoweit selbstbestimmte Entscheidung des Vertragspartners zu gewährleisten. Zwar ist es grundsätzlich Sache jeder Vertragspartei, sich selbst die Informationen zu beschaffen, die sie benötigt, um einen Vertrag abzuschlie-ßen, der ihren Interessen entspricht. In bestimmten Fällen legt die Rechtsordnung aber der Gegenseite die Verpflichtung auf, der anderen Seite für ihren Vertrags-
[26] Unrichtig daher Baum, ÖBA 2010, 285, der diese beiden OGH-E zu wenig be-rücksichtigt.
[27] 4 Ob 50/11y = ÖBA 2011, 898 und
10 Ob 69/11m.[28] ÖBA 2003, 483. [29] ecolex 2005, 682. [30] OGH 10 Ob 69/11m (unter I.1.3.);
4 Ob 50/11y = ÖBA 2011, 898 (unter 3.4.).[31] ÖBA 2003, 486. [32] GesRZ 2010, 39. [33] ÖBA 2010, 284.

grAf AbhAndlungen
234 ÖBA 4/12
schluss wichtige Informationen zukom-men zu lassen [34].
Bei der Beurteilung, ob eine Infor-mationspflicht besteht, sind verschiede-ne Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Offenkundige Relevanz kommt dabei dem Umstand zu, ob der einen Partei bekannt oder doch zumindest erkennbar ist, dass sich die Gegenseite in einem Irrtum über für den Vertragsabschluss wesentliche Aspekte befindet. Wer weiß, dass sein Gegenüber eine unzutreffende Vorstellung vom Vertragsgegenstand hat, den wird eher eine Aufklärungspflicht treffen als denjenigen, der dies nicht weiß und aufgrund der Umstände auch nicht wissen muss. Das gilt auch im Bereich des Effektengeschäftes: Weiß die Bank, dass ein Kunde, der eigentlich eine sichere Veranlagung sucht, im Begriff ist, ein hochriskantes Papier zu erwerben, weil er irrtümlich davon ausgeht, es würde sich um ein risikoloses Investment handeln, wird sie eher eine Aufklärungspflicht treffen als in jenem Fall, in dem sie über diese Information nicht verfügt [35]. Das hat bereits die Darstellung von Lehre und Rsp in Abschnitt 4.4. gezeigt: Selbst jene Autoren, die beispielsweise eine Verpflichtung der Bank verneinen, den Kunden über Kick-Back-Zahlungen an den Anlageberater aufzuklären, bejahen eine entsprechende Verpflichtung dann, wenn der Bank bekannt ist oder sich ihr doch aufgrund der Umstände aufdrängen muss, dass der Anlageberater diese Pro-visionen dem Kunden verschweigt.
Der Frage, in welchem Umfang bei der Bank Informationen über den Kunden und seine Kenntnisse hinsichtlich des zu erwerbenden Papiers vorliegen, kommt für die Bestimmung des Bestands und Umfangs allfälliger Aufklärungspflich-ten somit große Bedeutung zu. Noch wesentlicher ist freilich die zweite Frage, nämlich inwieweit der Bank im konkreten Fall Informationen darüber vorliegen, dass jene Vorstellungen, die der Kunde hinsichtlich des von ihm zu tätigenden Investments hat, unrichtig sind. Diese zweite Frage ist deswegen für die Beurtei-lung des Bestands von Aufklärungspflich-ten zentral, weil es diese Kenntnis von der Unzutreffendheit der Vorstellungen des Kunden ist, die in besonderem Maße geeignet ist, eine Informationspflicht auf Seiten der Bank auszulösen, muss der Bank damit doch klar sein, dass der Kun-de im Begriff ist, ein Geschäft zu tätigen,
5.3. Bank verursacht Geschäftsirrtum durch aktives Tun
Sind diese Informationen falsch, kann dies einen Geschäftsirrtum des Kunden hervorrufen. Zur Anfechtung des mit der Bank abgeschlossenen Effektengeschäf-tes berechtigt ihn dieser Irrtum gemäß § 871 ABGB aber nur dann, wenn – sieht man vom praktisch kaum relevanten Fall der rechtzeitigen Aufklärung ab – der Irrtum von der Bank verursacht wurde oder ihr auffallen musste. Eine Verursa-chung liegt jedenfalls dann vor, wenn die Fehlinformation auf ein positives Tun der Bank zurückzuführen ist; das ist un-zweifelhaft in der dritten Variante der Fall. Hier hat sie selbst falsche Informationen in die Welt gesetzt, die beim Kunden eine falsche Vorstellung vom Anlageprodukt hervorgerufen haben.
Ein Beispiel für eine solche Konstella-tion finden wir in den OGH-E [36] zu den MEL-Zertifikaten. Hier waren von einer Bank Zertifikate verkauft worden, denen in den von der Bank – bzw von einer ihrer Vertriebstöchter – erstellten Verkaufs- prospekten unzutreffende Eigenschaften beigelegt worden waren, die dem Leser eine besondere Sicherheit der Zertifi-kate suggerierten, die in Wirklichkeit nicht gegeben war. Der OGH bejahte einen von der Bank herbeigeführten Geschäftsirrtum, welcher dem Kunden die Berechtigung zur Anfechtung des Effektengeschäfts gab. Dass der Kunde von einem Finanzberater beraten worden war und seine Anlageentscheidung erst nach Beratung mit dem Berater getrof-fen hatte, stand dem zutreffend nicht entgegen. Wenn die verkaufende Bank selbst einen Irrtum beim Kunden ver-ursacht, dann trifft die Verantwortung für diesen Irrtum sie. Dass der Vermö-gensberater möglicherweise auch einen Irrtum beim Kunden verursacht hat oder seinen Informationspflichten gegenüber dem Kunden nicht nachgekommen ist, ändert daran nichts.
5.4. Die Unterlassung der gebotenen Aufklärung
Hingegen hat die Bank in den anderen drei Variationen den Irrtum des Kunden jedenfalls nicht durch positives Tun verur-sacht; eine Verursachung könnte allenfalls durch Unterlassung der gebotenen Auf-klärung erfolgt sein. Auch dann, wenn der Bank der Irrtum des Kunden auffallen
das seinen Interessen nicht entspricht, sondern auf einem Irrtum beruht.
5.2. Woher erhält der Kunde falsche Information?
Woher erhält der Kunde aber nun even-tuell falsche Vorstellungen hinsichtlich des von ihm ins Auge gefassten Invest-ments? Hier kommen vier verschiedene Ursachen in Betracht. Die erste Ursache kann im Bereich des Kunden angesiedelt sein. Dies wäre zB dann der Fall, wenn ein Bekannter ihm erzählt, bei einem bestimmten Papier handle es sich um ein sehr sicheres Papier, was aber den Tatsachen nicht entspricht. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass der vor-geschaltete Wertpapierdienstleister dem Kunden unzureichende oder unzutreffen-de Informationen hinsichtlich des Anlage-produktes mitteilt.
Drittens besteht die Möglichkeit, dass die den Ankauf durchführende oder im Wege des Selbsteintritts selbst verkau-fende Bank, mit der der Kunde das Effek-tengeschäft abschließt, selbst unrichtige Informationen in Umlauf gesetzt hat. Diese Möglichkeit besteht insbesondere dann, wenn diese Bank – zB als Emis-sionsbank – den Vertrieb der Papiere aktiv betreibt. In einem solchen Fall ist es üblich, dass von der Bank eigene Werbe- bzw Informationsunterlagen hergestellt werden. Hinsichtlich dieser Unterlagen besteht dann die Möglichkeit, dass sie unzutreffende, etwas euphemistische In-formationen enthalten. Die vierte Variante ist schließlich darin zu sehen, dass die un-richtigen Angaben vom Emittenten selber stammen; dies wäre dann der Fall, wenn ein allfälliger Prospekt falsche Angaben enthält oder auf sonstige Weise unrichtige Angaben gemacht werden.
Diese vier Möglichkeiten schließen einander nicht aus, sondern können einan-der überlappen: Finden sich im Prospekt falsche Angaben, besteht die große Wahr-scheinlichkeit, dass solche unzutreffenden Informationen dem Kunden in der Folge vom Vermögensberater weitergegeben werden. Dieser stützt sich in der Regel auch auf Informationen, die er – etwa in Schulungen – von der in den Vertrieb ein-gebundenen Bank oder vom Emittenten erhält; sind schon diese Informationen unrichtig, wird dies auch Niederschlag in den Informationen finden, die der Berater dem Anleger gibt.
[34] Details siehe bei Graf, Zweckentfrem-dete Anlegergelder und Aufklärungspflicht der Bank beim Effektengeschäft, im Erscheinen.
[35] Vgl Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts: Bydlinski (749) formuliert folgenden Informationsgrundsatz: „Im ge-
schäftlichen Kontakt ist bei starkem (konkre-tem oder typischem) Informationsgefälle der besser informierte Partner verpflichtet, den anderen (insbesondere einen Verbraucher) im zumutbaren Ausmaß über die für diesen wesentlichen Umstände zu informieren; wo
Informationspflichten nicht ausreichen, sind weitere rechtliche Maßnahmen erforderlich, die die Auswirkungen des Gefälles mildern.“
[36] 4 Ob 65/10b, 8 Ob 25/10z und öfter.

AbhAndlungen Aufklärungspflicht der BAnk
ÖBA 4/12 235
gesehen – unzweifelhaft auch eine Ver-pflichtung, den Kunden über den wahren Sachverhalt zu informieren, seinen Irr-tum also insoweit zu korrigieren. Wann ist diese Voraussetzung aber gegeben? Hier ist es wohl notwendig, zwischen verschiedenen Konstellationen zu dif-ferenzieren und darauf abzustellen, wie sehr die Bank dem Unternehmen, welches das Anlageprodukt emittiert, nahesteht. Je größer hier die Nahebeziehung ist, desto eher ist davon auszugehen, dass der Bank die wirkliche Lage des Unternehmens bekannt ist. Dies ist dann wesentlich, wenn das Unternehmen in seinen an die Öffentlichkeit gerichteten Aussagen Angaben macht, die den Tatsachen nicht entsprechen. Grundsätzlich kann man Wertpapiere über jede Bank kaufen. Die Banken sind aber in ganz unterschied-licher Weise in Verkauf und Vertrieb der Papiere involviert. Am stärksten ist diese Einbindung bei der Emissionsbank. Sie trifft gem § 11 Abs 1 KMG die Verant-wortung für die Richtigkeit des Prospekts; ist diese nicht gegeben, können gegen die Emissionsbank Prospekthaftungsansprü-che geltend gemacht werden [40].
Ein aktueller Fall [41] bietet Anschau-ungsmaterial; hier hatte die Bank die AG gegründet, deren Aktien sodann auf dem Kapitalmarkt plaziert wurden. Den Anlegern wurde versprochen, ihr Geld würde in Immobilien investiert werden. Das traf aber nur partiell zu; ein nicht unbeträchtlicher Teil der Anlegergelder wurde zur Finanzierung des Erwerbs eigener Aktien aufgewendet. Ein anderer Teil wurde in riskante Fonds investiert oder in einem Karussell von Konzern-gesellschaften hin und her geschickt. Und das Investment in Grund und Boden erfolgte auch nur in mediatisierter Form, indem Tochtergesellschaften gegründet wurden, die sodann die Immobilien an-schafften. Die AG erwarb mit dem Geld der Anleger somit nicht Grund und Boden, sondern bestenfalls Gesellschafterrechte an Gesellschaften, die ihrerseits das Geld erst in Immobilien investierten. Dies alles waren Umstände, die dem von den Anlegern verfolgten Zweck diametral zu-widerliefen [42]. Die Aktien waren ihnen als Immobilienaktien verkauft worden
hätte müssen, könnte er zur Irrtumsan-fechtung gegenüber der Bank berechtigt sein. In solchen Fällen wird freilich typi-scherweise auch eine Aufklärungspflicht der Bank zu bejahen sein – erkennt der Rechtsträger, dass sich der Kunde hin-sichtlich des von ihm zu erwerbenden Papiers in einem Irrtum befindet, trifft ihn eine Verpflichtung, den Kunden auf die-sen Irrtum hinzuweisen. Das war schon im Anwendungsbereich des WAG 1997 so; dessen § 13 Z 4 verpflichtete den Rechts-träger, dem Kunden alle zweckdienlichen Informationen mitzuteilen, soweit dies zur Wahrung der Interessen der Kunden und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich war. Musste der Rechtsträger erkennen, dass der Kunde die betreffenden Papiere beispielsweise deswegen erwarb, weil er sie für risikolos hielt, obwohl es sich in Wirklichkeit um sehr riskante Papiere handelte, musste er den Kunden über den wahren Sachverhalt aufklären. Es handelte sich insoweit um eine zweck-dienliche Information, die dem Kunden zur Wahrung seiner Interessen mitzuteilen war. An dieser Rechtslage hat sich auch durch die Erlassung des WAG 2007 nichts geändert, da die in §§ 13 und 14 WAG 1997 enthaltenen Verpflichtungen nichts anderes als die Konkretisierung vor- oder nebenvertraglicher Pflichten dargestellt haben [37]. In ihrem grundsätzlichen Bestand waren diese Pflichten vom WAG 1997 unabhängig, wurden sie von der Rspr doch schon vor dem Inkrafttreten des WAG 1997 mindestens seit der E 4 Ob 516/93 (KB-Lux-Fund) [38] bejaht. Die Aufhebung des WAG 1997 bzw seine Ersetzung durch das WAG 2007 hat am grundsätzlichen Bestand dieser Pflichten daher nichts geändert.
5.5. Kenntnis der Unrichtigkeit der Information verpflichtet zur Aufklärung
Ein Irrtum des Kunden kann der Bank nur dann [39] auffallen, wenn sie weiß oder aufgrund sich ihr aufdrängender Um-stände wissen muss, dass die Information des Kunden, auf deren Grundlage er das Effektengeschäft abschließt, unrichtig ist. In diesem Fall trifft sie – wie soeben
– also mehr Immobilien als Aktien. Man versprach den Anlegern eine Sicherheit, die eine größere war als bei „normalen“ Aktien. Dass dies nicht zutraf und dass man das Geld zu einem Gutteil nicht un-mittelbar in Immobilien anlegte, das war eine Information, die man den Anlegern vorenthielt; in den offiziellen Unterlagen war sie auch nicht auffindbar.
Die Bank, die den Vertrieb dieser Aktien übernommen hatte, war natürlich über diese Umstände voll im Bilde – der Vorsitzende ihres Vorstandes fungierte gleichzeitig als Mitglied des Vorstands der AG. Sie wusste auch, dass man von Seiten der AG den Anlegern diese Um-stände nicht kommuniziert hatte, sondern ihnen eben ganz im Gegenteil versprach, ihr Geld sicher in Immobilien zu inves-tieren. Daher wusste sie auch, dass die Anleger hinsichtlich dieser Aktien nicht korrekt informiert waren, sondern sich in einem Geschäftsirrtum befanden. Hätte der typische Anleger gewusst, welche abredewidrige Verwendung von seinem Kapital gemacht wurde, hätte er die Aktien nicht gekauft, sondern sein Geld lieber auf dem zwar niedrig verzinsten, aber aufgrund der Staatsgarantie sicheren Sparbuch gelassen. Dass die Bank in einer solchen Situation die Verpflichtung zur Aufklärung des Kunden hinsichtlich des wahren Sachverhalts trifft, liegt auf der Hand [43].
6. Aufklärungspflicht auch bei Vorschaltung eines anderen Rechtsträgers
Allerdings stellt sich die Frage, ob sich an dieser grundsätzlichen Bejahung einer Aufklärungspflicht der Bank dadurch etwas ändert, dass der Kunde nicht unmit-telbar den Kontakt zur Bank gesucht und gefunden hat, sondern über Vermittlung eines anderen Rechtsträgers.
Bei der Prüfung dieser Frage ist primär von § 27 WAG 2007 auszugehen, der ja das Zusammenspiel zweier Rechtsträ-ger regelt; zu unterscheiden ist weiters zwischen der in Abs 1 und der in Abs 2 geregelten Situation.
[37] 2 Ob 236/04a = ÖBA 2005, 635; 7 Ob 64/04v = ÖBA 2005, 721.
[38] = ÖBA 1993, 987.[39] Dem ist freilich der Fall gleichzuhal-
ten, dass die Information zwar an sich richtig ist, die Bank aber weiß oder wissen muss, dass der Kunde die Information falsch verstanden hat.
[40] Entsprechendes gilt nach § 11 Abs 1 Z 3 KMG auch für denjenigen, der im eigenen oder im fremden Namen die Vertragserklärung
des Anlegers entgegengenommen hat, bzw den Vermittler des Vertrages. Gegen ihn können Prospekthaftungsansprüche geltend gemacht werden, wenn er den Handel oder die Vermitt-lung gewerbsmäßig betreibt und er oder seine Leute die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Prospekts oder der Kontrolle kannten oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht gekannt haben.
[41] Hierzu vgl OGH 7 Ob 77/10i = ÖBA 2011, 501 und Graf, Zweckentfremdete An-
legergelder und Aufklärungspflicht der Bank beim Effektengeschäft, im Erscheinen.
[42] In den Fällen des share-deal ergibt sich typischerweise ein Problem aus einer allfälligen Fremdfinanzierung, die dazu führt, dass den Aktiva auch Verbindlichkeiten ge-genüberstehen.
[43] Vgl Graf, Zweckentfremdete Anleger-gelder und Aufklärungspflicht der Bank beim Effektengeschäft, im Erscheinen.

grAf AbhAndlungen
236 ÖBA 4/12
6.1. § 27 Abs 1 WAG schließt keine Aufklärungspflichten aus
Was § 27 Abs 1 WAG betrifft, fällt so-fort ins Auge, dass diese Bestimmung die Frage, inwieweit den Rechtsträger gegen-über dem Kunden Informationspflichten treffen, überhaupt nicht anspricht und daher den Rechtsträger auch nicht von der Erfüllung allfälliger Informations-pflichten entbindet. § 27 Abs 1 führt lediglich dazu, dass der Rechtsträger beim Kunden keine Informationen einholen muss, sondern sich auf jene Informa-tionen verlassen kann, die über den ers-ten Rechtsträger weitergegeben werden [44]. Die eigene Informationspflicht des zweiten Rechtsträgers wird überhaupt nicht eingeschränkt.
Dies ist deswegen praktisch bedeut-sam, weil das WAG 2007 dem Rechts-träger sehr umfassende, im Detail in § 40 WAG aufgelistete Informationspflichten auferlegt. Dass diese Informationspflich-ten durch § 27 WAG nicht beseitigt werden, hat einen ganz einfachen Grund. Die Informationen, die der Rechtsträger dem Kunden übermitteln muss, beziehen sich auf die dem Kunden vom Rechtsträ-ger erbrachte Wertpapierdienstleistung, den Erwerb von Wertpapieren. Diese Dienstleistung wird aber nicht vom ers-ten, sondern vom zweiten Rechtsträger erbracht. Die Einschaltung des ersten Rechtsträgers ändert daher daran nichts, dass der zweite Rechtsträger den Kunden über all jene Punkte informieren muss, die sich auf seine Wertpapierdienstleistung beziehen und im WAG vorgesehen sind.
Aus dem Umstand, dass § 27 Abs 1 zu keiner Reduktion der Informations-pflichten des Rechtsträgers nach WAG führt, lässt sich ein Größenschluss hin-sichtlich solcher Informationspflichten ziehen, die den Rechtsträger nach allge-meinem Zivilrecht treffen: Wenn durch die spezielle Regelung des WAG nicht einmal die WAG-spezifischen Informa-tionspflichten ausgesetzt werden, dann kann dieser WAG-spezifischen Regelung umso weniger eine pflichtenausschlie-ßende Wirkung auf dem Gebiet des Zivilrechts zukommen! § 27 Abs 1 WAG hat daher unmittelbar überhaupt keinerlei Auswirkungen auf den Bestand allgemein zivilrechtlicher Aufklärungspflichten. Der Umstand, dass der Rechtsträger sich auf die Kundeninformation verlassen darf, bedeutet ja nicht, dass er damit auch da-von ausgehen darf, dass der Kunde alle
auf das Grundbuch: Das Vertrauen des Erwerbers auf bestimmte Eintragungen im Grundbuch wird nur soweit geschützt, als der Erwerber die Unrichtigkeit der Eintragung nicht kennt und sie ihm auch nicht bekannt sein muss, wobei bereits leichte Fahrlässigkeit schadet [46]. Wenn nun durch § 27 Abs 2 WAG ebenfalls ein Vertrauensschutz etabliert wird, dann folgt aus dem allgemeinen Grundsatz, dass dieser Vertrauensschutz jedenfalls nur soweit reicht, als dem Rechtsträger nicht gegenteilige Informationen vor-liegen. Weiß der zweite Rechtsträger aufgrund solcher Informationen, dass die Empfehlung falsch ist, ist er trotz § 27 Abs 2 WAG zu entsprechender Informa- tion des Kunden verpflichtet. Der po-sitiven Kenntnis ist es gleichzuhalten, wenn dem Rechtsträger konkrete An-haltspunkte vorliegen, aus denen sich der Verdacht ergibt, dass die Information falsch ist.
6.2.2.1. Kein Vertrauensschutz aufgrund besonderer Kenntnisse
Eine solche Situation ist typischer-weise dann gegeben, wenn der zwei-te Rechtsträger über Informationen verfügt, die dem ersten unbekannt sind und daher in die Formulierung der Empfehlung nicht einfließen konnten. Damit ist ja unweigerlich eine Situation gegeben, in welcher auch die Informa- tionen des Kunden selbst falsch sind. Dies lässt sich anhand des oben gebrachten Beispiels verdeutlichen: Hier weiß das als Emissionsbank tätige Kreditinstitut zum einen über die Interna der Aktienge-sellschaft Bescheid. Die Bank weiß, dass die Aktiengesellschaft, deren Aktien zu erwerben der Kunde im Begriff ist, den Erwerb eigener Aktien durch die Bank bzw deren Tochtergesellschaften finan-ziert, und sie weiß auch von der sonsti-gen zweckwidrigen Verwendung der von Anlegern aufgebrachten Mittel durch die Aktiengesellschaft. Zum anderen ist der Bank aber auch bekannt, welche Infor-mationen die Emittentin den Anlegern zu-kommen hat lassen, welche Verwendung der Anlagegelder also zB im Prospekt in Aussicht gestellt wurde.
Damit weiß die Bank, dass die Anleger hinsichtlich des erworbenen Anlagepro-duktes eine falsche Vorstellung haben – eben weil die Aktiengesellschaft das Kapital der Anleger einer anderen Ver-wendung zuführt als versprochen wurde.
notwendigen Informationen erhalten hat, die er benötigt, um die Sinnhaftigkeit des Rechtsgeschäfts beurteilen zu können. Am Bestand der allgemeinen zivilrecht-lichen Aufklärungspflichten ändert sich durch § 27 Abs 1 WAG gar nichts.
6.2. Aufklärungspflicht im Bereich des § 27 Abs 2 WAG
6.2.1. § 27 Abs 2 WAG etabliert Vertrauensschutz
Dasselbe Ergebnis gilt auch im Bereich des § 27 Abs 2 WAG. Hier erhält die Bank einen Auftrag von einem anderen Rechtsträger, der dem Kunden bereits eine spezielle Empfehlung hinsichtlich dieses Papiers gegeben hat und der Bank ist die Existenz dieser Empfehlung be-kannt. Der vorgeschaltete Rechtsträger hat somit geprüft, ob das Papier für den Kunden geeignet ist. Er hat geprüft, ob es den Anlagezielen des Kunden entspricht, ob der Kunde in der Lage ist, die damit verbundenen Risiken zu verstehen und ob der Kunde von seinen finanziellen Verhältnissen her in der Lage ist, die mit dem Produkt verbundenen Risiken zu verkraften [45].
Wenn das Gesetz formuliert, der Rechtsträger, der den Auftrag gem Abs 1 erhält, dürfe sich auf Empfehlungen verlassen, die dem Kunden vom ersten Rechtsträger gegeben wurden, so wird hiermit ein Vertrauensschutz etabliert. Der nachgeschaltete Rechtsträger darf darauf vertrauen, dass das dem Kunden empfohlene Papier Eigenschaften auf-weist, die den in seinen Anlagezielen ge-bündelten Interessen des Kunden entspre-chen. Bei Aktien darf die dem Kunden die Aktien liefernde Bank darauf vertrauen, dass der Kunde Kenntnis von den Risiken hat, die mit dem Erwerb dieser Art von Wertpapier verbunden sind.
6.2.2. Die Grenzen des Vertrauens-schutzes
Jeder durch das Gesetz oder auf sons-tige Weise etablierte Vertrauensschutz hat aber seine inhärenten Grenzen. Das Vertrauen einer Person auf eine bestimmte Sachlage wird grundsätzlich nur soweit geschützt, als es berechtigt ist. Keines-falls berechtigtes Vertrauen liegt dann vor, wenn die in ihrem Vertrauen geschützte Person weiß, dass in Wirklichkeit eine andere Sachlage gegeben ist. Das zeigt zB deutlich der Schutz des Vertrauens
[44] Jedoch auch hier ist es möglich, dass den zweiten Rechtsträger Nachforschungs-pflichten treffen. Dies wäre dann der Fall, wenn die vom ersten Rechtsträger weitergelei-tete Information offenkundig unvollständig ist.
[45] Aufgrund dieser Vortätigkeit des kun-dennäheren Rechtsträgers besteht insoweit eine gegenüber § 27 Abs 1 WAG veränderte Situation, als der Rechtsträger nicht mehr prüfen muss, ob der Kunde die mit dem Papier
verbundenen Risiken verstehen kann, da diese Prüfung bereits der vorgeschaltete Rechtsträ-ger erledigt hat.
[46] Vgl statt aller Koziol/Welser, Bürger-liches Recht I13 364 ff.

AbhAndlungen Aufklärungspflicht der BAnk
ÖBA 4/12 237
Aktiengesellschaft verfügt, so wäre für sie weder erkennbar, dass die vom Anlagebe-rater dem Kunden gegebene Empfehlung seinen Interessen nicht entspricht, noch ersichtlich, dass sich der Kunde bezüg-lich des Investmentobjekts in einem Geschäftsirrtum befindet. Es wäre daher die zivilrechtliche Voraussetzung für das Bestehen einer Aufklärungspflicht nicht gegeben; die Bank könnte sich vielmehr auf die vom ihr vorgeschalteten Rechts-träger gegebene Empfehlung verlassen, ohne dass sie eigene spezielle Informa-tionspflichten träfen.
Damit bestätigt sich, dass bei der Beurteilung des Bestands der Aufklä-rungspflicht die Nähe der das Effek-tengeschäft durchführenden Bank zur Emittentin durchaus eine Rolle spielt: Je größer diese Nähe, desto eher ist der Bank die Innenperspektive der Emittentin zugänglich. Verfügt eine Bank hingegen nur über die Außenperspektive, wird ihr nur intern zugängliche Information nicht bekannt sein. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass eine Bank, die in ihr Portfolio [47] ein bestimmtes Produkt aufnimmt, eine Verpflichtung trifft, sich hinsichtlich dieses Produktes umfassend zu informieren, um diese Information den eigenen Kunden weitergeben zu können [48]. Soweit die Bank im Zuge dieser Re-cherchen auf Informationen stößt, die dem sich aus der bloßen Außenperspektive ergebenden Wissensstand widersprechen, kann dies zu Aufklärungspflichten führen und verhindern, dass sich die Bank auf die dem Kunden vom vorgeschalteten Rechtsträger gegebene Empfehlung ver-lassen kann.
Es zeigt sich somit, dass § 27 WAG eine Aufklärungspflicht der Bank ge-genüber dem Kunden keineswegs stets ausschließt. Entscheidend ist freilich, dass der Bank die Aufklärungsbedürftigkeit des Kunden bekannt ist oder bekannt sein muss. Diese Voraussetzung ist – wie gesehen – jedenfalls dann erfüllt, wenn der Bank jene relevanten Informationen zugänglich sind, über die der vorgeschal-tete Rechtsträger nicht verfügt, und die Bank von letzterem Umstand Kenntnis hat. Das bedeutet auch, dass die Bank nicht bloß bei positiver Kenntnis der Aufklärungsbedürftigkeit des Kunden aufklärungspflichtig werden kann. Dem gleichzuhalten ist die Situation, in dem diese Aufklärungsbedürftigkeit des Kun-den für die Bank evident ist, sich ihr
Gleichzeitig weiß die Bank aber, dass der Wertpapierdienstleister, der dem Kunden den Erwerb dieser Aktien empfohlen hat, von diesen, die Ungeeignetheit des Papiers begründenden Umständen keine Kenntnis hat, geht es doch hier eben um vor der Öffentlichkeit aus gutem Grund verborgene Interna: Hätte die Öffentlich-keit Kenntnis von ihnen, müssten die Ak-tiengesellschaft und die Bank befürchten, dass sich keine Erwerber für die Aktie finden. Der Bank muss auch klar sein, dass der Vermögensberater, hätte er von diesen Umständen Kenntnis, das Papier dem Kunden nicht empfohlen hätte.
Die Bank kann daher trotz des Um-stands, dass die Aktien dem Kunden vom ersten Rechtsträger empfohlen wurden, nicht davon ausgehen, dass sie seinen Interessen tatsächlich entsprechen. Der Bank muss bewusst sein, dass die Anlageempfehlung auf Basis falscher Annahmen erteilt wurde. Damit ist die Vermutung des § 27 Abs 2 WAG wider-legt. Und das hat nun auch Konsequenzen für die Frage des Bestehens von Aufklä-rungspflichten auf Seiten der Bank: Wenn die Bank nicht davon ausgehen kann, dass die auf Seiten des Kunden bestehenden Fehlinformationen vom Anlageberater korrigiert wurden, weil dem Berater die korrekte Sachlage unbekannt war, dann sind damit die Voraussetzungen für eine Aufklärungspflicht der Bank gegeben, nämlich die Kenntnis der Bank davon, dass der Kunde im Begriff ist, mit ihr ein Effektengeschäft auf der Basis falscher Vorstellungen hinsichtlich des Geschäfts-gegenstandes zu schließen, sich also in einem Geschäftsirrtum befindet. Damit ist sie verpflichtet, ihn von der wahren Sach-lage in Kenntnis zu setzen. Andernfalls steht dem Kunden das Recht zur Anfech-tung des Effektengeschäfts wegen eines von der Bank durch unterlassene Aufklä-rung verursachten Geschäftsirrtums zu; gleichzeitig würde ein Irrtum vorliegen, welcher der Bank auffallen hätte müssen.
Das soeben gebrachte Beispiel zeigt deutlich, dass es für die Frage des Bestands einer Aufklärungspflicht der Bank essentiell auf ihren Wissensstand ankommt. Würde es sich bei der Bank in unserem Beispiel nicht um jene Bank han-deln, deren Vorstandsvorsitzender gleich-zeitig die Geschicke der Aktiengesell-schaft lenkt, sondern eine andere Bank, die über keinerlei nähere Informationen hinsichtlich der geheimen Interna der
also aufgrund konkreter Anhaltspunkte aufdrängt. Schließlich kann eine Auf-klärungspflicht der Bank auch aufgrund solcher Information bestehen, die ihr nicht zur Verfügung steht, die sie sich aber bei gesetzeskonformer Vorgehensweise [49] beschaffen hätte müssen.
6.2.2.2. Kenntnis oder fahrlässige Un-kenntnis von Fehlberatung durch den ersten Rechtsträger
Darüber hinaus ist aber auch eine zweite Konstellation zu berücksichtigen, in welcher eine Informationspflicht der Bank besteht. Dies ist jene Konstellation, in welcher der Bank bekannt ist oder doch bekannt sein muss, dass der erste Rechts-träger seinen nach dem WAG bestehenden Pflichten nicht nachkommt. Auch in der Literatur [50] besteht Einigkeit darüber, dass die Bank sich gegenüber dem Kun-den nicht auf § 27 WAG berufen darf, sondern eigenständig die Geeignetheit oder Angemessenheit der Wertpapier-dienstleistung prüfen muss, wenn ihr konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er erste Rechtsträger seinen Pflichten nicht nachkommt [51]. Dies ist zu erwei-tern um Fälle, in denen der Bank solche Anhaltspunkte zwar nicht vorliegen, dies aber darauf zurückzuführen ist, dass es die Bank unterlassen hat, nähere Infor-mationen einzuholen, obwohl sie dazu aufsichts- oder zivilrechtlich verpflichtet gewesen wäre.
Eine solche Situation würde beispiels-weise beim Vertrieb von sogenannten Im-mobilienaktien dann vorliegen, wenn die von der Bank eingesetzten Vertriebspart-ner gegenüber ihren Kunden das mit diesen Aktien verbundene Risiko falsch darstellten, indem sie solchen Papieren eine größere Sicherheit im Vergleich zu normalen Aktien mit der Begründung beilegen, das von den Anlegern aufge-brachte Kapital würde in Immobilien investiert. Hierdurch würde der Aspekt ausgeblendet, dass es sich auch bei Im-mobilienaktien um Aktien handelt, der Anleger also gerade kein Eigentum an Grund und Boden, sondern nur eine ge-sellschaftsrechtliche Beteiligung erwirbt. Damit trägt der Anleger nicht bloß das Kursrisiko der Aktie, sondern auch das Insolvenzrisiko der Aktiengesellschaft – alles Risiken, die er bei einem Investment in Grund und Boden nicht tragen würde. Wird dem Anleger diese Gefahrenlage vom vorgeschalteten Rechtsträger nicht
[47] Damit sind Fälle gemeint, in denen die Bank beschließt, ein bestimmtes Papier Kunden aus eigener Initiative im Rahmen der Anlageberatung anzubieten oder mit Rechtsträ-gern Vereinbarungen hinsichtlich des Vertriebs dieses Papiers abzuschließen.
[48] Fuchs in Fuchs, WpHG § 31 Rz 25 ff; Graf in Gruber/N. Raschauer, WAG § 38 Rz 13.
[49] Vgl die Nw in Fn 48.[50] Vgl Baum, ÖBA 2011, 284; Knobl/
Grafenhofer, GesRZ 2010, 32; M. Harrer, in
Dullinger/Kaindl, Bank- und Kapitalmarkt-recht 2008 25.
[51] Zur Rsp des OGH siehe oben Ab-schnitt 4.2.

grAf AbhAndlungen
238 ÖBA 4/12
korrekt dargestellt und ist diese Fehlbera-tung der Bank bekannt bzw muss sie ihr bekannt sein, dann wüsste die Bank, dass der Kunde nicht korrekt beraten wurde und somit eine Erfüllung der sich aus dem WAG ergebenden Pflichten durch den Be-rater oder Vermittler nicht stattgefunden hat. Damit wäre die Bank nun selbst ver-pflichtet, dem Kunden die entsprechenden Informationen zukommen zu lassen.
In diesem Fall lässt sich die Entlas-tung der Bank von ihrer eigenen Aufklä-rungspflicht aufgrund der Einschaltung des Vermittlers oder Beraters nicht da-mit rechtfertigen, dass eine überflüssige Doppelaufklärung vermieden werden soll, weil der Vermittler oder Berater diese Information schon erteilt hat. Hier besteht vielmehr aufgrund der Fehlinformation durch den ersten Rechtsträger unver-mindert die Schutzbedürftigkeit des An-legers, sodass in einer solchen Situation die Information des Anlegers durch den zweiten Rechtsträger notwendig ist. Diese Gesichtspunkte sind in solchen Fällen von besonderer Bedeutung, in denen zwischen der Bank und Finanzintermediären eine institutionalisierte Zusammenarbeit [52] hinsichtlich des Vertriebs bestimm-ter Wertpapiere vorliegt. Hier hat die Bank ja gerade aufgrund dieser engen Zusammenarbeit zwangsläufig einen Ein-blick in die Beratungstätigkeit des ersten Rechtsträgers, sodass sie weit eher als eine außenstehende Bank Kenntnis von fehlerhafter Beratung oder Information erhalten wird [53].
Auch das lässt sich am besten an-hand eines Beispiels verdeutlichen. Wenn in den Werbeunterlagen eines Finanz-dienstleisters für Immobilienaktien For-mulierungen wie „Ansparplan“ sowie „Einmalerlag“ verwendet werden, dann ist das eine irreführende Sprachwahl, wird dem Anleger damit doch suggeriert, das von ihm aufgebrachte Geld würde in dieser Form bei der Bank verbleiben; der Umstand, dass das Geld zum Erwerb von Aktien verwendet, also ausgegeben werden sollte, wird dadurch verschleiert. Wenn der Kunde Geld „erlegt“, suggeriert dies, dass das Geld quasi auf einem Konto oder einer vergleichbaren Einrichtung verbleibt. Noch deutlicher ist der Begriff „Ansparplan“; wer anspart, investiert in ein Sparprodukt. Gerade dies passiert aber
die Vorschaltung eines Rechtsträgers die die Bank aufgrund der §§ 11 ff WAG 1997 treffenden Pflichten nicht einge-schränkt wurden, ist dieses Ergebnis offenkundig. Jedoch selbst dann, wenn man der restriktiveren Sichtweise, wie sie zB von Knobl/Grafenhofer vertreten wird, folgen wollte, wäre der Bestand einer Aufklärungspflicht zu bejahen. Der hierfür maßgebliche Umstand ist darin zu sehen, dass es um Situationen geht, in denen die Bank Kenntnis davon hat oder aufgrund evidenter Umstände Kenntnis davon haben muss, dass das dem Kunden zu verkaufende Papier seinen Interessen nicht entspricht, sondern diese durch den Erwerb des Papiers gefährdet sind. Die Bank weiß weiters, dass der Kunde diese Information vom ihn betreuenden Anlageberater nicht erhält, sondern sich hinsichtlich der wahren Eigenschaften des Produktes im Irrtum befindet. Damit ist aber eine Situation verwirklicht, in der auch die restriktive Sicht den Bestand der Aufklärungspflicht trotz Einschaltung eines Anlageberaters bejaht.
7. Der vorgeschaltete Rechts-träger als Verhandlungsgehilfe
Zusätzliche Ansprüche des Kunden gegen die Bank können dann bestehen, wenn der erste Rechtsträger als Verhand-lungsgehilfe des zweiten Rechtsträgers tätig wird. Nach allgemeinem Zivilrecht wird der Verhandlungsgehilfe [56] dem Geschäftsherrn zugerechnet. Ein Irrtum, den der Verhandlungsgehilfe beim Ver-tragspartner verursacht oder der ihm auf-fallen hätte müssen, berechtigt daher zur Anfechtung des mit dem Geschäftsherrn abgeschlossenen Vertrages. In vielen Fäl-len wird der vorgeschaltete Rechtsträger typischerweise als Verhandlungsgehilfe des zweiten Rechtsträgers tätig [57]. Die-ser stattet ihn wie gesehen mit den für den Vertragsabschluss notwendigen Vertrags-formularen aus. Wenn der erste Rechtsträ-ger beim Kunden einen Irrtum verursacht oder ihm ein Irrtum des Kunden auffallen muss, berechtigt dieser den Kunden daher nach allgemeinen zivilrechtlichen Regeln zur Anfechtung des mit der Bank geschlossenen Rechtsgeschäfts.
Dagegen wurden in der Literatur von Knobl/Grafenhofer [58] unter Be-
beim Aktienerwerb nicht. Aktien können niemals jene Sicherheit bieten, wie dies Spareinlagen tun.
Dies ist deswegen wesentlich, weil der OGH in einer anderen Entscheidung derartige Formulierungen zum Anlass nahm, von der Bank eine erhöhte Aufklä-rung zu fordern. In der E 7 Ob 177/98z [54] hatte eine Bank Immobilienaktien vertrieben und bewarb das Produkt ua mit dem Begriff „Ansparmodell“. Der OGH deutete diese Begrifflichkeit zu Recht dergestalt, dass hierdurch beim Kunden der Eindruck verstärkt wurde, sein Geld sicher und gut verzinst anzulegen. Die-ser Eindruck entsprach jedoch nicht der Wirklichkeit, sodass die Möglichkeit zur Anfechtung der mit der Bank hinsichtlich des Erwerbs der Immobilienaktien abge-schlossenen Verträge bejaht wurde. Hinzu kam, dass den Kunden gesagt worden war, Immobilienaktien seien sicherer als Industrieaktien.
Wenn nun die Bank weiß, dass der vorgeschaltete Rechtsträger derart formu-lierte Werbeunterlagen verwendet, dann ist ihr damit bekannt, dass beim Kunden ein unrichtiger Eindruck hinsichtlich des empfohlenen Papiers erweckt wird. Un-geachtet der Regel des § 27 Abs 2 WAG ist die Bank in einer solchen Situation verpflichtet, den Anleger darüber zu infor-mieren, dass das zu erwerbende Produkt nichts mit Sparen [55] oder Gelderlag zu tun hat. Noch weitergehende Rechts-folgen treffen die Bank, wenn sie selbst den Rechtsträger mit Werbeunterlagen ausgestattet hat, in denen diese Formulie-rungen verwendet werden, wenn sie also der Urheber dieser irreführenden Text- passagen ist. Hat sie hierdurch beim Kunden einen Irrtum herbeigeführt, wäre der Kunde aufgrund dieser Irrtumsverur- sachung durch positives Tun zur Irr-tumsanfechtung berechtigt. Auf eine Verletzung vorvertraglicher Aufklärungs-pflichten käme es gar nicht mehr an.
6.3. Zur Rechtslage nach dem WAG 1997
Auch nach der bis zum Inkrafttreten des WAG 2007 geltenden Rechtslage war in den soeben beschriebenen Fällen eine Aufklärungspflicht der Bank zu bejahen. Geht man von der hier vertre-tenen Rechtsansicht aus, wonach durch
[52] Eine solche liegt jedenfalls dann vor, wenn Antragsbögen, Werbefolder uä zur Verfügung gestellt werden; eine solche Zu-sammenarbeit manifestiert sich aber auch in der Abhaltung regelmäßiger Schulungen bzw Produktpräsentationen. Sie wird schließlich immer dann vorliegen, wenn die Bank mit dem Intermediär just zum Zwecke der Ab-satzförderung eigens Vertriebsvereinbarungen
abgeschlossen hat.[53] Darüber hinaus ist in solchen Kon-
stellationen in gewissem Umfang eine Ver-pflichtung der Bank zu bejahen, zumindest im Grundsätzlichen zu überprüfen, ob der Rechtsträger den Beratungsvorgang hinsicht-lich des von der Bank vertriebenen Papiers ent-sprechend den gesetzlichen Vorgaben gestaltet.
[54] = ÖBA 1999, 900 mit Anm Apathy.
[55] Zudem ist der Wortbestandteil „spar“ durch § 31 Abs 2 BWG geschützt und darf nur für Sparurkunden verwendet werden.
[56] Pletzer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 875 Rz 10 f; grundlegend Iro, JBl 1982, 470, 510
[57] Vgl Riedler, ÖJZ 2010, 849.[58] GesRZ 2010, 41; kritisch dazu Von-
kilch, RdW 2010, 326.

AbhAndlungen Aufklärungspflicht der BAnk
ÖBA 4/12 239
ziehungen zu beiden Vertragsteilen steht, schließt die Zurechnung seines Verhaltens an einen Vertragsteil nach stRsp [62] nicht aus. Ist der erste Rechtsträger nun Verhandlungsgehilfe des zweiten Rechts-trägers, so wird er diesem irrtumsrechtlich zugerechnet.
Im Fall des § 27 Abs 2 liegt insoweit eine etwas veränderte Situation vor, als das Gesetz ausdrücklich sagt, der zweite Rechtsträger könne sich auf vom ersten Rechtsträger gegebene Empfehlungen verlassen. Bedeutet dies auch, dass der zweite Rechtsträger sich darauf verlassen kann, dass hinsichtlich des zu erwerben-den Wertpapiers vom ersten Rechtsträger kein Irrtum verursacht wurde oder ihm auffallen hätte müssen? In diese Richtung scheint die Argumentation von Knobl/Grafenhofer [63] zu gehen. Sie argumen-tieren, der Bank könne der erste, die Wert-papierdienstleistung der Anlageberatung erbringende Rechtsträger nicht als Gehilfe zugerechnet werden, weil die Bank selbst keine Verpflichtung zur Erbringung einer Anlageberatung treffe.
Dieses Argument überzeugt nicht, weil es übersieht, dass die Möglichkeit zur zivilrechtlichen Anfechtung des Effek-tengeschäfts wegen Irrtums unabhängig davon ist, welche aufsichtsrechtlichen Pflichten die Bank bei diesem Geschäft treffen [64]. Dies lässt sich anhand des Beispiels des Execution-only-Geschäfts verdeutlichen: Bei diesem treffen die Bank – abgesehen von der Geschäfts-durchführung – überhaupt keine weiter-gehenden Pflichten; erkennt sie aber, dass der Kunde hinsichtlich des Geschäfts-gegenstands einem Irrtum unterliegt, ist das Geschäft vollkommen unabhängig von den Vorgaben des WAG nach § 871 ABGB anfechtbar. Gleiches gilt, wenn die Bank beim Kunden durch falsche Angaben aktiv einen Irrtum hervorruft.
Welche Pflichten nach WAG bestehen, sagt also nicht notwendigerweise etwas darüber aus, welche Rechte oder Ansprü-che dem Kunden gegen die Bank nach ABGB zustehen. Dieser Gesichtspunkt schlägt auch auf Konstellationen durch, die an sich von § 27 Abs 2 WAG geregelt sind: Wenn die Bank sich nicht die Mühe macht und dem Anleger die für die Abga-be seiner Vertragserklärung notwendigen Formulare selbst übergibt, sondern sich dazu eines Dritten, nämlich des ersten Rechtsträger bedient, dann darf dies nicht
rufung auf § 27 WAG Einwendungen erhoben. Sie meinen, § 27 WAG würde die Zurechnung als Verhandlungsgehilfe ausschließen. Das ist aber unzutreffend, da weder § 27 Abs 1 noch Abs 2 WAG diesen Effekt hat.
§ 27 Abs 1 WAG schützt – wie oben gezeigt – nur das Vertrauen der Bank darauf, dass die vom ersten Rechtsträ-ger weitergeleitete Information über den Kunden zutreffend ist. Dass der Kunde vom ersten Rechtsträger zutreffend in-formiert wurde und von ihm kein Irrtum verursacht wurde oder ihm kein Irrtum auffallen musste, ist schon rein vom Regelungsbereich der Norm her nicht Gegenstand dieses Vertrauens. Aus § 27 Abs 1 WAG lässt sich – wie oben gezeigt – insbesondere nicht ableiten, dass der zweite Rechtsträger auf eine korrekte Weiterleitung der Information durch den ersten Rechtsträger zu vertrauen be-rechtigt wäre. Ob ein solches Vertrauen berechtigt ist oder nicht, hängt davon ab, welche zivilrechtliche Gestaltung dem Tätigwerden des ersten Rechtsträgers zugrundeliegt. Typischerweise fungiert der erste Rechtsträger in den hier behan-delten Fällen als Verhandlungsgehilfe, wie der OGH in der E 6 Ob 24/10p [59] klargestellt hat. Maßgeblich für diese Qualifikation war der Umstand, dass der erste Rechtsträger mit den Formularen „Investmentangaben/Fondskäufe“ ausge-stattet worden war. Dies ist nach st Rsp des OGH ein typisches Indiz dafür, dass es sich um einen Empfangsboten handelt. Der OGH knüpft damit an seine bisherige Rsp an. So hat das Höchstgericht in der E 7 Ob 177/98z [60] klar festgehalten, dass die das Effektengeschäft durchführende Bank gegen sich gelten lassen muss, wenn ihr Verhandlungsgehilfe in dieser Eigen-schaft den Käufer im Rahmen der Abgabe seines Vertragsofferts listig täuscht, einen dem Käufer unterlaufenen beachtlichen Irrtum veranlasst und wenn ihm ein sol-cher Irrtum erkennbar war.
Schließlich ist in diesem Zusam-menhang auf die Rsp des OGH [61] zu Leasingverträgen zu verweisen; nach dieser wird der Lieferant dem Leasing-geber jedenfalls dann zugerechnet, wenn der Lieferant die Vertragsformulare des Leasinggebers mit dessen Zustimmung verwendet und tatsächlich auch ein Of-fert entgegengenommen hat. Dass ein Verhandlungsgehilfe in vertraglichen Be-
zu einer Verschlechterung der Rechts- position des Anlegers im Vergleich zu je-ner Rechtslage führen, die ohne Einschal-tung des Verhandlungsgehilfen gegeben wäre. Die irrtumsrechtliche Zurechnung des Verhandlungsgehilfen hat zivilrecht-lich ja den klaren Grund, dass eine Schlechterstellung des Vertragspart-ners verhindert werden soll. Würde der Geschäftsherr die Vertragsverhandlungen selbst führen und den Vertrag selbst ab-schließen, würde ein von ihm zu verant-wortender Irrtum seines Vertragspartners diesen zur Anfechtung berechtigen. Wenn der Geschäftsherr nun die Verhandlungen nicht führt, sondern sich eines Gehilfen bedient, würde der Vertragspartner die Möglichkeit zur Vertragsanfechtung ver-lieren, wenn das Verhalten des Gehilfen nicht dem Geschäftsherrn zugerechnet wird. Die Zurechnung des Verhaltens des Gehilfen zum Geschäftsherrn wird also durch elementare Gerechtigkeits-erwägungen, wie sie in § 1313a ABGB positiviert sind, gefordert. Diese werden durch § 27 Abs 2 WAG nicht „overruled“.
Die Möglichkeit der Irrtumsanfech-tung führt in jenen Fällen, in denen der erste Rechtsträger Verhandlungsgehilfe der Bank ist, zu einer Modifikation des aus § 27 Abs 2 WAG für die Bank resultie-renden Vertrauensschutzes. Sie kann nicht mehr uneingeschränkt darauf vertrauen, dass das dem Kunden vom ersten Rechts-träger empfohlene Papier dessen Inter-essen entspricht, weil sie die Möglichkeit berücksichtigen muss, dass der Berater durch eine unrichtige Information beim Kunden einen Irrtum hervorgerufen hat bzw ihm ein Irrtum des Kunden auffallen hätte müssen. Erklärt der Berater, dass das betreffende Papier risikolos ist, obwohl es diese Eigenschaft nicht aufweist, und empfiehlt er dem Kunden den Ankauf, würde ein Geschäftsirrtum des Kunden vorliegen. Gleichzeitig würde auch eine fehlerhafte Anlageberatung gegeben sein. Letzterer Umstand berechtigt den Kunden zur Geltendmachung von Schadenersatz-ansprüchen gegen den Berater, ersterer zur Anfechtung des mit der Bank abge-schlossenen Effektengeschäfts.
Diese Modifikation ist aber nicht als eine einschränkende Auslegung des § 27 Abs 2 WAG zu verstehen; sie resultiert vielmehr daraus, dass in jenen Fällen, in denen der erste Rechtsträger als Ver-handlungsgehilfe der Bank fungiert, ein
[59] = JBl 2010, 442.[60] = ÖBA 1999, 900. Auf die Bedeutung
dieser Entscheidung für den vorliegenden Kontext hat bereits Riedler, ÖJZ 2010, 850 hingewiesen.
[61] JBl 1988, 719 = ÖBA 1989, 316 (Iro); 3 Ob 15/98x.
[62] Vgl 2 Ob 176/10m = Zak 2011/705; 4 Ob 586/95.
[63] GesRZ 2010, 41.[64] Dies gilt in allen Fällen, also nicht
nur in jenen, in denen auf Seiten der Bank ein eigenständiges Verschulden vorliegt. Der Grund hierfür liegt darin, dass das Verhalten
des Verhandlungsgehilfen der Bank 1:1 zuge-rechnet wird. Daraus kann sich zum einen die Möglichkeit zur Irrtumsanfechtung ergeben; zum anderen können aber qua § 1313a ABGB dem Kunden auch Schadenersatzansprüche zustehen.

grAf AbhAndlungen
240 ÖBA 4/12
trotz § 27 Abs 2 WAG zugerechnet. Ein Irrtum des Anlegers, der vom Anlagebe-rater verursacht wurde oder ihm auffallen musste, berechtigt den Anleger zur An-fechtung des mit der Bank geschlossenen Effektengeschäftes. ◆
Literaturverzeichnis
Assmann / Schneider (Hrsg), WpHG5 (2009).
Baum, Pflichten und Haftung im ar-beitsteiligen Vertrieb von Finanzproduk-ten, ÖBA 2010, 278.
Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts (1996).
Fuchs (Hrsg), WpHG (2009). Graf, Zweckentfremdete Anlegergel-
der und Aufklärungspflicht der Bank beim Effektengeschäft, im Erscheinen.
Gruber / N. Raschauer (Hrsg), WAG (2010).
Gumpoltsberger, Aufklärungspflicht der Bank über Spesenaufteilungsver-einbarung bei gestaffelter Einschaltung zweier WPDLU, ecolex 2005, 682.
Iro, Zurechnung von Gehilfen im Recht der Willensmängel, JBl 1982, 470, 510.
M. Harrer, Mögliche Gestaltung der Vertriebsstruktur – ausgewählte Fragen der Wohlverhaltensregeln, in Dullinger / Kaindl, Bank- und Kapitalmarktrecht 2008 (2009).
Kletečka / Schauer (Hrsg), ABGB-ON (2010).
Knobl / Grafenhofer, Haftung einer Bank für allfälliges Fehlverhalten von externen Anlageberatern oder Vermittlern, GesRZ 2010, 27.
Koller, Wer ist „Kunde“ eines Wertpa-pierdienstleistungsunternehmens (§ 31 f WpHG)? ZBB 1996, 97.
Koziol, Die Haftung der depotführen-den Bank bei Provisionsvereinbarungen mit externen Vermögensverwaltern ihrer Kunden, ÖBA 2003, 483.
Koziol / Welser, Bürgerliches Recht I13 (2006).
Riedler, Geschäftsirrtum, Irrtumsver-anlassung und Gehilfenzurechnung beim Wertpapierkauf, ÖJZ 2010, 19.
Vonkilch, Irrtumsrechtliche Gehilfen-zurechnung beim arbeitsteiligen Vertrieb von Wertpapieren, RdW 2010, 324.
das damit einhergehende Haftungsrisiko tragen.
8. Resumee
1. Entschließt sich ein Anleger nach Beratung durch einen Anlageberater zum Erwerb eines Wertpapiers und leitet der Anlageberater den Kaufauftrag des Kun-den an eine Bank weiter, darf die Bank aufgrund von § 27 Abs 2 WAG 2007 darauf vertrauen, dass das Papier für den Kunden angemessen ist, vorausgesetzt die Bank hat Kenntnis von der durch den ersten Rechtsträger erfolgten Anlagebera-tung. Sie muss in diesem Fall weder eine Angemessenheitsprüfung nach § 44 WAG noch eine Geeignetheitsprüfung nach § 45 WAG durchführen. 2. Durch § 27 Abs 2 WAG werden nach allgemeinem Zivilrecht bestehende Aufklärungspflichten aber nicht ausge-schlossen. Ist der Bank bekannt, dass sich der Kunde hinsichtlich des von ihm zu erwerbenden Papiers in einem Geschäftsirrtum befindet, ist sie nach allgemeinen Grundsätzen zur Aufklärung verpflichtet. Eine derartige Situation ist zB dann gegeben, wenn die Bank über In-formationen verfügt, hinsichtlich derer sie weiß, dass sie weder dem Anlageberater noch dem Kunden zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für den Fall, dass die Bank weiß oder aufgrund evidenter Umstände wissen muss, dass der Anlageberater seine gegenüber dem Kunden nach § 44 WAG bestehenden Pflichten nicht erfüllt. 3. Unterlässt die Bank in derartigen Fällen die Aufklärung des Kunden, kann dieser das Effektengeschäft wegen Ge-schäftsirrtums anfechten, weil eine Irr-tumsverursachung durch unterlassene Aufklärung vorliegt. Gleiches gilt bei einer Irrtumsverursachung durch aktives Tun auf Seiten der Bank, wie beispiels-weise die Verbreitung von Werbepro-spekten, in denen irreführende Angaben gemacht werden.4. In derartigen Fällen bestand auch nach WAG 1997 eine entsprechende Aufklärungspflicht durch die Bank. Die Bejahung dieser Aufklärungspflicht ist unabhängig davon, ob man hinsichtlich der alten Rechtslage eine eher engere Auslegung oder wie hier eine weitere Auslegung vertritt. 5. Setzt die Bank den Anlageberater als Verhandlungsgehilfen oder Empfangs-boten ein, wird er ihr irrtumsrechtlich
zusätzliches Sachverhaltselement ver-wirklicht ist, das zur Anwendung einer zusätzlichen Rechtsnorm führt, deren Tatbestand durch dieses Sachverhalts-element verwirklicht wird [65]. § 27 Abs 2 WAG knüpft seine Rechtsfolge an einen einfachen Tatbestand, näm-lich die Erteilung des Auftrags eines Kunden durch den ersten Rechtsträger an den zweiten Rechtsträger. Die Mög-lichkeit zur Irrtumsanfechtung für den Kunden wird durch ein ganz anderes Sachverhaltselement ermöglicht, nämlich den Umstand, dass der erste Rechts-träger Verhandlungsgehilfe des zweiten Rechtsträgers ist. Das ist aber eine zur Grundkonstellation des § 27 Abs 2 WAG hinzutretende Qualifikation.
Wenn die Rechtsordnung nun an die-ses zusätzliche Element eine zusätzliche Rechtsfolge anknüpft, stellt dies keinen Widerspruch zur für die unmodifizierte Grundkonstellation geltenden Regelung dar. Es ist dies vielmehr ein Phänomen, das öfter auftritt. So schließt § 1432 ABGB die Rückforderung der Zahlung einer verjährten Schuld aus; diese Norm wird durch § 1433 ABGB aber für den Fall modifiziert, dass der Zahler nicht geschäftsfähig ist. Nicht anders ist das Verhältnis von § 27 Abs 2 WAG zu § 871 ABGB: Grundsätzlich kann sich der zwei-te Rechtsträger darauf verlassen, dass der erste Rechtsträger den Kunden korrekt beraten hat; ist der erste Rechtsträger jedoch Verhandlungsgehilfe des zweiten Rechtsträgers, kommt zusätzlich § 871 ABGB ins Spiel und der Kunde kann bei einem Irrtum, der vom ersten Rechtsträger verursacht wurde oder diesem auffallen hätte müssen, den Vertrag mit dem zwei-ten Rechtsträger anfechten.
Für den zweiten Rechtsträger resultiert daraus keine unzumutbare Belastung, kann er die Anwendbarkeit des § 871 ABGB doch ganz einfach dadurch ver-meiden, dass er den Anlageberater nicht als Verhandlungsgehilfen einsetzt. Ent-scheidet er sich jedoch dafür, Kosten zu sparen, und den Rechtsträger als Verhand-lungsgehilfen nutzbar zu machen, muss er
[65] Zusätzlich ist in Erinnerung zu rufen, dass der Zweck des WAG 2007 dahin ging, den Anlegerschutz zu verbessern; mit diesem Ziel wäre es aber komplett unvereinbar, wenn das Gesetz dazu führen würde, den Kernbereich des Irrtumsrechts zu Lasten des Anlegers einzuschränken.

OGH 8 Ob 11/11t
ÖBA 4/12 241
Zivilrechtliche und strafrechtliche
EntscheidungenBearbeitet von
RA Univ.-Prof. Dr. Raimund Bollenberger, unter Mitarbeit von
RAA Mag. Markus Kellner
OGH-Entscheidungen
1796.§§ 867, 918, 1295, 1304, 1313a ABGB; § 39 BWG; §§ 446, 447 ASVG; § 13 WAG 1996. Der Genehmigungsvorbe-halt nach § 446 Abs 3 ASVG beschränkt die Handlungsfähigkeit der Organe des Sozialversicherungsträgers im Außen-verhältnis. Eine nicht durch die erfor-derliche ministerielle Genehmigung gedeckte Willenserklärung des an sich zuständigen Organs bindet den Sozial-versicherungsträger nicht.Öffentlich-rechtliche Körperschaften sind verpflichtet, den Partner über die Gültigkeitsvoraussetzungen des beabsichtigten Geschäfts aufzuklären, sofern diese ihrem Organ bekannt oder leichter erkennbar sind als dem Partner. Wird der Partner im guten Glauben gelassen, es bestehe kei-ne Genehmigungsbedürftigkeit, haftet die Körperschaft auf das Vertrauens- interesse, wenn die Genehmigung in der Folge ausbleibt.Auch eine hohe Professionalität des Kunden kann nicht ausschließen, dass er im Einzelfall einer Fehlvorstellung unterliegt. Kann der Anlageberater dies erkennen, dann hat er den Kunden speziell aufzuklären.Die Übernahme des Risikos aus einem Vertrag, der vom anderen Teil mit Dritten abgeschlossen wurde, ist nur ausnahmsweise vom Schutzzweck des Grundverhältnisses erfasst.OGH 24. 10. 2011, 8 Ob 11/11t
Aus den Entscheidungsgründen:
Die Streitteile stehen seit vielen Jah-ren in ständiger Geschäftsbeziehung. Im Jahr 2002 hatte die klagende Großbank der Beklagten, einer Sozialversicherungs-trägerin, unwidersprochen mitgeteilt, dass sie sie als professionelle Marktteilneh-merin behandle.
Die Beklagte finanziert sich vorwie-gend aus den Beiträgen ihrer Mitglieder, die zum Großteil jeweils um den 18.
◆Rechtsprechungeines jeden Monats bei ihr einlangen. Davor muss die Beklagte ihre laufenden Ausgaben durch kurzfristige Barvorlagen zwischenfinanzieren. Vom 15. bis zum 22. eines jeden Monats ist sie in der Lage, Einnahmen zu veranlagen, um anschlie-ßend vom 20. bis zum Ultimo wieder Mittel zur Finanzierung ihrer Aufgaben aufzunehmen.
Die Beklagte verfügt über zwei Spe-zialfonds, in denen ihr Finanzvermögen angelegt ist und mit deren Erträgen die Kosten der Zwischenfinanzierungen zu-mindest großteils abgedeckt werden. Da die erforderlichen Barvorlagen immer weiter anstiegen, machte sich der Leiter der Finanzabteilung der Beklagten Ge-danken, wie man die „Struktur“ der Be-klagten absichern und verhindern könne, dass die Substanz der Spezialfonds zur Abdeckung der Barvorlagen angetastet werden müsse. Er verfiel dabei auf die Möglichkeit von Derivatgeschäften und ließ sich von der Beklagten – aber auch von anderen Bankinstituten – Angebote für Zinsabsicherungs- und Zinsoptimie-rungsprodukte vorschlagen. Bis zu die-sem Zeitpunkt hatte die Beklagte keine Erfahrungen mit Derivatgeschäften. Der Klägerin war bei der Erstattung ihrer Angebote die Zusammensetzung des Port-folios der Beklagten nicht bekannt, son-dern nur deren kurzfristiger periodischer Finanzierungsbedarf.
Am 25.7.2005 unterfertigten die Streit-teile einen Rahmenvertrag über den in Aussicht genommenen Abschluss von Finanztermingeschäften. Dieser Rahmen-vertrag war ein Standardvertrag, den die überwiegende Zahl der Bankinstitute verwendeten und dessen Inhalt mit dem Bankenverband akkordiert war. Er lautet auszugsweise wie folgt:
㤠1 Zweck und Gegenstand des Ver-trages
1. Die Parteien beabsichtigen, zur Gestaltung von Zinsänderungs-, Wäh-rungskurs- und sonstigen Kursrisiken im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Finanz-termingeschäfte abzuschließen. (...)
§ 8 Schadenersatz und Vorteilsaus-gleich
1. Im Falle der Beendigung steht der kündigenden oder solventen Partei ein vom Verschulden der anderen Partei un-abhängiger Anspruch auf Schadenersatz zu. Der Schaden wird auf der Grundlage von unverzüglich abzuschließenden Er-satzgeschäften ermittelt, die dazu führen, dass die ersatzberechtigte Partei alle Zahlungen und sonstigen Leistungen er-hält, die ihr bei ordnungsgemäßer Ver-tragsabwicklung zugestanden wären. Sie ist berechtigt, nach ihrer Auffassung dazu geeignete Verträge abzuschließen. (...)
§ 12 besondere Vereinbarungen: (...)
7. Der Vertragspartner versichert, dass er über ausreichende Kenntnisse in den in § 1 des Rahmenvertrages beschrie-benen Geschäften verfügt und mit den konkreten Risiken aus Einzelabschlüssen vertraut ist. Er schließt Einzelabschlüsse aufgrund seiner eigenen Entscheidung und nicht aufgrund einer Beratung der Bank ab. (...)“
Die Klägerin übermittelte der Beklag-ten zwei Ausfertigungen des Rahmenver-trags mit einem Begleitschreiben, in dem festgehalten wurde:
„Zum jeweiligen Einzelgeschäft bit-ten wir Sie dafür Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Beschlüsse (vgl § 446 Abs 3 ASVG) vorliegen, wenn es sich beim Einzelabschluss um kein Zinsgeschäft handelt, das nachweislich zur Absiche-rung bestehender Positionen dient.“
Der Vorstand und die Kontrollver-sammlung der Beklagten genehmigten mit Grundsatzbeschluss vom 5.7.2005 die Durchführung von „Swap-Geschäften im Bereich des Zinsrisikomanagements“ und ermächtigten das Büro zum Abschluss der entsprechenden Einzelgeschäfte. Grund-lage dieser Zustimmung war ein konkreter Produktvorschlag des Büros, der nicht nur eine reine Absicherung gegen steigende Zinsen, sondern auch eine gegenwärtige Zinschance versprach.
Am 18.10.2005 schloss die Beklagte mit der Klägerin ein anderes als das im Bericht an den Verwaltungsausschuss vorgestellte Geschäft ab, uzw einen Quan-to-Snowball-Swap mit Anfangstermin 19.10.2005 und einer Laufzeit von fünf Jahren. Nur der Klägerin war bei diesem Vertrag ein vorzeitiges Kündigungsrecht eingeräumt.
Der vereinbarte Quanto-Snowball-Swap war ein hochkomplexes Produkt, bei dem auf Basis eines fiktiven Nomi-nalbetrags von € 10 Mio vierteljährlich zwischen den Partnern Zinsenzahlun-gen „ausgetauscht“ und die jeweiligen Zahlungen gegenverrechnet wurden. Im ersten Jahr hatte die Beklagte einen Fixzinssatz von 0,75% pa vom Nominal-betrag zu bezahlen, die Klägerin hinge-gen den Dreimonats-Euribor-Zinssatz, wodurch in dieser Periode aufgrund der geringen Höhe des Fixzinssatzes ein Gewinn für die Beklagte sicher war. In den Folgejahren sollte die Klägerin wei-terhin jeweils den Dreimonats-Euribor-Zinssatz, die Beklagte dagegen einen vom jeweiligen Vorjahreswert und dem doppelten CHF-Libor abhängigen Zins-satz bezahlen.
Diese Form eines Swap-Geschäfts war für die Beklagte mit multiplen Risikofaktoren behaftet, nämlich dem zweifachen Zinsrisiko in EUR und CHF, einem Multiplikator, einem im Zeitablauf unterschiedlichen Abschlag zu Beginn

OGH 8 Ob 11/11t
242 ÖBA 4/12
Beklagten sei kein schuldhafter Verstoß gegen vorvertragliche Schutzpflichten vorzuwerfen, weil sie das Erfordernis einer Genehmigung aufgrund der fehler-haften Beratung durch die Klägerin falsch eingeschätzt habe.
Das Berufungsgericht trug dem Erst-gericht die neuerliche Entscheidung auf. Das Erstgericht sei zutreffend von der Un-wirksamkeit der Verträge ausgegangen. Der Beklagten sei aber eine Verletzung vorvertraglicher Aufklärungspflichten anzulasten. Der Klägerin sei ein gleich-teiliges Mitverschulden anzulasten. Zwar habe sie sich nach den festgestellten Um-ständen mit der Behauptung, es lägen alle Genehmigungen vor, zufriedengeben dür-fen, sie habe aber ihrerseits Aufklärungs- und Beratungspflichten nach § 13 WAG verletzt. Die Klägerin habe gewusst, dass die Beklagte mit Derivatgeschäften keine Erfahrung habe, trotzdem habe sie sie nicht sorgfältig über Chancen und Ris-ken des Swap-Geschäfts aufgeklärt. Das Verschulden der Streitteile sei im Zweifel gleich zu gewichten. Zur abschließenden Beurteilung der Schadenshöhe bedürfe es noch ergänzender Feststellungen.
Beide Streitteile erheben gegen diese Entscheidung Rekurs an den OGH. Nur der Rekurs der Beklagten ist berechtigt.
1. Rekurs der Klägerin
Die Klägerin macht zusammengefasst geltend, die Einhaltung der Genehmi-gungsvorbehalte nach § 446 Abs 3 ASVG sei nicht Voraussetzung für die Wirksam-keit des Geschäfts nach außen, sodass sowohl der Rahmenvertrag als auch das konkrete Swap-Geschäft wirksam zustan-de gekommen seien. Ein Beratungsfehler sei ihr nicht anzulasten, weil sie gegen-über der Beklagten als professionelle Marktteilnehmerin keine Verpflichtung zur Beratung und Aufklärung über Natur, Chancen und Risiken des angebotenen Geschäfts wahrzunehmen gehabt habe.
Diesen Ausführungen kann nicht ge-folgt werden.
1.1. Nach § 446 Abs 1 ASVG sind die zur Anlage verfügbaren Mittel der Versiche-rungsträger zinsenbringend anzulegen. Sie dürfen – kurz zusammengefasst – nur in verzinslichen Wertpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten, bestimmten Fonds und Immobilienfonds angelegt werden. Der Einsatz derivativer Instrumente (da-runter Zins-Swaps) ist nur dann zulässig, wenn er nachweislich zur Absicherung bestehender Positionen nach § 446 Abs 1 leg cit dient. Beschlüsse der Verwal-tungskörper über Vermögensanlagen, die von diesen Vorschriften abweichen, be-dürfen nach § 446 Abs 3 ASVG zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der dort genannten Ministerien.
als der Barwert, hätte er umso mehr von diesem Geschäft Abstand genommen.
Dass der Mitarbeiter der Klägerin wusste, dass die Beklagte für den Ab-schluss des zunächst ins Auge gefass-ten Swap-Geschäfts und schließlich des Quanto-Snowball-Swaps eine ministeri-elle Genehmigung benötigte, war nicht feststellbar. Der Finanzabteilungsleiter der Beklagten war hinsichtlich beider Varianten der Ansicht, dass keine Geneh-migung erforderlich sei, sondern nur eine Zustimmung des Vorstands und der Kon-trollversammlung der Beklagten. Als der Mitarbeiter der Klägerin den Finanzab-teilungsleiter der Beklagten daher fragte, ob die entsprechenden Genehmigungen vorliegen, dachte Letzterer an die internen Beschlüsse vom 5.7.2005 und bejahte diese Frage.
Am 21.4.2006 erfuhr der zuständige Mitarbeiter der Beklagten erstmals, dass der aktuelle Barwert des Swaps minus € 1.325.193 betrage. Diese Nachricht machte seine Vorstellungen von einem vorzeitigen Ausstieg aus dem Vertrag zunichte. Nachdem sich die Beklagte ihres Risikos bewusst geworden war, verhandelte sie mit der Klägerin um eine Bereinigung der Angelegenheit, gleich-zeitig hoffte sie auf eine Erholung des negativen Barwerts, die aber nicht eintraf.
Am 15.5.2007 stellte die Beklagte gem § 446 Abs 3 ASVG beim BM für Gesund-heit, Familie und Jugend einen Antrag auf nachträgliche Genehmigung der Be-schlüsse des Vorstands und der Kontroll-versammlung, der abschlägig beschieden wurde. Daraufhin zahlte die Beklagte der Klägerin die im ersten Jahr erhaltenen Zinserträge zurück und verweigerte un-ter Berufung auf die Unwirksamkeit des Swap-Geschäfts weitere Zahlungen.
Die Klägerin stellte am 27.6.2007 ihren Gegen-Swap glatt und musste dafür einen Auflösungspreis von rund € 2,95 Mio bezahlen.
In ihrer Klage begehrt sie diesen Be-trag, abzüglich der ihr aus dem Gegen-Swap bereits zugekommenen Zinszahlun-gen, wegen Vertragsbruchs der Beklagten, hilfsweise auch wegen Verletzung vorver-traglicher Schutz- und Sorgfaltspflichten. Die Beklagte habe nicht um die erforder-lichen Genehmigungen angesucht und diesen Umstand verschwiegen.
Die Beklagte wandte ein, die Klägerin habe sie nur unzureichend über die kon-kreten Eigenschaften des Swap-Geschäfts aufgeklärt und während der Laufzeit schlecht betreut.
Das Erstgericht wies die Klage ab. Es gelangte zu dem Ergebnis, dass der Ver-trag als Spekulationsgeschäft von vorn-herein einer ministeriellen Genehmigung bedurft hätte, deren Fehlen die Unwirk-samkeit des Vertrags zur Folge habe. Der
einer Periode mit einseitig fixer Verzin-sung, unterschiedlichen Zinsfeststellungs-zeitpunkten und dem „Snowballeffekt“ des Zinssatzes der Vorperiode.
Der Swap diente nicht der Absicherung konkreter bestehender Vermögenspositio-nen iS des § 466 Abs 1 ASVG, insb nicht der beiden Spezialfonds, vielmehr erwar-tete sich die Beklagte daraus einen Speku-lationsgewinn, mit dem sie die steigenden Kosten der monatlichen Zwischenfinan-zierungen ausgleichen wollte. Aufgrund der ihr vom „Treasury Sales“-Betreuer der Klägerin erteilten Auskünfte betrach-tete sie den Swap aber als Geschäft mit beherrschbarem Risiko zur Absicherung ihrer gesamten Finanzierungsstruktur.
Unmittelbar nach Abschluss dieses Swaps schloss die Klägerin auf dem Inter-bankenmarkt ein Gegen-Swap-Geschäft ab. Damit war für sie selbst das Risiko einer ungünstigen Zinsenentwicklung ausgeschlossen, sodass sie kein Interesse an einer vorzeitigen Auflösung hatte und ihr insges ein reines Spannengeschäft verblieb.
Der Finanzabteilungsleiter der Be-klagten rechnete hingegen damit, dass die Klägerin bei stagnierendem Zinsenniveau von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen werde und die Beklagte dadurch insges einen Gewinn lukrieren könne. In dieser Ansicht wurde er vom betreuenden Mitarbeiter der Klägerin bestärkt. Für den Fall eines steigenden CHF-Libors ging die Beklagte davon aus, gegen Ersatz des Bar-werts des Geschäfts vorzeitig aussteigen zu können, aber den zu zahlenden Barwert mit den Zinsgewinnen des ersten Jahres zumindest ausgleichen zu können.
Wie der Barwert tatsächlich errech-net wird und welche Faktoren wesent-lich sind, wussten weder der „Treasury-Sales“-Mitarbeiter der Klägerin noch der Finanzabteilungsleiter der Beklagten. Beiden waren auch die relevanten Unter-schiede zwischen Barwert und allfälli-gem Ausstiegswert sowie Gesamtergebnis nicht geläufig.
Ein Ausstiegswert war weder für die Beklagte noch für die Klägerin bere-chenbar, er hängt von der geforderten Prämie einer Gegenpartei für den Aus-stieg ab. Um den Barwert einschließlich Kündigungsrecht zu berechnen, ist neben theoretischem Wissen ein funktionieren-des Risikomanagement und Reporting mit Limits notwendig, die entsprechende Software allein reicht nicht aus.
Der Finanzabteilungsleiter hätte dem Büro der Beklagten den Abschluss des Quanto-Snowball-Swaps nicht empfoh-len, wenn er gewusst hätte, dass der Bar-wert binnen kurzer Zeit um eine Million schwanken kann. Hätte er gewusst, dass der Ausstiegspreis für eine vorzeitige Beendigung noch ungünstiger sein könnte

OGH 8 Ob 11/11t
ÖBA 4/12 243
die Revisionsausführungen über eine allgemeine Unzumutbarkeit der Kenntnis interner Organisationsvorschriften öffent-lich rechtlicher Körperschaften am kon-kreten Sachverhalt vorbeigehen. Eine An-scheinsvollmacht kommt im vorliegenden Fall mangels eines der Aufsichtsbehörde zurechenbaren Rechtsscheins von vorne-herein nicht in Frage (ua Apathy/Riedler in Schwimann³ § 867 ABGB Rz 7).
Der von der Rekurswerberin angestell-te Vergleich mit der Verletzung anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften, wie einer Überschreitung des Haushaltsplans oder der Missachtung einer Weisung (vgl Thunhart, öarr 2001, 419) und die Auswirkung von Beschlusserfordernissen in politischen Gemeinden betrifft keinen mit dem vorliegenden vergleichbaren Sachverhalt. Eine Beurteilung, ob ein Derivatgeschäft zur „Absicherung be-stehender Positionen“ dient, erfordert in erster Linie das Verständnis der Struktur des Geschäfts und ist daher gerade dem Anbieter am besten möglich, der sich auch von der Erteilung der Genehmigung durch eine bedungene Vorlage des Genehmi-gungsbescheids überzeugen kann, bevor er eigene Dispositionen im Vertrauen auf den wirksamen Vertragsabschluss trifft.
1.6. Das Genehmigungserfordernis des § 446 Abs 3 ASVG lässt entgegen den Rekursausführungen keine beson-dere Gefahr eines Missbrauchs durch die öffentlich-rechtliche Körperschaft befürchten. Gerade wenn dem Sozial-versicherungsträger die Berufung auf die Unwirksamkeit eines nicht genehmigten Geschäfts versagt würde, das sich als wirtschaftlich nachteilig erweist, würde der im öffentlichen Interesse gelegene Zweck der Genehmigungspflicht, ihn vor selbstschädigenden Vermögensdis-positionen zu bewahren, verfehlt. Die Funktion des Genehmigungsvorbehalts als Mittel der präventiven Kontrolle von Rechtshandlungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften ist nur dann gewährleistet, wenn die Wirksamkeit des zu kontrollierenden Rechtsakts von der Erteilung der Genehmigung abhängt. Anderenfalls bliebe eine Verletzung des Genehmigungsvorbehalts ohne Folgen, weil die Mittel der repressiven Verwal-tungskontrolle im Falle privatrechtlicher Verträge nicht wirksam eingreifen (BGH NJW 1999, 3335 [1]).
1.7. Die im Rekurs wiederholten verfas-sungsrechtlichen Bedenken gegen §§ 867 ABGB und 446 Abs 3 ASVG sind nicht zu teilen. Die Notwendigkeit einer aufsichts-
Positionen“ auffassen, würde selbst das Lotteriespiel unter den Begriff „Absiche-rungsgeschäft“ fallen.
Auf die Kausalität einer fehlerhaften Risikoaufklärung durch die Klägerin kann sich die Beklagte allerdings nicht mit Erfolg berufen, weil der Quanto-Snow-ball-Swap selbst nach der ungenauen Vorstellung, die ihr Finanzabteilungsleiter davon hegte, immer noch eindeutig ein Spekulationsgeschäft war, das als solches der Zustimmung der Aufsichtsbehörde bedurfte.1.4. Gegenstand genehmigungspflichti-ger Beschlüsse nach § 446 Abs 3 ASVG sind nach dem Gesetzeswortlaut nicht nur konkrete Vermögensanlagen in ei-nem einzelnen Fall, sondern auch durch gemeinsame Gruppenmerkmale gekenn-zeichnete und voraussichtlich vorzuneh-mende Vermögensanlagen. Bereits die Grundsatzbeschlüsse der zuständigen Gremien der Beklagten über die Zustim-mung zu Derivatgeschäften im Bereich des Zinsmanagements, die Grundlage für den Rahmenvertrag der Streitteile waren, hätten zu ihrer Wirksamkeit der aufsichts-behördlichen Genehmigung bedurft, weil sie sich nur auf einen bestimmten Typ von Derivatgeschäften bezogen, aber nicht – schon gar nicht „nachweislich“ – auf Geschäfte mit reiner Sicherungsfunktion eingeschränkt waren.1.5. Bereits der Wortlaut des § 446 Abs 3 ASVG normiert nicht nur eine intern zu beachtende Obliegenheit der Leitungs-organe, sondern eine Voraussetzung für die Wirksamkeit des zu genehmigenden Beschlusses. Zutreffend sind die Vorin-stanzen davon ausgegangen, dass diese Bestimmung genauso wie § 447 Abs 1 ASVG, der Geschäfte im Zusammenhang mit Immobilien unter Genehmigungsvor-behalt stellt, das im öffentlichen Interesse gelegene Ziel der Sicherung einer sorgfäl-tigen und umsichtigen wirtschaftlichen Gebarung des Sozialversicherungsträgers sichern soll. Die zu § 447 Abs 1 ASVG entwickelten Grundsätze der höchstge-richtlichen Rsp sind auch hier anzuwen-den.
Der Genehmigungsvorbehalt nach § 446 Abs 3 ASVG ist nicht eine bloße Organisationsvorschrift der internen Wil-lensbildung, sondern eine Anordnung, die die Handlungsfähigkeit der vertretungs-berechtigten Organe des Sozialversiche-rungsträgers auch im Außenverhältnis beschränkt. Eine nicht durch die erfor-derliche ministerielle Genehmigungen gedeckte Willenserklärung des an sich zum Vertragsabschluss zuständigen Or-gans der Beklagten bindet diese nicht (1 Ob 13/93).
Die Regelung des § 446 Abs 3 ASVG war auch der Klägerin vor Vertragsab-schluss ausdrücklich bekannt, weshalb
Ein Zins-Swap, bei dem zwei Ver-tragspartner vereinbaren, zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf festgelegte, fiktive Nennbeträge aus-zutauschen, kann entweder als Siche-rungsinstrument gegen Zinsschwankun-gen einer bestimmten Verbindlichkeit oder Veranlagung, oder ohne Verbindung mit einer bestehenden Position als reines Spekulationsinvestment benützt werden. Die Zustimmung der Leitungsgremien eines Sozialversicherungsträgers zu Zins-Swap-Geschäften hätte nach dem Ge- setzeswortlaut nur im ersteren Fall nicht der aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedurft, nämlich wenn der Swap aus-schließlich und nachweislich zur Absiche-rung einer konkreten Vermögensanlage oder Kreditaufnahme durch Ausschalten des Zinsschwankungsrisikos gedient hät-te.
Es liegt kein Absicherungsgeschäft vor, wenn mit einem Zins-Swap ein neues Risiko geschaffen oder ein beste-hendes erhöht wird; die Inkaufnahme eines – wenn auch subjektiv als gering eingeschätzten – Risikos zur Realisierung erhoffter Gewinnchancen ist vielmehr das Charakteristikum eines Spekulationsge-schäfts. Ein Absicherungsgeschäft wirft keinen Gewinn ab, sondern verursacht in jedem Fall Kosten und verhindert dafür – ähnlich einer Versicherung – mögliche Verluste.1.2. Aufgrund des für den OGH bin-dend festgestellten Sachverhalts war den Vertragsverhandlern auf beiden Seiten bereits vor dem Abschluss des Rahmen-vertrags klar, dass mit dem beabsichtigten Geschäft für die Beklagte nicht nur eine Gewinnchance, sondern auch ein spekula-tives Risiko verbunden war, wenn sie sich auch über dessen Ausmaß kein klares Bild verschafft hatten.
Erklärtes Ziel der Beklagten war von vornherein die Erzielung von Gewinn, um die Kapitalerträge der Fonds aufbessern und die steigenden Barvorlagenzinsen ausgleichen zu können. Ein Zins-Swap hätte nur dann der Absicherung gedient, wenn damit entweder die Sollzinsen eines Barvorlagenkredits oder die Erträge eines bestimmten Fonds auf einen Fixwert „ein-gefroren“ worden wären. Ausgehend vom festgestellten Sachverhalt ist daher die Beurteilung des streitgegenständlichen Swap-Geschäfts als Spekulationsgeschäft völlig zutreffend.1.3. Sowohl der Klägerin als auch der Beklagten musste daher unabhängig von-einander nach ihrem jeweiligen Kennt-nisstand klar sein, dass es sich beim Quanto-Snowball-Swap um kein geneh-migungsfreies Derivatgeschäft iSd § 446 Abs 2 ASVG handelte. Wollte man wie die Beklagte allein schon die Chance auf einen Gewinn zur Finanzierung künftiger Ausgaben als „Absicherung bestehender [1] BGH 10.6.1999, IX ZR 409/97.

OGH 8 Ob 11/11t
244 ÖBA 4/12
behördlichen Genehmigung für bestimm-te, (zumindest hier) auch abgrenzbare Geschäftsfälle ist in ihrer Auswirkung eine Beschränkung der Vertretungsmacht der Organe des Selbstverwaltungskörpers, die umso weniger bedenklich ist, als auch juristische Personen des Privatrechts un-terschiedlichen und abgestuften Formen der Vertretung nach außen unterliegen. Die Notwendigkeit einer aufsichtsbehörd-lichen Zustimmung stellt ein Hemmnis für risikobehaftete Finanztransaktionen der Sozialversicherungsträger dar. Eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung zu Lasten Privater ist in den hier zu be-urteilenden Bestimmungen aber nicht zu erkennen.
Die Vorinstanzen sind daher zutreffend von einer Unwirksamkeit sowohl des Rahmenvertrags als auch des Quanto-Snowball-Swaps ausgegangen.
1.8. Die konkrete Ausgestaltung und der Umfang der Beratungspflicht einer Bank nach § 13 WAG ergibt sich jeweils im Einzelfall in Abhängigkeit vom Kunden, insb von dessen Professionalität und vom ins Auge gefassten Anlageobjekt (RS0119752). Der Klägerin ist zuzuge-stehen, dass ihr Berater im vorliegenden Fall einem akademisch ausgebildeten Lei-ter der Finanzabteilung eines Sozialver- sicherungsträgers gegenüberstand, bei dem sie einen gehobenen allgemeinen Wissensstand über Anlageprodukte er-warten durfte, zumal Versicherungsträger nach § 446 Abs 4 ASVG dafür Sorge zu tragen haben, dass ihre Veranlagung durch Personen erfolgt, die dafür fachlich geeignet sind und eine entsprechende Berufserfahrung nachweisen können. Insofern kommt sowohl der Mitteilung der Klägerin, sie schätze die Beklagte als professionelle Marktteilnehmerin ein und nehme daher von einer Befragung und Beratung iS des WAG Abstand, als auch den Zusicherungen der Beklagten im Rahmenvertrag, über ausreichende Kenntnisse in den beschriebenen Ge-schäften zu verfügen und keine Beratung zu benötigen, in erster Linie deklarative Bedeutung zu.
1.9. Auch eine hohe Professionalität des Kunden kann aber nicht ausschließen, dass er im Einzelfall bezüglich eines be-stimmten Geschäfts doch einer Fehlvor-stellung unterliegt. Kann der Anlagebera-ter dies erkennen, dann hat er den Kunden speziell darüber aufzuklären, will er nicht das Geschäft der Anfechtbarkeit wegen Willensmangels aussetzen (RS0016184 [T5, T6]; RS0038122 [T6]; RS0014816). Auch ein versierter Geschäftspartner darf nicht in die Irre geführt werden.
1.10. Das Berufungsgericht hat den Vor-wurf einer Verletzung der Aufklärungs-pflichten der Klägerin daraus abgeleitet, dass deren Mitarbeiter falsche Vorstellun-
schen Unternehmens aufgrund behaup-teter fehlerhafter Anlageberatung (BGH 22.3.2011, XI ZR 33/10x) festgehalten, dass bei einem hochkomplex strukturier-ten und riskanten Produkt (dort: CMS Spread Ladder Swap) unabhängig von den Vorkenntnissen und der Risikobereit-schaft des Kunden hohe Anforderungen zu stellen seien. Insb müsse dem Kunden in verständlicher und nicht verharmlosen-der Weise klar vor Augen geführt werden, dass sein nach oben nicht begrenztes Ver-lustrisiko nicht nur theoretisch, sondern real und ruinös sein könne, wogegen die beratende Bank – abgesehen von Hedge-Geschäften – ihr Verlustrisiko von vorn-herein eng begrenzt habe.
Die Bank verletze ihre Beratungs-pflicht bereits dann, wenn sie den Kunden nicht auf den bereits zum Abschluss-zeitpunkt für ihn negativen Marktwert des Vertrags hinweise, weil der bewusst strukturierte negative Marktwert Aus-druck eines schwerwiegenden Interes-senkonflikts sei. Zwar müsse die Bank bei Vertrieb eigener Anlageprodukte nicht eigens darauf hinweisen, dass sie mit dem Produkt Gewinne erziele, weil der insofern bestehende Interessengegensatz offensichtlich sei. Die Bank sei jedoch dann aufklärungspflichtig, wenn über das reine Gewinnerzielungsinteresse hinaus besondere Umstände hinzutreten, insb wenn sie die Risikostruktur eines Anlagegeschäfts bewusst zu Lasten des Anlegers gestaltet habe, um das von ihm übernommene Risiko unmittelbar im Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertrags gewinnbringend verkaufen zu können.1.13. Diese auf die Wohlverhaltensregeln des § 31 dWpHG gestützten Erwägun-gen können in den Grundzügen auch für den vorliegenden Fall Beachtung finden. Auch beim Quanto-Snowball-Swap handelte es sich um ein komplex strukturiertes Produkt mit einem der Höhe nach kaum kalkulierbaren, aber schon wegen des einseitigen Kündigungsrechts asymmetrisch verteilten Risiko. Der sichere Zinsertrag im ersten Vertragsjahr vermochte einen Lockeffekt auszuüben. Über den Preis dieses Vorteils, insb über den (nicht festgestellten) Barwert des Ge-schäfts bei Vertragsabschluss wurde die Beklagte jedoch ebenso wenig aufgeklärt wie über die realistischen Bedingungen eines vorzeitigen Austritts und über die hohe Volatilität des Barwerts bei relativ geringen Zinsschwankungen.
Während der Finanzabteilungsleiter der Beklagten in seiner Meinung be-stärkt wurde, es liege ein beiderseitiges Spekulationsgeschäft vor, sodass sich die Klägerin idF auch dementsprechend risikoschonend verhalten und kündigen werde, hat diese – konträr zur ihr bekann-ten Erwartungshaltung der Kundin – das
gen des Kunden über das bei bestimmtem Verlauf des Geschäfts zu erwartende Verhalten der Bank und über die Höhe eines Ausstiegspreises nicht korrigiert und dadurch die Risiken des Geschäfts verharmlosend dargestellt haben. Diese Beurteilung wird vom erkennenden Senat geteilt.
Die Beklagte ist nicht etwa aus eigener Initiative an die Beklagte mit dem Ansin-nen herangetreten, gerade einen Quanto-Snowball-Swap abzuschließen, sondern dieses spezielle Geschäft wurde ihr – in genauer Kenntnis ihrer Erwartungen und Anforderungen – von der Klägerin vor-geschlagen. Bei der Beantwortung der konkreten Fragen, die der Vertreter der Beklagten zu diesem Produkt gestellt hat, befand sich die Klägerin in der Rolle einer Anlageberaterin, die für ihre Erklä-rungen einzustehen hat. Sie kann sich bezüglich erbetener Informationen und Auskünfte nicht auf formularmäßige all-gemeine Beratungsverzichtserklärungen oder Vermutungen bestehender – durch die Fragestellung aber widerlegter – Sach-kenntnisse berufen.1.11. Die objektiv unrichtige Informati-on des Beraters, die Bank werde „wohl“ bei stagnierenden Zinsen nach einem Jahr kündigen, war für den Vertragsentschluss der Beklagten ganz wesentlich, wäre sie doch in diesem Fall mit einem sicheren Gewinn aus dem Geschäft ausgestiegen, ohne länger das schwer kalkulierbare Risiko einer Zinserhöhung in den Folge-jahren tragen zu müssen.
Diese Überlegungen der Beklagten waren aber auch dem Verkaufsmitarbeiter aufgrund der mit dem Finanzabteilungs-leiter geführten Gespräche offenkundig. Seine Auskunft, in Verbindung mit der (ebenfalls nicht richtigen) Angabe, dass ein Ausstieg zum kalkulierbaren Barwert möglich wäre, musste geradezu zwangs-läufig bei der Beklagten die Vorstellung erwecken, dass sie nicht von der Zins-entwicklung über die ganze fünfjährige Laufzeit abhängig sein, sondern nur ein geringes, durch Marktbeobachtung lenk-bares Risiko bei erheblicher Gewinnchan-ce eingehen würde.
Tatsächlich hatte die Klägerin aber auf-grund des von ihr auf dem Interbanken-markt geschlossenen Hedge-Geschäfts ihr eigenes Spekulationsrisiko sofort neu-tralisiert und daher bei jedweder Zins-entwicklung kein Interesse an einer vor-zeitigen Kündigung des Swaps. Soweit die Rekursausführungen der Klägerin eine hypothetische Inanspruchnahme des Kündigungsrechts unterstellen, entfernen sie sich von den maßgeblichen Sachver-haltsfeststellungen.1.12. Der BGH hat in einer jüngst ergangenen Entscheidung über Scha-denersatzansprüche eines mittelständi-

OGH 8 Ob 11/11t
ÖBA 4/12 245
Genehmigung erübrigt hätte. Darüber hinaus sei der eingeklagte Schaden, der aus einem eigenständigen Swap-Geschäft mit einem Dritten abgeleitet werde, schon grundsätzlich nicht ersatzfähig.
Diesen Ausführungen kommt im Er-gebnis Berechtigung zu.
2.1. Der Beklagten ist die Verletzung ih-rer vorvertraglichen Pflicht zur Einholung der für die Wirksamkeit des Geschäfts er-forderlichen Genehmigung grundsätzlich vorzuwerfen. Eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist verpflichtet, die Genehmigung eines mangels einer sol-chen schwebend unwirksamen Vertrags zu beantragen, auch der Vertragspartner kann auf eine solche Genehmigung drin-gen (vgl 1 Ob 13/93, RS0014713).
In den Fällen der Unwirksamkeit eines Geschäfts wegen Fehlens beson-derer Gültigkeitsvoraussetzungen nach § 867 ABGB wird in hL und Rsp die Möglichkeit der Haftung des Rechtsträ-gers für culpa in contrahendo anerkannt (RS0009178; Rummel in Rummel³ § 867 ABGB Rz 9a; Apathy/Riedler aaO § 867 ABGB Rz 9 mwN; vgl auch Heinrichs in Palandt, BGB § 275 Rz 39; ausführlich BGH NJW 1999, 3335).
Umstände, die einem gültigen Ver-tragsschluss entgegenstehen, sind dem anderen Vertragspartner mitzuteilen (Reischauer in Rummel³ § 918 ABGB Rz 15 mwN). Auch öffentlich-rechtliche Körperschaften sind verpflichtet, den Partner durch ihre Verhandlungsführer als Erfüllungsgehilfen über die Gültig-keitsvoraussetzungen des beabsichtigten Geschäfts aufzuklären, sofern diese ihrem Organ bekannt oder leichter erkennbar sind als dem Partner. Wird der Partner im guten Glauben gelassen, es bestehe keine Genehmigungsbedürftigkeit, haf-tet die öffentlich-rechtliche Körperschaft auf das Vertrauensinteresse, wenn die Genehmigung in der Folge nicht erteilt wird (Wilhelm, Die Vertretung der Ge-bietskörperschaften im Privatrecht 278 f; allg Rummel aaO § 867 Rz 9a).
Schon allein aufgrund der Zielsetzung ihrer handelnden Organe, mit der in Aus-sicht genommenen Art von Geschäften Spekulationsgewinne zu erzielen, hätte die Beklagte selbst das Erfordernis einer ministeriellen Genehmigung nach § 446 Abs 3 ASVG erkennen müssen. Mit dem der Klägerin vorwerfbaren, erst das konkret gewählte Derivatprodukt betref-fenden Aufklärungsfehler kann sie sich insoweit nicht entlasten.
2.2. Die Frage der Schadensteilung kann aber ausnahmsweise dahingestellt blei-ben, weil die Klägerin im vorliegenden Verfahren keinen ersatzfähigen Schaden geltend macht.
von der Beklagten eingegangene Risiko für sich selbst umgehend durch Hedging in ein reines Spannengeschäft umgewan-delt. Welchen Wert das von der Beklagten eingegangene Risiko auf dem Interban-kenmarkt für die Klägerin tatsächlich hatte, lässt sich aus dem Klagsvorbringen insofern erahnen, als die Beklagte bis zur Glattstellung des Geschäfts € 261.104,12 an Zinsendifferenz lukriert hat, die Klä-gerin selbst aus dem Gegen-Swap aber € 671.104,12.1.14. Nach § 13 WAG in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gel-tenden Fassung hatte die Klägerin ihre Dienstleistungen mit der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissen-haftigkeit im Interesse ihrer Kunden zu erbringen, sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen, dafür zu sorgen, dass bei unvermeidbaren In- teressenkonflikten der Kundenauftrag unter der gebotenen Wahrung des Kun-deninteresses ausgeführt wird, und ihren Kunden alle zweckdienlichen Informatio-nen mitzuteilen, soweit dies zur Wahrung der Interessen der Kunden und im Hin-blick auf Art und Umfang der beabsich-tigten Geschäfte erforderlich war.
Die Klägerin wäre danach vor Ver-tragsabschluss verpflichtet gewesen, der Beklagten auf deren ausdrückliche Anfra-gen hin eine sachlich richtige Auskunft über ihr generell fehlendes wirtschaft-liches Interesse an der Ausübung des Kündigungsrechts zu geben, um ihr den bestehenden Interessenkonflikt deutlich zu machen. Da ihr bekannt war, dass die Beklagte mit einem vorzeitigen eigenen Vertragsausstieg im Fall nachhaltig stei-gender Zinsentwicklung spekulierte und ihre Risikoeinschätzung danach ausrich-tete, hätte es die Wahrung des Kunden-interesses außerdem erfordert, ihr eine re-alistische Vorstellung von der möglichen exorbitanten Höhe des Ausstiegspreises zu vermitteln.1.15. Die im Rekurs behandelte Frage einer allfälligen Verletzung von laufenden Betreuungspflichten durch die Klägerin kann im Hinblick darauf, dass überhaupt kein wirksamer Vertrag zustande gekom-men ist, dahingestellt bleiben.
Der Rekurs der Klägerin erweist sich damit insges als nicht berechtigt.
2. Rekurs der BeklagtenDie Beklagte macht geltend, das Beru-
fungsgericht habe die gravierende Verlet-zung vor- und nachvertraglicher Aufklä-rungs- und Sorgfaltspflichten durch die Klägerin nicht hinreichend gewürdigt. Die Annahme eines Mitverschuldens der Beklagten sei unvertretbar, weil sie den Swap ohne die vorangegangene Fehlbe-ratung von vornherein nicht in Betracht gezogen hätte, sodass sich die Frage einer
Auch für Schäden aus einer Ver-letzung vorvertraglicher Aufklärungs-pflichten gilt, dass nur alle adäquaten und im Rechtswidrigkeitszusammenhang stehenden Folgen vom Normzweck mit erfasst sind. Die Kausalität rechtswid-rigen Verhaltens reicht allein nicht zur Haftungsbegründung aus.
Aufklärungs-, Schutz- und Sorgfalts-pflichten gegenüber dem Vertragspartner bestehen im vorvertraglichen Stadium insb dann, wenn erkennbar ist, dass dieser im Vertrauen auf eine abgegebene Erklärung sich anschickt, selbst Verbind-lichkeiten einzugehen. Ist ein Geschäft formal abgeschlossen worden, aber nicht wirksam zustande gekommen, gebührt dem Vertragspartner, dessen Gegenüber ein Verschulden am Scheitern trifft, der Ersatz des Vertrauensschadens. Eine Haf-tung besteht jedoch nur für jene Folgen eines schädigenden Verhaltens, mit denen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge abstrakt gerechnet werden muss, nicht für einen atypischen Erfolg.
Eine adäquate Verursachung ist an-zunehmen, wenn das Verhalten unter Zugrundelegung eines zur Zeit der Beur-teilung vorhandenen höchsten mensch-lichen Erfahrungswissens und unter Be-rücksichtigung der zum Zeitpunkt der Handlung dem Verantwortlichen oder einem durchschnittlichen Menschen be-kannten oder erkennbaren Umstände ge-eignet war, eine Schadensfolge von der Art des eingetretenen Schadens in nicht ganz unerheblichem Grad zu begünstigen (ua 1 Ob 643/84, 644/84; zust Koziol, JBl 1986, 105). Ist das schädigende Er-eignis für den eingetretenen Erfolg nach allgemeiner Lebenserfahrung gleichgültig und war es nur durch eine außergewöhn-liche Verkettung von Umständen eine Bedingung für den Schaden, mangelt es an der Adäquanz.
2.3. Mit welchen Auswirkungen einer Unwirksamkeit des Grundgeschäfts auf Vertragsverhältnisse des Partners mit Dritten gerechnet werden konnte, kann objektiv nur aus der Position ex ante beurteilt werden. Wie weit der Kreis der Haftungsfolgen bei Verletzung einer Vertragsnorm oder einer vorvertraglichen Aufklärungspflicht reicht, ist davon ab-hängig, welche Umstände der Schuldner bei Vertragsschluss kannte oder kennen musste (Reischauer aaO § 1295 ABGB Rz 6; RS0017850).
2.4. Die Übernahme des Risikos aus einem Vertrag, der vom anderen Teil mit Dritten abgeschlossen wurde, ist nur aus-nahmsweise oder bei besonderer Verein-barung vom Schutzzweck des Grundver-hältnisses erfasst (1 Ob 643/84, 644/84). Umstände, die erst nach Vertragsab-schluss erkennbar waren und die der Schuldner bei Eingehen der Verpflichtung

OGH 8 Ob 11/11t
246 ÖBA 4/12
nicht berücksichtigen konnte, dürfen ihm auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Schutzzwecks zum Verhängnis werden (Reischauer aaO § 1295 ABGB Rz 8b, 8c). Wenn der geschädigte Vertragsteil mit der bedungenen Leistung Interessen verfolgt, die nicht mehr in der Leistung selbst liegen und daher vom üblichen Ent-gelt nicht abgedeckt werden, und überdies der Eintritt des Folgeschadens noch von einem Entschluss eines Dritten abhängig ist, der häufig kaum vorhersehbar ist, muss eine Zurechnung verneint werden (5 Ob 537/84 JBl 1986/105 [2] [zust Koziol]; Harrer in Schwimann³ § 1295 ABGB Rz 29).2.5. Der im vorliegenden Verfahren zu beurteilende Schadenersatzanspruch der Klägerin resultiert nicht aus dem be-reits rückabgewickelten, unwirksamen Swap-Geschäft selbst (sie macht keine Vertragsspesen, entgangenen Zinsen oder Finanzierungskosten geltend), sondern aus den Kosten der Auflösung eines nach-träglich mit einem Dritten eingegangenen Vertrags.
Der im Rekurs der Klägerin angestellte Vergleich ihres Anspruchs mit jenem eines Handwerkers, der sich mit Material zur Ausführung eines dann nicht zustande-gekommenen Auftrags eindecken musste, oder mit der Weiterveräußerung einer zu liefernden Sache, muss hier fehlschlagen. Die Klägerin musste das Gegen-Swap-Geschäft durchaus nicht abschließen, um den Vertrag mit der Beklagten erfüllen zu können. Der Senat verkennt zwar nicht, dass das Hedge-Geschäft wirtschaftlich betrachtet mit einem „Weiterverkauf“ der von der Beklagten im Derivatgeschäft übernommenen geldwerten Verpflichtun-gen verglichen werden könnte. Eine vor-zeitige Auflösung des Gegen-Swaps war – anders als bei Weiterverkauf einer vom Vertragspartner zu liefernden Ware – aber nicht notwendige Folge der Unwirksam-keit des Grundgeschäfts, handelte es sich doch um ein rechtlich selbstständiges Geschäft im Rahmen des Betriebsgegen-stands der Klägerin.2.6. Die Klägerin hat gegenüber der Beklagten vor Vertragsabschluss nicht zu erkennen gegeben, dass sie aufgrund des Swaps hohe Verbindlichkeiten gegenüber Dritten eingehen werde.
Die festgestellte Auskunft über die Wahrscheinlichkeit einer Kündigung bei stagnierendem CHF-Libor musste im Gegenteil bei der Beklagten den Ein-druck festigen, dass die Klägerin ihren Teil des Wettrisikos genauso wie die Beklagte selbst tragen werde. Es war der Beklagten damit aber nicht möglich, dieses zusätzliche Risiko bei ihren Ver-tragsverhandlungen einzukalkulieren. Sie konnte es va nicht bei ihrer Prüfung, ob eine aufsichtsbehördliche Genehmigung des Geschäfts erforderlich ist, berücksich-
liche Abschluss eines Quanto-Snowball-Swaps unter § 446 Abs 3 ASVG zu subsumieren ist.
Denn selbst unter Zugrundelegung des Grundsatzes, dass der Vagheits-bereich öffentlich-rechtlicher Normen, die die Vertretungsmacht von Organen juristischer Personen öffentlichen Rechts beschränken, zu Lasten einer allfälligen Beschränkung der Vertretungsmacht die-ser Organe geht, mithin im Zweifel sehr wohl vom Vorliegen hinreichender Ver-tretungsmacht auszugehen ist (vgl dazu va RIS-Justiz RS0014733), kann man im konkreten Fall vertretbar wohl nicht zum Ergebnis gelangen, dass – argumento e § 446 Abs 2 ASVG – hinreichende Vertretungsmacht der Organe der Sozial-versicherungsträgerin zum Abschluss des Swaps ohne ministerielle Genehmigung dieses Geschäftes bestanden hätte.
Zu eindeutig sind diesbezüglich so-wohl der Wortlaut von § 446 Abs 2 ASVG als auch die Materialien zur 60. ASVG-Novelle (1183 BlgNR XXI. GP 67f), mit der § 446 Abs 2 ASVG neu geschaffen und – offenkundig dem Trend der dama-ligen Zeit normativ Rechnung tragend – vom Gesetzgeber die damals marktüblich gewordenen Mechanismen zur Absiche-rung von Zinsrisiken durch Finanzderivate im Ergebnis den Maßnahmen der ordent-lichen Verwaltung des Vermögens der Sozialversicherungsträger zugeschlagen wurden – aber eben nur die Absicherung von ansonsten bereits bestehenden Zins-risiken, denen das Vermögen der Sozial-versicherungsträger ausgesetzt ist. Und dazu zählt gewiss nicht, was im konkre-ten Fall wohl vorgelegen hat, unabhängig von vorhandenen Zinsrisiken, denen die Sozialversicherungsträger bereits aus-gesetzt sind, völlig neue Risiken einzu-gehen. Das wollte der Gesetzgeber der 60. ASVG-Novelle gewiss nicht der ei-genständigen Entscheidungskompetenz der Organe der Sozialversicherungsträger übertragen.
Ebenfalls zutreffend ist, dass der Senat – im Anschluss an die Vorjudikatur – man-gels Vorliegens bzw wegen Versagung der ministeriellen Genehmigung von der Nichtigkeit des Abschlusses des Quanto-Snowball-Swaps ausgegangen ist.
1.2. Die generelle Problematik von öffentlich-rechtlichen Genehmigungs-erfordernissen
Dass freilich eine Beschränkung der Vertretungsmacht juristischer Personen des öffentlichen Rechts, wie sie in § 446
tigen, wobei es auf der Hand liegt, dass diese Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen hätte können, wenn die Beklagte bereits vor Vertragsabschluss auf das ge-samte Ausmaß drohender Folgeschäden hingewiesen worden wäre.
Die bloß allgemein gehaltene Anmer-kung des Treasury-Sales-Mitarbeiters, die Klägerin werde sich absichern, ist als ein Verweis auf die Risikobegrenzungspflicht der Banken nach § 39 Abs 1 BWG ver-ständlich, ohne dass ihm eine konkrete Bedeutung bezüglich der Art der vorgese-henen Absicherung beigemessen werden konnte. Insb war daraus für die Beklagte nicht erkennbar, dass die geplante „Ab-sicherung“ umgehend zur Ursache eines exorbitanten Schadens mutieren könnte.
Dass der Abschluss eines gegenläu-figen Spekulationsgeschäfts die einzige Möglichkeit der gesetzmäßigen Risiko-deckung gewesen wäre, wurde nicht be-hauptet. Gegenstand des Klagebegehrens ist noch dazu nicht der Betrag, den die Klägerin zur Erfüllung des Hedge-Ge-schäfts aufwenden hätte müssen, sondern dessen spekulativer, vom Zeitpunkt der von ihr selbst herbeigeführten vorzeiti-gen Auflösung abhängiger Ausstiegspreis. Dieser Schaden lag nach dem festgestell-ten Sachverhalt nicht mehr innerhalb der Reichweite der vorvertraglichen Schutz-pflichten der Beklagten.
Dieses Ergebnis ist auch aus dem Blickwinkel des Schutzzwecks des Ge-nehmigungsvorbehalts konsequent, käme die Beklagte doch ansonsten auf dem Umweg des Schadenersatzes in die Lage, anstelle des nicht genehmigungsfähigen, unwirksamen eigenen Spekulationsge-schäfts das nicht weniger nachteilige Spekulationsgeschäft der Klägerin erfül-len zu müssen.
Andere Forderungen als jene aus der vorzeitigen Beendigung des Hedge-Ge-schäfts wurden nicht erhoben, sodass sich eine weitergehende Auseinandersetzung mit Reichweite und Grenzen der eventuell möglichen Haftungsfolgen erübrigt.2.7. Dem Rekurs der Beklagten war daher Folge zu geben, der angefochtene Beschluss aufzuheben und das abwei-sende Urteil des Erstgerichts wiederher-zustellen.
Anmerkung:
Der Entscheidung des achten Senates ist im Ergebnis uneingeschränkt, in der Begründung überwiegend zuzustimmen.
1. Unwirksamkeit mangels ministeri-eller Genehmigung
1.1. Spezielle Regelung des ASVG
Zutreffend ist zunächst die Auffas-sung, dass der verfahrensgegenständ- [2] Richtig: JBl 1986, 103.

OGH 8 Ob 11/11t
ÖBA 4/12 247
zweiter Satz folgendermaßen lauten sollte: „Leidet Jemand hiebei (gemeint: im Rahmen des Kontrahierens mit der öffentlichen Hand ohne hinreichende Ver-tretungsmacht der für diese handelnden Organe, Anm d Verf) in gutem Glauben, ohne sein Versehn oder ohne eine schuld-bare Unwissenheit einen Schaden, so muss er von dem Staate, welchem der Ersatz gegen den schuldtragenden Ver-walter oder Geschäftsführer vorbehalten bleibt, entschädigt werden“ (vgl Ofner, Protokolle II 555f).
Der Erfolg dieses Vorstoßes von v Pratobevera war freilich denkbar gering: „Denn zu dem zweiten Theile des vor-geschlagenen Paragraphen“ – so die Be-ratungsprotokolle der Superrevision (vgl Ofner aaO) – „wollten sich diese Stimmen gar nie verstehen, indem man dadurch das Aerarium zu sehr kompromittieren würde“.
Gleichwohl ist die herrschende An-sicht, auf die sich auch die Entscheidung beruft, zweifellos im Recht, wenn sie die grundsätzliche Möglichkeit der Haftung auch von juristischen Personen des öffentlichen Rechts für vollmachtsloses Handeln ihrer Organe in contrahendo bejaht.
Nicht zu bezweifeln ist zunächst, dass der erwähnte „negative Regelungswille“ der Gesetzesredaktoren im Wortlaut des ABGB keinen Niederschlag gefunden hat, dieser „negative Regelungswille“ die Rechtsfindung diesseits der lex-lata-Grenze sohin gerade nicht definitiv präju-diziert (vgl dazu bloß F. Bydlinski, Thesen zur lex-lata-Grenze der Rechtsfindung, JBl 1997, 617ff).
Dementsprechend hat auch das Ge-wicht der übrigen Elemente des tradier-ten Auslegungscanons bei der Beur-teilung der Frage Beachtung zu finden, ob aus geltungszeitlicher Perspektive den Maßstäben der Rechtsordnung eine Haftung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts für die vollmachtslose Teilnahme ihrer Organe am Rechtsver-kehr ent- oder aber widerspricht.
Und unter diesen kommt mE – neben dem Umstand, dass einer historischen Stellungnahme zu einer Frage der cul-pa in contrahendo in einer Zeit, in der dieses Rechtsinstitut als solches dog-matisch noch nicht einmal ansatzweise in voller Deutlichkeit erkannt worden war, wohl schon per se nicht übermäßig großes Gewicht zugemessen werden kann – einerseits der aus § 26 ABGB hervorleuchtenden Wertung (Gleichstel-lung von juristischen und natürlichen Personen im Hinblick auf ihre Rechte und Pflichten gemäß des Satzes 2 von leg cit) sowie andererseits dem Gebot der verfassungskonformen Interpretation ein besonderer Stellenwert zu: Durch nichts
ASVG angeordnet ist, im Rahmen einer Rechtsordnung, die – mittlerweile – ua derartige Rechtspersonen ex lege zu Unternehmern stempelt (vgl § 1 Abs 2 Satz 2 KSchG) und selbst ideelle Vereine im Interesse der Sicherheit des Rechts-verkehrs den Risiken einer gesetzlich verfügten Formalvollmacht aussetzt (vgl § 6 Abs 3 VerG 2002; rechtspolitisch kri-tisch dazu freilich Vonkilch, Anmerkung zu ZAS 2002/5; vgl zum Problem auch OGH in ÖBA 2010/1637 und dazu wie-derum Kossak, Keine Formalvollmacht des Vereinsobmannes? ZAK 2010, 187), wertungsmäßig einigermaßen „schief“ erscheint, wird man wohl nicht ernstlich bestreiten können.
Gleichwohl können im gegenständ-lichen Zusammenhang allfällige verfas-sungsrechtliche Bedenken gegen diesen Zustand (gehegt etwa bei Thunhart, Eigenmächtige Vertragsabschlüsse des Bürgermeisters und die Notwendigkeit von Vertrauensschutz im Gemeinderecht, JBl 2001, 69ff) nichts an der Richtigkeit des vom Senat de lege lata , dh auf Basis der §§ 6f ABGB, § 446 ASVG, eingenom-menen Standpunktes ändern; und es ist dem Senat wohl auch recht zu geben, dass im gegenständlichen Zusammen-hang – va aufgrund des Umfangs und der Transparenz des die Vertretungsmacht der Organe von Sozialversicherungsträ-gern beschränkenden Tatbestandes des § 446 ASVG – kein hinreichender Anlass bestanden hat, den de lege lata zwei-felsfrei erzielbaren Befund durch die Ein-leitung eines Normprüfungsverfahrens einer allfälligen verfassungsgerichtlichen Revision zu unterziehen.
2. Culpa in contrahendo
2.1. Grundsätzliche Möglichkeit einer Haftung auch von juristischen Perso-nen öffentlichen Rechts aus culpa in contrahendo
Zustimmungswürdig ist auch das grundsätzliche Bekenntnis des Senates zur Möglichkeit einer Haftung von juris-tischen Person öffentlichen Rechts aus culpa in contrahendo, wenn ihre Organe am Rechtsverkehr teilnehmen, ohne hin-reichende Vertretungsmacht zu haben.
Wenn man sich bei seinem diesbe-züglichen Verständnis des geltenden Rechts von Reminiszenzen an die Entste-hungsgeschichte des ABGB leiten lässt, ist die Bejahung der Möglichkeit einer derartigen Haftung freilich keineswegs so selbstverständlich, wie dies die vor-liegende Entscheidung vermuten lassen würde.
Zu erinnern ist in diesem Zusammen-hang daran, dass von v Pratobevera im Rahmen der Superrevision des ABGB die zusätzliche Aufnahme eines Paragraphen ins Gesetz vorgeschlagen wurde, dessen
wäre es sachlich zu rechtfertigen, wenn juristische Personen des öffentlichen Rechts (bis hin zur Republik Österreich!) am Rechtsverkehr teilnehmen könnten, ohne für rechtswidriges Verhalten ihrer Organe in contrahendo einstehen zu müssen. Oder um es mit den Worten des BGH (in NJW 1999, 3355) zu formulieren: „Ein so weitgehender Eingriff (gemeint: durch Verneinung der gegenständlichen Haftung auch von juristischen Personen des öffentlichen Rechts) in schutzwür-diges Vertrauen der Geschäftspartner wäre nicht zu rechtfertigen; auch die Sonderstellung juristischer Personen des öffentlichen Rechts trägt ihn nicht“. Dem ist mE nichts hinzuzufügen.
2.2. Fragen der Haftungsbegrenzung
Im Ergebnis richtig war es schließlich auch, dass vom erkennenden Senat in concreto – und trotz ebenfalls richtiger-weise angenommenem Vorliegens von culpa in contrahendo auf Seiten ihres Finanzabteilungsleiters – eine Haftung der beklagten Sozialversicherungsträgerin auf den von der klagenden Bank verfahrens-gegenständlich geltend gemachten Ver-trauensschaden verneint wurde.
Nur zum Teil überzeugend erscheint freilich die von der Entscheidung für die Verneinung dieser Haftung gegebene Begründung.
Dies betrifft zunächst den in der Ent-scheidung enthaltenen Verweis auf jene Judikaturlinie, nach der die Übernahme des Risikos aus einem Vertrag, der vom anderen Teil mit Dritten abgeschlossen wurde, nur ausnahmsweise oder bei be-sonderer Vereinbarung vom Schutzzweck des Grundverhältnisses erfasst wäre.
Die diesbezüglichen Bedenken grün-den nicht nur daher, dass die angespro-chene Judikaturlinie so einheitlich, wie man dies der Entscheidung vielleicht ent-nehmen könnte, nicht ist. Zu verweisen ist etwa auf die Entscheidungen JBl 1986, 101 und JBl 1991, 457, die jenen Scha-den, den der Geschädigte aufgrund der mangelhaften Vertragserfüllung aus Ver-trägen, die er mit Dritten abgeschlossen hat, erlitten hat, sehr wohl für ersatzfähig angesehen haben (vgl allgemein dazu, dass zu nach den Maßstäben des red-lichen Verkehrs bestehenden vertrag-lichen Schutz- und Sorgfaltspflichten auch zählen kann, die Geschäftsbeziehungen des Vertragspartners mit Dritten nicht zu gefährden, Vonkilch in Fenyves/Kersch-ner/Vonkilch, Klang3 § 914 ABGB Rz 47, auch mit Nw zur einschlägigen Literatur; zur eben nachgewiesenen Judikatur sie-he auch Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1295 Rz 8l).
Viel gewichtiger erscheint der Um-stand, dass jener Wertungsgesichtspunkt, der die von der Entscheidung bezogene

OGH 8 Ob 11/11t
248 ÖBA 4/12
Judikaturlinie offenkundig trägt, nämlich das Bestreben der Vermeidung einer ansonsten drohenden gleichermaßen exorbitanten wie ex ante unvorherseh-baren Ausuferung des vom Schädiger zu leistenden Ersatzes, bei der Haftung aus culpa in contrahendo schon eo ipso nicht tragfähig erscheint.
Gewiss mag es in manchen Konstella-tionen zu Bedenken Anlass geben, wenn dem Schädiger Ersatzpflichten drohen, die – für den Schädiger ex ante unvor-hersehbar – uferlose Ausmaße anneh-men. Aber drohen diese Gefahren bei der Haftung aus culpa in contrahendo nicht schon idealtypisch deswegen gar nicht, weil diese nach völlig hA (vgl bloß Karner in KBB3 § 1293 Rz 11 mwN) mit dem (hypothetischen) Erfüllungsinteresse des Geschädigten aus dem potentiellen Vertrag begrenzt ist?
Aber selbst eine derartig begrenzte Haftung scheint der Entscheidung offen-bar in Konstellationen wie der verfahrens-gegenständlichen ganz grundsätzlich zu weit zu gehen; zumindest lässt sich der in der Entscheidung enthaltene Hinweis darauf, dass die Verneinung einer Haf-tung wie der verfahrensgegenständlichen „auch aus dem Blickwinkel des Schutz-zwecks der Genehmigungsvorbehalte konsequent erscheint, käme die Beklagte doch ansonsten auf dem Umweg des Schadenersatzes in die Lage, anstelle des nicht genehmigungsfähigen, unwirk-samen eigenen Spekulationsgeschäfts das nicht weniger nachteilige Spekula-tionsgeschäft der Klägerin erfüllen zu müssen“, ganz zwanglos so verstehen.
Gegenüber einer derartigen interpre-tativen Korrektur allgemeiner schaden-ersatzrechtlicher Grundsätze mit Blick auf den Schutzzweck jener Normen, die eine Begrenzung der rechtsgeschäft-lichen Handlungsfähigkeit bestimmter Rechtssubjekte normieren, erscheinen indes erhebliche dogmatische Bedenken angebracht.
Derartiges mag – wenn überhaupt (zum Meinungsstand bezüglich der Be-schränkung einer Haftung aus culpa in contrahendo von nicht geschäftsfähigen natürlichen Personen aus Schutzzweck-überlegungen zuletzt umfassend Fischer-Czermak, Zur Haftung beschränkt Ge-schäftsfähiger aus culpa in contrahendo, in: FS Reischauer [2010], 117ff) – de lege lata bei Personen adäquat erscheinen, die iSv § 21 ABGB „unter dem besonderen Schutz der Gesetze stehen.“ Bei juristi-schen Personen des öffentlichen Rechts ist dies indes seit dem VolljährG 1973 gerade nicht mehr der Fall (vgl zB Aicher in Rummel, ABGB3 § 21 Rz 2).
Ergo muss, vor allem wiederum argu-mento e § 26 ABGB sowie im Sinne ver-fassungskonformer Interpretation (Ver-
alldem nur der Hinweis der Entscheidung darauf, dass der Finanzabteilungsleiter der beklagten Sozialversicherungsträge-rin seitens der Mitarbeiter der klagenden Bank über die der Sozialversicherungs-trägerin aus dem Quanto-Snowball-Swap maximal drohenden Zahlungspflichten, mithin das Erfüllungsinteresse der kla-genden Bank aus diesem Geschäft, völlig unzutreffend beraten wurde und er bei korrekter Beratung dieses Geschäft – ministerielle Genehmigungspflicht hin oder her – jedenfalls nicht abgeschlossen hätte.
Zwar war in § 8 des zwischen den Streitteilen abgeschlossenen Rahmenver-trages („Schadenersatz und Vorteilsaus-gleich“) pauschal vorgesehen, dass im Falle der Beendigung der kündigenden Partei ein vom Verschulden der anderen Partei unabhängiger Anspruch auf Scha-denersatz zusteht, der auf der Grundlage von unverzüglich abzuschließenden Er-satzgeschäften ermittelt wird, „die dazu führen, dass die ersatzberechtigte Partei alle Zahlungen und sonstigen Leistungen erhält, die ihr bei ordnungsgemäßer Ver-tragsabwicklung zugestanden wären.“
Nach den Feststellungen betrachtete die Beklagte jedoch aufgrund der ihr vom „Treasury Sales“-Betreuer der Klägerin erteilten Auskünfte (!) den Swap als Ge-schäft mit beherrschbarem Risiko (!) zur Absicherung ihrer gesamten Finanzie-rungsstruktur. Genauer rechnete gemäß diesen Feststellungen der Finanzabtei-lungsleiter der Beklagten damit, dass die Klägerin bei stagnierendem Zinsenniveau von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen werde und die Beklagte dadurch insgesamt einen Gewinn lukrieren könne (!) und wurde in dieser Ansicht vom betreuenden Mitarbeiter der Klägerin noch bestärkt (!). Die Beklagte musste demnach mit keinem Schaden rechnen; daher stellte sich in concreto auch nicht mehr die Frage, wie der Fall zu lösen wäre, dass der Kunde zwar mit einem Schaden rechnen muss, dieser aber höher als erwartet ausfällt.
Bei einem solchen Sachverhalt über-zeugt das Argument des OGH jedenfalls. In der Tat kann man es schwerlich als vom Rechtswidrigkeitszusammenhang der das Organ einer juristischen Person öffent-lichen Rechts in contrahendo treffenden Sorgfaltspflichten umfasst ansehen, dass seitens der juristischen Person öffent-lichen Rechts auch (Vertrauens-)Schäden der Bank zu ersetzen wären, die bei kor-rekter Beratung der Kunden durch die Bank nicht entstanden wären.
a. Univ.-Prof. Dr. Andreas Vonkilch, Institut für Zivilrecht,
Universität Wien
meidung unsachlicher Differenzierungen) gelten, dass die allgemeinen Grundsät-ze der culpa in contrahendo uneinge-schränkt auch bei juristischen Personen öffentlichen Rechts bzw der Teilnahme von deren Organen am Rechtsverkehr zur Anwendung zu gelangen haben. Um es wieder mit den Worten des BGH (in NJW 1999, 3355) zu formulieren: „Der Umstand, dass die Höhe des erlittenen Vertrauensschadens im Einzelfall dem Erfüllungsinteresse der Kl. entspricht, rechtfertigt es für sich allein nicht, den Bekl. von einer Haftung völlig freizustel-len. Entscheidend ist, dass der Grund für das Einstehenmüssen nicht die Bindung des Bekl. an seine rechtsgeschäftliche Erklärung ist, sondern die Verletzung von Sorgfaltspflichten aus der Sonder-rechtsbeziehung mit der Kl.: Unabhängig von einer vertraglichen Bindung wäre der Schaden vermieden worden, wenn auf den Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde hingewiesen worden wäre.“
Hinzu kommt aus praktischer Sicht, dass eine – primär wohl ergebnisorien-tierte – Beschränkung der allgemeinen Grundsätze der culpa in contrahendo aus dem geschilderten Blickwinkel kaum wirklich judiziabel erscheint.
Dies mag allenfalls noch dann so sein, wenn sich tatsächlich ein erlittener Vertrauensschaden des Gegenübers und sein hypothetisches Erfüllungsinteresse aus dem potentiellen Vertrag im Ergeb-nis betraglich decken. Aber wie wollte man es in jenen Fällen halten, in denen es zwar nicht zu einer vollständigen Kongruenz von tatsächlich erlittenem Vertrauensschaden und hypothetischem Erfüllungsinteresse kommt, sich der nach allgemeinen Grundsätzen ersatzfähige Vertrauensschaden dem hypothetischen Erfüllungsinteresse aber – mehr oder we-niger weit – annähert (derartige Konstel-lationen spricht etwa Thunhart, JBl 2001, 69ff an; dies durchaus mit erheblicher rechtspolitischer Sympathie für den sol-cherart de facto erzeugten Druck auf juris-tische Personen des öffentlichen Rechts, das vollmachtslose Handeln ihrer Organe doch gegen sich gelten zu lassen)? Wollte man hier aus Schutzzwecküberlegungen die Haftung der juristischen Person öf-fentlichen Rechts aus culpa in contrahen-do ebenfalls begrenzen? Und wenn ja, in welchem Umfang? Etwa mit maximal 50% des Erfüllungsinteresses? Oder mit 75% desselben?
2.3. Berücksichtigung des Rechtswid-rigkeitszusammenhangs
Als wirklich durchschlagendes Argu-ment für die Verneinung der verfahrens-gegenständlichen Haftung der beklagten Sozialversicherungsträgerin bleibt nach

OGH 7 Ob 68/11t
ÖBA 4/12 249
1797.§ 38 BWG; §§ 6, 12, 25c, 28 KSchG. Eine Unterlassungserklärung, mit der sich der Abgemahnte erst rund 2 ½ Monate später als gefordert zur Zahlung der Konventionalstrafe verpflichtet, be-seitigt die Wiederholungsgefahr nicht.Eine Klausel mit einer Zugangsfiktion muss ausdrücklich klarstellen, dass der Eintritt der Fiktion voraussetzt, dass gerade an die vom Verbraucher zuletzt bekanntgegebene Anschrift zugestellt wird.Eine wirksame Entbindung vom Bank-geheimnis setzt voraus, dass die Erklä-rung vom Kunden unterschrieben wird. Die Aufnahme einer solchen Klausel in AGB erweckt den irreführenden Eindruck, die Klausel werde bereits dadurch Vertragsinhalt; sie ist daher unzulässig.OGH 12. 10. 2011, 7 Ob 68/11t
Aus den Entscheidungsgründen:
Die Beklagte betreibt das mittelbare Finanzierungsleasing in ganz Österreich und schließt Verträge mit Verbrauchern ab. Sie verwendet die strittigen Klauseln in ihren AGB und/oder Vertragsform-blättern.
Mit Schreiben vom 23.3.2007 forderte die Klägerin die Beklagte auf, bis spätes-tens 13.4.2007 eine Unterlassungserklä-rung abzugeben und räumte der Beklagten für diesen Fall eine Aufbrauchfrist bis 31.7.2007 ein. Die Beklagte nahm mit Schreiben vom 12.4.2007 zu den einzel-nen Klauseln Stellung und verwies darauf, dass sie mit 11.4.2007 neue Leasingan-tragsbedingungen verwende und dass damit die Beanstandungen der Klägerin hinsichtlich einiger Klauseln obsolet sei-en. Eine mit Konventionalstrafe besicher-te Unterlassungserklärung gab sie nicht ab. Mit Schreiben vom 24.4.2007 wies die Klägerin die Beklagte darauf hin, dass mit ihrer Stellungnahme keine den gesetz-lichen Anforderungen entsprechende Un-terlassungserklärung abgegeben worden sei und verlängerte die Frist zur Abgabe einer derartigen Erklärung bis 15.6.2007.
Mit Schreiben vom 15.6.2007 gab die Beklagte der Klägerin gegenüber eine Unterlassungserklärung ab. Diese war hinsichtlich [einiger Klauseln] uneinge-schränkt. Hinsichtlich [anderer] Klauseln betraf sie nur einen Teil des Textes und hinsichtlich [ua der Klausel 33] fügte die Beklagte weitere Bedingungen hinzu. Sie führte aus, dass sie ihre Leasingvertrags-bedingungen inhaltlich umfassend über-arbeitet, jedoch textlich nicht komplett abgeändert habe, weshalb eine „leich-te Adaptierung“ der verlangten Unter- lassungserklärung vorgenommen worden sei. Die neuen Leasingvertragsbedingun-gen würden bis 31.8.2007 umgesetzt.
Hinsichtlich [ua der Klausel 34] gab die Beklagte keine Unterlassungserklärung ab. Die Beklagte verpflichtete sich, „für den Fall des Zuwiderhandelns gegen Punkt 1 dieser Unterlassungserklärung nach Ablauf des 31.8.2007 eine Vertrags-strafe in der Höhe von € 700 pro Klausel und pro Zuwiderhandeln“ an die Klägerin zu bezahlen.
Im Revisionsverfahren sind nur mehr die Fragen der Wiederholungsgefahr und der Zulässigkeit der Klauseln 34 und 43 Gegenstand.
Zur Wiederholungsgefahr:Nach stRsp kann die Wiederholungsge-
fahr nur durch die vollständige Unterwer-fung unter den Anspruch einer gemäß § 29 KSchG klageberechtigten Einrichtung beseitigt werden (RS0111637). Lehnt die Beklagte eine Unterwerfungserklärung hinsichtlich der Verwendung sinngleicher Klauseln ab, bietet sie keine ausreichen-de Sicherheit gegen die Wiederholung von Gesetzesverstößen und beseitigt die Wiederholungsgefahr nicht (RS0111640, RS0111638). Bei der Prüfung der Wie-derholungsgefahr darf nicht engherzig vorgegangen werden. Diese liegt schon im Fortbestehen eines Zustands, der keine Sicherung gegen weitere Rechtsver-letzungen bietet. Wiederholungsgefahr ist daher auch anzunehmen, wenn der mit der Unterlassungsklage Belangte sein Unrecht nicht einsieht (RS0010497). Hat der Unternehmer unzulässige Klauseln verwendet, wird die Wiederholungsgefahr vermutet (4 Ob 227/06w, 7 Ob 173/10g [1]). Der OGH hat bereits mehrfach aus-gesprochen, dass auch keine vollständige Unterwerfung vorliegt, wenn der Verwen-der von AGB seiner nach Abmahnung gemäß § 28 Abs 2 KSchG abgegebenen Unterlassungserklärung neu formulierte Ersatzklauseln mit dem Bemerken bei-fügt, diese seien von der Unterlassungs-erklärung ausgenommen (RS0125395). Die Vorgangsweise widerspricht dem Zweck des § 28 Abs 2 KSchG, der auf eine für beide Teile kostengünstige und die Gerichte entlastende Bereinigung der Angelegenheit und die Schaffung von Rechtssicherheit für beide Seiten ausge-richtet ist. Es ist ausschließlich Sache des Verwenders der AGB, für deren gesetz-mäßigen Inhalt zu sorgen (1 Ob 131/09k [2] ua).
Mit der dagegen erhobenen Kritik der Lehre (etwa Kellner, ÖBA 2010, 674 ff [680]; Bollenberger, ÖBA 2010, 304 ff; ders, RdW 2010/480, 442; Riss, RdW 2009/713, 695 ff; Pöchhacker/Rie-de, wbl 2010, 217) setzte sich der OGH in seiner E 8 Ob 124/10h [3] eingehend auseinander. Unter Berücksichtigung der den gesetzlichen Bestimmungen zu Grun-de liegenden Richtlinien kam er zu dem Ergebnis, dass der Gesetzgeber mit dem
Abmahnverfahren ein eigenes Verfahren zur Vermeidung gerichtlicher Verfahren vorschalten und mangels verpflichtender Inanspruchnahme für die klageberechtig-ten Verbände auch attraktiv ausgestalten wollte. Mangels entsprechender Anhalts-punkte ist nicht zu unterstellen, dass der Gesetzgeber die in diesem Zusammen-hang vorgenommene Sonderregelung für die Beurteilung des Wegfalls der Wieder-holungsgefahr in § 28 Abs 2 KSchG auch dahin verstanden haben wollte, dass er es den bereits – zugestandenermaßen – rechtswidrig handelnden Unternehmern auch noch ermöglichen wollte, durch das Anbot einer allenfalls großen Anzahl von Ersatzklauseln die gerade noch zulässige Klauselvariante „auszutesten“ und den Verband zu einer neuerlichen Prüfung zu zwingen. Der Verband erlangt durch die unbedingte Unterlassungserklärung den Vorteil der bereits vereinbarten Vertrags-strafe, sodass das schon vorher rechts-widrig handelnde Unternehmen auch im Hinblick darauf bei der Ersatzklausel wohl eher eine klarere und unbedenk-lichere Variante wählen wird.
Nach stRsp muss also die mit einer Konventionalstrafe gesicherte Unterlas-sungserklärung, die zum Wegfall der Wie-derholungsgefahr führt, eine vollständige Unterwerfung unter die Abmahnung sein. Dies ist dann nicht der Fall, wenn das Unternehmen Einschränkungen macht und Bedingungen stellt.
Im vorliegenden Fall gab die Beklagte hinsichtlich eines Teils der Klauseln zwar eine textmäßig uneingeschränkte Unterlassungserklärung ab, aber mit dem Zusatz, dass sie sich erst rund 2 ½ Monate später als gefordert zur Zahlung einer Konventionalstrafe bei Zuwiderhandeln verpflichten wolle. Es steht dem rechts-widrig handelnden Unternehmen aber nicht zu, einseitig Sanktionen hinauszu-zögern und den Verband zum Zuwarten zu zwingen. Das zeigt insb der vorliegende Fall, in dem die Beklagte schon einmal eine Verlängerung der Frist erwirkt hat und dann den Vorbehalt machte, obwohl nach ihren Ankündigungen bereits „neue Bedingungen“ in Geltung seien. Eine Unterstützung dieser Verzögerungstaktik entspricht nicht dem vom Gesetzgeber angestrebten Zweck, durch das Abmahn-verfahren einen effektiven und raschen Rechtsschutz für den Verbraucher zu gewährleisten. Rechtssicherheit wäre nicht erreicht. Ob die Unterlassungs-erklärung geeignet ist, den Wegfall der Wiederholungsgefahr zu bewirken, ist
[1] ÖBA 2011, 751.[2] ÖBA 2010, 319 mit Besprechungsauf-
satz von Bollenberger.[3] ÖBA 2011, 826.

OGH 7 Ob 68/11t
250 ÖBA 4/12
der Betroffene weiß, welche seiner Daten zu welchem Zweck verwendet werden (RS0115216). Eine wirksame Entbindung vom Bankgeheimnis nach § 38 Abs 1 BWG setzt voraus, dass die Erklärung vom Kunden unterschrieben wird. Die Aufnahme einer solchen Klausel in All-gemeine Geschäftsbedingungen erweckt den irreführenden Eindruck, die Klausel werde bereits dadurch Vertragsinhalt; sie ist daher unzulässig (RS0115218). Die Klausel ist unwirksam, was auch die Beklagte erkannte, gab sie doch zu dieser Klausel zunächst eine – allerdings nicht wirksame – Unterlassungserklärung ab.
Anmerkung:
Diese Anmerkung wird sich nicht mit der Problematik der Wiederholungsge-fahr beschäftigen, da der OGH schon mehrfach (zuletzt in der E 7 Ob 173/10g in ÖBA 2011, 751) seinen neuen Stand-punkt hiezu vertreten hat, wobei aller-dings die Auseinandersetzung mit der Gegenmeinung nicht eingehend war und die Begründungen divergieren (ob sich die Judikatur zu § 28 KSchG, wie zuletzt die E 8 Ob 124/10h und die vor-liegende E meinen, auf EU-Richtlinien stützen kann, bedürfte einer gesonderten Erörterung). Den Ausführungen des OGH zur Klausel 43 ist zuzustimmen und es bedarf hiezu keiner weiteren Auseinan-dersetzung. Höchst diskussionswürdig ist hingegen die Entscheidung des OGH, soweit sie die Klausel 34 betrifft. Hiezu ist vor allem auch deshalb Stellung zu beziehen, weil der Senat damit seine schon in der E ÖBA 2011, 751 vertretene Ansicht bestätigt und damit die Gefahr des Entstehens einer ständigen Recht-sprechung droht.
Nach § 6 Abs 1 Z 3 KSchG kann eine für den Verbraucher rechtlich bedeutsame Erklärung des Unternehmers, die jenem nicht zugegangen ist, nur dann als dem Verbraucher zugegangen gelten, wenn sie „an die zuletzt bekanntgegebene An-schrift des Verbrauchers“ gesendet wurde und der Verbraucher dem Unternehmer eine Änderung seiner Anschrift nicht bekanntgegeben hat. In der im hier in-teressierenden Verfahren beanstandeten Klausel 34 heißt es nun, dass die Auffor-derung „an die dem LG zuletzt bekannt gegebene Adresse zu übermitteln“ ist. Der OGH gelangt – zunächst ohne jegliche Begründung – zu dem Schluss: „Dies widerspricht § 6 Abs 1 Z 3 KSchG.“ Diese Feststellung überrascht einigerma-ßen, da die AGB-Klausel wortwörtlich die gesetzliche Bestimmung wiedergibt und
im Zeitpunkt ihres Zugangs zu prüfen. Die geforderte Unterlassungserklärung wurde bis zum Schluss der Verhandlung erster Instanz nicht abgegeben, sodass die Wiederholungsgefahr iSd § 28 Abs 2 KSchG zu bejahen ist. Da sich die unzu-lässige (zeitliche) Einschränkung auf die gesamte Unterlassungserklärung bezieht, braucht keine differenzierte Beurteilung der weiteren von der Beklagten formu-lierten Bedingungen und Zusätze zu den einzelnen Klauseln erfolgen.
Zur Klausel 34:Gegen die Entscheidung in diesem
Punkt wendet sich die Revision der Klägerin mit einem Abänderungsantrag. Die Beklagte beantragt, die Revision zu-rückzuweisen, hilfsweise ihr nicht Folge zu geben. Die Revision ist zulässig und berechtigt.
Die Klausel lautet:„34. Der LN ist damit einverstanden,
dass ihn der LG zur Vermeidung unnöti-ger Kosten im Falle der Nichtbezahlung fälliger Forderungen auffordert, ihm die Ermächtigung zur Einziehung bei der/den bezugauszahlenden Stelle(n) zu erteilen. Diese Aufforderung ist an die dem LG zuletzt bekannt gegebene Adresse zu über-mitteln und hat eine Rückäußerungsfrist von 14 Tagen sowie den Hinweis zu ent-halten, dass im Falle der Nichtäußerung die Ermächtigung als erteilt gilt.“
Dem Verbot der Gehaltsabtretung des § 12 Abs 1 KSchG unterliegt nach dem Willen des Gesetzgebers nur die Zession und nach berichtigender Auslegung durch die Rsp auch die Verpfändung mit bedin-gungsloser Ermächtigung durch außer-gerichtliche Verwertung (8 ObA 5/02x mwN, 4 Ob 215/97i [4], 9 ObA 361/93, RS0108387).
Durch die Klausel 34 wird keine Er-mächtigung zur Einziehung erteilt. Der LN erklärt sich nur damit einverstanden, dass man ihn im Fall der Nichtzahlung fälliger Forderungen auffordert, dem LG eine solche zu erteilen. Daraus, dass in der E 9 ObA 361/93 ausgesprochen wur-de, dass nach § 6 Abs 1 Z 2 KSchG auch Schweigen als Zustimmung zur Einzie-hung gelten könne, wenn der Verbraucher bei Beginn der Frist auf die Bedeutung seines Verhaltens besonders hingewiesen werde und zur Abgabe einer ausdrück-lichen Erklärung eine angemessene Frist zur Verfügung habe, ist für die Beklagte aber nichts gewonnen. Dies kann nur in Betracht kommen, wenn die Zustellung wirksam erfolgt. Nach der Klausel soll aber die Zustellung der Aufforderung an die dem LG zuletzt „bekannt gegebene“ Adresse des LN erfolgen. Dies wider-spricht § 6 Abs 1 Z 3 KSchG. Danach sind Vertragsbestimmungen nicht verbindlich, wenn eine für den Verbraucher rechtlich
bedeutsame Erklärung des Unterneh-mers, die ihm nicht zugegangen ist, als ihm zugegangen gilt, sofern es sich nicht um die Wirksamkeit einer an die zuletzt bekanntgegebene Anschrift des Verbrauchers gesendeten Erklärung für den Fall handelt, dass der Verbraucher dem Unternehmer eine Änderung seiner Anschrift nicht bekannt gegeben hat. Bei kundenfeindlichster Auslegung ist nach der Klausel die Zustellung an jede dem LG zuletzt bekannt gewordene Anschrift des LN zulässig, egal welche Person ihm diese Anschrift mitgeteilt hat. Dies ver-stößt gegen § 6 Abs 1 Z 3 KSchG, weil die Zugangsfiktion nur dann greift, wenn die Zustellung an die zuletzt vom Verbraucher bekannt gegebene Anschrift erfolgt, nicht aber an eine sonst wie bekannt gewordene Anschrift (7 Ob 173/10g, RS0106801, RS0106804). Erfolgt die Zustellung da-her an eine andere als vom Verbraucher zuletzt bekannt gegebene Adresse, greift die Zugangsfiktion nicht und es kann das Schweigen des LN nicht als Ermächti-gung gewertet werden. Da im Verbands-prozess die Auslegung von Klauseln im kundenfeindlichsten Sinn zu erfolgen hat (RS0016590) und im Gegensatz zur jeweiligen Vertragsauslegung im Indivi-dualprozess auf eine etwaige teilweise Zu-lässigkeit der beanstandeten Bedingung nicht Rücksicht genommen werden kann, also keine geltungserhaltende Reduktion stattfindet (RS0038205), ist die vorliegen-de Klausel unwirksam.
Zu Klausel 43:„Der LN erklärt sein Einverständ-
nis, dass der LG dem Mitschuldner des gegenständlichen Vertrags anlässlich seiner Vertragsunterzeichnung zu dem vorliegenden Leasingvertrag umfassende Auskunft über die finanzielle Situation des LNs, einschließlich der vom LG ein-geholten KSV und Handelsauskünfte zum Zwecke der Aufklärung des Mitschuldners gem § 25c KSchG erteilt.“
Die Revision des Klägers ist zulässig und berechtigt.
Der Text der Klausel ist so weit gefasst, dass iSd gebotenen kundenfeindlichsten Auslegung auch Daten umfasst sind, die dem Bankgeheimnis unterliegen („um-fassende Auskunft“). Wenn dies nicht der Fall wäre, würde die Beklagte kein Einverständnis des LN brauchen. Die Klausel erweckt den Eindruck, dass der LN der Bekanntgabe aller Umstände, die seine finanzielle Situation betreffen, zustimmt. Dies ist in der vorliegenden Form nicht zulässig:
Soweit nicht auf die Widerrufsmög-lichkeit hingewiesen wird, verstößt die Klausel gegen das Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG (RS0117271). Eine wirksame Zustimmung zur Verwendung nicht sensibler Daten liegt nur vor, wenn [4] ÖBA 1998, 222.

OGH 7 Ob 68/11t
ÖBA 4/12 251
Widerspruch kommen. Die Auslegung wäre auch tatsächlich unterschiedlich, wenn dem OGH darin zu folgen ist, dass die Klausel möglichst kundenfeindlich auszulegen ist; diese Interpretationsre-gel gilt für das Gesetz sicherlich nicht (siehe §§ 6 und 7 ABGB). Ich habe mich allerdings kürzlich (RdW 2011, 68 f; aA etwa Leitner, Das Transparenzgebot [2005] 125 f) bemüht darzulegen, dass bei der Inhaltskontrolle von AGB-Klauseln der Grundsatz der kundenfeindlichsten Auslegung selbst im Verbandsverfahren keine Geltung haben kann, und mangels abweichender Bestimmungen im KSchG die AGB-Klauseln – so wie für Einzelver-fahren allgemein anerkannt (Nachweise bei Rummel in Rummel, ABGB I³ [2000] § 864a Rz 13) – entsprechend den §§ 914 f ABGB zu interpretieren sind; diese Auffassung hat der OGH bedauer-licherweise nicht zur Kenntnis genom-men. Auch nach meiner Auffassung sind im Verbandsverfahren jedoch einige Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der Vertragsauslegung zu berücksichtigen: Da in diesem Verfahren nicht die zwischen zwei konkreten Partei-en getroffene Vereinbarung auszulegen ist, sondern die einseitig vom Unter-nehmer in AGB vorgesehenen Rege-lungen, scheidet eine Berücksichtigung des übereinstimmenden Parteiwillens aus. Es kommt daher keine subjektive Interpretation in Betracht, es ist viel-mehr das objektivierte Verständnis eines durchschnittlichen Kunden maßgebend. Meiner Ansicht nach gibt es keine An-haltspunkte dafür, dass sich noch weiter gehend im Bereich der Verwendung von AGB die objektive Beurteilung gerade an jenen Kunden zu orientieren hat, deren geistige Fähigkeiten sich am Rande der Geschäftsunfähigkeit bewegen (siehe H. Schmidt in Bamberger/Roth, BGB² § 305c Rz 38) und die einen geradezu masochistischen Hang aufweisen, alles möglichst in einem Sinne misszuverste-hen, der für sie besonders nachteilig ist, oder dass eine allein nach dem Wortlaut gerade noch mögliche abstruseste In-terpretation maßgebend sein soll. Auf diesen Horizont wäre jedoch letztlich abzustellen, wenn für die Inhaltskontrolle bei der Auslegung von AGB im Verbands-prozess tatsächlich die für den Kunden „ungünstigste mögliche Auslegung“ zu wählen wäre, da den Möglichkeiten der Auslegung kaum Grenzen gesetzt sind, wenn die im Gesetz vorgesehenen Maßstäbe nicht berücksichtigt werden, da Unverständnis und die Neigung, stets das Negativste anzunehmen, nahezu uferlos sind.
Es ist allerdings einzuräumen, dass selbst bei Ablehnung einer möglichst kundenfeindlichen Auslegung von AGB für die Interpretation von Gesetzen und
lediglich statt des Wortes „Anschrift“ den Ausdruck „Adresse“ verwendet – was wohl nicht als Widerspruch mit der ge-setzlichen Bestimmung gesehen werden kann, der zur Unwirksamkeit der Klausel führt. Das Geheimnis, worin der Wider-spruch der Klausel zum wortgleichen Gesetz zu finden ist, versucht der OGH nicht ganz erfolgreich in den folgenden Sätzen zu lüften.
Bei der im Verbandsprozess gefor-derten kundenfeindlichsten Auslegung, so meint der OGH, sei nach der Klausel die Zustellung an jede dem LG zuletzt bekannt gewordene Anschrift des LN zulässig. Dies verstoße gegen § 6 Abs 1 Z 3 KSchG, weil die Zugangsfiktion nur dann greife, wenn die Zustellung an die zuletzt vom Verbraucher bekannt gege-bene Anschrift erfolge, nicht aber an eine sonstwie bekannt gewordene Anschrift. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass der OGH damit in die Klausel etwas hineinliest, was bei der Neufassung der AGB-Banken ganz bewusst herausge-strichen wurde (siehe Iro in Iro/Koziol, Allgemeine Bedingungen für Bankge-schäfte [2001] Z 11 Rz 4) und es nicht ein-mal bei kundenfeindlichster Auslegung möglich wäre, die strittige Klausel dahin zu verstehen, dass die Zustellung an jede „sonst wie bekannt gewordene Anschrift“ genüge. In der Klausel wird nämlich von der „zuletzt bekannt gegebenen Adres-se“ gesprochen, so dass die durch den äußerst möglichen Wortsinn begrenzte Auslegung vom OGH unzulässigerweise überschritten wird, wenn auch jede auf andere Art, etwa durch eigene Nachfor-schungen, bekannt gewordene Anschrift darunter verstanden werden sollte. Selbst die kundenfeindlichste Auslegung hat sich jedoch in den Grenzen der über-haupt noch möglichen Auslegung zu bewegen und darf kein mit dem Wortlaut unvereinbares Verständnis unterschie-ben. Die kundenfeindlichste Auslegung könnte daher nur dahin gehen, dass es nach der Klausel gleichgültig sei, von wem dem Unternehmer die Anschrift mitgeteilt wurde; die Klausel somit keine Beschränkung auf die Mitteilung durch den Verbraucher selbst vorsehe. Das mag der OGH mit dem einmal angefügten Hinweis „egal welche Person ihm diese Anschrift mitgeteilt hat“ gemeint haben; bei leserfeindlichster Auslegung der Aus-führungen des OGH ist das allerdings nicht klar, da ja zweimal ganz allgemein, ohne irgendwelche Einschränkungen von jeder „sonst wie bekannt gewordenen Anschrift“ gesprochen wird.
Aber selbst wenn angenommen wird, dass der OGH nur Anstoß daran genom-men hat, dass keine klare Einschränkung auf die Bekanntgabe der Anschrift durch den Verbraucher erfolgte, also auch die Mitteilung beliebiger Dritter ausreichend
wäre, bleiben noch erhebliche Fragen unbeantwortet und gewichtige Bedenken gegen die Entscheidung bestehen. Zu-nächst: Kann wirklich von einem Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot oder ge-gen die guten Sitten im Sinne des § 879 ABGB – darauf verweist ja die Einleitung des § 6 Abs 1 KSchG – gesprochen wer-den, wenn Gesetz und Klausel denselben Wortlaut haben? Kann ein Gesetzesver-stoß tatsächlich allein deshalb angenom-men werden, weil die möglichst kunden-feindlich – also so nachteilig als gerade noch zulässig – ausgelegte Klausel etwas anderes besagt, als die nach den Regeln der §§ 6 und 7 ABGB möglichst sinnvoll verstandene Gesetzesbestimmung? Gilt überhaupt der Grundsatz der kunden-feindlichsten Auslegung ganz allgemein im Verbandsprozess, wenn es um das Verständnis einer AGB-Klausel geht, oder nicht doch nur im Zusammenhang mit der Prüfung der Intransparenz? Hat der OGH in Wahrheit die Klausel nicht wegen Verstoßes gegen § 6 Abs 1 Z 3 KSchG für unwirksam erklärt, sondern wegen Intransparenz? Fragen über Fragen, auf die hier noch keine ausgereiften Antwor-ten gegeben werden können, zu denen aber immerhin Überlegungen angestellt werden sollen.
Halten wir zunächst den OGH an sei-ner ausdrücklichen Aussage fest, dass die Klausel wegen Widerspruchs zu § 6 Abs 1 Z 3 KSchG, also auf Grund einer Inhalts-kontrolle, unwirksam ist. Es ist zumindest auf den ersten Blick im Ergebnis höchst befremdlich, wenn der OGH behauptet, dass die mit dem Gesetz völlig überein-stimmende Klausel diesem Gesetz wider-spreche und sie deshalb als sitten- oder gesetzwidrig qualifiziert. Woran sollte sich denn ein AGB-Verfasser halten, wenn nicht an das Gesetz? Es wird ja selbst das dispositive Recht als Maßstab für die in-haltliche Angemessenheit von Vertrags-bestimmungen angesehen; umso mehr muss es doch für die Rechtfertigung einer Klausel genügen, dass sie dem Wortlaut zwingenden Rechts entspricht. Ferner: Wäre bei der Beurteilung der Klausel als sittenwidrig nicht auch zu berücksichti-gen, dass die Klausel ausdrücklich das Ziel verfolgt, dem Kunden Kosten zu ersparen, also – zumindest auch – die Interessen des Verbrauchers fördert?
Der OGH beurteilt die Klausel aller-dings nicht einfach trotz ihrer Überein-stimmung mit dem Gesetz als unwirk-sam. Er meint vielmehr, dass sich trotz wörtlicher Übereinstimmung ein Wider-spruch der Klausel zum Gesetz auf Grund der kundenfeindlichsten Auslegung der Klausel ergebe. Diese Behauptung setzt zwingend die Auffassung des OGH vor-aus, dass die Klausel anders auszulegen ist als das Gesetz; sonst könnte es ja bei wörtlichem Gleichklang zu keinem

OGH 7 Ob 106/10d
252 ÖBA 4/12
wiederholen, grundsätzlich der Transpa-renzkontrolle entzogen sind (Schurr in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang³ § 6 Abs 3 KSchG Rz 39 mwN). Überdies kann meiner Ansicht nach (RdW 2011, 68 f) die Transparenzprüfung nur dann eingreifen, wenn die Auslegung nach § 914 ABGB zu keinem eindeutigen Ergebnis führte. Dann ist zur Bereinigung der Zweifel die Unklarheitenregel heranzuziehen und in sinngemäßer Anwendung des § 915 ABGB von einem kundenfeindlichen Ver-ständnis auszugehen, da dieses eher zur Unwirksamerklärung der Klausel führen kann und daher für den Unternehmer un-günstiger ist. Da im vorliegenden Fall mit Hilfe der Auslegung gemäß § 914 ABGB – wie oben gezeigt – ein eindeutiges Ergebnis erzielt werden kann, scheidet hier jedoch die Beurteilung der Klausel als intransparent aus.
Die mit dem Wortlaut des Gesetzes übereinstimmende Klausel ist daher im Gegensatz zur Ansicht des OGH als wirk-sam anzusehen. Die Entscheidung liefert meines Erachtens ein weiteres Beispiel dafür, dass der Verbraucherschutz zuneh-mend die Grenzen der sachgerechten, sinnvollen Fürsorge für Konsumenten überschreitet. Die Berücksichtigung der Grundgedanken und Ziele des Verbrau-cherschutzes, der berechtigten Interessen der Unternehmer, der durch übertriebe-nen Verbraucherschutz verursachten Kos-ten, die letztlich von den Konsumenten zu tragen sind, sowie der auf Bedenken gegen die Rechtsprechung hinweisenden Literatur könnte helfen, auf einen ausge-wogeneren Weg zurückzufinden.
Helmut Koziol, Wien/Graz
die Auslegung von rechtsgeschäftlichen Erklärungen unterschiedliche Regeln zur Anwendung gelangen, nämlich einerseits die §§ 6 und 7 ABGB, andererseits die §§ 914 und 915 ABGB, und daher grund-sätzlich die Möglichkeit unterschied-licher Auslegungsergebnisse besteht. Im Verbandsverfahren ist allerdings – wie schon erwähnt – zu berücksichtigen, dass eine subjektive Interpretation der AGB ausscheidet und daher eine objektive Betrachtungsweise vorzunehmen ist, so dass der Unterschied zur Gesetzes-auslegung sogar regelmäßig erheblich geringer ausfällt. Im vorliegenden Fall dürften sogar überhaupt keine unter-schiedlichen Ergebnisse erzielt werden: § 6 Abs 1 Z 3 KSchG soll nach seinem Sinn und Zweck dem Verbraucher we-gen dessen objektiven Fehlverhaltens oder zumindest eines Fehlers in dessen Sphäre das Risiko des Fehlschlagens des Zugangs einer Erklärung aufbürden; es wird daher ganz allgemein davon aus-gegangen, dass es sich bei der im Gesetz erwähnten „zuletzt bekanntgegebenen Anschrift des Verbrauchers“ – obwohl dies im Gesetz nicht ausdrücklich gesagt wird – selbstverständlich um die vom Verbraucher bekanntgegebene Anschrift handeln muss (vgl Kathrein in KBB³ § 6 KSchG Rz 8). An diesem objektiven Verständnis der Regelung ändert sich aber wohl nichts, wenn sie sich wörtlich gleichlautend in AGB findet: Für den Gleichlauf spricht schon deutlich, dass nach § 914 ABGB die Übung des red-lichen Verkehrs entscheidend ist und daher anzunehmen ist, dass im redlichen Verkehr sich die Parteien möglichst ge-setzeskonform verhalten wollen und dies vom Partner auch erwartet werden darf; das Bestreben, sich dem Gesetz gemäß zu verhalten, schließt selbstverständlich ein, dass das Gesetz entsprechend seiner allgemein anerkannten, in keiner Weise bestrittenen Auslegung zu verstehen ist. Es ist schließlich daran zu erinnern, dass der OGH selbst die Meinung vertrat, dass dann, wenn in AGB nähere Ausführungen über Anspruchsvoraussetzungen fehlen, „auch bei der im Verbandsprozess gebo-tenen, ungünstigsten objektiven Ausle-gung nicht unterstellt werden kann, dass die Klausel eine von den Regelungen des Zivilrechts abweichende“ Pflicht vorse-hen wollte (4 Ob 179/02f in SZ 2002/153 [S 401] = ÖBA 2003, 129). Ferner be-tont Apathy in Schwimann, ABGB³ § 6 KSchG Rz 88, dass zu berücksichtigen ist, ob die konkrete Klausel die ohnedies bestehende Rechtslage wiedergibt oder Abweichungen zum Nachteil des Ver-brauchers vom dispositiven oder gar vom zwingenden Recht vorsieht.
Dazu kommt noch, dass in den vom OGH zu beurteilenden AGB vermutlich eine Pflicht des Verbrauchers vorge-
sehen ist, den Unternehmer von einer Anschriftsänderung zu verständigen. Das wird zwar nicht ausdrücklich festgestellt, es ist jedoch davon auszugehen, weil die Zugangsfiktion nach hA – obwohl das Gesetz diese Voraussetzung nicht erwähnt – nur dann eingreift, wenn der Verbraucher verpflichtet war, Anschrifts-änderungen bekanntzugeben (Apathy in Schwimann, ABGB³ § 6 KSchG Rz 17; Krejci in Rummel, ABGB³ § 6 KSchG Rz 54 und 61). Wäre in den AGB keine derartige Verpflichtung vorgesehen gewesen, so hätte der OGH die Zugangsfiktionsklausel schon aus diesem Grund überhaupt nicht anwenden dürfen. Wenn nun die AGB – im Gegensatz zum Gesetz – ausdrücklich eine Pflicht des Verbrauchers zur Bekannt-gabe der Anschriftsänderung vorsehen, dann ist es sogar noch erheblich klarer als nach dem Gesetz, dass die AGB auf eine Bekanntgabe durch den Verbraucher abstellen, weil ja ein eindeutiger Sinnzu-sammenhang zwischen der in den AGB festgelegten Verpflichtung des Verbrau-chers zur Bekanntgabe der Anschriftsän-derung und dem Hinweis auf „die zuletzt bekanntgegebene Anschrift“ besteht. Kein redlicher Verkehrsteilnehmer könnte mE davon ausgehen, dass mit der vom OGH für unwirksam erachteten Klausel entgegen der einhellig angenommenen Bedeutung des Gesetzes die Mitteilung der letzten Anschrift durch jeden beliebi-gen Dritten die Zugangsfiktion auslösen könnte. Es ist daher zusammenfassend festzuhalten, dass kein Widerspruch der AGB-Klausel zur Bestimmung des § 6 Abs 1 Z 3 KSchG vorliegt, so dass dieser Grund für eine Unwirksamerklärung nicht gegeben ist.
Die insofern intransparente Argu-mentation des OGH könnte allerdings auch dahin verstanden werden, dass er die fehlende Aussage, von wem die letzte Anschrift bekanntgegeben wor-den sein muss, damit die Zugangsfiktion eingreift, rügt und daher die Klausel für undeutlich, also intransparent im Sinne des § 6 Abs 3 KSchG hält. Bei dieser Prüfung geht es nicht darum, dass der wahre Inhalt der Vereinbarung sittenwidrig ist, sondern darum, dass der Verbraucher über seine Rechte nicht mit ausreichender Klarheit informiert, seine Rechtslage somit verdunkelt wird. Das ist keine Frage der inhaltlichen Ange-messenheit des Vertrages, sondern jene der Geltungskontrolle (Krejci in Rum-mel, ABGB³ § 6 KSchG Rz 207; Leitner, Transparenzgebot 107): Es geht darum, ob die Klausel wegen ihrer Auslegungs-bedürftigkeit als intransparent und daher als unwirksam anzusehen ist. Einerseits wird jedoch die Meinung vertreten, dass rechtsdeklaratorische Klauseln, die kein Abweichen vom dispositiven Recht vor-sehen, sondern gerade den Gesetzestext
1798.§§ 1293 ff, 1298, 1304 ABGB; §§ 11, 13 WAG. Für die Bewertung einer Anleihe, bei der zwar das Kapital, aber kein Ertrag garantiert wird, ist es notwendig zu wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeiten sind, dass ein Ertrag erwirtschaftet bzw nur das Ka-pital ausgezahlt werden kann. Für die Anlageentscheidung ist daher wesent-lich, wie die Gelder investiert werden sollen und inwiefern der Anleger selbst mit dem eingesetzten Kapital für die Einhaltung der Kapitalgarantie aufzu-kommen hat.OGH 29. 9. 2010, 7 Ob 106/10d
Aus den Entscheidungsgründen:
Bis zum Tod des Ehemanns der Erst-klägerin und Vaters der Zweitklägerin und des Drittklägers im Jahr 1990 erfolgte die Vermögensveranlagung der Familie

OGH 7 Ob 106/10d
ÖBA 4/12 253
Der Ankauf der V-Anleihe erfolgte zum Nominalwert von € 100 je Anteil. Der Kurs der Anleihe je Anteil entwickel-te sich wie folgt: 2001: € 95,19; 2002: € 94,36; 2003: € 95,61; 2004: € 94,50; 2005: € 90,00; 2006: € 88,47. Eine Wei-terveräußerung vor Ende der Laufzeit konnte nur zum geltenden Kurs erfolgen.
Nachdem der Drittkläger von den Be-ratern der Beklagten keine weiteren Infor-mationen zur Entwicklung von V erhielt, wandte er sich im Jänner 2005 direkt an die „H Partners“. Ihm wurde mitgeteilt, dass der Investitionsgrad von V nunmehr 17% am Referenzportfolio erreiche (dh, dass der restliche Teil bereits konservativ veranlagt war, um den bis dahin erzielten Verlust auszugleichen) und nach Analysen zwischen August 2005 und Februar 2006 auf 0% zurückgehen werde.
Am 11.3.2005 lösten die Kläger ihre Geschäftsbeziehungen zur Beklagten. Am 5.5.2009 erhielten die Kläger im Hinblick auf die Kapitalgarantie das eingesetzte Kapital zurück.
Es kann nicht festgestellt werden, dass die Kläger bei anderer Beratung in Wohnbauanleihen investiert hätten. Bis-her veranlagten die Kläger ihr Vermögen hauptsächlich in Sparbüchern. Auch den Vermögenszuwachs aus dem Verkauf der „R-Anteile“ veranlagten sie auf einem Sparbuch.
Die Kläger begehren Zahlung und die Feststellung, dass die Beklagte den Klägern für sämtliche Schäden aus der Veranlagung in V hafte.
Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens.
Das Erstgericht sprach aus, dass das Zahlungsbegehren dem Grunde nach zu Recht bestehe und wies das Feststellungs-begehren ab.
Das Berufungsgericht gab der Beru-fung der Kläger nicht, hingegen der Be-rufung der Beklagten Folge und änderte das angefochtene Urteil in eine gänzliche Klagsabweisung ab.
Die Revision ist zulässig, sie ist auch (zum Teil iSd Aufhebungsantrags) be-rechtigt.
Unstrittig ist, dass die beklagte Bank als Finanzdienstleisterin den Wohlverhal-tensregeln der §§ 11 ff WAG iF vor dem BGBl [I] Nr 60/2007 [= WAG 2007] un-terliegt. § 13 Z 3 und 4 WAG aF schreibt die bisher schon von der Rsp und L zu Effektengeschäften insb aus culpa in con-trahendo, positiver Forderungsverletzung
„konservativ“ in Form von Sparbüchern. Es bestand eine langjährige Geschäftsbe-ziehung zur Beklagten. Danach übernahm der damalige „Direktor“ der Beklagten und Jugendfreund des Verstorbenen, G S, die Beratung der Kläger hinsichtlich der Vermögensveranlagung, soweit sie über die Beklagte erfolgte. Das Familienver-mögen wurde auch dann nur „konservativ und risikoscheu“ veranlagt.
Im Jahr 1997 bot G S den Klägern den Ankauf von Anteilen des V-Investment-fonds (in der Folge V) an. Die Kläger hatten keinerlei Erfahrung mit Wertpa-pieren. Dennoch folgten sie dem Rat des langjährigen Freundes der Familie G S, ohne dass Beratungsgespräche über diese Veranlagungsform geführt wurden. Diese Investitionen erwiesen sich in der Folge für die Kläger als gewinnbringend.
Infolge Kursverfalls des V riet G S dem Drittkläger, die von den Klägern gehalte-nen V-Anteile zu verkaufen und den Erlös in die durch die B-Bank AG (in der Folge H) neu aufgelegte V-Garantieanleihe (in der Folge V) [1] zu investieren. Eine weitere mögliche Veranlagungsform bot er nicht an. Bei einem Treffen händigte G S dem Drittkläger ein „Term Sheet“ und ein mit „Risikohinweise“ überschriebenes Blatt aus.
V war eine von der B-Bank AG ausge-gebene und auf Euro lautende Nullkupon-anleihe (Zero-Bond) mit einer Laufzeit von März 2001 bis April 2009, die eine Kapitalgarantie enthielt. Die Performance war an einen Dachhedgefonds der S-Funds, den V-Funds gekoppelt. Die Notes (Anteilsscheine) sind Inhaberschuldver-schreibungen, die zum Nennwert ausge-geben und durch eine auf Inhaber lautende Dauersammelurkunde ohne Zinskoupon verbrieft und bei einer Gesellschaft in Luxemburg hinterlegt wurden. Während der Laufzeit sollten die Erträge an-gesammelt werden. Am Fälligkeitstag, dem 30.4.2009, standen den Anteilsin-habern anteilsmäßig diejenigen Beträge zu, die einem anteiligen Investment in den Dachhedgefonds entsprachen. Die Struktur von V war hoch komplex, wenig transparent und in verschiedene Struk-turstufen gegliedert [2]. V war über zwei weitere unverzinste Anleihen in einem ausländischen Investmentfonds investiert, der nicht nach österreichischem Recht errichtet war.
Das der Anleihe zugrundeliegende Portfolio bestand aus einer Reihe von Hedgefonds, die jeweils unterschiedliche Investmentziele verfolgten. V enthielt
also spekulative Anteile, mit denen ein Ertrag erzielt werden sollte. Im Hinblick auf die Kapitalgarantie wurde aber so vorgegangen, dass nicht das gesamte Kapital in risikobehaftete Anteile inves-tiert wurde, sondern auch ein risikoloses Portfolio bestand. Die Aufteilung zwi-schen risikobehaftetem und risikolosem Portfolio erfolgte aufgrund der Perfor-mance der risikobehafteten Anteile. Wenn diese schlecht war, wurde ein Teil der risikobehafteten Anlage liquidiert und in eine sichere Anlage investiert. Die Ka-pitalgarantie wurde demnach durch die Verzinsung der risikolosen Komponenten vom Fonds und damit von den Investoren selbst „erarbeitet“.
Die V fällt nicht unter die traditio-nellen Anlageformen mit sehr gerin-gem Wertschwankungsrisiko. Für einen Wertpapierfachmann war aufgrund der Struktur von V und der Kenntnis der Zu-sammensetzung des Portfolios erkennbar, dass bei Fehlschlagen des spekulativen Anteils keine Wertsteigerung erzielbar sein werde. Weiters war aus den Anlei-hebedingungen der Aufbau der V nur mit erheblichem Zeitaufwand ableitbar. Ein direkter Rückschluss, dass in Hedgefonds veranlagt wurde, war nicht möglich.
Der Drittkläger vertraute der Beratung durch G S und unterschrieb die Urkunden „Term Sheet“ und „Risikohinweise“. Die Kläger beschlossen gemeinsam, auf V umzusteigen und gaben hinsichtlich V einen Verkaufsauftrag und hinsichtlich V Kaufaufträge [3], wobei der Drittkläger den Kaufantrag für sich selbst und für die im Ausland befindliche Zweitklägerin unterschrieb. Direkte Gespräche zwischen G S und Erst- und Zweitklägerin fanden nicht statt.
Die Beklagte hatte zu diesem Zeit-punkt hinsichtlich der Kläger keine Kun-denprofile angefertigt. Es ergab sich aber aus bankinternen Aufzeichnungen, dass die Kläger als „eher konservativ und werterhaltend“ eingestuft wurden. Im März 2001 investierten die Kläger in V: die Erstklägerin € 2.229.000, die Zweit-klägerin € 283.000 und der Drittkläger € 282.000.
Ende des Jahres 2004 begann sich der Drittkläger, der mittlerweile Anwalt geworden war, mit der Problematik von Investmentfonds auseinanderzusetzen. Ihm wurde im Jahr 2005 bekannt, dass V in Hedgefonds investiert war. Die Mit-arbeiterin der Beklagten teilte ihm auf seine Fragen hin mit, dass man noch auf „Besserung“ hoffen könnte.
[1] Bei der Anonymisierung der E gemäß § 15 Abs 4 OGH-G ging die Unterscheidung zwischen dem „V*****-Investmentfonds (in der Folge V*****)“ und der „V*****-Garan-tieanleihe (in der Folge V*****)“ verloren.
[2] Im Original findet sich hier eine Skiz-ze von der Struktur des Produkts, Anm der Redaktion.
[3] Sic. Gemeint ist vermutlich: „Die Klä-ger beschlossen gemeinsam, auf [die V-Garan-
tieanleihe] umzusteigen und gaben hinsichtlich des [V-Investmentfonds] einen Verkaufsauftrag und hinsichtlich der [V-Garantieanleihe] Kauf-aufträge.“

OGH 7 Ob 106/10d
254 ÖBA 4/12
übergebenen Gelder investiert werden sollen und inwiefern der Anleger selbst mit dem eingesetzten Kapital für die Einhaltung der Kapitalgarantie aufzu-kommen hat. Diese Parameter haben hier insb zur Folge, dass – schon aufgrund der Konstruktion von V absehbar – einmal eingetretene Verluste auf dem spekula-tiven Sektor auch über die Jahre kaum durch allfällig erfolgreiche Spekulationen ausgeglichen werden können, weil die Anlagestrategie dann nur mehr auf das Erwirtschaften der Kapitalgarantie am Ende der Laufzeit gerichtet ist. MaW bedarf ein Anleger selbst bei Kenntnis von der Kapitalgarantie und vom Risiko, keinen Ertrag am Ende der Laufzeit zu bekommen, der Aufklärung über gewis-se, für ihn verständliche Parameter, nach denen er die Chance, dass ein Ertrag er-wirtschaftet werden oder entfallen wird, selbst einschätzen kann.
Diese Information fehlt hier zur Gänze. Die Kläger haben sich zwar nicht auf ein das Kapital gefährdendes, aber auf ein den Ertrag betreffend spekulatives Anlage-geschäft eingelassen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie damit keinerlei Aufklä-rung für die Beurteilung einer allfälligen Ertragschance bedürfen. Erträge hängen nicht nur von der Marktlage, sondern auch – wie oben dargelegt – davon ab, welches Konzept hinter der Veranlagung steht. Außerdem ist bei dieser Anlageentschei-dung auch zu berücksichtigen, dass das Kapital acht Jahre lang gebunden bleiben muss, weil ansonsten die Kapitalgarantie nicht zum Tragen kommt. Dadurch ist bei erkennbarer Ertraglosigkeit und Kursver-fall der Notes keine Ausstiegsmöglichkeit des Anlegers gegeben, will er nicht die Kapitalgarantie verlieren und dadurch einen Verlust am Kapital erleiden.
Damit, dass sich die Mitarbeiter der Beklagten mit der Ausfolgung der Urkun-den „Term Sheet“ und „Risikohinweise“ begnügten, kamen sie demnach ihrer Aufklärungsverpflichtung nicht nach; den Klägern kamen nicht die Informationen zu, die es ihnen ermöglicht hätten, für das konkrete Anlageprodukt die Risken und Chancen hinsichtlich eines Ertrags einzuschätzen und entsprechend ihre An-lageentscheidung zu treffen.
Eine Verletzung der Aufklärungs-pflicht würde auch dann zu bejahen sein, wenn statt der (einleitend nicht wieder-gegebenen) Feststellung, G S habe den Klägern keine genauen Erläuterungen über die Funktionsweise von V gegeben, die von der Beklagten gewünschte Fest-stellung getroffen worden wäre, G S habe den Drittkläger darüber aufgeklärt, dass eine Kapitalgarantie existiere, aber die Gefahr bestehe, dass unter Umständen keine Zinsen anfielen. Auch diese Infor-mation wäre rudimentär und würde – wie oben dargelegt – nicht ausreichen. Dazu
und dem Beratungsvertrag abgeleiteten Aufklärungspflichten und Beratungs-pflichten fest. Die konkrete Ausgestaltung und der Umfang der Beratung ergeben sich jeweils im Einzelfall in Abhängigkeit vom Kunden, insb aus dessen Professi-onalität, sowie vom ins Auge gefassten Anlageobjekt (RS0119752). Der Kunde ist über die Risikoträchtigkeit der in Aus-sicht genommenen Anlage aufzuklären. Die Haftung besteht bei fehlerhafter Be-ratung selbst dann, wenn der Mitarbeiter der Bank von der Seriosität des Anlage-geschäfts überzeugt gewesen sein sollte (vgl RS0108074). Zumindest dann, wenn die Risikoträchtigkeit einer Kapitalanlage auf der Hand liegt, ist der Anlagevermitt-ler verpflichtet, richtig und vollständig über diejenigen tatsächlichen Umstände zu informieren, die für den Anlageent-schluss des Interessenten von besonderer Bedeutung sind. Verfügt der Anlagever-mittler nicht über objektive Daten und entsprechende Informationen, sondern nur über unzureichende Kenntnisse, muss er dies dem Anlageinteressenten offen le-gen (RS0108073). Ein Finanzdienstleister hat mit der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit die Inter-essen seines Kunden zu wahren und dem Kunden alle zweckdienlichen Informa- tionen mitzuteilen, soweit dies im Hin-blick auf die Art und den Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. Eine Bank ist jedoch nicht verpflichtet, einen spekulierenden Kunden zu be-vormunden (RS0123043). Die Informa- tionserteilung hat dem Gebot vollständi-ger, richtiger und rechtzeitiger Beratung zu genügen, durch die der Kunde in den Stand versetzt werden muss, die Auswir-kungen seiner Anlageentscheidung zu erkennen. Sie hat aber auch in einer für den Kunden verständlichen Form zu erfolgen, wobei auf dessen persönliche Kenntnisse und Erfahrungen Rücksicht zu nehmen und bei der Verwendung von Fachausdrücken Vorsicht geboten ist (RS0123046).
Für den vorliegenden Fall bedeutet dies Folgendes:
Ob der Drittkläger das „Term Sheet“ und das Blatt „Risikohinweise“ gelesen oder ungelesen unterschrieben hat, ist schon deshalb unerheblich, weil sich an der Rechtslage selbst für den Fall, dass er die Urkunden gelesen hätte, nichts ändern würde.
Nach den diesbezüglich unbestritte-nen Feststellungen beschränkten sich die Aufklärungen durch G S über die V auf den Inhalt dieser beiden Urkunden. Aus den Urkunden, insb aus dem „Term Sheet“, ergibt sich einerseits, dass sich V an institutionelle Anleger richtet und andererseits, dass diese Unterlagen nur eine „unverbindliche Vorab-Information“ sind und der Kauf der Anleihe nur nach
ausführlicher Beratung und Kenntnis-nahme der produktbezogenen Verkaufs-unterlagen und Risikohinweise möglich ist. Damit ist klargestellt, dass sich die von der Emittentin selbst aufgetragene Aufklärung des Interessenten nicht auf die beiden Kurzinformationen beschränken durfte, diese sohin den Informations-bedarf nicht befriedigen konnten. Das wird auch dadurch bestätigt, dass der (allerdings nur in englischer Sprache) aufliegende Prospekt zu V 332 Seiten umfasst und daraus in den vom Drittklä-ger unterschriebenen Urkunden keine Erläuterungen gegeben wurden.
Bereits nach den beiden Urkunden ist klar, dass die Kurzinformation, es werde ein nachhaltig stetiger Ertrag von 10% bis 12% pa angestrebt, es bestehe eine Kapitalgarantie, aber die Anleihe könne auch bis zur Tilgung ertraglos bleiben, keine ausreichende Aufklärung für eine Investitionsentscheidung des Kunden ist. Weitere Informationen wurden aber un-strittig nicht gegeben.
Vielmehr steht fest, dass die hinter der V-Anleihe stehende Konstruktion samt Unterbeteiligungen hoch komplex und auch für einen Fachmann nicht ohne weiteres durchschau- und erkennbar sind. Aus den von den Mitarbeitern der Beklagten gegebenen Informationen ist weder die Involvierung von Hedgefonds (was ein allgemein bekanntes besonde-res spekulatives Element in sich birgt) ersichtlich, noch der Umstand, dass nicht während der gesamten Laufzeit mit dem gesamten eingesetzten Kapital versucht wird, Zinserträge zu erwirtschaften, was aber durch das angestrebte Ziel von 10% bis 12% pa nahegelegt wird. Es wird den Interessenten nicht klar und deutlich offengelegt, dass die Kapitalgarantie am Ende der Laufzeit vom Geld der Anleger selbst „erarbeitet“ werden muss, indem vom spekulativen und damit potentiell ge-winnbringenden Anteil der Investitionen in dem Maße Gelder in sichere Anlagen abgezogen werden, als dies zur Sicherung der Kapitalgarantie notwendig ist.
Damit liegt auf der Hand, dass die Chance auf einen Ertrag (in welcher Höhe immer) stark eingeschränkt ist. Auch wenn kein konkreter Ertrag zugesagt wurde, wird doch auf das Ziel von 10% bis 12% pa hingewiesen. Um beurteilen zu können, ob man sich auf eine Anla-geform einlassen soll, bei der zwar die Rückzahlung des Kapitals garantiert ist, nicht jedoch ein Ertrag, ist es notwendig zu wissen, wie groß die Wahrscheinlich-keit ist, dass während der Laufzeit (hier rund acht Jahre) ein Ertrag erwirtschaftet werden kann und wie groß die Chance ist zu riskieren, am Ende nur das Kapital zu erhalten.
Es ist daher für die Anlageentschei-dung die Kenntnis wesentlich, wie die

OGH 3 Ob 181/11f
ÖBA 4/12 255
da bereits alle Kriterien bekannt sind, um den Vertrauensschaden (RS0108267) zu ermitteln. Das Berufungsgericht wird sich daher bei neuerlicher Entscheidung über das Feststellungsbegehren mit der Beweisrüge auseinanderzusetzen haben. Es ist abzuklären, in welche Anlageform die Kläger investiert hätten, hätten sie nicht V erworben.
kommt, dass G S bekannt war, dass die Kläger keine besonderen Kenntnisse oder Erfahrungen mit derartigen Anlageformen hatten. Auch wenn die Kläger zweifellos über bedeutende Geldbeträge verfügten, die sie veranlagen wollten, so sind sie al-lein deshalb noch keine „institutionellen“ Anleger, die die Emittentin als Anleger im Auge hatte.
Die Beklagte haftet aufgrund des hier dargelegten Sachverhalts für die schuld-hafte (§ 1298 ABGB) Verletzung ihrer Aufklärungspflichten.
Für die Frage des Beginns der Verjäh-rungsfrist der geltend gemachten Scha-denersatzansprüche ist die von der Be-klagten begehrte Feststellung, dass eine Mitarbeiterin der Beklagten den Klägern schon in den Jahren 2002 und 2003 wegen Kursverlusts von V einen Wechsel der Veranlagung vorgeschlagen hätte, den diese ablehnten, ebenfalls unerheblich. Es wird nämlich nicht ein im Kursverlust liegender Schaden begehrt (es bestand ohnehin eine Kapitalgarantie), sondern der Vertrauensschaden, der darin liegt, dass die Kläger nicht in eine „sichere“ Anlageform investiert haben, bei der sie einen Ertrag erwirtschaftet hätten. Der Beginn der Verjährungsfrist hängt davon ab, wann den Klägern bekannt wurde oder bekannt sein musste, dass ihre Erwartun-gen hinsichtlich der Rahmenbedingungen für eine allfällige Ertragschance wegen der fehlerhaften Beratung nicht zutreffend waren. Dies war nach den insoweit unbe-kämpften Feststellungen im Jänner 2005 der Fall. Erst damals wurden den Klägern die Hedgefondsbeteiligungen und der Umstand bekannt, dass im Hinblick auf die selbst zu „erarbeitende“ Kapitalgaran-tie in immer größer werdendem Ausmaß sichere Veranlagungen vorgenommen wurden und daher mit keinem Ertrag bei Laufzeitende zu rechnen war. Erst damit waren der Schaden und der Schädiger bekannt. Die Klage wurde im Jahr 2006 eingebracht. Die Ansprüche sind daher nicht verjährt.
Ohne rechtliche Bedeutung ist die begehrte Feststellung auch für die Frage nach dem von der Beklagten eingewand-ten Mitverschulden der Kläger, das darin gelegen sein soll, dass die Kläger nicht vor Ende der Laufzeit die V verkauft haben. Die Beklagte übergeht nämlich, dass die Kläger bei einem Verkauf von V vor Ende der Laufzeit die Kapitalgarantie verloren hätten und daher ein zusätzlicher Schaden infolge Kursverlusts eingetreten wäre, dessen Ausgleich durch andere,
sichere Investitionen in nur relativ kurzer Zeit nicht absehbar war. Im Übrigen steht – von der Beklagten unbekämpft – fest, dass bei dem Gespräch im Jahr 2005 die Mitarbeiterin der Beklagten darauf hingewiesen hatte, dass man noch auf „Besserung“ hoffen könne. Damit war offenbar nicht einmal für die Mitarbeiter der Beklagten eindeutig, dass ein Verkauf der V die beste Vorgangsweise wäre. Es kann daher den Klägern schon deshalb nicht vorgeworfen werden, sie hätten eine Obliegenheit verletzt, weil sie die V-Notes im Hinblick auf die Kapitalgarantie nicht vorzeitig verkauft haben. Der von der Beklagten erhobene Mitverschuldensein-wand ist unberechtigt.
Den Beklagten trifft die Behaup-tungs- und Beweislast für ein allfälliges Mitverschulden des Klägers. Hat der Beklagte keinen Mitverschuldensein-wand erhoben, so steht ein allfälliges Mitverschulden des Klägers nicht zur Debatte (RS0022560). Für die Prüfung eines allfälligen Mitverschuldens des Klägers sind allein die vom Schädiger vorgebrachten Tatsachen maßgeblich (5 Ob 519/92 mwN). Der Einwand des Mitverschuldens muss nicht ausdrücklich erhoben werden, es genügt, wenn sich aus dem Vorbringen des Schädigers eine entsprechende Behauptung entnehmen lässt (1 Ob 214/98x, 10 Ob 170/00y; RS0022560 [T14 und T19]). Die bloße Behauptung der Haftungsfreiheit – insb die Bestreitung des eigenen Verschuldens – ist kein ausreichender Mitverschuldens-einwand (RS0027103 [T3], RS0111235 [T3]; RS0022560 [T10]). Die Prüfung des Mitverschuldens hat sich auf jene tatsächlichen Umstände zu beschränken, die vom Schädiger eingewendet wurden. Da die Beklagte im erstinstanzlichen Verfahren ihren Mitverschuldenseinwand nicht darauf stützte, dass die Kläger dem Anlageberater „nahezu blind“ vertraut hätten (8 Ob 259/98s [4]; 5 Ob 106/05g [5]; 9 Ob 128/06y), widerspricht ihr dies-bezügliches Vorbringen in der Berufung dem im Rechtsmittelverfahren geltenden Neuerungsverbot (§ 482 ZPO), weshalb auf diese Frage nicht weiter einzugehen ist.
Es ist daher das Zwischenurteil des Erstgerichts wiederherzustellen.
Für die Berechtigung des Feststel-lungsbegehrens ist allerdings die von den Klägern bekämpfte, bei der einlei-tenden Darstellung des Sachverhalts kur-siv wiedergegebene Negativfeststellung relevant, nämlich dass nicht fest stehe, dass die Kläger bei korrekter Beratung in Wohnbauanleihen investiert hätten. Diese Feststellung ist notwendig, um beurteilen zu können, ob den Klägern ein Feststel-lungsinteresse zuzubilligen ist. Sollte es bei der bisherigen Feststellung bleiben, wäre ein solches Interesse zu verneinen,
[4] ÖBA 1999, 833.[5] ÖBA 2006, 376.
1799.§ 364c ABGB; § 97 GBG; §§ 27, 28 IO. Sowohl Verpflichtungs- als auch Ver-fügungsgeschäfte können angefochten werden. Liegen die Voraussetzungen für eine Anfechtung des Verpflich-tungsgeschäfts nicht vor, sind sie aber beim Verfügungsgeschäft gegeben, so steht einer Anfechtung nichts im Wege.Bei der Einverleibung eines Belastungs- und Veräußerungsverbots ist die An-tragstellung beim Grundbuchsgericht eine anfechtbare Rechtshandlung des Schuldners. Anderes gilt nur, wenn nach Abgabe der Aufsandungser-klärung durch den Schuldner nur der Gläubiger den Antrag auf Einverleibung stellt.Einzelne Teile eines Vertrags können grundsätzlich nicht angefochten wer-den, wenn ein einheitlicher Vertrags-zweck verfolgt wurde und/oder dieser Teil in unlösbarem Zusammenhang mit anderen Vertragsteilen steht. Ent-scheidend ist, ob sich die Anfechtung gegen einheitliche Wirkungen einer Rechtshandlung richtet (in diesem Fall kommt nur eine einheitliche An-fechtung in Betracht) oder ob sich die gläubigerbenachteiligenden Folgen einer Rechtshandlung in einzelne, von-einander unabhängige, selbständige Teile zerlegen lassen; dann ist eine „echte“ Teilanfechtung zulässig. Bei der Abgrenzung ist insb der Parteiwille zu berücksichtigen.OGH 8. 11. 2011, 3 Ob 181/11f
Aus den Entscheidungsgründen:
Mit von einem Rechtsanwalt verfass-ten, notariell beglaubigten Kaufvertrag vom 5.10.2007 verkaufte der Beklagte seine lastenfreie Liegenschaft um insges € 95.000 an seinen Sohn Franz, den späte-ren Gemeinschuldner (im Folgenden kurz „Gemeinschuldner“, auch betreffend die Zeit vor Konkurseröffnung). Der Beklagte bestätigte, bereits vor Unterfertigung des Vertrags € 45.000 vom Käufer erhalten zu haben, der restliche Kaufpreis von € 50.000 war binnen 14 Tagen zu zahlen.
Im Vertragspunkt VII. mit der Über-schrift „Belastungs- und Veräußerungs-verbot“ räumte der Sohn seinem Vater ein Belastungs- und Veräußerungsverbot

OGH 3 Ob 181/11f
256 ÖBA 4/12
3.1. IdS geht auch die ganz hA in Deutschland davon aus, dass grundsätz-lich nur das gesamte Rechtsgeschäft, nicht nur eine einzelne Vertragsbestimmung angefochten werden kann (anstatt vieler BGH IX ZB 39/05, ZInsO 2008, 558 [Rz 16]; Kirchhof in MünchKommInsO2 § 143 Rz 17 mwN). Eine (echte) Teilan-fechtung wird nur für zulässig erachtet, wenn sich das Rechtsgeschäft bzw die Rechtshandlung in einzelne, voneinander unabhängige selbständige Teile zerlegen lässt, von denen möglicherweise nur ein-zelne die Gläubiger benachteiligen (Hirte in Uhlenbruck, InsO13 § 129 Rz 72 mwN). Bei der Beurteilung der Zerlegbarkeit wird dem subjektiven Willen der Partei-en maßgebliche Bedeutung zugemessen (Henckel in Jaeger, InsO § 129 Rz 247; Huber in Gottwald, Insolvenzrechtshand-buch4 § 46 Rz 41; Obermüller, Insol-venzrecht in der Bankpraxis8 Rz 5.273). Teilbarkeit wird auch dann angenommen, wenn einem Beteiligten eines umfassen-den Vertrags gerade für den Fall seiner Insolvenz Vermögensnachteile auferlegt werden, die über die gesetzlichen Folgen hinausgehen und nicht zur Erreichung des Vertragszwecks geboten sind (BGH IX ZR 257/92, ZIP 1994, 40; IX ZB 39/05, ZInsO 2008, 558 [Rz 16]).
3.2. Auch die österreichische Rsp hat es in Bezug auf die Möglichkeit einer Teilan-fechtung als entscheidend angesehen, ob sich die Anfechtung gegen einheitliche Wirkungen einer Rechtshandlung richtet (in diesem Fall kommt nur eine einheit-liche Anfechtung in Betracht) oder ob sich die gläubigerbenachteiligenden Folgen einer Rechtshandlung in einzelne, von-einander unabhängige, selbständige Teile zerlegen lassen; dann ist eine („echte“) Teilanfechtung zulässig (3 Ob 55/10z = RS0123338 [T2]; Rebernig in Konecny/Schubert § 27 KO Rz 67). Auch die öster-reichische Rsp betont den Willen der Vertragsparteien: Soll bspw mit einem Vertrag nach dem Willen der Vertrags-schließenden ein einheitlicher Vertrags-zweck erreicht werden oder bilden die mehreren Teile eines Rechtsgeschäfts eine sachliche Einheit, kommt eine Teilanfech-tung nicht in Betracht (10 Ob 104/07b: keine Anfechtbarkeit eines Kaufvertrags, mit dem mehrere Liegenschaften um einen Pauschalpreis veräußert wurden, hinsichtlich einer dieser Liegenschaf-ten; zur Anfechtung eines Vertrags als Gesamtheit wegen Willensmängeln s etwa 4 Ob 508/90; RS0014822). Bei synallagmatischen Verträgen bilden die
gemäß § 364c ABGB ein. Im Vertrags-punkt VIII. mit der Überschrift „Aufsan-dungserklärung“ erteilten die Vertragspar-teien ihre unbedingte und unwiderrufliche Einwilligung, dass ob der Liegenschaft das Eigentumsrecht für den Sohn und das Belastungs- und Veräußerungsver-bot zugunsten des Vaters einverleibt werden kann (ein expliziter Hinweis auf die gleichzeitige Einverleibung ist nicht enthalten). Im Vertragspunkt XI. mit der Überschrift „Bevollmächtigung, Auftrag“ bevollmächtigten die Vertragsparteien den Schriftenverfasser unwiderruflich, alle notwendigen Erklärungen zur grund-bücherlichen Durchführung des Vertrags vorzunehmen.
Am 11.10.2007 beantragte der Schrif-tenverfasser im Namen des Sohnes beim Grundbuchgericht die Einverleibung des Eigentumsrechts für den Sohn und die Einverleibung des Belastungs- und Ver-äußerungsverbots für den Vater; diese Einverleibungen wurden antragsgemäß vorgenommen.
Mit Beschluss des LG L vom 9.10.2009 wurde über das Vermögen des Sohnes der Konkurs eröffnet und der Kläger zum Masseverwalter bestellt.
Der Verkehrswert der Liegenschaft zum Zeitpunkt des Kaufvertragsab-schlusses steht mit € 227.000 außer Streit.
Der klagende Insolvenzverwalter begehrte die Unwirksamerklärung der Einverleibung des Belastungs- und Ver-äußerungsverbots. Das sachenrechtliche Verfügungsgeschäft, nämlich die Ein-bringung des Grundbuchgesuchs durch den beauftragten Rechtsanwalt, sei eine Rechtshandlung, die vom Gemeinschuld-ner innerhalb der letzten zwei Jahre vor Konkurseröffnung vorgenommen worden sei und daher wegen Benachteiligungsab-sicht nach § 28 Z 3 KO angefochten wer-de. Außerdem habe der Gemeinschuldner eine Erfüllungshandlung, nämlich die vollständige Kaufpreiszahlung erst inner-halb der Zweijahresfrist vorgenommen, weshalb hilfsweise auch die Kaufpreis-teilzahlung von € 50.000 angefochten werde.
Der Beklagte wandte ein, dass auf-grund der grundbücherlichen Verpflich-tungen im Kaufvertrag keine gesonderte Anfechtung des Verfügungsgeschäfts konstruiert werden könne.
Das Erstgericht gab dem Hauptbegeh-ren statt. Die Einräumung des Belastungs- und Veräußerungsverbots sei für die Gläu-biger sicherlich benachteiligend gewesen; sie sei auch innerhalb der kritischen Frist des § 28 Z 3 KO gesetzt worden.
Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil im klageabweisenden Sinn ab. In synallagmatischen Verträgen wür-den die gegenseitigen Verpflichtungen eine untrennbare Einheit bilden, deren
Schicksal stets verknüpft sei, weshalb Gegenstand der Anfechtung immer nur der gesamte Vertrag sein könne. Im vorliegenden Fall würden sowohl die Verpflichtungen im Kaufvertrag als auch die im Grundbuchgesuch beantragten Einverleibungen jeweils eine untrennbare Einheit bilden, sodass die Einverleibung des Belastungs- und Veräußerungsverbots ohne gleichzeitige Anfechtung auch der Eigentumseinverleibung nicht angefoch-ten werden könne. Aufgrund des außer Streit gestellten Werts der Liegenschaft und des geringeren Kaufpreises liege es nahe, dass die Rechtseinräumung eine Gegenleistung des Gemeinschuldners gewesen sei.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Revision des klagenden Insolvenz-verwalters. Sie ist zulässig; jedoch nicht berechtigt.1. Nach ganz hA kann sowohl ein Ver-pflichtungsgeschäft als auch ein Ver-fügungsgeschäft angefochten werden. Liegen die Voraussetzungen für eine Anfechtung des Verpflichtungsgeschäfts nicht vor, etwa weil die Anfechtungs-frist schon abgelaufen ist, sind aber die Voraussetzungen für eine Anfechtung des Verfügungsgeschäfts gegeben, steht einer Anfechtung nichts im Wege (RS0050710, RS0050774; König, Die Anfechtung nach der Konkursordnung4 Rz 3/4; Rebernig in Konecny/Schubert § 28 KO Rz 5).2. Auch in Bezug auf die Einverleibung eines Belastungs- und Veräußerungsver-bots im Grundbuch hat die Rsp in der An-tragstellung beim Grundbuchgericht eine anfechtbare Rechtshandlung des Schuld-ners gesehen (2 Ob 53/07v = JBl 2008, 531 [König] [1]); dass die gleichzeitige Antragstellung des Vertragspartners die Einverleibung ebenfalls bewirkt hatte, könne daran nichts ändern. Anderes gelte nur, wenn nach Abgabe der Aufsandungs-erklärung durch den Schuldner (nur) der Gläubiger einen Antrag auf entsprechende Grundbuchseintragung stelle: Dann liege weder in diesem Grundbuchantrag noch im Beschluss des Grundbuchgerichts eine Rechtshandlung des Schuldners (2 Ob 53/07v; idS auch König, Anfech-tung4 Rz 7/5; vgl auch 3 Ob 16/08m zur Schenkung [2]).3. Betreffend Verpflichtungsgeschäfte geht die Rsp davon aus, dass einzelne Tei-le eines Vertrags grundsätzlich nicht an-gefochten werden, wenn ein einheitlicher Vertragszweck verfolgt wurde und/oder dieser Teil in unlösbarem Zusammenhang mit anderen Vertragsteilen steht (vgl – iZm einem Mietvertrag – 7 Ob 225/98h = AnwBl 1999, 254 [zust H. Auer] [3] sowie – jeweils iZm einem Kaufvertrag – 10 Ob 104/07b [4] und 3 Ob 55/10z; RS0123338; König, Anfechtung4 Rz 3/4a mit abl Stellungnahme zur „Vertragsan-passung via Anfechtungsrecht“).
[1] ÖBA 2008, 736.[2] ÖBA 2008, 884.[3] ÖBA 1999, 919.[4] ÖBA 2008, 812.

OGH 4 Ob 53/11i
ÖBA 4/12 257
Verpflichteten einen Freihandverkauf zu ermöglichen. Die Beurteilung, ob dem Gläubiger für die Kosten des von ihm zur Bewerbung der Liegenschaft beigezogenen Immobilienbüros (kre-dit-)vertraglich bedungener Aufwan-dersatz gebührt, kann sich an den Grundsätzen zu § 1014 ABGB orientie-ren. Bei der Beurteilung, ob der getä-tigte Aufwand notwendig oder nützlich war, ist daher auf den Zeitpunkt der Aufwendung abzustellen.OGH 12. 4. 2011, 4 Ob 53/11i
Aus der Begründung:
Die Vorinstanzen gaben der nach Zwangsversteigerung von als Kredit-sicherheit dienenden Liegenschaften der Beklagten aushaftenden Kreditrestforde-rung statt. Die Restforderung umfasste auch € 7.350,60 Honorar für ein von der Klägerin im Zwangsversteigerungsver-fahren mit der Bewerbung der Liegen-schaft betrautes Immobilienbüro. Die Ge-genforderung der Beklagten von € 54.000 erachteten sie hingegen als unberechtigt. Die Beklagte hatte dazu ausgeführt, die Klägerin habe einen Freihandverkauf mit mehr Erlös in dieser Höhe vereitelt.
Die Beklagte macht als erhebliche Rechtsfrage nach § 502 Abs 1 ZPO geltend, es fehle Rsp zur Frage, ob die kreditgewährende Bank aufgrund gesetz-licher Sorgfaltspflichten oder vertrag-licher Vereinbarung verpflichtet sei, dem Kreditnehmer in angemessener Frist einen Freihandverkauf der Pfandliegenschaft anstelle der Zwangsversteigerung zu er-möglichen.
Eine gesetzliche Verpflichtung, wo-nach die eine titulierte Kreditforderung betreibende Bank eine bewilligte Zwangs-versteigerung der verpfändeten Liegen-schaft aufzuschieben hätte, um dem Verpflichteten einen Freihandverkauf zu ermöglichen, behauptet die Beklagte nicht, sie ist auch nicht ersichtlich. Die erwähnte Aufschiebungsnorm (§ 45a EO) ermöglicht die kurzfristige Aufschiebung eines Zwangsversteigerungsverfahrens auf Antrag oder mit Zustimmung der betreibenden Partei, enthält aber keine Verpflichtung der betreibenden Partei.
Dem festgestellten Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, dass eine Aufschiebung des Zwangsversteigerungsverfahrens tat-sächlich einen höheren Verwertungserlös als die durchgeführte Zwangsversteige-rung erbracht hätte. Das Verfahren bis zur Rechtskraft des Exekutionstitels nach Fäl-ligstellung der Kreditforderung sowie das Zwangsversteigerungsverfahren bis zur Versteigerungstagsatzung schaffen einen Zeitraum, der vom Kredit-/Pfandschuld-ner zur Käufersuche genützt werden kann. Dass die von der Beklagten bzw von ihren Vertretern unternommenen Verkaufsbe-
gegenseitigen Verpflichtungen eine un-trennbare Einheit, sodass immer nur das gesamte Rechtsgeschäft angefochten wer-den kann (6 Ob 701/86 = SZ 60/207 [5]; 7 Ob 225/98h). Allerdings ist zu bemer-ken, dass nicht alle Verpflichtungen, die Vertragspartner in einem gegenseitigen Vertrag übernehmen, in einem Gegensei-tigkeitsverhältnis stehen (vgl RS0019902 zum Leistungsverweigerungsrecht).3.3. Im vorliegenden Fall ist die Rechts-ansicht des Berufungsgerichts über eine von den Vertragsparteien gewollte Einheit von Liegenschaftsverkauf – gegen einen beträchtlich unter dem wahren Verkehrs-wert liegenden Kaufpreis – auf der einen Seite und Einräumung des Belastungs- und Veräußerungsverbots auf der anderen Seite nicht zu beanstanden; ein solcher Vorgang ist im Geschäftsverkehr – un-abhängig von einer möglichen Gläubi-gerbenachteiligung – im Zusammenhang mit der Veräußerung von Liegenschaften auch nicht unüblich (vgl etwa 3 Ob 2/09d [6] in einer besonderen Konstellation; 5 Ob 220/09b; 5 Ob 176/08f uva). Eine bewusste Einräumung gerade des Verbots für den Fall der Insolvenz des Verbots-verpflichteten ist nicht festgestellt; dazu wurde vom Erstgericht eine Negativfest-stellung getroffen.4. Im vorliegenden Fall wird vom Insol-venzverwalter in seinem Hauptbegehren allein die bücherliche Einverleibung des Belastungs- und Veräußerungsverbots angefochten.
Ungeachtet der Möglichkeit, selbstän-dig das Verfügungsgeschäft anzufechten (siehe oben 1. und 2.), kann nicht auf die vom Insolvenzverwalter gewählte Weise ein Effekt erzielt werden, der zu einem den unter 3. angeführten Grundsätzen über die Teilanfechtung widersprechen-den Ergebnis führt, nämlich einer Zerle-gung der sachenrechtlichen Folgen eines als Einheit zu sehenden Verpflichtungs-geschäfts, das auch einheitlich verbüchert wurde (zum Zusammenhang zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft bei der Anfechtung vgl im Übrigen RS0123435).
Dieses Ergebnis wird dadurch bestä-tigt, dass das Anfechtungsrecht nicht dazu dient, den Insolvenzgläubigern Vorteile zu verschaffen, die sie ohne Vornahme der anfechtbaren Rechtshandlung nicht erzielt hätten (Obermüller, Insolvenzrecht in der Bankpraxis8 Rz 5.273). Durch eine Anfechtung soll der Masse nur dasjenige wieder zugeführt werden, was ihr ohne die anfechtbare Rechtshandlung verblieben wäre (BGH IX ZR 199/97, ZIP 1998, 2165). Im vorliegenden Fall zielt die
Klage des Insolvenzverwalters darauf ab, etwas für die Masse zu erhalten, was der Gemeinschuldner – ob der Einheitlichkeit des Geschäfts – von vornherein nicht er-langen hätte können, nämlich eine nicht mit einem Belastungs- und Veräußerungs-verbot belastete Liegenschaft.
Dieser Fall unterscheidet sich grund-legend von der „nachträglichen“ Ein-räumung allein eines Belastungs- und Veräußerungsverbots. Ist doch hier auch das Verfügungsgeschäft – in Form der ge-meinsamen Verbücherung des Eigentums-rechts und des Belastungs- und Veräuße-rungsverbots – als Einheit zu sehen: § 97 GBG sieht zur Sicherstellung der Rechte des Vertragspartners des Erwerbers eines dinglichen Rechts vor, dass dann, wenn dem Erwerber zugleich Beschränkungen in der Verfügung über das erworbene Recht oder Gegenverpflichtungen auf-erlegt worden sind, die Eintragung des Rechts nicht bewilligt werden darf, wenn nicht zugleich hinsichtlich der bedun-genen Beschränkungen oder Gegenver-pflichtung die Einverleibung oder Vor-merkung beantragt wird. Voraussetzung ist, dass die gleichzeitige Einverleibung der Gegenverpflichtung bzw Beschrän-kung ausdrücklich oder unzweideutig bedungen wurde (5 Ob 124/01y zu ei-nem Aufteilungsbeschluss nach §§ 81 ff EheG). Ob eine derartige gegenseitige Beschränkung vorliegt, ist durch Vertrags-auslegung zu ermitteln (Hoyer, NZ 1996, 94/353). Bei Einräumung eines Be- lastungs- und Veräußerungsverbots zu-gunsten des Veräußerers im Zuge des Erwerbs einer Liegenschaft liegt Gleich-zeitigkeit iSd § 97 GBG nahe (Kodek in Kodek, Grundbuchsrecht § 97 GBG Rz 2 und 9; die E 5 Ob 91/95 = NZ 1996, 94/353 [krit Hoyer] ist insoweit abzuleh-nen). Aus den bereits zur Einheitlichkeit des Verpflichtungsgeschäfts dargelegten Erwägungen muss auch für den vorliegen-den Fall angenommen werden, dass die gleichzeitige Einverleibung des Eigen-tumsrechts und des Belastungs- und Ver-äußerungsverbots unzweideutig bedungen ist. Ein in diesem Sinn einheitliches Verfügungsgeschäft kann nur einheitlich und nicht „zerlegt“ angefochten werden.
5. Zutreffend hat das Berufungsgericht darauf hingewiesen, dass auch das Even-tualbegehren bezüglich der Zahlung des Kaufpreisteils von € 50.000 an der Un-trennbarkeit der Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag scheitert.
[5] ÖBA 1988, 276 mit Anm von Koziol.[6] ÖBA 2009, 832.
1800.§§ 859, 1014, 1333 ABGB; §§ 42, 45a EO. Der betreibende Gläubiger ist ge-setzlich nicht verpflichtet, die Zwangs-versteigerung aufzuschieben, um dem

OGH 3 Ob 195/11i
258 ÖBA 4/12
Die Kläger machen als erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO geltend, es fehle Rsp zur Frage, unter welchen Voraussetzungen ein als „endgültige Be-dingungen“ bezeichnetes Dokument als Prospektnachtrag zu werten sei, sodass es den Prospektveröffentlichungsregeln nach KMG unterliege und mangels ausrei-chender Veröffentlichung ein Rücktritts-recht nach § 5 KMG zustehe.
Noch in der Berufung sprachen die Kläger – ebenso wie in ihrem erst-instanzlichen Vorbringen – ausdrück-lich von „endgültigen Bedingungen“. Das nunmehr erhobene Vorbringen, die Beurteilung der Chancen und Risken sei ohne Einbeziehung der „endgülti-gen Bedingungen“ nicht möglich, sodass diese in Wahrheit einen zwingenden Prospektnachtrag bilden würden, erweist sich damit als unzulässige und damit unbeachtliche Neuerung (6 Ob 138/11d mwN; RS0043352 [T33], RS0043338 [T11]). Auf diese Frage ist somit in dritter Instanz nicht mehr einzugehen, mangels Präjudizialität im Einzelfall fehlt daher eine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO (RS0088931 [T2]).
Hat das Berufungsgericht das Vorlie-gen einer in der Berufung behaupteten Nichtigkeit des erstinstanzlichen Verfah-rens geprüft und eine solche verneint, ist die Wahrnehmung dieser Nichtigkeit im Revisionsverfahren nicht mehr möglich (RS0042981, RS0042917, RS0043405). Diese Anfechtungsbeschränkung – es liegt ein gemäß § 519 ZPO unanfechtba-rer Beschluss des Berufungsgerichts vor (RS0042981 [T3, T6]) – kann auch nicht mit der Behauptung unterlaufen werden, die Verneinung der Nichtigkeit beruhe auf einer unrichtigen rechtlichen Beurteilung oder begründe die Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens (RS0042981 [T5, T15]).
Zu 8 Ob 38/11p [1] hielt der OGH fest, dass ein (angeblicher) Verstoß ge-gen § 7 Abs 4 KMG sich nicht auf das Rücktrittsrecht bezieht. Auf die genannte Gesetzesbestimmung bezughabende Aus-führungen der Kläger werfen damit keine erhebliche Rechtsfrage nach § 502 Abs 1 ZPO auf.
Das Rücktrittsrecht nach § 5 Abs 1 KMG knüpft an der Nichtveröffent-lichung eines KMG-Prospekts (auch Ba-sisprospekt und Nachtrag nach § 6 KMG) trotz Prospektpflicht nach § 2 Abs 1 KMG an. Die Nichtveröffentlichung bloß end-gültiger Bedingungen löst hingegen kein Rücktrittsrecht aus. Die Beweislast für die fehlende Prospektveröffentlichung trägt der Verbraucher (8 Ob 38/11p mwN). Da
mühungen an der Klägerin, etwa an von ihr gesetzten zeitlichen Beschränkungen gescheitert wären, steht nicht fest. Beste-hen und Ausmaß allfälliger vertraglicher Schutz- und Sorgfaltspflichten der Pfand-gläubigerin brauchen daher nicht weiter untersucht zu werden.
Die Vereinbarung eines Freihandver-kaufs zwischen den Streitteilen vermoch-ten die Vorinstanzen nicht festzustellen, die von der Klägerin hiefür gesetzten Bedingungen (Vertragserklärungen, Bo-nitätsnachweise) wurden nicht erfüllt. Es fehlen daher von vornherein jegliche Anhaltspunkte für ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten der Klägerin, welches die compensando eingewende-te Schadenersatzforderung rechtfertigen könnte.
Weiters moniert die Beklagte fehlende Rsp zur Frage, ob der Kreditnehmer die Kosten eines von der betreibenden Bank im Rahmen der Zwangsversteigerung beigezogenen Immobilienbüros tragen müsse, wenn dessen Leistungen nicht zur Erzielung eines höheren Meistbots beige-tragen hätten und der Kreditnehmer diese Leistungen selbst hätte erbringen können.
Grundlage des Aufwandersatzes für das von der Klägerin zur Bewerbung der zu versteigernden Liegenschaft beigezo-gene Immobilienbüro ist die dem Kredit-vertrag der Streitteile zugrundeliegende Klausel, wonach der Kreditnehmer „alle aufgrund der Geschäftsbeziehung mit ihm entstehenden notwendigen und nützlichen Aufwendungen, Auslagen, Spesen und Kosten, insb Stempel- und Rechtsgebüh-ren, Steuern, Porti, Kosten für Versiche-rung, Rechtsvertretung, Betreibung und Einbringung ... Verwertung oder Freigabe von Sicherheiten“ zu tragen hat. Die gene-relle Unwirksamkeit dieser Vertragsklau-sel behauptet die Beklagte nicht, sie beruft sich (nur) darauf, dass die Beiziehung des Immobilienbüros weder notwendig noch nützlich, sondern zu teuer und überdies erfolglos gewesen wäre.
Zum unmittelbar vergleichbaren Auf-wandersatzanspruch des Gewaltgebers nach § 1014 ABGB hat der OGH ausge-sprochen, dass es darauf ankommt, ob der Machthaber bei pflichtgemäßer Sorgfalt die Aufwendung zu diesem Zeitpunkt für die von ihm geschuldete Geschäftsbesor-gung für erforderlich und zweckmäßig halten durfte (5 Ob 268/08k). Auf den tatsächlichen Erfolg kommt es somit nicht an, sondern ist bei der Beurteilung, ob der getätigte Aufwand notwendig oder nützlich war, auf den Zeitpunkt der Aufwendung abzustellen (1 Ob 78/02f [1] = SZ 2002/58; RS0116446).
Ob der gemachte Aufwand für den zur Interessentenwerbung beigezogenen Immobilienmakler zum Zeitpunkt der Beiziehung als notwendig und nützlich anzusehen ist, lässt sich nur nach den Umständen des konkreten Falls beurtei-len. Die Bejahung von Notwendigkeit und Nützlichkeit durch das Berufungsge-richt bildet im Hinblick auf das Interesse beider Streitteile an der Erzielung eines möglichst hohen Versteigerungserlöses, wofür die Gewinnung möglichst vieler Interessenten erforderlich ist, und die tatsächliche Erstellung einer Interessen-tenliste sowie das Mitbieten eines vom Makler gewonnenen Interessenten bei der Versteigerungstagsatzung, keine vom OGH im Interesse der Rechtssicherheit aufzugreifende Fehlbeurteilung. Dass die Einschaltung des Immobilienbüros im konkreten Fall von vornherein als nutzlos erkennbar gewesen wäre, etwa weil zu erwarten gewesen wäre, dass daraus kein über das Honorar hinausgehender Mehr-erlös erzielt werden könnte, behauptete weder die Beklagte noch bot das Verfah-ren hiefür Anhaltspunkte.
[1] ÖBA 2003, 214.
1801.§§ 2, 5, 6, 7 KMG; Art 29, 33 Prospekt-VO (EG) Nr 809/2004; §§ 502, 519 ZPO. Ein (angeblicher) Verstoß gegen § 7 Abs 4 KMG bezieht sich nicht auf das Rücktrittsrecht des Anlegers.Die Beweislast für die fehlende Pro-spektveröffentlichung trägt der Ver-braucher.Die Nichtveröffentlichung bloß der endgültigen Bedingungen löst kein Rücktrittsrecht nach § 5 KMG aus.Ob die Veröffentlichung eines Pro-spekts als „leicht zugänglich“ zu beurteilen ist, ist eine nicht revisible Einzelfallsfrage. Die Beurteilung, dass die Veröffentlichung „ausreichend“ zugänglich ist, wenn keine Hinder-nisse vorliegen, die im elektronischen Verkehr übliche einfache Such- und Registrierungsschritte übersteigen, ist vertretbar.OGH 8. 11. 2011, 3 Ob 195/11i
Aus der Begründung:
Die Vorinstanzen wiesen das auf Rück-zahlung des Kaufpreises Zug-um-Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Wertpapiere gerichtete Begehren der Klä-ger ab. Sie verneinten das Rücktrittsrecht mangels Veröffentlichung des Kapital-marktprospekts gemäß § 5 KMG und in-folge fehlender Kausalität einer allfälligen Irreführung oder allfälligen Verletzung von Aufklärungspflichten sowohl Irr-tumsanfechtung als auch Schadenersatz. [1] ÖBA 2011, 830.

VfGH b 886/11
ÖBA 4/12 259
kam aber letztlich zum Ergebnis, dass die Bankensonderabgabe mit anderen Über-legungen gerechtfertigt werden könne. Er hat damals wörtlich Folgendes ausgeführt (aaO, S 315): „Kreditunternehmungen nehmen eine – aus ihrer besonderen wirtschaftlichen Funktion [...] erklärbare – spezifische rechtliche Sonderstellung ein, wie sie sich insbesondere in der extrem restriktiven wirtschaftsverwal-tungsrechtlichen Regelung des Zugangs zum Markt, in der wettbewerbsmäßigen Stellung, die den Kreditunternehmungen durch das Kartellrecht und das Kredit-wesenrecht eingeräumt ist, und in der von der BReg ins Treffen geführten indirekten Förderung der Kreditwirtschaft durch die Sparförderung und die Konstruktion der Subventionsverwaltung dokumentiert. Die für Kreditunternehmungen geltenden Sondervorschriften bewirken in ihrer Summe eine derartige rechtliche Sonder-stellung, dass sie eine unterschiedliche steuerliche Behandlung in der Weise, wie sie die in Prüfung gezogene Rege-lung vorsieht, nach Ansicht des VfGH zu rechtfertigen vermag.“ Bedenken gegen die Bemessungsgrundlage der Abgabe hatte der VfGH bei diesem Ergebnis nicht.1.1. Die Materialien zum StabAbgG (RV 981 BlgNR 24. GP, 6 f) weisen in ihrem Allgemeinen Teil darauf hin, dass einer der wesentlichen Verursacher der Finanzkrise die Finanzmärkte waren, von denen sich die Krise auf die reale Wirtschaft übertragen habe. Die Repub-lik Österreich habe seit dem Jahr 2008 durch umfangreiche Bankenhilfspakete, Konjunkturpakete und weitere Maßnah-men die Folgen der Finanzkrise so weit wie möglich abgefedert und dadurch zu einer Stabilisierung der Finanzmärkte und Banken in Österreich beigetragen. Der Staatshaushalt sei in den Jahren 2008 bis 2010 durch diese Maßnahmen erheblich belastet worden. Wörtlich heißt es sodann: „Die nun vorgesehene Stabili-tätsabgabe soll einerseits eine Beteiligung der Kreditinstitute, die von diesen Maß-nahmen erheblich profitiert haben, an den Krisenkosten darstellen und zum anderen soll damit dem Ziel der Finanzmarkt-stabilität Rechnung getragen werden. Die Abgabe soll auch eine allgemeine Sicherungsmaßnahme für Leistungen des Staates in Zeiten von Finanzkrisen darstellen. Außerdem können durch eine Stabilitätsabgabe Lenkungseffekte erzielt werden, indem risikoreichere Finanzie-rungsinstrumente besteuert werden, wo-durch indirekt auch die systemische Finanzmarktstabilität gefördert wird. Die
die Kläger im erstinstanzlichen Verfahren eine fehlende (fehlerhafte) Prospektver- öffentlichung im Hinblick auf den Wort-laut der den österreichischen Prospektver-öffentlichungsbestimmungen zugrunde-liegenden RL 2003/71/EG (angeblicher Übersetzungsfehler) nicht vorgebracht haben, ist auf insoweit unzulässige Neue-rungen im Revisionsverfahren gleichfalls nicht einzugehen.
Ob gemäß Art 33 der Prospekt-VO 809/2004 auch endgültige Bedingun-gen zu veröffentlichen sind, kann auf sich beruhen, zumal die Nichtveröffentlichung bloß der endgültigen Bedingungen kein Rücktrittsrecht nach § 5 KMG auslöst (5 Ob 56/11b; 6 Ob 138/11d).
Ob die konkrete Veröffentlichung ei-nes Prospekts als „leicht zugänglich“ iSd Art 29 ProspektVO 809/2004 zu beur-teilen ist, hängt von der Ausgestaltung der Internetveröffentlichung im Einzel-fall ab, die Beantwortung dieser Frage bildet daher regelmäßig keine erheb-liche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO (Einzelfallbezogenheit). Dass die Vor-instanzen die veröffentlichten Prospekte als „ausreichend“ zugänglich erachteten, zumal Hindernisse, die im elektronischen Verkehr übliche einfache Such- und Registrierungsschritte übersteigen, nicht vorlagen, bildet keine vom OGH aufzu-greifende Fehlbeurteilung.
Die außerordentliche Revision der Kläger ist daher mangels Aufzeigens einer erheblichen Rechtsfrage nach § 502 Abs 1 ZPO zurückzuweisen.
Öffentlich-rechtliche Entscheidungen
Bearbeitet von Univ.-Prof. Dr. Karl Stöger, MJur, Institut für
Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht,
Politikwissenschaft und Verwaltungs-lehre, Universität Graz
Erkenntnisse des VfGH
31.Stabilitätsabgabegesetz (StabAbgG; Art 56 Budgetbegleitgesetz 2011); Art 144 B VG; Abweisung einer Be-scheidbeschwerde, in der die Ver-fassungswidrigkeit des Stabilitätsab-
gabegesetzes behauptet wird. Die Stabilitätsabgabe ist verfassungskon-form, da es sachlich ist, die Banken, die in der Finanzkrise besondere staatliche Unterstützung benötigten, durch eine Abgabe auch besonders an der Finanzierung der zur Bewältigung der Krise eingeleiteten bzw durchge-führten Maßnahmen zu beteiligen. Die Belastung des gesamten Bankensektors durch die Stabilitätsabgabe ohne wei-tere Differenzierung nach einzelnen Banken ist verfassungskonform. Führt der Gesetzgeber eine bestimmte Ab-gabe erstmals und ohne entsprechen-de Erfahrungswerte ein, ist ihm ein großer rechtlicher Gestaltungsspiel-raum zuzubilligen.VfGH 14. 12. 2011, B 886/11 [1]
1. Die beschwerdeführende Gesellschaft [Vorarlberger Landes- und Hypotheken-bank AG] ist ein Kreditinstitut iSd § 1 Abs 1 Bankwesengesetz (BWG). Sie leistete am 31.1.2011 eine Quartalsvo-rauszahlung der Stabilitätsabgabe iHv 1,5 Mio. Euro nach dem Bundesgesetz, mit dem eine Stabilitätsabgabe von Kre-ditinstituten eingeführt wird (Stabili-tätsabgabegesetz – in der Folge kurz: StabAbgG), Art 56 des Budgetbegleit-gesetzes 2011, BGBl I 2010/111, und beantragte unter Berufung auf die Ver-fassungswidrigkeit dieses Gesetzes die Festsetzung der Stabilitätsabgabe gemäß § 201 Abs 3 BAO mit Null Euro sowie die Rückerstattung des geleisteten Betrages. [Der Antrag wurde im Berufungsweg vom UFS abgewiesen, dagegen erhob die beschwerdeführende Gesellschaft Bescheidbeschwerde an den VfGH gem Art 144 BVG]. [...].
III. Erwägungen des VfGH1. Im Erkenntnis VfSlg 10.001/1984 (zur Bankensonderabgabe gemäß BGBl 1980/ 553, deren Bemessungsgrundlage [eben-falls] die um bestimmte Positionen ge-kürzte Bilanzsumme bildete) ging der VfGH davon aus, dass eine auf Kredit-unternehmungen beschränkte Sonder-abgabe nur dann verfassungsrechtlich Bestand haben könne, wenn sich eine sachliche Rechtfertigung dafür finden lasse, dass gerade Kreditunternehmun-gen mit einer derartigen Abgabe belegt werden. Die damals von den Materialien als Rechtfertigung angeführte besondere Ertragskraft der Kreditinstitute hielt der VfGH bereits im Prüfungsbeschluss für fragwürdig; er hat diese Rechtfertigung im Enderkenntnis verworfen. Der VfGH
[1] Das in diesem Verfahren beschwer-deführende Kreditinstitut hatte auch einen Individualantrag an den VfGH gerichtet, der
von diesem wegen des anhängigen Bescheid-beschwerdeverfahrens aber mit Beschluss vom 3.12.2011, G 44/11 zurückgewiesen wurde
(Subsidiarität des Individualantrages).

VfGH b 886/11
260 ÖBA 4/12
Ausweitung angesichts des dargelegten Hintergrundes nicht.
Auf der anderen Seite ist es verfas-sungsrechtlich auch nicht geboten – und auch mit vernünftigem Aufwand gar nicht möglich –, innerhalb des Bankensektors zwischen „guten“ und „bösen“ Kredit-unternehmungen zu unterscheiden. Die Stabilitätsabgabe ist keine Strafe für eine riskante Geschäftsgebarung; sie ist auch kein Äquivalent für die „Systemrelevanz“ eines Kreditinstituts. Ihre Aufgabe ist es, einen Sektor der Volkswirtschaft zu belasten, von dem nach den jüngsten Erfahrungen qualifizierte Risken aus-gehen (können) und für den bereits der Staat durch Intervention und den Einsatz öffentlicher Mittel einstehen musste, um auf diesem Wege finanzielle Mittel für den Staatshaushalt zu gewinnen, die ei-nerseits der Abdeckung der Kosten bereits in die Wege geleiteter Maßnahmen und andererseits der Vorsorge für künftige Krisenfälle dienen sollen. Dass die Sta-bilitätsabgabe dafür untauglich wäre und dies nicht leisten kann, wird auch von der beschwerdeführenden Gesellschaft nicht behauptet.
Der VfGH kann auch nicht finden, dass das Anknüpfen an die (modifizierte) Bilanzsumme von vornherein unsachlich wäre. Es ist dies eine Bemessungsgrund-lage, die die Geschäftstätigkeit einer Bank in geeigneter Weise abbildet und die auch in anderen Ländern als Bezugsgröße für einschlägige Bankenabgaben gewählt wurde bzw diskutiert wird (s. dazu die Beispiele in den Materialien sowie den erwähnten Bericht des IWF, S 13 ff).2.3. Was hingegen die von der beschwer-deführenden Gesellschaft vorgebrachten Bedenken gegen einzelne Regelungen des StabAbgG betrifft, so werden damit rechtspolitische, nicht aber verfassungs-rechtliche Fragen aufgeworfen. Ob die Bilanzsumme um die gesicherten Ein-lagen vermindert wird, steht daher im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers (der hiebei etwa berück-sichtigen darf, dass die Einlagensicherung gemäß §§ 93 und 93a BWG in erster Linie vom Sektor selbst zu gewährleisten ist). Wenn der Gesetzgeber auf eine ent-sprechende Ausnahme für Pfandbriefe verzichtet, ist ihm daher im Hinblick auf die genannten Erwägungen aus verfas-sungsrechtlicher Sicht nicht entgegen-zutreten (selbst wenn der von der BReg angestellte Vergleich mit den bekannt gewordenen „asset backed securities“ des US-amerikanischen Finanzmarktes unzu-treffend sein sollte). Der Gesetzgeber ist verfassungsrechtlich auch nicht gehindert, als Bemessungsgrundlage grundsätzlich die unkonsolidierte Bilanzsumme heran-zuziehen, weil damit berücksichtigt wird, dass das einzelne Kreditinstitut, und nicht (bloß) die Institutsgruppe, von den staat-
Stabilitätsabgabe soll jedoch die Wettbe-werbsfähigkeit des österreichischen Fi-nanzsektors so weit möglich nicht negativ beeinflussen. Kundenvermögen, das im Rahmen der Einlagensicherung abge- sichert ist (zB Spareinlagen bis zu 100.000 Euro), soll nicht von der Abgabe erfasst werden.“ [...]. Zu § 1 StabAbgG wird in den Erläuterungen (RV 981 Blg-NR 24. GP, 104) ergänzend ausgeführt: „Im Vergleich zu den anderen Teilneh-mern des Finanzmarktes (zB Versicherun-gen, Wertpapierdienstleistungsunterneh-men) hat der Bankensektor in Österreich den größten Teil der finanzmarktkrisen-bedingten Kosten für den Staatshaushalt verursacht. Die Bankenhilfspakete, die Erhöhung der Einlagensicherung und die Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzmarktes haben in erster Linie den Bankensektor betroffen. Zudem stellen instabile Banken im Vergleich zu den anderen Finanzinstituten ein wesentlich höheres systemisches Risiko für den Staat und die gesamte Volkswirtschaft dar. Der Konkurs einer Bank begründet aufgrund der zu erwartenden Folgewirkungen für den Staat ein hohes budgetäres Risiko; dies gilt insbesondere für Banken, die eine bestimmte Größe überschreiten und somit als für die heimische aber auch euro-päische Volkswirtschaft systemrelevante Bankinstitute bezeichnet werden können. Der Staat unterliegt in diesen Fällen einem wesentlich höheren Druck, Ban-ken durch Rettungspakete oder Verstaat-lichungen aufzufangen, um die negativen volkswirtschaftlichen Konsequenzen ab-zuwehren, als bei allen anderen Teilneh-mern des Finanzmarktes. Aufgrund der Sonderstellung des Bankensektors ist es daher gerechtfertigt, nur diesen in die Stabilitätsabgabe einzubeziehen.“
1.2. Der von der BReg in ihrer Äußerung im Verfahren zu G 44/11 [zurückgewiese-ner Individualantrag desselben Antrag-stellers] vorgelegte Bericht des IWF für das G-20-Meeting im April 2010 wurde auf Ersuchen der „G-20 leaders“ verfasst und sollte diese darüber informieren, wel-che Maßnahmen die Staaten ergriffen ha-ben oder überlegen, um den Finanzsektor in fairer und substantieller Weise an den Kosten der Krisenbewältigung zu beteili-gen. Die darin geäußerten und weiter be-ratenen Vorschläge wurden im Juni 2010 im Endbericht des IWF für die G-20, „A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector“, veröffentlicht. Eines der dort diskutierten Instrumente ist eine „Financial Stability Contribution“ (FSC), das heißt eine Steuer, die die Kosten künftiger staatlicher Unter- stützungsmaßnahmen des Finanzsektors abgelten soll, wobei sowohl eine Fonds-lösung als auch eine Vereinnahmung im allgemeinen Staatshaushalt als Optionen dargestellt werden. Was die persönliche
Reichweite einer solchen Steuer angeht, so hält der Bericht (S 13) sowohl einen breiten als auch einen engen Ansatz für möglich, spricht sich aber letztlich für eine größere Reichweite aus, bei der sämtliche Finanzinstitute und nicht bloß Banken einbezogen werden. Als Be- messungsgrundlage soll nach Auffassung des Berichtes von der Bilanzsumme aus-gegangen werden, wobei einige außer-bilanzielle Posten einbezogen werden können, hingegen das Eigenkapital und gesicherte Verbindlichkeiten („insured liabilities“) ausgenommen werden sollen (S 17).2. Vor diesem Hintergrund kommt der Beschwerde keine Berechtigung zu:2.1. Wenn die Beschwerde darauf ver-weist, dass einige der vom VfGH im Erkenntnis VfSlg 10.001/1984 hervor-gehobenen und für maßgeblich erach-teten rechtlichen Besonderheiten des Kreditsektors heute nicht mehr oder nur noch modifiziert bestehen, so mag dies zutreffen. Das ändert aber nichts daran, dass für den Bankensektor – vor allem in Form des BWG – nach wie vor ein spezi-fisches rechtliches Regime gilt und dass er sich hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Bedeutung und Funktionen markant von anderen Sektoren der Volkswirtschaft unterscheidet.2.2. Der VfGH kann es dahingestellt sein lassen, ob diese rechtliche und wirtschaft-liche Sonderstellung für sich allein auch heute eine steuerliche Sonderbehandlung des Bankensektors rechtfertigen würde. Die Materialien zum StabAbgG begrün-den die Stabilitätsabgabe nämlich nicht mit der rechtlichen und wirtschaftlichen Sonderstellung des Bankensektors, son-dern weisen auf die besondere Rolle hin, die speziell die Banken in der Finanz-krise des Jahres 2008 gespielt haben. Zur Bewältigung dieser Krise habe die Republik Österreich umfangreiche, den Staatshaushalt erheblich belastende Ban-kenhilfspakete, Konjunkturpakete und andere Maßnahmen ergreifen müssen, die in besonderem Maße den Banken zugute gekommen seien. Wenn der Gesetzgeber im Hinblick darauf die Banken durch eine spezielle Abgabe an der Finanzierung der zur Bewältigung der Krise eingeleiteten bzw durchgeführten Maßnahmen betei-ligen will, kann der VfGH das nicht als unsachlich erkennen. Ebenso wenig stößt es auf Bedenken, wenn der Gesetzgeber mit einer solchen Steuer (auch) das Ziel verfolgt, die Finanzmarktstabilität zu verbessern bzw die finanziellen Mittel für entsprechende künftige Staatsleistungen zu gewinnen. Ob eine Ausweitung der persönlichen Steuerpflicht auf andere Bereiche des Finanzsektors verfassungs-rechtlich in Betracht käme, braucht der VfGH dabei nicht zu untersuchen. Ver-fassungsrechtlich geboten ist eine solche

VfGH b 886/11
ÖBA 4/12 261
(Rz 30 des Erkenntnisses; III.2.3.). Wört-lich führt der VfGH aus: „Bei einer solchen Situation ist der rechtspolitische Spiel-raum des Gesetzgebers wenigstens im gegenwärtigen Zeitraum ein größerer als bei einer Abgabe, deren rechtliche Konturen schon fest umrissen sind und deren Wirkungen und Konsequenzen sich bereits ohne Schwierigkeiten ermit-teln lassen.“ Diese Argumentation hat zwei Seiten: Zum einen ist es zweifellos eine gute Nachricht für den Gesetzgeber (und die die Gesetze regelmäßig vorbe-reitenden Ministerien), dass der VfGH Verständnis dafür zeigt, dass man in akuten Krisensituationen manchmal eben etwas schneller reagieren muss und dann allenfalls auch die zweit- oder drittbesten Lösungen noch akzeptabel sind. Freilich: Diese Aussage hat der VfGH spezifisch für die rechtliche Konstruktion von Abgaben getroffen und es ist sehr zu hoffen, dass diese Argumentation nicht eines Tages auch in Erk auftaucht, die ganz andere Rechtsgebiete betreffen. Bei grundrechts-nahen gesetzlichen Eingriffen hat eine derartige Argumentation nämlich nichts verloren.
4. Im konkreten Fall der Stabilitätsabga-be ist freilich richtig, dass der Staat zuerst in – auch für ihn – wirtschaftlich schwie-rigen Zeiten große finanzielle Mittel zur Stützung des Bankensektors aufwenden musste und dementsprechend auch unter Zeitdruck stand, seinerseits neue Finan-zierungsquellen zu erschließen. Eine interessante Frage ist jedoch nunmehr, ob der VfGH die konkrete Ausgestaltung der Stabilitätsabgabe, würde sie in einigen Jahren nach „Durchtauchen“ der Krise er-neut angefochten, anders beurteilen wür-de als zum jetzigen, von „Dringlichkeit“ geprägten Zeitpunkt. In diesem Zusam-menhang ist nämlich darauf hinzuweisen, dass der VfGH noch eine andere Möglich-keit gehabt hätte, allfälligen Bedenken gegen die Stabilitätsabgabe Rechnung zu tragen, ohne dabei die Möglichkeit des Gesetzgebers, in akuten Krisenzeiten besonders schnell und mit größerem politischem Gestaltungsspielraum Ge-setze zu erlassen, zu konterkarieren: Er hätte nämlich Teile des (bzw das ganze) StabAbgG auch unter Fristsetzung auf-heben können. Dies hätte zwar, sofern der VfGH nicht eine Änderung der Anlassfallwirkung ausgesprochen hätte, die Republik € 1,5 Millionen gekostet (das wäre dann nämlich die „Ergreifer-prämie“ der Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank gewesen), im Übrigen hätte er damit aber den seit der Erlassung des StabAbgG geäußerten Bedenken gegen dieses – so sie seiner Ansicht nach zugetroffen hätten – Rechnung tragen können und zugleich dem Gesetzgeber eine ausreichende Frist zur Reparatur zur Verfügung gestellt. Alle anderen Kredit-
lichen Maßnahmen profitiert bzw diese veranlasst hat. Dass andere Argumente für die Heranziehung der konsolidierten Bilanzsumme sprechen, ändert daran nichts. Ebenso wenig kann der VfGH erkennen, dass eine progressive Ausge-staltung des Steuertarifs, die zur Steuerbe-freiung von Kleinstkreditinstituten führt (die an der Auslösung der Finanzkrise kaum beteiligt waren und deren Probleme in der Regel sektoral gelöst werden) und große Kreditinstitute überproportional belastet, auf verfassungsrechtliche Beden-ken stoßen könnte, zumal damit berück-sichtigt wird, dass das systemische Risiko von Kreditinstituten jedenfalls in der Re-gel mit der Größe steigt. Dass die Besteu-erung von Derivaten auch nach anderen Gesichtspunkten hätte erfolgen können, beweist nicht die Verfassungswidrigkeit der getroffenen Regelung. Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang zu be-rücksichtigen, dass der Gesetzgeber im Hinblick auf den konkreten Anlass für die Einführung und Ausgestaltung der Stabili-tätsabgabe Neuland betreten musste. Die getroffene Regelung hält sich dabei offen-bar im Rahmen dessen, was auf interna-tionaler Ebene diskutiert wird bzw bereits in anderen Ländern realisiert ist. Bei einer solchen Situation ist der rechtspolitische Spielraum des Gesetzgebers wenigstens im gegenwärtigen Zeitraum ein größerer als bei einer Abgabe, deren rechtliche Konturen schon fest umrissen sind und deren Wirkungen und Konsequenzen sich bereits ohne Schwierigkeiten ermitteln lassen. Dass die vom Gesetzgeber getrof-fene Regelung überhaupt untauglich wäre oder zu sachfremden, willkürlichen Er-gebnissen führen würde, kann der VfGH nicht erkennen. [...].
IV. Ergebnis1. Die behauptete Verletzung verfas-sungsgesetzlich gewährleisteter Rechte hat sohin nicht stattgefunden.2. Das Verfahren hat auch nicht ergeben, dass die beschwerdeführende Partei in von ihr nicht geltend gemachten verfas-sungsgesetzlich gewährleisteten Rechten verletzt wurde. Angesichts der Unbedenk-lichkeit der angewendeten Rechtsgrund-lagen ist es auch ausgeschlossen, dass sie in ihren Rechten wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm verletzt wurde.
Die Beschwerde war daher abzuwei-sen. [...].
Anmerkung:1. Das ist ein Erk von weitreichender Bedeutung, über das auch in vielen Jah-ren noch diskutiert werden wird. Denn auch wenn die jetzige Finanzmarktkrise noch nicht überstanden sein dürfte, so wird irgendwann sicherlich die nächste
kommen. Soweit dann wieder eine Betei-ligung der Banken (bzw terminologisch korrekter: Kreditinstitute) an den Kosten der Folgenbeseitigung überlegt wird, wird die Diskussion um dieses Erk nicht herumkommen. Nicht anders war es im vorliegenden Fall: Schon bei der Einfüh-rung des StabAbgG (und auch in seinen Materialien) wurde dem mehr als 25 Jah-re alten Erk VfSlg 10.001/1984 zur Ban-kensonderabgabe gem BGBl 1980/553 besondere Bedeutung für die Begrün-dung der (Un)Zulässigkeit der „neuen“ Abgabe zugemessen. Schon diese Vor-geschichte zeigt, dass das vorliegende Erk zwar ein Produkt der Krise ist, jedoch auch eine potentiell weit in die Zukunft reichende Dimension aufweist.
2. Dass ausgerechnet die Vorarlber-ger Landes- und Hypothekenbank zum VfGH zog, kann eigentlich nicht wirk-lich überraschen: Die vbg LReg hat-te bereits im Begutachtungsverfahren zum Ministerialentwurf des StabAbgG darauf hingewiesen, dass die konkre-te Ausgestaltung des Gesetzes, nach der ua gesicherte Einlagen nach § 93 BWG die Bemessungsgrundlage für die Abgabe verringern, Hypothekenbanken benachteiligen würde, da diese aufgrund ihres Geschäftsmodells traditionellerwei-se über geringere sicherungspflichtige Spareinlagen verfügen würden. Da die Landeshypothekenbanken zusammen etwa 9% des Bankensektors ausmachen (Hofko, Das Stabilitätsabgabesetz – Ver-fassungsrechtliche Grenzen der Österrei-chischen „Bankensteuer“, ZfV 2011, 936 [940]), war es nicht ganz überraschend, dass eine Bank aus diesem Sektor vor-preschte (der einer LReg grundsätzlich zustehende Weg der Anfechtung eines Bundesgesetzes wurde freilich nicht be-schritten; man darf vermuten, dass das politisch zu weit gegangen wäre).
3. Ein wesentliches, an einer Stelle des Erk auch ausdrücklich angesprochenes Leitmotiv des VfGH bei seiner Ent-scheidung ist die Betonung des rechts-politischen Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers. Diese Figur ist in der Rsp des VfGH nicht unbekannt, und auch der Europäische „Menschenrechtsgerichts-hof“ EGMR verwendet diese Argumen-tationsfigur immer wieder. Dagegen ist auch grundsätzlich nichts einzuwenden, denn Gesetze macht das Parlament, ein Verfassungsgericht soll nicht un-bedingt jedes Detail eines Gesetzes, sondern dessen Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Vorgaben der Ver-fassung prüfen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang allerdings das Argument des VfGH, der rechtspolitische Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei Einführung der Stabilitätsabgabe sei deswegen besonders groß gewesen, weil „Neuland betreten“ werden musste

VfGH b 886/11
262 ÖBA 4/12
Auslösung der Finanzkrise kaum beteiligt waren und deren Probleme in der Regel sektoral gelöst werden und zudem „das systemische Risiko von Kreditinstituten jedenfalls in der Regel mit der Größe steigt“ (was auch die Materialien so sehen: RV 981 BlgNR 24. GP, 106; vgl weiters E. Lachmayer, Die Eckpunkte des Stabilitätsabgabegesetzes, Aufsichtsrat aktuell 2/2011, 23, 24). Diese Begrün-dung stellt nun offensichtlich sehr wohl auf die Systemrelevanz von Banken nach der Lesart „too big to fail“ ab (im Gegen-satz zur Lesart „too connected to fail“; dazu Hofko, ZfV 2011, 639).
9. Ein letzter Punkt betrifft schließlich das von der beschwerdeführenden Bank vorgebrachte Argument der Besonder-heit von Pfandbriefen. In Rz 29 (III.2.3.) führt der VfGH aus, dass der Gesetzgeber keinesfalls verpflichtet wäre, „die Bemes-sungsgrundlage ‚Bilanzsumme‘ nach Ri-sikogesichtspunkten aufzuschlüsseln und danach die Abgabenbelastung abzustu-fen“. Freilich betonen die Materialien zum StabAbgG, dass durch die Abgabe auch Lenkungseffekte erzielt werden sollen, indem risikoreichere Finanzierungsinst-rumente besteuert werden sollen (981 BlgNR 24. GP, 7). Unmittelbar beziehen sich diese Ausführungen jedoch nur auf die im vorliegenden Verfahren nicht wirk-lich diskutierte zusätzliche Besteuerung von Derivaten. Allerdings ist Folgendes zu überlegen: Wenn der Gesetzgeber risi-koreiche Instrumente besonders belasten will, ist er dann nicht auch iS eines sach-lichen Gesamtsystems der Stabilitätsab-gabe verpflichtet, risikoarme Instrumente als solche zu entlasten? Dabei handelt es sich nämlich nur um die andere Seite desselben Steuerungsziels. Dabei ist auch zu bedenken, dass Pfandbriefe ex lege gem § 230b ABGB als mündelsicher gelten und somit sogar eine gesetzliche Vermutung der Sicherheit für sich haben. Immerhin: Das Argument der BReg, Pfandbriefe seien mit ABS-Strukturen vergleichbar, hat der VfGH dahingestellt gelassen. Dieses Argument ist in der Tat auch wenig überzeugend; vgl zu den Un-terschieden zwischen Pfandbriefen und ABS zuletzt Uitz, Der Pfandbrief nach dem Österreichischen Pfandbriefgesetz (2010) 152.
10. Insgesamt ist festzuhalten, dass sich das Erk des VfGH sicher einer sehr klaren und gut verständlichen Sprache bedient. Das Argument „Wer Kosten verursacht, soll dafür auch zahlen“ ist leicht nach-vollziehbar. Wie die obenstehenden Ar-gumente zeigen sollten, sind einige der Überlegungen des VfGH aber vielleicht doch etwas zu einfach geraten. Damit ist nicht gesagt, dass den Argumenten gegen die Zulässigkeit der Stabilitätsab-gabe unbedingt hätte Erfolg beschieden sein müssen, doch sie hätten an der einen
institute hätten die Steuer inzwischen nach den bisherigen Vorschriften weiter entrichten müssen.
5. Dass der Gerichtshof diesen Weg nicht beschritten hat, lässt somit zwei mögliche Deutungen zu: Entweder ist der VfGH der Ansicht, dass einige der gegen das Gesetz geäußerten Bedenken vielleicht in einigen Jahren, nach Ab-flauen der Finanzmarktkrise, dann doch zutreffen würden, oder aber er ist der Ansicht, dass das StabAbgG in seiner vorliegenden Fassung jetzt und auch in Zukunft verfassungskonform ist (wobei in diesem Zusammenhang darauf hin-zuweisen ist, dass das Gesetz selbst ja ab dem Jahr 2014 eine Änderung der Bemessungsgrundlage vorsieht). Wel-che dieser beiden Deutungen nunmehr die zutreffende ist, ist angesichts der kryptischen Formulierung vom größeren rechtspolitischem Spielraum des Gesetz-gebers „wenigstens im gegenwärtigen Zeitraum“ nicht zu erschließen, der Tenor des Erk deutet mE jedoch insgesamt in die zweite Richtung, dh Unbedenklichkeit auch pro futuro. Freilich würde die Ant-wort auf diese Frage wohl nicht nur die Banken, sondern auch den Gesetzgeber interessieren, der ja gerade in Art 11 des ersten StabilitätsG 2012 (= erster Teil des Sparpakets 2012) eine Erhöhung der Stabilitätsabgabe für Banken um 25% bis zum Jahr 2017 vorsieht (bzw für einige Monate des Jahres 2012 sogar um 50%; die Erträge werden allerdings im Unter-schied zur bisherigen Rechtslage direkt an einen Fonds für „Finanzmarktunter-stützungsmaßnahmen“ gehen). Darauf werde ich noch zurückkommen. Inte-ressant ist schließlich, dass die „Über-prüfungsverpflichtung“ des StabAbgG bis Herbst 2012 durch den BMF, die § 10 Abs 3 leg cit vorsieht, zwar im Erk kurz erwähnt wird, aber keine näheren Überlegungen dazu angestellt werden, ob diese vielleicht eine verfassungsrecht-lich beachtliche „Ausgleichsmaßnahme“ zum großen Zeitdruck bei der Einführung wäre.
6. Die zahlreichen Argumente für und gegen die verfassungsrechtliche Zuläs-sigkeit der Stabilitätsabgabe sollen im Folgenden schon aus Platzgründen nicht nochmals dargelegt werden. Diese lassen sich zum einen im Erk in den Schrift-sätzen der Beschwerdeführerin bzw der BReg, zum anderen in den Materialien zum StabAbgG (RV 981 BlgNR 24. GP, 104 ff) und schließlich auch in der Fach-literatur nachlesen (vgl neben Hofko, ZfV 2011, 936 insb auch Staringer, Darf Österreich eine Bankensteuer einführen? Presse/Rechtspanorama vom 25.1.2010; Schweighart/Zach, BBG 2011 – 2014: Zur neuen Bankenabgabe, taxlex 2010, 465; zur Bemessungsgrundlage auch Schuschnig/Sylle, Finanzstabilitätsabga-
ben im europäischen Wirtschaftsraum, ÖBA 2011, 288 [291]). Der VfGH hat die Argumente gewogen, die Gegenargu-mente – jedenfalls für den Moment – als zu leicht befunden und das StabAbgG als verfassungskonform eingestuft. Dennoch finden sich in seinem Erk neben den bereits angesprochenen einige weitere Punkte, die einen kurzen Kommentar wert sind:
7. Da ist zum einen einmal die Tatsa-che, dass der VfGH sehr elegant eine Antwort auf die Frage vermeidet, ob denn die rechtliche und wirtschaftliche Sonderstellung des Bankensektors auch heute noch eine sei, die seine rechtliche Sonderbehandlung gegenüber anderen Sektoren des Finanzmarktes, insb Versi-cherungen und Wertpapierdienstleistern, rechtfertige. 1984 hatte er dies im Erk VfSlg 10.001 noch bejaht, im vorlie-genden Erk hat er dies jedenfalls auch nicht verneint. Vielmehr schließt er sich den Ausführungen in den Materialien zum StabAbgG an, nach denen es in der Finanzkrise des Jahres 2008 primär die Banken und nicht die anderen Sektoren des Finanzmarktes gewesen wären, die staatlicher Hilfe bedurft hätten. Dies ist in der Tat gegenüber dem Erk aus 1984 ein neues Argument, dass sich – zuge-gebenermaßen zugespitzt – wie folgt zusammenfassen lässt: „Wer Kosten ver-ursacht, soll dafür auch zahlen“. Freilich hatten die Materialien zum StabAbgG sehr wohl als zweite Argumentation das Erk VfSlg 10.001/1984 und die darin be-tonte wirtschaftliche und rechtliche Son-derstellung der Banken zur Begründung der Zulässigkeit der Stabilitätsabgabe herangezogen. Da der VfGH zu dieser Problematik freilich explizit nicht Stellung nahm, hat er sich die Möglichkeit offen gehalten, in Zukunft auszusprechen, dass eine Sonderstellung der Banken gegenüber den sonstigen Unternehmen am Finanzmarkt eben doch noch weiter besteht oder aber auch nicht. Damit hat er sich für allfällige zukünftige Rechts-streitigkeiten einen gewissen Spielraum gesichert, der freilich aus Sicht der Betrof-fenen nicht optimal ist. Wenn Banken in Zukunft Regelungen bekämpfen wollten, die speziell an sie adressiert sind, so sollten sie jedenfalls die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der VfGH seine Argumentation aus VfSlg 10.001/1984 wieder aufgreift – verlassen sollten sie sich darauf aber nicht.
8. Zum anderen besteht mE ein Wider-spruch zwischen den Ausführungen des VfGH in den Rz 27 und 29 (III.2.2. bzw III.2.3.) seines Erk: In Rz 27 betont er, dass die Stabilitätsabgabe kein Äquivalent für die Systemrelevanz eines Kreditinstitutes ist, in Rz 29 aE hingegen rechtfertigt er die Steuerbefreiung von Kleinstkredit-instituten ua damit, dass diese an der

ÖBA 4/12 263
◆
Auskünfte und AnmeldungenMag. LuciusTelefon (01) 533 50 50Telefax (01) 533 50 50/33e-mail: [email protected]
Mag. StejskalTelefon (01) 533 86 36/31Telefax (01) 533 86 36/36
e-mail: [email protected]
Faxanforderung für Detailprogramme
EMINAREDie Bankwissenschaftliche Gesellschaft veranstaltet gemeinsam mit dem Österreichischen Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum, Wien, Seminare zum Bank- und Finanzwesen.S
Name:
Institut/Firma:
Anschrift:
Telefon: Fax:
April – Juni 2012
■ Integrierte Unternehmens-finanzplanung mit Excel
Gießen Sie Ihren Business Plan in Zahlen! Mag. Mario Pichler 12.–13. 4. 2012, Wien
■ Fonds- und Derivate
Update für Diplom.Finanzberater und CFP®-ExpertenMercedes Schoppik, MBA 16. 4. 2012, Wien
■ Finanzberater-Ausbildung
3. WocheRef.-Team 16.–20. 4. 2012, Wien
■ Einführung in das Steuer- und Finanzrecht
MMag. Martin Nussbaumer 17. 4. 2012, Wien
■ Umsatzsteuer aktuell
Wichtige Änderungen 2011 / 2012Dr. Petra Reinbacher HR Dr. Gabrielle Krafft 19. 4. 2012, Wien
■ Bilanzanalyse für Geschäfts-führer – So liest man eine Bilanz!
Mag. (FH) Dominik Kalcher 19. 4. 2012, Wien
■ Business Intelligence erfolgreich einführen
Ing. Mag Norbert Kainc 23. 4. 2012, Wien
■ Verrechnungspreise – im Brenn-punkt der Betriebsprüfung
Dr. Wilfried Serles Piller 25. 4. 2012, Wien
■ Mit Begeisterung beraten – mit Erfolg abschließen II
Aktive Kundenbetreuung und Neu-kundengewinnungMag. Andreas Weese 25.–26. 4. 2012, Wien
■ Finanzmathematik in der Praxis mit Excel + PC
Mag. Peter Wais 3.–4. 5. 2012, Wien
■ Investitionscontrolling
Dr. Peter BaierMag. Max PanholzerDr. Georg Silber 7.–8. 5. 2012, Wien
■ Jahresabschlüsse lesen und verstehen
Kompakte Einführung in Bilanz, GuV und Cash FlowMag. Mario Pichler, CPA 9. 5. 2012, Linz
■ Finanzberater-Tagung 2012
Ref.-Team 10.–11. 5. 2012, Wien
■ Statistik im Finanzbereich mit Excel + PC
Mag. Peter Wais 14.–15. 5. 2012, Wien
■ Wertpapiergrundlagen in Theorie und Praxis
Mag. Andreas Hahn 22. 5. 2012, Wien
■ Der Jahresabschluss 2011 /2012Ein „Hands-on“-Workshop für alle, die es (wieder) genau wissen wollen!Mag. Catharina Karl 22.–23. 4. 2012, Wien
■ Upgrade Estate Planning – Upgrade-Schulung für CFP-Zertifikatsträger für die Zertifizierung zum CFEP®
Ref.-Team 30. 5.–1. 6. 2012, Wien 25.–28. 6. 2012, Wien

WeiterbildunG
264 ÖBA 4/12
oder anderen Stelle des Erk vielleicht doch eine etwas gründlichere Auseinan-dersetzung verdient.
11. Was freilich bleibt und was der VfGH leider nicht beantwortet hat (er hätte dies freilich auch nur obiter tun können), ist die Frage, „wie viel noch geht“. Wie schon erwähnt, wird die Stabilitätsab-gabe dieser Tage erhöht, Hintergrund sind (auch) erneute „Rettungskosten“ für eine Bank. In den Materialien wird die Stabilitätsabgabe als Beteiligung der Kreditinstitute an den Krisenkosten sowie als eine allgemeine Sicherungsmaßnah-me für Leistungen des Staates in Zeiten von Finanzkrisen bezeichnet (RV 981 BlgNR 24. GP, 7). Dennoch: Ein Beitrag im finanzwissenschaftlichen Sinn, für den dann aus verfassungsrechtlicher Sicht das Äquivalenzprinzip gilt, ist sie nicht. Damit stellt sich die Frage, ob und wann der VfGH einer Erhöhung der Stabilitäts-abgabe eine Grenze ziehen würde (vgl dazu auch Ehrke/Rabel in Doralt/Ruppe, Steuerrecht II6 [2011] Rz 68: Keine An-wendung des eigentumsrechtlichen Ver-hältnismäßigkeitsgrundsatzes auf Abga-ben durch den VfGH; so auch Korinek in Merten/Papier/Schäffer [Hrsg] Handbuch Grundrechte VII/1 [2009] § 196 Rz 34). Wie oben schon gezeigt, hat er sich im Hinblick auf eine allfällige Beantwortung dieser Frage einigen Spielraum offen gelassen. Wenn daher die erhöhte Stabi-litätsabgabe auch angefochten werden sollte (was im Raum steht), dann wird es sicher wieder spannend.
Univ.-Prof. Dr. Karl Stöger, Graz
Cernko, Unicredit Bank Austria AG; Vorstands- direktor Dr. Helmut Gerlich, Bankhaus Carl Spängler & Co AG; Dr. Stephan Koren, FIMBAG; o. Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. Helmut Koziol, Europäisches Zentrum für Schadenersatz- und Ver- sicherungsrecht; Generalsekretär Dr. Wilhelm Miklas, Verband der österreichischen Landeshypo-theken; o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Reinhard Moser, Wirtschaftsuniversität Wien; Generaldirektor Dkfm. Dr. Heimo J. Penker, BKS Bank AG; Prof. Dr. Her-bert Pichler, Bundessparte Bank + Versicherung, WKO; Univ.-Prof. Dr. Stefan Pichler, Institut für Kreditwirtschaft, WU Wien; Vorstandsdirektor Dr. Christoph Raninger, BAWAG P.S.K. AG; Generaldirektor Dr. Walter Rothensteiner, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG; Dr. Rudolf F. Stahl, Bank Gutmann AG; o. Univ.-Prof. Dr. Peter Steiner, Universität Graz; Generaldirektor Mag. Andreas Treichl, Erste Bank der oesterreichischen Sparkas-sen AG; o. Univ.-Prof. i.R. Dr. Helmut Uhlir, Wien; Generaldirektor Mag. Gerald Wenzel, Österreichi-sche Volksbanken AG; Vorstandsdirektor Robert Zadrazil, Unicredit Bank Austria AG.Mitglieder des KuratoriuMs: Univ.-Prof. Dr. Matthias Bank, CFA, Universität Innsbruck; Prof. Direktor Dr. Andreas R. Dombret, Deutsche Bundesbank, Frankfurt; o. Univ.-Prof. Dr. Peter Doralt, Wirtschaftsuniversität Wien; Direktor Dr. Wolfgang Feuchtmüller, Unicredit Bank Austria AG; Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard Fink, WU Wien; Dr. Erhard Fürst, Vereinigung der österreichischen Industrie; Generalsekretär Mag. Maria Geyer,
Verband österreichischer Banken und Bankiers; o. Univ.-Prof. Dr. Stefan Griller, Wirtschaftsuni-versität Wien; Univ.-Prof. Dr. Andreas Grün- bichler, Wüstenrot AG; Univ.-Doz. Dr. Heinz Handler, Wirtschaftsforschungsinstitut; Verbands-anwalt Prof. DDr. Hans Hofinger, Österreichischer Genossen schaftsverband; Direktor Mag. Andreas Ittner, OeNB; o. Univ.-Prof. Dr. Peter Jabornegg, Universität Linz; o. Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud, Universität Graz; o. Univ.-Prof. Dr. Hans Georg Koppensteiner, Universität Salzburg; Ge-neraldirektor Dr. Gernot Krenner, Volkskreditbank AG; o. Univ.-Prof. RA DDr. H. René Laurer, Wirt-schaftsuniversität Wien; Ministerialrat Mag. Alfred Lejsek, BMF; o. Univ.-Prof. Dr. Christian Nowot-ny, Wirtschaftsuniversität Wien; Generalsekretär Dr. Andreas Pangl, Raiffeisenfach verband; Vor-standsdirektor Mag. Dr. Kurt Pribil, Finanzmarkt-aufsicht; Generalsekretär KommR Dr. Erich Reb-holz, Sparkassenverband; o. Univ.-Prof. Dr. Peter Rummel, Universität Linz; o. Univ.-Prof. Dr. Klaus Schredelseker, Universität Innsbruck; Präsident o. Univ.-Prof. Dr. Gunther Tichy, Österreichische Akademie der Wissenschaften; Mag. Dr. Gertru-de Tumpel-Gugerell, Mitglied des Aufsichtsrates der ÖBB Holding AG; o. Univ.-Prof. Dr. Georg Winckler, Universität Wien; o. Univ.-Prof. Dr. Josef Zechner, Universität Wien.
geschäftsführer: Prof. (FH) Mag. Otto Lucius, Eßlingg. 17/5, A 1010 Wien, Telefon (01) 533 50 50, Fax (01) 533 50 50/33; e-mail: [email protected]
Österreichische Bankwissenschaftliche
Gesellschaft
Austrian Society for Bank Research
Die Bankwissenschaftliche Gesellschaft, 1952 von em. o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Krasensky gegründet, ist die einzige unabhängige und über- sektorale wissenschaftliche Gesellschaft im Bank-bereich in Österreich. Ihr Ziel ist die Ausein-andersetzung mit langfristigen Entwicklungen im Bankwesen, die praxisbezogene Aus- und Weiter- bildung leistungsfähiger Mitarbeiter der Ban-ken und die Forschungsförderung. Neben den drei wis senschaftlichen Abteilungen – Forum für Bankrecht, Kapitalmarktforum und Forum für Bankmanage ment – sorgt die Abteilung BanKVerlagWien für die Herausgabe des BankArchivs, der Schriftenreihen sowie von Fach-büchern, während in der Abteilung BanKaKadeMie die gesamten Aus- und Weiterbildungsaktivitäten zusammengefasst sind.
Präsident: Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank.
Mitglieder des Vorstandes: Vorstandsdirektor Dr. Johannes Attems, Oesterreichische Kontrollbank AG; Rektor Univ.-Prof. Dr. Christoph Badelt, Wirt-schaftsuniversität Wien; Generaldirektor Willibald
Walter-Haslinger-Preis
Ausschreibung
Die Walter Haslinger Privatstiftung setzt für eine hervorragende wissen-schaftliche Arbeit aus dem Bereich des Wirtschaftsrechts, insbesondere des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts und der wirtschaftsrelevanten Teile des allgemeinen Privatrechts, den Walter-Haslinger-Preis in der Höhe von € 5.000,– aus. Der Preis wird jährlich vergeben.
Teilnahmebedingungen
1. Die Bewerber(innen) dürfen das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie müssen Angehörige oder Absolventen der Universität Linz oder Salzburg oder im Bereich des OLG Linz beruflich tätig sein. Professoren österreichischer Universitäten und Mitarbeiter der Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Darüber hinaus sind Personen, welchen bereits ein Preis zuerkannt wurde, von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen.
2. Eingereicht werden können in deutscher Sprache verfasste rechtswissen-schaftliche unveröffentlichte Arbeiten und solche, deren Veröffentlichung nach dem 1. Juli 2011 erfolgt ist. Bei Dissertationen / Diplomarbeiten gilt der gleiche Termin für deren Approbation.
3. Die Arbeit muss bis spätestens 30. Juni 2012 bei der Walter Haslinger Privatstiftung, 4020 Linz, Roseggerstraße 58, im verschlossenen Umschlag einlangen. Der eingereichten Arbeit ist ein kurzer Lebenslauf der Ver-fasserin / des Verfassers beizulegen; etwaige akademische Zeugnisse, die für die Arbeit erteilt wurden, sind bekanntzugeben. Sollte die Arbeit bereits bei anderen Institutionen, welche Preise stiften, eingereicht oder prämiert worden sein, ist dies im Bewerbungsschreiben mitzuteilen.
4. Über die Zuerkennung des Preises entscheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des Kuratoriums. Der Preis kann unter mehreren AutorInnen ge-teilt werden. Mangels preiswürdiger Arbeiten kann die Vergabe ausgesetzt werden. Die Entscheidung der Stiftungsorgane ist endgültig und unterliegt keinerlei Anfechtung, insbesondere auch nicht vor Gericht.

Die neue eBanking app
Mitten im Leben.www.bawagpsk.com
Mitten iM leBen hat ein konto eine fernBeDienung.
Gratiszu ihrer
Kontobox!
Die Bank zum Mitnehmen.Mit der neuen eBanking App der BAWAG P.S.K. erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte jederzeit bequem und sicher vom Smartphone aus. Einfach kostenlos im Android Market oder im iTunes Store downloaden.
QR-Code scannen – App direkt downloaden!

P.b.b. Erscheinungsort Wien – Verlagspostamt 1210 Wien – Plus.Zeitung 12Z039232 P