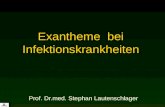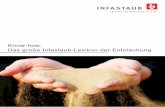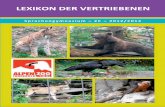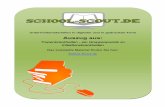Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen || Citrobacter
Transcript of Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen || Citrobacter

169Citrobacter
C
Principles and Practice of Infectious Diseases (PPID) on-line, 2239–2255
9. Stephens RS, Kalman S, Lammel C, Fan J, Marathe R, Aravind L, Mitchell W, Olinger L, Tatusov RL, Zhao Q, Koonin EV, Davis RW (1998) Genome sequence of an obligate intracellular pathogen of humans: Chlamydia trachomatis. Science 282:754–759
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Chlamydia psittaci
Cholangitis
Ascaris lumbricoides Bacteroides Echinokokken Escherichia coliFasciola hepatica
Cholera
Vibrio
Cholezystitis
Bacteroides BilophilaClostridien der GasbrandgruppeEnterobacterEscherichia coliMikrosporidienSalmonella
Chorioretinitis
CandidaCytomegalievirusHerpes-simplex-Virus (HSV)Onchocerca volvulusVaricella-zoster-Virus (VZV)
Chryseobacterium spp.
Flavobacterium
Chrysomyia spp.
Myiasis-Erreger
Cimex spp.
Ektoparasiten, sonstige (Stechmücken, Trombiculi-den, Flöhe, Wanzen, Zecken)
Citrobacter
Uwe UllmannErreger
Erregerspezies
Citrobacter freundii, (C. freundii-Komplex mit 8 Spe-zies), C. coseri, C. amalonaticus
Taxonomie
Familie: Enterobacteriaceae; Gattung: Citrobacter: Spezies: Citrobacter freundii
Historie
Erstbeschreibung durch Werkmann und Gill 1932: Bacteria producing trimethylene glycol. J Bacteriol 1932, 23:167–182. Der Name leitet sich ab von Citrus (Zitrone), Bacter (griech.: Stäbchen).
Morphologie
Gramnegative Stäbchenbakterien, 1,0 μm im Durch-messer und 2,0–6,0 μm Länge. Beweglich durch peri-triche Begeißelung.
Pathogenität / Virulenz / Antigenvariabilität
Von C. freundii wurden hitzelabile und hitzestabile Enterotoxine beschrieben. Die Wirkungsweise der Enterotoxine ist jedoch noch nicht so gut erforscht wie bei E. coli-Endotoxin. Bei C. diversus, der bei Pa-tienten mit Meningitis isoliert wurde, wurde ein äu-ßeres Membranprotein beobachtet, das bei anderen Citrobacter-Stämmen nicht vorhanden ist.
Erkrankungen
1. Lokalisierte Prozesse
In warmen Klimazonen, sporadisch bei kleinen Kin-dern Diarrhoe, Erreger von Harnwegsinfektionen (selten), Wundinfektionen, Infektionen des Respirati-onstraktes, Meningitis, Otitis; C. koseri ist ein häufi-ger Erreger von Meningitiden und Hirnabszessen bei Neugeborenen.
2. Generalisierte Erkrankungen
Durch Einschwemmen von Citrobacter sp. in die Blut-bahn kann es zur Sepsis und extrem selten zur Endo-karditis kommen.
Diagnostik
Untersuchungsmaterial
Enterobacter.

170 Clonorchiasis
Diagnostische VerfahrenKulturelle Anzüchtung: fakultativ pathogene E. coli. (Escherichia coli).Biochemische Differenzierung:
Citrat kann als alleinige Kohlenstoffquelle verwer-tet werden.
Nitrat wird zu Nitrit reduziert. Glucose wird abgebaut zu Säure und Gas. Methylrotreaktion ist positiv. Anwesenheit von Betagalaktosidase. Fermentation von Arabinose, Zellobiose, Maltose,
L-Rhamnose, Trehalose, D-Xylose, D-Mannit, D-Sorbit, Glycerol.
H2S-Bildung durch C. freundii
Serologische Differenzierung: bei C. freundii können 42 O- und mehr als 90 H-Antigene unterschieden werden.
Therapie
Therapeutische MaßnahmenMehrfach-resistente Stämme werden beobachtet. Die Therapie entsprechend dem Antibiogramm wird empfohlen. Wirksam sind häufig Ureidopenicilline, Cefotaxim, Cefmenoxim, Ceftriaxon, Carbapeneme, Chinolone und Aminoglykoside.
Epidemiologie
VerbreitungEine epidemische Ausbreitung von Citrobacter sp. im Rahmen von nosokomialen Infektionen wurde bisher nicht beobachtet.
Wirtsbereich / ReservoirAngehörige des Genus Citrobacter finden sich in Fae-zes von Menschen und Tieren, sie werden auch aus Wasser, Abwasser und Abfall isoliert.
RisikogruppenSäuglinge, Immunsupprimierte, Karzinom- und Transplantationspatienten.
Transmission / VektorenCitrobacter spp. werden durch direkten Kontakt oder auch indirekt über Gegenstände oder Lebensmittel übertragen.
Prävention / Impfstoffefakultativ pathogene E. coli (Escherichia coli).
Meldepflicht§ 23 IfSG Abs. 1: Multiresistenz ist zu dokumentieren.
Weiterführende Informationen
Web-Adressen www.cdc.gov/
Schlüsselliteratur1. Blaser MJ, Smith PhD, Ravdin JI, Greenberg HB, Guer-
rant RL (1995) (eds) Infections of the Gastrointestinal Tract. Raven Press, New York
2. Hahn H, Falke D, Kaufmann SHE, Ullmann U (Hrsg) (2005) Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie. 5. Aufl. Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York
3. Kist M, Bockemühl J, Aleksic S, Altwegg M, Autenrieth IB, Bär W, Beutin L, Gerten B, Heintschel von Heinegg E, Karch H, Lehmacher A, Mehnert F, Sonnenborn U, Tschäpe H, v. Eichel-Streiber C (2000) Infektionen des Darmes: MiQ 9. Urban und Fischer, München, Jena
4. Konemann EW, Allen HD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC (eds) (1997) Diagnostic Microbiology, 5th edn. Lippincott, Philadelphia, New York
5. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds) Mandell, Doug-las, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th edn. Churchill-Livingstone, Philadelphia
Clonorchiasis
Leberegel - Opisthorchis, Clonorchis
Clonorchis sinensis
Leberegel - Opisthorchis, Clonorchis
Clostridien der Gasbrand-Gruppe
Heidi Schütt-GerowittErreger
Synonym(e)Gasbranderreger, Welch-Fraenkel-„Bazillus“ (C. per-fringens = C. welchii), Prarauschbrand-„Bazillus“ (= C. septicum)
ErregerspeziesClostridium perfringens, C. septicum, C. histolyticum, C. novyi sowie einige andere Clostridien-Arten
TaxonomieFamilie: Bacillaceae; Gattung Clostridium (anaerob)
HistorieBereits im Altertum wurde das Krankheitsbild Gas-brand von Hippokrates u. a. beschrieben und auch aus dem Mittelalter liegen Berichte darüber vor. Eine exakte Beschreibung des klinischen Bildes stammt aus der Zeit des Krimkrieges von Pirogoff. 1892 fan-den Welch und Nuttal in den Blutgefäßen Verstorbe-ner grampositive, gasbildende Stäbchen, die sich schnell vermehrten. Welch und Flexner erkannten 1896 die ätiologische Bedeutung dieses Erregers für das Krankheitsbild des Gasbrandes. Die mikrobiolo-gische Erstbeschreibung von C. perfringens erfolgte 1898 durch Veillon und Zuber. Vor der antiseptischen Ära war das Krankheitsbild auch unter der Bezeich-nung Hospitalbrand bekannt und gefürchtet. Zum