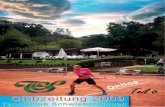Medien und Formen der Wissenschaftsvermittlung (XVII. Symposium der „Gesellschaft für...
Transcript of Medien und Formen der Wissenschaftsvermittlung (XVII. Symposium der „Gesellschaft für...

BerWissGesch 3, 1-6 (1980)
Medien und Formen der Wissenschaftsvermittlung
Berichtezur WISSENSCHAFTSGESCHICHTE c Akademische Ycrlagsgcscllschaft 1980
(XVII. Symposium der "Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte", 24.-26. Mai 1979 im Clubhaus der Freien Universität Berlin) Ansprache des Präsidenten bei der Eröffnung des XVII. Symposiums
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
"Medien und Formen der Wissenschaftsvermittlung" ist das Generalthema des diesjährigen Symposiums der ,Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte', zu dem ich Sie hier im Clubhaus der Freien Universität herzlich willkommen heiße. Den Intensionen unserer Gesellschaft entsprechend, soll hierin versucht werden, auch diese übergreifende allgemeine Problematik des Wissenschaftsbetriebes in interdisziplinär möglichst großer Breite von der Geschichte der Wissenschaft( en) her schlaglichtartig zu beleuchten, um - wenn möglich - überdisziplinäre Einsichten in den Vorgang Wissenschaft und Forschung zu erlangen.
Damit gar nicht erst falsche Erwartungen entstehen, bedarf das Generalthema einiger Erläuterungen. Es meint nicht: Popularisierung der Wissenschaften; und auch die Mittel und Wege der Vermittlung innerhalb der Wissenschaftlergemeinschaft (scientific community) bilden nicht das eigentliche Thema wenn auch oft davon die Rede sein wird. Die in mehreren V argesprächen innerhalb des Vorbereitungsausschusses (Rolf Winau, Richard Toellner, Fritz Krafft) und mit den Referenten vertiefte Intension ist vielmehr, zu untersuchen, ob und wie die "Medien und Formen" der Wissens- beziehungsweise Wissenschaftsvermittlung dieses Wissen oder die Wissenschaft( en) selbst prägen - oder ob und wie das zu vermittelnde Wissen und die zu vermittelnde Wissenschaft ihrerseits die Vermittlungsformen und die vermittelnden Medien bestimmend verändern. Dabei soll unter ,Wissen' jeweils begründetes und gerechtfertigtes Wissen, also wissenschaftliche Erkenntnis(se) verstanden sein.
Obgleich eine ,Begründung' und ,Rechtfertigung' nicht ohne ,Sprache' im eigentlichen Sinne, ohne die das Denken prägende und von ihm als ,Werkzeug' benutzte menschliche Sprache, möglich ist, kann alllerdings das grundlegende Problem einer Bedingtheit von Wissenschaft durch diese oder eine solche Sprache ebensowenig im Rahmen dieses wissenschaftshistorischen Symposiums behandelt werden wie der (wechselseitige) Einfluß von Wissenschaft, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungsmitteln auf die ,nicht-wissenschaftliche(n)' Sprache(n) und ihren begrifflichen Inhalt. Fragen wie diese, ob es die griechische Sprache gewesen ist, die ,Wissenschaft' gerade im klassischen Griechenland entstehen ließ; ob es an der klassischen lateinischen Sprache lag, daß die Naturwissenschaften sich bei den Römern über eine mehr enzyldopädische Rezeption hinaus nicht erheben konnten, und welche (wodurch bedingte) Veränderungen sie dann erfahren mußte, um in der Spätrenaissance (gemeinsam mit den ,Volkssprachen') das Entstehen neuzeitlicher Naturwissenschaft mitbedingen zu können; ob nationale Unterschiede im

2 Fritz Krafft
Bereich der Wissenschaften durch die jeweilige ,Sprache' bedingt waren (sind) und ob das Vordringen des Englischen als ,Wissenschaftssprache' und der Anglisierung der Begriffe (und Syntax) in andere nationale Wissenschaftssprachen deshalb nicht durch das Abschneiden der sich in den Sprach- und (Denk-) Strukturen unterschiedlich niederschlagenden verschiedenartigen Einflüsse, welche die jeweiligen Denk- und Erfahrungsweisen (und aufgrund unterschiedlicher ,Wortfelder' auch die ,Erfahrungen') mit bedingen und bestimmen, zwar die Verständigungsbasis (Intersubjektivität) erweitert, aber gleichzeitig auch die Erfahrungsmöglichkeiten einengt und die Wissenschaften verarmen läßt - sind nämlich bisher noch nicht einmal ernstlich gestellt, geschweige denn auch nur in Details beantwortet worden. Mir scheint es aber so, als ob die Erfahrungsmöglichkeiten etwa in den exakten Erfahrungswissenschaften nicht nur durch die mathematischen Formalismen und die (ihrerseits hierdurch bedingten) instrumentellen Vermittler zwischen Objekt und Subjekt, die alle nicht durch sie erfaßbaren Erfahrungsweisen ausschließen und als nicht gegeben hinstellen, zunehmend eingeschränkt wurden.
Der von der Antike bis in die frühe Neuzeit währende Streit um den Erkenntniswert der Erfahrung in der Naturwissenschaft, der nur durch Ausschaltung der Unterschiede der individuellen, subjektiven Erfahrungsweisen und -bedingungen einerseits durch ,Abstraktion' und andererseits durch ,Instrumentalisierung' des Denkens und Erfahrens positiv entschieden werden konnte, zeigt gleichzeitig, welche Erfahrungsverluste mit dieser Abstrahierung seit dem frühen 17. Jahrhundert in der Form der Idealisierung und Instrumentalisierung verbunden sind - die andererseits aber flir die damit erfaßbaren (immer enger werdenden) Erfahrungsbereiche gerrauere Erkenntnisse erbringen, ohne die unsere technisch-wirtschaftliche Zivilisation nicht mehr denkbar wäre: Wir wissen über immer Weniger immer mehr; neben dem Blick flir das Ganze ging durch die unter diesen Gesichtspunkten notwendige Spezialisierung seit der frühen Neuzeit auch der überblick über die besser denn je durchschauten Details mehr und mehr verloren- und das beginnt langsam, sich zu rächen.
Die Kommunikation mit den Objekten auf experimenteller Basis hat zwar (meßbare) Erfahrungsbereiche erschlossen, die den menschlichen Sinnen nicht ohne Hilfsmittel (Teleskop, Mikroskop) oder prinzipiell nicht zugänglich sind (elektromagnetisches Spektrum beiderseits des ,sichtbaren Lichtes'), sie hat aber dadurch die Erfahrung gleichzeitig (weitestgehend) auf das Zählbare und Meßbare (zähl- und meßbar Gemachte) beschränkt - und damit auch die Wissenschaften, welche diese ,Erfahrungsdaten' systematisch zusammenfassen. -Das kann nicht deutlich genug flir alle diejenigen Wissenschaften gemacht werden, die sich in einer Mathematisierung und Quantifizierung das Heil und den Erfolg versprechen, den die weitestgehend abstrakten exakten Naturwissenschaften nicht nur in ihren Augen damit erreicht haben.
In diesen wird man sich der Grenzen, zumindest aber der Gefahren jedoch immer bewußter. Ein unvoreingenommener Zugang zum Objekt ist hier schon deshalb nicht mehr möglich, weil die Apparaturen einerseits zu kompliziert und andererseits zu kostspielig geworden sind. Die Zeiten, in denen sich jeder Experimentator - anfangs mit eigenen oder der Person dazu von anderer privater Seite zur VerfUgung gestellten, später mit staatlichen Mitteln seine Gerätschaft individuell selber konstruierte und meist auch baute, sind mit dem Wachsen der Ansprüche und dann jeweils nach der ,probelnden' Basteiphase der Anfänge rasch durch solche ersetzt worden, in denen einerseits die Notwendigkeit in der Funktion gleicher Geräte und Apparaturen (anfangs erreicht durch den Nachbau aufgrund einer ,Versuchsbeschreibung', häufig mit Abbildungen, dann nach Patenterteilung oder eigener Entwicklung durch billigere Mehrfach- oder Massenherstellung in darauf spezialisierten Manufaktur- und Industriebetrieben was auch fi.ir chemische Reagenzien gilt) und in denen andererseits die Größe und Kompliziertheit der Apparaturen und die Aufwendungen, die häufig flir ihren (stationären) Bau oder (mo-

Medien und Formen der Wissenschaftsvermittlung 3
bilen) Einsatz nötig sind, den experimentellen Forscher (aber etwa auch den behandelnden Arzt) in wachsende Abhängigkeiten gebracht hat, die ihn weitgehend von außen beeinflußbar und lenkbar gemacht haben, insofern er (zwar gelegentlich noch vorschlagen, jedoch) nicht mehr selber bestimmen kann, was er erforschen (behandeln) und wie er dabei vorgehen will. Aber nicht nur die Kommerzialisierung und Spezialisierung im Gerätebau, die den Benutzer vom Konstrukteur und Erbauer trennten und ihm durch diese (und seine Geldgeber) vorschreiben läßt, wie er in welchem Bereich vorzugehen hat, sondern auch die durch die jeweils ältere Physik (Chemie usw.) bedingte, in das Gerät ,determinierend' eingehende Technologie, die als eine besondere Art indirekter ,Wissenschaftsvermittlung' nur ein Weiterschreiten auf dem vorher bestimmten und bereits seit langem eingeschlagenen Weg ermöglicht, verengt die Erfahrungsmöglichkeiten stark. Die Phantasie wird weitgehend ausgeschaltet; und, um es etwas überspitzt zu formulieren, ,wissenschaftliche Revolutionen', wie wir sie zuletzt durch Albert Einstein erlebt haben, sind wegen der in die jetzigen Erfahrungswissenschaften investierten Finanzmittel eigentlich nicht mehr zu verantworten.
Aber man sollte sich davor hüten, derartige Einflußnahmen nur im Bereich der sogenannten (exakten) Erfahrungswissenschaften anzusetzen. Ein wichtiges, von diesen und anfangs flir diese entwickeltes Hilfsmittel hat inzwischen nicht nur viele Lebensbereiche des Menschen, sondern auch zahlreiche Bereiche anderer Wissenschaften erfaßt. Ich spreche von der Elektronischen Datenverarbeitung mittels Computer (EDV). Da, wo es den Einzelnen selber betrifft, wo er vom komplexen Individuum zwangsweise zur abstrakten Nummer degradiert wird, über die, von ihm unkontrollierbar und durch ihm Unbekannte und ihn nicht Kennende, numerische Daten gespeichert und abgerufen werden, sieht er -je nach Erfahrung auch den Fluch neben dem angeblichen Segen der Anwendung dieser Erfindung, und er sieht die durch die Arbeitsweise und Kapazität des Gerätes bedingte ,Voreingenommenheit' ihm selbst gegenüber. Vielleicht machen solche individuellen Erfahrungen deutlicher, was ich oben flir den Bereich der experimentellen Erfahrungswissenschaften angesprochen habe.
Inzwischen sind Elektronische Datenspeicher aber auch in zunehmendem Maße "Medien der Wissen(schaft)svermittlung" geworden: Die Flut der wissenschaftlichen Literatur mit ihren steigenden Zuwachsraten (Monographien, Dissertationen, Zeitschriftenaufsätze) hat schon frühzeitig auswählend zusammenfassende "Wissenschaftsvermittler" in Form von enzyklopädischen oder monographischen Kompendien hervorgebracht, in denen die vermittelte Wissenschaft (das vermittelte Wissen) jeweils stark durch die Sehweise des (der) Autoren auch selektiv geprägt wurde. Der immense quantitative Zuwachs der Literatur insbesondere seit den letzten hundert Jahren hat das Entstehen solcher Kompendien und Handbücher immer mehr verzögert und in der Aktualität immer schneller überholt. Die Zeitschriftenliteratur nicht nur alter traditionsreicher Wissenschaften, sondern auch neu entstandener, junger Disziplinen nachdem sie sich einmal durch die Gründung einer Spezialzeitschrift als ,reif' erwiesen haben -hatte außerdem jeweils rasch einen Umfang und eine nicht nur damit verbundene Unübersichtlichkeit erhalten, der nur durch eine neue wissenschaftliche Literaturgattung Abhilfe geschaffen werden konnte, durch das Referateorgan, das in vielen Disziplinen bereits durch sogenannte ,Abstracts' ersetzt wurde, um noch einigermaßen Aktualität wahren zu können wobei häufig bereits in den Referateorganen aus demselben Grunde Fremdreferate durch Autoreferate ersetzt werden, so daß auch die filternde Wertung durch die ,scientific community' (in Gestalt des Kompendien-, Handbuch-, Forschungsberichts- oder Referateschreibers) ganz verloren geht.
Bibliographien, Forschungsberichte, Referateorgane, ,Abstracts' treten so zunehmend an die Stelle der wissenschaftlichen Literatur selber als deren ,Vermittler' - schon weil diese einerseits aus Finanz- und Platzgründen am Orte des Wissenschaftlers nicht selber

4 Fritz Krafft
vollständig zugänglich sein, aber auch weil sie wegen des Umfangs von ihm nicht mehr selber überschaut, geschweige denn gelesen werden kann. Sie enthalten aber wenigstens eine mehr oder weniger kritische Inhalts- und Ergebnisdarstellung durch jeweilige Fachvertreter. Die mit dieser Art der ,Vermittlung' verknüpfte Vorauswahl durch andere, aber weigehend fachverbundene Personen erhält in der Regel durch die jeweilige Systematik (Klassifikation) der Anordnung der Referate oder ,Abstracts' und ihre Zuordnung zu bestimmten größeren oder kleineren Unterabteilungen - zumal eine Mehrfachnennung meist unterlassen wird - ftir Cien Benutzer eine weitere Einengung, die nicht eigenen Vorstellungen vom Umfang seines Arbeitsgebietes entwachsen ist.
Besonders gefährlich wird diese nicht vom Wissenschaftler ftir sich selber vorgenommene Abgrenzung im Rahmen der zur Wiedererlangung der Aktualität eingeleiteten, inzwischen aber sich selbständig weiterentwickelnden bloßen Titelerschließung mittels EDVAnlagen. Soll diese Art der Vermittlung einen Sinn behalten, so müssen die ,Titel' statt der Inahltsangaben (Referate, ,Abstracts') durch ,Schlagwörter' erschlossen werden, die von einem mehr oder weniger fachfremden ,Bearbeiter' im einfachsten Fall dem Titel selbst, im aufwendigsten Fall dem Text der Arbeit entnommen werden. Damit eine so erstellte Schlagwortsammlung benutzbar (,abrufbar') wird, muß sie auf EDV-gemäß klassifikatorisch vereinheitlichte Begriffe reduziert werden - wobei die Klassifikationsschemata und -elemente den Wandlungen der Wissenschaften und ihrer Begrifflichkeit entweder nach und nach angepaßt werden (ohne daß der Zeitpunkt der ,Anpassung', das heißt Änderung, bekannt gegeben und mittels Transformationsprogrammen nachträglich ftir ältere Systeme aufgehoben werden können soll) oder beibehalten werden können (was Stagnation und Festschreibung zur Folge hätte). Die Gefahren, die hierin insbesondere ftir die Geisteswissenschaften liegen, kann man sich leicht ausmalen. Sie müssen im Gegensatz zu Medizin, Technik und exakten Naturwissenschaften als den wohlhabenden (,nutzbringenden') Wissenschaften als ,arme Wissenschaften' zwar noch weitgehend auf dieses kostenaufwendige ,Hilfsmittel' verzichten, werden aber durch staatliche Unterstützung über kurz oder lang auch diesen ,Segen' empfangen (müssen).
Das mag als aktueller Bezug unserer historischen Betrachtung der Arten und Möglichkeiten einer Einflußnahme der Formen und Medien der Wissen(schaft)svermittlung auf Inhalt, Methode und Form der Wissenschaften selbst genügen. Dabei muß die Frage, ob die Wissenschaft(en) die ihr angemessenen Vermittlungsformen und-medienjeweils nach sich ziehen oder diese die Wissenschaften entsprechend formen, vorerst offen bleiben. Häufig wird es wohl zu einer Wechselwirkung gekommen sein, zumindest nachdem die eine Seite ein entsprechendes ,Bedürfnis' erweckt oder Neuland erschlossen hatte. Letzteres trifft sicherlich in vielen Fällen der Anwendung von technischen Verfahren und Geräten zu, wenn Bilder, Kurven und Graphen ganz neue Vorstellungsformen erfordern, die im herkömmlichen Sinne unanschaulich sind - wir werden hierüber einiges aus der Medizin kennen lernen. Andererseits scheint das Entstehen von wissenschaftlichen Zeitschriften mehr einem Bedürfnis der Spezialisierung (Atomisierung) der Wissenschaften und innerhalb der Wissenschaften und ihrer Disziplinen in der frühen Neuzeit und dem damit verbundenen Selbstbewußtsein des einzelnen Wissenschaftlers entsprochen zu haben, als nachdem nach dem aristotelisch-scholastischen auch das cartesische ,System' in Auflösung begriffen war- die Detailuntersuchung nicht mehr eine Ergänzung und Vervollständigung des (vorgegebenen) Ganzen bedeutete, sondern lediglich ein Steinehen zu einem zukünftig daraus vielleicht zusammenzusetzenden Mosaik bildete, ftir das einerseits auch die Priorität beansprucht, andererseits aber auch der Charakter der Vorläufigkeit der Mitteilung gewahrt bleiben und die Möglichkeit der Weiterführung durch andere ,Spezialisten' gegeben sein sollte.
Hierzu hatten vor dem Entstehen der ersten wissenschaftlichen Zeitschriften (Periodika) Briefe gedient, wobei sich zwei besondere Formen der brieflichen Kommunikation

Medien und Formen der Wissenschaftsvermittlung 5
entwickelten: der gedruckte, ,offene' Brief (Georg Joachlm Rhetikus' ,Narratio prima' von 1540 und Galileo Galileis ,Nuncius sidereus' von 1610 seien als extreme Beispiele genannt, die aber etwa schon in mathematischen ,Schriften' des Arehirnedes ihre Vorläufer hatten) und die ,Kommunikationszentrale', wie sie im 17. Jahrhundert etwa Marin Mersenne, Athanasius Kirchner und Henry Oldenburg (als Sekretär der Royal Society) bildeten, die angeschrieben wurden, damit sie die brieflichen Informationen zur Prüfung und Information an andere Korrespondenten weitergaben. Die ,Philosophlcal Transactions' der Royal Society haben lange diesen Charakter beibehalten; und auch in anderen, später entstandenen Zeitschriften bildeten lange Zeit ,Briefe an den Herausgeber' einen vorwiegenden Teil der Beiträge.
Daß diese Form des ,Zeitschriftenaufsatzes' als rasch veröffentlichte (kurze) ,Zuschrift' gegenwärtig immer häufiger wieder auftritt, beruht sicherlich nicht auf einem nostalgischen Anliegen, sondern geschieht vorwiegend, um Anregungen, Kritik und Forschungsergebnisse möglichst rasch der Wissenschaftlergemeinschaft des betreffenden Fachgebietes bekannt zu machen; denn die Zeitspannen flir die Drucklegung von Büchern und das Erscheinen von Zeitschriftenaufsätzen haben sich im Vergleich zu den ersten Jahrhunderten des Buchdrucks und auch zum 19. und beginnenden 20. Jahrhundert inzwischen trotz aller ,Revolutionen' der Satz- und Drucktechniken ftir die demgegenüber wachsende Schnellebigkeit der Wissenschaften allzusehr verlängert. Solche ,Zuschriften' umgehen zumindest den Teil des Verzögerungsfaktors, der aus der ,filternden' Beurteilung durch Herausgebergremien und Lektoren resultiert.
Aber auch bei anderen Kommunikationsarten geht die Wissenschaft wieder mehr auf die Urformen zurück, etwa auf den unmittelbaren Kontakt der Wissenschaftler im Gespräch weniger auf repräsentativen Mammutkongressen, die sich als innerwissenschaftliches Kommunikationsmittel überlebt haben, als auf kleinen Expertenkolloquien und -symposien, durch das persönliche Aufsuchen des Kommunikationspartners, auch über Kontinente hinweg, und das Telephonat, welche Formen die briefliche Korrespondenz als Telekommunikationsmittel weitgehend verdrängt haben (zum Leidwesen des Historikers, dem dadurch weniger Material ftir Einblicke in die kommunikative Verpflechtung einer Wissenschaftlergemeinschaft erhalten bleibt). Der Brief, ,offene' Brief, lebt aber als Möglichkeit, Publikationsverzögerungen zu umgehen oder die Spezialistengemeinschaft rasch und vorläufig zu informieren, in den ,Preprints' und zur Diskussion gestellten ,vorläufigen Fassungen' wieder auf, zu deren Entstehen die neuen Kopier-und Vervielfaltigungsverfahren beigetragen haben. Auch helfen sich manche größere Institute mit PreprintSerien und ,Newsletters' über die Misere der Publikationsverzögerungen hinweg - damit aber auch den Charakter der Vorläufigkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse, die leicht ,vorschnell' mitgeteilt werden, wieder in den Vordergrund stellend.
Wieweit haben nun diese und andere, vor- und außerwissenschaftliche Literaturformen als von den Wissenschaften übernommene Medien die Wissenschaften auch inhaltlich und methodisch beeinflußt: Epos - Lehrgedicht, Prosa wie Erzählung und Dialog, Kommentar und Glosse, Enzyklopädie? Hatte der Übergang von der handschriftlichen Vervielfältigung zum Buchdruck nur die quantitative Folge, daß Wissen und Wissenschaft größeren Kreisen zugänglich wurden (was sicherlich seinerseits nicht ohne Einfluß auf die Wissenschaft geblieben ist), oder ftihrte er auch zu einer mit der garantiert identischen Wiedergabe (auch und besonders von Abbildungen, die daraufhin einen anderen - auch einen naturalistischen - Charakter annehmen konnten) verbundenen Fixierung im positivem (größere gemeinsame Basis als Ausgangspunkt) oder negativem Sinne (Stagnation, Festhalten an Altem, Festschreibung)? Hat die Erschließung neuer Wahrnehmungsebenen (Mikroskop, Teleskop, Elektronenmikroskop, Radioteleskop; Photographle, Kinematographie mit Zeitlupe und Zeitraffer usw.) neue Wissenschaften entstehen lasen und alte gewandelt, und kann mit dem Zuwachs an Einsichten und Vermittlungsformen und

6 Fritz Krafft
-medien auch ein Verlust an ,Wissenschaft' verbunden sein? Welchen Einfluß haben Formalisierungen der Erkenntnis- und Vermittlungssprachen und ,Maschinensprachen' auf Inhalt und Methode der Wissenschaften genommen? Das sind nur einige der Fragen, zu denen wir uns von den Beiträgen und Diskussionen auf diesem Symposium Teilantworten erhoffen - ohne den Anspruch erheben zu können, mit den in den nächsten beiden Tagen angesprochenen Fragen sämtliche Aspekte des mit dem Generalthema "Medien und Formen der Wissenschaftsvermittlung" verbundenen Problemkreises auch nur zu berühren.
(Die Durchftihrung des Symposiums wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziell unterstützt. Dank gebührt auch dem Berliner Senator für Wissenschaft und Forschung, der durch einen Zuschuß jüngeren angehenden Wissenschaftshistorikern die Teilnahme erleichterte. Der Beitrag "Glosse - Expositio - Quaestio: Zur Form und Entwicklung des Philosophischen Kommentars im Mittelalter" von Christoph Heitmann, München, wurde leider nicht zum Druck eingereicht. Ergänzt werden die überarbeiteten Beiträge des Symposiums hier durch eine Untersuchung von Franz Stuhlhofer, Wien, über "Strukturen der wissenschatlichen Betätigung und das zeitlich exponentielle Wachstum der neuzeitlichen Naturwissenschaft".)
Prof. Dr. Fritz Krafft Johannes Gutenberg-Universität Fachbereich Mathematik, Arbeitsgruppe für Geschichte der Naturwissenschaften Saarstraße 21 D-6500 Mainz