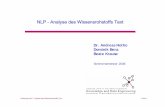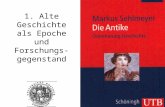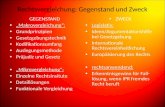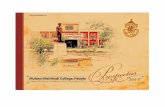Modi der Weltbegegnung als Gegenstand fachdidaktischer Analysen
Transcript of Modi der Weltbegegnung als Gegenstand fachdidaktischer Analysen

249
Bemhard Dressler
Modi der Weltbegegnung als Gegenstand fachdidaktischer Analysen l
Abstract
Die modeme Bildungsidee ist als Reaktion auf die funktionale Ausdifferenzierung unterschiedlicher kultureller Wertsphären, Rationalitätsmuster und Praxisformen zu verstehen. Entsprechend liegen dem Fächerkanon der Schule unterschiedliche "Modi der Weltbegegnung" zugrunde, die nicht wechselseitig substituierbar und auch nicht nach Geltungshierarchien zu ordnen sind. Das schulische Curriculum kann nicht mehr auf einem materialen Kanon von Lemgegenständen aufbauen. Für die Kohärenz der Weltzugänge haben die lernenden Subjekte aufzukommen, ohne dafür über eine einheitswissenschaftliche Perspektive verfügen zu können. Das in allen Fächern anzustrebende Lernziel ist "Differenzkompetenz".
The modem "Bildung" concept has developed in response to the diversification of cultural values, concepts of rationality and practical models. Correspondingly, school curricula are based on different ways ofknowledge or cognition, which are neither mutuaUy interchangeable nor can they be judged in order ofmerit or validity. School curricula can no longer be defined in a pure1y material sense, reducing the process of learning to the facts. In the absence of a universally valid scientific approach, the student is required to address each subject within its own context, supplying the neccessary ideological coherence hirnself, the aim being to acquire "differential skills" in all subjects.
1 PISA und die Differenz der Weltzugänge
Für die gegenwärtige Hochkonjunktur des Bildungsthemas ist nicht zuletzt die PISAStudie verantwortlich. Dafür, dass unter dem falschen Etikett der Bildung zumeist etwas völlig anderes verhandelt wird, nämlich die Frage nach der Konkurrenzfahigkeit des Wirtschafts standorts Deutschland und nach der Effektivierung der Kosten-NutzenBilanz von Bildungsinstitutionen - dafür ist PISA nicht verantwortlich zu machen. Dennoch hat PISA bei kritischen Pädagogen keinen guten Ruf. Der Vorwurf ist zu hören, die PISA-Studie folge einem unzureichenden Konzept von Allgemeinbildung, weil sie den Anspruch erhebe, die wesentlichen Erwartungen an schulische Bildungsprozesse ließen sich mit dem Ziel ihrer messtechnischen Erfassung operationalisieren. Darüber würden dann didaktische, bildungstheoretische und schultheoretische Problemstellungen vernachlässigt? Ohne diesen Aspekt an dieser Stelle vertiefen zu können, ist doch festzustellen, dass keine empirische Untersuchung die in bildungstheoretischen Diskussionen
Referat vor der 40. Tagung für Didaktik der Mathematik in Osnabrück am 08. 03. 2006. Der Vortragsduktus wurde beibehalten. Vgl. Benner, Dietrich [2002].
(JMD 28 (2007) H. 3/4, S. 249-262)

250 Bernhard Dressler
anzustrebende normative Verständigung darüber ersetzen kann, was an den Schulen gelernt und was nicht gelernt werden soll. In dieser Diskussion können gar nicht nur empirische Gründe gelten, weil normative Entscheidungen immer auch eine kontrafaktische Dimension haben. Aber dass überhaupt Vorschläge zur "bildungstheoretischen Rahmung" von PISA sinnvoll möglich sind, zeigt die nicht gering zu schätzende, theoriegeschichtlich m. E. vorbildlose Anschlussfahigkeit von PISA (und damit von empirischevaluativen Fragestellungen) an bildungstheoretische Diskurse. Nun erst lässt sich die alte Forderung Heinrich Roths nach einer "empirischen Wendung" der Pädagogik realisieren, ohne dafür bildungstheoretische Ansprüche zu verspielen.
Woran liegt das? Ich halte zwei Gründe für die bildungstheoretische Bedeutung von PISA für maßgeblich, die m. E. in der öffentlichen Debatte eine viel zu geringe Rolle spielen.3 Da ist erstens der zugrunde liegende Begriff von Kompetenz. Er unterscheidet sich, jedenfalls auf den zweiten Blick, fundamental von jenen Qualifikationen, auf die in den I 970er Jahren die Curriculumtheorie abzielte, die nicht zuletzt an ihrem technokratischen Anspruch scheiterte, schulische Lernziele prognostisch aus gesellschaftlichen Bedarfsanalysen herleiten und dann lernprozesslieh operationalisieren zu können. Bei aller handlungspraktischen (und damit von einem verschwiemelten Bildungsidealismus unterschiedenen) Akzentuierung ist der Kompetenzbegrift nicht an außerschulischen Verwertungssituationen und darauf ausgerichteten Qualifikationen orientiert, sondern an den spezifischen Rationalitätsmustern der schulischen Fächer und ihrer jeweiligen wissenschaftlichen "Domänen", und zwar anwendungspraktisch vermittelt mit lebensweltlichen Gebrauchskontexten. Ein Blick auf die Aufgabenstellungen von PISA zeigt das sofort. Anders gesagt: Das "literacy"-Konzept von PISA, das Konzept nämlich, Welterschließung und Weltverständnis als die Fähigkeit zu verstehen, die Welt auf unterschiedliche Weise lesen zu können und damit zugleich die Welt unter dem Aspekt ihrer "Lesbarkeit" zu erschließen5
- dieses "literacy"-Konzept zielt auf fachlich gegründete Kompetenzen bei den lernenden Subjekten und nicht auf prognostisch ermittelte Qualifikationserfordernisse der Gesellschaft. Die mit den unterschiedlichen "Lesarten" der Welt verbundene je spezifische Modellierung von Wirklichkeit wird dabei an ihr jeweils gemäßen Praxisformen erprobt.
Damit bin ich beim zweiten wesentlichen bildungstheoretischen Aspekt von PISA, der für mein Thema entscheidend ist. Zur theoretischen Voraussetzung von PISA gehört, dass Bildung unterschiedliche Weltzugänge, unterschiedliche Horizonte des Weltverstehens eröffuet, die - das ist entscheidend - nicht wechselseitig substituierbar sind und auch nicht nach Geltungshierarchien zu ordnen sind. Die PISA-Studie spricht von der "Orientierungswissen vermittelnde(n) Begegnung mit kognitiver, moralisch-evaluativer, ästhetisch-expressiver und religiös-konstitutiver Rationalität.,,6 Der Leiter der deutschen PISA-Sektion, Jürgen Baumert, veranschlagt mit geringen Bedeutungsverschiebungen vier "Modi der Weltbegegnung": 1. "Kognitiv-instrumentelle Modellierung der Welt" (Mathematik, Naturwissenschaften), 2. "Ästhetisch-expressive Begegnung und Gestal-
Ich diskutiere hier ausdrücklich nicht die empirische Validität der PISA-Daten und ob aus ihnen die richtigen schul- und bildungspolitischen Folgerungen gezogen werden. Vgl. das sog. "Klieme-Gutachten": BMBF [2003]. Vgl. Blumenberg, Hans [1981]. PISA 2000 [2001]., 21.

Modi der Weltbegegnung 251
tung" (Sprache/Literatur, Musik! Malerei/ Bildende Kunst, Physische Expression), 3. "Normativ-evaluative Auseinandersetzung mit Wirtschaft und Gesellschaft" (Geschichte, Ökonomie, Politik!Gesellschaft, Recht), 4. "Probleme konstitutiver Rationalität" (Religion, Philosophie). 7
Baumert verschränkt diese "Modi der Weltbegegnung" mit der Beherrschung von fünf "kulturellen Basiskompetenzen,,8, man könnte auch von Kulturwerkzeugen als "basalen Sprach- und Selbstregulationskompetenzen" sprechen: 1. "Beherrschung der Verkehrssprache", 2. "Mathematisierungskompetenz", 3. "Fremdsprachliche Kompetenz", 4. "IT-Kompetenz", 5. "Selbstregulation des Wissenserwerbs". Die "Modi der Weltbegegnung" und die "kulturellen Basiskompetenzen" gemeinsam bilden die "Grundstruktur der Allgemeinbildung und des Kanons.,,9 Dieses Tableau setzt eine ausdifferenzierte Fächerstruktur der Schule voraus, was Interdisziplinarität nicht ausschließt, sie aber an den Differenzen der Weltzugänge orientiert, also nicht unter dem Modebegriff der "Ganzheitlichkeit" missversteht. Natürlich ist das Ganze vom Ende der Schule, von der Sekundarstufe II her gedacht, ohne aber vorher abgebrochene Bildungsgänge zu entwerten.
Das Verständnis der von PISA zugrunde gelegten "Modi des Weltverstehens" (und das Verständnis der schulischen Fächer bzw. Fachdomänen als konkreten Formen solcher Weltzugangsweisen) macht es notwendig, in Lehr-Lern-Prozessen zu thematisieren, wie die Welt im Lichte dieser unterschiedlichen Zugangsweisen jeweils modelliert wird. Eine bildungstheoretisch orientierte Fachdidaktik lässt sich aus genau diesem Grunde nicht verkürzt als Applikationstechnik verstehen, wie es im abfällig-elitären Urteil über die "Didaktik" und die "Fachdidaktiker" in manchen Feuilletons und vonseiten mancher Fachwissenschaftler geschieht. Allenfalls die Beschreibung einer "objektiven" Wirklichkeit ließe sich maßstabsgerecht als ein Schulstoff abbilden. Und wer die Logik subjektiver Aneignung einer Sache mit ihrer "objektiven" inneren Logik kurzschließt, hat von seiner Sache nur die Hälfte verstanden. Nicht in Vereinfachung besteht die Pointe jeder didaktischen Elementarisierung, sondern darin, die Sachlogik mit der davon unterschiedenen, wenn auch nicht zu trennenden Aneignungslogik zu vermitteln. Didaktisch wird auf diese Weise anerkannt, dass die Welt niemals an sich dem Bildungsprozess gegenüber steht. Damit ist also immer auch fachdidaktisch die Frage impliziert, was unter den unterschiedlichen "Modi des Weltverstehens" präzise zu verstehen sei, was ihre Propria und ihre Grenzen sind.
Damit sind übrigens gerade auch im Blick auf den naturwissenschaftlichen Unterricht Problemanzeigen fällig. Jürgen Baumert jedenfalls hat das schlechte Abschneiden deutscher Schüler bei der Evaluation naturwissenschaftlicher Kenntnisse und Problemlösungskompetenzen in einen überraschenden Zusammenhang mit einem empiristischen Wissenschaftsbild gestellt, das in anderen Ländern nicht in gleichem Maße vorherrsche. Überwiegend induktives Vorgehen im naturwissenschaftlichen Unterricht fördere, so Baumert, den Eindruck, Experimente seien der Schlüssel zur Entdeckung der in der Natur verborgenen Gesetze, statt dass die Schüler das Experiment als den instrumentellen Durchgriff auf die Realität unter den Annahmen eines vorgängigen theoretischen Mo-
Baumert, Jürgen (2002], 113. Baumert, Jürgen [2002], \08 Baumert, Jürgen [2002], 113.

252 Bernhard Dressler
dells zu verstehen lernen. "In dieser didaktischen Konzeption scheinen ein missverstandener Wagenscheinlo und empirizistische Wissenschaftsvorstellungen eine unheilige Allianz einzugehen. "lI Dietrich Benner spricht in dieser Hinsicht von einem "modellplatonistische(n) Missverständnis neuzeitlicher Wissenschaft", mit dem theoretische Konstruktionen ontologisiert werden. 12 Wenn also auf diese Weise Naturwissenschaften mit Geltungsansprüchen überlastet werden, schadet das auch ihrer Didaktik, weil - so folgere ich - die Schüler auf einlinig-kausale Denkspuren gesetzt werden, statt sich mehrdimensionale Denkspielräume erschließen zu können. Wissen gewinnt nur dann Raum, wenn es seine Ordnungsmuster und seine Grenzen kennt. Die Unterscheidung der "Modi der Weltbegegnung" vermeidet mit jedem Szientismus auch einen Monopolanspruch naturwissenschaftlichen Wissens (wie er z. B. in der gegenwärtigen Konjunktur naturalistischer Menschenbilder grassiert) - und öffnet naturwissenschaftlichen Lernprozessen gerade damit sachangemessenen Erfolg.
2 Bildung als Antwort auf den Verlust der Einheit der Welt
Entscheidend ist, dass dieses bildungstheoretische Konzept das grundlegende Muster moderner Gesellschaften reflektiert: Den Prozess funktionaler Ausdifferenzierung und, damit verbunden, die Pluralisierung von Rationalitätsformen: Religion, Politik, Ethik, Ökonomie, Ästhetik, Pädagogik - auf diesen Feldern gelten jeweils eigene, nicht, jedenfalls nicht vollständig kompatible Regeln. Die neuzeitliche Entwicklung von Bildungsinstitutionen und pädagogischen Theorien ist ja selbst nur als Phänomen eines solchen Ausdifferenzierungsprozesses zu verstehen, insofern mit der Komplexität moderner Gesellschaften die unmittelbare Einheit von Leben und Lernen zerbricht und besondere Lemorte und besondere Lernstrategien ausdifferenziert werden. Die Ausdifferenzierung des Bildungssystems aus der zuvor ungeschiedenen Einheit von Leben und Lernen hat sich genau darin als alternativ los erwiesen, dass die Funktionalität der Systeme der Gesellschaft durch die reflexive Selbststeuerung von Bildungsprozessen gesichert wird.
Dieser Entwicklung lief immer wieder die Suche nach der Einheit der Vernunft entgegen, indem sich unterschiedliche "große Erzählungen" an die Stelle der verloren gegangenen einheitsstiftenden Funktion der Religion setzten: Die Nation, die Geschichte, die Natur, die Wissenschaft, der Markt. Demgegenüber bedeutet Ausdifferenzierung die Nichthierarchizität der unterschiedlichen Rationalitätsformen. Keine Rationalitätsform darf sich über andere oder an die Stelle anderer Rationalitätsformen stellen. "Recht" z. B. bedeutet kein minderes Ethos für Staat und Justiz, sondern etwas anderes als die lebensweltlichen Formen von Gerechtigkeit, und diese wiederum sind etwas anderes als das Gerechtfertigtsein eines religiösen Subjekts. Aus naturwissenschaftlicher Perspektive sieht die Welt anders aus als aus ästhetischer oder religiöser Perspektive. Keine dieser
10 Vgl. Wagenschein, Martin [1982]. 11 Baumert, Jürgen [2002],142. 12 Benner, Dietrich [2002], 78f. In Bezug auf die Mathematik ist diese Kritik bereits vorgetragen
worden von: Jab1onka, Eva [1996].

Modi der Weltbegegnung 253
Perspektiven hat einen prinzipiellen Geltungsvorrang, keine erschließt die Welt "besser" als die andere, sondern immer nur "anders". Relativ besser ist eine Welterschließungsperspektive nur jeweils in bestimmten Frage- oder Handlungskontexten. Die Verlässlichkeit einer Brückenkonstruktion ist keine moralische Frage, sondern ein Problem ingenieurwissenschaftlicher Kompetenz. Um die ästhetische Qualität eines Gemäldes zu beurteilen, werde ich nicht die chemische Analyse seines Farbmaterials benötigen. Es macht einen Unterschied, ob ich Pubertätsprobleme aus der Sicht des Selbsterlebnisses von Jugendlichen betrachte oder mich dabei auf empirisches Wissen über hormonelle Umstellungsprozesse beziehe. Nun wissen wir, so hat es einmal sinngemäß der Philosoph Ludwig Wittgenstein formuliert, dass selbst dann, wenn alle wissenschaftlich möglichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Es sind dies die Probleme, die weder nur empirisch, noch nur kognitiv, auch nicht nur ästhetisch oder nur moralisch zu verhandeln sind, sondern die als "Probleme konstitutiver Rationalität" jene Fragen aufwerfen, die ganz grundlegend auf die Deutung der Welt und meines Lebens in dieser Welt hinführen. In das Feld dieser Fragen gehört die Religion.
Auch wenn man den Begriff "Postmoderne" nicht mag: Richtig daran ist so viel, dass erst in den letzten ca. 20 Jahren sich das Bewusstsein über das Gewordensein moderner Gesellschaften und ihrer Bauprinzipien und Regeln verallgemeinert hat. Die modeme Gesellschaft kann sich nun gleichsam von außen beobachten, d.h. sie wird selbstreflexiv, und zwar, das ist das Neue, bis in die Lebenswelt hinein. Und so wird allgemein bewusst, dass sich unterschiedliche kulturelle Wertsphären, Rationalitätsformen und Systemlogiken so weit ausdifferenziert haben, dass kein einigendes Band mehr das Ganze inhaltlich konsistent zusammenhalten kann. Damit hängt zusammen, dass nicht, wie in kurzschlüssigen Zeitdiagnosen immer wieder behauptet wird, Werteverluste die Signatur der Gegenwart sind, sondern, wie schon Max Weber wusste, Wertekonflikte. Was seit Kant als Elitenwissen gelten konnte, nämlich dass für das Gute, das Wahre und das Schöne, für Ethik, Wissen und Ästhetik (um hier nur die drei Felder der Kant'schen Vernunftkritiken zu nennen) keine gemeinsamen Urteilsmaßstäbe mehr heranzuziehen sind, dringt nun ins Alltagswissen ein: Der Markt, die Politik, die Kunst, die Familie, die Religion funktionieren nicht nach einheitlichem Logos und Ethos. Der Verlust eines substanziell gehaltvollen Begriffs von Allgemeinbildung hat weniger - wie oft vermutet -mit der Wachstumsbeschleunigung unserer Wissensbestände, dem angeblich rapiden Verfall ihrer "Halbwertzeiten" zu tun, sondern ist als Resultat dieses Ausdifferenzierungsprozesses zu verstehen. Bildung ist nicht mehr idealistisch als "integrativer Gesamtbegriff' zu denken. Bildung kann auch nicht mehr auf einer einheitswissenschaftlichen Weltsicht aufruhen. Die funktionale Differenzierung moderner Gesellschaften lässt es also nicht mehr zu, Bildung über umgreifende kulturelle Gehalte als Allgemeinbildung zu bestimmen. Es kann keine Zentralperspektive mehr in Anspruch genommen werden, aus der die Welt ohne blinden Fleck, wie mit den Augen Gottes zu betrachten wäre, auch wenn einheitswissenschaftliche Reduktionismen wegen der Entlastung von Differenzierungszumutungen immer wieder gefährlich attraktiv werden. Die oft beklagte Vervielfältigung und Segmentierung des Wissens ist aus systemtheoretischer Sicht nicht rückgängig zu machen und weder durch die Bestimmung eines Allgemeinen, noch durch das Prinzip der Exemplarizität aufzufangen.

254 Bernhard Dressler
Dennoch bleibt Bildung auch in funktional ausdifferenzierten modemen Gesellschaften auf der Tagesordnung. Sie zielt auf jene anspruchsvolle, jeweils systemspezifisch auszuformende Kommunikationskompetenz, die erforderlich wird, weil Kommunikation das entscheidende Medium ist, in dem sich Systernkontakte überhaupt abspielen. "Ohne kompetente Mitspieler in den Systemgeflechten, ohne Akteure von Kommunikationen kann - bei aller sonst so stark behaupteten Subjektfeme der Systemtheorie - das Spiel der systemf6rmigen Differenzierung und Stabilisierung nicht fortgesetzt werden.,,13
Das Bildungssystem muss in seinem ausdifferenzierten Fächergefiige virtuelle Systemperspektiven imaginieren und entsprechende Kommunikationskompetenzen generieren, um seinem eigenen Systemanspruch zu genügen. Indem dazu eine Auswahl solcher Systemperspektiven erforderlich ist, ist jede Bildung systemrelativ - "und muss sich doch zugleich reflexiv so weit über die unmittelbare Funktionstüchtigkeit des Kommunizierens hinaus bewegen, dass überhaupt innovative Fortsetzungen von Kommunikation möglich werden.'d4 Eben so ist das Allgemeinbildungspotenzial systemspezifischer Bildung zu verstehen.
Bildung soll einerseits das innersystemische Funktionieren gewährleisten, also die Kontinuität der systeminternen Verarbeitungsmechanismen gewährleisten. Sie soll aber auch differenzierend-generelle Kompetenzen vermitteln. Es geht also sowohl um die Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Systeme, als auch darum, der funktionalen Differenzierung des Systemparadigmas überhaupt gerecht werden zu können.
Bildung kann unter diesen Voraussetzungen weder die mit der modemen Kultur unvermeidlich verbundenen Unsicherheiten beseitigen, noch irgendeine Einheitsperspektive anbieten, in der sich die Differenzen auflösen. Bildung zielt nicht auf Sicherheit, sondern auf Unsicherheitstoleranz, nicht auf ganzheitliche Weitsicht, sondern auf "Differenzkompetenz."IS Differenzkompetenz ist im Zusammenhang allgemeiner Bildung sachlich vermutlich am schärfsten herausgefordert durch die immer wieder neuen Tendenzen, hinter den Ausdifferenzierungen von Rationalitätsformen und gesellschaftlicher Praxen neue einheitswissenschaftliche Grundlagen zu suchen. Naturalistische Menschenbilder in der Himforschung sind dafiir die gegenwärtig prominentesten Kandidaten im Wissenschaftsbereich, der neo liberale Ökonomismus ist das ideologische Pendant im Bereich der sozialen und kulturellen Lebensgestaltung.
Bildungsprozesse insgesamt leben also vom Perspektivenwechsel und dem damit verbundenen Unterscheidungsvermögen. In modemen Gesellschaften müssen Menschen wissen, aus welchen unterschiedlichen Perspektiven sie in unterschiedlichen beruflichen, gesellschaftlichen, privaten Situationen die Welt wahrnehmen, und welcher blinde Fleck mit jeder dieser Perspektiven unvermeidlich verbunden ist. Dass etwa in der Schule viele Fächer unterrichtet werden, darf nicht zu der Illusion fuhren, dass das Wissen der verschiedenen Fächer sich irgendwann einmal bruchlos zu einer vollständigen und einheitlichen Weltwahrnehmung zusammenfiigt.
Zur Vervollständigung der hier skizzierten bildungstheoretischen Perspektive erwähne ich noch, dass das gerade dargestellte, gleichsam synchrone und auf der Fächerstruk-
13 Korsch, Dietrich [2006], 166f. 14 Kürsch, Dietrich [2006], 167. 15 Korsch, Dietrich [2003], 278.

Modi der Weltbegegnung 255
tur der Schule auflagernde Differenzgefüge zu ergänzen ist durch ein dazu quer liegendes, diachronisch an der kognitiven Entwicklung der Schülerinnen und Schüler orientiertes Differenzgefüge: Die Schule hat im Blick auf die lebensgeschichtlich vermittelten Kognitionsmuster die Übergänge zwischen den alltagspraktischen "Umgangsverhältnissen" und jenen "Sachkunden" zu gestalten, die über kulturelle Zeichensysteme wie die Schrift vermittelt sind und die im Verlauf der Sekundarstufen in szientifisches und historisches Wissen sowie schließlich in dessen wissenschaftstheoretische Reflexion zu transformieren sind. 16 Die Grundschule vermittelt den Übergang von der familiären Erziehung und der Muttersprache in die künstliche Form der Schriftsprache und bereitet den Zugang zu den über die Schrift vermittelten Reflexionsverhältnissen vor. Sie verändert und erweitert damit die Umgangsverhältnisse über die Grenzen der vormodernen unmittelbaren Einheit von Leben und Lernen hinaus. Also auch hier: Anknüpfen an Unterscheidungen und Entwicklung von Kompetenzen zum Übergang zwischen differenten Lebensformen. Auf die Grundschule aufbauend leistet die Sekundarstufe I den Übergang zu "Kunden", und zwar durch "Lehr-Lernprozesse, die ohne eine künstliche Vermittlung im Unterricht nicht stattfinden könnten.,,17 In der Sekundarstufe 11 wird dann - nicht nur, aber insbesondere in ihren wissenschaftspropädeutischen Anteilen - der Übergang zur expliziten Reflexion der Perspektivenwechsel zumindest angebahnt. Die Modi des Weltzugangs werden in diesem Ablauf nicht jeweils in andere überführt, sondern erweitert. Zwischen ihnen werden Übergänge als Aufgaben der Transformation zwischen verschiedenen Erkenntnis- und Handlungslogiken gestaltet, die zu unterscheiden sind, aber auch wechselseitig kommunizieren und miteinander verwoben sind.
Im Idealfall sind dann am Ende der Sekundarstufe 11 in allgemeinbildender Hinsicht vier fundamentale Kompetenzen erworben: - Die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen Umgangserfahrungen und wissenschaftlich vermittelten (szientifischen) Erfahrungen; - die Fähigkeit zur Kritik an einem szientistischen Reduktionsmus, d.h. die Fähigkeit zur ideologiekritischen Distanz gegenüber "einheitswissenschaftlichen Deutungsmustem"; - die Fähigkeit, wissenschaftliche Theorien als modellhafte Konstruktionen zu verstehen (also dem in den Naturwissenschaftsdidaktiken immer noch verbreiteten "Model\platonismus" zu entkommen); - die Fähigkeit, die Probleme eines verantwortlichen Weltumgangs ökonomisch, ethisch, pädagogisch, politisch, ästhetisch und religiös zu reflektieren und zu begreifen, dass zwischen diesen unterschiedlichen Deutungsmustern kein harmonisches Verhältnis herstel\bar ist:
Zum Abschluss dieses Abschnitts will ich noch kurz darauf hinweisen, dass die bleibende Bedeutung der 200 Jahre alten klassischen neuhumanistischen Bildungskonzepte weder in ihrer Ehrwürdigkeit noch in ihrer Idealität besteht, sondern darin, dass in ihnen - im Kontrast zu ihrem antikisierenden, zuweilen abgehoben erscheinenden Gestus -"die neuzeitliche Grundsituation, vor der wir heute immer noch stehen, in aller Schärfe erkannt" wurde. 18 Es sind die sozialhistorisch mit der Auflösung ständischer Ordnungen
16 Benncr, Dietrich [2002], 73f. 17 Benner, Dietrich [2002], 74. 18 Biehl, Peter [1988], 41 (Hervorhebung B. D.).

256 Bernhard Dressler
und mentalitäts geschichtlich mit der Aufklärung verbundenen Entsicherungen, die auf die Frage, wozu der Mensch bestimmt sei, keine Antworten im Sinne tradierter Selbstverständlichkeiten mehr zulassen. Die teleologischen Muster des Welt- und Selbstverständnisses, wonach alles seinen Sinn und Zweck hat, zeigen erste Risse. Die aus der Antike überkommene und mit dem christlichen Schöpfungs glauben verbundene Kosmosfrömmigkeit wird erschüttert. Das bürgerliche Selbstbewusstsein setzt erworbene gegen ererbte Autorität und untergräbt damit den Geltungsanspruch von Traditionen. Als Zerrissenheit des bürgerlichen Lebens wird thematisch, was wenig später mit der Diagnose der "Entfremdung" des Menschen einen Grundton modemen Lebensgefühls anstimmt. Mit der Entwicklung marktwirtschaftlicher Verhältnisse und bürgerlicher Lebensformen gewinnt die funktionale Ausdifferenzierung von Teilsystemen als das Grundprinzip der Modeme eine neue Qualität - und die Institutionalisierung von Erziehung und Bildung ist nicht nur Reflex auf diesen neuen Ausdifferenzierungsschub, sondern dessen genuines Phänomen. "Dass Bildung in der Modeme immer dort thematisiert wird, wo Übergänge stattfinden, die mit Unsicherheiten und Undeutlichkeiten verbunden sind", ist das verbindende Motiv zwischen dem historischen Ursprung des modemen Bildungsbegriffs und der Gegenwart: "Bildung wird dann zum Thema, wenn der Ausgang des Menschen aus zerbrochenen Selbstverständlichkeiten bewältigt werden sol1.,,19 Von Anfang an richtet sich Bildung auf die Entwicklung einer Subjektivität, die in der Erschließung der Welt das Inkompatible, das Ganze in seinen Differenzen, zusammenzuhalten in der Lage ist. Alles, was Bildung nur im Kontext "ganzheitlicher" Sozialformen gelten lässt, erweist sich daher gemessen an den Ursprüngen des Bildungsdenkens als reaktionäre Sozialromantik. Den Kern des Bildungsdenkens bildet seit jeher ein (selbst)kritischer Bezug auf die Aufklärung - zumindest auf eine in der Aufklärung virulente rationalistisch-utilitaristische Strömung: Die Ablehnung sowohl einer rationalistischen Reduktion des Menschen als auch seiner Verzweckung durch wissenschaftliche, wirtschaftliche oder politische Ziele. Damit wird radikal zwischen Personen und Sachen unterschieden. Als Theologe gestatte ich mir die Randbemerkung, dass aus diesem Grunde keine Bildungstheorie an religiösen Fragen vorbeikommt - weder konzeptionell noch cUITicular.
19 Schwöbel, Christoph [1998],177. "Mit dem Begriff der Bildung reagiert das Erziehungssystem auf den Verlust externer (gesellschaftlicher, rollenförmiger) Anhaltspunkte für das, was der Mensch sein bzw. werden soll." (Luhmann, Niklas [2002], 186.

Modi der Weltbegegnung 257
3 Das Ziel allgemeiner Bildung: Differenzkompetenz
Lässt sich noch etwas genauer bestimmen, wie eine bildungstheoretisch orientierte Didaktik auf "Differenzkompetenz" abzielt? Ich erlaube mir an dieser Stelle als Religionspädagoge, diese Frage an einem Kemproblem religiöser Bildung zu exemplifizieren. Die Anschlussmöglichkeiten rur andere Fachdidaktiken sind aber problemlos zu erkennen.
Für den wesentlich von Friedrich Schleiermacher geprägten neuzeitlichen Religionsbegriff ist entscheidend, dass sich auch die Religion als Differenzphänomen versteht: Schleiermacher unterscheidet Religion fundamental von Metaphysik und Moral. Sie ist also weder auf Ethik zu reduzieren, noch konkurriert sie mit Wissenssystemen oder mit Erkenntnistheorien. Religion ist als "Sinn und Geschmack rur das Unendliche" eine "eigene Provinz im Gemüt", ein genuiner Modus des Weltzugangs, eine Kultur der Weltdeutung, in der sich keine andere Welt erschließt, aber diese Welt als eine andere zeigt. Zugleich entwickelt sich in der Neuzeit die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen Religion und Theologie, zwischen religiöser Rede und Reflexion über Religion.20 Der verstorbene Sozialphilosoph Niklas Luhmann sieht eine der wichtigsten kulturellen Errungenschaften der neuzeitlichen Christentums geschichte darin, dass man sich "über Religion" verständigen kann, ohne sich "religiös" verstehen zu müssen. Eben dies setzt die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels voraus: Religiös zu kommunizieren, d.h. die Welt religiös zu beobachten - Luhmann sagt: als Religion zu kommunizieren - und zu beobachten, wie Religion die Welt beobachtet, also "über Religion" zu kommunizieren?l Was aber am Beginn der Neuzeit allenfalls eine Fähigkeit kultureller Eliten war, wird gegenwärtig in der "zweiten", der reflexiv gewordenen Modeme zu einer generellen Anforderung an religiöse Mündigkeit, nicht zuletzt auch angesichts der Pluralisierung von Religion. Denn damit ist die Fähigkeit verbunden, sich über Religion auch dann verständigen zu können, wenn man sich religiös nicht verstehen kann. Die bleibende Differenz ist dann eine Bedingung und kein Defizit religiöser Verständigung.
Zum entscheidenden Kriterium rur religiöse Bildung als einem unverzichtbaren Aspekt allgemeiner Bildung wird damit die Fähigkeit, die Binnenperspektive des Vollzugs einer Religion und die Außenperspektive des distanzierten Nachdenkens über Religion ins Verhältnis setzen zu können, ohne dass das eine das andere dementiert. Im Religionsunterricht kann nicht "über Religion" geredet werden, ohne dabei die Differenz zu "religiösem Reden" bewusst zu halten. Das wiederum kann nur gelingen, wenn die immer unvertrauteren genuinen Formgestalten religiösen Redens elementar erschlossen werden: Symbolische Kommunikation einschließlich aller dazu gehörigen metaphorischen und szenisch-gestischen Formen in ihrer Differenz zu diskursiv-argumentierender Sprache - aber (Stichwort Perspektivenwechsel!) immer wieder im Anschluss an und im Übergang zu diskursiver Sprache.
20 Ahlers, Botho [1980],43. 2l Luhmann, Nilklas [1996a], 17.

258 Bernhard Dressler
Die wissenschaftlichen, kognitiven und instrumentellen Beobachtungsperspektiven sind damit als bestimmte (in bestimmten Zusammenhängen notwendige und erfolgreiche) Möglichkeiten des Weltzugangs ausdrücklich nicht ausgeschlossen, ihnen wird aber das Monopol bestritten. Entscheidend für Bildungsprozesse ist die Möglichkeit des Perspektivenwechsels statt eines Perspektivenmonopols. In semiotischer Perspektive ist damit die Unterscheidung zwischen Zeichen bzw. Zeichensystemen, ihren Semantiken und ihren Referenzen verbunden.22
Dieser Gedanke ist umstandslos z. B. auf naturwissenschaftliche Lehr-Lern-Prozesse zu übertragen: Auch im Bereich der Naturwissenschaften muss zwischen naturwissenschaftlichem Wissen als dem Wissen über die natürliche Welt in den Feldern Physik, Chemie, Biologie und Geowissenschaften einerseits und dem Wissen über Naturwissenschaften unterschieden werden23
, dem Wissen also über naturwissenschaftliche Methoden und Ziele, vor allem über die Art und Weise, wie in naturwissenschaftlicher Perspektive die Welt anders modelliert wird als Z.B. in religiöser oder ästhetischer oder ethischer Perspektive. Nur so ist ein naturwissenschaftlicher Fundamentalismus in szientistischer Gestalt vermeidbar, der mir gegenwärtig nur wenig ungefährlicher als die religiösen Fundamentalismen erscheint. Weil dieser Fundamentalismus nicht zwischen Sein und Sollen unterscheiden kann, überzieht er die Welt mit naturalistischen Fehlschlüssen, und entzieht - weil er prinzipiell zwischen Personen und Sachen nicht unterscheiden kann - der Bildung selbst die Grundlage.
Ganz ähnliche Gedanken zum Perspektivenwechsel finde ich, wenn ich es als mathematischer Laie richtig verstehe, beim Nachdenken über die Probleme, die jeweils sichtbar werden, wenn nach dem Erarbeiten und Einüben von Algorithmen in sogenannten Textaufgaben oder Anwendungsaufgaben gezeigt werden soll, dass die erworbenen Begriffe und Verfahren auch für die Mathematisierung von realen Situationen genutzt werden können. So fordert Elmar Cohors-Fresenborg, den Mathematikunterricht verstärkt darauf auszurichten, "in den Köpfen der Schüler tragfähige Modellvorstellungen aufzubauen, sowohl über den innermathematischen ,Betrieb' als auch über den Prozess der Abstraktion von Begriffen aus umgangssprachlichem Text und der Interpretation von abstrakter Mathematik durch konkrete Situationen. ,,24 So erstaunlich es sei, "dass nur sehr selten die für (die) Mathematisierung erforderlichen kognitiven Prozesse der Abstraktion und formalen Repräsentation von (in umgangssprachlich formuliertem Text) vorhandenem Wissen explizit Unterrichtsgegenstand ist", so bedeutsamer werde es, den "Transfer von umgangssprachlich codiertem intuitivem Wissen in formal repräsentierbares Wissen" zu erlernen.25 Wird so der Übergang von einem (mathematischen) Code in den (alltags sprachlichen) Code geleistet, kann dann in einem zweiten Schritt auf einer Metaebene der damit verbundene Perspektivenwechsel reflektiert werden: Was ist im Vergleich beider Codes deren jeweilige Leistungsfähigkeit aber auch deren jeweiliger Mangel?
22 Hierzu grundsätzlich: Dressler, Bemhard [2006]. 23 ACER [2004], 11; zit. nach: www.pisa.ipn.uni-kiel.de/naturwissenschaft.html. 24 Cohors-Fresenborg, Elmar [1996], 86. 25 Ebd. Welchen spezifischen Beitrag die Mathematik zur Erschließung der Weltwirklichkeit
leistet, erörtert auch Hefendehl-Hebeker, Lisa [2004].

Modi der Weltbegegnung 259
Bildung, so möchte ich diesen Abschnitt abschließen, Bildung, die auf "Differenzkompetenz" zielt, kann ebenso wenig wie die Religion den Verlust einer einheitswissenschaftlichen Gesamtsicht der Dinge dadurch ersetzen, dass sie ihn zu kompensieren versucht, indem sie gleichsam die Lücke füllt. Sie hat keinen Allzuständigkeitsanspruch zu stellen und keine Zentralperspektive zu bieten. Zu dem mit "Differenzkompetenz" geführten Leben gehört die Fähigkeit zum situativ angemessenen Wechsel der Sprachspiele. Ich muss im Blick auf die Situationen und die Orte meiner Lebensführung entscheiden können, wann ich nach Regeln alltagspraktischer Klugheit kommuniziere und wann nach Regeln privater Intimität, wann nach Regeln wissenschaftlicher Geltungsansprüche und wann nach Regeln ästhetischer Geschmacksurteile oder religiösen Zeichengebrauchs angemessen, sinnvoll, lebensdienlich und existenziell geboten ist. Mit den Worten Niklas Luhmanns: "Man braucht sich nicht zu halbieren, aber man muss die Fähigkeit haben, von einer Teilnahme zu einer anderen zu wechseln. Man muss eine Art innere Elastizität haben. ,,26
4 Differenzkompetenz und Übergangsfähigkeit
Ich habe die Ausdifferenzierung funktionaler Teilsysteme und unterschiedlicher Rationalitätsformen für irreversibel und nicht hintergehbar dargestellt. Die Menschen sind damit freilich in einem Maße mit der Frage nach ihrem Selbstverständnis konfrontiert, wie kaum je zuvor in der Geschichte, wenn sie sich diesem Prozess nicht nur einfach in fröhlicher Indifferenz anpassen wollen. Robert Musils Ulrich sieht sich als "Mann ohne Eigenschaften" in eine Welt gestellt, in der "die Verantwortung ihren Schwerpunkt nicht im Menschen, sondern in den Sachzusammenhängen" hat. Was soll denn gelten, wenn ich mich zwischen den unterschiedlichen Perspektiven, Normen und Regeln des Berufslebens, des Marktes, der Freizeitindustrie und der intimen Privatheit zerrissen fühle? Wie kann es mir gelingen, als flexibler und mobiler Mensch der Gegenwart meine verwirbelte Biographie als eine kohärente Lebensgeschichte zu erzählen? Auf Bildungsprozesse gewendet und in Anlehnung an die geniale Formulierung Hartrnut von Hentigs: Wie können die Sachen geklärt und die Menschen gestärkt werden?
Pragmatisch muss Bildung an der Frage orientiert bleiben, wie erreicht und gesichert werden kann, dass es so etwas gibt wie einen Verständnishorizont für eine gemeinsame Kommunikationsbasis aller, die in dieser Gesellschaft heranwachsen. Diese Frage darf nicht vorschnell mit der "Wahrheitsfrage" in Zusammenhang gebracht werden. Sie orientiert Bildungsprozesse an Unterscheidungen: Zwischen Eigenem und Fremdem, ego und alter, Wissen und Nicht-Wissbarem. Diese Unterscheidungen bleiben für Bildungsprozesse konstitutiv, weil sie nicht aufgehoben, sondern nur in neue Unterscheidungen transformiert werden können. Differenzerfahrungen und ihre Reflexion stehen am Anfang und am Ende jedes Bildungsganges. Auch deshalb kann niemand fertig gebildet sem.
Vor allem aber bleibt die Einsicht maßgeblich, dass Bildungsprozesse die Menschen nicht gegen die Funktionssysteme positionieren können. Sie können keine Gegenwelt gegen die ausdifferenzierten modemen Lebensformen konstituieren. Aber: Wo Funktio-
26 Luhmann, Niklas [1996b], 169.

260 Bernhard Dressler
nalität und instrumentelle Rationalität dominant werden, macht Bildung deutlich, dass es "prinzipiell ... nur eine Grenze fur systemspezifische Funktionalisierung (gibt), die individuelle Existenz. Menschen sind die Grenzen der Systeme. Diese beziehen Menschen ein, gehen durch sie hindurch, können sie aber nicht absorbieren. ,,27
Die Bedingungen fur Übergänge zwischen den verschiedenen Praxen und Rationalitätsformen werden in dieser Hinsicht offener, aber auch komplexer, weil unter den Bedingungen der "zweiten Modeme" lebensweltinterne Rationalisi~rungen die Unterschiede abfedern. Aber umso mehr müssen Übergänge gelernt und reflektiert werden. W olfgang Welsch hat im Blick auf solche Übergangsfähigkeit von "transversaler Vernunft" gesprochen. Sie "ist grundlegend unterschieden von allen prinzipialistischen, hierarchischen oder formalen Vernunftkonzeptionen, die allesamt ein Ganzes zu begreifen oder zu strukturieren suchen und darin Vernunft an Verstand assimilieren ... sie geht von einer Rationalitätskonfiguration zu einer anderen über, artikuliert Unterscheidungen, knüpft Verbindungen und betreibt Auseinandersetzungen und Veränderungen. Ihr ganzes Prozedieren ist horizontal und übergängig ... ,,28
Welsch weist darauf hin, dass schon Kant die verschiedenen Vernunftformen nicht säuberlich getrennt sieht. Sie durchdringen einander, sodass Übergänge weniger als "Brücken", sondern als netzartige "Verknüpfungen" zu verstehen sind. Ein ethisches Problem kann sich inmitten einer ökonomischen Entscheidungssituation stellen, und es ist nicht eindeutig, nach welchen' Kriterien zu entscheiden sein wird. Die Eleganz der Lösung einer Mathematikaufgabe bedeutet einen Überschuss über die bloße Richtigkeit, ohne Richtigkeitsmaßstäbe außer Kraft zu setzen. Welsch wendet sich gegen die "Suggestionen räumlicher Modelle", weil Rationalitätstypen nicht nebeneinander stehen, son~ dem in anderer Weise verschieden sind.29 Er besteht aber darauf, dass Übergänge "nicht verwischend und zerstörend zu vollziehen" sind, "sondern vernünftig geklärt und kontrolliert. ,dO Freilich sind die Klärungsmodalitäten der transversalen Vernunft ins Handgemenge der Lebenspraxis verstrickt. Sie sind auf Deutungspraktiken angewiesen, und "wie es Zeichen nur im Zusammenhang von Zeichengebrauch gibt, so gibt es Interpretationen nur im Zusammenhang von Interpretationspraktiken. Die aber sind nicht einlinig, homogen oder hierarchisch geordnet, sondern vielfältig, situationsspezifisch und kontextsensibel und vollziehen sich in der Vielfalt dessen, was Wittgenstein ,Sprachspiele' nannte.,,31
Umso deutlicher ist es, dass der Zusammenhang von Bildungsprozessen nicht über ihre materialen Gehalte zu sichern ist, und zwar ganz unabhängig davon, dass die Frage nach einem Kanon von Bildungsgütern nicht mehr zu klären ist. Für den Zusammenhang seiner Bildung hat allein das sich bildende Subjekt aufzukommen. Ein gebildeter Mensch verbindet "Differenzkompetenz" mit Übergangsfähigkeit: "Er lebt nicht so in verschiedenen Welten, dass er bewusstlos von der einen in die andere hinübergleitet. Er kann verschiedene Rollen spielen, aber es ist immer er, der sie spielt.,,32. Es geht um die
27 Schmidt, Heinz [1992], 50. 28 Welsch, Wolfgang [1991], 296. 29 Welsch, Wolfgang [1991], 307. 30 Welsch, Wolfgang [1991], 305f. 31 Dalferth, Ingolf[2004], 61, Fn 95. 32 Spaemann, Robert [1994],

Modi der Weltbegegnung 261
"Zusammenbestehbarkeit" (Ernst Troeltsch) des Handeins in einer immer desintegrierter erscheinenden Welt durch die Differenzen des Lebens hindurch. Um eine Lebensführung also, die den Perspektivenpluralismus umgreift, ohne ihn aufheben zu können, die ihn dabei aber in ein Selbstverhältnis zu integrieren verhilft, das keiner Einheitsphantasie erliegt und in dem das Ich sich deshalb nicht als Souverän seines Lebens begreifen muss: Wir verdanken unser Personsein nicht uns selbst, können also auch die Einheit unseres Selbst nicht herstellen, aber wir müssen unser Leben selbst führen. Bildungsprozesse gründen und vertrauen darauf, dass das möglich ist, und sie leben davon, diese Möglichkeit zu erschließen.
5 Literatur
Australian Council for Educational Research (ACER) [2004] Scientific Literary Framework, Melbourne.
Ahlers, Botho [2003]: Die Unterscheidung von Theologie und Religion. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Praktischen Theologie im 18. Jahrhundert, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Baumert, Jürgen [2002]: Deutschland im internationalen Bildungsvergleich. In: Killius, Nelson u.a. (Hg.) Die Zukunft der Bildung, Frankfurt/M. 2002: Suhrkamp.
Benner, Dietrich [2002]: Die Struktur der Allgemeinbildung imKerncurriculum moderner Bildungssysteme. Ein Vorschlag zur bildungstheoretischen Rahmung von PISA. In: Zeitschrift für Pädagogik 112002, 68-90.
BMBF (Hg.) [2003]: Expertise: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards ("KliemeGutachten"), Bonn.
Biehl, Peter [1988]: Religionspädagogik und Ästhetik. In: Jahrbuch der Religionspädagogik 5/1988.
Blumenberg, Hans [1981]: Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt/M: Suhrkamp. Cohors-Fresenborg, Elmar [1996]: Mathematik als Werkzeug zur Wissensrepräsentation. Eine
neue Sicht der Schulmathematik. In: Kadunz, Gert u. a. (Hg.): Trends und Perspektiven, Wien: ÖBV & HPT, 85-90.
Dalferth, IngolfU. [2004]: Evangelische Theologie als Interpretationspraxis. Eine systematische Orientierung, Leipzig: EVA.
Dressler, Bernhard [2006]: Unterscheidungen. Religion und Bildung, Leipzig: EVA. Hefendehl-Hebeker, Lisa [2004]: Thesen - Konsequenzen aus PISA. In: Bayrhuber, Horst u.a.
(Hg.): Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken, InnsbrucklWienIBozen: StudienVerlag, 129-129.
Jablonka, Eva [1996]: Meta-Analyse von Zugängen zur mathematischen Modellbildung und Konsequenzen für den Unterricht, Berlin: Transparent Verlag.
Korsch, Dietrich [2003]: Religion - Identität - Differenz. Ein Beitrag zur Bildungskompetenz des Religionsunterrichts. In: Evangelische Theologie, 412003, 271-279.
Korsch, Dietrich [2006]: Den Atem des Lebens spüren. Bildungsstandards und Religion. In: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, 2/2006, 166-173.
Luhmann, Niklas [1996a]: Religion als Kultur, unveröffentlichtes Manuskript. Luhmann, Niklas [1996b]: Die Selbstbeobachtung des Systems. Niklas Luhmann im Gespräch. In:
Breuer, Ingeborg u.a.: Welten im Kopf. Profile der Gegenwartsphilosophie. Deutschland, Berlin: Rotbuch Vlg., 1996, 169-179.

262 Bernhard Dressler
Luhmann, Niklas [2002]: Das Erziehungssystem der Gesellschaft, hrsg. v. Dieter Lenzen, FrankfurtIM.: Suhrkamp.
PISA 2000 [2001]: hrsg, v. Deutschen PISA-Konsortium, Opladen:Leske&Budrich. Schmidt, Heinz [1991]: Brennpunkte des Religionsunterrichts: Sinn - Person - Erfahrung; in: Ar
beitshilfe f. d. ev. RU an Gymnasien ("Rote Hefte") 49, hrsg. vom Landeskirchenamt der EV.-luth. Landeskirche Hannovers, 0.1.
Schwöbe1, Christoph Glaube im Bildungsprozess. In: Zeitschrift for Pädagogik und Theologie, 2/1998, 169-187.
Spaemann, Robert [1994]: Wer ist ein gebildeter Mensch? In: Scheidewege 24 (1994/95). Wagenschein, Martin [1982]: Verstehen lernen. Genetisch-Sokratisch-Exemplarisch, Wein
heim/Basel: Beltz. Welsch, Wolf gang [1991]: Unsere postmoderne Modeme, Weinheim:VCH.
Adresse des Autors
Prof. Dr. Bernhard Dressler Philipps-Universität Marburg Fachbereich Ev. Theologie Lahntor 3 35032 Marburg
Manuskripteingang: 10. März 2006 Typoskripteingang: 12. März 2007