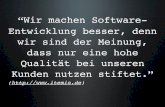Nearshoring 2.0: Innovationstreiber oder Gift für die Schweizer Softwareentwicklung?
-
Upload
ciklum-switzerland -
Category
Business
-
view
7.526 -
download
1
description
Transcript of Nearshoring 2.0: Innovationstreiber oder Gift für die Schweizer Softwareentwicklung?

14/2010 © netzmedien ag 18
Die Zahlen sind beeindruckend. Mit seinen knapp 45 Millionen Einwohnern bringt die Ukraine jährlich 14 000 IT-Spezialisten mit Masterabschluss hervor. Weitere 16 000 schaf-fen es bis zum Bachelor. Schaut man indes etwas näher hin, relativiert sich die Sache wieder. Tatsache ist, dass begabte junge Men-schen in Kiew, Odessa oder Donetsk nach dem Schulabschluss kaum Aussichten auf Arbeit haben. Und da Ausbildung, eine der Meriten aus sozialistischen Zeiten, weiterhin zur Verfügung steht, wird studiert. Und nicht wenige decken sich danach mit den einschlä-gigen Handbüchern ein und bringen sich das Programmieren selbst bei. Reif für den Nearshoring-Arbeitsmarkt sind sie damit aber noch lange nicht.
Marina Vyshegorodskikh, HR-Chefin bei Ciklum und selbst studierte Mathematikerin und Psychologin, muss die Leute schon gezielt bei den über 850 ukrainischen Outsourcing-Anbietern abwerben. Anders bekommt sie die Spezialisten für die Kunden ihres Arbeit-gebers nicht zusammen. Dafür steht ihr mitt-lerweile ein Team von 30 Mitarbeitenden zur Verfügung. Für westeuropäische Kunden IT-Fachkräfte anzustellen, ihnen einen adäqua-ten Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass sie zufrieden ihre Arbeit verrichten, ist denn auch die Kernkompetenz
des Nearshore-Spezialisten. Die fachliche Mitarbeiterführung und die Projektverant-wortung überlässt man ganz bewusst dem Kunden. Der Gründer von Ciklum, der Däne Torben Maj gaard (siehe Artikel Seiten 19/20), beansprucht für sich mit diesem Ansatz, auch Teamsourcing genannt, das Thema Nearshoring neu lanciert zu haben. Mit 800 Mitarbeitenden und über 100 Kundenteams hat man sich mittlerweile etabliert.
Haben in der ersten Off- und Nearshore-Welle Ende der 90er-Jahre viele westeuropä-ische IT-Unternehmen meist wenig erfolg-reich versucht, das günstige, aber qualitativ hochstehende IT-Know-how Osteuropas über eine lokale Partnerfirma anzuzapfen, setzt sich Teamsourcing mehr und mehr durch. In Betracht gezogen wird es vor allem von klei-neren Firmen, deren Nearshoring-Anteil nicht die notwendige Grösse erreicht, um selbst eine Niederlassung zu gründen, aber dennoch einen kontinuierlichen Bedarf an Kapazitäten benötigen.
Kein JobkillerEbenfalls schon sehr früh auf den Nearshoring-Zug aufgesprungen ist der Zürcher Marco Zoppi mit Youngculture. Allerdings kocht man in der 2004 in Belgrad etablierten Niederlas-sung entsprechend dem serbischen Markt auf
ungleich kleinerem Feuer. Mit 75 Mitarbeiten-den für rund ein Dutzend Kunden will man sich derzeit jedoch auch vermehrt im gesamten europäischen Markt bemerkbar machen. Bis in fünf Jahren rechnet Zoppi mit 200 Mitarbeiten-den. Für seine Expansionspläne steht zwar ein deutlich kleinerer Arbeitsmarkt zur Verfügung: Serbiens Universitäten produzieren rund 1000 IT-Spezialisten mit Masterabschluss pro Jahr. Dafür ist der War for Talents noch nicht derart entfesselt wie bei den Kollegen in der Ukraine. Gemäss Youngcultures HR-Chefin Mirjana Parpura Djordjevic gelingt die Rekrutierung noch weitgehend ohne Headhunting.
Doch der Nearshore-Markt brummt. Auf-grund der Erhebungen der Central and Eas-tern Europe Outsourcing Association lässt sich im ehemaligen Ostblock (ohne Russland) für 2008 ein Marktvolumen von über vier Milliarden US-Dollar errechnen. Inna Sergiy-chuk, COO der «Ukrainian Hi-Tech Initiative», schätzt das Wachstum im vergangenen Jahr je nach Land auf zwischen 5 und 20 Prozent ein. Angeführt wird das Länderranking von der Ukraine mit einem Marktvolumen von 650 Millionen US-Dollar im Jahr 2009. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von rund 20 Prozent. Noch stärker zugelegt, nämlich von 410 auf 550 Millionen Dollar, hat die Nummer zwei Rumänien. Ebenfalls deut-
Nearshoring 2.0: Innovationstreiber oder Gift für die Schweizer Softwareentwicklung?Vor allem für Start-ups oder Unternehmen mit einer innovativen Businessidee bietet sich Osteuropa mehr und mehr als kostengünstiges Umsetzungslabor an. Teamsourcing heisst das Gebot der Stunde. Während die Skandinavier bereits auf den Zug aufgesprungen sind, üben sich Schweizer Softwareunternehmen noch eher in Zurückhaltung. Thomas Brenzikofer
TITELSTORY
Bild
quel
le: F
otol
ia

lich gewachsen ist Weissrussland und hat mit einem Marktvolumen von 400 Millionen Dol-lar (im Vorjahr waren es noch 310 Millionen Dollar) Ungarn vom dritten Rang verdrängt.
Auch über einen grösseren Zeitraum betrachtet, konnte das Nearshore-Geschäft in den osteuropäischen Staaten weit über dem Wachstum des globalen IT-Markts zulegen. Allein in der Ukraine hat sich das IT-Outsour-cing-Geschäft zwischen 2003 und 2007 von 100 auf 600 Millionen versechsfacht. Dies würde eigentlich die Vermutung nahelegen, dass doch bedeutende Auftragsvolumina aus Westeuropa abgezogen wurden. Konsultiert man hingegen die jüngsten Zahlen vom Bun-desamt für Statistik, so trifft dies zumindest für die Schweiz nicht zu. So konnte in den vergangenen drei Jahren gerade das Segment der Schweizer IT-Dienstleister, das zu einem grossen Teil in der Entwicklung von Individu-alsoftware tätig ist, seinen Mitarbeiterbestand um 15 Prozent deutlich vergrössern. Von Stel-lenvernichtung kann also nicht die Rede sein.
Viel verbrannte ErdeAuch unter den Schweizer Softwareunterneh-men, die sich dem Label «Swiss Made Software» angeschlossen haben, ist gemäss Umfrage der Netzwoche nur eine Minderheit der Meinung, dass Near- oder Offshoring den ICT-Werkplatz Schweiz gefährde. Eine Mehrheit sieht darin gar eine Chance. Und über ein Drittel der 25 Unter-nehmen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, betreibt sogar selbst Near- oder Offshoring. Allerdings macht sich auch eine starke Front von Ablehnern bemerkbar. So findet eine deut-liche Mehrheit, dass sich Off- oder Nearshoring partout nicht mit dem Label vertrage, obwohl gemäss dem Initiator von «Swiss Made Soft-ware», Luc Haldimann von Anycase, bei einem schweizerischen Wertschöpfungsgrad von 60 Prozent die Auflagen eigentlich erfüllt wären (siehe Interview auf Seiten 20/21).
Geradezu vernichtend eindeutig ist die Antwort der Off-/Nearshore-Abstinenzler auf die Frage, ob man in absehbarer Zeit seine Fühler in Richtung Billiglohnland auszustre-cken gedenke: Nur gerade einer von dreizehn bejaht dies. Umso kategorischer erscheint diese Ablehnung vor der Tatsache, dass jeder Zweite bereits eine Near- oder Offshore-Erfah-rung hinter sich hat. Dabei wurde offensicht-lich einiges an verbrannter Erde hinterlassen: «Aus Ressourcenmangel haben wir vor zwei Jahren einen Versuch mit Offshoring in Asien unternommen. Resultat: Wir haben sehr viel Geld und ein Jahr verloren. Die schlimmsten Befürchtungen wurden Realität. Wir mussten
14/2010 © netzmedien ag 19
TITELSTORY
4
Wie kommt ein Däne in den Wilden Osten?2002 in einer 50-Quadratmeter-Wohnung gegründet, besetzt Ciklum heute mit über 800 Mitarbeitern und rund 100 Kunden die obersten vier Etagen eines Büroturms in Kiew. Thomas Brenzikofer
Wie kommt ein Däne nach Kiew und baut dort ein Unternehmen mit bald 1000 Mit-arbeitern auf? Für den historikversessenen Torben Majgaard ist das gar nicht abwegig. Schon die Wikinger gingen den Dnepr hinun-ter bis ans Schwarze Meer. Über das Baltikum führte auch Majgaards Weg. In den 90er-Jah-ren baute er dort ein einigermassen florieren-des Geschäft mit gebrauchter Hardware auf. Auf die Idee brachte ihn ein Passant, der eines Tages in seinem Computershop in Dänemark auftauchte.
Doch was trieb Majgaard in den Osten? Eine Frauengeschichte war es nicht (nur): «Mitte der 90er-Jahre gab es noch sehr wenige Regeln in den Staaten der ehemaligen Sow-jetunion. Anders als in Westeuropa konnte man die Sachen noch formen und mitgestal-ten. Das faszinierte mich.» Die Inspiration zu Ciklum gab ihm jedoch eine ganz andere Meldung. 2001 hatte er irgendwo gelesen, dass von den weltweit sieben Millionen Mil-lionären die meisten im Softwarebusiness zu ihrem Vermögen gekommen sind. Und so kam ihm die Idee, statt Hardware von Westen in den Osten zu verschieben, Brainware vom Osten in den Westen zu vermitteln.
Jedem Kunden sein KabäuschenDass Majgaard selbst nicht vom Fach war, begünstigte eher das heute erfolgreiche Geschäftsmodell. Statt ganze Projekte abzu-wickeln, konzentrierte sich Ciklum von Anbe-ginn an auf die Anstellung von Fachkräften und die Einrichtung der Arbeitplätze. Unter-nehmerisch geführt werden Ciklums Mitar-beitende von den Kunden selbst. Die Teams arbeiten meist in eigenen, abgeschlossenen Kabäuschen, die nach Belieben der Corpo-rate Identity des Kunden angepasst werden können. Dabei ist man absolut transparent: Der Ciklum-Service wird einfach auf den Grundlohn draufgeschlagen und schlägt mit rund 1450 US-Dollar pro Monat und Mitar-beiter zu Buche.
Teamsourcing wird dieser Ansatz heute genannt. Rund hundert Kunden, vornehm-lich aus Skandinavien, «hosten» derzeit bis
zu 20-köpfige Nearshore-Entwicklerteams auf einer der vier obersten Etagen in einem 20-stöckigen Kiewer Büroturm. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die unteren Etagen ebenfalls aufgefüllt werden: «Allein mit den Wachstumsplänen unserer bishe-rigen Kunden sprengen wir dieses Jahr die Tausendergrenze», ist Majgaard zuversicht-lich.
Torben Majgaard, Gründer und CEO von Ciklum:
«Mitte der 90er-Jahre gab es noch sehr wenige Regeln in den Staa-ten der ehemaligen Sowjetunion. Anders als in Westeuropa konnte man die Sachen noch formen und mitgestalten. Das faszinierte mich.»
Fortsetzung auf Seite 21

«Kein Missbrauch zu Marke-tingzwecken»Nicht wenige bei «Swiss Made Software» angeschlossenen Schweizer ICT-Anbieter betreiben Near- oder Offshoring. Die Netzwoche wollte vom Initiator des Labels wissen, warum dies kein Widerspruch ist. Interview: Thomas Brenzikofer
Herr Haldimann, die Mehrheit der von uns be-fragten Firmen finden, dass sich Nearshoring und das Label «Swiss Made Software» nicht vertragen. Sind Sie auch dieser Meinung?Ich sehe keinen absoluten Widerspruch. Aber natürlich kann man das Konfliktpotenzial nicht negieren. Es gilt, sich Klarheit darüber zu verschaffen, welche Formen des Nearshorings mit dem «Swiss Made Software»-Label kom-patibel sind und welche nicht. In der Uhren-branche beträgt der Schweizer Anteil an der gesamten Wertschöpfung rund 80 Prozent. Für unsere Softwarebranche würde ich die-sen Anteil etwas tiefer, mindestens aber bei 60 Prozent ansetzen.Wenn also 60 Prozent der Wertschöpfung eines Projekts oder eines Produkts in der Schweiz erfolgt, darf man sich weiterhin «Swiss Made» nennen?Ja, wenn zusätzlich der wichtigste Fabrikati-onsprozess in der Schweiz stattgefunden hat. So will es das Gesetz. Nicht wenige Unter-nehmen, die bei «Swiss Made Software» angeschlossen sind, betreiben heute schon Near- oder Offshoring und dürfen das Label trotzdem führen. Wir haben klar gesagt, dass der Hauptteil der Wertschöpfung in der Schweiz zu erfolgen hat. Dies wird übrigens auch im Rahmen der von «Swiss Made Soft-ware» unterstützten ISO-Norm 25001 veri-fiziert. Zudem sind wir zusammen mit der Simsa derzeit daran, das Thema nochmals genauer zu prüfen. Es ist uns ein Anliegen, dass «Swiss Made Software» nicht zu Marke-tingzwecken missbraucht wird.Die Programmierung macht ja heute in ei-nem Projekt meist weit weniger als 50 Pro-zent aus. Wenn ich also über eine Partnerfir-ma die Programmierung in Indien ausführen lasse, aber in der Schweiz spezifiziere, ist das in Ordnung?Nein, das wäre zu einfach. Es ist ganz wich-tig, dass Kernprozesse wie Qualitätssicherung und Architektur, also der technische Lead in der Schweiz angesiedelt ist. Dies ist ja auch notwendig, weil vermehrt mit agilen Metho-den entwickelt wird, weshalb ein Teil des Teams immer auch hierzulande, nahe beim
Kunden, arbeiten muss. Aber wie gesagt, wir werden das Thema noch vertieft aufgreifen und klar definierte Leitplanken aufstellen müssen, damit die Hersteller sicher sein kön-nen, dass das Label zu Recht geführt wird. Ein gewisser Graubereich wird sich aber wohl auch in Zukunft nicht vermeiden las-sen. Meiner Einschätzung nach ist ja auch in der Uhrenbranche nicht alles schwarzweiss. Es fragt sich ja auch, wo die Wertschöpfung anfängt und wo sie aufhört.Diese Frage stellt sich insbesondere dann, wenn auf existierenden Plattformen ent-wickelt wird, oder beim Einsatz von Open-Source-Software. Es ist im Einzelnen sehr schwierig abzuschätzen, wie gross der Anteil dessen ist, was man gewissermassen als Roh-
4
14/2010 © netzmedien ag 20
TITELSTORY
Luc Haldimann, Gründer und CEO von Anycase sowie Initiator des Labels Swiss Made Software:
«Es ist nun mal eine Tatsache, dass die lokale Nähe zum Kunden eine ganz andere Art der Soft-wareentwicklung möglich macht.»
Und natürlich sollen es noch mehr werden. Denn auch in Westeuropa hat man expan-diert, vor allem im Verkauf. Seit diesem Jahr ist man in sämtlichen reiferen europäischen Märkten mit einem Country Manager vor Ort unterwegs. In der Schweiz verkündet seit Anfang des Jahres der Mitgründer und ehe-malige CTO von Collanos, Franco Dal Molin, die frohe Ciklum-Botschaft von günstigen, topqualifizierten ukrainischen Programmie-rern, die binnen zweier Monate arbeitsfähig gemacht werden können. Dal Molin zeigt sich sehr zuversichtlich: «Das Interesse ist gross, vor allem in der Start-up-Szene, aber zuneh-mend auch bei grösseren IT-Dienstleistern.» Acht Schweizer Teams beherbergt Ciklum bereits.
Neben der Internationalisierung inves-tiert Majgaard derzeit noch in ein weiteres Geschäftsfeld. Neben dem Start-up-Service und dem kontinuierlichen Monitoring der Mitarbeitenden will man den bestehenden Kunden vor allem auch Beratungen anbieten. Christian Aaen, Leiter von Ciklum Services & Consulting: «Aus den rund 100 Teams wollen wir in Form von Best Practices die Erfahrung gezielt an unsere Kunden weitergeben.» Basis dafür sind quantitative Auswertungen, die dem Kunden zeigen, wo sein Team steht und wie er sich verbessern kann. Dabei will man sich insbesondere auch als Spezialist für Agile Methoden der Softwareentwicklung positio-nieren, wie sie von drei Viertel aller Ciklum-Kunden praktiziert wird.
Als nächstes PakistanVon der 50-Quadratmeter-Wohnung, wo Ciklum einst mit vier Entwicklern angefangen hat, bis zu Scrum war es ein langer Weg. Und eines ist für Majgaard klar: «Wegen der Unter-stützung der hiesigen Behörden sind wird nicht hiergeblieben.» In einem Land, das von rund einem Dutzend Oligarchen beherrscht wird, bleibt denn auch vieles auf Sand gebaut. Von Investitionssicherheit und stabilen Rah-menbedingung kann man nicht ausgehen. Über Nacht können sich die Mieten verdop-peln, ungerechtfertigte Steuernachzahlungen ins Haus flattern oder der Strom ausbleiben.
Doch letztlich sind gerade diese Unan-nehmlichkeiten der Kern von Majgaards Businessmodell: Sonst könnte ja jeder seine Zelte im Wilden Osten aufschlagen und von den günstigeren IT-Fachkräften profitieren. Und wenn es jemals so weit kommt, dass sich die Ukraine westeuropäischen Standards anpasst, wird man eben weiter ostwärts wan-dern müssen. Über eine Akquisition hat man auch schon seine Fühler nach Pakistan ausge-streckt. <

alle Komponenten selbst komplett neu bauen. Für uns ist das Thema Offshoring damit ein für alle Mal abgeschlossen», meint Maya Reinsha-gen, CEO von Mayoris.
Die Gründe für die ablehnende Haltung sind denn auch eindeutig. Während man die Projekt-risiken, die Datensicherheit sowie die Quali-tätsanforderung noch eher im Griff zu haben wähnt, scheut man vor allem den Imageverlust bei den Kunden. Gleichzeitig gibt man sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis nur wenig über-zeugt. «Near-/Offshoring spart unter dem Strich keine Kosten, strapaziert interne und externe Geschäftsbeziehungen und reduziert die Leis-tungsqualität», bringt etwa Oliver Bliggenber-ger, bei Brainware Solutions für Marketing und den Verkauf verantwortlich, die Problematik auf den Punkt. Ähnlich klingt es bei Adcubum: «Der Tagessatz ist nicht das allein seligmachende Kri-terium, oder umgekehrt: wenn man ihn überge-wichtet, kann er in die Hölle führen», gibt CEO Richard Heinzer zu Protokoll.
Das bis zu Faktor drei tiefere Lohnniveau ist auch nur für eine Minderheit der befrag-ten Firmen das treibende Element für das Nearshoring. Weit stärker ins Gewicht fallen die knappen Ressourcen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. «Für kleine Firmen ist es nicht einfach, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Die kleine Menge an Leuten wird zum grossen Teil von den Big Playern aufgesogen», klagt Patrick Walgis, Geschäftsleiter der Chili Solutions. Diese Erfahrung machte man auch bei der Delta Energy Solution in Basel. Deshalb ging man mit der Umsetzung eines komplexeren Portalprojekts zu Youngculture nach Serbien und führt dort ein fünfköpfiges Java-Team.
Businessmodell für Start-ups Noch pointierter bringt es Christoph Mül-ler auf den Punkt: «Ohne Nearshoring hät-ten wir unser Projekt gar nicht erst in Angriff genommen.» Zusammen mit ein paar Kollegen hatte er die Idee zu einer viel versprechenden Social-Media-Anwendung. Dank Nearshoring bot sich die Chance, bei Ciklum in Wien ein fünfköpfiges Projektteam anzuheuern und das Vorhaben neben seinem Hauptberuf als System architekt und Geschäftsleitungsmit-glied von Peaches Industries weiterverfolgen. Müller setzt das Projekt streng nach der agi-len Methode Scrum um. Einmal in der Woche gibt es eine Telefonkonferenz und nach jedem erfolgten Sprint reist er für einen Workshop-Tag zu seinem Team in die Ukraine.
Vier Monate nachdem Müller seinen ukrainischen Entwickler auf einem Flipboard erstmals die Idee aufgezeichnet hatte, ist eine
komplette Webapplikation inklusive Front-end, Backend, Schnittstellenanbindung und I-Phone-Applikation entstanden. «Dies alles in der Schweiz zu entwickeln, hätte unsere finan-ziellen Möglichkeiten bei weitem überschrit-ten», meint Müller. «Wir konnten in Kiew drei-mal günstiger entwickeln.» So wurde dann eine erste Version der Anwendung ohne Fremdgeld zur Funktionsreife gebracht, was nun die Suche nach Investoren für die weltweite Vermarktung und Weiterentwicklung wesentlich erleichtert.
«Die Entwickler hier sind so gut, dass ich mich ernsthaft um unseren Berufsstand in der Schweiz Sorgen mache», meint Müller. Aller-dings gibt er auch zu, dass seine Projektidee anders als bei komplexen Geschäftsprozessen etwa im Versicherungsbereich, einfach nach-vollziehbar sei. Zudem könne man als Start-up immer auf der grünen Wiese anfangen, was bei Kundenprojekten eben höchst selten der Fall sei.
Wandelt man durch die Räumlichkeiten von Ciklum in Kiew, ist an den Kundenlogos unschwer zu erkennen, dass in den skandi-navischen Ländern Nearshoring vor allem von Start-ups oder für innovative Projekte im Web oder Mobilebereich entdeckt wurde. Der Wilde Osten als Experimentierlabor für findige Unternehmen könnte auch hierzulande Schule machen und Europa als Softwarestandort ins-gesamt stärken. Doch wird man sich auch beei-len müssen. Denn ewig steht das Tor zum Ent-wicklerparadies im Wilden Osten nicht offen. Das geben die Zahlen unmissverständlich zu verstehen: Konnte man 2005 einen Entwickler in der Ukraine noch für 900 Franken im Monat anheuern, hat sich das Lohnniveau bereits fünf Jahre später mehr als verdoppelt. <
stoff übernehmen kann, und wo die Eigenleis-tung beginnt. Off- und Nearshoring ist jedoch auch eine grosse Chance für die Schweizer ICT-Indus-trie, gerade für Start-ups, die so wesentlich günstiger produzieren können. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Eine Erstimplementierung an einer Nearshore-Destination zu entwickeln, finde ich völlig legitim. So erhält man für einen tieferen Preis ganz klar mehr Funktionalität. Aber natürlich müssen wir irgendwo die Grenzen ziehen und solchen Unternehmen in letzter Konsequenz das Label «Swiss Made Software» verweigern. Wenn hingegen die Qualitätssicherung und die Führung der Leute vor Ort, etwa über eine eigene Niederlassung, gewährleistet sind, mag dies wieder ganz anders aussehen.Sind Schweizer Programmierer denn auch wirklich besser als serbische, ukrainische oder vietnamesische Softwareingenieure?Das Label «Swiss Made Software» positio-niert sich nicht als Bollwerk gegen Off- oder Nearshoring. Ich persönlich sehe dies sehr entspannt. Unsere Aussage ist nicht, dass anderswo nicht gute Software geschrieben wird, genauso wie man auch ausserhalb der Schweiz schöne Uhren bauen kann. Es ist aber nun mal eine Tatsache, dass die lokale Nähe zum Kunden eine ganz andere Art der Soft-wareentwicklung möglich macht. Um genau diese Qualität geht es bei «Swiss Made Soft-ware» letztlich. Das heisst, wenn man Near- oder Offshoring praktiziert, dann muss man eben auch einen gewissen Aufwand betreiben und einiges ins Management und in die Qua-litätssicherung investieren, um den gleichen Qualitätsstandard zu erreichen wie bei einer Onshore-Entwicklung. Damit relativieren sich aber die Kostenvorteile wiederum doch deut-lich.Kosten sind ja das eine. Die meisten Firmen betreiben Off- oder Nearshoring aus Ressour-cenmangel. Das Fehlen von IT-Fachkräften ist tatsäch-lich ein Faktor. Ich kenne viele «Swiss Made Software»-Unternehmen, die derzeit Projekte ablehnen müssen, weil sie die Ressourcen nicht haben. So gesehen ist es verständlich, dass man nach neuen Lösungen sucht. In extremis würde dies ja bedeuten, dass dann gewisse Firmen gezwungenermassen das Label «Swiss Made Software» wieder abgeben müssten?Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Aber wir haben derzeit tatsächlich einen Fall, der in der Beurteilung der Simsa das Label «Swiss Made Software» vermutlich zu Unrecht trägt. Hier sind wir gerade dabei zu evaluieren, was zu tun ist. <
14/2010 © netzmedien ag 21
TITELSTORY
Jahresansätze für IT-Spezialisten in Osteuropa im Überblick.Quelle: Central & Eastern Europe IT Outsourcing Review 2008
Fortsetzung von Seite 19