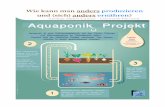Neue DFG-Schwerpunktprogramme/DFG fördert höchstauflösende Elektronenmikroskopie/Studieren in...
Transcript of Neue DFG-Schwerpunktprogramme/DFG fördert höchstauflösende Elektronenmikroskopie/Studieren in...

Aktuelles
Neue DFG-Schwer- punktprogramme Ende April traf der Senat der DFG seine Aus- wahl unter 69 Vorschlagen fur neue Schwer- punktprogramme: 15 wurden beschlossen, darunter zwei aus der Physik, die sich beide durch Interdisziplinaritat auszeichnen.
Wissenschaftler aus der Festkorperchemie sowie der experimentellen und theoretischen Festkorperphysik werden im Schwerpunkt ,, Kollektive Quantenzustancle in elektronisch eiizdimensionalen Ubergangsmetallverbin- dungen " zusammenarbeiten. Ziel des Schwerpunktes ist die koordinierte Erfor- schung der vielfaltigen Erscheinungsformen von Luttinger-Fliissigkeiten, den kollektiven Quantenzustanden in elektronisch eindimen- sionalen Materialien wie Metallen und Spin- Ketten. An Materialien stehen die Uber- gangsmetallverbindungen, meist temare Oxide und andere Chalkogenide, im Mittel- punkt. Ein groBes Ziel der Theorie ist es, die verschiedenen, zum Teil konkurrierenden Wechselwirkungen der Elektronen in Nahe- rungen gleicher Giite zu behandeln. Insge- samt soll iiber die Beschreibung der einzel- nen Phanomene hinaus ein koharentes Ver- standnis der Luttinger-Fliissigkeiten erreicht werden. Koordinator dieses Schwerpunktpro- gramms ist Priv.-Doz. Dr. Claudius GroB, Universitat Dortmund.
Das Ziel des Schwerpunkts ,,Quartteninfor- mntionsverarbeitung" ist die systematische Erforschung von verschrankten Quanten- zustanden im Hinblick auf Tests der physika- lischen Grundlagen und auf Anwendung in der Kornmunikation, der Kryptographie und der Schaltungstechnik. Entsprechend arbeiten hier Wissenschaftler aus der Physik, der In- formatik und der Elektrotechnik zusammen. Themenfelder sind die experimentelle Reali- sierung von beherrschbaren, verschrankten Quantenzustanden; theoretische Studien zu den Begriffen Quanteninformation und Ver- schranktheit sowie ihrer quantitativen Erfas- sung; Beobachtung der Meariickwirkung auf die Dynamik von Quantensystemen und Messung einer quantenmechanischen Varia- blen ohne ihre Beeinflussung durch den MeBprozeB; Beherrschung von Dekoharenz in Quantensystemen; Modellierung und Auf- bau elementarer Quantenschaltungen. Die In- itiatoren des Schwerpunktes sind die Profes- soren Thomas Beth, Karlsruhe, Gerd Leuchs, Erlangen, Wolfgang Mathis, Magdeburg und Wolfgang Schleich, Ulm; Koordinator ist G. Leuchs (Kontakt: http:llwww.physik.uni- erlangen.de/opti Wmain-e. html)
DFG fordert hochstauflosende Elektronenmikroskopie Ende April hat die DFG eine GroBgerate- initiative ,,Hochauflosende Elektronenmi- kroskopie" ins Leben gerufen, mit der rund 13 Mio. DM fur die Finanzierung von acht neuen Geraten zur Verfiigung gestellt wer- den sollen. Das Forschungszentrum Jiilich sowie das MPI fur Metallforschung erhalten die weltweit ersten Subangstrom-Transmis- sionselektronenmikroskope (TEM) zum Stuckpreis von rund 5 Mio. DM, die es er- moglichen, nichtperiodische Strukturen in Festkorpern direkt atomar aufzulosen (vgl. den Artikel von H. Rose et al., Phys. BI., Mai 1998, S. 411). Spater wird die Uni Miinster ein weiteres Gerat dieser Art erhalten. Wei- terhin finanziert die DFG drei konventionel- le hochauflosende TEM-Gerate (2 ca. 2 Mio.
... kurzgefafit Alumni-Chatting Ab sofort konnen sich alle Stipendiaten, Lekto- ren und Hochschullehrer, die durch den Deut- schen\ Akademischen Austauschdienst (DAAD) gefordert wurden und werden, weltweit mitein- ander vernetzen. Unter http://www.daad-alumni- forum.de konnen sie in den neu eingerichteten Online-Konferenzen des DAAD Kontakte unter- einander knupfen, Erfahrungen weitergeben, Fachgesprache fiihren, Wohnungen tauschen, Praktikumsplatze anbieten oder ganz einfach nur ,,chatten".
Erstes ,,virtuelles Graduiertenkolleg" Aus 90 Antragen hat die DFG 32 Graduierten- kollegs (GKs) ausgewalt, darunter ein ,,virtuel- les", in dem unter psychologischen Aspekten un- tersucht wird, wie der Wissensenverb und -am- tausch mit neuen Medien, insbesondere mit dem Internet, vonstatten geht. In diesem Kolleg ste- hen Hochschullehrer und Doktoranden an den Universitaten Tubingen, Heidelberg, Freiburg, Saarbriicken und Greifswald iiber das Internet miteinander im Austausch. Die Lehr- und Dis- kussionsveranstaltungen sind speziell auf dieses Medium abgestimmt. Derzeit bereiten sich in GKs rund zehn Prozent aller Doktoranden auf ihre Promotion vor. Absolventen von GKs sind in der Regel umfassender qualifiziert und durch- schnittlich zwei Jahre jiinger als ihre Studienkol- legen. Die Gesamtzahl der Graduiertenkollegs steigt mit 330 kurzfristig iiber den angestrebten Zielwert von 300. Damit soll eine Forderungs- liicke verhindert werden, denn im kommenden Jahr werden rund fiinfzig der auf eine Laufzeit von neun Jahren begrenzten Programme auslau- fen. Informationen erteilt Dr. Robert Paul Ko- nigs, DFG, Kennedyallee 40, D-53175 Bonn, Tel: 0228/885-2424, e-mail: [email protected]. d400.de.
DM) fur die Universitaten Mainz, Berlin und Regensburg und zwei hochauflosende, analytische Rasterelektronenmikroskope (Stiickpreis rund 1 Mio. DM) fur Arbeits- gruppen in HamburglRostock und Halle. Die DFG reagiert mit dieser Initiative auf den dringenden Bedarf an hochauflosenden Elektronenmikroskopen in den Ingenieur-, Natur- und Biowissenschaften. Neben der DFG beteiligen sich an der Finanzierung auch die Max-Planck-Gesellschaft, das FZ Jiilich, das Land Baden-Wurttemberg, die Universitaten Tubingen und Stuttgart sowie die Beiersdorf AG. Nahere Informationen bei Dr. Werner Brocker, Deutsche For- schungsgemeinschaft, Tel.: 02281885-2476, email: [email protected]
Klage gegen FRM 11 abgewksen Die von der Stadt Munchen eingereichte Klage gegen die 1997 erteilte zweite Teilgenehmigung des Forschungsreaktors Miinchen II ist vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VHGj fiir unzulassig erkliirt worden. Der Grund Umwelt- schutzreferent Joachim Lorenz, der die Klage eingereicht hatte, ist als juristischer Laie beim VHG nicht unterschriftsberechtigt.
DAAD-Auslandsstipendienfiihrer 1999/2000 Unter diesem Titel finden sich auf 380 Seiten smtliche Stipendienangebote des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und anderer Stipendienorganisationen zur internatio- nalen Qualifizierung des Fiihrungsnachwuchses an deutschen Hochschulen. Damit mehr Deut- sche den Startvorteil eines Auslandsstudiums er- halten, hat der DAAD fiir Studierende seine Sti- pendienangebote von Europa auf die ganze Welt ausgeweitet und gleichzeitig durch eine Umstel- lung auf Teilstipendien die Zahl der Stipendien deutlich erhoht. Der neue Auslandsstipendien- fiihrer des DAAD ist kostenlos.ausschlieBlich bei den Akademischen Auslandsamtern aller Hoch- schulen erhatlich.
Friedensnobelpreis fur CERN? Gut moglich, daB sich CERN und JINR (Joint Institute for Nuclear Research in Dubna)'eines Tages den Friedensnobelpreis teilen. Nach der Konferenz ,,Atoms for Peace" hat eine Gruppe osteuropiiischer Politiker beschlossen, die beiden Laboratorien fiir diesen Preis zu nominieren. CERN war eine der ersten europaischen Organi- sationen, die mitten im Kalten Krieg die Ost- West-Annaerung vorangetrieben hat. ,,Zusatz- lich zu wissenschaftlichen Werten muB CERN auch fiir andere Werte stehen", meint die Gruppe, die hinter dem Vorschlag steht. (Queue: Proton)
~~
Phys. B1.54 (1998) Nr. 6 " nn

Studieren in Deutschland? Was auslandische Studenten von einem Studium in Deutschland erwarten - Erfahrungen des deutschen Botschafters in Jakarta
Auf der letztjahrigen Ausbildungsmesse in Jakarta rief ein indonesisches Kabinettsmit- glied einer Gruppe von angehenden Studen- ten vor laufenden Fernsehkameras zu: ,,Wollt Ihr auch einmal Minister werden?" Auf ein vielstimmiges Ja meinte der Politiker, dann sei es am besten, in Deutschland zu studie- ren. Denn das habe er auch getan und es schlieRlich bis zum Minister gebracht.
Mit seinem damaligen Studium in Deutsch- land warder Minister nicht allein. Vier wei- tere seiner Kabinettskollegen haben auch bei uns studiert. Insgesamt gibt es in Indonesien ca. 17000 ,,Alumni Jerman", wie man die Absolventen deutscher Hochschulen und Universitaten nennt. Aber deren Studium in Deutschland ist lange her. Es waren die Jahre nach der Erringung der Unabhangigkeit die- ses mit 200 Millionen Einwohnern inzwi- schen viertgroRten Landes der Welt, als viele Angehorige der ersten und zweiten Generati- on der jungen Intellektuellen zum Studium nach Deutschland gingen.
Seit geraumer Zeit ist dies anders. Amerika- nische und australische Universitaten haben uns den Rang abgelaufen. Das hat nicht allein rnit der Reputation dieser Universitaten zu tun oder rnit der Tatsache, daR Englisch heute Pflichtfach in den indonesischen Schulen ist; friiher wares einmal Deutsch. Hinzu kornmt, daR die meisten indonesischen Studenten und Studentinnen Selbstzahler sind und daR sich fur diese Selbstzahler ein Markt entwickelt hat, den die australischen und amerikani- schen Universitaten rnit ihren anderen, kom- merziell orientierten Strukturen fast voll- kommen beherrschen. Dieser Markt und die von ihm ausgehende Ausstrahlung beeinflus- sen die indonesische und sudostasiatische Bildungslandschaft inzwischen so stark, daR die jungen Menschen ein Studium in anderen Landern kaum mehr ins Auge fassen.
Um zu versuchen, wieder verstarkt deutsche Universitaten ins Spiel zu bringen, beteiligte sich die Deutsche Botschaft und der DAAD im Friihjahr 1997 zum ersten Ma1 rnit finan- zieller Unterstutzung der deutschen Wirt- schaft und Industrie an der jahrlich in Jakarta stattfindenden ,,Education and Training Expo". Trotz der gegenwartigen wahrungs- und wirtschaftspolitischen Krise haben wir uns, wiederum grol3zugig unterstutzt von der deutschen Wirtschaft, dazu entschlossen, uns auch in diesem Jahr mit einem groRen Deut- schen Pavillon abermals zu beteiligen.
Drei Hauptuberlegungen stehen dabei im Vordergrund: 0 Die sudostasiatischen Staaten werden ihre Krise uberwinden und rnit aller Wahrschein-
lichkeit sogar gestarkt und gesunder aus ihr hervorgehen. 0 Gerade in der Zeit der Geldknappheit ist ein Studium in Deutschland weitaus kosten- gunstiger als ein Studium an einer amerika- nischen oder australischen Universitat, die teure Gebuhren fordern. 0 Unsere wirtschaftliche Zukunft hangt auch davon ab, ob wir drauRen im Ausland auch in Zukunft noch genugend Partner finden, die Deutschland kennen und bereit sind, rnit uns zusammenzuarbeiten.
Botschafter Heinrich Seemann, Jakarta
Wie sieht nun eine solche Ausbildungsmesse aus und wie reagieren angehende Studentin- nen und Studenten auf unser Angebot?
Zunachst sind GroRe und Anzahl der Besu- cher einer solchen Ausbildungsmesse fur deutsche Begriffe uberraschend. In einer rie- sigen Messehalle tummeln sich wahrend der 3 oder 4 Tage dauemden Messe etwa 250000 Besucher. Schulabganger und Eltern infor- mieren sich uber Studienmoglichkeiten im In- und Ausland. Es handelt sich uberwie- gend um sog. Selbstzahler, die bereit sind, fur eine Ausbildung ihrer Kinder Geld zu inve- stieren und sich fragen, wo dieses Investment den groRtmoglichen Nutzen bringen kann. Amenkanische, australische, inzwischen auch hollandische, englische, japanische Universititen haben ihre Stande dort und bieten die Ware ,,Universitatsausbildung" auf Hochglanzbroschuren, mit Videos und den ublichen Werbegags an. Das Angebot ist kornpakt und ubersichtlich: Es ist ein Hoch- schulstudium rnit quasi garantiertem Ab- schluR in einem festen zeitlichen Rahmen zu einem festen Preis. ,,Tutorials" sind ebenso dabei wie ein Platz im ,,Dormitory". Sport
und Freizeitaktivitaten, ja sogar der Flug hin und zuruck gehort zum Paket. Geregelt sind selbstverstandlich auch die Fragen der Ein- reise und der Aufenthaltsgenehmigung. Der Vorteil: Wer das Paket kauft, weil3, was er hat, wann er es hat und zu welchem Preis er es hat.
Am deutschen Pavillion angekommen, wird der Besucher zunachst angenehm uberrascht mit der Information, daR ein Studium in Deutschland nichts kostet. Dies lost sowohl freudige Uberraschung aber auch Skepsis aus. Denn ist ein Studium, das gar nichts ko- stet, uberhaupt etwas wert? Der Hinweis auf hier bekannte und prestigetrachtige Quali- tatserzeugnisse aus Stuttgart und Munchen und den dahinter steckenden Ingenieursgeist mag solche Skepsis noch zerstreuen. Fragen nach den Voraussetzungen fur ein Studium konnen dann allerdings schon schwerer be- antwortet werden. Dies sei von Bundesland zu Bundesland durchaus verschieden, und die Autonomie der Hochschulen bringe es rnit sich, daR auch innerhalb eines Bundes- landes durchaus von den einzelnen Hoch- schulen Unterschiedliches verlangt werde. Ebenso vage mu8 die Antwort auf die Frage nach der Studiendauer bleiben. Fur jemand, der eine ,,Ware" fur einen festen Preis kaufen will, ist das schwer zu begreifen. Noch schlimmer wird es, wenn nach der Art des Abschlusses gefragt wird. Ein Diplom wird verliehen? Doch nicht das in Indonesien ub- liche Diplom fur Ausbildungsgange, die un- terhalb unserer Fachhochschulen anzusie- deln wiiren, sondern ein hochqualifizierter AbschluB, den vor allem die Industrie hoch einschatzt. Die bedauerliche Tatsache, daB die indonesische Regierung, geht es um den Staatsdienst, das deutsche Hochschuldiplom als lediglich ersten qualifizierenden Ab- schluB nur dem angelsachsischen Bachelor gleichsetzt, mussen wir vorsichtshalber vor- erst verschweigen, um niemand weiter zu er- schrecken. Kommt es zur Frage nach den Bedingungen fur den Aufenthalt in Deutsch- land, wird es ebenfalls knifflig. Die Ansicht, es sei besonders schwierig, fur Deutschland ein Visum zu erhalten, ist weit verbreitet. Weiter heiljt es, die Anforderungen seien zu streng, das Studium dauere zu lang, man musse vie1 Geld hinterlegen, man brauche viele Referenzadressen. Auch die Frage nach der personlichen Sicherheit spielt da eine Rolle. Die Presse habe doch uber Auslander- feindlichkeit berichtet, die sich auch gegen Asiaten richte. Dann die schwierige deutsche Sprache.
Kurzum, die Unsicherheit ist groR, der Ratsu- chende wendet sich in seinem Zweifel wie- der einem der Nachbarstande zu und unter-
~ ~ ~~ ~ ~ ~
490 Phys. BI. 54 (1998) Nr. 6

schreibt dort einen Vertrag, der das Studium zu einem festen Preis in einem festgelegten Zeitraum rnit einem bekannten und aner- kannten AbschluB garantiert - naturlich an einer amerikanischen oder australischen Uni- versitat. Dazu die Zahlen: in Australien stu- dieren zur Zeit noch ca. 18000, in USA ca. 16 000 Indonesier. Bei uns sind es nur 2300.
Ich denke jedoch, darj es im langfristigen In- ' teresse der deutschen Wirtschaft und des
Standorts Deutschland sein muB, wieder moglichst viele junge Menschen, die spater Fiihrungspositionen in ihren Landem in Wis- senschaft, Wirtschaft und Politik einnehmen, an unseren Universitaten und Hochschulen auszubilden. Freundschaften, die wahrend des Studiums geknupft werden, halten meist ein ganzes Leben lang und sind entscheidend auch fur die Entwicklung der langfristigen Beziehungen von Volkern und Staaten auf allen Gebieten. Der jetzige Vizeprasident In- donesiens und langjahrige Forschungs- und Technologieminister, Prof. Dr. B. .I. Habibie, ist ein beredtes Beispiel. Er hat in Aachen studiert und dort auch promoviert. Wer tut das heute noch? Der Blick in die Statistik war deutlich genug. Dabei studieren heute gotz Wirtschaftskrise insgesamt viermal so viele Indonesier im Ausland wie zu den Zei- ten als fur deren Vater Deutschland das Stu- dienland Nr. 1 war.
Was ist zu tun?
Asien als Bildungsmarkt bedarf sorgfaltiger und aufmerksamer Marktpflege. Fur die kiinftigen wirtschaftlichen Chancen Deutsch- land ist der Bildungssektor in zweifacher Hinsicht von strategischer Bedeutung. Zum einen wird es in der global vernetzten und global kooperierenden Welt des 21. Jahrhun- derts kiinftig fur unsere Wirtschaftsbeziehun- gen, insbesondere rnit Asien, noch wichtiger sein, Ansprechpartner vorzufinden, die in Deutschland ausgebildet worden und deshalb rnit unserem Denken und rnit unserem wirt- schaftlichen Handeln vertraut sind. Zum an- deren wird der Dienstleistungssektor ,,Aus- bildung" als Wirtschaftsfaktor kunftig erheb- lich an Bedeutung gewinnen. Bereits heute ist fur Australien dieser Bereich der am dynamischsten wachsende Devisenbringer. Deutschland rnit seinem Wissens- und For- schungspotential wird es sich auf Dauer nicht erlauben konnen, den Auf- und Ausbau die- ses Wirtschaftszweiges zu vernachlassigen.
Um zu den bereits sehr aktiven amerikani- schen und australischen Universitaten aufzu- schlieBen, bedarf es zweier Dinge. Wir miis- sen erstens unser Produkt verbessem und zweitens ein entsprechendes Marketing auf- bauen.
Was die Verbesserung des Produkts betrifft, ist es ermutigend zu sehen, daB immer mehr Universitaten in Deutschland den internatio-
nalen Wettbewerb im Bildungssektor erken- nen und aktiv annehmen, indem sie 2.B. eng- lischsprachige Studiengange einrichten und international anerkannte Abschlusse wie ,,Bachelor" und ,,Master" anbieten. DaB deutsche Universitaten hier bereits eigen- initiativ tatig werden und nicht auf Impulse von staatlicher Seite warten, ist positiv zu vermerken. Wichtig ist in diesem Zusam- menhang, daB das Produkt ,,Studium in Deutschland" als moglichst komplettes und einheitliches Paket angeboten wird. Zu einem solchen Paket sollten nicht nur ein klar umrissener Studienplan sowie studienbeglei- tende Fachberatung und -betreuung, sondern auch alle notwendigen praktischen und ad- ministrativen Elemente wie Visabeschaf- fung, Aufenthaltsgenehmigung bis hin zur Unterbringung gehoren. Solche umfassende Dienstleistungspakete konnten kommerziell von darauf spezialisierten Dienstleistern an- geboten werden, die den auslandischen Stu- denten sozusagen an der Hand nehmen und ihn sicher durch sein Studium steuern.
Ebenso ist ermutigend, dalj immer mehr Uni- versitaten aktiv auf ihre potentiellen auslan- dischen ,,Kunden" zugehen, wie an der wachsenden Beteiligung an der Ausbil- dungsmesse in Jakarta zu beobachten ist. Erste Schritte sind also getan, aber es wird noch immenser Anstrengung bediirfen, bevor sich Deutschland auf dem internatio- nalen Bildungsmarkt eine adaquate Position wird eningen konnen.
Wir mussen uns auch auf dem Bildungssek- tor dem internationalen Wettbewerb stellen, dort wo andere besser sind, von ihnen lernen
und selber moglichst innovative Ansatze ent- wickeln. Es ist absehbar, daB die gegenwiirti- ge Wirtschaftskrise in Sudostasien eine wei- tere Marktoffnung in allen Bereichen, auch im Bildungsbereich, bringen wird.
Es gilt bereits jetzt zu iiberlegen, welche Chance sich hinsichtlich der Kooperation im Bildungssektor daraus ergeben werden. Be- reits jetzt sollten die Moglichkeiten echter Joint-Ventures zwischen deutschen und asia- tischen Universitaten konkret gepriift wer- den. Solche Joint-Ventures konnten den Aus- tausch von Lehrpersonal, die Eroffnung von Universitatsniederlassungen in Asien, die Kombination von Grundstudium in Asien rnit Ausrichtung auf weiterfuhrendes Auf- baustudium in Deutschland zum Gegenstand haben (Sandwich-Studium). Interessant ware auch zu priifen, ob und inwieweit der Gedan- ke des Franchising sich auf den Bildungsbe- reich iibertragen liefie, 2.B. durch Zusam- menarbeit rnit indonesischen Universitaten bei der Cumculum-Gestaltung und der Ge- wahrleistung von Qualitatsstandards.
Asien als Bildungsmarkt ist im Begriff er- schlossen zu werden. Noch sind die Markt- anteile nicht fest vergeben, aber einige Wett- bewerber haben die Marktchancen friiher als wir erkannt. Es gibt vie1 zu tun, packen wir's an!
H. Seemann
Dr. Heinrich Seemann ist Deutscher Bot- schafter in Indonesien. (Anschrift: J1. M. H. Thamrin 1, Jakarta 10310, Indonesien)
Humboldt-Stipendien: Wer sind die groBten Gastgeber? 8 1 % der Humboldt-Forschungsstipendiaten wiihlten als Gastinstitution in Deutschland eine wissenschaftliche Hochschule. Dieser Prozent- satz ist seit langem konstant. Interessant ist, daB sich die Gewichtung der Spitzenuniversitaten in diesem ,,Humboldt-Ranking" in den letzten Jah- ren zum Teil deutlich verschoben hat. So stieg die FU Berlin im 10-Jahres-Vergleich vom 6. auf den 1. Platz (zusammen mit der LMU Munchen, die auch schon vor zehn Jahren auf Platz 1 stand). Die TU Munchen stieg vom 11. auf den 4. Platz. Die Uni Heidelberg blieb auf Platz 3. Deutlich verschlechtert haben sich die Uni Bonn (von 2 auf 6), die Uni K81n (von 4 auf 14), die Uni Frei- burg (von 7 auf 15) und die Uni Hamburg (von 9 auf 17). Der Anteil der Forschungsstipendiaten an Max-Planck-Instituten sank in den letzten zehn Jahren von 11,2 % auf 8,5 %; der der HGF- Zentren stieg dagegen von 2,3 % auf 3,3 %.
In dem erstmals seit 1986 wieder veroffentlichten ,,Humboldt-Ranking" sieht es fur die Physik so aus: Die zehn zahlenm2J?ig stiirksten Gastgeber
von Humboldt-Stipendiaten der Jahre 1993-97 waren das Forschungszentrum Jiilich rnit 18 Sti- pendiaten, gefolgt von den beiden Munchener Universitaten und der FU Berlin rnit je 16 sowie der U Bochum mit 14 und der U Heidelberg rnit 13 Stipendiaten. Jeweils 12 Stipendiaten waren zu Gast am DESY, der U Hamburg, der U Bonn und der U Kaiserslautern. Julich ist damit von Platz 12 auf Platz 1 geriickt.
Bekannt gegeben wurde das Ranking anlaRIich der Veroffentlichung des Jahresberichts 1997 der Humboldt-Stiftung Mitte Mai. Insgesamt unter- stiitzte die Humboldt-Stiftung 1997 2212 WE- senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus rund 90 Nationen der Welt. Die Zuwendungen an die Humboldt-Stiftung betrugen 1997 ca. 85 Mio DM, wovon ca. 60 % vom AuBenministe- rium und ca. 32% vom BMBF kommen. Der Jah- resbericht ist bei der Humboldt-Stiftung, Grund- satzabteilung, Jean-Paul-StraRe 12, 53 173 Bonn- Bad Godesberg, erhaltlich (Tel: 0228/833-184; Fax 0228/833-216, E-Mail [email protected]).
Phys. BI. 54 (1998) Nr. 6 49 1

Wissenschaftler fordern Energieforschungskonsens Zehn Wissenschaftler aus den unterschied- lichsten Gebieten der Energieforschung - Solarenergie, Windenergie, Biomasse, Fusi- onsenergie und Kernspaltung - haben Ende April in einem gemeinsamen Appell an Poli- tik und Offentlichkeit zur Neubestimmung der Prioritaten offentlich geforderter Ener- gieforschung aufgerufen. Ihre Motivation ist die Furcht, daR der gegenwartige Streit um die Energieversorgung auch in die For- schung hineingetragen werden konnte. Das in Zukunft zu erwartende Energieproblem erscheint den Unterzeichnern als so bedroh- lich, daR alle durch Forschung erschlieRba- ren Losungsmoglichkeiten erkundet werden sollten. Mit diesem Anliegen liegt der Appell auf der Linie des ,,Energiememorandums" der DPG aus dem Jahr 1995.
Im einzelnen geben die Experten Empfeh- lungen fur ein ,,energietechnisches Porte- feuille". Beispielhaft werden wichtige Felder der Energieforschung in ihrer unterschiedli- chen zeitlichen Wirksamkeit, ihrem unter- schiedlichen Stand zwischen Forschung und Markteinfuhrung beschrieben. Es sol1 ge- zeigt werden, daR ein betrachtliches Ent- wicklungs- und Innovationspotential vorhan- den ist. Unterzeichnet ist der Appell von H. Albrecht, Stuttgart, A. Birkhofer, Garching, G. EisenbeiB, Koln, M. Fischer, Stuttgart, K. Heinloth, Bonn, W. Kleinkauf, Kassel, F. Mayinger, Garching, H. Mohr, Freiburg, K. Pinkau, Garching, und E. te Kaat, Klein- machnow.
Aus Platzgriinden ist im folgenden nur ein Teil der Empfehlungen wiedergegeben, nicht die jeweils vorangehenden Begrundungen. Im Wortlaut kann man den Appell nach- lesen unter http://www.ipp.mpg.de/ipp/ Energiememo.html.
Rationeller Umgang mit Energie Trotz der hohen Prioritat der Energieein- sparung durch Effizienzsteigerung ganzer Systeme scheint ein Ansatz staatlicher For- schungsforderung nur in Ausnahmefallen grol3en Entwicklungspotentials, hohen Risi- kos und unzulanglicher Marktverhaltnisse angebracht; ansonsten ist hier eher eine Wirt- schafts- und Energiepolitik gefragt, die die Randbedingungen wirtschaftlichen und pri- vaten Handelns fur Energieeffizienz gunstig gestaltet.
Kernfusion Das erschlieljbare Energiepotential der Kern- fusion ist so groB, daR die Staatengemein- schaft erforschen und zeigen muB, ob und wie es erschlossen werden kann; dafur hat sich bereits jetzt eine weltweite Zusammen- arbeit gebildet. Fur die Wirtschaft sind die notwendigen Aufwendungen in Anbetracht der Risiken und Langfristigkeit nicht leistbar.
Es ist eindeutig, dal3 das Potential dieser Technik ohne staatliche Finanzierung der notwendigen Forschung und Entwicklung und ohne Forderung der internationalen Ko- operation nicht realisiert werden kann.
Nukleare Sicherheit Es besteht ein Entwicklungspotential und Forschungsbedarf in Verfahren, Materialien und Komponenten mit dem Ziel hoherer Si- cherheit, Vermeidung unnotiger Kosten und Entsorgung radioaktiven Materials. Diese Aufgaben mussen unabhangig von Indu- strieinteressen wahrgenommen werden und konnen daher nicht der Industrie zugescho- ben werden.
Biomasse Aufgaben fur weitere Forschung und Ent- wicklung sind schwerpunktrnlRig Probleme der Logistik, der Bevorratung und der Brennstoffaufbereitung, Zuchtung neuer Sorten bei Energiegetreide. Wichtig ist auch Forschung zur Optimierung der Fruchtfolgen beim Energiegetreide. Bei der Entwicklung geeigneter Marktanreizprogramme pladieren die Unterzeichner vorrangig fur eine Investi- tionsforderung (Anschubfinanzierung) bei Produktion und Nutzung von Biomasse. Diese sollte sich an dem zu erwartenden Nut- Zen-Kosten-Verhdltnis orientieren. Dieses wiederum errechnet sich nicht nur betriebs- wirtschaftlich, sondern nach MaBgabe von Okopunkten, zum Beispiel sollten die C0,- Minderungskosten eine wesentliche Rolle spielen.
Photovoltaik Trotz wieder zunehmendem Wirtschaftsen- gagements fur Fertigung und Vermarktung auch vom Standort Deutschland aus kann of- fentliche Forschungsfinanzierung noch nicht durch Auftrage der Unternehmen ersetzt werden, da Umsatze und Gewinne dies noch fur einige Zeit nicht hergeben. Auch muR die weitere Entwicklung begleitet sein von staat- lichen Programmen der Markterweiterung in Deutschland und in Landern der Dritten Welt.
Solarthermische Kraftwerke Entwicklungspotential und Forschungsbe- dai-f besteht in Verfahren und Komponenten; hier konnen Kostensenkungen erarbeitet werden, die den Eintritt in den Markt sowie seine Erweiterung wesentlich erleichtern konnen. Auch sind gerade in Deutschland neue Wege beschntten worden, Sonnenener- gie mit hochsten Wirkungsgraden in moder- ne Gas- und Dampfturbinenkraftwerke ein- zubringen. Diese Fortschritte sind zur Zeit besonders gefahrdet. Die noch bestehende ZuschuBabhdngigkeit, die GroRe des Einzel- projektes sowie Beschrankung nioglicher Anwendung auf den Sonnengurtel der Welt
halten den Eigenaufwand selbst der enga- gierten Unternehmen in engen Grenzen. Die weiterfuhrende Forschung und Entwicklung hdngt daher entscheidend von offentlicher Forderung ab.
Windenergie Gestutzt auf langfristige Forderprogramme und gesetzliche Rahmenbedingungen ist hier insbesondere in Deutschland eine Entwick- lungsdynamik entstanden, die nicht fur mog- lich gehalten wurde. Gleichwohl bestehen noch bedeutende Entwicklungspotentiale, die zur Kostensenkung und Erweiterung der Marktchancen genutzt werden mussen; dabei ist auch die Erganzung mit leistungssichern- den Anlagen wichtig. Die zukunftigen ener- giewirtschaftlichen Bedingungen und die Forderung von Verbundvorhaben von Indu- strie und Instituten werden entscheidenden EinfluR haben, ob dies gelingt.
Hybridanlagentechnik Aus systemtechnischer Sicht ist ein innovati- ves Konzept gefragt, das sich trotz stark un- terschiedlicher Einsatzbereiche auf einfache Weise entwerfen und kostengunstig umset- zen IaBt. Diese Anforderungen erfullt eine Anlagenstruktur, die aus unterschiedlichen, standardisierten Umwandlungs- und Spei- cherbausteinen besteht, deren energie- und kommunikationstechnisches Zusammen- spiel aufeinander abgestimmt ist. Dies ist eine komplexe Entwicklungsaufgabe, die noch geleistet werden muR.
Die Unterzeichner nehmen auch zur Ausbil- dungssituation auf dem Gebiet der Energie- technik Stellung. Hierzu heiRt es: ,,Im Hoch- schulbereich stellt der Ruckgang in den inge- nieurwissenschaftlichen Studiengangen eine besondere Gefahrdung auch der energietech- nischen Ausbildung, Forschung und Ent- wicklung dar. Hier ist nicht nur eine Beratung von Abiturienten uber die Bedeutung von Naturwissenschaften und Ingenieurwesen fur die Zukunft unseres Landes notwendig, son- dem auch eine bessere Ausstattung der Hoch- schulen sowie die Forderung von energie- technischen Forschungsprojekten, um eine praxisorientierte Ausbildung sicherzustellen. Nachwuchsforderung, Promotionsstipendien und Verbundforschungsprogramme sollten in diesem Zusammenhang verstarkt werden. Auch mu8 bei finanzierungsbedingten Stel- lenabbauprogrammen berucksichtigt werden, daR langfristig angelegte Energieforschungs- programme wie die der ErschlieRung der Kernfusion und der Sonnenenergie Spiel- raum fur Nachwuchswissenschaftler behal- ten; dies gilt fur alle Einrichtungen der deut- schen Energieforschung. Die international starke Stellung der deutschen energietechni- schen Industrie ware ohne gezielte MaRnah- men in diesem Bereich gefahrdet."
492 Phys. BI. 54 (1998) Nr. 6

Diese Forderungen sind auch ein DPG-An- liegen, wie man in den Statuten des Arbeits- kreises Energie (AKE) liest, wonach die ,Pflege, Forderung und Intensivierung der akademischen Forschung und Lehre im Be- reich der Energietechnik in den Fakultaten fur Physik" zu den Aufgaben des AKE zahlt.
Im letzten Abschnitt wenden sich die Unter- zeichner direkt an die Politik: ,,Obwohl unser Pladoyer in Ubereinstimmung steht mit den Erklarungen von Parteien und Regierungen zur Notwendigkeit nachhaltiger Entwick- lung, wissen wir, dal3 sich unsere Empfeh- lung gegen einen Haupttrend der Politik wendet, namlich den Ruckzug des Staates auf Kemgebiete und Einsparungen in den of- fentlichen Haushalten. Wir wissen auch um die Bedeutung dieser Bemuhungen und be- furworten sie weithin. Wir sind aber weder unrealistisch noch als Verantwortliche in der deutschen Energieforschung egoistisch, wenn wir unsere Stimme dafur erheben, die ausgelosten Veranderungen in der Energie- wirtschaft neu zu analysieren und die grol3e gesellschaftliche Aufgabe ausreichender und umweltfreundlicher Energievorsorge fur das nachste Jahrhundert wieder stiirker in die of- fentliche Verantwortung zu nehmen."
Fundig werden durch Forschungsprospektion
Forschungsprospektion bedeutet die Suche nach neuen und kunftig bedeutsamen The- men in Forschung und Technologie unter Einbezug gegenwiirtig bereits erkennbarer Schwerpunkte und Tendenzen. Durch sie las- sen sich attraktive Gebiete benennen, aber nicht Forschungsergebnisse vorhersagen; Wissenschaft sol1 und wird immer wieder vollig uberraschende Erkenntnisse finden - so der Wissenschaftsrat, der 1994 empfahl, dieses in anderen Industriestaaten seit lan- gem genutzte forschungspolitische Instru- ment auch in Deutschland zu etablieren. In- zwischen liegen die Ergebnisse einer Pilot- studie zu ausgewahlten Gebieten der Materi- alforschung vor.
Ausgehend von der These, dal3 Neues vor allem ,,zwischen" den Disziplinen entstehe, verstandigte sich die eigens eingesetzte zwolfkopfige Arbeitsgruppe aus Vertretern der grol3en deutschen Wissenschaftsorgani- sationen darauf, einen Schwerpunkt auf in- terdisziplinare Forschungsthemen aus Phy- sik, Chemie, Biologie u. a. zu legen. Moleku- lare Architektul; Molekular- und Bioelektro-
nik sowie Durch innere Grenflachen be- stirnrnte Materialien waren die ausgewiihlten Gebiete, die durch Expertenbefragungen (Peer Review), bibliometrische Kartierungen (d. h. das Erfassen und statistische Auswer- ten aller weltweit zu einem Thema erschei- nenden Publikationen) sowie die Verknup- fung mit vorliegenden Delphi-Untersuchun- gen analysiert wurden.
Nach einer naheren Definition der einzelnen Gebiete weist die Studie jeweils u. a. ,,Lan- gerfristig zu bearbeitende Fragestellungen" sowie ,,Anwendungsmoglichkeiten und Pro- duktvisionen" aus. Letztere umfassen bei- spielsweise neuartige Fasem oder Schichten mit besonderen mechanischen Eigenschaf- ten, organische Leuchtdioden oder Transisto- ren (,,Biochips") oder Bio- und Chemosen- soren. Gegenuber der klassischen Material- forschung betont die Studie, dal3 der Einbe- ziehung biowissenschaftlicher Disziplinen entscheidende Bedeutung zukommt, was zu einer ,,bioinspirierten Chemie und Physik" fuhren wird. Die bibliometrischen Analysen zeigen, dal3 amerikanische und japanische
Phys. BI. 54 (1998) Nr. 6 493

Publikationen die drei angefuhrten Gebiete dominieren. Deutschland belegt bei den elf wichtigsten Teilgebieten der molekularen Architektur viermal zweite Positionen, er- reicht bei der Molekular- und Bioelektronik sowie den grenzflachenbestimmten Materia- lien jedoch nur dritte bis funfte Positionen. Bemerkenswert ist der hervorragende Stand einzelner deutscher Universitaten oder aufieruniversitarer Institute in einzelnen Teil- gebieten. Demgegenuber sind industrielle Forschungslabors aus Deutschland im Ver- gleich zu solchen in USA und Japan nur in verschwindend geringem Umfang aktiv (ausfuhrliches Material ist im WWW unter http://sahara.fsw.leidenuniv.nl/ed/intro.html zu finden). Insgesamt ergeben sich zum Teil sehr differenzierte Fach- und Landerprofile, mit denen sich Aktivitatszentren bestimmen lassen - also wesentliche Ansatzpunkte fur
Das Netz der Netze - und Wahrend das Web exponentiell wachst, lei- den die Nutzer zusehends unter verstopften Leitungen (WWW = World Wide Waiting) und dem Problem, Spreu vom Weizen tren- nen zu mussen. Jeder kennt diese frustrieren- de Erfahrung: Auf der Suche nach einer be- stiminten Information liefert eine Suchma- schine zigtausend Eintrage, von denen die meisten vollig irrelevant sind. Ein paar davon steuert man dennoch an, um bald ent- nervt aufzugeben - uberzeugt davon, daR die gesuchte Information zwar irgendwo ,,da drauRen" vorhanden ist, es aber nicht gelun- gen ist, bis zu ihr vorzustofien. Diese Erfah- rung 12Rt sich durch hartes Zahlenmaterial untermauern, wie zwei Arbeiten zur Efflzi- enz von Suchmaschinen bzw. zum Verhalten von ,,Surfern" in Science belegen.
S. Lawrence und C. Lee Giles, zwei ameri- kanische Computerwissenschaftler, beauf- tragten die Suchmaschinen AltaVista, Exci- te, HotBot, Infoseek, Lycos und Northern Light mit der Suche nach rund 600 Begrif- fen, die Mitarbeiter von NEC aus berufli- chem Interesse ausgewahlt hatten, und erfalj- ten samtliche Antworten [Science 280, 98 (1998)J. Ausgehend von den bekannten 110 Mio. Webseiten, in denen HotBot nachge- wiesenermafien sucht, laRt sich aus dem Uberlapp der Antworten von verschiedenen Suchmaschinen die GroRe des Web auf 320 Mio. Seiten abschatzen. Der Haken daran: Selbst die beste Suchmaschine durchsucht gerade ma1 ein Drittel davon, die anderen teilweise deutlich weniger, und von den Ant- worten sind obendrein bis zu 5% ungultig, weil veraltet. (s. Tabelle).
Fur den Nutzer bietet sich als Ausweg an, die Antworten mehrerer Suchmaschinen durch eine Meta-Suchmaschine zu kombinieren
forschungspolitische Uberlegungen zu Lei- stungsspitzen, Schwerpunktbildungen, zur Notwendigkeit von Kooperationen usw.
Insgesamt wird die Prospektion in der Studie als ein erfolgversprechendes, kunftig ver- mehrt zu nutzendes Instrument bewertet, das jedoch ,,sehr sorgfaltig und methodisch re- flektiert" eingesetzt werden muR. Prospekti- on darf nicht mit dem Versuch verwechselt werden, wesentliche Forschungsgebiete einer externen Steuerung im Sinne eines top down-Ansatzes zu unterwerfen; durch die in- tensive Beteiligung von Wissenschaftlern sei Prospektion vielmehr einem bottoin upPrin- zip verpflichtet.
Der abschliefiende Teil der Studie widmet sich den forschungs- und technologiepoliti- schen Defiziten in Deutschland, die einer
seine Grenzen
Suchmaschine Abdeckung Ungultige des Web links
HotBot 34 % 5.3 % AltaVista 28 % 2.5% Northern Light 20% 5.0% Excite 14% 2.0% lnfoseek 10% 2.6% Lycos 3 % 1.6%
(beispielsweise MetaGer, meta.rrzn.uni- hannover.de, in Deutschland oder Metdcra- wler, www.metacrawler.com). Aber selbst das ist im allgemeinen noch unbefriedigend, wenn es darum geht, wissenschaftliche Daten oder Dokumente zu finden. Ein Ian- gerfristiger und speziell auf die Bedurfnisse von Wissenschaftlern zugeschnittener Aus- weg sol1 mit dem ProjekrEPRINT ausgelotet werden, das im vergangenen Jahr an den Universitaten Augsburg, Darmstadt, Halle und Oldenburg angelaufen ist: EPRINT (www.eprint.de) steht fur E-mnt-Server zur Informationsvermittlung in Naturwissen- schaft und Technik und sol1 durch die Ent- wicklung standardisierter Metadatensatze Abhilfe schaffen beim Hauptmanko der ak- tuellen Webseiten: der fehlenden ,,Beschlag- wortung". (vgl. auch den Artikel von E. Hilf, Phys. BI., April 1997, S. 310).
Derweil haben B. H. Hubermann und Kolle- gen vom Xerox Palo Alto Forschungszen- trum die Surfgewohnheiten von 25000 Nut- 'zem des Dienstes America Online analysiert [Science 280,95 ( I 998)]. Sie fanden charak- teristische Gemeinsamkeiten, die sich im Rahmen eines Kosten-Nutzen-Modells be- schreiben lassen: Demnach bricht ein Nutzer das Surfen dann ab, wenn er den zu zahlen- den Preis (im ubertragenen Sinne) fur die nachste Seite hoher einschatzt als den zu er-
Verstandigung uber mittel- und Iangerfristige Perspektiven in Forschung und Technologie sowie einer effektiven Umsetzung wissen- schaftlicher Erkenntnisse in technische Inno- vationen im Wege stehen. Dazu rechnen die Autoren die mangelnde Verstandigung uber Ziele und Themen auf nationaler Ebene, den fehlenden Konsens uber Ziele, Methoden und Einsatz einer Forschungsprospektion, die zu geringe Interdisziplinaritat (die Aus- bildung des wissenschaftlichen Nachwuch- ses ist disziplinar angelegt; Professuren sind i. a. einzelnen Fachgebieten zuzurechen; die Forschungsforderung ist disziplinar organi- siert), die unzureichende Verknupfung von Wissenschaft und Wirtschaft sowie den Mangel an langfristigem Denken und an Ri- sikobereitschaft.
S. J./WR Drs. 3387/98
wartenden Wert. Dieses Modell erkI2rt auch die schon seit einigen Jahren bekannte Tatsa- che, dalj die Anzahl der Zugriffe auf die ein- zelnen Seiten eines Website einer sehr weit verbreiteten Verteilung folgt: der Pareto- oder Zipf-Verteilung (P(x) - x"', CI in der GroRenordnung von I), nach der sehr weni- ge, sehr haufig besuchte Seiten einer sehr groRen Anzahl von praktisch gar nicht be- suchten gegenuberstehen. Das beruhmteste Beispiel fur die Zipf-Verteilung (nach dem Linguisten George Zip0 ist die Haufigkeits- verteilung der Worter in einer Sprache.
Bald der Vergangenheit angehoren wird die unbefriedigende Darstellung von mathemati- schen Formeln im Web. Bisher ging das nur durch das Einbinden von gif- oder jpg-Bil- dern im Bitmap-Format, so daR zum einen die logische Struktur einer Formel vollig ver- loren ging und man zum anderen auch nicht nach Formeln suchen oder sie in andere An- wendungen ubemehmen konnte. Das World Wide Web Consortium (www.w3.org) hat daher eine Empfehlung fur die Mathematical Markup Language (MathML) ausgespro- chen, die auf der neuen Metasprache XML (Extensible Markup Language) beruht. XML ist sehr vie1 machtiger als die jetzige Lingua franca des Internet HTML und wird diese mittelfristig ablosen.
S. Jorda
494 Phys. B1.54 (1998) Nr. 6

I I I I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I I I
Das RM-21 ist ein kompaktes und hochwertiges Dosimeter zur Messung von Bestrahlungsstarke und Dosis im optischen Spektralbereich von 200 bis 700 rim. Es erlaubt den AnschluO von zwei Sensoren gleichzeitig. Wesentliche Vorteile gegenuber herkomm- lichen, vergleichbarer Dosimeter sind die handliche, mobile Handhabung (Batterie), geringe Restempfindlichkeit auOerhalb des MeObereiches be1 sehr gunstigen Anschaf- fungskosten. Fehlbedienungen sind durch I die einfache Menufuhrung weitgehend aus- /A\ - - I geschlossen.
I tragung der MeOdaten in einen Rechner , moglich.
Eine serielle Schnittstelle macht die Uber-
Dr. Grobel UV-Elektronik GmbH I Goethestr. 17 I
I I
1 Es besteht die Moglichkeit, I zwei Sensoren verschiedener
Spektralbereiche wie UV-C, D-76275 Ettlingen I UV-B, UV-A und fur den sicht-
baren Bereich anzuschlieOen L - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - -
T: 0 72 43-3 15 97 F: 0 72 43-1 39 02
Zum Thema: ,,Low Noise<< Vorverstarker Breitbandverstarker fur den
Ohm bis Giga Ohm lmpedanzbereich
Modell 565 d l t r a Low Noise - Low Impedance.. Verstarker mit Transformatorkopplung.
0 Rauschen OJ5 n V / m R s opt. 0,5 Ohm bis 50 Ohm 0 Verstarkung 60 dB, Bandbreite OJ Hz - 200 kHz
Modell 566 >>Low Noise - Medium Impedancef<Verstarker mit unsymmetrischem Eingang.
0 Rauschen 1,2 n V / m Rs opt. 50 Ohm bis 10 kOhm 0 Verstarkung 40/60 dB, Bandbreite DC bis 2 MHz
Modell 568 >.Low Noise - High Impedance.< Verstarker mit diffprentiellem Eingang.
0 Rauschen 8 n V / f & ' R s opt. 4 kOhm bis 3 GOhm 0 Verstarkung 20/40 dB, Bandbreite DC bis 10 MHz
Modell 571 Breitbandverstarker mit direkter und transformato- rischer Eingangskopplung.
0 DC bis 100 MHz,Verstarkung 20/40 dB
Stromverstarker fur Fotodetektoren - .. - -
Modell 564 ist in miniaturisierter Bauform als Kabelvorverstarker speziell fur den unmittelbaren AnschluO an Fotomultiplier und Halbleiterdetektoren geeignet. Die umschaltbare DC/AC Kopplung sowie hervorragende Rausch- u. Driftdaten ermoglichen den Einsatz als Vorverstarker fur Lock-In Verstarker, Transientenrecorder, A D - Wandler, Oszilloskope etc.
0 Empfindlichkeit von 10-4-10-10A/V 0 Rauschen 1,3 x A e d m bei lO-'A/V 0 Bandbreite DC bis 250 kHz bei A/V 0 Einstellbare Detektorbias 0 bis 1OV 0 Abmessungen 60 x 80 x 43 mrn, 0,3 kp
Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an.
Hans M. Strassner GmbH Am Arenzberg 42 51381 Leverkusen 23 021 71 13814-5 . Fax 021 71 I33852
Digital Instruments GmbH JanderstraRe 9, D-68199 Mannheim Tel.: 06 21/842 1 O-O,,Fax: 06 21/842 10-22
Phys. B1.54 (1998) Nr. 6 495

Auf der Suche nach der Energie der Zukunft AKE-Podiumsdiskussion auf der 62. Physikertagung in Regensburg
Die Zunahme der Weltbevolkerung .und die rasche wirtschaftliche Entwicklung in vielen Landem lassen den Energiebedarf der Menschheit stetig wachsen. Eine stabile oko- nomische und gesellschaftliche Entwicklung setzt ein ausreichendes Energieangebot vor- aus. Die fossilen Energietrager sind derzeit sehr preiswert, doch das kann sich andern, sobald ihre Verknappung spurbar werden sollte. Nachteilige Wirkungen auf Umwelt und Klima entfalten sie schon heute. Die Nutzung der Kemenergie erschlieRt zwar ge- waltige Energieressourcen, zugleich hinter- 1aRt sie aber auch groBe Mengen an radioak- tivem Abfall, der fur Jahrtausende sicher auf- bewahrt werden muR. Die Wissenschaftler suchen seit langem nach Altemativen zu die- sen nicht unproblematischen Energiequellen. Der Arbeitskreis Energie (AKE) der DPG hat drei profilierte Vertreter neuer Energie- technologien zu einer gutbesuchten Podi- umsdiskussion geladen, die unter dem Motto ,,Energy Options for Tomorrow" stand.
Diskussionsteilnehmer: Pro$ Dr Joachiin Luther, Direktor des Fraunhofer-Instituts fur Solare Energiesyste- me, Freiburg Prof: DK Klaus Pinkau, Wissenschaftlicher Direktor des MPI fur Plasmaphysik, Gar- ching Prof: DI: Curlo Rubbia, CERN
Zu Beginn skizzierte Klaus Pinkau vom MPI fur Plasmaphysik in Garching den derzeiti- gen Stand der Fusionsforschung. ,,Wir wol- len den FusionsprozeR, der in einem Plasma aus Deuterium und Tritium stattfindet, mit einem Magnetfeld einsperren. Die entstehen- den Alphateilchen heizen das Plasma auf, so daR die Fusion in Gang gehalten wird." Dabei sei der Stahlmantel des Fusionsreak- tors einer starken Neutronenstrahlung ausge- setzt. ,,Er kann aber so konstruiert werden, dab seine Dosisrate innerhalb von 100 Jahren auf das hands-on level abgefallen ist." Nach dieser Zeit konne man das Material wieder benutzen. An zwei Reaktortypen werde gear- beitet, dem Tokamak und dem Stellarator. Der Tokamak besitzt ein von Spulen erzeug- tes toroidales Magnetfeld. Das Plasma wird dadurch festgehalten, daR ein in ihm flieBen- der Strom die Magnetlinien verdrillt. Da der Strom nur kurze Zeit flieBt, konne der Toka- mak bisher nur gepulst betrieben werden. Ein Stellarator, wie er zur Zeit in Greifswald gebaut wird, kann hingegen dauerhaft bren- nen, weil bei ihm das Magnetfeld durch ex- teme Spulen verdrillt wird. ,,Schon vor 15 Jahren," so Pinkau, ,,wuRten wir, wie man die Fusion erreichen kann. Es fehlte aber noch die experimentelle Bestatigung." Heute wisse man daruber hinaus, wie grol3 ein Fusi- onsreaktor sein mu13 und wie man ein geeig-
netes Plasma erzeugt. Auch das Problem der Warmeabfuhr sei mittlerweile gelost: ,,Wir lassen die Teilchen den groBten Teil ihrer Energie durch elektromagnetische Strahlung loswerden. Dadurch begrenzen wir die Bean- spruchung der WInde auf 5MW/m2 - und das konnen die uns zur Verfiigung stehenden Materialien aushalten." Beim Internationa- len Thermonuklearen Experimentalreaktor ITER, den die USA, Japan, RuRland und Eu- ropa bauen wollen, werde die Fusion erst- mals selbstandig ablaufen. Pinkau ging auch auf den Streit urn die hohen Kosten von ITER ein - 12Mrd.DM werden genannt. ,,Auf einem Treffen von 20 internationalen Vertretem Ende MPrz in Garching ist verein- bart worden, mit einem verkleinerten und preiswerteren ITER dasselbe Ziel zu errei- chen. Dazu wird ein Tokamak gebaut, bei dem der Stroni im Plasma durch Neutralteil- chen- oder Laserstrahlung von auRen getrie- ben wird."
,,Schon vor 15 Jahren wul3ten wir, wie man die Fusion erreichen kann." K. Pinkau
,,Im Vergleich zur Kernfusion ist unser Vor- schlag vie1 bescheidener", meinte Carlo Rub- bia, Physik-Nobelpreistrager des Jahres 1984 und ehemaliger CERN-Direktor, uber einen ,,EnergieverstPrker", der unter seiner Leitung am CERN entwickelt worden ist. Wichtiger Teil dieses Reaktors sei ein Protonenbe- schleuniger, der ein Blei-Target bestrahlt und durch Spallation Neutronen erzeugt. Die Neutronen entweichen dem Blei, das ein idealer ,,Neutronenleiter" ist, und wandeln Thorium-232, den Brennstoff des Reaktors, in Thorium-233 um, das dann schliel3lich zu Uran-233 wird [vgl. z. B. M. Schwarzenberg, Physik i. u. Zeit 6/97, S. 2591. ,,Aus dem nichtspaltbaren Thorium-Brennstoff wird also spaltbares Uran erbrutet. Wenn man davon genug hat, kommt es zur Kemspaltung und zur Produktion von Energie und weite- ren Neutronen." Bei der Reaktortemperatur von iiber 400 "C ist Blei flussig und kann durch Konvektion die entstehende Warme zum Warmetauscher transportieren. ,,Unter geeigneten Bedingungen komint dabei mehr Energie heraus, als fur den Betrieb des Be- schleunigers benotigt wird." Der Reaktor sei sicher, meinte Rubbia, denn schalte man den Beschleuniger ab, so komme die Energieer- zeugung augenblicklich zum Stillstand. Mischt man dem Thorium radioaktive, Abfal- le bei, so konnen diese ebenfalls umgewan- delt werden. ,,Wir erzielen mit diesem Reak- tor also dreierlei: die Beseitigung uner- wiinschter radioaktiver Abfalle, die Produk- tion von Energie auf sauberem Wege und die Herstellung kurzlebiger radioaktiver Isotope fur die medizinische Anwendung." Der Re-
aktor konne zur Losung des globalen Ener- gieproblems beitragen, erklarte Rubbia. ,,Um den Weltenergieverbrauch zu bestreiten, benotigt man 3900 Tonnen Thorium im Jahr. Das ist relativ wenig, denn Thorium kommt fast so haufig vor wie Blei."
,,Unser Reaktor beseitigt radioaktiven Abfall und erzeugt Energie und radioaktive Isotope
fur die Medizin." C. Rubbia
Joachim Luther vom Fraunhofer-Institut fur solare Energiesysteme in Freiburg konnte, im Gegensatz zu seinen Vorrednem, eine schon erprobte Technologie vorweisen [vgl. z. B. W. Wettling, Phys. BI., Dezember 1997, S. 11971. Luther: ,,Im Zusammenhang mit der Sonnenenergie haben photovoltaische Systeme bei weitem das groRte Potential." Beim photovoltaischen Effekt erzeugt Licht in einem Material freie Ladungen. Eine Asymmetrie im benutzten Material IaRt die Elektronen zur einen Elektrode wandem und die Locher zur anderen. Fur Solarzellen werde vor allem der Halbleiter Silizium be- nutzt, wie er fur die Mikroelektronik herge- stellt wird. Eine typische Solarzelle besteht aus einem 300 mm,dicken und 10 cm ma1 10 cm groRen Wafer. Eine solche Zelle liefert eine Spannung von etwa 0,5 Volt und eine Leistung von 1 Watt. Die Photovoltaik zeige jahrliche Wachstumsraten von 15%, die damit noch uber denen der Elektronikindu- strie liegen. Alle 1997 weltweit produzierten Solarzellen haben jedoch zusammengenom- men nur eine Spitzenleistung von 100 MW. Verglichen mit dem globalen Energiebedarf sei dies vollig vemachlassigbar. ,Zur Erzeu- gung grol3er Leistungen ist die Photovoltaik zur Zeit nicht geeignet. Deshalb wiirde ich sie auch nur als Option fur die zukunftige Energieversorgung bezeichnen, ahnlich der Fusion." Der Grund fur diese ernuchternde Situation liege an den hohen Kosten der So- larzellen. ,,Die fur unsere meteorologischen Verhaltnisse errechneten Kosten liegen zwi- schen 1,20 DM und 1,80 DM pro kW. Das ist fur die absehbare Zukunft nicht konkurrenz- fahig." Doch Luther versicherte, daR dieser Preis schon mit heutiger Technologie zumin- dest halbiert werden konne. Gehe man in den Mittelmeerraum, sei eine weitere Halbierung des Preises moglich. Luther: ,,Ich bin davon uberzeugt, daR die Photovoltaik konkurrenz- fahig werden wird." Es habe jedoch keinen Sinn, nur zu forschen und zu warten bis der Energiepreis der Photovoltaik niedrig genug sei. ,,Wir brauchen eine Strategie, wie wir mit diesen Technologien auf den Markt kom- men. Heute haben wir schon die netzunab- hangige Nutzung, z. B. auf dem Lande oder die Energieversorgung von Telekommunika- tionsnetzen." Dies sei ein exponentiell wach-
496 Phys. B1.54 (1998) Nr. 6

sender Markt, der ubrigens nicht subventio- niert werde. Als nachstes musse man in den Markt hoher Leistungen kommen. Doch um die Kosten der Solarzellen zu senken, benoti- ge man nicht nur wesentlich mehr For- schungsmittel als bisher, man musse auch verstkkt in Produktionstechnologien inve- stieren. Da 1997 ungefahr 100Mio. Wafer .produziert worden seien, konnten verbesser- te Fertigungstechniken vie1 bewirken. Eine der sich abzeichnenden Moglichkeiten, um den Preis zu reduzieren, sei die Entwicklung einer Siliziumtechnologie, die nicht wie bis- her vor allem an den Interessen der Chip- Hersteller orientiert ist.
In der anschlieRenden Diskussion bedauerte Klaus Pinkau, dal3 in Deutschland die ver- schiedenen Energietechnologien gegenein- ander ausgespielt wurden: ,,Weder in Deutschland noch in der Welt hatten wir je- mals nur ein einziges Energiesystem. Die Nutzung der Sonnenenergie wird in dem MaRe zunehmen wie sie konkurrenzfahiger wird. Warum also mit ideologischen Argu- menten uber etwas streiten, was der Markt
von sich aus regeln wird." Fur unsere Ener- gieversogung konnten kurzfristig Probleme entstehen, die sich dann nur in einer Zeit von mehreren Jahrzehnten durch die Entwick- lung neuer Energiesysteme losen lieRen. ,,Es ist unklar, welche Technologie an die Stelle bestehender treten soll. Ich hake die Situati- on in Deutschland fur sehr bedenklich, in der keine Einigung erreicht werden kann, weil jeder seine Energieart fur die einzig richtige halt." Die Regierung vernachlassige die Energieforschung, weil sie ihr politisch zu riskant sei. Pinkaus Fazit: ,,Wir sind nur sehr schlecht auf die Zukunft vorbereitet."
Joachim Luther meinte, ihm werde oft ge- sagt, daB die Photovoltaik einfacfi zu teuer sei und nicht konkurrenzfahig werden konne. ,,Aber rnit einer Forschung in groRem Rah- men und einer GroBproduktion konnten die Dinge bald ganz anders aussehen. Ich wurde den von Prof. Pinkau erwahnten ITER rnit 1 GWh pro Jahr schon als GroBproduktion be- zeichnen. Gabe es so etwas fur die Photovol- taik, dann wiirjten wir, was machbar ist. Und genau das mu13 geschehen."
Auf die Frage aus dem Publikum, welche Entwicklungszeit sein Reaktor benotige, ant- wortete Rubbia: ,,Der Reaktor enthalt keine technologischen Unbekannten. Eine Demon- strationsanlage mit etwa 200MW wird ca. 500Mio.DM kosten und konnte in 5 bis 6 Jahren gebaut werden." Zunachst solle ge- zeigt werden, daR diese Anlage Plutonium eliminieren kann. Naturlich werde dabei auch Energie gewonnen. In Frankreich gebe es Plane, ab 2006 auf diese Weise nuklearen Abfall zu beseitigen.
Klaus Pinkau antwortete auf den Einwand aus dem Publikum, daR die Energieprobleme zu sehr aus Sicht der Induktrienationen gese- hen wurden: ,,Das World Energy Council sagt vorher, daR alle Nationen mehr Energie und Elektrizitat zur Verfugung haben wollen. Vor allem in den Landern der Dritten Welt ist die Nachfrage nach billigen, fossilen Brennstof- fen groB. Die Industrienationen haben des- halb die Verantwortung, nach Moglichkeit Hochtechnologie-Energieformen zu nutzen und die Vorrate an fossilen Brennstoffen zu schonen." Darauf ging Joachim Luther ein: b
IMAGINATA - ein Experiment fur alle Sinne Haben Sie schon einmal mit Klangfarben gemalt, die Tiir mit lhrer Stimme geofiet, dem Vor- lesen eines Blinden gelauscht? Wollen Sie Ihren akustischen Fin- gerabdruck hinterlassen, das Horlabyrinth erkunden oder sich im schalltoten Raum entspan- nen? Horten Sie jemals von der Sprechmaschine des Baron von Kempelen (nach Planen aus dem 18. JH. neu konstruiert), bei der Laute und Worter mit den Han- den gefonnt werden? Die som- mer-Imaginata in Jena bietet vom 16. bis 21. Juli diese und an- dere, iiberraschende Sinnes- wahrnehmungen, faszinierende Phanomene, Aktionen und Erlebnisse rund um das Thema ,, Horen ".
Im Zentrum der Imaginata steht wie jedes Jahr ein Experimentarium fur die Sinne, in dem die Besucher Phanomene aus Natur und Wissenschaft, Technik und Kunst leibhaft er- fahren konnen. Parallel dazu gibt es eine Fulle von spektakularen Aktionen in Jenas Innenstadt: experimentelle musikalische Passagen, Wettbewerbe, Planspiele, Ausstel- lungen und insbesondere die Produktionen des Imaginata-Theaters. Veranstalter ist der Imaginata e.V., eine Initiative von Prof. Dr. Peter Fauser (Institut fur Erziehungswissen- schaften der Universitat Jena) in Zusammen- arbeit rnit der Stiftung fur Bildung und Be-
hindertenforderung, Stuttgart (Dr. Eva Ma- delung).
Trotz ihres typischen, ebenso entspannenden wie unverkrampften Charakters sehen die Veranstalter die Sommer-Imaginata keines- falls als blol3es Unterhaltungsangebot, das seinen Gasten einen fluchtigen Reiz und die Illusion bietet, auch etwas fur die Bildung getan zu haben. Der Veranstaltungsreigen ist vielmehr auf Besucher angewiesen, die selbst experimentieren, ausprobieren, sich uberraschen lassen wollen. Dabei geht es nicht unbedingt darum, auf vorgezeichneten Wegen z. B. physikalische Gesetze nachzu- vollziehen; Imaginata-Experimente reizen vielmehr zum Staunen, Spielen und Griibeln, zum Entdecken und Erfinden. In den letzten
Jahren fanden regelmaBig mehr als 10000 Besucher den Weg zum ehemaligen Umspannwerk Jena-Nord und zu den Veranstal- tungsorten in Jenas Innenstadt.
Das Experimentarium in dem als technisches Denkmal geschutzten Umspannwerk ist ubrigens Regi- striertes Projekt der Weltausstel- lung EXPO 2000 und soll in den nachsten Jahren eine Dauerein- richtung werden. Ziel des Ganzen ist es, die Vorstellungskraft als wichtige geistige Ressource fur die menschliche Zukunft und fur ein lebenslanges Lernen heraus-
zufordern und anzuregen, denn: Jmaginati- on is more important than knowledge'' (A. Einstein).
Eroffnungsveranstaltung: 16.7. ab 19 Uhr: ,,Klangskulptur" Offnungszeiten Experimentarium: 17.-21.7.von 10-13und16-19Uhr mdr-Horfenster: taglich Konzerte mit neuer Musik (werden zum Teil auch im Rundfunk ubertragen)
Kontakte und Informationen: Imaginata e.V., Institut fur Erziehungswis- senschaften der Friedrich-Schiller-Univer- sitat Jena, Otto-Schott-StraBe 41, 07745 Jena, Tel.: 036411945363, Fax: 036411 945362, e-mail: [email protected]
Phys. B1.54 (1998) Nr. 6 497

,,Heute haben zwei Milliarden Menschen kei- nen Zugang zu Elektrizitat. Die Photovoltaik hat groRe Vorteile fur die Dritte Welt, da dort vielfach groRe Kraftwerke und Elektrizitats- netze nicht praktikabel sind."
Auf die Frage, wann die beiden vorgestellten Kernenergie-Optionen zur Verfugung stehen konnten, antwortete zuerst Klaus Pinkau fur den Fusionsreaktor: ,,Der Bau der Anlage wird zehn Jahre dauern, erste Resultate wer- den funf Jahre nach dem Anschalten erwartet. Erst dann kann die Entscheidung fur oder gegen die Fusion fallen. Es sind leider schon funfzehn Jahre vergangen, seit ITER vorge- schlagen wurde. vor allem aus politischen Grunden haben wir vie1 Zeit verloren." Carlo Rubbia schatzte, daR fur die Entwicklung und den Bau seines Reaktor 15 Jahre ausreichen.
Luther erklarte anschlieljend, dab die Solar- zelle die in ihre Herstellung gesteckte Ener-
Blick in die USA Schnelleres Internet fur US-Universitaten Die USA bauen ihr Internet ziigig aus. Wie Vizeprasident Al Gore am 14. April ankiin- digte, installiert die Firma Qwest Communi- cations bis Ende 1999 ein 26000 Kilometer langes faseroptisches Kommunikationsnetz fur 500Mio$. Dieses Netz namens ,,Abile- ne" wird das Ruckgrat des Internet2 sein, das 160 Forschungsuniversitaten miteinander verbinden sol1 und eine Ubertragungsrate von zunachst 2,4Gbits/s, spater sogar 9,6 Gbitsk haben wird. ,,Es konnte alle 30 Bande der Encyclopedia Britannica in einer Sekun- de ubertragen", schwarmte Gore. ,,Abilene" wird den Universitaten unter anderem er- moglichen, weit entfernte Supercomputer in Echtzeit zu nutzen. Qwest erwartet keine groBen Einnahmen von dieser Investition, vielmehr sieht man das Netz als Test fur das geplante Next Generution Internet (NGI), das auch kommerziellen Nutzern offenstehen wird. - Der Streit um die Finanzierung des NGI ist unterdessen in die nachste Runde ge- gangen. Am 6. April hat ein Distriktgericht entschieden, daR die National Science Foun- dation (NSF) ihren Beitrag zum NGI in Hohe von 23 Mio $ pro Jahr nicht uber die Firma Network Solutions von den Internet-Benut- zem eintreiben darf. Network Solutions kas- siert fur jeden Domain-Namen, der rnit ,,.corn", ,,.net" oder ,,.org" endet, 50$ im Jahr, wovon 15 $ fur das NGI abgezweigt wurden. Bisher sind schon 50Mio$ zusam- mengekommen. Diese Gebuhr sei illegal, entschied das Gericht, da es sich de facto um Steuern handele, die nur der Kongrelj erhe- ben darf. Der konnte indes ein ruckwirkendes Gesetz beschlieljen, das der NSF doch noch die Nutzung der angehauften Gelder ermog- licht. (Pressemittlg. des Weiljen Hauses vom 14.4.98; Science 17.4.98; Nature 23.4.98)
gie in sechs Jahren zuriickgibt. ,,Diese pay- back-Zeit wird bald auf vier, rnit zukunftigen Technologien auf drei Jahre sinken." Die Le- benszeit einer Solarzelle schatze er auf 30 bis 40 Jahre. Auf die Frage, welche Flache man mit Photozellen belegen musse, um den Energiebedarf in Deutschland zu decken,
,,Wir brauchen bessere Fertigungstechniken, urn die Preise fur Salarzellen zu senken."
J. Luther -~ ~
meinte er: ,,Nimmt man Hausdacher und Fassaden, die sich fur die Sonnenenergienut- zung e ignp , zudem Parkpktze und ahnliche Flachen, dann kommt man auf 1000 km'. Damit lassen sich 150 TWh pro Jahr gewin- nen, verglichen rnit dem Gesamtverbrauch fur 1993 von 430 TWh." Auf Rubbias Ein- wand, daR dies doch Science Fiction sei und niemand eine derartige Flache regelmaljig
Etaterhohung fur F&E bleibt ungewiB Der US-Senat hat ein Haushaltsgesetz verab- schiedet, das die Aufforderung enthalt, die Ausgaben fur F&E in den nachsten zehn Jah- ren zu verdoppeln. Damit folgt er der Initiati- ve der Senatoren Phil Gramm und Joe Lie- berman, die auch von der APS unterstutzt wurde. Die zusatzlichen Mittel sollen jedoch vor allem den National Institutes of Health (NIH) zukommen. Die Ausgaben fur die ubrigen Wissenschaftsorganisationen, vor allem der National Science Foundation (NSF), konnten in den kommenden Jahren sogar abnehmen, wie eine Analyse des De- mokraten George Brown, eines einfluarei- chen Mitglieds im Wissenschaftskommitee des Reprasentantenhauses zeigt. Gramm halt Browns Einwand zum jetzigen Zeitpunkt fur unangebracht. Es komme vor allem darauf an, die Erhohung fur den nachsten Haushalt durchzusetzen. Die Benachteiligung der NSF ist vielerorts kritisiert worden. So for- dert die APS in ihrer ersten genieinsamen Stellungnahmen rnit den Standesorganisatio- nen der Chemiker und der Biologen, die Mit- tel fur die NSF um 10% erhohen. - Inzwi- schen hat sich Prasident Clintons Idee zur Fi- nanzierung seines Forschungsfonds fur das 21. Jahrhundert durch die Tabakindustrie (s. Phys. BI. 3/98) in Rauch aufgelost. Die fur den Fonds benotigten 65 Mrd $ sollten aus einem geplanten Vergleich zwischen den Ta- bakkonzernen und Washington kommen, doch diese scheinen kein Interesse mehr an einem Vergleich zu haben. (APS What's New 3.4.98; Nature 16.4.)
Advanced Light Source im Aufwind Die dunklen Wolken, die uber der Advanced Light Source (ALS) des Lawrence Berkeley National Laboratory hingen, haben sich wie-
reinigen konne, entgegnete Luther: ,,Wenn Sie die Sonnenzelle im richtigen Winkel in- stallieren, ist das alles kein Problem, und an- gesichts der riesigen versiegelten Boden- flache ist auch der Flachenbedarf kein Pro- blem. Immerhin haben wir den Vorteil, dab unsere Kraftwerke schon laufen." Ab- schlieRend stellte er fest, daR eine rationelle- re Nutzung der Energie geboten sei und auch. neue Stromnetzstrukturen entwickelt werden sollten, z. B. bidirektionale Netzwerke, die die Einspeisung lokal gewonnener Energie ermoglichen. Sein Fazit: ,,Bei jeder Option mussen wir auch alle sozialen Kosten beriicksichtigen."
Wer sich von der Veranstaltung einen Streit der Experten erhofft hatte, wurde enttauscht. Es uberwog das Bemuhen, bei der Suche nach der Energie der Zukunft alle vorgestell- ten Technologien gerecht zu bewerten.
R. Scharf
der verzogen. Im letzten Jahr war eine Kom- mission des Department of Energy (DOE) nach Begutachtung aller DOE-Synchrotrons zu dem SchluR gekommen, daR die funf Jahre alte und 100 Mio$ teure Anlage die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfullt habe und deshalb nicht weiter ausgebaut werden solle. Es drohte sogar die endgultige Schlie- fiung. Da sich der finanzielle Spielraum des DOE mittlerweile verbessert hat, ist eine Neubewertung moglich geworden. Mehr als 300 Wissenschaftler haben an einem Work- shop uber die Forschungsmoglichkeiten der ALS teilgenommen. Die ALS produziert als einziges DOE-Synchrotron weiche Rontgen- strahlung. Die enthusiastische Unterstutzung und die uberzeugenden Argumente fur die ALS veranlaljten das DOE, eine Budgeter- hohung in Aussicht zu stellen. Die Schlie- ljungsplane sind jedenfalls vom Tisch. (ALS News I .4.98; Science 3.4.98)
Wieviel verdienen US-Professoren? Die American Association of University Professors (AAUP) weist in einem Report darauf hin, daR die Fakultatsmitglieder an den mehr als 2600 Universitaten und Colle- ges von der gunstigen Entwicklung der US- Okonomie profitiert haben. Ihr Einkommen stieg im letzten Jahr real urn durchschnittlich 1,7 %. Die Professoren an den Hochschulen verdienen im Mittel 95000$ im Jahr, ihre Kollegen an den zum Bakkalaureat fuhren- den Schulen knapp 65000 $. Diese Unter- schiede haben sich in den letzten Jahren ste- tig vergrol3ert. Es bestehen auch starke regio- nale Gefalle: So erreicht der Verdienst in den Sudstaaten kaum 3/4 des Einkommens im Nordosten der USA oder in den Staaten am Pazifik. (AAUP und Science 17.4.98)
498 Phys. BI. 54 (1998) Nr. 6

lhrinSNOM
Optisches Nahfeld Mikroskop fur Reflexion/Transmission
50pm
TwinSNOM - fur uberlegene optische Auflosung
SNOM in Reflexion
Rasterkraftmikroskopie
SNOM in Transmission An der Ringstrukturvon Fischohren laOt sich das Alter eines Fisches ablesen.
n d
~VB@MllGBaN INSTRUMENTS FOR SURFACE SCIENCE
OMICRON VAKUUMPHYSIK GmbH
http://www.omicron-instruments.com/ ldsteiner Str. 78 D-65232 Taunusstein Deutschland Tel. +49 (0) 61 28 9 87 - 0 Fax +49 (0) 61 28 9 87 - 185
\ c
4. Optatec in Frankfurt Halle Nr. 5.1 D11

Studie kritisiert Ausbildung an US-Unis Mit dem Unterricht an den 125 Forschungs- universitaten der USA liegt einiges im argen. Zu diesem SchluR kommt eine Studie, die von der Carnegie Foundation for the Advarz- cement of Teaching in Auftrag gegeben wurde (siehe: www.sunysb.edu). Autoren der Studie sind unter anderem Shirley Kenny, die Prasidentin der State University of New York, Bruce Alberts, der Prasident der National Academy of Sciences, und Chen Ning Yang, dem Physik-Nobelpreistra- ger von 1957. Sie kritisieren, daB die urzder- graduates wahrend ihrer Studienzeit kaum einen ihrer Professoren ZLI sehen bekommen, und weder Einblick in die Forschung erhal- ten, noch selbst forschen konnen. Der Unter- richt sei haufig schlecht und altmodisch, und die undergraduates wurden vom intellektu- ellen Leben der Universitaten ausgeschlos- sen. Einer der Griinde dafur sei, daR an den Fakultaten die Forschung hoher angesehen sei als die Lehre. Die Studie schlagt vor, schon im ersten Studienjahr Plenarvorlesun- gen durch Seminare und kleine Forschungs- projekte zu ersetzen und die Studenten in personlichen Kontakt mit erfahrenen Fakul- tatsmitgliedern zu bringen. Interdisziplinares Arbeiten musse gefordert werden, wobei die Grenzen zwischen den verschiedenen Fach- bereichen im Interesse der Studenten zu ubenvinden seien. (,,Reinventing Undergra- duate Education", New York 4/98)
Bibliotheken gegen zu teure e-Journale Die International Coalition of Library Con- sortia (ICOLC), ein ZusammenschluB von weltweit mehr als 5000 Bibliotheken, kriti- siert die Praxis der wissenschaftlichen Verla- ge, elektronische Joumale nur zusatzlich zur Papierversion anzubieten. In einer Erklarung pladieren die Bibliotheken dafur, die Online- Lizenzen von den Papier-Abos zu trennen und verbilligt anzubieten (www.library.yale. edu/consortia/statement.html). Sie kritisie- ren, daB die Verlage die F&E-Kosten fur das neue Medium voll an die Benutzer weiterge- ben und dennoch haufig unausgereifte Pro- dukte anbieten. AuBerdem befurchten sie, daB die Verleger mit der Einfuhrung elektro- nischer Journale die bisherige Praxis der fai- ren, kostenlosen Nutzung urheberrechtlich geschutzter Information beenden wollen. Fur ICOLC sei das oberste Ziel, die Kosten pro Informationseinheit zu senken und den Teu- felskreis zu beenden, daB die Bibliotheken fur immer weniger Zeitschriften immer mehr bezahlen miifiten. SchlieRlich musse die dau- erhafte Archivierung elektronischer Infor- mation sichergestellt werden. Die Bibliothe- ken betonen ausdrucklich, daR sie diese Probleme im Einvernehmen mit den Verle- gem losen wollen. (ICOLC-Pressemittlg. 25.3.98)
R. Scharf
Dr. Rainer Scharf ist freier Wissenschafts- journalist
Blick nach Frankreich
CNRS fordert Mobilitiit seiner Wissenschaftler Die Wissenschaftsorganisation CNRS wurde in der Vergangenheit haufig dafur kritisiert, einen wahren Elfenbeinturm darzustellen. Ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter wurden in der Regel unmittelbar nach dem Univer- sitatsstudium rekrutiert und verlieljen ihr In- stitut oder ,,Laboratoire" erst wieder, um in Rente zu gehen. Nun fordert das Direktorium des CNRS die Mobilitat seiner Wissen- schaftler. Erste Adresse sind Universitaten und andere Hochschulen. Die CNRS-Mitar- beiter, die ihre Kamere in der Forschung durch Erfahrungen in der Lehre erganzen wollen, konnen dazu unter verschiedenden Varianten wahlen. Zum ,,hereinschnuppem" bietet sich die ,,delegation" (,,Entsendung") an, bei der ein Professor oder ein Univer- sitatsdozent fur einige Zeit durch einen CNRS-Wissenschaftler ersetzt wird. Wer es ernster meint mit seinem Engagement im akademischen Unterricht, kann sich von sei- nem Institut fur unbestimmte Dauer an eine Universitat abordnen lassen. Der Vorteil ist, das er/sie dabei nicht die Bedingungen fur eine Habilitation erfullen muR. (Auch in Frankreich mu13 sich ein Wissenschaftler normalenveise habilitieren, bevor er an einer Hochschule unterrichten darf, das Verfahren unterscheidet sich jedoch deutlich von dem im deutschsprachigen Raum ublichen). Ha- bilitierte Wissenschaftler schliel3lich konnen sich auf eine Professur bewerben und unbe- fristet in den Universitatsdienst ubernommen werden. Der Wechsel in die Lehre wird durch finanzielle Zulagen zum ansonsten gleichen Grundgehalt schmackhaft gemacht. Quelle: CNRS
NEPAL am Gymnasium IN2P3, das Departement fur Kern- und Teil- chenphysik im CNRS, lost eines der im Ak- tionsplan 1997-2000 gemachten Verspre- chen ein: den Versuch, moderne Grundlagen- forschung an franzosische Gymnasiasten zu vermitteln. Die Arbeitsgruppe NEPAL (Noyaux et particules au lycCe, Kerne und Teilchen am Gymnasium) bereitet funf ver- schiedene Muster-Untenichtsstunden vor, die von interessierten Wissenschaftlem des lN2P3 an den Schulen der Umgebung ihres Instituts gegeben werden sollen. Themen wie ,,Elementsynthese und die Zukunft der Ster- ne", ,,Das Neutrino, das Geisterteilchen" oder ,,Das LHC-Projekt" sollen auf einfache Weise in 30-minutigen Unterrichtseinheiten erkart werden. Danach sol1 genugend Zeit fur eine moglichst freie Diskussion zwischen der Schulklasse und dem Vortragenden blei- ben. Gymnasiallehrern, die an einer solchen Unterrichtseinheit fur ihre Klasse interessiert sind, erhalten jetzt eine Liste mit Kontaktper- sonen in den einzelnen Instituten des IN2P3. Der Unterrichtsstunde geht eine griindliche
Diskussion uber ihre Inhalte und Ziele zwi- schen dem Lehrer und dem Wissenschaftler voraus, nach getaner Arbeit wird im Rahmen einer Auswertung noch Manoverkritik geubt. Quelle: IN2P3
Was sol1 am Gymnasium gelehrt werden ? Wissenschafts- und Bildungsminister Claude Allkgre eroffnete im Dezember 1997 einen landesweiten DiskussionsprozeB zwischen Lehrem, Schulern und Akademikern uber die Frage, was und wie zukunftig an Gym- nasiasten vermittelt werden sollte (vgl. Blick nach Frankreich, M5rz 1998). Vor dem Ab- schluBkolloquium in Lyon Ende April fan- den kleinere themenspezifische Konferenzen statt, von denen zwei den Themenkreis der Physik betrafen (,,Physik" und ,,Weltbild"). Zusatzlich liegt die Auswertung der von Physiklehrem ausgefullten Fragebogen vor. Diese erhoffen, den Schulem im Physikun- terricht Kritikvermogen, Objektivitat und wissenschaftliche Strenge vermitteln zu kon- nen. Diese uber die reine Wissensvermitt- lung hinausgehenden Unterrichtsziele wer- den nach Meinung der Lehrer jedoch durch die Stoffulle, die KlassengroBe, den unter- schiedlichen Wissens- und Interessensstand der Schuler und den Mangel an Untemchts- mitteln erschwert. Die beiden themenspezifi- schen Kolloquien nahmen teilweise die An- regungen der Lehrerbefragung auf. Die SchluRerklarung der Konferenz ,,Physik", an der unter anderem die Nobelpreistrager Ge- orges Charpak und Claude Cohen-Tannoudji mitwirkten, empfiehlt, Experimente im Mit- telpunkt des Physikunterrichts zu belassen. Der Physik des 20. Jahrhunderts solt ein hoherer Stellenwert eingeraumt werden, um sie auch Nichtakademikern zuganglich zu machen. Dazu muaten jedoch zunachst ande- re Themen aus den nach allgemeiner h e - reinstimmung uberfullten Lehrplanen ent- femt werden. Die Durchfuhrung von Projek- ten rnit den Schulern wird als Alternative zum Frontaluntemcht empfohlen. Die zu- satzlichen Anforderungen an die Physikleh- rer sollen durch eine Verlangerung ihrer Grundausbildung erfullt werden. Als zentral wird die kontinuierliche Weiterbildung des Lehrkorpers angesehen, da modeme und le- bendige Physik nicht 40 Jahre lang nur mit den im Studium envorbenen Kenntnissen unterrichtet werden kann.-Quelle: Min. Edu- cations & Recherche
Th. Otto
Dr. Thomas Otto ist am CERN angestellt und in seiner Freizeit als Wissenschaftsjournalist tiitig.
~~ ~~
500 Phys. B1.54 (1998) Nr. 6

Flussigkeiten mit Ecken und Kanten
Laminar stromende Flussigkeiten konnen Stufen bilden - das wuRte schon Lord Ray- leigh. Doch jetzt haben Tomas Bohr und seine Mitarbeiter vom Niels Bohr Institut in Kopenhagen entdeckt, daR Stromungen manchmal auch Ecken und Kanten haben. Von der Existenz der Stufen kann man sich mit einem einfachen Experiment im Kuchen- ausguB iiberzeugen. Wenn eine Flussigkeit in senkrechtem Strahl auf eine horizontale Flache trifft, so fliel3t sie auf dieser radial nach auljen. Dabei hat die Fliissigkeits- schicht in der Nahe des Auftreffpunktes eine deutlich geringere Dicke als in einigem Ab- stand davon. Der ijbergang zwischen diinn und dick erfolgt ziemlich abrupt. Es bildet sich eine ,,hydraulische Stufe", die den Auf- treffpunkt normalerweise kreisformig um- gibt (s. Abb.). Ahnliche Stufen beobachtet man auch in Flussen, z. B. unterhalb von Stauwehren und Dammen. Hier kann der Wasserstand auf einer Strecke von ein bis zwei Metern fluRab um mehrere Meter zu- nehmen.
Lord Rayleigh hat eine erste und zugleich quantitative Erkltirung dieses Phanomens ge- geben und auf die Analogie zwischen hy- draulischen Stufen in Flussigkeiten und Stoljfronten in Gasen hingewiesen. Demzu- folge halten sich an der Stufe die nach aul3en gerichtete Scherkraft, verursacht von der stromenden Flussigkeit, und der hydrostati- sche Druck des sich mangels AbfluRmog- lichkeit aufturmenden Flussigkeitsberges die Waage. Bohr und Mitarbeiter beobachten nun ein bisher ganzlich unbekanntes Verhal- ten der Stufen [C. Ellegaard et al., Nature
Hick ins Web ... gibt Hinweise auf interessante und nutzli- che WWW-links aus der Physik und ihrem Umfeld. Eigene Funde sind willkommen. Bitte schicken Sie in diesem Fall eine e-mail mit Kurzbeschreibung an Thomas Severiens, [email protected].
Eine Seite, die wohl fastjeden Physiker und Phy- sikstudenten interessieren diirfte, findet sich unter srartuu.uc.iVQUW. ,,Physics Questions/ Problems" stellt interessante und manchmal uberraschende Probleme zur Diskussion und gibt auch gleich online eine Antwort. Das Spektrum reicht von Fragen wie ,,Wie schnell muR man mindestens laufen, wenn man uber Wasser gehen will?" bis hin zu komplexen mathematischen Problemen.
Eigentlich schon ein alter Hut im Web ist die Nu- klidkarte von J. Chang, die im Original beim
Hydraulische Stufe beim Glykol, das in einem Strahl auf eine ebene Unterlage trifft. Wenn man die Dicke der aufieren Fliissigkeitsschicht erhoht, wird die zunachst kreisformige Stufe (a) fiinfeckig (b).
392, 767 (1 998)]. Wenn sie die Dicke der Flussigkeitsschicht oberhalb der Stufe lang- sam erhohen (dies geschieht mit einem den AbfluB regelnden, verstellbaren Uberlauf), so entsteht plotzlich ein Wirbel, der auf dem Hang der Stufe suift. In ihm lauft die Flus- sigkeit zunachst die Stufe hinauf, um sich, oben angelangt, zu uberschlagen und wieder herabzustiirzen. Der Wirbel schliel3t sich, wie die Stufe, zu einern Kreis und hat des- halb die Gestalt eines Torus.
Fur eine Flussigkeit mit hoher kinematischer Viskositat, beispielsweise Glykol, konnen die kreisformige Stufe und der am Abhang reitende Wirbel instabil werden. Ihre Radial- symmetrie wird gebrochen, indem sie deut- lich sichtbare, leicht abgerundete Ecken und Kanten bilden, etwa in Gestalt eines regel- mal3igen Polygons. Die Abb. zeigt ein Fun- feck, doch es wurden auch weitere regel-
mal3ige Polygone bis zum Vierzehneck be- obachtet. Diese Muster sind stabil, und wenn man die Stromung voriibergehend stort, so entstehen sie nach kurzer Zeit von neuem. Welches Polygon sich bildet, hangt unter an- derem von der Dicke der Flussigkeitsschicht oberhalb der Stufe ab. Dabei hat man Hyste- rese beobachtet: Bei gleicher Schichtdicke lassen sich, j e nach Vorgeschichte, verschie- dene Polygone erzeugen. Erhoht man die Schichtdicke, so verliert die zunachst vorlie- gende polygonformige Stufe nach und nach ihre Ecken. Auljerdem nimmt ihr Umfang ab, und schliel3lich verschwindet sie ganz. Eine noch unveroffentlichte Theorie repro- duziert, den Angaben der Autoren zufolge, sowohl die Polygongestalt der Stufen als auch die Hysterese bei deren Entstehung. Lord Rayleigh hatte sicherlich seine Freude daran gehabt.
R. Scharf
KAERI in Korea zu finden ist. Da dieser, Server fur europaische Benutzer leider geringe Ubertra- gungsraten hat, wurde er jetzt am Lehrstuhl fur Nukleare und Neue Energiesysteme der Ruhr- Universitat angepat und gespiegelt. Die Nuklid- karte ist erreichbar unter www.nes.ruhr-uni- bochum.de/CoN.
Auf der Seite www.ustronomie.com findet man alles, was einen astronomisch interessierten Laien, Physikstudenten, Physiklehrer oder Amateura- stronomen in einer verregneten Nacht bei Laune halt. Neben Einsteigerseiten, die die Grundlagen der Astronomie erkliren, ausfiihrlichen Infoma- tionen zu Amateurteleskopen und verschiedenen Foren, in denen man uber aktuelle Ereignisse am Himmel diskutieren kann, befinden sich auf die- sen Seiten umfangreiche Handler- und Vereinsre- gister und eine sehr grol3e Liste von thematisch gegliederten Links zu anderen Organisationen und
Web-Pages. Taglich aktuelle Berichte runden das standig steigende Angebot ab. Eine ideale Start- seite zu ausgedehnten astronomischen Surf- touren.
Kommt sie oder kommt sie doch nicht? Es sieht immer mehr danach aus, daB sie kommt - oder doch: dass sie kommt? Die Rede ist von der Rechtschreibreform. Wer auch zukunftig lieber auf gut Deutsch publizieren will oder muB, der wird sich langfristig wohl kaum von der Seite www. ids-mnnnheim.de/grummis/reform/inhalt. html mit den amtlichen Regeln der Rechtschrei- bung ,fernhalten konnen. Die Alternative: Man publiziert gleich auf English. Diesen ,,Sprach- Fluchtlingen" mu6 ich allerdings die Seite www. wsu.edu/-briuizs/errors/errors.html der ,,Com- mon Errors in English" dringend empfehlen.
Phys. B1.54 (1998) Nr. 6 50 1

Quantenmechanik und die Suche nach der Nadel im Heuhaufen Suchalgorithmus auf einem rudimentaren Quantencomputer implementiert
Ob es je gelingen wird, mit ihrer Hilfe ,,rich- tig" zu rechnen, ist vollig offen - sollte es aber soweit kommen, werden Quantencom- puter bei bestiininten Problemen eine Revo- lution herbeifuhren. Vorerst sind die ange- strebten und erreichbaren Ziele noch ver- gleichsweise bescheiden, und in naher Zu- kunft geht es vorrangig darum, einfache logische Operationen mit wenigen ,,Quan- tenbit" zu realisieren. Amerikanische Physi- ker stellten kurzlich einen rudimentaren 2bit- Quantencomputer vor, mit dem man eine einfache Ausgabe losen kann. Es gelang ihnen, mit eineni Suchalgorithmus ein Ele- ment aus einer Menge mit vier Elementen herauszusuchen, und zwar in einem einzigen Schritt - fur einen klassischen Rechner gibt es bei dieser Aufgabe keine bessere Strate- gie, als die vier Elemente nacheinander abzu- fragen; im Mittel bedeutet das 2,25 Suchschritte. [I. L. Chuang et al., Phys. Rev. Lett. 80, 3408 (1998)l.
lin Gegensatz zu einein klassischen Bit, das sich entweder im Zustand ,,O" oder , , I '' be- findet, nutzt man bei einein Quantenbit die Moglichkeit quantenmechanischer Superpo- sitionen aus, d. h. ein ,,@Bit'' kann sich gleichzeitig im Zustand ,,O" und , , I" befin- den. Dadurch ist es moglich, dem Quanten- computer eine koharente Uberlageiung meh- rerer Zustande einzugeben und eine grol3e Zahl von Rechnungen parallel durchzu- fuhren. Dieser ,,massive Quantenparallelis- mus" erlaubt es, alle Eingabezustande gleichzeitig auf eine bestiminte Eigenschaft hin zu untersuchen, ohne daR man die Rech- nung fur jeden einzelnen Eingabezustand se- parat durchfuhren muB. Bisher gibt es aller- dings erst wenige Algorithmen, die speziell auf diesen Voi-teil eines Quantencomputers hin konzipiert wurden. Der bekannteste ist der Shor-Algorithmus zur Zerlegung einer naturlichen Zahl in Primfaktoren: Wahrend die Rechenzeit eines klassischen Computers bei dieser Aufgabe exponentiell init der An- zahl der Stellen N anwachst, kann ein Quan- tencoinputer diese Aufgabe in einer zu N proportionalen Rechenzeit losen - ein Ergeb- nis init weitreichenden Auswirkungen auf heutige Verschlusselungstechniken, die gera- de darauf beruhen, daR es praktisch unmog- lich ist, eine sehr groRe Zahl in endlicherzeit in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Den jetzt implementierten Algorithmus hat der ameri- kanische Physiker Lov Grover erst im ver- gangenen Jahr ersonnen: Er dient dazu, aus einer Menge mit vielen Elementen ein ausge- zeichnetes herauszusuchen, beispielsweise in einem Telefonbuch den Namen zu einer vorgegebenen Nummer zu finden. Ein klas- sischer Computer muR dafur alle Elemente nacheinander uberprufen und benotigt im Schnitt ca. N/2 Schritte (N: Anzahl der Ele-
mente); ein Quantencomputer hat die Aufga- be init dem Grover-Algorithmus bereits nach rund nTN/4 Schritten gelost.
Welches Konzept sich fur die Hardware eines Quantencomputers durchsetzen wird, ist zur Zeit noch nicht abzusehen. Allen An- satzen ist aber gemein, daB ein Q-Bit rnithil- fe eines quantenmechanischen Zwei-Ni- veau-Systems dargestellt wird, beispielswei- se zwei Hyperfeinstruktur-Zustanden eines Ions, das in einer Falle gefangen ist. Wahrend sich weltweit einige Gruppen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen liefern bei dem Versuch, ein logisches Gatter init zwei Ionen zu realisieren, verfolgen Isaac Chuang (IBM Almaden), Neil Gershenfeld (MIT) und an- dere ein grundsatzlich unterschiedliches Konzept: den ,,NMR-Computer". der auf der Manipulation der Kernspins in Molekulen gewohnlicher Flussigkeiten beruht. Diesem Ansatz stehen ausgereifte und kommerziell erhaltliche Techniken der Kernspinresonanz zur Verfugung, und seit vergangeneni Jahr ist auch bekannt, wie sich aus den1 zwangslau- fig geinischten Zustand makroskopisch vie- ler Spins ein effektiver reiner Zustand extra- hieren I&, analog zu einein einzelnen Ion i n der Falle. Die ,,Hardware" des Rechners von Chuang und Kollegen besteht aus einem hal- ben Milliliter Chloroform (CHCI,), in dem das Isotop '?'C mit Kernspin 1/2 angereichert wurde. Geineinsain mit dein Kernspin 1/2 des Wasserstoffs steht damit ein Paar von Zwei-Niveau-Systemen zur Verfugung, mit dem sich vier unterschiedliche Zustande dar- stellen lassen. Die Kopplung der Spins unter- einander koinmt dabei automatisch durch die Kernspin-Kernspin-Wechselwirkung zustan- de. Zu Beginn wird dieses System im Zu- stand (I??) + l?J) + IL?) + 111))/2 prapariert. anschliefiend eines der vier Vorzeichen ver-
... kurzgefallt SOHO entdeckt Tornados auf der Sonne Auf der Sonne toben grol3e Wirbelsturme, die vie1 ausgedehnter und schneller sind als die Tor- nados auf der Erde. Diese unerwartete Ent- deckung gehort zu den neuesten Ergebnissen vom Sonnenforschungssatelliten SOHO, die am 28. April auf einer Pressekonferenz der Eu- ropaischen Weltraumorganisation bekanntgege- ben wurden. Britische Wissenschaftler haben die solaren Wirbelstiirme in Bildern und Daten des SOHO-Spektrometers CDS entdeckt. Bis jetzt haben sie ein Dutzend solcher Ereignisse festgestellt. Sie treten am haufigsten in der Nahe des Nord- und Sudpols der Sonne auf und sind in ihrer Ausdehnung fast so grol3 wie die Erde. In den Wirbelsturmen auf der Sonne sind stetige Windgeschwindigkeiten von 15 km pro Sekunde sowie zehnmal hehere Geschwindig-
tauscht, und die Aufgabe besteht nun darin, diesen ausgezeichneten Zustand zu suchen. Der Grover-Algorithmus gibt eine Vorschrift an, wie sich die Amplitude des ausgezeich- neten Zustands verstarken und die der ande- ren Zustande gleichzeitig reduzieren lafit. Implenientieren laBt sich diese Vorschrift, indem man nacheinander acht verschiedene Mikrowellenpulse auf die Spins schickt und diese zwischendurch zweimal eine definierte Zeit lang ihrer freien Zeitentwicklung uber- lafit. Bereits nach einer einzigen Iteration ist der ausgezeichnete Zustand eindeutig identi- fiziei-t, so das Ergebnis des Experiments, in vollkommener Ubereinstiminung mit der Theorie. Bestunde die Menge aus inehr Ele- menten, so muRte man die genannte Vor- schrift mehrmals ausfuhren.
In den nachsten Jahren ist mit groRen Fort- schritten sowohl beim NMR-Konzept als auch beim Quantencomputer init Ionenfallen zu rechnen. Ob sich allerdings einer dieser Ansatze auf einige zehn oder gar hundert Q- Bits skalieren lafit, ist besonders beim NMR- Computer BuRerst fraglich. Vielleicht ma- chen letzten Endes ganz andere Konzepte das Rennen, beispielsweise mit Halbleiter- Quantenpunkten statt Ionen. Rainer Blatt von der Universitat Innsbruck, der selbst am Rennen um das Zwei-Ionen-Gatter beteiligt ist, sieht den Wert dieser ,,ungeheuer reizvol- len Experimente" denn auch vor allem darin, diese ,,wunderschone Physik" zu verstehen. Seine ,,Vision", sehr zur Ernuchterung all derer, die schon bald eine ,,Quanten-CPU" erstehen wollen: ein Quantencomputer mit einer zweistelligen Anzahl an Gattern und der Rechenleistung eines Rohrencomputers.
S. Jorda
keitsspitzen (d.h. 500000 kin pro Stunde) zu verzeichnen.
Ozonprognosen im Internet Das Umweltbundesamt stellt ab sofort taglich Ozonprognosen im Internet bereit Unter http:// umweltbundesamt.de/uba-info-dateddated aod.htm gibt es jeweils ab 16 Uhr eine Prognose- karte mit einem Prognosetext fur den folgenden Tag. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr findet inan dort eine Kurzzeitinformation fur den laufenden Tag und die gemessenen Ozoninaxima des Vor- tages. Die Maximalwerte des laufenden Tages von etwa 100 ausgewahlten, im Bundesgebiet verteilten Stationen werden zusammengefaBt und Prognosen uber die Ozonkonzentration des kommenden Tages als grol3flachiger Uberblick uber ganz Deutschland crstellt.
502 Phys. BI. 54 (1998) Nr. 6

Notizen .
Kompaktkurs ,,Vakuurnphysik" Vom 28.September bis 2.Oktober 1998 findet an der Fachrichtung Physik der TU Dresden der 14. Kompaktkurs ,,Vakuumphysik und -technik" fur Studierende der Physik auswartiger Univer- sitaten und Hochschulen statt. Der Kurs bietet eine enge Verflechtung von theoretischen Grundlagen (14 Stunden Vorlesung) und praktischer Anwen- dung (24 Stunden Praktikud6 Versuche an mo- derner Vakuumtechnik). Voraussetzung zur Teil- nahme ist das Vordiplom. Inhaltliche Angaben zu diesem Kurs: http://www.phy.tu-dresden.de/ittp/ kompkurs. Anmeldung wegen begrenzter Teilneh- merzahl bis spatestens 8.8.1998 bei: Priv.-Doz. Dr. M. Jackel, TU Dresden, Institut fur Tieftempe- raturphysik, 01062 Dresden, Tel: (0351) 463-5445 0. -5 170, Fax: -7060.
Steven Chu zu Gast in Bonn/ ,,Wolfgang-Paul-Horsaal" Steven Chu, einer der drei Physik-Nobelpreis- trager 1997, Professor fur Physik und Angewand- te Physik an der Stanford Universitat in Palo Alto, Kalifornien, wird als Gast der Wolfgang- Paul-Stiftung vom 17. bis 19. Juni 1998 an das Physikalische Institut in Bonn kommen. Steven Chu wird seine erste Wolfgang-Paul-Vorlesung am Donnerstag, den 18. Juni urn 10 Uhr im GroBen Horsaal des Physikalischen Instituts im Kreuzbergweg halten. Er wird uber seine Experi- mente an einzelnen Atomen und Molekulen spre- chen. Im Rahmen dieser offentlichen Vorlesung wird die Alexander von Humboldt-Stiftung dem Physikalischen Institut eine Buste von Wolfgang Paul als Leihgabe ubergeben, und der GroRe Hor- saal wird den Namen Wolfgang-Paul-Horsaal er- halten.
Karl W. Boer Solar Energy Medal of Merit 1999 Mit der Karl W. Boer-Medaille sollen bedeutende Beitrage BUS Forschung, Entwicklung und Wirt- schaft ausgezeichnet werden, die zur verstarkten Nutzung der Solarenergie als alternativer Enegie- quelle beitragen. Ebenso kann sie fur ausdauern- de, zielgerichtete Bemuhungen in anderen Berei- chen (z. B. in der Politik) verliehen werden. Das Preisgeld betragt $40000. Die Preiskommission fordert dazu auf, bis spatestens 15. Oktober 1998 Kandidatenhnnen zu benennen. Formulare sind erhaltlich bei: Stanley I. Sandler, Department of Chemical Engineering, University of Delaware, Newark DE 19716, USA, Fax: (302) 83 1-4466, e- mail: [email protected]
,,Probiert die Uni aus" Unter dem Motto ,,Probiert die Uni nus!" fand an der Universitat Stuttgart von Januar bis Mai 1998 ein Veranstaltungszyklus ,,Naturwissenschaften und Technik fur Schulerinnen der Oberstufe" statt. Zielgruppe waren Gymnasiastinnen aus mehr als 180 Schulen des Raumes Stuttgart, die fur natur-
und ingenieurwissenschaftliche Studiengange be- geistert und ermutigt werden sollten. Die Fakultat Physik veranstaltete drei Nachmittage, an denen uber den Studiengang Physik informiert und ein Blick hinter die Kulissen der Physikvorlesungen sowie der aktuellen Forschung ermoglicht wurde. Den Schulerinnen wurden Experimente der Phy- sikvorlesungen vorgefuhrt und erlautert, sie konn- ten auch eigenhandig verschiedene Versuche des Anfangerpraktikums durchfuhren, und es gab die Gelegenheit zu Laborfuhrungen (MPI fur Metall- forschung, Physikinstitute der Universitat) mit anschlieRender Diskussion. Die Aktion stieR auf reges Interesse, es nahmen gut 220 Frauen teil. Weitere Informationen unter: http://www.uni- stuttgart.de/Cis/frauenbeauftragte/frauwork. htm
Sommerkurs ,,Vakuumphysik" Vom 17. bis 21. August 1998 findet an der Uni- versitat Magdeburg ein Sommerkurs zur Vakuum- physik statt, der sich an Studierende sowie an Fachleute aus der Industrie richtet. Grundlagen der Vakuumphysik und -technik werden einerseits durch Vorlesungen, andererseits durch das Absol- vieren einiger Praktikumsversuche vermittelt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Vakuumerzeu- gung, Druckmessung, Lecksuche und Beschich- tungstechnik. Weiterhin sollen die Forschungs- schwerpunkte der Abteilung Vnkuurnpliysik vor- gestellt werden, insbesondere die AESIXPS- Oberflachenanalytik, Rastersondenmikroskopien, GasabgabemeRplatze, thermische Desorptions- spektrometrie. Die Teilnahmegebuhr betragt fur Studierende DM 200,-, fur Industriemitarbeiter DM 850,-. Anineldungen bis zuin 17.7.1998 an: Otto-von-Guericke-Universitat Magdebug, Fakultlt fur Naturwissenschaften, Institut fur Ex- perimentelle Physik, Abteilung Vakuumphysik und -technik, Tel: (0391) 67.11267, Fax: -18109. Ansprechpartner: Dr. N. Schindler, e-mail: Nor- [email protected]
TU Berlin: Bestes Internet-Angebot
Das Internet-Angebot der TU Berlin (http://www. tu-berhde) hat bei einem Ranking unter 250 deut- schen Hochschulen den ersten Platz erreicht, so eine Studie der Unternehmensberatung Westenvel- le & Partner (Hamburg), die fur die Zeitschrift Start, dem Jugendmagazin des sfern, erstellt wurde. Bewertet wurde, ob die WWW-Seiten schnell zu laden sind, ob sie aktuell, inhaltlich in- formativ, ubersichtlich und leicht abzurufen sind, ob sie einen guten Service, interessante Querver- weise und Suchmaschinen bieten und wie schnell die Webmaster und Pressestellen auf spezielle An- fragen reagieren. Weitere Details stehen in dem Online-Angebot von Start (http://www.stern.de/ start/) oder konnen uber Westenvelle & Partner ab- gerufen werden ([email protected]).
Auf'baustudiengang , ,Medizinische Ph y sik" Im Wintersemester 1998/99 beginnt an der Hoch- schule fur Technik und Wirtschaft Mittweida (FH) wieder der berufsbegleitenden Aufbaustudiengang ,,Medizinische Physik". Angesprochen werden Hochschulabsolventen (auch FH) mit abgeschlos- senem Studium physikalischer oder ingenieunvis- senschaftlicher Richtung. Nach dem zweijahrigen Studium wird ein Zertifikat verliehen, das verbun- den mit einer dreijahrigen praktischen Tatigkeit auf dem Fachgebiet zur ,,Fachanerkennung fur Medizinische Physik der Deutschen Gesellschaft fur Medizinische Physik" fuhrt. Auch einzelne Modulbausteine konnen belegt werden. Weitere Informationen bei: Hochschule fur Technik und Wirtschaft Mittweida (FH), Wissenschaftliche Weiterbildung, Frau Dr. Zenker, Technikum- platz 17,09648 Mittweida, Tel.: (03727) 58-1201, Fax: -1375, e-mail: [email protected]
Die wundersame Welt der Atomis
COUPE OU M Q U b E
548 Phys. BI. 54 (1998) Nr. 6