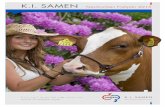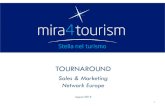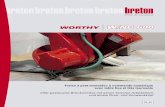one 4/2015 DEU
-
Upload
azienda-sanitaria-dellalto-adige-suedtiroler-sanitaetsbetrieb -
Category
Documents
-
view
225 -
download
5
description
Transcript of one 4/2015 DEU

Da s M ag a zin D e s süD tiro l e r s a nität sbe trie be s
eDitorial Wenn Systeme nicht zusammenarbeiten 3 leitartikel One more beer! 4 infos & news Datenvergleich für Fachleute 6 Momo 6 Eine Studie, die pusht 7 Rosa Krankenhäuser 8 Auszeichnung für Sabes 9 Den Planeten ernähren 9 Pet-therapy 9
gastkoMMentar 10 ManageMent & Verwaltung Landesgesundheitsplan 12 Gesundheitsversorgung im Wandel 13 titelgeschichte Digital und gesund 16 Interview mit Martha Stocker 22 Reorganisation 23 aus Den bezirken Brixen Preisträger 25 Vorbereitet sein 26 Gefährlicher Körperschmuck 27 Bozen Bank der Zukunft 28 Babys im Mittelpunkt 28 Neues Hospiz 29 Veranstaltun-gen 29 Mer an Jedem sein eigenes Süppchen 30 Made in South Tyrol 31 Remember! 32 Notfallübung 33 Bruneck Begleitung durch die Nacht 34 Tagesklinik Onkologie 35 Open month 35 Vita „Zum Glück konnte ich helfen“ 36 infogr afik 38 Personalia 39 gesunD -
heit iM netz Gezählte Welt 39 kontak t & iMPressuM 40 one
31.1
2.20
15
#0
4/1
5
„es
brau
cht e
inhe
itlic
he, z
wei
-sp
rach
ige
und
mod
ern
e Lö
sun
gen
. Wir
müs
sen
mit
de
r zei
t geh
en.“
Tho
Ma
s sc
ha
el
tit
elg
es
ch
ich
te
s
eit
e 1
6

Im Oktober 2015 mutierte das Krankenhaus Schlanders zur Filmkulisse. Gedreht wurden Szenen für den Film „Der Einsiedler“ (Arbeitstitel).F
oto
Ve
re
na
sp
ec
hTe
nh
au
ser
2
one # 04/15

Wie unangenehm und nervenaufreibend es ist, wenn Systeme nicht zusammenarbeiten, hat wohl jeder und jede schon erfahren (müssen), wenn ihm oder ihr ein Bild via E-Mail zugesandt wurde, das sich nicht öffnen ließ, weil das dazu benötigte Programm nicht installiert war.
So ähnlich verhält es sich zur Zeit mit den IT-Systemen der vier Südtiroler Gesundheitsbezirke. Sie können nicht miteinander kommunizieren und auch innerhalb der Krankenhäuser gibt es Programme, bei denen dies der Fall ist. Dies erschwert die Arbeit all jener, die sich damit beschäftigen (müssen) – inklusive der Patientinnen und Patienten. Damit soll nun in absehbarer Zeit Schluss sein. Geht es nach den Vorgaben des großen Plans für den Aus- und Umbau der Informationstechnologie (IT) des Südtiroler Sanitätsbetriebes, des sogenannten IT-Masterplans, dann wird sich innerhalb der nächsten drei Jahre in diesem Bereich vieles ändern – und zwar zum Besseren. Wie das geschehen soll, lesen Sie im Hauptteil dieser Ausgabe ab Seite 16.
Nichts ist so ungewiss, wie die Zukunft, heißt es. Das ist wahr und auch wieder nicht denn Statistiker können sehr wohl ein we-nig die Zukunft voraussagen, indem sie aktuelle Entwicklungen anhand von Berechnungen weiterschreiben. Und diese Entwick-lungen halten für das Gesundheitswesen in Südtirol und Italien einige Herausforderungen bereit. Welche, das beschreibt Bocconi- Universitätsprofessor Francesco Longo ab Seite 13.
Nicht unerwähnt bleiben soll diesmal der Gastkommentar. Der Autor des Beitrages ist Christophorus Zöschg. Er hat Philoso-phie studiert und ist zur Zeit im Gesundheitsbezirk Brixen tätig. Zöschg nimmt den VW-Abgasskandal zum Anlass, um über „Kritischen Rationalismus“ zu philosophieren und beantwortet die Frage, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit aus Organisationen „lernende Organisationen“ werden. Zu lesen ab Seite 10.
Die Meldungen und Informationen aus den Gesundheitsbezirken finden Sie ab Seite 24.
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre! peTer a . seeBacher
3
one # 04/15
eD
ito
ria
l

D ie Reaktion meiner persönlichen Umgebung: unisono! Wie, schon wieder (ja, zugegeben, ich war schon
mehrmals dort), und ist es jetzt dort nicht zu gefährlich? Beinahe täglich kommt es in Jerusalem, wohin ich auch wollte, und im Westjordanland zu Übergriffen, gewalttä-tigen Auseinandersetzungen, Verletzten, Toten. Manche sprechen von der dritten In-tifada – und jetzt willst du dorthin? Kannst du dir nicht ein ruhigeres Reiseziel aussu-chen? Meine Reaktion meist gelassen-sou-verän: Wenn in Algund ein Bankraub pas-siert, dann merkt man in den Meraner Lauben ja auch nichts davon. So ähnlich müsse man sich das vorstellen…!
Wie ich diese Zeilen schreibe, kommt über Twitter gerade eine Meldung her-ein: Ein Mann schießt in Tel-Aviv wahllos in einen Pub. Zwei Tote, sieben Verletzte! Vorher hatte er seelenruhig seine Maschi-nenpistole in einem Bio-Gemüse-Laden ausgepackt, sogar noch eingekauft, die Auf-nahmen der Überwachungskamera halten alles fest, auch wie er auf die Straße stürmt und losschießt. Ich scanne die Stadtkarte von Tel Aviv durch: wo war das? In der Di-zengoff-Street … Genau dort hatte ich mein
Hotel, am Pub bin ich x-mal vorbeigeschlen-dert. Gleich nebenan war ich öfters zu Gast, in einer Kneipe, die vor Jahren selbst schon Ziel eines Bombenattentats gewesen war. Ist Israel doch gefährlicher als ich meinte?
S chnitt. Jahresrückblick im TV – Eine renommierte Nachrichten-Sendung zeigt die Bilder des Jahres 2015 – und
wie es der Anspruch seriösen Journalismus ist, soll aus den Myriaden von Meldungen und Bildern das herausgefiltert werden was bleibt, was das Muster dahinter ist, was Entwicklung und Zusammenhänge erken-nen lässt. Nachrichten-Formate als Anker im Chaos des Alltags eben. Der Moderator meint, seine zwei Kollegen hätten den „Job des Jahres“ übernommen, in einem wenige Minuten langen Beitrag das zu erklären, was 2015 ausmachte und ein Fenster zu öff-nen auf 2016, auf das, was uns erwarte. Was folgt ist ein Meisterstück journalistischen Handwerks - ein Musterbeispiel medialer Alltagskunst. Zwar überwogen im Jahr 2015 die Suchbegriffe „Mut“, „Hoffnung“ und „Empathie“, was bleibt, so die Einschätzung der Chronisten, sei aber die Erschütterung von Gewissheiten, der Verlust von Selbst-verständlichkeiten, von Vertrauen, das erst
one more beer!
leitartikel luk a s r affl
Verfasser von Leitartikeln haben eine Unsitte. Sie schreiben und reden oft über sich selbst. Okay, einmal zu Beginn dieses Jahres sei auch mir das gestattet: Ich war vor Weihnachten auf Kurzbesuch in Tel Aviv.
4
one # 04/15
leit
ar
tik
el

„Möge es auch uns gelingen, 2016 im Privaten wie beruflichen wie ganz allgemein, die richtige tonalität im umgang mit den herausforderungen zu finden!“
wieder gewonnen werden muss. Was wohl stimmt: Bilder mythischen Ausmaßes ha-ben sich tief in unser kollektives Bewusst-sein eingraben, wir kannten sie bisher nur in Schwarzweiß, plötzlich sind sie ganz nah und real: Flüchtlingswellen, Terror, Kriege, Krisen, Katastrophen. 2015 schien manch-mal die Welt auseinanderzubrechen; die Risse veränderten uns. Wie schaffen wir das? Die Attentate in Paris sind Anschläge auf unsere unbeschwerte Art zu leben. Die Unfähigkeit, eine einheitliche Flüchtlings-politik zu finden, ist die größte Belastungs-probe für Europa seit seinem Bestehen. Pegida, brennende Flüchtlingsheime, das Mittelmeer ein Massengrab – unser Lebens-modell mitsamt unseren Werten steht auf dem Prüfstand. Helfen kann nicht mehr de-legiert werden. War 2015 ein Jahr der Zumu-tung? Tatsächlich scheinen wir ein Stück weit erwachsener geworden zu sein. Im althergebrachten Sinne, dass mit den Jah-ren die Illusionen gehen. Die Frische des Le-bens, aber auch dessen Schatten bewusster erlebt werden. Die Chance zum Kern der ei-genen Existenz vorzudringen gesehen wird. Die Suche nach Lösungen wird auch 2016 weitergehen. Sie scheint ehrlicher, direkter, intensiver zu werden.
Fo
to p
eTe
r a
. se
eB
ac
he
r
Auch im Südtiroler Sanitätsbetrieb glau-be ich den Willen zur Veränderung stärker als bisher wahrzunehmen. 2015 hat es in-tern bis hin zum Führungswechsel viele Neuerungen gegeben. Die Geschwindigkeit der Änderungen wird in diesem Jahr nicht abnehmen. Doch auch hier scheint viel von uns selbst abzuhängen, wie wir uns darauf einstellen. Die schönste Schlagzeile in die-sem Zusammenhang kommt für mich von Simone Wasserer, der ehemaligen Gleich-stellungsrätin des Betriebes und nun Vize-bürgermeisterin in Innichen: Sie schrieb vor kurzem auf Salto.bz: „Wir alle sind die Gesundheitsreform“. Schöner und gleich-zeitig intensiver kann man es wohl nicht sagen!
Z urück zu Tel Aviv: Auch dort fanden die Pubs und Restaurants der Flanier-meile Dizengoff-Street eine Metho-
de, mit dem Schrecklichen umzugehen: Sie starteten die Aktion „one more beer“ – ein Gratisbier für all jene, die sich nicht ein-schüchtern ließen und trotz Grauen ihrem Freizeitvergnügen nachgingen. Laut der Sprecherin des Rathauses nicht die Lösung, aber immerhin eine willkommene Ände-rung in der Tonalität, dem Schrecklichen zu begegnen.
Möge es auch uns gelingen, 2016 im Pri-vaten wie Beruflichen wie ganz allgemein, die richtige Tonalität im Umgang mit den Herausforderungen zu finden!
5
one # 04/15
leit
ar
tik
el

MOMO Förderverein für die Palliativ-Versorgung von Neugeborenen, Kindern und Ju-gendlichen Momo, das ist das Mädchen mit den Lo-cken, das auf der Straße lebt. Niemand kann so gut zuhören wie sie. Sie verän-dert alle, denen sie ihre Zeit schenkt. Als die grauen Herren in die Stadt kommen, überzeugen sie die Menschen, immer mehr Zeit zu sparen und Momos Freun-de werden immer unglücklicher. Doch Momo reist mit Hilfe der Schildkröte Kassiopeia bis zu Meister Hora, um ihnen zu helfen und ihre gestohlene Zeit zurückzuholen.
Der Roman „Momo oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und dem Kind, das den Menschen die ge-stohlene Zeit zurückbrachte“ erschien 1973 und ist so aktuell wie nie. „Keine Zeit haben“ ist das Mantra dieser Tage. Dass dieser Satz wenig Sinn hat, wird uns meistens dann klar, wenn wir auf Menschen treffen, die wirklich wenig Lebenszeit haben oder diese nicht mit aller Kraft und Gesundheit leben kön-nen. Besonders trifft uns das, wenn es Kinder sind.
In Südtirol gibt es an die 150 Neugebore-ne, Kinder und Jugendliche mit lebens-bedrohlichen oder lebenslimitierenden Erkrankungen. „Durch die zunehmende Lebenserwartung sind sie und ihre Familien länger mit den Symptomen, Einschränkungen und Ängsten konfron-tiert. Um betroffenen Familien unter die Arme zu greifen, wurde der Verein Momo gegründet. Er will den Betroffe-nen einen Raum schaffen, eine eigene Einrichtung, in der sie und ihre Familien betreut und begleitet werden“, erklärt Marianne Siller von der Stabstelle für Organisations- und Prozessentwicklung der Pflegedirektion im Südtiroler Sani-tätsbetrieb und Gründungsmitglied von Momo. „Palliativversorgung bedeutet einen Zugewinn an Lebensqualität und nicht nur Lebensverlängerung“, ist Ro-bert Peer, Pflegedirektor des Sanitäts-betriebes überzeugt. „Palliativbetreu-ung beginnt bereits ab dem Moment der Diagnose, sie unterstützt auch die Familienangehörigen in der Betreuung und trägt den seelischen Bedürfnissen Rechnung.“
Wer Momo unterstützen möchte, kann das mit einer Spende tun: spendenkonto Momo förderverein kinder-Palliativ in südtirol onlus, st. anna weg 6, 39040 kastelruth - raif-feisenkasse kastelruth - st. ulrich Informationen unter
6
one # 04/15
inf
os
& n
ew
s
Sabes-Generaldirektor Thomas Scha-el war es wichtig, dass diese wertvolle Sammlung von Infos nicht nur von eini-gen wenigen Personen in der Abteilung für Gesundheitswesen des Landes genutzt werden kann, sondern vor allem von den Verantwortlichen der Krannkenhausab-teilungen. Seit Kurzem können nach einer kurzen Einschulung auch Primare und verantwortliche Direktorinnen und Di-rektoren auf die ständig aktualisierten Daten zugreifen und beispielsweise mit einem Klick erfahren, wann und wo wie viele Hüftoperationen gemacht oder wie Menschen mit Lungenentzündungen in Südtirols Krankenhäusern aufgenommen wurden.
Möglich macht das alles die Zusam-menarbeit von Epidemiologischer Beob-achtungsstelle und Südtiroler Informa-tik-AG. Die Datenflüsse selbst sind anonym und informatisiert, das heißt, sie werden direkt aus den Daten der Krankenge-schichte gespeist, die bereits an die Epide-miologische Beobachtungsstelle geschickt wurden. Für alle Kennzahlen können so Trendanalysen und lokale Verteilungen im Land berechnet werden; eventuelle kritische Punkte springen dabei sofort ins Auge. „Das ist ein Schritt, um zum einen Transparenz zu garantieren, zum anderen aber auch, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen, sich Wissen anzueignen und den Austausch zu för-dern“, begründet der Generaldirektor den ausgeweiteten Zugang zur Plattform.
„SiVAS“ ist eine elektronische Plattform, welche die Epidemiologische Beobach-tungsstelle den Fachleuten in den Kran-kenhäusern zur Verfügung stellt. So können sich etwa Primare mit Hilfe dieser Daten-sammlung in Echtzeit einen Überblick über Südtirols Leistungen im stationären und ambulanten Bereich verschaffen.
Datenver-gleich für die Fachleute
infos & news saBine fl arer
„MoMo“, tr ailer
(1985/86)

Im Rahmen einer dreijährigen Studie werden die Themen Patientensicherheit und Pflegequali-tät auf den bettenführenden Abteilungen in den sieben Krankenhäusern des Südtiroler Sanitäts-betriebs untersucht.
Die Studie „Patientensicherheit und Pflegequalität in Südtiroler Krankenhäu-sern“ – kurz PUSH – ist ein gemeinsames, auf drei Jahre (2015–2017) angelegtes For-schungsprojekt der Landesfachhochschu-le für Gesundheitsberufe Claudiana und des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Projekt-leiter ist Dietmar Ausserhofer, Forschungs-mitglieder sind Dr. Franco Mantovan, Dr.in Giorgia Floretta, Dr.in Waltraud Tap-peiner, Dr. Eduard Egarter-Vigl und Dr. Ro-bert Peer. Unterstützt wird das PUSH-Team vom Institut für Pflegewissenschaft der Universität Basel (Schweiz).
Die Südtiroler Studie baut auf inter-national erfolgreiche Studien, wie die so-genannte RN4CAST-Studie auf (Nurse fo-recasting in Europe, www.rn4cast.eu). Das gemeinsame Forschungsprojekt von Clau-diana und dem Südtiroler Sanitätsbetrieb untersucht das Arbeitsumfeld – wie etwa die Teamarbeit, das Führungs- und Sicher-heitsklima, die Arbeitsbelastung, die Ratio-nierung und Prioritätensetzung - und deren Zusammenhänge. Dieses Forschungspro-jekt kann dem Südtiroler Sanitätsbetrieb wichtige Informationen liefern, um priori-täre Themen zur Verbesserung der Patien-tensicherheit und Pflegequalität zu iden-tifizieren, sowie weitere Forschungs- und Qualitätsverbesserungsprojekte durchzu- führen.
Eine Studie, die pusht
Erste Teilergebnisse liegen bereits vor: im Zeitraum von September bis Oktober erfolgte die Verteilung der Fragebögen an das Pflegepersonal, Ärzte und Patienten. Insgesamt nahmen 1433 Pflegepersonen, 641 Patienten und 365 Ärzte an der Befra-gung teil. Die Rücklaufquote war mit 74% beim Pflegepersonal, 41% beim ärztlichen Personal und 76% bei Patienten sehr gut. Das Forschungsteam möchte sich bei die-ser Gelegenheit bei allen bedanken!
Im Jahr 2016 wird vom Claudiana-For-schungsteam die wissenschaftlichen Aus-wertung durchgeführt und der zweite Teil der Studie vorbereitet. Im Frühjahr 2016 werden der Betriebsdirektion die ersten Ergebnisse der Studie vorgestellt.
Für Fragen zur Studie steht der Projektlei-ter Dr. Dietmar Ausserhofer zur Verfügung:
[email protected], tel. 0471 067 290
infos & news DieTMar ausserhofer
7
one # 04/15
inf
os
& n
ew
s

Fo
to s
aB
ine
fla
re
r
An die so genannten „bollini rosa“ (rosa Punkte) zu gelangen ist allerdings nicht so einfach, denn diese müssen hart erarbeitet werden. Wer die begehr-te Auszeichnung, die von der staatli-chen Vereinigung „Onda“ (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) im Zweijahresrhythmus vergeben wird, er-halten will, muss einiges an Vorarbeit leisten. Minutiös muss jedes Kranken-haus auflisten, welche frauenspezifi-schen Angebote vorhanden sind. Dabei reicht es nicht, nur bestimmte techni-sche Voraussetzungen wie beispielswei-se Wickelräume oder Spielzimmer an-zubieten, sondern das Hauptaugenmerk muss auf einer guten Betreuung der Frauen liegen. Eigene Sprechstunden für bestimmte frauenspezifische Pa-thologien zählen ebenfalls dazu wie Be-handlungen nach festgelegten interna-tionalen Standards, zum Beispiel in der Behandlung weiblicher Tumorarten.
Generaldirektor Thomas Schael durfte die Auszeichnung direkt aus den Hän-den von Gesundheitsministerin Beatrice Lorenzin entgegennehmen
Auszeichnung für Südtiroler Sanitätsbetrieb Im Rahmen der Jahresabschluss-Veran-staltung „Öffentliches Auftragswesen als Innovationstreiber im Gesundheits-wesen“ der Federsanità Anci in Rom wurde Mitte Dezember der Südtiroler Sanitätsbetrieb für „Innovatives Auf-tragswesen“ ausgezeichnet.
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erhält diese Auszeichnung dafür, so der Gesund-heitsverbandes Federsanità Anci in seiner Begründung, weil er „als einer der ersten in Italien das Potential, das neue Techno-logien bieten, begriffen und verstanden hat, dass die Qualität der Pflege durch innovatives Auftrags- und Beschaffungs-wesen gesteigert werden kann.“ Gerade im Bereich der Betreuung onkologischer Patienten und Patientinnen treffe dies zu.
Sabes-Generaldirektor Thomas Schael nahm den Preis stellvertretend für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Südtiroler Sanitätsbetriebes aus den Händen der Ministerin für Gesundheit, Beatrice Lorenzin, in und im Beisein des Federsanità Anci -Präsidenten, Angelo Lino Del Favero, entgegen. Thomas Schael: „Neue Technologien eröffnen uns viele Möglichkeiten. Diese müssen erkannt und umgesetzt werden. Aber: Innovation im Gesundheitsbereich darf nicht Selbstzweck sein, sondern muss immer auch Verbesserungen für Patienten und Patientinnen im Auge haben. Und genau das versuchen wir im Südtiroler Sanitätsbetrieb umzusetzen. Diese Auszeichnung ist eine Bestäti-gung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“
Der italienische Gesundheitsverband Federsanità Anci (Associazione Na-zionale Comuni Italiani) wurde 1995 mit dem Ziel gegründet, das „gute Gesundheitswesen“ zu fördern und den Bürgermeistern und Generaldirek-toren nützliche Instrumente dafür an die Hand zu geben, um die Qualität der Gesundheits- und Sozialeinrichtungen und – leistungen zu verbessern.
Alle sieben Südtiroler Krankenhäuser durf-ten sich in diesem Jahr über die Verleihung der „bollini rosa“ freuen. Diese werden jenen Krankenhäusern verliehen, deren Angebote besonders frauenfreundlich sind.
rosa kranken-häuser
infos & news saBine fl arer
Alles rosa und die Frauen freuen sich: (v.l.) Onda-Prä-sidentin Francesca Merza-gora, Bezirksdirektorin Irene Pechlaner (Meran) und Verwaltungskoordi-natorin Evelin Reinstaller (Brixen)
Der ausgefüllte und eingereichte Fragebogen wird dann von der Onda ausgewertet und analysiert. Anschlie-ßend werden die Punkte vergeben. Da-bei reicht die Skala von null Punkten bis zu einem Maximum von drei. Ein Punkt entspricht einem „bollino rosa“. Die Südtiroler Krankenhäusern haben sich auch diesmal – so wie in den ver-gangenen Jahren- wieder sehr gut ge-schlagen. Die Krankenhäuser von Bri-xen, Schlanders, Innichen und Sterzing heimsten jeweils zwei Punkte ein. Die Krankenhäuser in Bozen, Meran und Bruneck durften sich sogar über die Maximalpunktezahl von drei „Bollini“ freuen. Das Meraner Krankenhaus ist dabei der „Veteran“ unter den Südtiroler Teilnehmern, denn es ist seit Beginn der ersten Erhebung 2007 mit dabei und er-hält diese Auszeichnung seitdem ohne Unterbrechung.
Die offizielle Verleihung der Ur-kunden mit den rosa Punkten für das nächste Biennium fand am 16. Dezem-ber im Chigi-Palast in Rom statt. Insge-samt erhielten 82 Häuser drei Punkte, 127 zwei Punkte und 40 einen Punkt. Alle 249 Krankenhäuser und Uni- versitätseinrichtungen, die sich über die rosa Punkte freuen dürfen, sind auf der Webseite der „Onda“ gelistet www.bollinirosa.it.
Fo
to s
aB
ine
fla
re
r
8
one # 04/15
inf
os
& n
ew
s

”Mit der Teilnahme an der Expo hat Südtirol ma-ximale Sichtbarkeit erreicht. Unser Stand zählte zu den bestbesuchten. Nun gilt es, diesen Antrieb zu nutzen. Schafft es Südtirol, die Expo-Erfahrung umzusetzen, kann es eine Vorreiterfunktion ein-nehmen – und zwar auf nationaler wie internatio-naler Ebene? Die Produkte dazu haben wir bereits. Nun gilt es, nicht nur deren wirtschaftliche Relevanz, sondern auch ihren Gesundheitswert hervorzuheben. Leider gab es in Südtirol bisher gerade im wissenschaftli-chen Bereich kaum Synergien. Für eine Leadership braucht es allerdings starke Kooperationen.“
prof. Dr. lucio lucchin
„Den Planeten ernähren, Energie für das Leben“ war das anspruchsvolle Thema der Expo 2015. Ein Motto, das von den teilnehmenden Ländern sehr un-terschiedlich interpretiert wurde. Da-bei reichte die Palette von gelungenen Lösungsansätzen über spektakuläre Installationen bis hin zum Zelebrieren der gastronomischen Traditionen. Die Schau der Nationen war aber weit mehr als nur ein kulinarisches Karussell. Das Thema hat neben politischen Entschei-dungsträgern aus aller Welt auch viele Produzenten nach Mailand geholt. Sie haben die internationale Bühne ge-nutzt, um einander zu begegnen, um sich den Konsumenten zu präsentieren und ihren Standpunkt darzustellen
Es gibt aber noch einen weiteren As-pekt, der hier angeführt werden muss. Sechs Monate lang hat die Expo als wis-senschaftliches Laboratorium fungiert. Über 1000 Foren, Symposien, Kongresse haben sich mit dem Thema Ernährung befasst. Unter den Veranstaltungen war auch die Abschlusskonferenz der inter-regionalen Arbeitsgruppe „Food & Rese-arch Innovation“ – mit Südtirol und der Region Friaul in federführenden Rollen. Ziel des Treffens war die Schaffung ei-nes europäischen Netzes für Innovation und Forschung in der Lebensmittel- und Agrarbranche. Daran teilgenommen hat, unter anderen, der Bozner Primar Lucio Lucchin. Der bekannte Ernäh-rungswissenschaftler hatte im vergan-
Seelen heilen mit zärtlicher SchnauzeDer landesweite Tierärztliche Dienst und das Tierheim in der Sill, in Zu-sammenarbeit mit den territorialen Diensten des Sanitätsbetriebes und dem psychiatrischen Reha-Zentrum Bozen-Gries, haben vor Kurzem ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, bei dem Tiere die Hauptrolle spielen: die sogenannte „Pet-therapy“, genannt auch „Erfahrungen auf sechs Pfo-ten“.
Der Begriff „Pet-therapy“, begründet vom Kinderpsychiater Boris Levin-son, umschreibt den Einsatz von Haustieren als Hilfe und Unterstüt-zung bei traditionellen Therapien. Tiere können helfen, Gefühlsblocka-den zu lösen, die Kommunikation mit dem Therapeuten auf eine neue Ebe-ne zu heben und somit zu erleich-tern und – nicht zuletzt – auch eine Normalisierung der physiologischen Werte der Patientin beziehungswei-se des Patienten wie beispielsweise den Pulsschlag, Bluthochdruck oder Muskelspannung zu erreichen.
Ziel des Projektes „Erfahrungen auf sechs Pfoten“ war es, die Selbststän-digkeit und Sozialisierung, aber auch das Gedächtnis der Patientinnen und Patienten des Gesundheitszentrums und des psychiatrischen Reha-Zent-rums in der Fagenstraße in Bozen zu verbessern. Alle Treffen haben in ei-ner freundlichen und ansprechenden Atmosphäre stattgefunden, fernab eines klinischen Umfelds. Es wurden Tiere aus dem Tierheim in der Sill ausgewählt, die ein angemessenes Verhalten im Umgang mit Menschen zeigten, es wurde außerdem ein Ab-lauf erarbeitet, welchen die Betrof-fenen strikt befolgen mussten.
Die Treffen von jeweils einer Stunde fanden an ganzen sechs Wochen statt und wurden im Einklang mit der psychiatrisch-rehabilitativen Therapie und dem Wohlbefinden der Tiere organisiert. Die dabei erzielten Erfolge können sich sehen lassen: So konnte zum Beispiel eine gesteigerte Pünktlichkeit bei den Patientinnen und Patienten beobachtet werden, außerdem ein Motivations-, Kon-zentrations- und Gedächtnisschub. Auch der Umstand, dass während der Therapie der Umgang mit Fremden in einem völlig neuen Kontext geübt werden musste, hat zu einem ver-mehrten Sich-Öffnen der Betroffe-nen geführt. Zusammenfassend kann also nur gesagt werden: eine rundum positive Erfahrung!
infos & news lucio lucchin
Den Planeten ernähren – die Expo war der Anfang
Essen und die Ernährung waren die großen Prota- gonisten der Expo 2015. Sie waren die Attraktion auf dem Ausstellungsgelände, haben Produzenten und Konsumenten zusammengeführt und in über 1000 Veranstaltungen Wissenschaftler aus aller Welt beschäftigt.
genen Juni auch an einem Dokument mitgearbeitet. „Darin wurden die zehn kritischen Punkte aufgezeigt, die in Angriff genommen werden müssen, um zu vermeiden, dass sich so genannte Er-nährungskrankheiten in einen sozialen Boomerang verwandeln.“ Die italieni-sche Gesundheitsministerin habe die Thesen zur Kenntnis genommen und be-reits eine entsprechende Arbeitsgruppe eingesetzt. „Als Beweis dafür, dass die Expo eigentlich nur der Anfang war.“
9
one # 04/15
inf
os
& n
ew
s

Fo
to p
riV
aTKürzlich stieß ich auf einen Artikel der
beiden Wirtschaftsredakteure Caspar Bus-se und Alexander Hagelüken mit dem Titel „Nie mehr rumschreien“. Es geht darin um die Abgasaffäre bei Volkswagen. Busse und Hagelüken gehen in ihrer Recherche der Frage nach, ob der Nährboden für diesen Skandal im autoritären Führungssystem des Autokonzerns liegen könnte. VW-Mit-arbeiter beschrieben das Betriebsklima so: „Wer aufgemuckt hat, ist niedergebrüllt worden“. Kritikverbot, strikte Hierarchie und Tendenz zum Größenwahn erzeugen autoritäre Systeme und das wohl Schlimms-te dabei: Das organisationale Lernen bleibt auf der Strecke. Dagegen stellt eine kons-truktiv-kritische (Selbst-)Reflexion über Strukturen, Prozesse, Verhaltensweisen, Regeln und Normen eine Lernkultur dar, welche mit starren hierarchischen Struk-turen inkompatibel ist. Die kulturelle Basis für „organisationales Lernen“, die mir dabei in den Sinn kommt, steht in einem diamet-ralen Gegensatz zu Befehlsorganisationen. Karl Poppers wissenschaftstheoretisches Modell des „Kritischen Rationalismus“ und seine wesentlichen Grundsätze sollten allen Anhängern der Befehlsgewalt zu denken ge-ben. Der kritische Rationalist ist demnach der festen Überzeugung, dass die kritische
Diskussion mit anderen und die Selbstkritik essentielle Voraussetzungen für Fortschritt und Entwicklung sind. Im Fokus steht dabei die grundsätzliche Bereitschaft, von ande-ren zu lernen. Popper drückt diesen Aspekt folgendermaßen aus:
„Vielleicht hast du recht, und vielleicht habe ich unrecht; und wenn wir auch in un-serer kritischen Diskussion vielleicht nicht endgültig entscheiden werden, wer von uns recht hat, so können wir doch hoffen, nach einer solchen Diskussion die Dinge etwas klarer zu sehen als vorher. Wir können bei-de voneinander lernen, solange wir nicht vergessen, dass es nicht so sehr darauf an-kommt, wer recht behält, als vielmehr dar-auf, der objektiven Wahrheit näher zu kom-men. Denn es geht uns ja beide vor allem um die objektive Wahrheit.“
Dies kann aber nur in einer kulturel-len Atmosphäre gelingen, die sich grund-sätzlich der rationalen und konstruktiven Kritik öffnet, in einem Umfeld, das die Bereitschaft zeigt, aus Fehlern zu lernen, in einer Umgebung, wo man Fehler zugeben darf, keine Angst vor disqualifizierenden Bemerkungen haben muss und wo es keine Tabuthemen gibt. Es ist demnach eine At-
VW und Abgasskandal – ein Wortpaar, das wohl für die nächsten Jahrzehnte untrennbar mitei-nander verbunden sein wird. Wie konnte es dazu kommen? Hat die VW-typische Führungs- und Unternehmenskultur mit dazu beigetragen? Eine Betrachtung.
gastkoMMentar chrisTophorus zöschg
Christophorus Zöschg, Stabstelle Berufliche Entwicklung – Pflege-dienstleitung – Gesundheitsbezirk Brixen; Krankenpfleger, Studium der Philosophie, derzeit Masterstudium Personalentwicklung, Technische Universität KaiserslauternAbgasskandal
und autoritäre Führungs-strukturen
10
one # 04/15
ga
stk
oM
Me
nta
r

mosphäre, wo man bereit ist, konstruktiv zu kritisieren und sich kritisieren zu las-sen, weil das verbindende Anliegen nicht darin besteht, recht zu behalten und sich durchzusetzen, sondern darin, sich auf die gemeinsame Suche nach der besseren Lösung zu machen. Voraussetzungen da-für sind eine gelingende Kommunikation, eine wohlwollende Toleranz und intellek-tuelle Bescheidenheit.
Was bedeutet aber diese selbstreflexive und möglicherweise selbstkritische Hal-tung für die jeweilige Organisation? Wel-che Voraussetzungen muss eine Organisa-tion dabei beachten? Edgar H. Schein, der US-amerikanische Mitbegründer der mo-dernen Organisationspsychologie, stützt sich auf seinen Kollegen Warren Bennis, wenn er folgende – wie passend für unse-ren Betrieb – „Gesundheitskriterien“ einer effizienten Organisation ins Feld führt:
adaptionsfähigkeitEin gesunder Betrieb verfügt über das Ver-mögen, Probleme zu lösen und über die Fä-higkeit, hinsichtlich der wechselnden An-forderungen aus der Umwelt angemessen und flexibel zu reagieren.
identitätsgefühlEin gesundes Unternehmen verfügt über das Wissen und die Einsicht über ihre Zie-le und was sie zur Zielerreichung zu tun hat. Diesbezüglich ist nach Schein zu fra-gen, inwieweit die Organisationsziele von den Mitgliedern der Organisation verstan-den und anerkannt werden und inwieweit sich das Selbst-Verständnis der Mitglieder mit dem Bild, das sich andere von der Or-ganisation machen, deckt.
realitätsbewusstseinEine gesunde Organisation verfügt über die Fähigkeit, Gegebenheiten aus der or-ganisationalen Umwelt präzise wahrzu-nehmen und zutreffend zu interpretieren, wobei insbesondere jene Umfeldeigen-schaften zu beachten sind, welche für das Funktionieren der Organisation beson-ders relevant sind.
Schein erwähnt zudem noch ein viertes Kriterium, das nach Meinung einiger Au-toren das entscheidende sein könnte:
integrationGesunde Betriebe weisen eine angemesse-ne Integration zwischen ihren Teileinhei-
literaturverzeichnis
Busse, C.; Hagelüken, A. (2015): Nie mehr rumschreien. In: Süddeutsche Zeitung vom 16.10.2015. http://www.sueddeu-tsche.de/wirtschaft/abgasskan-dal-und-die-folgen-nie-mehr-rum-schreien-1.2693522 (abgerufen am 11.10.2015).
Geiselhart, H. (2012): Philosophie und Führung. Fragen und erkennen, planen und handeln, hoffen und Mensch sein. Wiesbaden: Springer Gabler.
Popper, K. (2006): Woran glaubt der Westen? In: K. Pop-per, Auf der Suche nach einer besse-ren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreißig Jahren (14. Aufl.). München: Piper.
Schein, E. H. (1980): Organisationspsychologie (deutsche Übersetzung aus dem amerikani-schen Englisch von Thomas Müns-ter). Wiesbaden: Th. Gabler.
ten auf, das heißt, die Ziele dieser Teilein-heiten überschneiden und widersprechen sich nicht. Diesbezüglich geht es ferner darum, dass sich individuelle Bedürfnisse und Organisationsziele in diesem Sinne möglichst optimal integrieren lassen.
Zu einer lernenden Organisation ge-hört auch, für eine kulturelle Grundhal-tung einzustehen, die eine kontinuierliche Reflexion dieser „Gesundheitskriterien“ ermöglicht. Der kritische Rationalismus könnte so eine Grundhaltung sein. Nach-dem wir uns einige wichtige Gesundheits-kriterien vor Augen halten konnten, soll-ten wir der Vollständigkeit halber auch die Krankheitskriterien kurz zur Sprache bringen. Nach dem bisher Dargelegten scheinen die eine Organisation „krankma-chenden“ Kriterien im Wesentlichen fol-gende zu sein:
Ein Betriebsklima, welches sich durch autoritäre Strukturen und Missgunst in Konkurrenzverhältnissen aus-drückt und demgemäß ein Ambiente, in welchem Autoritätsargumenten ein höherer Stellenwert zugesprochen wird als wohlbegründeten Sachargu-menten
Denunziantentum Wissens- und Kompetenzegoismus Fehlende Kompetenz(-entwicklung) in Schlüsselpositionen
Eine strafend-urteilende und bloßstel-lende Diskussionskultur
Mangelnde überzeugende und über-zeugte Partizipation der Belegschaft - auch jene der Basis - in tiefgreifenden Veränderungsprozessen
Blinder Aktionismus Substanzielle Orientierungslosigkeit
Eine lernende Organisation wird sich vor solchen Krankmachern zu bewahren wissen, indem sie Regeln und Strukturen einrichtet, die solche Krankheitskriterien frühzeitig aufdecken und thematisieren helfen. Auch hierfür scheint die Rolle des Managements als Kultur- und Wertever-mittler zentral zu sein. Die lernende Orga-nisation wird nicht aus sich selbst geboren und erfordert meiner Überzeugung nach fortwährende Bemühungen, großen Mut und die Fähigkeit, an Krisen zu wachsen und die Mitarbeitenden mitzunehmen und zu begeistern. Andernfalls lässt der nächste Abgasskandal nicht lange auf sich warten.
11
one # 04/15
ga
st
ko
MM
en
tar

Fo
to T
aTia
na
De
Bo
nis
ManageMent & Verwaltung Wolfgang Bayer
Dazu gehört sicherlich die Abhaltung der „bezirksgesundheitskonferenzen“, welche im Herbst diesen Jahres unter engagierter Be-teiligung der MitarbeiterInnen des Betrie-bes stattfanden. Sie nutzten ihre Gelegen-heit, um mit den Arbeitsgruppenleitern zu diskutieren und ihre Meinungen einzubrin-gen. Der Bogen der Themen spannte sich von den Rahmenbedingungen über die in-tramurale und territoriale Versorgung bis hin zu sozio-sanitären und bereichsüber-greifenden Themen. Die zahlreichen Rück-meldungen wurden in 38 Themen-Cluster (zum Beispiel IT, Personal-Management, Zu-sammenarbeitsthemen) eingeteilt und den
Arbeitsgruppen für die Berücksichtigung im weiteren Planungsprozess zugeteilt. Die Ergebnisse aus den nachmittäglichen Work-shops wurden am jeweiligen Abend mit den verantwortlichen Stakeholdern des Bezir-kes besprochen.
Die Phase 1 „Analyse und Beteiligungs-prozess“ konnte erfolgreich abgeschlossen werden und die Phase 2 „Konzeptionierung im Expertenprozess“ hat mit Anfang De-zember 2015 begonnen. Derzeit steht die Er-arbeitung der Leistungsprofile der Grund-versorgungshäuser im Mittelpunkt des Geschehens. Ziel dieses Prozesses ist es, die Grundversorgungsleistungen der Fächer In-nere Medizin, Chirurgie/Orthopädie für die Krankenhäuser Innichen, Schlanders und Sterzing in Abstimmung mit dem jeweili-gen Bezirkskrankenhaus zu definieren.
Grundsätzlich werden jene Leistungen als Grundversorgungsleistungen definiert, die den Standard der medizinischen Ver-sorgung darstellen. Die vorhandene tech-nische Ausstattung ist sehr gut geeignet, um diese Grundversorgungsleistungen anzubieten. Die dazu notwendigen Perso-nalressourcen sind – verschärft durch das neue Arbeitszeitgesetz - derzeit unzurei-chend vorhanden. Zur Absicherung des de-finierten Leistungsspektrums werden alle Anstrengungen unternommen, dieses Per-sonal zu finden. Sollte das Personal nicht ge-funden werden, dann sind in Abstimmung mit dem Bezirkskrankenhaus die Dienste so anzupassen, dass eine gute Versorgung der Bevölkerung sicher gestellt ist. Detail-lierte Umsetzungspläne werden im Betrieb gemacht.
ausblick Die Ergebnisse der Leistungsprofilerstel-lung stellen den Rahmen für ein abgestuf-tes Versorgungskonzept im Landesgesund-heitsplan dar. Als nächster konkreter Schritt erfolgt die Kapazitätsplanung für den Kran-kenhaus- und den territorialen Bereich.
Landesge-sundheitsplan on the road
Wie in der one-Ausgabe vom 3/2015 angekündigt, wurden bereits die ersten Arbeitspa-kete zur Erarbeitung des Landesgesundheitsplanes abgeschlossen.
12
one # 04/15
Ma
na
ge
Me
nt
& V
er
wa
ltu
ng

I n den wichtigsten europäischen Län-dern gibt es einige gemeinsame Tenden-zen der epidemiologischen Entwick-
lung. Zurückzuführen sind diese auf die Steigerung der mittleren Lebenserwar-tung, der Zunahme des Anteils älterer Menschen in der Bevölkerung, der gerin-gen Geburtenrate sowie der zunehmenden „Clusterisierung“ – also Zusammenbal-lung - der Gesellschaft.
Ganze 35 Prozent der italienischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind chronisch krank (19,5 Millionen Men-schen), während 2,4 Millionen pflegebe-dürftig sind. Das bedeutet, dass ein Sani-tätsbetrieb mit einem Einzugsgebiet von 500.000 Menschen etwa 165.000 chronisch Kranke in strukturierten Behandlungs-programme (Disease-Management-Pro-gramme = DMP) aufnehmen muss und 20.000 pflegebedürftige ältere Menschen zu versorgen hat. Wenn wir dies aus der Sicht eines Arztes für Allgemeinmedizin mit 1.500 Patientinnen und Patienten se-hen, ergibt das 475 Menschen mit chro-nischen Krankheiten (bei einer Visite im Monat bedeutet das also 24 Visiten am Tag, alleine für diese Patientengruppe) und 60 pflegebedürftige Menschen, die regelmä-ßig zu Hause besucht werden müssen (je-
gesundheits- versorgung im wandel
ManageMent & Verwaltung fr ancesco longo
weils eine Visite im Monat heißt drei Haus-besuche am Tag für diese Patientengruppe mit hohem Betreuungsanspruch).
In Anbetracht dieser Zahlen und um den Ärztemangel in den wichtigsten eu-ropäischen Ländern wissend, wird klar, dass wir in eine neue Ära der öffentlichen Versorgungssysteme getreten sind: „Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbei-ter“, heißt es schon in der Bibel. Es ist nicht mehr nötig, um die Patientinnen und Pati-enten zu „kämpfen“, im Gegenteil: die Ar-beit muss präzise und strukturiert organi-siert werden, damit diese herausfordernde epidemiologische Situation – mit immer geringer werdenden Ressourcen, wie es in den westlichen Gesundheitssystemen der Fall ist – gemeistert werden kann.
W as die Situation noch komplexer macht, ist das Phänomen der „Multimorbidität“, also mehre-
rer gleichzeitig bestehender Erkrankun-gen. Zwei von drei chronisch Kranken sind davon betroffen. Für sie reicht eine Betreuung durch nur einen Spezialisten nicht mehr aus, diese Patienten und Pati-entinnen brauchen eine Versorgung über verschiedene Fachbereiche hinweg, die ab-gestimmt werden muss.
Francesco Longo, von der SDA-Università Bocconi in Mailand und Mitglied des Beratungsteams für den Landesgesundheitsplan, über die epidemiolo-gischen Rahmenbedingungen und die Tendenzen der Gesundheitsversorgung in Europa
13
one # 04/15
Ma
na
ge
Me
nt
& V
er
wa
ltu
ng

E s gibt zahlreiche Studien, die gezeigt haben, dass einer/m multimorbiden Patienten und Patientinnen, die von
einer Vielzahl verschiedener Fachkräfte betreut wird, eine derart große Anzahl von Medikamenten und Untersuchungen ver-schrieben wird, dass sie nicht in der Lage sind, die verschiedenen Verschreibungen zu berücksichtigen.
Eine Studie der „Agenzia Italiana del Farmaco“ (AIFA) hat nachgewiesen, dass viele Menschen über 65 mehr als zehn Medikamente am Tag einnehmen sollten, verschrieben von verschiedenen Fachkräf-ten. Dies führt dazu, dass Therapien oft nur geringfügige Erfolge zeigen, da nur die Hälfte der Medikamente tatsächlich ein-genommen werden – und meist nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden.
Eine chronische krankheit – vor allem wenn noch nicht im fortgeschrittenem Stadium – erfordert einen Ansatz, der auf mehreren entscheidenden medizi-nisch-pflegerischen Säulen fußt: die zeit-gerechte „Rekrutierung“ von Patientin-nen und Patienten, die Eingliederung in einen diagnostisch-therapeutischen und gleichzeitig effizienten Betreuungspfad, die Steuerung und Kontrolle der ver-schiedenen Gesundheitsberufe, die am Betreuungsprozess teilnehmen (jene des Krankenhauses, die fachärztlichen Spe-zialisten in der ambulanten Betreuung, die Hausärzte, Berufskrankenpfleger), die Überwachung der Mitarbeit der Patientin-nen und Patienten am Betreuungsprozess sowie die Überprüfung der Zwischener-gebnisse. Alle diese grundlegenden Ele-mente der Behandlung chronisch Kranker gehen über die übliche Kultur und Praxis des Krankenhauses weit hinaus, welche sich - historisch betrachtet –vor allem um die stationäre Aufnahme von Akutkran-ken kümmert. Tatsächlich ist das Kran-kenhaus jener Bereich, wo üblicherweise Akutpatienten betreut werden, in einer Logik der „abwartenden Medizin“, konzen-triert auf das Angebot innerhalb der eige-nen vier Wände, mit wenig Interesse, die eigenen Pflegepfade nach außen auszuwei-ten oder die Compliance der Patientinnen und Patienten zu überwachen, wenn diese erst einmal entlassen werden.
Aber auch nicht selbständige Patienten brauchen eine Betreuung, die deren Be-dürfnisse im Auge behält und die insbeson-dere auf den Erhalt sowie die Aufwertung der Fähigkeiten und die Behandlung meh-rerer gleichzeitig bestehender Pathologien zielt sowie zu erwartende Entwicklungen antizipiert und auf diese ausgleichend ein-wirkt. Es sind dies Betreuungsangebote, die sich grundlegend von den Angeboten der Dienste, die auf Akutversorgung spezi-alisiert sind, unterscheiden.
R und 70 Prozent der Ressourcen des Gesundheitssystems werden für Menschen mit chronischen Krank-
heiten sowie Pflegebedürftige aufgewandt. Deshalb müssen in diesem Bereich die Dienste neu ausgerichtet werden, einer-seits zum Schutz für die Patientinnen und Patienten, andererseits aber auch für das spezialisierte Personal, dem es ermöglicht werden muss, das eigene Angebot in Über-einstimmung mit den neuen epidemiolo-gischen Herausforderungen zu erbringen,
Heraus- forderungen auch für Südtirol
Die europaweiten epidemiolo-gischen Entwicklungen machen auch vor Südtirol nicht Halt. Im Jahre 2030, so die statistischen Berechnungen, wird es in unserem Land wahrscheinliche 140.000 Über-65-Jährige geben. Das wird Folgen für die Gesundheitsversor-gung haben. Schon heute bean-spruchen jene 28 Prozent chronisch kranker Patientinnen und Patien-ten ganze 77 Prozent der Leistun-gen. Eine Zunahme der „Over-65“ wird diese Entwicklung verstärken, da gerade Menschen im höheren Alter von chronischen Krankheiten betroffen sind. Laut Landesamt für Statistik (Astat) leiden bereits heute schon über 30 Prozent der 65-Jährigen in Südtirol an einer schweren chronischen Krankheit.
Dazu kommt, dass die Lebenser-wartung der Menschen – genauso wie im restlichen Europa – weiter steigen wird. Ein Südtiroler, der 2012 geboren wurde, hat eine um 10,5 Jahre höhere Lebenserwartung als ein im Jahr 1982 geborener. Die Lebensdauer der Südtiroler und Südtirolerinnen, die im Jahre 2012 bereits 65 Jahre alt waren, hat sich ebenfalls verlängert. Bei den Män-nern um 6,7 Lebensjahre, bei den Frauen um 4,9 Jahre.
Diese Entwicklungen – Zunahme chronischer Krankheiten bei gleich-zeitiger höherer Lebenserwartung der Erkrankten – erfordern voraus-schauende Reaktionen. (pa s)
14
one # 04/15
Ma
na
ge
Me
nt
& V
er
wa
ltu
ng

um eine höhere Wertschöpfung für die ei-genen Gemeinschaft zu erzielen.
Parallel zu den epidemiologischen Rahmenbedingungen ändert sich auch der Bereich der informationstechnologie sowie die Voraussetzungen der klinischen Organisation grundlegend. Insbesondere ist die Medizintechnik einem radikalen Wandel unterworfen, was auch die Rah-menbedingungen für die verschiedenen Betreuungsangebote stark verändert.
D as traditionelle Bild, das komplexe Krankheitsbilder und Hightech mit stationärer Aufnahme in Zusam-
menhang bringt, während die ambulante betreuung als untergeordnet angesehen wird, einfachen Krankheitsbildern und Therapiephasen vorbehalten, ist so nicht mehr uneingeschränkt gültig. Vielmehr haben sich oft die Verhältnisse ins Ge-genteil verkehrt. Beispielsweise erfolgen die onkologischen Therapien oder jene für Infektionskrankheiten – also lebensret-tende Maßnahmen, die kostenintensiv und klinisch anspruchsvoll sind – heute hauptsächlich im ambulanten Bereich. Im Gegensatz dazu überwiegen in vielen me-dizinischen Abteilungen mit einer hohen Anzahl von älteren und schwächeren Pati-entinnen und Patienten die sozio-sanitä-ren Bedürfnisse gegenüber den im engeren Sinne klinischen. Wodurch der Mehrwert der vorhandenen medizinisch-fachärztli-chen Kompetenz für die Patientinnen und Patienten überschaubar bleibt.
Die Verbreitung einer soliden wissen-schaftlichen kultur in der Vergangenheit, die sich auf Evidenzen stützt, ließ uns das Thema der „Clinical Competence“ entde-cken: das sind Erkenntnisse über Bedeu-tung von Mindest-Behandlungsfallzahlen,
die eine Abteilung oder eine Fachkraft vor-weisen müssen, um Krankheiten mit dem nötigen Wissen und der gefragten Fertig-keit sicher und wirksam behandeln zu kön-nen. Bleiben Abteilungen unter den gängi-gen Fallzahlen-Standards, sind sie weniger sicher und haben niedrigere Indizes der Wirksamkeit (Erhöhung der stationären Wiederaufnahme, der Mortalität und Ähn-liches). Das Erreichen der notwendigen „Clinical Competence“ wird heute als not-wendige Voraussetzung angesehen, um die Sicherheit für Patientinnen und Patienten sowie die bestmöglichen Bedingungen für das Fachpersonal zu erlangen. Die Fokus-sierung auf Fallzahlen begünstigt auch die Weiterentwicklung und Bündelung der Technologien, sowie deren schnellere Modernisierung und bessere Auslastung und damit schlussendlich die Stärkung der Kompetenz.
Die wachsende anerkennung der gesund-heitsberufe ist aufgrund einer Reihe von Faktoren international ein weit verbrei-tetes Phänomen. Auf der einen Seite sind diese mehr und besser ausgebildet durch die Forderung nach Hochschulabschlüssen und Spezialisierungen (viele mit Master-abschluss). Auf der anderen Seite führt die Zunahme chronischer Krankheiten zur Entwicklung neuer Organisationsrollen, wobei die Gesundheitsberufe effektiver und kompetenter werden (Fall-Management, Follow-up, Erarbeitung von individuellen Betreuungsplänen, Lenkung der Betreu-ungsstrukturen und so weiter). Der Mangel an Ärzten und Ärztinnen, die sich verstärkt auf präzise klinische Aktivitäten fokussie-ren müssen, schafft Platz für professionelle Entwicklung in vielen betrieblichen Funk-tionen, welche mit großer Kompetenz von den Berufsbildern im Gesundheitsbereich ausgefüllt werden können.
Die epidemiologie (von griech. epi „auf, über“, demos „Volk“, lógos „Lehre“) ist jene wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Verbreitung sowie den Ursachen und Folgen von gesundheitsbezogenen Zuständen und Ereignissen in Bevölkerungen oder Populationen beschäftigt.
(WikipeDia)
15
one # 04/15
Ma
na
ge
Me
nt
& V
er
wa
ltu
ng

Sabes - Ist-Situation
Digital Governance
SmartHospital
SmartWorkspace
Omni-channel
Relationship
Integration Care
2018
Digital Services
2018
VirtualHospital
2018
Unified Digital Work-
space 2018
Real time Interaction
2018
SocialIntegration
2017
Digital Workflow
MobileHospital
Cloud & Mobile
Enabled
Online Services
2016
Extended Care
Setting
Electronic Documents
Pathology focused Hospital
Basic Virtual
Infrastruc-ture
Call Center
Support
Connected Islands
2017
Paper based Admini-stration
Paper based
Hospital
Traditional Infrastruc-
ture
WalledSystems
SmartHealthcare
System
Vergleich Benchmark *
TraditionalHealthcare
System
Sabes IT-Ziele
*Vergleich mit den Sanitäts- betriebe Norditaliens mit mehr als 800 KH-Betten
Verwaltung Infrastrukturen Dienste für Sozio-sanitäre
Integration
Klinisch-sanitärer
Bereich
BürgerInnen-dienste
Es ist kompliziert, würde der Status auf Facebook wohl heißen. Die Grafik veranschaulicht – zum Ersten - sehr gut, dass der Weg zu einem „smarten“ Gesundheitssystem kein leichter ist. Und zum Zwei-ten, dass bis zum Erreichen des Ziels noch ein weiter Weg vor dem Südtiroler Sanitätsbetrieb liegt. Fünf Bereiche gilt es zu bearbeiten und zu verbessern: Verwaltung, klinisch-sanitärer Bereich, Infrastruk-turen, Dienste für Bürgerinnen, Dienste für sozio-sanitäre Integration. Am Ende, so der Plan, wird der Südtiroler Sanitätsbe-trieb viel „smarter“ sein, als vorher.
Physical Desk
one # 04/15
16t
ite
lge
sc
hc
iht
e

Ein funktionierendes Informationssystem (IT) ist heute für Unternehmen unerlässlich. Für Großbetriebe, denen die Gesundheitsversorgung von Menschen anvertraut wurde, gilt dies erst recht. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb macht sich nun auf, sein Informationssystem zu erneuern und zu vereinheitlichen. In drei Jahren soll die Umstel-lung abgeschlossen sein.
„ IT-Systeme und -Lösungen sollen die Mitarbeiter bei ihrer täglichen Routine durch erhöhte Effizienz der
betrieblichen Abläufe unterstützen. Die kontinuierliche Steigerung des erreich-ten Qualitätsniveaus in der Behandlung der Patienten stellt ein gleichwertiges Ziel für den Einsatz von IT dar“, heißt es in einer Studie, die vom Beratungsunter-nehmen Deloitte und der Fachhochschule Dortmund gemeinsam durchgeführt wur-de. Diese Aussage benennt, was auch der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit der Neu-ausrichtung, Überarbeitung und Verein-heitlichung seines Informationssystems erreichen will, nämlich einen Mehrwert für Patientinnen und Patienten schaffen sowie eine moderne und der alltäglichen medizinischen Praxis verpflichtete Ge-sundheitsversorgung garantieren.
Die Ausgangslage ist mittlerweile be-kannt und in den Medien des Landes wäh-rend der letzten Wochen öfter behandelt worden: Drei der vier Gesundheitsbezirke nutzen unterschiedliche IT-Systeme, die untereinander nicht kommunizieren kön-nen. Nur die Bezirke Bruneck und Brixen haben das gleiche System – das aber laut Expertenmeinung nicht zukunftsfähig ist. Aber das ist noch nicht alles, wie Sabes-Ge-neraldirektor in seiner Rede beim Sympo-sium zur Präsentation des IT-Masterplans im Zentralkrankenhaus Bozen Anfang Dezember feststellte: „Zur Zeit haben wir über 300 verschiedene Applikationen im Betrieb, damit ist wohl jedem klar, dass man so nicht arbeiten kann – es braucht wenige, einheitliche, zweisprachige und moderne Lösungen. Wir müssen mit der Zeit gehen!“
Dass dies geschieht und dass der Weg auch in die richtige Richtung geht, dafür soll der IT-Masterplan 2016 – 2018 des Südtiro-ler Sanitätsbetriebes sorgen, der mit zwei anerkannten Institutionen im Gesund-heits-IT-Bereich in Italien, nämlich dem Osservatorio Innovazione Digitale in Sa-nità, Politecnico Milano sowie der Federsa-nità Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) eine Vereinigung von Gemeinden und Sanitätsbetrieben, erarbeitet wurde. In diesem Masterplan ist grob der Weg be-schrieben, der in Sachen IT in den nächsten drei Jahren vom Südtiroler Sanitätsbetrieb beschritten werden soll. Rückmeldungen zum IT-Masterplan werden noch bis 31. Jän-ner 2016 von Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeholt. Innerhalb März 2016, so der Zeitplan, sollen dann die defini-tiven Maßnahmen feststehen. Bis 2018 soll dann nicht nur eine Zusammenführung der bestehenden, unterschiedlichen Syste-me abgeschlossen, sondern gleichzeitig ein Sprung nach vorne im Bereich IT-unterstütz-ter Gesundheitsversorgung gelungen sein.
titelgeschichte peTer a. seeBacher & saBine flarer
Digital und gesund
17
one # 04/15
tit
elg
es
ch
ich
te

W o befindet sich der Südtiroler Sa-nitätsbetrieb im Bereich IT zur Zeit? Das Urteil der Experten
nach der ersten Analyse war klar und ein-deutig: Auf einer Achse an dessen Endpunk-ten sich traditionelle Gesundheitsversor-gung und smarte Gesundheitsversorgung als Gegensätze gegenüberstehen, liegt der Südtiroler Gesundheitsbetrieb in fast allen Bereichen näher am „traditionellen“ Ende. Was bedeutet das? Und was heißt smarte Gesundheitsversorgung überhaupt? Mit smarter Gesundheitsversorgung – oft auch im Begriff E-Health zusammengefasst - ist gemeint, dass digitale Geräte in allen Aus-prägungen zur medizinischen Versorgung und für andere, anfallende Aufgaben im Gesundheitsbereich herangezogen werden. Und zwar zur Beschaffung und Weiterver-mittlung von Information, zur Kommuni-kation zum und vom Patienten, zur Inter-aktion zwischen Gesundheitsbetrieb und Patienten, zur Transaktion, also den Aus-tausch von Daten (zum Beispiel elektroni-sche Patientenkarte), sowie zur Integration, also der Zusammenführung aller gesund-heitsrelevanten Daten von Patientinnen und Patienten, sprich elektronische Ge-sundheitsakte. Bei all dem muss die Privacy der Patienten und Patientinnen berücksich-tigt und gewahrt werden.
E-Health oder smarte Gesundheitsver-sorgung bedeutet für Patienten und Patien-tinnen eine Verbesserung bei Schnelligkeit und Vollständigkeit der Informationen, welche die behandelnden Ärzte und Ärz-tinnen zur Verfügung stehen. Und damit ein Mehr an Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Behandelten. Experten sehen darin
auch eine Möglichkeit, um der vorauszuse-henden Kostenexplosion im Gesundheits-wesen Einhalt zu gebieten.
Was will der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit der Einführung eines neuen IT-Systems erreichen? Zuerst einmal soll ein homo-genes und integriertes System geschaffen werden, dessen Fokus auf dem klinischen Bereich liegt. Wichtig ist auch die Funk-tion als Instrument des Clinical Govern-ment und Unterstützung für die Direktion. Schwerpunkt, so der Plan, soll die Einfüh-rung innovativer Dienste sein, um den Zu-gang zu den Gesundheitsleistungen für die Bevölkerung zu erleichtern und die Beteili-gung im Bereich des Gesundheitsschutzes zu erhöhen.
Paolo Locatelli, der im Auftrag des „Osser- vatorio Innovazione Digitale in sanità Politecnico Milano“ entsandte Projekt-
manager, meint dazu: „Wir müssen vom traditionellen System zu einer smarten Gesundheitsversorgung kommen.“ Und er betont, dass besonders an den Schnittstel-len gearbeitet werden müsse. Es brauche vor allem, so Locatelli, die Integration mit den Front Offices, denn derzeit bestünden viele verschiedene Ebenen. Auch bei den Anwendungen im Personalbereich brauche es eine Homogenisierung, denn die unter-schiedliche Situation in den einzelnen Ge-sundheitsbezirken stünde einer einheit-lichen Lösung im Wege. Auch spricht sich Paolo Locatelli für die Möglichkeit einer gut vernetzten territorialen Versorgung oder einem Ausbau der Telemedizin aus. Der Experte weist darauf hin, dass der Südtiro-ler Sanitätsbetrieb bei der Bewertung des
Die Umsetzung der Idee, das Krankenhaus-Informationssystem aus Trient in Südtirol zu nutzen, sieht der Trentiner Experte als kaum möglich an. Vorstellen kann sich Turra, dass einzelne Teile des Trentiner IT-Systems für sehr spezielle Lösungen auch in Süd-tirol eingesetzt werden könnten.
Allerdings erfordere dies einiges an Anpassungsarbeiten.
Sabes-Generaldirektor Thomas Schael stimmt dieser Einschätzung zu, sieht aber auch das hohe Ni-veau des Trentiner Informations-systems. Schael: „Das ist mit ein Grund, warum ich in Zukunft die
Zusammenarbeit in diesem Bereich mit Trient intensivieren möchte – die ja bereits seit Jahren besteht – und wenn möglich, möchte ich diese Zusammenarbeit auch in Richtung Tirol ausweiten. Mit dem Ziel, gemeinsam innovative Lö-sungen im Bereich Gesundheit zu entwickeln.“
Nicht immer funktioniert Recycling Der IT-Masterplan des Südtiroler Sanitätsbetriebes sei ambitioniert und umfasse zahlreiche IT-Systeme, die es zu berücksichti-gen gelte, so der IT-Verantwortliche des Sanitätsbetrie-bes Trient, Ettore Turra.
18
one # 04/15
tit
elg
es
ch
ich
te

Ist-Zustandes mit Einrichtungen in Itali-en, Österreich und Deutschland verglichen wurde: „Wir haben auch sehr gut vernetzte Kliniken in Deutschland und Österreich, beispielsweise in der Steiermark, zum Vergleich herangezogen. Die meisten sind EDV-technisch bedeutend weiter, etwa bei Lösungen, die auf dem Smartphone genutzt werden können.“
F ür die Zukunft gelte es vor allem auf Vereinheitlichung, Ausweitung und strategische Prozesse zu setzen. Zur
Bewertung des Südtiroler Sanitätsbetrie-bes wurde das vom Osservatorio Innovazi-one Digitale in Sanità entwickelte Modell des E-Health Journey herangezogen, mit dem die digitale Innovation und Entwick-lung von Sanitätsbetrieben überprüft und Schwachstellen schnell erkannt werden können. Seit rund zehn Jahren gibt es ein „Ranking“ der Fortschrittlichkeit der Kran-kenhäuser Italiens, so der Experte Paolo Colli Franzone, Leiter des „Osservatorio Netics, einem italienischen IT-Strategie-Be-ratungsunternehmen, bei seinem Vortrag beim IT-Symposium im Krankenhaus Bo-zen. Die so genannte „Sanità digitale“ zeige auf, wie weit die Informatisierung der Sani-tätsbetriebe fortgeschritten ist: „Von einer Medizin, die noch fast als ‚Zauberkunst‘ bezeichnet werden kann, sind wir über die Jahrhunderte zu einer wissenschaftlichen Kunst gekommen – heute ist die sogenann-te ‚reaktive Medizin‘ Standard, ein Ansatz, der vor allem aus den USA kommt. Der Pa-tient ist informiert und erwartet sich eine bestimmte Behandlung, am PC hat er be-reits selbst erste ‚Diagnosen‘ erstellt. Wir müssen lernen, damit umzugehen, denn wie jede andere Entwicklung, so wird uns auch diese weiterbringen.“ Italien müsse vor allem auf die vier „P“ setzen, so Colli Franzone. Die vier P stünden für „Medicina preventiva, predittiva, proattiva e persona-lizzata”. In Zukunft sei also eine Medizin notwendig, die präventiv, vorausschauend, proaktiv und personalisiert vorgeht.
Denn, so Paolo Colli Franzone, nicht nur für die so genannten. Digital Natives seien Online-Dienste bereits jetzt schon mehr als bloßes Schmuckwerk. Eine Herausfor-derungen der nächsten Jahre sei es aller-dings, in diesem Bereich seriöse Qualität zu bieten. „Wenn wir keine adäquate Antwort geben, fördern wir den Sanitätstourismus“,
warnt Franzone. Technische Neuerun-gen seien anzustreben, ganz besonders in Südtirol, wo Aufholbedarf herrsche: „Im italienweiten Ranking ist Südtirol unter dem Durchschnitt, es gilt, durch Digi-tal Acts neue Lösungen anzubieten, bei-spielsweise die Möglichkeit der elektro-nischen Verschreibung, Online-Befunde, Online-Zahlungen und Vormerkungen via Internet. Langfristig können dadurch postakute Aufenthalte verringert wer-den, aber auch Überprüfungen sind jeder-zeit in Echtzeit möglich.“
Massimo Mangia von der Vereinigung Federsanità-Anci betont, dass es drei Ma-krobereiche gäbe, in die zu investieren sei: die Primärversorgung, das „Territori-um“, also die Gesundheitsversorgung vor Ort, sowie das Krankenhaus: „Es braucht ein holistisches ganzheitliches Konzept der Gesundheit, wir müssen die Gesund-heit ‚umarmen‘ – nach einer Bedürfni-sanalyse sollten möglichst alle auf die Lö-sungen zurückgreifen können, es braucht eine transversale Komponente.“ Eines der Ziele sei etwa, durch „EPR“ (Electronic Pa-tient Record) eine Art „Sammlung“ aller Informationen zur Gesundheit im Laufe eines Lebens anzubieten – immer unter Wahrung des Datenschutzes. Auch die elektronische Krankenakte sei anzuge-hen. Dabei seien bereits vorhandene Po-tenziale zu nutzen, vor allem im Bereich interdisziplinäre Zusammenarbeit. „Un-ser System muss vor allem patientenori-entiert werden, wir müssen aber weg von der reinen Defensivmedizin“, so Mangia.
SAIMDie Südtiroler Alto Adige Informatik und Medizin GmbH, kurz Saim, wurde als Public Privat Partnership (PPP) im Jahre 2004 gegründet. Mehrheitsei-gentümer ist der Südtiroler Sanitäts-betrieb (51 Prozent), weitere Teilhaber sind die Unternehmen Inisiel Mercato AG (46,5 Prozent) mit Sitz in Triest sowie die Datef AG (2,5 Prozent) mit Sitz in Bozen.
Präsident des Verwaltungsrates ist Enrico Wegher (Südtiroler Sanitätsbe-trieb). Der Verwaltungsrat besteht
aus Andreas Fabi (Südtiroler Sanitäts-betrieb), Kurt Ferdinand Pöhl (Land Südtirol), Alberto Steindler (Insiel Mercato S.p.A) sowie Georg Patzleiner (Datef AG).
Laut IT-Masterpan des Südtiroler Sanitätsbetriebes soll die Gesellschaft Saim mit der Umsetzung und Durch-führung der geplanten Maßnahmen beauftragt werden. Gleichzeitig mit der Vertragsvergabe wird auch der Verwaltungsrat der Saim neu besetzt werden.
noch bis zum 31.1.2016 können Mitar-beiter und Mitarbeiterinnen auf der intranetseite mysabes.it Vorschläge und anregungen zum it-Masterplan einbringen.
i
T-M
asTerpl an
iT-MasTer
pl
an
iT-M
asTerplan
iT-M
asTer
pl
an
Machen
Sie mit!
Ihre Anregungen
sind willkom-
men!
19
one # 04/15
tit
elg
es
ch
ich
te

Massimo Mangia Experten/ beauftragte Institutionen
Das „Osservatorio innovazione digitale in sanità” ist eines von 30 „Observatorien“ der School of Management des Politecnico di Milano, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, digitale Innova-tion sowie die Entwicklung der Informations- und Kommunika-tionstechnologien (IKT) in Italien zu fördern. Insgesamt arbeiten 80 Professoren, Forscher und Analys-ten in 30 verschiedenen Bereichen. Im Mittelpunkte steht dabei immer die digitale Innovation in Unterneh-men und der öffentlichen Verwal-tung. Paolo locatelli unterstützt als Projektmanager von Seiten des „Osservatorio innovazione digitale in sanità Politecnico Milano“ den Südtiroler Sanitätsbetrieb bei der Neuausrichtung der EDV. Der diplo-mierte Informatikingenieur forscht und lehrt am Politecnico di Milano. Schwerpunkte seiner Forschung
sind die elektronische Gesundheits-karte, Interoperabilität zwischen Gesundheitsinformationssys-temen, Cloud Computing sowie Zugang zu Informationssystemen im Gesundheitswesen.
Der italienische Gesundheitsver-band Federsanità Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ist ein Zusammenschluss von Gemeinden und Sanitätsbetrieben. Der Verband wurde 1995 mit dem Ziel gegründet, das „gute Gesundheitswesen“ zu fördern und den Bürgermeistern und Generaldirektoren nützliche Instrumente an die Hand zu geben, um die Qualität der Gesundheits- und Sozialeinrichtungen und –leistungen zu verbessern.
Massimo Mangia ist der von Federsanità- Anci beauftragte Projektmanager für den Südtiroler Sanitätsbetrieb. Der IT-Experte kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Gesundheitsinformatik zurückbli-cken und war in der Vergangenheit als Berater für Regionen und einige der wichtigsten italienischen und inter-nationalen IT-Unternehmen tätig.
Als Berater ist er vor allem im Bereich Gesundheitsnetzwerke und E-Health für öffentliche Verwaltungen und Gesundheitsbetriebe tätig. Neben seiner Tätigkeit als Berater ist er auch als Fachautor für E-Health-Themen tätig, unter anderen auch für die Wo-chenzeitung „Il Sole 24 Ore Sanità“. Mangia war außerdem Mitbegründer und mehrjähriger Präsident der HL7 Italia, des italienischen Ablegers der weltweit führenden Vereinigung für IT-Standards im Gesundheitsbereich. Die von HL7 entwickelten Standards wurden vom italienischen Gesund-heitsministerium und den Regionen für die Erstellung der elektronischen Patientenakten übernommen.
Die „Baustellen“ stehen also fest, wer soll diese aber bearbeiten und beseitigen? Mehrere Möglichkeiten wurden von den Experten in Betracht gezogen:
ausweitung des in bruneck und brixen im einsatz befindliche krankenhausinforma-tionssystems (ikis) auf alle vier bezirke und entwicklungen der integrierten Patienten-akte (krankenhaus und „territorium“)
wiederverwendung eines informatik- systems („riuso“), das andernorts be-reits verwendet wird
europaweite ausschreibung beauftragung für die integrierte Pati-
entenakte der südtirol alto adige infor-matica Medica gmbh (saim) sowie für ausschreibungen für weitere anwen-dungen. an der saim ist der südtiroler sanitätsbetrieb mit 51 Prozent beteiligt und hält damit die Mehrheit. Das unter-nehmen hatte bereits in den vergange-nen Jahren den auftrag, die informati-onstechnologie des sanitätsbetriebes weiterzuentwickeln.
F ünf Handlungsdimensionen, die im Bereich der IT des Südtiroler Sanitäts-betriebes angegangen werden müs-
sen, wurden von den internen und exter-nen IT-Experten schließlich ausgemacht: die EDV-Landschaften in der Verwaltung, der klinisch-sanitären Bereich, die IT-Inf-rastruktur, die IT-Systeme und Dienste für die Bürger und Bürgerinnen sowie jene der sozio-sanitären Integration der Gesund-heitsversorgung vor Ort. Diese fünf Berei-che sollen in mehreren Schritten – zum Teil parallel, zum Teil nacheinander – „be-ackert“ werden. Die Schaffung einer Elekt-ronischen Patientenakte der Basismedizin und der territorialen Versorgung ist dabei als erster Schritt vorgesehen.
Fo
to p
eTe
r a
. se
eB
ac
he
rF
oto
pr
iVaT
Paolo locatelli
20
one # 04/15
tit
elg
es
ch
ich
te

N ach Abwägen der Vor- und Nachtei-le der einzelnen Varianten schien der Expertengruppe die Wiederbe-
auftragung der Saim, unter Berücksichti-gung der Aspekte Kosten und mittel- bis langfristige Entwicklungsmöglichkeiten als die günstigste und gangbarste Lösung. Dazu Sabes-Generaldirektor Thomas Scha-el: „Wir sind zum Schluss gekommen, dass die Neubeauftragung der Saim die beste Lösung ist, um die ‚Baustelle‘ IT endlich zu schließen. Es wurden zwar in der Vergan-genheit Fehler gemacht, doch ich schaue nicht zurück, sondern nach vorne“. War-um die Entscheidung für Saim? Das Mo-dell Saim wird von den Experten in seiner Grundidee als richtig gesehen. Dass in der Vergangenheit viele Lösungen zu oft „auf Maß geschneidert“ wurden, was eine enor-me Verlangsamung zur Folge hatte und die Übertragbarkeit der entwickelten Lösun-gen innerhalb des Betriebes und die Pro-grammierung von Schnittstellen behin-derte, steht außer Frage. In Zukunft soll deshalb ein striktes Projektmanagement dafür sorgen, dass die vorgegebenen Ziele zügig erreicht und die Lösungen landes-weit einsetzbar sind.
W as spricht gegen die anderen Möglichkeiten? Die Ausweitung des Systems von Bruneck, so die
Experten, sei nur bedingt möglich, mittel- bis langfristige Weiterentwicklungsmög-lichkeiten des Systems seien gering oder gar nicht vorhanden. Eine Wiederverwen-dung eines fremden Systems sahen die Experten ebenfalls als wenig sinnvoll an, da dies nur zu einem geringen Teil mög-lich wäre (siehe Kasten). Eine europaweite Ausschreibung des Dienstes würde eine inakzeptable Verzögerung von wohl meh-reren Jahren bis zur Umsetzung bedeuten, weshalb diese Möglichkeit ebenfalls fal-lengelassen wurde.
Der Blick nach vorne beinhaltet auch eine Reorganisation mit Neudefinition der Zuständigkeiten der Informatikabtei-lung im Südtiroler Sanitätsbetrieb, einen Relaunch der Südtirol Alto Adige Infor-matica Medica GmbH (Saim) samt neuer Geschäftsführung sowie einer Stärkung der Sabes-Informatikabteilung durch eine Task force externer Experten sowie konti-nuierlicher Weiterbildung des bestehen-den IT-Personals.
Der Startschuss für eine der größten Veränderungen der vergangenen Jahre in-
bereich
Elektronische Patientenakte der Basismedizin
Territoriales Informations-system (TIS)
Krankenhausinformations-sytem (KIS)
Dienstleistungen an die Bevölkerung
Handhabung Chronische Krankheiten –Telemedizin
Landesweite Vormerkstelle (CUPP)
Informationssystem der Verwaltung
Direktionssystem
fertigstellung
2016
Phase 1: 2017
Phase 2: 2018
Phase 1: 2016 Phase 2: 2018
Phase 1: 2017 Phase 2: 2018
2018
2018
2018
Modus
Beauftragung SAIM
Ankauf Dienstleistungen und Inhalte
Pilotprojekt – Wettbewerb Fullservice-Dienstleistung
Vergabe Fullservice-Dienstleistung 3-5 Jahre
Ausweitung oder Wettbewerb Lizenzen Wettbewerb Dienstleistungen
Wettbewerb Lizenzen und Dienst-leistungen
Planung – Next steps
Fo
to p
eTe
r a
. se
eB
ac
he
r
iT-experten unter sich: (v.l.) Thomas schael, Massimo Mangia, christian steurer, paolo colli franzone, paolo locatelli und kurt ferdinand pöhl
nerhalb des Südtiroler Sanitätsbetriebes ist mit der Vorstellung des IT-Masterplanes Anfang Dezember 2015 bereits gefallen, die benötigten finanziellen Mittel sind bereits von der Landesregierung zugesagt. Ins-gesamt sollen in die Modernisierung der Informationstechnologie des Südtiroler Sanitätsbetriebes innerhalb der nächsten drei Jahre rund 30 Millionen Euro inves-tiert werden. Wenn alles wie geplant läuft, wird sich der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Ende dieser drei Jahre von einem traditio-nellen zu einem smarten Sanitätsbetrieb gewandelt haben.
Derzeit liegt der it-Masterplan in entwurfform vor. bis 31. März 2016 soll die Diskus-sionsphase abgeschlossen sein. Danach erfolgt die definitive beschlussfassung.
21
one # 04/15
tit
elg
es
ch
ich
te

seit ihrem amtsantritt setzen sie sich vehement für ein landesweites kranken-haus-informationssystem ein. gibt es schon erfolge zu vermelden? Die Vernetzung der sieben Krankenhäuser unseres Landes und der direkte Datenfluss zwischen den verschiedenen Abteilungen, die Vereinfachung und Beschleunigung des Datenzugriffes vonseiten der Sprengel und der Hausärzte sind für ein funktionie-rendes Netzwerk in der Patientenbetreu-ung entscheidend. Mithilfe einer klaren Strategie gilt es daher, begonnene Arbeiten voranzubringen und in ein Gesamtprojekt einzubetten. Dabei sind mittlerweile Rönt-genaufnahmen landesweit einsehbar, auch bei den Laborbefunden ist der Sanitätsbe-trieb weitergekommen.
konkret merken die bürger davon jedoch noch sehr wenig. in vielen italienischen regio-nen gibt es etwa schon lange die Möglichkeit, Visiten und untersuchungen online vorzumer-ken. warum geht es in südtirol so schleppend? Auch in Südtirol wurden in diese Richtung Schritte unternommen: die Patientinnen und Patienten können für die vier Fachbe-reiche Dermatologie, Hals-Nasen-Ohren, Kardiologie und Urologie ihre Visiten on-line vormerken. Das System funktioniert inzwischen und die steigenden Nutzerzah-len zeigen, dass es angenommen wird. Das landesweite Vormerksystem sollte dazu dienen, die Verfügbarkeit von Facharztvi-siten in allen unseren Einrichtungen op-timaler zu nutzen. Dazu gehört aber nicht nur eine funktionierende technische Lö-sung, sondern die organisatorische Verein-heitlichung von medizinischen Leistungen landesweit.
wie weit ist man mit der elektronischen Verschreibung?Von den 346 Allgemeinmedizinern und Kinderärzten in Südtirol haben sich bisher 300 für das System angemeldet, bei etwa 200 konnte die technische Lösung bereits
installiert werden. Wir hoffen, in den ersten vier Monaten des neuen Jahres die 120 Süd-tiroler Apotheken an das System anbinden zu können, um dann sukzessive auf die elektronische Verschreibung und das digi-tale Rezept umzustellen.
generaldirektor thomas schael benötigt in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen euro an zusätzlichen geldmitteln. ist hier nicht bereits viel geld in den sand gesetzt worden? Der Bereich der Datenverarbeitung entwi-ckelt sich erfahrungsgemäß enorm schnell weiter: Was heute auf dem letzten Stand der Dinge ist, gilt in zwei bis drei Jahren bereits als überholt. Aufgrund der nicht vollstän-dig abgeschlossenen Zusammenführung der vier Bezirke zu einem einzigen landes-weiten Betrieb fehlte es in Vergangenheit an einer einheitlichen Strategie, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Mit dem EDV-Masterplan haben wir jedoch nun die Marschroute für die nächsten Jahre vorgegeben. Der klare Auftrag ist nun, dass die gesetzten Ziele vom Sanitätsbetrieb zeitnah umgesetzt werden.
wo steht die informatik des sanitätsbe-triebes ende 2016? Nach Verabschiedung des EDV-Masterplans gilt es, mithilfe eines operativen Projekt-planes die konkrete Umsetzung vorzuberei-ten. Ich erwarte mir dabei bereits im Laufe des nächsten Jahres greifbare Ergebnisse. Gleichzeitig ist es so, dass die laufenden Sys-teme bei laufendem Betrieb weiterbetreut und schrittweise in die neuen EDV-Pakete überführt werden. Diese Umstellung benö-tigt ihre Zeit und bedarf der tatkräftigen Mithilfe aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, doch ich bin mir sicher, dass wir nach dieser Kraftanstrengung eine EDV-Unterstützung für unsere Arbeit haben werden, die uns in die Zukunft be-gleiten kann. Dafür danke ich allen ganz herzlich.
„Die Marschroute für die nächsten Jahre festgelegt.“ Gesundheitslandesrätin Martha Stocker nimmt im Interview Stellung zur Bedeutung eines funktionierenden Datennetzwer-kes für die Betreuung der Patienten und die Verbesserung des Vormerksystems für Facharztvisiten und zu ihren Erwartun-gen an den unlängst verabschiedeten EDV-Masterplan des Süd-tiroler Sanitätsbetriebes.
titelgeschichte INtERvIEW Maria pichler
22
one # 04/15
tit
elg
es
ch
ich
te

Ver-antwort-
liche/r
Stabstelle
ProjectManage-
ment
SIO
SIT
AMM
Data e SW manage-
ment
Configu-ration
work- flow
Tuning
IT service
Infra-struc-
ture
Fleet manage-
ment
Service desk
Enterprise architec-
ture
Security
Contract & SLA
Manage- ment
Scouting
Strategic sourcing
Integration
Project leader
begleitung / schnittstelle zu externen ressourcen
Die derzeitige Organisation der Abteilung Informatik des Südtiroler Sanitätsbetriebes spiegelt sowohl deren Entstehung als auch die Rolle, die sie bis heute spielt, wider. Um den künftigen Aufgaben und neuen Strategie gerecht zu werden, ist eine Reorganisation unerlässlich. Die Struktur, die der neuen Rolle am besten gerecht wird, sieht folgen-dermaßen aus: Dem Verantwort-lichen unterstehen das Personal von Stabstellen und der Einheit „strategic sourcing“. Letztere hat die Aufgabe, Waren und Dienstleistun-gen zu finden, die für den Sanitäts-betrieb erforderlich sind, die Akqui-sition und Vertragstätigkeit mit den Lieferfirmen durchzuführen, indem auch die Angemessenheit der gelie-ferten Waren und Dienstleistungen bewertet und die der Einhaltung der sogenannten Service-Level-Agree-ments (SLA) überwacht wird.
reorganisationder Abteilung Informatik und
Zusammenarbeit mit der Südtiroler Informatik AG
(Siag)
Dem Verantwortlichen unterstehen vier weitere operative Einheiten:
Projektmanagement und De-mand, zuständig für die führung von Projekten und der internen nachfrage, indem die anträge bewertet und die anforderun-gen vereinheitlicht werden, die in weiterer folge als technische Vorgaben an die lieferfirmen weitergegeben werden.
enterprise architecture, ver-antwortlich die für die gesamte architektur des informations-systems, die integration zwi-schen verschiedenen systemen und deren sicherheit
Daten- und softwareverwal-tung, zuständig für die konfigu-ration, Personalisierung und be-reitstellung von anwendungen und betrieblichen Datenbanken
it-services, verantwortlich für den betrieb der hardware- und software-infrastruktur, die betriebliche führung der geräte (zentral und peripher) und der technischen assistenz der nutzer.
Die Reorganisation ist ein notwendi-ger, aber nicht ausreichender Schritt, um die Abteilung zu positionieren und auf die zukünftigen Anforderun-gen des Südtiroler Sanitätsbetriebes vorzubereiten. Bis heute gibt es innerhalb des Betriebes keine spezi-fischen Kompetenzen in Sachen Pro-jektmanagement und Systeminteg-ration, zwei strategische Bereiche. Auch die Funktion des „Enterprise Architect“ wird nicht ausgeübt.
Aus diesen Gründen ist es unerläss-lich, die Begleitung und Fortbildung des Personals der IT-Abteilung zu planen und auf den Weg zu brin-gen, unter Zuhilfenahme externer Berater, die eine breite sektorielle Erfahrung und große Kompetenzen in technischer, funktioneller und Führungs-Hinsicht mit sich bringen.
zusammenarbeit mit der südtiro-ler informatik ag
Die IT-Abteilungen der Landesver-waltung, des Gemeindeverbandes, des Sanitätsbetriebes und der Region erarbeiten zur Zeit mit der Südtiroler Informatik AG (Siag) einen IT-Dreijahresplan der öffentlichen Verwaltung. Das Ziel ist der Abgleich der IT-Strategien der einzelnen Körperschaften, die Definition von ersten Richtlinien für eine einheitli-che IT-Landschaft und die Definition von gemeinsamen IT-Diensten. Während sich die einzelnen IT-Abtei-lungen der Körperschaften verstärkt auf IT-Strategie und Governance konzentrieren, übernimmt die Siag eine operative Rolle in der Umset-zung dieser Strategien.
So wurde beispielsweise definiert, dass in Südtirol ein einziges Re-chenzentrum für die öffentliche Verwaltung betrieben wird und dass nicht jede Körperschaft ihr eige-nes betreibt. Dies ermöglicht eine Reduktion der Kosten und garantiert aber auch einheitliche Standards für die Körperschaften.
one # 04/15
23t
ite
lge
sc
hic
ht
e

24
one # 04/15
au
s D
en
be
zir
ke
n
Me
ra
n
bruneck Begleitung durch die Nacht 34 Tagesklinik Onkologie 35 Open month 35
br
un
ec
k
brixen Preisträger 25 Vorbereitet sein 26 Gefährlicher Körperschmuck 27 bozen Bank der Zukunft 28 Babys im Mittel-punkt 28 Neues Hospiz 29 Veranstaltungen 29 Mer an Jedem sein eigenes Süppchen 30 Made in South Tyrol 31 Remember! 32 Notfallübung 33 bruneck Begleitung durch die Nacht 34 Tagesklinik Onkologie 35 Open month 35
bozen Bank der Zukunft 28 Babys im Mittelpunkt 28 Neues Hospiz 29 Veranstaltungen 29 Mer an Jedem sein eigenes Süpp-chen 30 Made in South Tyrol 31 Remember! 32 Notfallübung 33 bruneck Begleitung durch die Nacht 34 Tagesklinik Onko-logie 35 Open month 35
br
ixe
nb
oz
en
bozen Bank der Zukunft 28 Babys im Mittelpunkt 28 Neues Hospiz 29 Veranstaltungen 29 Mer an Jedem sein eigenes Süpp-chen 30 Made in South Tyrol 31 Remember! 32 Notfallübung 33 bruneck Begleitung durch die Nacht 34 Tagesklinik Onko-logie 35 Open month 35
Mer an Jedem sein eigenes Süppchen 30 Made in South Tyrol 31 Remember! 32 Notfallübung 33 bruneck Begleitung durch die Nacht 34 Tagesklinik Onkologie 35 Open month 35

Fo
to p
riV
aT
brixen eDMunD senoner
Roland Keim ist Direktor des Psychologischen Dienstes Brixen und wurde im vergangenen Oktober von der Psy-chologenkammer der Provinz Bozen zum Psychologen des Jahres ernannt. Anlass genug für ein Gespräch über Gesundheitsversorgung, zukünftige Herausforderungen und – natürlich - Psychologie.
was bedeutet die ernennung zum Psy-chologen des Jahres für sie?Die Ehrung war für mich einigermaßen überraschend, gibt es doch in Südtirol vie-le Kollegen und Kolleginnen, die sich eine solche Ernennung genauso gut verdient hätten. Es liegt mir nicht, im Rampenlicht zu stehen. Durch diese Auszeichnung füh-le ich mich noch mehr verpflichtet, meiner Überzeugung treu zu bleiben.
und die wäre?Psychologie ist nicht nur eine Art Hilfswis-senschaft, sondern zentraler Bestandteil einer Gesundheitsversorgung. Schon seit Jahren bemerken wir auch in Südtirol eine deutliche Zunahme der Nachfrage nach fachpsychologischen Leistungen. Das liegt sicherlich auch daran, dass die psychi-schen Probleme zusehends enttabuisiert werden, dass Betroffene, Lehrer, Eltern oder andere „Zuweiser“ nun auch mehr über psychische Erkrankungen wissen. Zum anderen aber dürften wir tatsächlich auch von einer Zunahme beispielsweise von Depressionen oder Ängsten ausgehen.
Das zeigen neuere Untersuchungen, die identische objektive psychodiagnostische Verfahren im Abstand von einem oder zwei Jahrzehnten einer großen Stichprobe vorgelegt und die Ergebnisse verglichen haben. Nicht zuletzt sind auch die Anfor-derungen an die psychische Stabilität und kognitive Fähigkeiten in und außerhalb des Berufslebens deutlich gewachsen. Ein und dieselbe psychische Schwäche hat heute also wesentlich mehr Brisanz. Und dann kommt noch der ganze Bereich der chronischen körperlichen Erkrankun-gen hinzu, bei denen die psychische Sei-te nicht nur eine Begleiterscheinung ist, sondern auch eine kausale Rolle zu spie-len scheint. Außerdem kommen aufgrund der medizinischen Fortschritte ganz neue psychische Herausforderungen auf uns Menschen zu. Wie soll jemand etwa mit dem Wissen umgehen, dass er oder sie in fünf, zehn oder 20 Jahren wahrscheinlich an einer schweren Krankheit leiden wird? Was sagen wir einem Kind, dessen Vater an Chorea Huntington oder einer erbli-chen Variante von Alzheimer erkrankt ist
Der Preis-träger
25
one # 04/15
au
s D
en
be
zir
ke
nb
rix
en

Vorbereitet seinIn der Luftfahrt oder Atomindust-rie ist das Üben von kritischen und komplexen Prozessen mittels Simu-lation einen fester Bestandteil der Ausbildung des Personals. Simu-lationstraining dient nicht nur zur Vorbereitung auf im Alltag seltenen Ereignissen sondern auch zur För-derung der Zusammenarbeit und der Kommunikationsfähigkeiten in Stresssituationen.
Mittlerweile hat sich das „Simula-tion & Skill Trainig“ auch in der Aus- und Fortbildung im medizinischen und pflegerischen Bereich etabliert. Die 1. Brixner Notfallübung, die am 7.November im Krankenhaus Brixen stattfand, ist ein Beispiel dafür.
Auch die Notfall- und Evakuierungs-übung am 28.10 beruht auf densel-ben Grundsätzen und ermöglichte durch das risikolose Herbeiführen einer kritischen und gefährlichen Si-tuation das Erproben und Trainieren von komplexen organisatorischen Abläufen.
und ebenfalls Träger des Gens ist? Wie leben Menschen mit schweren chroni-schen Erkrankungen, wie kommen de-ren Angehörigen mit diesen Situationen zurecht? Früher stellten sich viele die-ser Fragen gar nicht.
was zeichnet einen „guten“ Psycho-logen aus?Ich betone immer, dass besonders für uns Psychologen eine wissenschaftli-che Haltung von zentraler Bedeutung ist. Wir sind keine Gurus, keine Hellse-her und keine Besserwisser, die zu allem und überall ihren Kommentar abgeben und diesen als die Erkenntnis verkau-fen. Leider wird von uns oft genau das erwartet. Ein guter Psychologe muss da-her die Theorien, Methodik und die em-pirische Basis und damit auch die Mög-lichkeiten und Grenzen kennen. Eine gute Psychologin muss klar eigene Mei-nung von Fachwissen unterscheiden. Das ist in der Psychologie noch wichti-ger als anderswo. Im klinischen Bereich bedarf es zudem selbstverständlich ei-ner angemessenen Fachkompetenz. Wir müssen über die Entstehung, die diag-nostischen Möglichkeiten, den Verlauf und die Behandlungswege Bescheid wissen und dafür auch genügend Er-fahrung mitbringen. Letztlich ist es im klinischen Bereich aber auch unabding-bar, die nötigen zwischenmenschlichen Kompetenzen zu haben.
welche bedeutung hat die Psycholo-gie für die gesundheit des Menschen?Psychische Probleme sind weit häufi-ger als angenommen. Das sieht man beispielsweise daran, dass in Öster-reich und Deutschland die psychi-schen Erkrankungen die häufigste Ursache für Frühberentung sind und zu den häufigsten Gründen für Krank-schreibungen zählen. Darüber hinaus führen psychische Probleme zu vielen Arztbesuchen. Eine schon etwas ältere Hamburger Studie hat beispielsweise ergeben, dass bei knapp der Hälfte aller Patienten in Praxen von Allgemeinme-dizinern vor allem psychische Probleme vorliegen. Zweitens neigen psychische
Erkrankungen zur Chronifizierung, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden. Außerdem haben einige psy-chische Erkrankungen ein höheres To-desrisiko als beispielsweise manche Form von Leukämie. Auch ohne Sui-zidalität verringert sich übrigens die Lebenserwartung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Zum Teil ist hierfür ein gesundheitsschädigen-der Lebensstil verantwortlich, zum Teil aber kommt es wohl auch direkt zu Ver-änderungen des Immunsystems. Wir haben mittlerweile Hinweise darauf, dass psychische Belastungen ein erhöh-tes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-kungen, Diabetes Typ I und II, Rheuma, Asthma, chronische Schmerzen und neuerdings sogar Alzheimer und viel-leicht auch manche Tumore bedingen. Wie diese Mechanismen ablaufen, wird noch erforscht. Langzeitstudien deuten aber auch auf eine kausale Mitverant-wortung psychischer Belastungen hin.
welche rollen und funktionen haben die Psychologen im südtiroler sanitäts-betrieb?Das ist eine sehr lange Liste: bei Kin-dern denke ich an die Entwicklungsdia-gnostik, an die klinisch-psychologische Diagnostik von Verhaltensauffällig-keiten, von emotionalen Störungen, kognitive Diagnostik der Intelligenz, Aufmerksamkeit, Lernstörungen, psy-chologische Beratung von Lehrern oder Eltern, Einzel- und Gruppenpsychothe-rapie. Bei Erwachsenen ist es primär die Psychodiagnostik, Beratung und Psy-chotherapie bei unterschiedlichen psy-chischen und körperlichen Erkrankun-gen im ambulanten und stationären Kontext, Notfallinterventionen bei Kri-senereignissen, Verkehrspsychologie, Präventionsprojekte, Mitarbeit bei der Erstellung von Rehabilitationsplänen, Zusammenarbeit mit Institutionen, etwa den Sozialdiensten, Gerichten, Pflegeheimen, neuropsychologische Diagnostik bei Demenzen, Beratung und Begleitung deren Angehörigen und Pflegekräfte. Ohne Psychologie ist heu-te eine Zertifizierung in den meisten
Fo
to k
h B
rix
en
26
one # 04/15
au
s D
en
be
zir
ke
nb
rix
en

Bereichen undenkbar. Die Anforderungen wachsen entsprechend. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus aber auch eine Ent-lastung der ohnehin schon knappen Ärzte. Daher besteht mit ihnen, aber auch mit Pflegern und anderen Berufsgruppen zu-meist eine exzellente interprofessionelle Zusammenarbeit.
wie steht es um die psychologische Ver-sorgung im land; ist sie angemessen, und welchen besonderen bedarf an psychologi-schen leistungen gibt es derzeit?Wenn wir uns an italienischen Standards messen, ist die Versorgung sehr gut. Wenn wir uns allerdings mit Österreich, Schweiz, Deutschland, Holland und Skandinavien vergleichen, so ist sie unzureichend. In Restitalien hat sich die Psychologie erst spät entwickelt. Zudem ist dort die Ak-zeptanz bei weitem nicht vergleichbar mit unserer Realität. Auch wenn sich hierzu-lande die Versorgung deutlich verbessert hat, so müssen wir bessere Möglichkeiten entwickeln, die Betroffenen niederschwel-lig zu betreuen. Dadurch können wir nicht nur einer Chronifizierung entgegenwir-ken, sondern reduzieren auch die Kran-kenhausaufenthalte, die Aufnahmen in die Erste Hilfe, viele unnötigen medizini-schen Untersuchungen. Hierfür müssen wir uns optimal organisieren und effizi-ent sein. Angesichts der vielfältigen Auf-gaben bezweifle ich, dass all das mit dem aktuellen Personalstand machbar ist. Ich wünsche mir daher im Rahmen des neuen Landesgesundheitsplanes eine vorurteils-lose Planung der Aufgaben und Ressour-cen, und zwar anhand der zu erwartenden Prävalenzraten, Inanspruchnahme und Outcomeforschung und Kosten/Nutzen-berechnungen zur psychologischen und psychotherapeutischen Versorgung.
was raten sie studenten, die Psycholo-gie studieren möchten?Es ist schwer vorherzusehen, wie sich der Stellenwert der Psychologie in Südtirol in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird. Mit den entsprechenden Qualifikationen ist es zumindest aktuell im Ausland trotz größerer Versorgungsdichte wesentlich ein- facher, einen Arbeitsplatz zu finden.
Sicherheit im Operationssaal ist ein heikles Thema und wird von vielen Komponenten bestimmt. Etwa durch die chirurgischen Abläufe, den Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten, dem technologischen Standard, der richtigen Entkeimung der Materialien, der Anästhesie und den Zustand des Operationsberei-ches insgesamt. Die Empfehlungen zur Sicherheit bei Operationen durch das Gesundheitsministeri-um (2009) geben genaue Anwei-sungen für die Abwicklung der verschiedenen Phasen, sowohl für den Operationssaal selbst als auch für Vorbereitung der Person, die operiert wird. Die Südtiroler Gesundheitsbezirke haben auf dieser Grundlage ein Protokoll zum Gebrauch der OP-Checkliste und der Vorbereitungs-Checkliste ausgearbeitet und implementiert. Bei Letzterer geht es vor allem um die Hygiene der Patientinnen und Patienten, um das Entfernen von Zahnprothese, Hörgeräten, Schmuck jeder Art (Piercings, Ringe, Ketten, Ohrringe) und Nagellack. Das Gesundheitspersonal hat die Aufgabe, die Patientinnen und Patienten in dieser Hinsicht zu beraten, damit die Vorgaben auch eingehalten werden.
Warum ist Schmuck gefährlich? Ringe, Ohrringe und Piercings können - wie jeder metallene Ge-genstand, weil stromleitend – mit den medizintechnischen Geräten (beispielsweise dem elektrischen Skalpell) interferieren und Verbren-nungen verursachen. Ein Piercing im Mundbereich, etwa in der Zunge, kann bei der Intubation Probleme verursachen und stellt außerdem – aus chirurgischer Sicht – ein Risiko für Infektionen dar. Dies auch, wenn die Haut ausreichend desinfiziert wird.
Ein Tattoo ist dann ein Problem, wenn an genau jener Stelle operiert werden soll, an dem sich die Täto-wierung befindet. Auch hier gibt es ein erhöhtes Infektionsrisiko, weil Bestandteile des Tatoos dazu führen, dass die Haut nicht mehr ganz intakt ist.
Gefährlicher Körperschmuck Wieso bei Operationen Vorsicht angesagt ist, wenn der Patient oder die Patientin Tattoos oder Piercings tragen.
Fo
to f
oTo
lia
© o
lly
27
one # 04/15
au
s D
en
be
zir
ke
nb
rix
en

Fo
to p
eTe
r a
. se
eB
ac
he
r
bozen saBine fl arer
Babys im Mittel-punktNicht nur in der Weihnachtszeit steht ein Neugeborenes im Mittel-punkt: Für Primar Hubert Messner von der Neugeborenen-Intensivsta-tion am Krankenhaus Bozen stehen die Kleinsten der Kleinen jeden Tag an erster Stelle. Vom 10. bis zum 12. Dezember 2015 leitete Messner als Tagungsvorsitzender an der Bozner Eurac einen Kongress der AMIETIP („Accademia medica infermierstica di emergenza e terapia intensiva pediatrica“)
Dieser Kongress wurde heuer bereits das vierte Mal veranstaltet und zog wie immer illustre Fachleute aus nah und fern an. Hauptteil des Kongresses waren auch dieses Jahr verschiedene Kurseinheiten, bei denen hochkomplexe Behandlungs-techniken an den kleinen Körpern nach den neuesten Erkenntnissen gezeigt wurden und geübt werden konnten. Dabei standen der kindli-che Herzstillstand, Verbrennungen und Politraumen bei Babys im Mittelpunkt. Aber auch die Sicht des Neonatologen und des Pflegers zur Behandlung eines erkrankten Säuglings in der Intensivstation, etwa bei Asthma, wurden erläutert. Nicht zuletzt wurde der Frage nach dem krankenhausinternen Transport eines kranken Babys ebenso Zeit gewidmet wie jener nach den not-wendigen „non technical skills“, also den Fähigkeiten, die über die bloße „Handwerklichkeit“ hinausgehen. Denn eines steht auch in den Zeiten modernster Medizintechnik fest: die Liebe zu den kleinen Patienten kann kein noch so ausgefeiltes High-Tech-Gerät ersetzen.
„Wir alle haben mit großem Enthusias-mus an der Verwirklichung der Biobank gearbeitet“, erklärt Sabes-Sanitätsdirektor Oswald Mayr, „denn diese Einrichtung ist sowohl für klinische Zwecke als auch für die Forschung grundlegend. Unser Ziel ist es, möglichst bald konkrete Resultate für unsere Patienten zu erzielen, das heißt, Di-agnostik und Therapie zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass mit dieser Zusammen-arbeit die Gesundheitsversorgung in Süd-tirol verbessert werden kann.“
Bereits jetzt schon werden in der Bio-bank etwa 600 000 Blut-, Urin- und DNA-Proben aufbewahrt. Mit den
dazugehörigen klinischen Daten spiegeln sie den Gesundheitszustand der Bevöl-kerung wider und stellen eine wertvolle Grundlage für die medizinische Forschung dar. Denn jede Probe erhöht die Chance, Krankheiten besser zu verstehen, ihnen vorzubeugen und Behandlungsmöglich-keiten zu entwickeln. Eurac-Direktor Stephan Ortner unterstrich bei der Eröff-nung die Bedeutung der neuen Einrich-
bank der zukunft
Mitte Dezember wurde die größte Biobank Südtirols an der Europäischen Akademie (Eurac) eröffnet. Mög-lichst bald sollen die darin gesammelten Proben helfen, Diagnostik und Therapie für Patienten und Patientin-nen zu verbessern.
Peter Pramstaller, Leiter des Eu-rac-Zentrums für Biomedizin
28
one # 04/15
au
s D
en
be
zir
ke
nb
oz
en
bo
ze
n

Veranstaltungen und Reisen des Freizeitclubs
samstag, 9 Januar 2016 shopping-fahrt nach innsbruck und zum einkaufszentrum „Dez“ Abfahrt um 7.30 Uhr vom Platz vor dem Nebeneingang des Friedhofs Bozen (gegenüber Geschäft „Frilo“) Kostenbeitrag Mitglieder: 10 Euro Familienangehörige: 12 Euro Nichtmitglieder: 15 Euro
samstag, 30 Januar 2016
shopping-fahrt nach innsbruck und zum einkaufszentrum „Dez“ Abfahrt um 7.30 Uhr vom Platz vor dem Nebeneingang des Friedhofs Bozen (gegenüber Geschäft „Frilo“) Kostenbeitrag Mitglieder: 10 Euro Familienangehörige: 12 Euro Nichtmitglieder: 15 Euro
samstag, 6 februar 2016
fahrt zum karneval in Venedig Abfahrt um 7.30 Uhr vom Platz vor dem Nebeneingang des Friedhofs Bozen (gegenüber Geschäft „Frilo“) Kostenbeitrag Mitglieder: 22 Euro Familienangehörige: 24 Euro Nichtmitglieder: 27 Euro
samstag, 27 februar 2016
fahrt zum Deutschen Museum, München Abfahrt um 7.30 Uhr vom Platz vor dem Nebeneingang des Friedhofs Bozen (gegenüber Geschäft „Frilo“) Kostenbeitrag Mitglieder: 20 Euro Familienangehörige: 22 Euro Nichtmitglieder: 25 Euro (Eintritt Museum nicht inbegriffen!)
reservierung der Plätze im büro (8894 oder 339 3470852), bei ferdinando (339 8352348) oder bei facchini (8244)
tung für die biomedizinische Forschung in Südtirol: „Das ist eine Ressource von großem Wert, denn es sind Proben der Süd-tiroler Bevölkerung, die hier gelagert wer-den.“ Der größte Teil der Proben stammt bislang von den 8.000 TeilnehmerInnen an der großen Chris-Gesundheitsstudie im Vinschgau (Cooperative Health Rese-arch in South Tyrol), einem gemeinsamen Projekt der Eurac und des Südtiroler Sa-nitätsbetriebs, das untersucht, welche Rolle genetische Veranlagung, Lebens-wandel und Umwelteinflüsse bei der Ent-wicklung bestimmter Krankheiten spielen.
B iobanken sind „Bibliotheken des menschlichen Organismus“ und beinhalten systematische, auswert-
bare Sammlungen humaner Proben für vielfältige Zwecke der Diagnostik und Forschung. Schon seit 2011 gibt es in Mer-an eine derartige Einrichtung. Nun wurde diese durch eine wesentlich größere (230 Quadratmeter) in Bozen ergänzt. Bei Tem-peraturen bis minus 80 Grad – im Fall der Tanks mit flüssigem Stickstoff sogar bis minus 196 Grad – können die Proben hier
langfristig gelagert werden, ohne dass ihre Qualität und damit ihr Wert für zukünf-tige Untersuchungen abnimmt. Es han-delt sich um Blut-, Urin- und DNA-Proben der Südtiroler Bevölkerung und klinische Proben des Dienstes für Immunhämatolo-gie und Bluttransfusion. Alle Proben und Daten sind mit einem Code gekennzeich-net - die sichere Verschlüsselung von In-formationen ist ein zentrales Element im Management von Biobanken.
„Anhand der großen Datenmenge ist es möglich, statistisch relevante Ergebnisse zu erhalten, um die Entwicklung von Krank-heiten, etwa Diabetes und Herz-Kreis-lauf-Erkrankungen, über einen langen Zeitraum zu untersuchen“, erklärt Peter Pramstaller, Leiter des Eurac-Zentrums für Biomedizin. „Indem wir die Proben und Daten von Patienten analysieren, die an der Krankheit leiden, und sie mit gesunden Kontrollen vergleichen, können wir even-tuelle molekulare, wie zum Beispiel geneti-sche, Ursachen entdecken und den Einfluss von Umweltfaktoren bestimmen.“
„Erst die Zusammenarbeit zwischen Land Südtirol, Gesundheitsbezirk und der Vereinigung Il Papavero – der Mohn hat es möglich gemacht, diese für die betroffenen Personen wichtige Einrichtung zu verwirkli-chen“, unterstrich der Direktor des Gesundheitsbezirkes Bozen, Um-berto Tait, bei der Eröffnung.
Der Verantwortliche des Dienstes Hospiz – Palliativcare, Massimo Bernardo, bedankte sich bei allen, die an diesem Projekt mitgeholfen hatten und betonte, dass das neue Hospiz „eine Brücke zwischen Kran-kenhaus und der Gesundheitsver-sorgung vor Ort (Territorium, A.d.R) mit mehr Nähe zu den Bürgern darstellt“.
Landesrätin Martha Stocker war von der „Abteilung mit einer Seele“ und dem gemütlichen Ambiente beeindruckt und lobte die Profes-sionalität und Ausdauer des ärztli-chen und pflegerischen Personals. Stocker hob hervor, wie wichtig die Arbeit sowie die Zusammenarbeit mit der Vereinigung „Der Mohn“ für die Betroffenen und deren Famili-enangehörigen sei.
Sabes-Sanitätsdirektor Oswald Mayr stellte fest, dass der Tod in der heutigen Gesellschaft noch nicht als ein Teil des Lebens wahrgenom-men werde. Die neu gestaltete Ein-richtung sei ein wichtiger Ansatz, um den betroffenen Menschen eine ganzheitliche kulturelle und famili-äre Begleitung zu ermöglichen.
Neues HospizAnfang Dezember wurde die neu gestaltete Palliativstation – Hospiz im Krankenhaus Bozen eröffnet. Gesundheitslandesrätin Martha Stocker sprach die Eröffnungsworte.
Fo
to a
MT
für
Bü
rg
er
an
lie
ge
n, B
oz
en
29
one # 04/15
au
s D
en
be
zir
ke
nb
oz
en

Mer an saBine fl arer
Die steigende Bevölkerungsanzahl in der zweitgrößten Stadt Südtirols, die Fünf-Tage-Woche in den meisten Schulen, die vermehrte Berufstätigkeit beider El-tern – das sind nur einige der Gründe, die dazu führten, dass die Zahl der Anfragen um einen Mensabesuch von Merans Schü-lerinnen und Schülern in den letzten Jah-ren geradezu explodiert sind. Der Neubau einer eigenen Großmensa im „School-Vil-lage“ ist noch Zukunftsmusik, bis da-hin müssen sich die Verantwortlichen der Stadtgemeinde zu helfen wissen. Die „Ausspeisungen“ sind auf verschiedene Einrichtungen verteilt, sogar im Kranken-haus „Franz Tappeiner“ ertönt periodisch (Mittelschul-)Kinderlärm in der hauseige-nen Mensa. Die Nachfrage ist so groß wie die Essenswünsche unterschiedlich sind – immer mehr Kinder müssen oder dürfen dabei auch etwas „anderes“ essen. Alice Bertoli von der Gemeinde Meran erzählt von einer Situation, in der von 80 Kindern ganze 26 ein Alternativmenü ordern. Die Gründe dafür sind vielfältig: Manche sind laktoseintolerant, Zöliaker, Vegetarier, aber es gibt auch die immer größer werden-
So könnte man es nennen, wenn der Dienst für Diät und Ernährung zu Rate gezogen wird, um den vielen verschiedenen Men-sa-Besucherinnen und Besuchern an Merans Kindergärten und Schulen gerecht zu wer-den. Ein Projekt, das im September dieses Jahres abgeschlossen wurde.
Jedem sein eigenes Süppchen
de Anzahl an islamischen Mitbürgerinnen und Mitbürger oder anderer Konfessionen, die aus religiösen Gründen bestimmte Nahrungsmittel nicht essen. Dabei endet das Ganze nicht nur beim bloßen „Weglas-sen“, so müssen beispielsweise bei Zöliakie Lebensmittel ausgetauscht und bei der Zubereitung separate Kochutensilien ver-wendet werden.
Maria Elena Azzaro, Direktorin des Dienstes für Diät und Ernährung im Ge-sundheitsbezirk Meran und Elisabeth Gruber, Koordinatorin des Dienstes, ha-ben im letzten Jahr seit dem Projektstart mit ihren Mitarbeiterinnen Christa Ver-dorfer und Dolores Kuppelwieser intensiv Aufklärung betrieben, um ein Angebot zu erstellen, das nicht nur den hygienischen und geschmacklichen Anforderungen ent-spricht, sondern auch ernährungswissen-schaftlich haltbar ist. Dabei standen ver-schiedene Treffen mit allen Köchen ebenso an wie die Intensivbearbeitung in einer Arbeitsgruppe, in der vier Köche vertreten waren: „Bis jetzt stand es jedem Koch frei, nach eigenen Gutdünken seine Menüs zu planen und zu kochen. Uns war es wichtig, dass nicht nur etwas weggelassen wird, sondern dass sinnvolle Alternativen ent-wickelt werden. Es reicht nicht, die Speck-knödel einfach ohne Speck zu formen – und diese als Alternative anzubieten. Es muss ein eigenes, bedarfsgerechtes Menü für jedes Kind garantiert werden, soweit dies möglich ist“, so Maria Elena Azzaro. Auch die Abwechslung war den Fachleu-ten wichtig: „Es gibt jetzt für sechs Wochen ein anderes Menü, das jeweils im Sommer und Winter unterschiedlich ist.“
G utes Essen kann viel mehr als nur sättigen: Eine richtige Ernährung macht leistungsfähig und fit und
trägt zur Vorbeugung ernährungsbeding-ter Folgeerkrankungen bei. Darüber ist man sich – nicht nur – im Diätdienst einig. Deshalb wünscht sich das Team um Maria Elena Azzaro, dass dieses Projekt nicht auf die Stadt Meran begrenzt bleiben möge, sondern auch in den umliegenden Schul-mensen Einzug findet.
one # 04/15
au
s D
en
be
zir
ke
n
30M
er
an

Mer an saBine fl arer
D as Buch nennt sich „Orthopedic Ma-nagement of Children with Cerebral Palsy“ und ist seit Mitte Oktober auf
dem amerikanischen Markt. Kapitel 24 be-handelt die pathologischen Frakturen von Kindern mit Zerebralparese („Pathologic Fractures in Children with Cerebral Palsy“) und stammt aus der Feder von Olaf Schmidt. „Durch die guten Kontakte, die mir nach
Olaf Schmidt, Kinderorthopäde im Gesundheitsbezirk Meran, war 2013 für zwei Monate am bekannten „Sick-Kids“-Hospital in Toronto, Kanada, tätig und konnte dabei wichtige Kontakte knüpfen. Im Wissenschafts-verlag Nova Science Publishers (New York) ist nun ein Fachbuch erschienen, zu dem der Arzt aus „South Tyrol“ ein ganzes Kapitel beigesteuert hat.
Made in south tyrol
meinem Aufenthalt in Toronto geblieben sind, besonders mit dem Leiter Andrew Ho-ward und dessen Team beziehungsweise mit meinem Ansprechpartner Unni Naray-anan, hatte ich die Möglichkeit, ständig ‚up to date‘ über die Entwicklungen in der chi-rurgischen Kinderorthopädie zu bleiben. Die Erfahrung dort und in der Praxis hier waren grundlegende Voraussetzungen, um an diesem Fachbuch mitzuarbeiten“, schil-dert Schmidt.
Einige OP-freie Stunden musste Schmidt dafür aufwenden, bis das Kapitel druckreif und für die gestrengen Herausgeber in Ord-nung war. Doch die Mühe hat sich gelohnt, die Autorenliste von „Orthopedic Manage-ment of Children with Cerebral Palsy“ liest sich wie das „Who is who“ bekannter Kinder- orthopäden. Darauf vertreten zu sein, sei eine besondere Ehre, so Schmidt.
Bereits 2013 erklärte Schmidt die beson-dere Faszination der siebenstöckigen Kli-nik: „Von dem Moment an, an dem ein klei-ner Patient das Krankenhaus betritt, steht er absolut im Mittelpunkt. Zeit- oder Perso-nalressourcen sind zweitrangig – es zählt einzig und allein das Wohl des Kindes.“
one # 04/15
31a
us
De
n b
ez
irk
en
M
er
an
Link zum Buchwww.novapublishers.com

Mer an saBine fl arer
„Memory“ bedeutet auf Deutsch „Er-innerung“ – und wie im bekannten Kin-derlegespiel mit den bunten Kärtchen geht es auch in diesem Fall darum zu er-kennen, wie gut das Gedächtnis noch ist. Einmal Schlüssel oder Lesebrille verlegen mag noch ok sein, aber was, wenn die An-zeichen für Gedächtnisstörungen sich häufen? Bloße „Schusseligkeit“ oder ein ernsthaftes Problem? Diesen Fragen wird
Remember!
in der „Memory clinic“ arbeiten gleich mehrere Berufsbilder hand in hand, um Diagnose und Behandlung so pra-zise wie moglich stellen zu konnen.
in der neu eröffneten Ambulanz der „Me-mory clinic“ unter der Leitung von Geriat-rie-Primar Christian Wenter am Kranken-haus Meran nun nachgegangen.
Keine Ausreden mehr: Gedächtnisstö-rungen sollten möglichst frühzeitig abge-klärt werden, und sie sind beileibe nicht nur älteren Menschen „reserviert“. Auch Jüngere können – oft im Rahmen einer Erkrankung – an Demenz oder Alzheimer erkranken. Und wer darunter leidet, der belastet damit gleich mehrere Menschen: sich selbst und gleichzeitig die Angehöri-gen oder Personen des engsten Umfeldes im Alltag. Deshalb ist eine fachlich quali-fizierte Abklärung wichtig: In der „Memo-ry clinic“ arbeiten gleich mehrere Berufs-bilder Hand in Hand, um Diagnose und Behandlung so präzise wie möglich stellen zu können. Ärztliches Personal untersucht und bespricht die einzelnen Fälle mit Psy-chologen, Krankenpflegern und Sozial-assistenten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben spezielle Erfahrung in der Diagnostik und Behandlung von Ge-dächtnisproblemen und Hirnleistungsstö-rungen. Körperliche Untersuchungen ge-hören ebenfalls dazu wie Laboranalysen, psychologische Tests und - falls notwendig - weitere Untersuchungen.
Seit kurzem gibt es ein neues Angebot am Krankenhaus Meran: das Ambulato-rium der „Memory clinic“
32
one # 04/15
au
s D
en
be
zir
ke
n
32M
er
an

Das team der „Memory clinic“ Christian Wenter (Primar) Elisabeth Abraham (Ärztin) Miriam Insam (Ärztin)
Christine Kirchlechner (Ärztin) Ingrid Ruffini (Ärztin) Helga Meister (Krankenpflegerin) Barbara Elisabeth Klotz (Psychologin) Valentina Pilotto (Sozialassistentin) Enrica Pedot (Verwaltungsmitarbeiterin)
Vormerkung Visiten von Montag bis Freitag von 11:00 – 12:00 Uhr unter der Telefonnummer 0473 251 150 (Geriatrie)
Fo
to
sa
Bin
e f
la
re
r
Abschließend wird mit dem Patienten oder der Patientin ein intensives Aufklä-rungs– und Beratungsgespräch geführt. Ein individueller Therapie– und Behand-lungsplan - auf Wunsch mit dem Hausarzt und den Angehören besprochen – bildet den Abschluss eines Besuches in der Ge-dächtnisambulanz. Zur Philosophie der neuen Memory clinic gehört auch, dass der Zustand des Patienten oder der Patientin anschließend in periodischen Abständen überprüft wird.
fo
to
ga
Br
iel
Ma
gn
ar
ell
i
Gabriel Magnarelli, Krankenpfleger Notaufnahme Krankenhaus Meran
Diese Szene fanden die Mitarbei-terinnen und Mitarbeitern der Notaufnahme Meran vor, die sich an der diesjährigen Notfallübung beteiligten.
Rund 300 Personen nahmen an einer der größten Notfallübungen des Jahres teil, die am Samstag, 21. November 2015 im großen Innen-hof der „Rossi-Kaserne“ in Meran stattfand. Mit dabei waren sechs Pfleger und fünf Ärzte des Gesund-heitsbezirkes Meran sowie viele Freiwillige der Rettungsdienste Weißes und Rotes Kreuz und der Feuerwehren. Sie alle haben ihre Erfahrung und Kompetenz in die Waagschale geworfen, um eine optimale Gesundheitsversorgung und logistische Betreuung der 38 „Verletzten“ zu garantieren. Unterstützt wurden sie dabei von Mitgliedern des Bataillons „Julia“, die organisatorische Schützenhilfe leisteten.
Die gute Organisation des Weißen Kreuzes und des Notrufdienstes 118 ermöglichten es, dass das Notfallprotokoll für den Ablauf eines sogenannten „MANV 3“ (Massenanfall an Verletzten Stufe 3) perfekt durchgespielt werden konnte – genauso, wie vom Zivil-schutz vorgesehen.
Durch tragische Erfahrungen, wie etwa dem Zugunglück im Vinschgau im Jahre 2010, wird uns tagtäglich vor Augen geführt, wie wichtig eine ständige fachliche Aus- und Weiterbildung ist, damit im Ernstfall eine große Anzahl von Verletzten betreut werden kann. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes beteiligen sich regelmäßig an diesen Übungen.
Notfallübung: simulierte ExplosionEs begann mit einem lauten Knall, anschließend war alles in Rauch ge-hüllt und nur die Schreie der Verletz-ten waren zu hören.
es geht voran: Der firstbaum auf dem Dach des neuen Teiles des krankenhauses schlanders anfang Dezember.
fo
to
ka
rl
un
ge
ric
hT
33
one # 04/15
au
s D
en
be
zir
ke
n
Me
ra
n

Seit Dezember 2014 begleiten ehrenamtliche Mitarbei-terInnen der Caritas Hospizbewegung Patientinnen und Patienten im Krankenhaus Bruneck durch die Nacht. Ende Oktober lud der Pflegedienstleiter Alexander Kugler die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Caritas Hospizbewe-gung zu einem ersten Erfahrungsaustausch ein.
Z um ersten Treffen nach Einführung des Angebotes im Krankenhaus Bruneck waren neben der Verant-
wortlichen für die Caritas Hospizbewe-gung, Ursula Steinkasserer Goldwurm, drei von sieben Freiwilligen gekommen. Pflegedienstleiter Kugler berichtete, so-wohl Patientinnen und Patienten und de-ren Angehörige als auch das Pflegeperso-nal hätten den Dienst gut angenommen. Von allen Seiten gebe es nur Lob für die Arbeit der Freiwilligen. Er betonte: „Dieser Dienst ist eine wichtige Unterstützung der Arbeit des Krankenpflegepersonals. Von Dezember 2014 bis Ende Oktober 2015 wur-de der Dienste 31 Mal angefordert.“
Interessant und berührend waren die Berichte der Ehrenamtlichen über die Erfahrungen mit Patienten und Kran-kenpflegepersonal. Einig waren sich alle darin, dass gute Kommunikation, ein en-ger Kontakt und Austausch zwischen Pfle-gepersonal und ehrenamtlichen Helfern sehr wichtig sei. Denn jede Betreuung sei anders, Feingefühl und Flexibilität seien unbedingt nötig, um kranke Menschen gut durch die Nacht zu begleiten. Alle Freiwilligen bestätigten, dass sich die Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal gut eingespielt habe. Sie seien dankbar für die Erfahrungen mit den Patienten, für manches tiefe Gespräch und dafür, einen Dienst am Nächsten leisten zu können und
„Einfach da sein“ – Begleitung durch die Nacht
gebraucht zu werden. „Ich komme beflügelt heim, die Dankbarkeit und die tollen Er-fahrungen wiegen den Schlafmangel auf“, so Peter Baumgartner, der einzige Mann in der Runde der Freiwilligen. „Dann ist das wohl eine Erfolgsgeschichte mit Vorteilen für alle, für die Patienten, für die Angehö-rigen und für das Pflegepersonal, die wir auf jeden Fall fortsetzen wollen “, brachte es Frau Ursula Steinkasserer Goldwurm, von der Caritas Hospizbewegung abschlie-ßend auf den Punkt.
Fo
to M
ar
ia r
ieD
er
bruneck Maria elisaBeTh rieDer
34
one # 04/15
au
s D
en
be
zir
ke
n
34b
ru
ne
ck
Von li. nach re.: Alexander Kugler, Ursu-la Steinkasserer Goldwurm, die ehren-amtlichen MitarbeiterInnen: Renate Huber Mitterhofer, Maria Pramstaller Horvat, Peter Baumgartner.
Auf dem Bild fehlen die ehrenamtli-chen Mitarbeiterinnen: Wally Felderer Seeber, Melitta Irschara Feichter, Hil-degard Tammerle Durnwalder, Zäzilia Gasteiger Gasser

Fo
to D
ieTe
r D
ur
eg
ge
r
Seit 2.November 2015 ist die „Tages- klinik Onkologie“ im 5.Stock des Krankenhauses Bruneck in Betrieb. 14 Therapiestühle und zwei Liegeplätze stehen für die stationären Patientin-nen und Patienten zur Verfügung. Die Zubereitung der Chemotherapie erfolgt im dafür vorgesehenen Labor-bereich. Ein motiviertes Team hat die Arbeit aufgenommen.
Innerhalb eines Jahres entstand im Krankenhaus Bruneck im 5. Stock, Bau B, eine moderne Tagesklinik für onkolo-gische Patientinnen und Patienten. Die „Tagesklinik Onkologie“ ist Teil des me-dizinischen Departments. Die Ärztinnen Ulrike Felder, Marlene Notdurfter und Evelyn Hainz arbeiten abwechselnd im Team der Tagesklinik und betreuen die Patientinnen und Patienten mit Tumorer-krankungen. Das Pflegeteam, das aus Be-werberinnen verschiedensten Abteilun-gen zusammengesetzt wurde, wird von der Koordinatorin Margareth Reier geleitet. In den letzten Wochen und Monaten hat sich das Pflegepersonal fachlich gut auf die neuen Herausforderungen vorbereitet und sein Wissen erweitert. Ein Großteil der Krankenpflegerinnen hat bereits vor-her in den verschiedenen Chemotherapie-bereichen gearbeitet.
Die Zubereitung der Therapien erfolgt unter höchstem Sicherheitsstandard in einem extra dafür errichteten Labor. Apo-thekerIn und biomedizinisch-technische AssistentIn sind in enger Zusammenarbeit für die exakte Vorbereitung der Chemo-therapien zuständig und verantwortlich.
Eine kleine Gruppe von spezialisierten Hilfskräften sorgt, durch die spezielle Rei-nigung der Abteilung, täglich dafür, dass die hygienischen Voraussetzungen für eine sichere Betreuung der Patientinnen und Patienten gewährleistet sind. Ziel des gesamten Teams in der Tagesklinik ist eine umfassende Betreuung der Tumorer-krankten. Diese erhalten eine adäquate Therapie unter Einhaltung aller Sicher-heitsmaßnahmen, aber genauso wichtig ist es, den Patientinnen und Patienten in ihrer schwierigen Lebenssituation, Stütze und Bezugspunkt zu sein. „Eine individu-elle Beratung und Betreuung der onkolo-gischen Patientinnen und Patienten und ihrer engsten Angehörigen kann nur ein motiviertes, interdisziplinäres Team er-möglichen und ein solches haben wir für unsere neue Abteilung gefunden“, sagt An-nelies Hopfgartner von der Pflegedienstlei-tung in Bruneck.
Ein Dank gilt allen Mitarbeiter/innen der unterschiedlichsten Berufsgruppen und Abteilungen, die zur Realisierung und Inbetriebnahme dieser schönen Ab-teilung beigetragen haben.
bruneck Maria elisaBeTh rieDer
neue „tagesklinik onkologie“
one # 04/15
35a
us
De
n b
ez
irk
en
b
ru
ne
ck
Open month – Frauengesund-heitDas „Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) ist die nationale Beobachtungsstelle für Frauengesundheit. Ihr Ziel ist es, die Kultur der geschlechterorientierten Gesundheit zu fördern und in Vorsor-gemaßnahmen die Unterschiede zu berücksichtigen. Der Monat Oktober war der „Frauengesundheit“ gewid-met. So wurden die „Frauenfreund-lichen Krankenhäuser“ aufgerufen, Aktionen zum Thema „Frauenge-sundheit und Ernährung“ zu setzen.
Im Krankenhaus Bruneck haben die Abteilung Gynäkologie/Geburtshilfe, Zentrum für Reproduktionsmedizin und Kryokonservierung der Gameten und der Dienst für Diät und Ernäh-rung in der Eingangshalle bildliches Anschauungsmaterial und inter-essante Informationsbroschüren aufgelegt. Zudem wurden Bilder von Frauen in spezifischen Lebenssitua-tionen ausgestellt (aT )
Therapiestühle in der Tagesklinik Onkologie

„zum glück konnte ich helfen“
Pia David war 1981 eine der ersten Sozialassis-tentinnen Südtirols. Nun, nach über 30 Jahren Dienst im Krankenhaus Bozen und der Versetzung in den Ruhestand, wagt sie einen Blick zurück.
wenn sie an ihre ersten arbeitswochen denken und an ihre letzten – welche unter-schiede fallen ihnen da auf?„Die ersten Wochen und Monate musste ich erst einmal das Krankenhaus, die Organi-sation und die sozialen Einrichtungen von Bozen beziehungsweise Südtirol kennenler-nen. Ich hatte genug Zeit, Dienste und Ver-eine zu besuchen, um persönliche Kontakte zu knüpfen. Der Sozialdienst im Kranken-haus Bozen war ganz neu, seine Funktion musste erst – auch intern - bekannt ge-macht werden. Es gab keine Richtlinien, weder bezüglich der Aufgaben, noch der Arbeitsabläufe. Meine Kollegin Marta Ran-zi hatte 1980 begonnen, den Dienst alleine aufzubauen, formell unterstützt von unse-rem damaligen Vorgesetzten, dem Vizesani-tätsdirektor Karl Kob. Es hat sich dann bald herausgestellt, dass unsere Hauptaufgabe die Organisation der Entlassung von nicht mehr selbständigen oder alleinstehenden Patienten und die Unterstützung und Bera-tung der Angehörigen sein würde. Damals waren wir die einzigen, die sich innerhalb des Krankenhauses in diesem Bereich betä-tigten, so etwas wie eine ‚geschützte Entlas-
Vita saBine fl arer
sung‘ gab es nicht. In der Gemeinde Bozen gab es außerdem keinen Sozialdienst für Se-nioren und so haben wir einzelne Patienten oder Patientinnen auch über einen längeren Zeitraum nach der Entlassung betreut. Wir hatten damals mehr Zeit, auch für Hausbe-suche, wenn es notwendig war. Die letzten Jahre meiner Arbeit waren hingegen ge-kennzeichnet von großem Zeitdruck, sehr vielen Meldungen von Patienten mit Proble-men, viel mehr Bürokratie in jedem Bereich sowie immer weniger Zeit für das Erarbei-ten von Lösungen und für das persönliche Gespräch mit den Patienten und Patientin-nen. Und immer mehr Zeit am PC für Doku-mentation oder Prozeduren.
sind die Patientinnen und Patienten heu-te anders als vor 35 Jahren?Die Klientel ist ziemlich gleich geblieben: alleinstehende, betagte Kranke, Menschen mit Demenz, vollkommen vereinsamte Alte, Obdachlose, Patienten jeden Alters mit schweren Erkrankungen, die alle nach der Entlassung Hilfe brauchen sowie viele ver-zweifelte Angehörige von pflegebedürftigen Patienten. Ich selbst habe die meisten Jahre
36
one # 04/15
Vit
a

Fo
to l
eo
la
nz
ing
er
Patientinnen und Patienten eine bedürf-nisgerechtere Hilfe vermittelt werden konnte. Die Milleniumsjahre waren ge-kennzeichnet durch Verbürokratisierung, immer kompliziertere Zugangsbedingun-gen zu den Diensten, erste Einsparungen und Einschränkungen bei gleichzeitiger Zunahme der Problemsituationen – und manchmal ein Gefühl der Überforderung.
Zum Glück gab es trotz allem immer Patienten, denen ich helfen konnte oder Angehörige, die nach einem ausführlichen Gespräch mit einer belastenden Situati-on besser fertig werden konnten und mir dafür sehr dankbar waren, obwohl ich das Gefühl hatte, eigentlich nichts getan zu haben.
in der Abteilung für Geriatrie gearbeitet und dort bin ich in der letzten Zeit vielen Senioren zwischen 90 und 100 Jahren be-gegnet, die vor ihrer Einlieferung selbstän-dig waren. Das gab es vor 30 Jahren kaum. Die Kinder dieser Patienten sind dann oft selbst schon 70 oder älter und haben oft einen kranken Ehepartner zu pflegen, En-kelkinder zu betreuen und dabei selbst ge-sundheitliche Probleme. Und dann sollten sie auch noch ihre kranke Mutter pflegen. Relativ neu sind natürlich auch die vielen ausländischen Patienten und Patientin-nen aus allen Erdteilen. In meinen ersten Jahren gab aufgrund des eisernen Vor-hanges ja nicht einmal Patienten aus Ost-europa! Bestenfalls deutsche Touristen. Einmal gab es einen schwierigen Patienten von den Philippinen, an den ich mich erin-nere, der war schon fast eine Sensation.
an welches ereignis während ihres be-rufslebens erinnern sie sich besonders?Abgesehen von einzelnen Fällen, besser Schicksalen, an die ich mich natürlich er-innere, war für mich jede neue Kollegin, jeder neue Kollege, der zu uns dazugekom-men ist, ein Ereignis. Vor allem war es aber die Tatsache, dass dank der Einstellung unserer Koordinatorin, Daniela Pintarelli, vor zirka 15 Jahren, aus zwei einzelnen So-zialassistentinnen, die nirgends wirklich dazugehörten, der Sozialdienst des Kran-kenhauses Bozen wurde. Heute besteht dieser aus sechs Mitarbeitern.
wenn sie einen zauberstab hätten – welche gesellschaftlichen Probleme wären ihrer Meinung nach am dringendsten zu lö-sen, damit der sozialdienst weniger oft kon-taktiert werden müsste?Keine Einsamkeit, keine Kriege, genug fi-nanzielle Mittel für alle und alles, eine perfekte Vernetzung aller sozialen und sa-nitären Einrichtungen - ich glaube, nicht einmal ein Zauberstab würde das alles schaffen. Auch an sich positive Phänomene wie eine hohe Lebenserwartung und der medizinische Fortschritt können manch-mal soziale Probleme verursachen.
Drei schlagworte zu über drei Jahrzehn-ten Dienst: was hat die achziger, neunziger und Milleniumsjahre charakterisiert?In den 80er-Jahren hieß es Aufbau, Er-weiterung und Etablierung des Dienstes im Krankenhaus. In den 90er-Jahren ent-standen viele neue soziale Einrichtungen auf dem „Territorium“, damit verbesser-ten sich die Arbeitsbedingungen, da den
Seit 35 Jahren ein Netz für Men-schen in NotDas Berufsbild des Sozialassistenten in den Krankenhäusern ist seit 1968 gesetzlich verankert; seit 35 Jahren gibt es diese auch in Südtirol. Was im Krankenhaus Bozen einst als Dienst mit einer Mitarbeiterin begann, gehört heute zum Alltag nicht nur in Bozen, sondern auch in Meran, Schlanders und Bruneck. Insgesamt sind heute in diesen Krankenhäusern neun Sozialassistenten beschäftigt. Hierarchisch untersteht die Berufs-gruppe der jeweiligen ärztlichen Di-rektionen. Gerufen und kontaktiert werden können sie vom Personal oder von den Betroffenen und/oder deren Angehörigen selbst.
„auch an sich positive Phänomene wie eine hohe lebenserwartung und der medizinische fortschritt können manchmal soziale Probleme verursachen. “
pia DaViD
37
one # 04/15
Vit
a

infografik
Over 65Die Zahlen, sie lügen nicht, heißt es. Und die Zahlen sagen, dass der Anteil der über 65-jährigen in den letzten Jahren in Italien – und den meisten europäischen Ländern – stark zu-genommen hat. Für Italien sprechen die vom nationalen Sta-tistikinstitut (Istat) gesammelten Daten eine klare Sprache.So betrug im Jahre 2002 in Italien das Verhältnis Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren zu Menschen älter als 65 Jahre 100 zu 131,7. Zwölf Jahre später betrug dieses bereits 100 zu 157,7. Geringe Geburtenrate gepaart mit verbesserten Lebenserwartung trugen und tragen zu dieser Entwicklung bei. Hatten Männer mit 65 in Italien im Jahre 2002 noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von 16,9 Jahren, ist diese im Jahre 2002 um gut zwei Jahre auf 18,8 Jahre gestiegen. Gleiches gilt für die Frauen, deren Le-benserwartung mit 65 im Jahre 2014 sich statistisch gesehen auf 22,2 Jahre belief. Zwölf Jahre vorher waren es mit 20,8 Jahren fast zwei Jahre weniger. Diesen Zahlen entsprechend sind auch die Pro-gnosen. So geht das Istat davon aus, dass der Anteil der Bevölkerung mit einem Lebensalter höher als 65 Jahren von heu-te 21,7 Prozent der Bevölkerung auf 32,6 Prozent im Jahre 2065 steigen wird.
Eine derartige Entwicklung stellt für ein Gesundheitssystem eine große Heraus-forderung dar, denn naturgemäß müs-sen ältere Menschen öfter medizinische Leistungen in Anspruch nehmen als jün-gere. Auch dazu liefert das Istat Daten, die diese Annahme untermauern: Wäh-rend italienische Haushalte mit Paaren unter 35 im Jahr 2014 rund 100 Euro für ihre Gesundheit und Gesundheitsver-sorgung ausgegeben haben, waren es bei Paaren mit einem Lebensalter von über 65 Jahren im gleichen Zeitraum schon rund 150 Euro.(pas)
38P
er
so
na
lia
< 15100unter 15-Jährige
201513.219.074über 65-Jährige
< 3592,92 €im Jahr 2014
206520.007.068über 65-Jährige
65+148,46 €im Jahr 2014
Bevölkerungsanstieg der über 65-Jährigen in Italien
Ausgaben für Sanität und Gesundheit
€€€
2014157,7über 65-Jährige
2002131,7über 65-Jährige
€€€
one # 04/15

Wer immer schon wissen wollte, wie viele Zigaretten weltweit heute geraucht wurden, wie viele Menschen dieses Laster mit dem Leben bezahlt haben oder wie viel Geld die Regierun-gen dieser Welt bis dato in die Ge-sundheitsversorgung gesteckt haben, bekommt seinen Wunsch auf www.worldometers.info schnell und ohne großen Aufwand erfüllt.
Die Seite, die es in 35 Sprachen gibt - unter anderen auch in Deutsch und Italienisch - stellt diese und viele andere Daten in „Echtzeit“ zur Verfü-gung. Die Informationen sind unter-teilt in die Rubriken Weltpopulation, Regierung & Wirtschaft, Gesellschaft & Medien, Umwelt, Essen, Wasser, Energie sowie Gesundheit. Die Zah-len können „live“ dabei beobachtet werden, wie sie in die Höhe rattern. Manche schnell, andere schneller und wiederum andere fast gar nicht.
„Weltstatistiken in Echtzeit“ ist das Motto von www.worldometers.info und es ist tatsächlich ziemlich beeindru-ckend, wenn man der Zahl der durch Rauchen verursachten Todesfälle beim Größerwerden zusieht. Oder jener der Gesundheitsausgaben der Regierun-gen, die mit hoher Geschwindigkeit nach oben rauscht. Oder jener, welche die durch übertragbare Krankheiten verursachten Todesfälle darstellt.
Wie kommen diese Zahlen zustande? Grundlage ist, so wird auf der Seite erklärt, ein Algorithmus, der die neu-esten und genauesten zur Verfügung stehenden Statistiken verarbeitet und dann das Resultat auf der Seite dar-stellt. Nicht, dass man diese Informa-tionen anderswo nicht finden würde, aber diese in einer derart gebündelten und aktuellen – und sich aktualisie-renden Form – vor sich zu sehen beein-druckt und macht nachdenklich.
gesunDheit iM netz peTer a . seeBacher
online lesen
Dr. Roberto Mag-nato: neuer Primar der HNO Meran
Ab 1. Jänner 2016 wird Dr. roberto Magnato, langjähriger Facharzt an der Meraner HNO-Abteilung, die Abteilung im Gesundheitsbezirk Meran leiten. „Dr. Magnato zeichnet neben seinen Fähigkeiten als erfahrenen HNO-Arzt auch aus, dass er ein exzellenter Kie-ferchirurg ist“, so Generaldirektor Thomas Schael und Bezirksdirektorin Irene Pechlaner. Besonders für die Rekonstruktion von angeborenen oder erworbenen Kiefer- und Gesichtsmiss-bildungen ist er in Fachkreisen bekannt. Der 51-jährige sieht sich selbst als „Netzwerker“ und freut sich über seine neue Aufgabe: „Gerade mit den ‚Nach-barbereichen‘ wie der Dermatologie oder der Zahnheilkunde haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit. Aber auch im Bereich der Onkologie arbeiten wir sehr gut mit der ‚Schwesterabteilung‘ am Krankenhaus Bozen zusammen.“
Dr. Norbert Über-bacher: neuer Primar der HNO Brixen
In Brixen wird ab 1. Jänner 2016 der 63-jährige facharzt norbert überba-cher die HNO-Abteilung leiten. „Dr. Überbacher verfügt über aus-gezeichnete Erfahrung im gesamten Bereich der HNO, insbesondere bei kom-plexen Fällen. Außerdem kann er eine kontinuierliche Teilnahme an Weiterbil-dungen aufweisen“, so Generaldirektor Thomas Schael und Bezirksdirektor Walter Amhof, die Überbacher weiters Erfahrung im Konfliktmanagement und Führungsverhalten bestätigen.
Besonders in der Betreuung hörge-schädigter Kinder hat sich der Facharzt einen Namen gemacht, seit 1987 leitet er die diesbezügliche einfache Einrich-tung der Bezirke Brixen und Bruneck und ist Mitglied des Fachteams auf Landesebene. „Auch im Bereich der Ohr- und Tumorchirurgie war es mir immer ein Anliegen, auf dem neuesten Stand zu sein. Besondere Erfahrung konnte ich dabei bei einem Aufenthalt in München am Klinikum Großhadern sammeln“, so Norbert Überbacher, der seit 1998 als Stellvertreter dem ehemaligen Primar Paul Goller zur Seite stand.
Gezählte Welt
Kopf des Jahres
Gesundheitslandesrätin Martha Stocker ist für die Rai Südtirol „Kopf des Jahres“ 2015. Die Redaktion begründet es in einem Tweet folgendermaßen: „Sie musste immer den Kopf hinhalten, sie stellte sich trotzdem der Diskussion: Unser Kopf des Jahres @MarthaSto-cker”. Wir gratulieren herzlich.
Fo
to p
riV
aT
Fo
to l
eo
pr
iVaT
F
oto
Ma
ria
pic
hle
r/l
pa
39
one # 04/15
ge
su
nD
he
it i
M n
et
z

iMPressuM one – das Magazin des Südtiroler Sanitätsbetriebes ausgaBe 4 /2015 (Aut. Pres.Trib. BZ Nr. 17/2002 R.ST.17.09.02) her ausgeBer: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen, Sparkassenstr. 4, 39100 Bozen Ver anT WorTlicher Direk Tor: Lukas Raffl koorDinaTion: Peter A. Seebacher reDak Tion: Evelyn Gruber-Fischnaller (egf), Ulrike Kalser (uk ), Maria Elisabeth Rieder (Mer), Marina Cattoi (Mc), Sabine Flarer (sf ), Lukas Raffl (lr), Peter A. Seebacher (pa s) üBerseTzungen: Tatiana De Bonis, Emanuela Covi gr afik: Gruppe Gut Gestaltung OHG, Kapuzinergasse 8/15, 39100 Bozen erscheinungsWeise: vierteljährlich reDak TionsaDresse: Abteilung für Kommunikation, Marketing und Bürgeranliegen, Sparkassenstraße 2, 39100 Bozen Tel : +39 0471 907138 e-Mail : [email protected] WeB: www.sabes.it Druck: Fotolito Varesco GmbH, Nationalstraße 57, 39040 Auer
süDtiroler sanitätsbetrieb online Homepage: www.sabes.it Erstvisiten vormerken (Dermatologie, Kardiologie, HNO und Uro- logie): www.sabes.it/onlinevormerkung Wo sind Leistungen am schnellsten verfügbar?: www.sabes.it/vormerkzeiten Stellen- angebote, Neuigkeiten zu Behandlungsmethoden, Vormerkungsmodalitäten, Dienste in Ambulatorien/Abteilungen: www.sabes.it/news Praktische Tipps zur Gesundheit: www.sabes.it/gesundheitsvorsorge Diese Ausgabe digital und online: www.issuu.com/sabesasdaa
kontak t Redaktion one: [email protected] Redaktion Gesundheitsbezirk Brixen: [email protected] Redaktion Gesund-heitsbezirk Bozen: [email protected] Redaktion Gesundheitsbezirk Meran: [email protected] Redaktion Gesund-heitsbezirk Bruneck: [email protected]
one