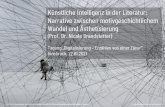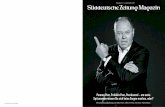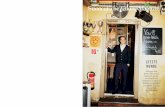SpurenLesen: Das narrative Moment im improvisierten ... · PDF fileInhalt I Einleitung:...
Click here to load reader
Transcript of SpurenLesen: Das narrative Moment im improvisierten ... · PDF fileInhalt I Einleitung:...

Fachbereich 10: Sprach- und
Literaturwissenschaften
Studiengang:
Transnationale Literaturwissenschaft: Literatur,
Theater, Film
Masterarbeit
SpurenLesen:
Das narrative Moment im
improvisierten Theater der
Gegenwart
vorgelegt von: Ina Schenker
Römerstraße 28
28203 Bremen
Telefon: 0176-84286568
Email: [email protected]
Matrikelnummer: 255084 3
Gutachterin: Dr. Elke Richter
Zweitgutachterin: Prof. Dr. Elisabeth Arend
Abgabetermin: 27.01.2013
Vorgelegt.am: 31.12.2012

Inhalt
I Einleitung: Ausführung der Fragestellung 3
II Das narrative Moment im improvisierten Theater 5
1. Wichtige Grundlagen dieser Arbeit 5
2. Definition des Gegenstands und Forschungsüberblick 7
a) kurzer Blick in die Entstehungsgeschichte 7
b) Improvisationstheater heute: eine Definition 9
c) Forschungstand 11
3. „group mind“ und Emergenz als konstituierende Parameter improvisierter
Narrationen? 14
a) Del Close und der Mythos des „group mind“ 15
b) Emergenz in der Ästhetik des Performativen bei Erika Fischer-Lichte 16
c) soziale Emergenz und kollaborative Kreativität bei Robert K. Sawyer 19
d) systemtheoretische Emergenz bei Gunter Lösel und Zwischenfazit 21
III Spuren und SpurenLesen 24
1. Verwendung des Spurbegriffs 25
a) Der Spurbegriff bei Jacques Derrida 27
b) Der Spurbegriff bei Carlo Ginzburg 29
2. Attribute der Spur und Ebenen des Spurenlesens 31
3. Das narrative Moment der Spur im Forschungsüberblick 35
IV SpurenLesen als Erklärungsmodell improvisierter Narrationen 39
1. Improvisierte Narrationen als Semioseprozesse 41
2. Das abwesende Skript 42
3. Das Subjekt im Kollektiv 46
V Fazit und weiterführende Fragen 52
Bibliografie 57
Erklärung 62
Anhang: DVD

3
I Einleitung: Ausführung der Fragestellung
Ein Improvisations-Spieler muss wie ein Mensch sein, der
rückwärtsgeht: Er sieht, wo er gewesen ist, aber er achtet nicht
auf Zukünftiges. Seine Geschichte kann ihn überall hin führen,
doch er muss ihr ein „Gleichgewicht“ und Struktur geben, das
heißt sich an die vorangegangenen Episoden erinnern und sie
wieder in die Geschichte einführen.1
Pas des traces, pas d’histoires.2
Das moderne westliche Improvisationstheater wird oft in einer Schublade hinter Stand-Up-
Comedy versteckt, gilt als Laientheaterbewegung, gruppentherapeutische
Theaterpädagogikübung oder wird als Vorform im Probenprozess einer Inszenierung verortet.
All dies kann improvisiertes Theater sein, es kann aber auch mehr. Neben den bereits
erwähnten Erscheinungsformen wird improvisiertes Theater seit einiger Zeit verstärkt als
eigenständiges ästhetisches Erlebnis wahrgenommen, dem so auch ein Platz in der
wissenschaftlichen Forschung eingeräumt werden muss.3 In den Vordergrund rücken dabei
neben diachronen Fragen, die eine historische Entwicklung des modernen
Improvisationstheaters nachzeichnen, auch synchrone Interessen. Diese orientieren sich vor
allem am „Wie“ des theatralen Improvisationsprozesses, für den theoretische Beschreibungs-
und Erklärungsmodelle gesucht werden.
Auch in dieser Arbeit soll der Frage nach dem „Wie“ weiter auf den Grund gegangen werden.
Hauptanknüpfungspunkte bilden dabei die Grundpfeiler des improvisierten Theaters: Die
unvorbereitete, momentgebundene Erzeugung narrativer Szenen in Gemeinschaft. Das
Prozesshafte, Erlebnis- und Ereignisorientierte, das dieser hic et nunc-Situation
eingeschrieben ist, rückt das improvisierte Theater aus theaterwissenschaftlicher Perspektive
in die Nähe eines performanztheoretischen Ansatzes, der im deutschsprachigen Raum vor
allem durch Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen aus dem Jahr 2004 geprägt ist.
Als besonders relevant können dabei Fischer-Lichtes Überlegungen zur Entstehung von
Bedeutung in einem gemeinschaftlichen Prozess gelten, für die sie das Konzept der Emergenz
anführt. Emergenztheorien werden auch von Robert Keith Sawyer in seinem Buch Improvised
Dialogues. Emergence and Creativity in Conversation von 2003 und Gunter Lösels 2011
verfasster und bisher unveröffentlichter Dissertation „Das Spiel mit dem Chaos.
1 Johnstone, Keith: Improvisation und Theater, S. 198. 2 Hard, Gerhard : Spuren und Spurenleser, S. 70. 3 Dörger, Dagmar/Nickel, Hans-Wolfgang: Improvisationstheater, S.8.

4
Performativität und Systemcharakter des Improvisationstheaters“4 herangezogen, um den
Improvisationsprozess beschreiben zu können. Improvisationstheater wird in beiden letzteren
Ansätzen als System verstanden, das im Laufe seiner Entwicklung eigenständige Dynamiken
hervorbringt, die nicht mehr auf die einzelnen Spielerindividuen reduzierbar sind und die eine
eigene Rolle bei der Erzeugung von Bedeutung spielen. Aus diesen Betrachtungen resultieren
wichtige und schlüssige Erkenntnisse, es bleiben aber auch Lücken im Beschreibungsmodell.
Diese beziehen sich vor allem auf die Rolle des Individuums im Kollektiv und das narrative
Moment an sich, welches doch eine ganz besondere Funktion im improvisierten Theater
einnimmt, da im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen performativen Formen in erster Linie
und ganz explizit versucht wird, Geschichten zu erzählen.
An diesen Leerstellen soll hier vor allem anhand der Arbeit von Gunter Lösel angesetzt und
eine erweiternde Theorie vorgestellt werden. Es wird davon ausgegangen, dass das
Spielersubjekt eine ganz entscheidende Rolle bei der Erzeugung von Narration im Kollektiv
spielt. Um diese zu erklären, wird als emergenztheoretisch ergänzendes Modell
vorgeschlagen, den Prozess des Improvisierens als SpurenLesen zu verstehen. SpurenLesen5,
hier gekennzeichnet durch einen starken Fokus auf einen aktiven Lesebegriff, wird als ein
Semioseprozess verhandelt, dem das Narration konstruierende Moment durch den
interpretierenden Spurenleser eingeschrieben ist und der so vor allem die Wahrnehmung und
Deutung durch ein Individuum in den Vordergrund rückt.
Folgende Fragen werden also in dieser Arbeit gestellt: Wie kann das Subjekt in einem als
emergent verstandenen, theatralen Improvisationsprozess gedacht werden? Wo verlaufen die
Grenzen eines emergenztheoretischen Zugriffs? Wie können die Spieler Narrationen im
improvisierten Theater erschaffen? Kann die Denkfigur des SpurenLesens als
Beschreibungsmodell greifen und welche Rückwirkungen hat diese Anwendung dann auf das
Paradigma des SpurenLesens und der Spur selbst?
Für die Beantwortung dieser Fragen ist es notwendig, dass in einem ersten Schritt genau
definiert wird, was unter modernem, westlich geprägtem Improvisationstheater als
Gegenstand dieser Untersuchung verstanden wird und wie sich der Forschungsstand
diesbezüglich verhält. Anschließend werden das Konzept des Kollektiven, in der
Improvisationstheaterfachsprache als „group mind“ bekannt, und der daraus resultierende
emergenztheoretische Zugriff auf seine Wirkung, Erklärungskraft und -schwäche untersucht.
Schließlich gilt es, das weite Denkparadigma der Spur und des SpurenLesens für den
4 Die Dissertation ist vom Prüfungsausschuss bereits abgenommen und nach eigenen Angaben plant Gunter Lösel die Publikation für 2013. 5 Zur Verdeutlichung und Betonung der Tätigkeit des Lesens wird im Titel und in der Einleitung die Schreibung SpurenLesen verwendet. Im
weiteren Verlauf der Arbeit jedoch zur Kleinschreibung Spurenlesen zurückgekehrt, um den Lesefluss zu erleichtern.

5
Analysezusammenhang dieser Arbeit zu definieren und auf das Improvisationstheater
anzuwenden. Dies soll über den theoretischen Rahmen hinaus anhand von Beispielaufnahmen
an realen Aufführungen6 verdeutlicht werden. Exemplarisch werden die Überlegungen vor
allem an zwei Formaten, zum einen der extrem freien Form aka nichts muss des Bremer
Improvisationstheaterduos die beiden und zum anderen einer improvisierten Langform, dem
sogenannten „Harold“ der Gruppe Jennifer‘s Elch demonstriert.
V Fazit und weiterführende Fragen
Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass das Spurenlesen mit der Betonung auf der
interpretativen und narrativen Tätigkeit des Lesens zeigt, wie die Entstehung der narrativen
Sequenzen im westlichen, zeitgenössischen Improvisationstheater von einem Subjekt
ausgehend gedacht werden kann. Das künstlerisch aktiv entscheidende Individuum ist der
Ausgangspunkt der Narration, da es Spuren als Anhaltspunkte wahrnimmt, auswählt und
versucht sie konsistent, konsequent und kohärent in einer neuen dramatischen Logik zu
verarbeiten. Dabei entsteht das kollektive Erzählen durch die polysemische Flexibilität und
ständig veränderbare Nachträglichkeit dieses Spurenlesens, bei dem so stets jede neue
Deutung körperlicher, atmosphärischer oder sprachlicher Art der anderen Spieler
mitverarbeitet wird. Es liegt im Anspruch der Spur, dass sie, wenn sie einmal wahrgenommen
wurde, auch gelesen und erklärt werden muss. Diese Anforderung spielt im künstlerischen
Produktionsprozess wie er für das improvisierte Theater der Gegenwart als Rahmung gilt vor
allem für die motivierten, nach narrativer Orientierung suchenden Spieler als Spurenleser eine
wichtige Rolle. Der Spieler sucht nach Auffälligkeiten, die er interpretierend verarbeiten
kann, dabei können diese Auffälligkeiten seitens anderer Akteure wie Zuschauer, Musiker,
Spieler oder Lichtregisseure gewollter Natur oder aber kontingenter Art und völlig unbewusst
und unmotiviert sein. Es ist immer der Spieler, dem die Definitionsmacht solange obliegt, bis
ein weiterer Spieler als Spurenleser aktiv wird, die Spuren selbst stehen dabei in einem
eindimensionalen Kommunikationskontext. Dies gilt vor allem für die aktiv gewollte
Produktionsleistung einer Narration. Daneben greifen immer die bedeutungsgenerierenden
Phänomene, die Erika Fischer-Lichte mit ihrer autopoietischen Feedbackschleife beschreibt
und die Anteil an der Textproduktion einer Aufführung haben, aber nicht unbedingt bewusst
seitens der Spieler in die narrative Produktion einbezogen werden. Dazu zählen die positiven
6 Es soll hier noch betont werden, dass die gewählten Aufführungen einer gewissen Willkür unterliegen, da auch jede andere Aufführung als
Beispiel dienen könnte. Dieser Fakt soll aber nur das Potential des theoretischen Zugriffs verdeutlichen.

6
oder negativen Stimmungen, die sich zwischen Spielern und Spielern und Publikum und
Publikum und Spielern und Publikum aufbauen und die sich dann auf die
Aufführungsbeschaffenheit im Gesamten auswirken können. Diese Stimmungen können auch
aktiv von den spielenden Spurenlesern wahrgenommen und verarbeitet werden, es kann aber
eben auch sein, dass sie eher den Grundlagenteppich bilden, auf denen dann die
improvisierten, narrativen Szenen stattfinden.
Die Fragen, wie das Subjekt dann in einem als emergent verstandenden Prozess gedacht
werden kann und ob die Denkfigur der Spur das systemtheoretische Modell der Emergenz
ergänzen oder gar ablösen kann oder sollte, lassen sich sodann zweigleisig beantworten, da
auch der Emergenzbegriff nicht einheitlich verwendet wird. Geht man von Fischer-Lichtes
eher schwachem Emergenzbegriff aus, der hauptsächlich das unmotivierte und damit
unvorhersehbare Moment in der Bedeutungsgenerierung stützt, dann kann das Spurenlesen im
Kontext des improvisierten Theaters als ergänzend verstanden werden. Das Spurenlesen
erlaubt, als fein detailliertes Erklärungsmodell gedacht, zu beschreiben wie Kontingenz durch
das wahrnehmende Subjekt in narrative Zusammenhänge übertragen wird. Das ständig
entscheidende Subjekt wählt aus, was aus den vielen angebotenen Reizen verarbeitet wird und
dabei können sowohl unmotivierte als auch motivierte Aktionen einfließen. Für den
Betrachter wird es immer unvorhersehbar bleiben, da aufgrund der Individualität jedes
interpretierenden Subjekts und des Zusammenspiels der Subjekte vielleicht Prognosen jedoch
keine eindeutigen Vorhersagen möglich sind.
Geht man von einem starken Emergenzbegriff aus, den vor allem Lösel seinen Überlegungen
zugrunde legt, der von den Eigenschaften der Irreduzibilität, der Unvorhersehbarkeit und dem
Neuen geprägt ist und den er bei Sawyer entlehnt, dann greift das Erklärungsmodell des
Spurenlesens vor allem den Punkt der Irreduzibilität an. Das Emergenzmodell wie Sawyer
und, noch verstärkt, Lösel es darlegt, kann vor allem auf einer Makroebene gut zeigen, wie
einmal bereits entstandene Muster und Patterns Rückwirkungen als Rahmung auf den
weiteren Szenenverlauf haben, es kann aber auf einer Mikroebene nicht gut erklären, wie
diese dann tatsächlich entstehen können, da das entscheidende und aktive künstlerische
Subjekt nur als relativer Faktor auf der Mikroebene gewertet wird. Das Spurenlesen mit
seinem narrativen Moment setzt nun aber genau an diesem Punkt an und hat auch den Vorteil,
das aus disziplinärer Perspektive das Improvisationstheater naheliegend als ein aktiver Modus
der Textproduktion gedacht wird und keiner systemtheoretischen Rückkopplung, die auf einer
eher fachfremden Disziplin beruht, bedarf. Es soll nun nicht angezweifelt werden, dass
transdisziplinäres Arbeiten generell nicht sehr ergiebig sein kann. Es hat schließlich auch

7
wichtige Erkenntnisse gebracht, die einen Diskussionsgrundstein offen legen. Man kann aber
noch einmal Wolfgang Raible zitieren, der davon ausgeht, dass alles Lebendige zusammen
mehr als die Summe seiner Teile ist, eine Paar oder eine Familie mehr als die einzelnen
Menschen und es daher immer einen systemischen Mehrwert gibt, der jedoch nicht immer
gleich als emergent zu bezeichnen ist, vor allem nicht, wenn diese einzelnen Mitglieder auch
noch künstlerisch agieren.7
Damit soll jedoch auch nicht behauptet werden, dass das Beschreibungsmodell des
Spurenlesens für das narrative Moment im improvisierten Theater der Gegenwart der
Weisheit letzter Schluss ist. Sicher gibt es hier noch viele Ansatzpunkte, die weitere Fragen
aufwerfen. Das Spurenlesen wurde hier gerade für das, was eben auch gemeinschaftlich an
Narration entstehen kann herangezogen. Eine spannende Frage bleibt, wie es sich verhält,
wenn ein einzelner Spieler improvisiert. Er könnte wohl auch Spurenlesen, aber wo bedient er
sich derer? Sein eigener Körper im performativen Raum mit dem Publikum bliebe weiterhin
bestehen, doch als ein großer Fundus wurden bisher stets die Mitspieler betrachtet und die
fielen dann weg. Auch das systemtheoretische Erklärungsmodell wäre hiermit vor neue
Herausforderungen gestellt, denn es bleibt fraglich, ob die Aktionen eines einzelnen Spielers
als System beschrieben werden können.
Zur Frage, wie die fiktive Welt im improvisierten Theater entsteht, wurden durch das
Spurenlesen bereits einige Anhaltspunkte gegeben, da davon ausgegangen wurde, das der
Spieler als Spurenleser permanent präsent ist und alles, was für ihn dienlich ist, auswählt und
durch fiktionale Aussagen in die fiktive Welt einfüttert. Spannend und noch ausführlicher in
weiteren Arbeiten zu diskutieren bleiben dabei weiterhin aus kognitionstheoretischer und
auch neurowissenschaftlicher Sicht, welche Vorgänge dabei genau im Gehirn die Produktion
der Narration auslösen. Aus semiotischer könnte Sicht könnte es reizvoll sein, die
Textproduktion und die Fragen der Autorschaft weiter zu erforschen. Im Zusammenhang mit
der Textproduktion und der Textfrage steht auch eng verknüpft eine potentielle Werkfrage.
Was Werk vor dem Hintergrund des improvisierten Theater alles bedeuten kann, ist noch
ausführlich zu diskutieren. Im Hinblick auf diesen Aspekt ließe sich beispielsweise die Frage
stellen, ob das improvisierte Theater der Gegenwart mit Umberto Ecos Begriff des offenen
Kunstwerks8 zu greifen ist oder ob es vielleicht sogar das offene Kunstwerk, wie Eco es für
die moderne Kunst an sich beschreibt, schlechthin repräsentieren könnte.
Darüber hinaus ist, wie bereits gezeigt wurde, das heutige Improvisationstheater ein noch sehr
unerforschter Gegenstand. So können neben rein semiotisch-ästhetischen Fragen auch
7 Vgl. Wolfgang, Raible: „Adaptation aus kultur- und lebenswissenschaftlicher Perspektive“, S.24. 8 Vgl. Eco, Umberto: Das offene Kunstwerk, Einleitung.

8
soziokulturelle Fragestellungen von Interesse sein. Wie kann das Improvisationstheater
beispielsweise vor transnationalen oder transkulturellen Paradigmen verhandelt werden? Es
handelt sich hier um eine Kunstform, die sowohl von Amateuren als auch Profis ihren
Austausch und ihre Weiterentwicklung über das Internet, über Podcasts und Foren
vorantreibt. Welche kulturellen Einflüsse neben dem bekannten US-amerikanischen,
kanadischen und europäischen Engagement lassen sich hier festmachen? Inwiefern wird das
Wissen aus Kulturen, die traditionell von jeher eher der Oralität und dem Theater ohne Skript
verbunden waren, einbezogen, genutzt oder „wiederentdeckt“? Diese Frage stellt sich unter
anderem beim Betrachten von Keith Johnstones Impro for Storytellers in der 1999er Ausgabe
von Faber&Faber. Das Cover zeigt eine Gruppe Kariben, die um einen Geschichtenerzähler
versammelt ist, während das Buch selbst keinen weiteren Bezug darauf nimmt. Neben
diesem produktiven ist vor allem auch der rezeptive Aspekt noch weitgehend unerforscht.
Wer geht eigentlich ins Improvisationstheater und warum? Welche Erwartungen werden
damit verknüpft und was ist es, was dieser Kunstform in den letzten Jahren einen solchen
Auftrieb verleiht, das sie auch finanziell auf einem eigenständigen Markt einen wichtigen
Einfluss ausübt?
Neben dem noch sehr offenen Forschungsgebiet des improvisierten Theaters wurde aber auch
noch die Frage gestellt, welche Rückwirkungen die Anwendung der Denkfigur
„SpurenLesen“ auf diese selbst hat. Wie bereits in der Analyse geschehen, haben sich
Gegenstand und Theorie wechselseitig vielfach durchdrungen. Von einem engen Spurbegriff
im Sinne Krämers wurde sich durch den Fokus auf den Vorgang des Spurenlesens nach und
nach entfernt. Dadurch wurde die Spur teilweiser ihrer Spezifizität beraubt, die sie an
historische Narrationen und reine Rekonstruktionen bindet, was für viele Denkbewegungen
ihre eigentliche Besonderheit ausmacht. Es stellt sich so die Frage einer wissenschaftlichen
Strenge. Darf man die Spur und das Lesen von Spuren soweit dehnen, dass nur noch
Teilaspekte beachtet werden oder beschneidet man damit die Spur in ihrem eigenen Sein?
Wie eklektisch darf vorgegangen werden, um die Möglichkeit zu haben, sich neuen und
komplexen Gegenständen zu nähern? Der Fokus auf einen prozessual gedachten Spurbegriff,
der es erlaubt sich rein auf den Vorgang des Lesens in seinen eigenen Besonderheiten für das
narrative Moment zu beziehen, könnte so schließlich für neue Gegenstandsbereiche fruchtbar
gemacht werden. Das narrative Moment des SpurenLesens noch vor anderen Hintergründen
weiter zu erforschen, bietet so ein weites Feld von Fragestellungen. Gerade wenn bedacht
wird, das eine der Grundfragen im Umgang mit dem Spurkonzept für Literatur-, Theater- oder

9
Filmwissenschaftler ist, wie dieses operationell nutzbar gemacht werden kann. Sybille
Krämer stellt die Frage, ob es nicht sein kann,
dass das Spurenlesen nicht nur archaischer Restbestand eines >wilden Wissens<, Kinderstube
der Metaphysik, textloses Stadium einer Hermeneutik und instinkthafte Frühform
symbolischer Grammatiken ist, sondern sich in allen entfalteten Zeichen-, Erkenntnis- und
Interpretationspraktiken aufspüren lässt.9
Der Historiker D’Haenens schlägt mit „pas de trace, pas d’histoire“10
in dieselbe Kerbe und
auch Carlo Ginzburg stellt die Hypothese auf, dass alle Narration mit Spuren ihren Anfang
nahm. Auch vor dem Hintergrund postkolonialer Fragestellungen wird mit dem Literaten und
Philosophen Edouard Glissant11
die Spur bereits produktiv neben philosophischen auch in
narrativen Zusammenhängen gedacht. Die Spur und das Spurenlesen scheinen sich also
geradezu anzubieten von Fachrichtungen, die sich mit der Erzeugung von Narrationen
beschäftigen auch transdisziplinär weitererforscht und operationalisiert zu werden. Diese
Arbeit wollte neben anregenden Überlegungen zum Gegenstand des improvisierten Theaters
einen kleinen Beitrag zu diesem Schritt in dem ihr möglichen Rahmen leisten.
9 Krämer, Sybille: „Was also ist eine Spur“, S.11 10 D’Haenens, Ward: Théorie de la trace, zitiert nach Hard, Gerhard: Spur und Spurenleser, S.70. 11 Vgl. hierzu Edouard Glissant: La case du commandeur als Roman oder Le discours antillais als philosophische Schrift.

10
Bibliografie
Aczel, Richard: „Subjekt und Subjektivität“, in: Metzler Lexikon. Literatur- und
Kulturtheorie, hrsg. von Ansgar Nünning, Stuttgart 20084, S.691-692.
Aristoteles. Physik: Vorlesung über Natur. Halbbd. 1: Bücher I-IV, hrsg. von Hans
Günter Zekl, Hamburg 1987.
Ax, Wolfram: „Improvisation in der antiken Rhetorik“, in: Improvisation: Kultur- und
lebenswissenschaftliche Perspektiven, hrsg. von Maximilian Gröne, Hans-Joachim
Gehrke, Frank-Rutger Hausmann, Stefan Pfänder, Bernhard Zimmermann, Freiburg
im Breisgau 2009, S. 63-78.
Arnold, Sonja: „Geschichte als Spurensuche zwischen Transzendenz und Immanenz in
Max Frischs Der Mensch erscheint im Holozän und Felicitas Happes Johanna“, in:
Moderne. Kulturwissenschaftliches Jahrbuch 5 (2009) – Themenschwerpunkt: Spuren,
hrsg. von Helga Mittelbauer, Katharina Scherke mit Sabine Müller, Innsbruck 2010, S.
85-100.
Bal, Mieke: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative, Toronto 20093.
Bertram, Georg W.: „Improvisation und Normativität“, in: Improvisieren. Paradoxien
des Unvorhersehbaren. Kunst – Medien – Praxis hrsg. von Hans Friedrich Bormann,
Gabriele Brandstetter, Annemarie Matzke, Bielefeld 2010, S.21-39.
Borges, Jorge Luis: Fiktionen. Erzählungen 1939-1944, Frankfurt a.M. 1992.
Bormann, Hans-Friedrich / Brandstetter, Gabriele / Matzke, Annemarie:
„Improvisieren: eine Eröffnung“, in: Improvisieren. Paradoxien des
Unvorhersehbaren. Kunst – Medien – Praxis, hrsg. von Hans Friedrich Bormann,
Gabriele Brandstetter, Annemarie Matzke, Bielefeld 2010, S.7-19.
Brandstetter, Gabriele: „Improvisation im Tanz. Lecture Performance mit Friederike
Lampert“, in: Improvisation: Kultur- und lebenswissenschaftliche Perspektiven, hrsg.
von Maximilian Gröne, Hans-Joachim Gehrke, Frank-Rutger Hausmann, Stefan
Pfänder, Bernhard Zimmermann, Freiburg im Breisgau 2009, S. 133-157.
Dell, Christopher: „Subjekt der Wiederverwertung (Remix)1“
, in: Improvisieren.
Paradoxien des Unvorhersehbaren. Kunst – Medien – Praxis, hrsg. von Hans
Friedrich Bormann, Gabriele Brandstetter, Annemarie Matzke, Bielefeld 2010, S.217-
233.
Derrida, Jacques: Grammatologie, Frankfurt a.M. 1983.

11
Derrida, Jacques: Positionen. Gespräche mit Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis
Houdine, Guy Scarpetta, hrsg. von Peter Engelmann, Wien 1986.
D’Haenens, Ward: Théorie de la Trace, Louvain-la-Neuve 1984.
Dörger, Dagmar / Nickel, Hans-Wolfgang: Improvisationstheater: Das Publikum als
Autor. Ein Überblick, Uckerland 2008.
Eco, Umberto: Zeichen. Eine Einführung in einen Begriff und seine Geschichte,
Frankfurt a.M.1977.
Eco, Umberto: Das offene Kunstwerk, Frankfurt a.M. 2006.
Fehrmann, Gisela / Linz, Erika / Epping-Jäger, Cornelia: „Vorwort“, in: Spuren
Lektüren. Praktiken des Symbolischen, hrsg. von Gisela Fehrmann, Erika Linz,
Cornelia Epping-Jäger, München 2005, S.9-11.
Fischer-Lichte, Erika: Semiotik des Theaters. Das System der theatralischen Zeichen
Bd.1, Tübingen 1998.
Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen, Frankfurt a.M. 2004.
Frings, Andreas: „Denunzianten der Vergangenheit? Methodologische Potentiale einer
indexikalischen Semiotik für die Historischen Kulturwissenschaften“, in:
Vergangenheiten auf der Spur. Indexikalische Semiotik in den historischen
Kulturwissenschaften, hrsg. von Sascha Weber, Andreas Frings, Andreas Linsenmann,
Bielefeld 2012, S.11-34.
Frings, Andreas: „Entführung aus dem Detail. Abduktion und die Logik der
kulturwissenschaftlichen Forschung“, in: Vergangenheiten auf der Spur.
Indexikalische Semiotik in den historischen Kulturwissenschaften, hrsg. von Sascha
Weber, Andreas Frings, Andreas Linsenmann, Bielefeld 2012, S.115-148.
Frost, Anthony / Yarrow, Ralph: Improvisation in Drama, New York/Hampshire
2007.
Gawoll, Hans-Jürgen: „Spur“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. von
Joachim Ritter und Karlfried Gründer Bd 9, Darmstadt 1995, S.1550-1556.
Gawoll, Hans-Jürgen: „Spur: Gedächtnis und Andersheit. Teil 1: Geschichte des
Aufbewahrens“, in: Archiv für Begriffsgeschichte – 30, S.44-69.
Gawoll, Hans-Jürgen: „Spur: Gedächtnis und Andersheit. Teil 2: Geschichte des
Aufbewahrens“, in: Archiv für Begriffsgeschichte – 32, S.269-296.
Geisler, Oliver: „,Gras, auseinandergeschrieben‘ – Zu einem Leitmotiv des Shoa-
Diskurses“, in: Moderne. Kulturwissenschaftliches Jahrbuch 5 (2009) –

12
Themenschwerpunkt: Spuren, hrsg. von Helga Mittelbauer, Katharina Scherke mit
Sabine Müller, Innsbruck 2010, S. 52-69.
Genette, Gérard: Die Erzählung, München 1998.
Ginzburg, Carlo: „Spurensicherung. Der Jäger entziffert die Fährte, Sherlock Holmes
nimmt die Lupe, Freud liest Morelli – Die Wissenschaft auf der Suche nach sich
selbst“, in: Spurensicherungen: Über verborgene Geschichte, Kunst und soziales
Gedächtnis, hrsg. von Carlo Ginzburg, Berlin 1983, S.61-96.
Ginzburg, Carlo: Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600, Berlin
1990.
Ginzburg, Carlo: Hexensabbat, Berlin 1990.
Ginzburg, Carlo: Die Benandanti. Feldkulte und Hexenwesen im 16. Und 17.
Jahrhundert, Hamburg 1993.
Glissant, Édouard: La case du commandeur, Paris 1981.
Glissant, Edouard: Le discours antillais, Paris 1981.
Halpern, Charna / Close, Del /Johnson, Kim: Truth in Comedy – the Manual for
Improvisation, Colorado Springs 2011.
Hard, Gerhard: Spuren und Spurenleser. Zur Theorie und Ästhetik des Spurenlesens in
der Vegetation und anderswo, Osnabrück 1995.
Hollendonner, Barbara: „Die Spur in CSI und in ausgewählten zeitgenössischen
Theorien“, in: Moderne. Kulturwissenschaftliches Jahrbuch 5 (2009) –
Themenschwerpunkt: Spuren, hrsg. von Helga Mittelbauer, Katharina Scherke mit
Sabine Müller, Innsbruck 2010, S.140-155.
Hengst, Lutz: „Spur“, in: Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie, hrsg. von
Ansgar Nünning, Stuttgart 20084, S.673-674.
Johnstone, Barbara: „Review: Improvised Dialogues. Emergence and Creativity in
Conversation”, in: Language in Society, Volume 33 Number 3, 2004, S.440-442.
Johnstone, Keith: Improvisation und Theater, Berlin 1998.
Krämer, Sybille: „Was also ist eine Spur? Und worin besteht ihre epistemologische
Rolle? Eine Bestandsaufnahme“, in: Spurenlesen als Orientierungstechnik und
Wissenskunst, hrsg. von Gernot Grube, Sybille Krämer, Wernot Kogge, Frankfurt a.M.
2007, S.11-33.
Krämer, Sybille: „Immanenz und Transzendenz der Spur: Über das epistemologische
Doppelleben der Spur“, in: Spurenlesen als Orientierungstechnik und Wissenskunst,

13
hrsg. von Gernot Grube, Sybille Krämer, Wernot Kogge, Frankfurt a.M. 2007, S. 155-
181.
Langenscheidt Collins. Großes Studienwörterbuch Englisch, München 2008.
Lavagno, Christian: „Kleine Einleitung in die Philosophie von Jacques Derrida“,
www.philosophie.uniosnabrueck.de/Lavagno%20Einfuehrung%20Derrida.pdf, zuletzt
abgerufen am 13.03.12.
Lösel, Gunter: „Das Spiel mit dem Chaos. Performativität und Systemcharakter des
Improvisationstheaters“, Universität Hildesheim 2012.
Martinez, Matias / Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie, München
20077.
Müller-Oberhäuser, Gabriele: „Lesen/Lektüre“, in: Metzler Lexikon. Literatur- und
Kulturtheorie, hrsg. von Ansgar Nünning, Stuttgart 20084,
S.417-418.
Nünning, Ansgar: „Narrativität“, in: Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie,
hrsg. von Ansgar Nünning, Stuttgart 20084,
S.528.
Pape, Helmut: „Fußabdrücke und Eigennamen: Peirces Theorie des relationalen Kerns
der Bedeutung indexikalischer Zeichen“, in: Spur. Spurenlesen als
Orientierungstechnik und Wissenskunst, hrsg. von Gernot Grube, Sybille Krämer,
Wernot Kogge, Frankfurt a.M. 2007, S.37-54.
Raible, Wolfgang: „Adaptation aus kultur- und lebenswissenschaftlicher Perspektive –
ist Improvisation ein in diesem Zusammenhang brauchbarer Begriff?“, in:
Improvisation: Kultur- und lebenswissenschaftliche Perspektiven, hrsg. von
Maximilian Gröne, Hans-Joachim Gehrke, Frank-Rutger Hausmann, Stefan Pfänder,
Bernhard Zimmermann, Freiburg im Breisgau 2009, S. 19-24.
Richter, Elke / Struve, Karen / Ueckmann (Hrsg.): Balzacs „Sarrasine“ und die
Literaturtheorie. Zwölf Modellanalysen, Stuttgart 2011.
Rudolph, Enno: Odyssee des Individuums. Zur Geschichte eines vergessenen
Problems, Stuttgart 1991.
Salinsky, Tom / Frances-White, Deborah: The Improv Handbook. The Ultimate Guide
to Improvising in Comedy, Theatre and Beyond, New York 2011.
Sartre, Jean-Paul: Das Sein und das Nichts, Reinbek bei Hamburg 2009.
Sawyer, Keith Robert: Improvised Dialogues. Emergence and Creativity in
Conversation, Westport 2003.
Schaub, Mirjam: „Die Kunst des Spurenlegens und –verfolgens. Sophie Calles,
Francis Alÿs‘ und Janet Cardiffs Beitrag zu einem philosophischen Spurenbegriff“, in:

14
Spur. Spurenlesen als Orientierungstechnik und Wissenskunst, hrsg. von Gernot
Grube, Sybille Krämer, Wernot Kogge, Frankfurt a.M. 2007, S.121-141.
Schechner, Richard: Performance-Theory, New York 2009.
Spolin, Viola: Improvisation for the Theater. A handbook of teaching of directing
techniques, Evanston 1963.
Stegmaier, Werner: „Anhaltspunkte. Spuren zur Orientierung“, in: Spur. Spurenlesen
als Orientierungstechnik und Wissenskunst, hrsg. von Gernot Grube, Sybille Krämer,
Wernot Kogge, Frankfurt a.M. 2007, S.82-94.
Stephan, Achim: Emergenz: Von der Unvorhersagbarkeit zur Selbstorganisation,
Dresden 1999.
Thiele, Wolfgang: „Text“, in: Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie, hrsg. von
Ansgar Nünning, Stuttgart 20084, S.706.
Weidacher, Georg: Fiktionale Texte – Fiktive Welten. Fiktionalität aus
textlinguistischer Perspektive, Tübingen 2007.
Weiler, Christel: „Improvisation“, in: Metzler Lexikon Theatertheorie, hrsg. von Erika
Fischer-Lichte, Doris Kolesch, Matthias Warstat, Stuttgart 2005, S.144-146.
Wolf, Werner: „Das Problem der Narrativität in Literatur, bildender Kunst und Musik:
Ein Beitrag zu einer intermedialen Erzähltheorie“, in: Erzähltheorie transgenerisch,
intermedial, interdisziplinär, hrsg. von Vera und Ansgar Nünning, Trier 2002, S.23-
87.
Internetverweise
http://www.improwiki.de/improtheater, zuletzt abgerufen am 27.12.2012.
http://improvencyclopedia.org/, zuletzt abgerufen am 27.12.2012

15