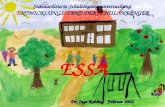Standardisierte Enteroklyse
Transcript of Standardisierte Enteroklyse

| Der Radiologe 7·98
Freies Thema
624
R. Leppek1 · M. Sauerwald1 · L.D. Berthold1 · U. Franzen2 · K.J. Klose1
1 Medizinisches Zentrum für Radiologie, Abteilung für Strahlendiagnostik, Philipps-Universität
Marburg · 2 Fachbereich Psychologie, Philipps-Universität Marburg
Standardisierte EnteroklyseRegistrierung des intraluminalen Drucks indrei unterschiedlichen Patientenkollektiven
an die Motilität angepaßten Instillati-onsrate zum Erzielen einer optimalenDarstellungsqualität in den Vorder-grund. Da die individuell unterschiedli-che Dünndarmmotilität sowohl durchfunktionelle Störungen [13, 18] und or-ganische Dünndarmerkrankungen [21]als auch reaktiv durch die Untersu-chungstechnik selbst beeinflußt wird,wurde die Beurteilung von Motilitäts-störungen in der Enteroklyse lange Zeitzurückhaltend aufgenommen, obwohlSellink bereits 1981 auf diese Möglich-keit hinwies [17]. Die Abhängigkeit desintraluminalen Drucks von der durch-leuchtungsgesteuerten Instillationsrateführt zu der Überlegung, in einem er-sten Schritt das Verhalten des intralu-minalen Drucks in einer standardisier-ten Enteroklyse zu untersuchen. Dar-über hinaus ist es denkbar, daß sich dieRückkopplung des gemessenen intralu-minalen Drucks als Stellgröße zurSteuerung der Instillationsraten eignet.
Material und Methoden
Studienkollektiv
Insgesamt 38 Frauen und 29 Männerwurden konsekutiv innerhalb eines 7-monatigen Zeitraums eingeschlossen(n=67, durchschnittliches Alter 44±16Jahre, Spannweite 17–75 Jahre). MittlereGröße und mittleres Körpergewicht be-trugen bei den Männern 178,9±7,8 cmbzw. 75,1±12,8 kg, bei den Frauen
Die Enteroklyse ist der konventionel-len Dünndarmpassage hinsichtlich Ab-bildungsqualität und Informationsge-winn diagnostisch überlegen [9, 12, 19].Dazu ist eine optimale und vollständigeDarmentfaltung notwendig, die der Un-tersucher durch eine Anpassung derFlußraten von Kontrastmittel und Di-stensionsmedium nach Maßgabe desDurchleuchtungsbefundes erzielt. Diesteuerbare Füllung des Darmlumenswährend der Enteroklyse induziertDruck- und Motilitätsänderungen imDünndarm. Eine hohe Instillationsrateführt infolge Volumenbelastung zu ei-ner reflektorischen Hypotonie und Di-latation des Darmes bis zur komplettenPeristaltikhemmung. Zu geringe Instil-lationsraten lassen bei Hyperperistaltikeine zu rasche Passage unbeeinflußt, sodaß Darmwanddehnung und Darstel-lungsqualität unzureichend bleiben.Gelegentlich sind drastische Anpassun-gen der Instillationsraten notwendig,um eine kohärente Kontrastmittelsäuleim Darmlumen mit durchgehenderDoppelkontrastdarstellung zu erzielen.Oudkerk u. Rijke [15] sowie Antes [1]rücken die Bedeutung einer adäquaten,
Freies ThemaRadiologe1998 · 38:624–631 © Springer-Verlag 1998
Zusammenfassung
Fragestellung: Registrierung des intralumi-
nalen Drucks bei standardisierter Enteroklyse.
Methodik: Druckmonitoring mittels Doppel-
lumensonde parallel zur durchleuchtungs-
kontrollierten Anpassung der Instillationsra-
te von Kontrastmittel und Distensionsmedi-
um an die individuelle Motilität, Dehnung
und Transportleistung des Dünndarms bei
67 Patienten. Es erfolgte eine Stratifizierung
gemäß anamnestisch-klinischer Daten und
Enteroklysebefunde in 3 Teilkollektive: be-
kannter oder in der Enteroklyse nachgewie-
sener M. Crohn (n=12), bekannte nichtent-
zündliche organische Erkrankung (n=35)
und irritables Darmsyndrom nach Manning
(n=20).
Ergebnisse: Menge, Instillationsdauer und
-rate von Kontrastmittel und Distensionsme-
dium unterscheiden sich nicht signifikant in
den 3 Teilkollektiven. Der intraluminale
Druck am Ende der Distensionsphase ist bei
Crohn-Patienten mit 47,94±10,42 cm H2O
gegenüber 38,03±10,08 bzw.39,55±9,74 cm
H2O statistisch signifikant höher (p=0,0099).
Ebenso ist bei Crohn-Patienten der maximal
erreichte Druck (51,75±9,94 cm H2O gegen-
über 43,00±6,20 bzw. 39,55±9,74 cm H2O,
p=0,0010) und Druck am Untersuchungs-
ende (48,59±10,42 cm H2O gegenüber
39,66±6,52 bzw. 35,67±8,28 cm H2O,
p=0,0002) höher. Das Ende der Distensions-
phase wird bei Crohn-Patienten statistisch
nicht signifikant etwas später erreicht
(28,05±12,82 min).
Schlußfolgerungen: In der standardisierten
Enteroklyse mit angepaßter Instillationsrate
unterscheidet sich der intraluminale Druck
bei Crohn-Patienten unabhängig vom resi-
dualen „string sign“ oder mäßiger Erkran-
kungsaktivität gegenüber Patienten mit
Dr. R. LeppekMedizinisches Zentrum für Radiologie, Abteilung
für Strahlendiagnostik, Klinikum der Philipps-
Universität, Baldinger Straße, D-35033 Marburg&/fn-block:&bdy:
nichtentzündlicher organischer Dünndarm-
erkrankung oder irritablen Darmsyndrom.
Schlüsselwörter
Enteroklyse · Intraluminaler Druck · M.Crohn ·
Irritables Darmsyndrom

Der Radiologe 7·98 | 625
R. Leppek · M. Sauerwald · L.D. Berthold
U. Franzen · K.J. Klose
Standardized enteroclysis. Monitoringof intraluminal pressure in threedifferent groups of patients
Summary
Purpose: Monitoring of intraluminal pressure
in standardized enteroclysis.
Material and methods: Pressure monitoring
with a double-lumen tube during fluor-
oscopy-guided adjustment of contrast me-
dia instillation rate due to small bowel motil-
ity and contrast media transport of 67 pa-
tients. Stratification according to patient
data and findings in enteroclysis: Crohn’s dis-
ease (n=12), non-inflammatory disease
(n=35) and irritable bowel syndrome
(n=20).
Results: The amount, instillation period and
rate of contrast media and distension media
were not statistically different within the
study population. Crohn’s disease patients
showed elevated intraluminal pressure at
the end of the distension phase
(47.94±10.42 cm H2O versus 38.03±10.08
and 39.55±9.74 cm H2O, respectively,
P=0.0099), as well as at the end of the ex-
amination (48.59±10.42 cm H2O versus
39.66±6.52 and 35.67±8.28 cm H2O,
P=0.0002). In comparison with both other
patient groups, maximum intraluminal pres-
sure in Crohn’s disease is higher and totals
51.75±9.94 cm H2O versus 43.00±6.20 and
39.55±9.74 cm H2O, P=0.0010. Patients with
Crohn’s disease require a longer instillation
period of distension media (28.05±12.82
min, not statistically significant).
Conclusion: Intraluminal pressure differs in
standardized enteroclysis with fluoroscopy-
guided instillation rate adjustment. Irrespec-
tive of stenosis or acute inflammation, pa-
tients with Crohn’s disease show a higher in-
traluminal pressure compared to patients
with non-inflammatory disease or irritable
bowel syndrome.
Key words
Enteroclysis · intraluminal pressure · Crohn’s
disease · irritable bowel syndrome
Nr. 817, Einmal-Schlauchsystem Nr. 837,Y-Stück Nr. 836, Enema-Bags Nr. 857,Guerbet,Sulzbach) verwendet.Die intra-luminale Druckmessung erfolgte nachEntfernung des Ballons über den Kanal,der ursprünglich zur Luftinsufflation inden Ballon dient. Messung und Regi-strierung erfolgten mit einem Druckauf-nehmer (Schaevitz Modell P 720, Range0–20 bar, VG Auswerteelektronik DD80/20, TK 035, Lucas Schaevitz Ltd.,Berkshire, England) und einem 2-Koor-dinaten-Schreiber (BD9 2-Kanal, Kipp&Zonen, Solingen).
Nach Nullabgleich des etwa auf Ni-veau der Sondenspitze angebrachtenDruckaufnehmers wurde nach Errei-chen eines konstanten Druckniveausder Ruhe- bzw. Initialdruck im Darmlu-men des Patienten gemessen und da-nach die Kontrastmittelinstillation vor-genommen. Unmittelbar anschließendan die Verabreichung des vorbereitetenKontrastmittels erfolgte die Instillationdes Distensionsmediums, dessen Volu-men in Abhängigkeit von individuellerDarmlänge, Peristaltik und Dehnungs-grad des Darmlumens variierte. DieDruckwerte und benötigten Untersu-chungszeiten wurden zu Beginn der In-stillationsphase (Ruhe- oder Initial-druck), bei Ende der Kontrastmittelin-stillation und bei Ende der Instillati-onsphase des Distensionsmediumsregistriert sowie der Druck am Untersu-chungsende und maximal erreichte in-traluminale Druck aus der Druckkurveprotokolliert. Die Instillation erfolgteunter intermittierender Durchleuch-tung (Diagnost 73 P, Philips, Hamburg)zur Anpassung der Förderrate an Darm-füllung, -dehnung und Motilität. Beilebhafter Peristaltik mit beschleunigterPassage wurde eine Motilitätsdämpfungdurch eine relativ erhöhte Einlaufge-schwindigkeit erzielt. Umgekehrt wurdebei langsamer Passage eine relativ nied-rigere Förderrate gewählt, um die Peri-staltik nicht zusätzlich zu hemmen. Diestatistische Auswertung erfolgte mittelseinfacher Varianzanalyse und Produkt-momentkorrelation.
Ergebnisse
Stratifizierung desPatientenkollektivs
Die radiologische Auswertung (R.L.)nach Abschluß der gesamten Untersu-
166,5±6,5 cm bzw. 62,2±16,5 kg. Zusätz-lich zu den Überweisungsdiagnosen(n=67) wurden Anamnese sowie vege-tative und gastrointestinale Beschwer-den in einem standardisierten Fragebo-gen (n=61) erfaßt. 25 Patienten (41%)gaben abdominelle Schmerzen und 20Patienten (32,8%) Diarrhoen als Grün-de für den Arztbesuch an. Weitere Kon-sultationsgründe waren bei je 7 Patien-ten Gewichtsverlust und Blut im Stuhlsowie in je 4 Fällen Übelkeit, Erbre-chen, nicht näher beschriebene Magen-Darm-Beschwerden sowie eine ausge-prägte Obstipation bis hin zur Subile-ussymptomatik. Die Mehrzahl der Pa-tienten (90,2%) gab einzelne odermehrere vegetative Beschwerden wieAbgeschlagenheit (55,7%), Gewichts-verlust im letzten Vierteljahr (50,8%)und Schlafstörungen (40,9%) an. 47von 61 Patienten (77%) klagten übermehrere gastrointestinale Symptomewie abdominale Schmerzen, Übelkeit,Meteorismus und Diarrhoe. Dement-sprechend war die mit Abstand häufig-ste Indikation (46,3%) zur Enteroklysedie Verdachtsdiagnose (n=21) oder dieVerlaufskontrolle bei bekanntem M.Crohn (n=10). Bei je 9 Patienten wurdedie Enteroklyse aufgrund vermuteterpostoperativer Stenosen oder Bridenbzw. zur Klärung einer Malabsorptiondurchgeführt. Bei 7 Patienten sollte eineRaumforderung bzw. Stenose unbe-kannter Genese ausgeschlossen werden.
Standardisierte Enteroklyse
Die Vorbereitung der Patienten, derKontrast- und Distensionsmedien sowiedie Durchführung der Enteroklyse er-folgte gemäß einer Arbeitsanleitung vonFuchs et al. [6] unter Verwendung einerBariumsulfatsuspension kleiner Teil-chengröße (Micropaque®, Guerbet, Sulz-bach), Glycerol DAB 9, Wasser und einerhochmolekularen Guarinfraktion (HP7000, Hepart AG, Berlingen, Schweiz).Das Konstrastmittel, ein Gemisch aus320 ml der tags zuvor angesetzten, auf34° C erwärmten Guarinlösung und180 ml Bariumsulfatsuspension, wurdeerst unmittelbar vor der Untersuchungzubereitet. Zur Instillation des Kontrast-und Distensionsmediums wurden einedrehzahlgeregelte elektrische Kontrast-mittelpumpe und fertig konfektionier-te Einmalartikel (KontrastmittelpumpeKMP 2000, Doppellumen-Ballonsonde
Radiologe1998 · 38:624–631 © Springer-Verlag 1998

| Der Radiologe 7·98
Freies Thema
626
chungsreihe zeigte lediglich bei 11 von67 Patienten einen auffälligen Entero-klysebefund. 6 Patienten mit bekanntenM. Crohn und 2 Patienten mit erstmalignachgewiesener Enteritis regionaliszeigten eine mäßige Krankheitsaktivi-tät in der Enteroklyse. Bei je einem Pati-enten bestätigte sich der Verdacht aufeinen Dünndarmtumor, Karzinoidrezi-div bzw. Strahlenenteritis. Bei 14 Patien-ten, davon 4 Crohn-Patienten, bestandein Zustand nach Dünndarmteilresek-tion. Alle diese Patienten wiesen Nor-malbefunde in der Enteroklyse auf. InZusammenschau von Enteroklysebe-fund und anamnestischen Daten wur-den die 67 Patienten drei Teilkollekti-ven zugeordnet, die hinsichtlich ihreranthropometrischen Daten keine stati-stisch signifikanten Unterschiede zeig-ten:
1. Patienten mit M. Crohn (n=12). Die Ente-roklyse ergab bei 6 Patienten mit be-kanntem M. Crohn eine mäßig aktiveEnteritis regionalis ohne operations-pflichtige Stenosen,Begleittumoren oderFistelungen. Eingeschlossen wurden indiese Gruppe 4 Patienten mit stattgehab-ter Dünndarmteilresektion bei bekann-
roklyse als auch laborchemisch und kli-nisch keine Auffälligkeiten. Lediglichdie psychovegetative Anamnese kenn-zeichnete diese Patienten, die meist vonDiarrhoen assoziiert mit abdominellenSchmerzen, Völlegefühl und über vege-tative Symptome wie Abgeschlagenheit,Schlafstörungen und Kopfschmerzenberichteten.
Tabelle 2 gibt die mittlere Durch-leuchtungs- und Untersuchungsdauerfür die standardisierte Enteroklyse an,die im Mittel etwa eine Dreiviertelstun-de dauert. Als Indikator der patienten-individuellen enteralen Transportlei-stung gibt Tabelle 3 eine Übersicht derInstillationsmengen, Instillationsratenund dafür notwendigen Zeitspannen.
Intraluminaler Druck in derstandardisierten Enteroklyse
Die registrierten Druckkurven habenein relativ uniformes Aussehen (Abb. 1).Einige Patienten zeigen einen ausge-prägten Druckanstieg, während anderePatienten nur einen geringen reaktivenDruckanstieg bei Instillation von Kon-trastmittel und Distensionsmedium auf-weisen. Der Initial- oder Ruhedruck vorInstillation des Kontrastmittels betrugim Mittel 20,91±6,14 cm H2O. Im Zugeder Kontrastmittelinstillation kam esmeist zu einem relativ langsamenDruckanstieg auf durchschnittlich30,00±7,06 cm H2O. Bei Instillation desDistensionsmediums stieg der Druck ra-scher als bei Kontrastmittelinstillationim Mittel auf 40,04±9,35 cm H2O an. Dermaximale Druck wurde entweder amEnde oder kurz nach Beendigung der In-
tem M.Crohn,ohne daß sich ein residua-les „string sign“ oder floride Schleim-hautveränderungen nachweisen ließen.Von den 21 Patienten, die mit dem Ver-dacht auf eine chronisch entzündlicheDarmerkrankung untersucht wurden,konnte bei nur 2 Patienten die Verdachts-diagnose eines M. Crohn in der Entero-klyse bestätigt werden, so daß diese bei-den Patienten den 10 Patienten mit be-kanntem M. Crohn hinzugerechnet wur-den.
2. Patienten mit nichtentzündlicher Darm-erkrankung (n=35). Dieser Gruppe wur-den 3 Patienten mit pathologischemEnteroklysebefund (Tumorstenose, ra-diogene Stenose, Karzinoid) zugerech-net. Bei 22 Patienten bestand aufgrundklinischer, laborchemischer und ana-mnestischer Befunde ein dringenderVerdacht auf eine organisch manifesteErkrankung (Briden, Adhäsionen,Sprue, M. Hodgkin, Blutung), ohne daßsich diese Verdachtsdiagnosen in derEnteroklyse bestätigten. 10 Patientenmit stattgehabter Dünndarmsegment-resektion bei nichtentzündlicherGrunderkrankung und Normalbefundin der Enteroklyse wurden ebenfalls indieses Kollektiv aufgenommen.
3. Patienten mit funktioneller Störung(n=20). Diese Patienten litten an einem„Reizdarmsyndrom“, wie es von Man-ning et al. [13] definiert wurde (Tabelle1). Die Enteroklyse diente bei diesen Pa-tienten der Ausschlußdiagnostik einerorganischen Dünndarmerkrankung. ImUnterschied zur Patientengruppe 2 zeig-ten diese Patienten sowohl in der Ente-
Tabelle 1
Zusammenstellung der diagnosti-schen Kriterien und Symptome, dienach Manning et al. ein „IrritablesDarmsyndrom“ kennzeichnen [13]
Kontinuierliche oder intermittierendenSymptome über mindestens drei Monatemit:
● abdominellen Schmerzen, die sich nachdem Stuhlgang bessern bzw.
● mit einer Änderung der Stuhlfrequenzoder Stuhlkonsistenz einhergehen und
● einer unregelmäßigen bzw. wechselndenStuhlentleerung über mindestens 25%des Beobachtungszeitraums
Dazu sind drei oder mehr der folgenden Pa-rameter vorhanden:
A. veränderte StuhlfrequenzB. veränderte Stuhlkonsistenz (hart, breiig,
wäßrig)C. veränderte Defäkation (Stuhldrang, Pres-
sen, Gefühl der unvollständigen Entlee-rung)
D. peranaler SchleimabgangE. Blähungen oder abdominelles Völlege-
fühl
Tabelle 2
Mittlere Untersuchungs- und Durchleuchtungszeit mit Standard-abweichung und Spannweite der standardisierten Enteroklyse imGesamtkollektiv (n=67). Die zur Sondenplazierung benötigte Zeitentspricht der Sondierungsphase. Die Instillations- und Dokumen-tationsphase umfaßt die Zeit vom Beginn der Kontrastmittelinstilla-tion bis zum Ende der Untersuchung
Zeitbedarf [min] Davon Durchleuchtungszeit [min]
Sondierungsphase 10,1±5,2 4,1±2,8(4,0–30,8) (0,6–13,2)
Instillations- und 32,9±10,4 11,4±4,3Dokumentationsphase (11,8–74,9) (4,2–21,2)
Gesamtuntersuchung 43,1±12,9 15,5±5,7(17,0–91,6) (6,3–30,5)

Der Radiologe 7·98 | 627
stillationsphase des Distensionsmedi-ums erreicht und betrug im Mittel43,13±9,10 cm H2O. Danach kommt esdurch aboralen Transport der instillier-ten Flüssigkeiten zum allmählichenDruckabfall, so daß der Druck am Un-tersuchungsende durchschnittlich nurnoch 39,72±8,55 cm H2O betrug (Abb. 2).
Tabelle 5].Diese Druckdifferenzen kenn-zeichnen den untersuchungsabhängigenindividuellen Druckanstieg und ermög-lichen einen interindividuellen Vergleichder registrierten intraluminalen Drucke.Bei Crohn-Patienten unterscheidet sichder Druckanstieg deutlich vom Druck-anstieg in den beiden anderen Patien-tengruppen (Tabelle 4 und 5). Bereits fürden mittleren Initialdruck besitzen dieM.-Crohn-Patienten mit 23,27±7,01 cmH2O den höchsten Wert im Vergleich zuetwa 19,16±6,32 bzw. 21,40±5,58 cm H2Ofür die Patienten mit funktioneller Stö-rung bzw. Patienten mit nichtentzündli-cher Dünndarmerkrankung. Bis zumEnde der Kontrastmittelphase gleichensich die Druckwerte der beiden letztenPatientengruppen weitgehend an und
Zur Elimination des patientenindivi-duell unterschiedlichen Ruhedruckserfolgte die Berechnung von Druckdiffe-renzen (∆P) aus dem jeweiligen Ruhe-druck und dem zu bestimmten Untersu-chungszeitpunkten gemessenen Druck-werten [∆(PKM-Ende−PRuhe), ∆(PDM-Ende−PRuhe), ∆(PMax−PRuhe), ∆(PEnde−PRuhe),
Tabelle 3
Verabreichte Mengen, Instillationsraten und Instillationsdauer von Kontrastmittel (KM) und Distensionsmedium(DM) in den 3 Patientengruppen „M. Crohn“,„nicht-entzündliche organische Dünndarmerkrankung“ und „Funktio-nelle Störung“ im Sinne des irritablen Darmsyndroms. Die Instillationsraten entsprechen den tatsächlichen, aus derDruckkurve entnommenen und protokollierten Werten. n.s.=nicht signifikant
Gesamt- Morbus Crohn Organische Funktionelle p-Wertkollektiv Erkrankung Störung(n=67) (n=12) (n=35) (n=20)
KM-Menge [ml] 485,1±38,0 475,00±54,01 482,81±39,37 494,74±22,94 n.s. (0,3540)Dauer der KM-Instillation [min] 10,84±5,04 10,53±3,87 11,58±6,47 9,92±3,21 n.s. (0,5334)Mittl. KM-Instillationsrate [ml/min] 52,70±21,59 50,42±18,04 52,42±22,55 55,58±24,86 n.s. (0,8152)
DM-Menge [min] 1653,70±446,3 1550,00±490,46 1662,50±402,21 1715,79±477,57 n.s. (0,6216)Dauer der DM-Instillation [min] 14,62±5,18 16,92±9,66 13,85±3,78 15,12±3,46 n.s. (0,2288)Mittl. DM-Instillationsrate [ml/min] 119,4±32,1 107,22±39,70 124,29±31,21 115,39±28,25 n.s. (0,2829)
Abb. 1 m Typische Druckkurve einer standardisierten Enteroklyse. Die Zeitachse verläuft von rechtsnach links. Nach Einjustierung des Ruhe- bzw. Initialdrucks (1) Beginn der Kontrastmittelinstillationmit langsamen Druckanstieg. Druckschwankungen infolge Anpassung der Flußrate an Motilität undDarmdehnung bei intermittierender Durchleuchtung. Ende der Kontrastmittelphase (2) und unmit-telbarer Beginn der Instillationsphase des Distensionsmediums. Der Pfeil markiert den Anstieg desintraluminalen Drucks bei Erhöhung der Instillationsrate von 150 ml/min auf 190 ml/min. Bei Errei-chen des Maximaldrucks (3) erfolgt bei guter Darmdistension die Röntgendokumentation auf Über-sichts- und Zielaufnahmen (❏). Im weiteren Verlauf nach Ende der Instillationsphase des Disten-sionsmediums langsamer Druckabfall. Einzelne Druckspitzen durch manuelle Palpation und Tubus-kompression. Die am Schluß der Untersuchung angefertigte Übersichtsaufnahme in Bauchlage führtzu einem Druckanstieg

| Der Radiologe 7·98
Freies Thema
628
liegen im Mittel bei etwa 29 cm H2O,während die Crohn-Patienten mit33,97±8,48 cm H2O einen höheren Werterreichen. Dieser Unterschied desDruckanstiegs zwischen den Crohn-Pa-tienten und den beiden anderen Patien-tengruppen nimmt im Laufe der Instil-lations- und Dokumentationsphaseweiter zu. Der am Ende der Instillationdes Distensionsmediums erreichtemittlere Druck von 47,94±10,42 cm H2Obei Crohn-Patienten liegt mit etwa10 cm H2O signifikant über dem mittle-ren intraluminalen Druck der beidenanderen Patientenkollektive (Tabelle 4,p=0,0099). Noch deutlicher wird dieunterschiedliche Drucksteigerung beiBetrachtung des maximalen intralumi-nalen Drucks. Bei den Crohn-Patientenbeträgt dieser absolut 51,75±9,94 cmH2O, bei der Patientengruppe mit nicht-entzündlicher Dünndarmerkrankung43,00± 6,20 cm H2O und bei den Pati-enten mit funktioneller Störung39,55±9,74 cm H2O (p=0,0010). DieserUnterschied des mittleren intralumina-len Drucks ist auch am Untersuchungs-ende nachweisbar (p=0,0002). Die Be-trachtung der Druckdifferenzen relativzum Ruhedruck zeigt signifikante Un-terschiede insbesondere zum Ende der
anstieg bis zum Erreichen des maxima-len Druckes ist bei den Crohn-Patien-ten mit 28,48±10,26 cm H2O signifikanthöher (p=0,0163) und persistiert biszum Untersuchungsende (p=0,0068).Die Transportleistung des Dünndarmsist gemessen an definierten Untersu-chungszeitpunkten bei Crohn-Patien-ten reduziert. Das Ende der Distensi-onsphase wird im Vergleich insbeson-dere zu Patienten mit Reizdarmsyn-drom später erreicht, ohne daß sichdieser Unterschied statistisch absi-chern läßt (Tabelle 4).
Diskussion
Stratifizierung desPatientenkollektivs
Die Synopsis von Verdachtsdiagnosenund Enteroklysebefunden bestätigt denStellenwert der Enteroklyse zur Dia-gnose und Verlaufskontrolle bei M.Crohn. Bei 6 von 10 Patienten mit be-kanntem M. Crohn ließen sich Zeicheneiner mäßigen Entzündungsaktivitätnachweisen. Hingegen war der Anteilpathologischer Röntgenbefunde bei Pa-tienten, die zur Ausschlußdiagnostik ei-ner entzündlichen Darmerkrankungzur Enteroklyse überwiesen wurden,gering. Bei 21 Patienten mit der Ver-dachtsdiagnose M. Crohn konnte ledig-lich in 2 Fällen ein M. Crohn radiolo-
Distensionsphase (Tabelle 5). Bei denCrohn-Patienten beträgt der Druckan-stieg 24,67±10,55 cm H2O und damitdurchschnittlich etwa 6 cm H2O mehrals bei den beiden anderen Patienten-gruppen (p=0,0381). Der mittlere Druck-
Initialdruck0
Dru
ck [
cmH
2O]
Gesamtkollektiv (n = 61)
10
20
30
40
50
60
M. Crohn-Patienten (n = 10)
Patienten mit organ. Erkrankungen (n = 32)
Patienten mit funkt. Stˆrung (n = 19)
Druck am Endeder KM-
Instillation
Druck am Endeder DM-
Instillation
Max. Druck Druck am Unter-suchungsende
Abb. 2 m Mittlere intraluminale Druckwerte nach ätiologischer Stratifizierung der Patienten in dieGruppen „M. Crohn“,„Patienten mit nichtentzündlicher organischer Erkrankung“ und „Patienten mitfunktioneller Störung“ im Vergleich zum „Gesamtkollektiv“. Auf der Abszisse sind definierte Unter-suchungszeitpunkte angegeben:„Ruhe- oder Initialdruck vor Beginn der Kontrastmittelinstillation“,„Druck am Ende der Kontrastmittelinstillation“,„Druck am Ende der Instillationsphase des Disten-sionsmediums“,„Maximaler Druck“ in der parallel mitgeführten Druckkurve und „Druck amUntersuchungsende“. Infolge unvollständigen Datenmaterials blieben programmbedingt (WiStat,Wissenschaftliche Interferenzstatistik, Version 3.2, Dr. Ule Franzen und Dr. H.W. Fritsch, Marburg)6 Patienten des Gesamtkollektivs in der Auswertung unberücksichtigt)
Tabelle 4
Unterschiede des intraluminalen Drucks und definierter Untersuchungszeitpunk-te in den 3 ätiologisch stratifizierten Patientengruppen. n.s.=nicht signifikant
Morbus Crohn Organische Funktionelle p-WertErkrankung Störung
(n=10) (n=32) (n=19)
Initial- bzw. Ruhedruck [cm H2O] 23,27±7,01 21,40±5,58 19,16±6,32 n.s. (0,1989)Zeitpunkt Ende KM- 10,41±3,15 11,87±6,43 9,80±3,25 n.s. (0,3661)
Instillation [min]Druck am Ende der KM-Inst. 33,97±8,48 29,74±5,77 29,09±7,33 n.s. (0,1525)
[cm H2O]Zeitpunkt Ende DM-Instillation 28,05±12,82 26,60±7,52 24,55±6,51 n.s. (0,5211)
[min]Druck am Ende der DM-Inst. 47,94±10,42 39,27±6,94 38,03±10,08 0,0099
[cm H2O]Zeit bis Erreichen des max. 29,08±13,55 28,82±9,31 25,15±7,00 n.s. (0,3729)
Druckes [min]Maximaler Druck [cm H2O] 51,75±9,94 43,00±6,20 39,55±9,74 0,0010Ende Instillations- und 33,00±13,69 33,47±9,52 31,39±7,71 n.s. (0,7634)
Dokument.phase [min]Druck am Untersuchungsende 48,59±8,33 39,66±6,52 35,67±8,28 0,0002
[cm H2O]

Der Radiologe 7·98 | 629
gisch bestätigt werden. Bei der Mehr-zahl der übrigen Patienten mit der Ver-dachtsdiagnose einer entzündlichenDarmerkrankung und auffälliger psy-chovegetativer Symptomatik standenunspezifische Abdominalbeschwerdenwie Diarrhoen, Bauchschmerzen oderÜbelkeit im Vordergrund. Aus dieserPatientengruppe rekrutierten sichmehrheitlich die Patienten, die bei derätiologischen Stratifizierung des Ge-samtkollektivs dem Teilkollektiv mitfunktioneller Störung zugerechnetwurden. Diese Patienten hatten einenNormalbefund in der Enteroklyse. Jenach Ausprägung der abdominellenund vegetativen Beschwerden ist dieAbgrenzung funktioneller Störungengegenüber chronisch entzündlichenDarmerkrankungen allein anhand desklinischen Bildes schwierig, so daß dieEnteroklyse als bildgebendes Verfahrenzur Ausschlußdiagnostik einer Dünn-darmerkrankung indiziert ist. Auf demBoden der in der Literatur angegebe-nen Zahlen, nach denen bis zu 50% deran den Gastroenterologen überwiese-nen Patienten an funktionellen Störun-gen leiden [4], erscheint der hohe Anteilder Patienten mit unauffälligem Ente-roklysebefund trotz abdomineller Be-schwerden durchaus plausibel.
Standardisierte Enteroklyse
Untersuchungs- und Durchleuchtungs-zeiten variieren mit den individuellenFähigkeiten des Untersuchers, der an-gewandten Untersuchungstechnik, dembenutzten Sondenmaterial und Instilla-
zwischen 15 und 30 min. Hippeli u.Grehn [10] geben hingegen für dieDurchleuchtung einen Mittelwert von10,75 min und für die Gesamtuntersu-chungszeit durchschnittlich 36,35 minan. Die vorgegebene Kontrastmittel-menge von 500 ml wurde nur in Einzel-fällen unterschritten. Die mittlere In-stillationsrate des Kontrastmittels lagim Gesamtkollektiv mit 52,7±21,59ml/min unter der in der Literatur über-wiegend empfohlenen Instillationsratevon 75 ml/min [1, 15].
Da der Arbeitskanal der Doppellu-mensonde einen gegenüber der konven-tionellen Dünndarmsonde geringerenInnendurchmesser aufweist, kommt esmit zunehmender Viskosität des Kon-trastmittels zu einer Abnahme der tat-sächlich geförderten Kontrastmittel-menge. Dies veranschaulicht Abb. 3 imVergleich der eingestellten Flußrate ander Pumpe mit der aus der Druckkurveerrechneten Flußrate. Die fallweisegeringe Kontrastmittelinstillationsrateist mitverantwortlich für die relativ lan-ge mittlere Kontrastmittelinstillations-dauer von 10,84 (±5,04) min im Ge-samtkollektiv. In anderen Fällen wurdedie Kontrastmittelphase durch eineausgeprägte Hypomotilität des Darmesbeeinflußt, die keine höhere Instillati-onsrate gestattete. Die tatsächliche In-stillationsrate des gering viskösen Di-stensionsmediums verhält sich im un-tersuchungstechnisch relevanten Be-reich linear zur eingestellten Flußrate(Abb. 3).
Das instillierte Volumen des Di-stensionsmediums betrug im Mittel1653,7 ml mit einer Standardabwei-chung von 446,3 ml, in der sich die An-passung der verabreichten Menge an
tionsmodus, aber auch mit patientenin-dividuellen Bedingungen, z.B. den ana-tomischen Verhältnissen und der Darm-motilität. Die Gesamtuntersuchungs-zeit ist in dieser Studie mit 43,1±12,9min im Vergleich mit anderen Arbeits-gruppen relativ lang. Die Gesamtdurch-leuchtungszeit als kennzeichnender Pa-rameter der Strahlenexposition liegtmit 15,5±5,7 min im Bereich der Anga-ben anderer Arbeitsgruppen. Sandersu. Ho [16] benötigten 25–30 min für diegesamte Untersuchung einschließlichIntubation. Ekberg [3] ermittelte Ge-samtzeiten zwischen 15 min und 5 h,wobei 70% der Untersuchungen inner-halb von 45 min beendet waren. Thoeniu. Gould [20] gaben eine totale Durch-leuchtungszeit von 18,4±6,7 min undeine Gesamtuntersuchungszeit von31,2±9,6 min an. Geiter u. Fuchs [7] er-mittelten Durchleuchtungszeiten vonnur 4–5 min und Untersuchungszeiten
Tabelle 5
Berechnung der Druckdifferenzen zwischen intraluminalen Ruhedruck (PRuhe)und Druckwerten zu bestimmten Untersuchungszeitpunkten in den drei ätiolo-gisch stratifizierten Patientengruppen „M. Crohn“,„nichtentzündlich organischeDünndarmerkrankung“ und „funktionelle Störung“. n.s.=nicht signifikant
Morbus Crohn Organische Funktionelle p-WertErkrankung Störung
(n=10) (n=32) (n=19)
∆ (PKM-Ende−PRuhe) [cm H2O] 10,70±6,12 8,50±3,80 9,93±5,25 n.s. (0,3345)∆ (PDM-Ende−PRuhe) [cm H2O] 24,67±10,55 17,87±6,50 18,87±6,58 0,0381∆ (PMax−PRuhe) [cm H2O] 28,48±10,26 21,60±6,86 20,39±6,34 0,0163∆ (PEnde−PRuhe) [cm H2O] 25,32±11,00 18,26±6,00 16,51±6,22 0,0068
(PKM-Ende): Druck am Ende der Kontrastmittelinstillation.(PDM-Ende): Druck am Ende der Instillationsphase des Distensionsmediums.(PMax.): in der Untersuchung erreichter maximaler Druck.(PEnde): Druck am Ende der Untersuchung
Abb. 3 m Vergleich der an der Kontrastmittelpumpe eingestellten Flußrate mit der tatsächlichenFlußrate, die aus protokollierten Werten und der parallel geführten Druckkurve ermittelt wurde. De-monstration der Abhängigkeit der Flußraten von Viskosität (Visk.), die mit einem Auslaufbecher ge-messen wurde, und der Temperatur (T). KM, Kontrastmittel; DM, Distensionsmedium

die patientenindividuellen Bedingun-gen niederschlägt. Bei Patienten mitlangem Dünndarm oder starker Motili-tät war die Instillation größerer Men-gen Distensionsmedium notwendig,um eine vollständige Dehnung desDünndarms über seine gesamte Längezu erzielen. Die mittlere Instillationsra-te ist mit 119,4±32,1 ml/min relativhoch, während die durchschnittlicheInstillationsdauer des Distensionsme-diums trotz der relativ hohen Voluminamit 14,62±5,18 Minuten vergleichsweiseniedrig erscheint. Signifikante Unter-schiede der instillierten Menge, der In-stillationsdauer und der mittleren In-stillationsrate von Kontrastmittel undDistensionsmedium ließen sich beiVergleich der Patientengruppen nichtnachweisen (Tabelle 3).
Intraluminale Drucke in derstandardisierten Enteroklyse
Die Trägheit des Meßsystems und dieSignaldämpfung entlang der Dünn-darmsonde bis zum Druckaufnehmerverhindern eine Registrierung rascherperistaltischer Kontraktionen im Se-kundenbereich. Die gemessene Druck-kurve entspricht einem mittleren intra-luminalen Druck, dessen Betrag im Ver-gleich zu Literaturangaben plausibelerscheint. Hightower [8] gibt für denintraluminalen basalen Druck Wertezwischen 5,3 und 13,6 cm H2O an, Mit-telwert 8–9 cm H2O. SuperponierteDruckwellen durch Kontraktionen derDarmwand haben nach Hightower Am-plituden zwischen 5 und 80 cm H2O.Der Vergleich der Druckwerte in dendrei Patientengruppen zeigt, daß diePatienten mit M. Crohn sowohl denhöchsten Initialdruck, die höchsten ab-soluten Druckwerte während der Un-tersuchung als auch die höchstenDruckdifferenzen gegenüber dem Ru-hedruck aufweisen (Abb. 2). Im Gegen-satz dazu unterscheiden sich dieDruckwerte bei Patienten mit nichtent-zündlicher organischer Erkrankungund Patienten mit funktioneller Stö-rung nur geringfügig. Die Patienten mitnichtentzündlicher organischer Erkran-kung zeigten im Vergleich zu den Pati-enten mit funktioneller Störung leichthöhere Druckwerte. Die Transportlei-stung des Dünndarms, gemessen amZeitbedarf bis zum Ende der Distensi-onsphase, ist bei Patienten mit nicht-
ten wiesen eine passagebeeinträchti-gende Stenose des terminalen Ileumsmit prästenotischer Dilatation auf. Ineinem weiteren Fall zeigte das termina-le Ileum zwar Entzündungszeichen, je-doch keine Engstellung. Ergebnisse an-derer Studien bezüglich Tonus- undMotilitätsveränderungen bei Crohn-Patienten sind uneinheitlich. Lampe u.Schopen [11] beobachteten bei der per-oralen Magen-Darm-Kontrastdarstel-lung eine auffällige Hypoperistaltik desMagens und oberen Dünndarms beiCrohn-Patienten und postulierten alsUrsache eine funktionelle Dünndarm-insuffizienz bei sekundärem Malab-sorptionssyndrom. Auch in dieser Stu-die ließen sich Motilitätsminderungennicht durch reflektorische prästenoti-sche Darmatonien erklären, da ent-zündliche Veränderungen überwiegendim terminalen Ileum zur Darstellungkamen. Fóti (zit. nach [11]) beschrieb ei-ne Bewegungsruhe des Darmes nachvorausgegangener Reizung der Darm-muskulatur. Er nahm eine nervale To-nusregulationsstörung bei funktionel-lem Insuffizienzsyndrom des Dünn-darms an, bei dem einer hypertonenReizphase eine hypotone Ermüdungs-phase mit herabgesetzter Erregbarkeitder Muskulatur folgt. Ursächlich könn-te eine Störung der nervalen Koordina-tion der einzelnen Muskelelemente fürdie synergistische Tätigkeit der Darm-muskulatur zugrunde liegen [11]. NachBruch et al. [2] entstehen Motilitätsstö-rungen bei entzündlichen Darmer-krankungen auf dem Boden entzün-dungsabhängiger Veränderungen derMuskulatur und des intramuralen Ner-vensystems.
Änderungen der Motilität und desTonus können somit aufgefaßt werdenals
● reflektorische Reaktion des Plexusauf das entzündliche Geschehen,
● direkte entzündliche Alteration desPlexus und
● Beeinflussung von Plexus und glatterMuskulatur durch freiwerdende Me-diatoren.
Der M. Crohn zeichnet sich nach Anga-ben derselben Autoren [2] durch eineProstaglandin-induzierte Hyperperi-staltik mit maximal gesteigerter Motili-tät aus. In-vitro Untersuchungen erga-ben eine nach Frequenz und Kontrakti-
entzündlicher organischer Erkrankungim Vergleich zu Crohn-Patienten etwasrascher. Der Zeitbedarf bis zum Endeder Distensionsphase beträgt 26,60±7,52min gegenüber 28,05±12,82 min im Kol-lektiv der Patienten mit M. Crohn. Bei-de Kollektive schließen die Distensi-onsphase im Vergleich zu Patienten mitReizdarmsyndrom später ab, wenn-gleich dieser Unterschied statistischnicht signifikant ist. Patienten mit funk-tioneller Störung werden durch denniedrigsten intraluminalen Druck beigleichzeitig hoher Transportleistungdes Dünndarms charakterisiert. Patien-ten mit Reizdarmsyndrom erreichendas Ende der Distensionsphase nach24,55±6,51 min am frühesten. Dies re-sultiert aus der Tatsache, daß bei Pati-enten mit funktioneller Hyperperistal-tik hohe Instillationsraten zur Hem-mung der Motilität notwendig sind.An-tes [1] beobachtete nach Instillation von300 ml Barium mit einer konstantenGeschwindigkeit von 75 ml/min, daß„in den meisten Fällen“ das Ileum er-reicht würde. Von „intestinal hurry“spricht er, wenn am Ende der Kontrast-mittelphase bereits das Zökum gefülltist, von einer „pseudoobstruktiven Hy-poperistaltik“, wenn lediglich das pro-ximale Jejunum gefüllt ist. Trotz Anpas-sung der Instillationsrate von Kontrast-mittel und Distensionsmedium könnendie Angaben von Antes [1] in dieser Stu-die insofern bestätigt werden, daß imGesamtkollektiv bei 3/4 aller Patientendie Kontrastmittelsäule am Ende derKontrastmittelphase im Ileum ange-langt war. Bei 13 Patienten hatte dasKontrastmittel das Ileum noch nicht er-reicht, während bei 3 Patienten bereitsder Übertritt ins Kolon erfolgt war. Ineiner Studie von Ekberg [3] erreicht dasKontrastmittel in 95% der Fälle das Zö-kum in weniger als 50 min. Im Grup-penvergleich ist die Passagezeit bei M.Crohn um etwa 5 min verlängert.
Obwohl die Patienten mit M. Crohndurch relativ hohe Druckwerte, etwaslängere Passagezeiten und relativgleichförmige, eher träge Peristaltikcharakterisiert sind, zeigt die Entero-klyse dennoch unterschiedliche mor-phologische Befunde. Bei 6 von 12Crohn-Patienten wies die Enteroklyseein funktionell nicht wirksames „stringsign“ im terminalen Ileum bzw. imAnastomosenbereich bei Zustand nachIlecoecalresektion nach. Nur 2 Patien-
| Der Radiologe 7·98
Freies Thema
630

5. Eysselein VE, Nast CC (1991) Neuropeptidesand inflammatory bowel disease.Z Gastroenterol Verh 26:253–257
6. Fuchs H, Jakobi V (o.J.) Arbeitsanleitung zurRöntgenuntersuchung des Dünndarms.Hrsg. Fa. Guerbet, Sulzbach,Ts
7. Geiter B, Fuchs HF (1977) Dünndarm-Kontrasteinlauf – Indikationen und Tech-nik. Dtsch Ärztebl 43:2575–2578
8. Hightower NCJ Jr (1968) Motor action of thesmall bowel. In: Heidel W (ed) Handbook of
Physiology, Section 6, Alimentary Canal,
American Physiology Society,Washington D.C.,
pp 2001–2024
9. Hildell J (1990) Röntgenuntersuchung desDünndarms. Radiologe 30:266–272
10. Hippeli R, Grehn S (1978) Untersuchung zurIntensivdiagnostik des Dünndarms mitder Sondenmethode. RöFo 129:713–723
11. Lampe K, Schopen RD (1972) Zum Bild derfunktionellen Dünndarminsuffizienz beiregionärer Enteritis Crohn. RöFo
117:312–316
12. Lappas JC, Maglinte DDT (1990) Small-bowelimaging. Curr Opin Radiol 2:400–406
13. Manning AP,Thompson WG, Heaton KW, Morris
AF (1978) Towards positive diagnosis of theirritable bowel. Br Med J 2:653–654
14. Mayer EA, Raybould H, Koelbel C (1988)
Neuropeptides, inflammation andmotility. Dig Dis Sci 33:71S–77S
15. Oudkerk M, Rijke AM (1988) The effect ofbarium infusion rate on the diagnosticvalue of small bowel enteroclysis.J Med Imaging 2:123–129
16. Sanders DE, Ho CS (1976) The small bowelenema: experience with 150 examina-tions. Am J Roentgenol 127:743–751
17. Sellink JL, Rosenbusch G (1981) ModerneUntersuchungstechnik des Dünndarmsoder: Die zehn Gebote des Enteroklysmas.Radiologe 21:366–378
18. Stacher G (1991) Psyche und gastroin-testinale Erkrankungen: Hypothesen undFakten. Z Gesamt Inn Med 46:310–314
19. Thoeni RF (1989) Small bowel.Curr Opin Radiol 1:60–65
20. Thoeni RF, Gould RG (1991) Enteroclysis andsmall bowel series: comparison of radia-tion dose and examination time. Radiology
178:659–662
21. Vermillion DL, Huizinga JD, Riddell RH,
Collins SM (1993) Altered small intestinalsmooth muscle function in Crohn’sdisease. Gastroenterology 104:1692–1699
Der Radiologe 7·98 | 631
onsamplitude hochsignifikant gestei-gerte phasische Aktivität und einen pri-mär maximal erhöhten Basaltonus mitaufgepfropften phasischen Kontraktio-nen von kleiner Amplitude. Ferner wirddie Bedeutung von Neuropeptiden undanderen lokal wirksamen Mediatorenbei der Regulation der Motilität imRahmen chronisch entzündlicherDarmerkrankungen diskutiert. Mayeret al. [14] maßen neben intramuralen,peripheren und zentralen Reflexen derFreisetzung von Substanz P aus primärafferenten Nervenendigungen bei ent-sprechenden entzündlichen, mechani-schen oder chemischen Stimuli beson-dere Bedeutung bei. Auch Eysselein u.Nast [5] schrieben der Substanz P eineregulatorische Wirkung bei chronischentzündlichen Darmerkrankungen zu.Auch für andere Neuropeptide undTransmitter konnten veränderte Gewe-bekonzentrationen im Rahmen ent-zündlicher Darmerkrankungen nach-gewiesen werden. Vermillion et al. [21]wiesen bei In-vitro-Versuchen an glat-ter Dünndarmmuskulatur eine deutli-che Beeinflussung der Muskelkontrak-tilität durch entzündliche Prozessenach.
Schlußfolgerung
Motilitäts- und Tonusstörungen desDünndarms bei Patienten mit M. Crohnsind phänomenologisch bekannt. Indieser Pilotstudie konnten unabhängigvon der Krankheitsaktivität Unter-schiede des intraluminalen Drucks beiPatienten mit M. Crohn im Vergleichzu Patienten mit nichtentzündlicherDünndarmerkrankung und funktionel-ler Störung im Sinne eines Reizdarm-syndroms belegt werden. Die Ursachendieser Beobachtung sind allerdingskomplex und in ihrem Zusammenspielnoch nicht abschließend geklärt. Dievorgestellte standardisierte Enteroklyse
mit Anpassung der Flußrate an die je-weilige patientenindividuelle Motilität,Dünndarmdehnung und Transportlei-stung sowohl in der Kontrastmittelpha-se als auch in der Distensionsphase istder bislang etablierten radiologischenUntersuchungstechnik zumindest eben-bürtig. Die mitgeteilten Beobachtungengeben Anlaß zur Überlegung, ob sichder intraluminale Druck als Stellgrößein einem Regelkreis zur Steuerung derInstillationsraten von Kontrastmittel-und Distensionsmedium eignet. Der-zeit wird in einer Folgestudie unter-sucht, ob ein kontinuierliches, verzöge-rungsarmes Druckmonitoring zur Op-timierung der Enteroklyse beiträgt. Dieuntersucherabhängige Anpassung vonInstillationsraten könnte sich dann zu-künftig nicht nur auf den Durchleuch-tungsbefund, sondern auch auf den in-traluminalen Druck stützen. Einer pro-spektiven Studie wäre es vorbehalten,ein spezifisches, differentes Verhaltendes intraluminalen Drucks bei Patien-ten mit M. Crohn einerseits gegenüberPatienten mit einer nichtentzündlichenDünndarmerkrankung bzw. funktio-neller Störung andererseits zu belegen.
Für die sorgfältige Zubereitung der Kon-trast- und Distensionsmedien, umsichtigePatientenvorbereitung sowie Pflege und In-standhaltung der Meßapparatur gebührtden MTRA der Abteilung Strahlendiagno-stik, insbesondere Herrn Werner Beykirch,MTRA, ganz besonderer Dank. Für die tech-nische Unterstützung und Beratung ist denHerrn Schneider, Fa. Guerbet, und Dipl.Ing.Völcker, Fa. Fresenius, zu danken.
Literatur1. Antes G (1990) Die allgemeinen Motilitäts-
störungen des Dünndarms. Radiologe
30:273–279
2. Bruch HP, Imhof M,Wunsch P (1988)
Motilitätsstörungen bei entzündlichenDarmerkrankungen. Chirurg 59:15–19
3. Ekberg O (1977) Double contrast examina-tion of the small bowel. Gastrointest Radiol
1:349–353
4. Enck P, Holtkotter B,Whitehead WE, Schuster
MM,Wienbeck M (1989) Klinische Sympto-matik, Psychopathologie und Darmmo-tilität bei Patienten mit ,irritablem Darm‘.Z Gastroenterol 27:357–361