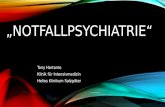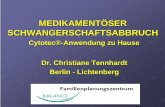Stellenwert nicht-medikamentöser und nicht-technischer Behandlungsverfahren in der Versorgung
Transcript of Stellenwert nicht-medikamentöser und nicht-technischer Behandlungsverfahren in der Versorgung
Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ) (2013) 107, 200—205
Online verfügbar unter www.sciencedirect.com
journa l homepage: ht tp : / / journa ls .e lsev ier .de /ze fq
SCHWERPUNKT I
Stellenwert nicht-medikamentöser undnicht-technischer Behandlungsverfahren in derVersorgungThe role of non-pharmaceutical and non-technical therapeutic interventionsin patient care
Stefan Wilm ∗, Sara Santos, Verena Leve
Institut für Allgemeinmedizin (ifam), Fakultät für Medizin, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
SCHLÜSSELWÖRTERPatientenversorgung;nicht-medikamentöseTherapie;nicht-technischeTherapie;Kommunikation;Patient-Therapeut-Beziehung
Zusammenfassung Eine klare Definition des breiten Feldes nicht-medikamentöser und nicht-technischer Behandlungsverfahren in der Versorgung von Patienten existiert nicht, was dieDiskussion über die Thematik erschwert. Die Interaktion der Personen von Patient und Thera-peut, die Kontextfaktoren der Therapie und der Einfluss des Patienten spielen hier eine größereRolle als bei medikamentösen und technischen Ansätzen. Beim überwiegenden Teil der nicht-medikamentösen und nicht-technischen Behandlungen handelt es sich um komplexe, fast immerauch kommunikative Interventionen. Die Datenlage zu ihrer Erbringung ist in Bezug auf Häufig-keit der Anwendung, zeitlichen Umfang der Anwendung, entstehende Kosten, Qualität, Zahl deranwendenden Therapeuten und Bedeutung für den Patienten als Kriterien für ihren Stellenwertaber sehr dünn. Diese Behandlungsverfahren machen vermutlich den Kern und die Masse in derVersorgung von Patienten aus.(Wie vom Gastherausgeber eingereicht)
KEYWORDSPatient care;non-pharmaceuticalinterventions;non-technicalinterventions;communication;professional-patientrelationship
Summary A clear definition of the broad field of non-pharmaceutical and non-technical thera-peutic interventions in patient care does not exist, making the discussion more difficult. Here,the relationship between patient and professional, contextual factors, and the influence of thepatient play a more prominent role than with drug therapy and technical interventions. The vastmajority of non-pharmaceutical and non-technical procedures consist of complex and nearlyalways communication-based interventions. It is difficult to describe their role, since reliabledata on criteria like frequency, time required, costs, quality, number of professionals involvedand the importance for the patient are sparse. These therapeutic interventions may well formthe core and biggest part of therapy in patient care.(As supplied by publisher)
∗ Korrespondenzadresse: Univ.-Prof. Dr. med. Stefan Wilm, Institut für Allgemeinmedizin (ifam), Fakultät für Medizin, Universitätsklinikum,Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf. Tel.: +0211/8117771; Fax: +0211/8118755.E-Mail: [email protected] (S. Wilm).
1865-9217/$ – see front matterhttp://dx.doi.org/10.1016/j.zefq.2013.04.008
Stellenwert nicht-medikamentöser und nicht-technischer Behandlungsverfahren in der Versorgung 201
Einleitung
Über Definition, Methoden und Verfahren zur Nutzenbe-wertung medizinischer Leistungen gibt es in Deutschlandein breites Spektrum unterschiedlicher Auffassungen undeine andauernde Diskussion. Insbesondere die patienten-orientierte klinische Forschung sollte von Anfang an inden Dialog zwischen Gesundheitsforschungsrat (GFR) desBundesministeriums für Bildung und Forschung und demInstitut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-wesen (IQWiG) einerseits und der Wissenschaft andererseitseinbezogen werden, um in der unverzichtbaren Zusam-menarbeit zwischen der patientenorientierten Forschungund den Instanzen zur Bewertung und Entscheidung vonmedizinischen Leistungen die bisherigen wechselseitig ent-täuschten Erwartungen zu vermindern [1].
Mit dem Thema des 6. Diskussionsforums zur Nutzenbe-wertung im Gesundheitswesen ,,Therapeutische Behandlun-gen mit nicht-medikamentösen, nicht-technischen Ansätzen— Evidenz, Evaluation und Nutzenbewertung‘‘ ist der Dia-log jetzt endgültig in der patientenorientierten Versorgungangekommen und hat sich gleichzeitig auf sehr unsicheres,die Enttäuschungen vermutlich verstärkendes, aber für dieDiskussion zentrales Terrain begeben. Es werden im Folgen-den die Thesen aufgestellt, dass
1. eine klare Definition von ,nicht-medikamentösen undnicht-technischen Behandlungsverfahren‘ nicht existiert
2. Zahlen zum Stellenwert dieser Behandlungsverfahren inder täglichen Versorgung von Patienten in Deutschlandkaum existieren und gleichzeitig
3. diese Behandlungsverfahren den Kern und die Masse inder Versorgung von Patienten ausmachen.
Definition von nicht-medikamentösen undnicht-technischen Behandlungsverfahren
Wenn bereits im Titel der Veranstaltung das Thema nurüber eine Benennung erfolgen kann, die sich lediglich übereine ,Nicht‘-Abgrenzung gegenüber medikamentösen undtechnischen Behandlungsverfahren definieren lässt, wird dieProblematik der Definition sofort spürbar. Medikamentöseund technische Therapieansätze waren Gegenstand der bis-herigen Diskussionsforen und ließen sich klar begrifflichbeschreiben. Machen sie in der Summe aller Behandlungs-verfahren den größten Teil aus, und der kleine Rest lässt sichnur in Abgrenzung hiervon erfassen? Oder sind die medika-mentösen und technischen Behandlungsverfahren nur zweikleine, gut definierbare Inseln im großen Meer aller Behand-lungsverfahren? Wie wäre dann der große Rest befriedigenddefinierbar?
Eine (nicht-repräsentative und sicher nicht vollständige)Aufstellung nicht-medikamentöser und alternativer Thera-pien im Internet-Auftritt der AOK [2] listet eine bunteMischung von Akupressur bis Zelltherapie auf, von denenKrankengymnastik und Ernährungslehre sicherlich noch zuden bekannteren und gebräuchlicheren zählen. Interessan-terweise sind kommunikative oder psychotherapeutischeTherapien hier nicht genannt. Im Behandlungsalltag derBerufe im Gesundheitswesen in der Versorgung von Pati-enten spielt Kommunikation allerdings eine zentrale Rolle
und wird — gezielt, beiläufig oder gar unbeachtet — thera-peutisch eingesetzt. Das Gespräch mit dem Patienten undggf. seinen Angehörigen ist als therapeutisch wirksamesAgens Grundlage der Patient-Therapeut-Beziehung. Aberwie können Akupressur, Krankengymnastik, Ernährungslehreund therapeutisch wirksames Gespräch in einer gemeinsa-men Definition gefasst werden? Verführerisch einfach wärees, sie als ,personale Behandlungsverfahren‘ zu benennen,da sie die Begegnung der Personen Therapeut und Patientvoraussetzen. Aber Yoga und Autogenes Training wendet derPatient therapeutisch alleine an (und wer ist bei der Del-fintherapie der Therapeut?). Zudem wird ein Medikamentvom Patienten zwar alleine eingenommen, die Verschrei-bung erfolgt aber üblicherweise vom Arzt, und die Forschungzeigt, dass die Wirkung des Medikamentes von der ,spre-chenden‘ Droge Arzt [3] stark beeinflusst wird. TechnischeBehandlungsverfahren setzen ebenfalls (oft) einen anwen-denden Therapeuten voraus, so wie Krankengymnastik undAkupressur die Hände des Be-Hand-lers brauchen.
• Fazit 1: Eine klare Definition des breiten Feldesnicht-medikamentöser und nicht-technischer Behand-lungsverfahren existiert nicht, und wir vergleichen nichtnur Äpfel mit Birnen, sondern Äpfel, Möhren und Hafer.
• Fazit 2: Die Interaktion der Personen von Patient und The-rapeut und die Kontextfaktoren der Therapie spielen beidiesen Behandlungsverfahren eine größere Rolle als beimedikamentösen und technischen Ansätzen.
• Fazit 3: Der Einfluss des Patienten auf Inanspruchnahmeund Erbringung der Therapien ist stark.
Der Stellenwert dieser Behandlungsverfahrenin der täglichen Versorgung von Patienten
Die Beschreibung des Stellenwertes nicht aus sich selbstheraus definierbarer Behandlungsverfahren in der Versor-gung birgt aber noch eine weitere Schwierigkeit: Was istder Maßstab für ,Stellenwert‘? Geht es um die Häufigkeit derAnwendung, den zeitlichen Umfang der Anwendung, die ent-stehenden Kosten, die Zahl der anwendenden Therapeuten,die Bedeutung für den Patienten?
Als Zugangswege zur Beschreibung des Stellenwertes vonTherapien bieten sich der Patient, der Therapeut (bzw.der Sektor im Gesundheitswesen), das Behandlungsverfah-ren oder die zu behandelnde Erkrankung (Diagnose) an.
Fall 1: Herr Bräsig, 64 Jahre alt; rüstig, in gutem Allge-meinzustand. Er ist vor sechs Monaten verwitwet, hat keineKinder und lebt allein. Herr Bräsig wird von seinem Hausarztwegen der Erkrankungen arterielle Hypertonie, Diabetesmellitus Typ 2, COPD und Depression behandelt.
Als nicht-medikamentöse, nicht-technische Maßnahmenzur Senkung erhöhter Blutdruck- und Blutzuckerwerte bie-ten sich hier (ob evidenzbasiert oder nicht sei dahingestellt) Ernährungslehre (Kochsalzbeschränkung; kalium-reiche Kost; reichlich Obst und Gemüse; Fettmodifikation;Alkoholrestriktion; Gewichtsreduktion), Ausdauertrainingund Stressbewältigungs-/Entspannungstraining an. Aberwie grenzen wir diese therapeutischen Ansätze vonMaßnahmen der primären Prävention oder von der Selbst-hilfe/Selbstpflege der Betroffenen ab? Wann und beiwelchen Menschen ist ihre Anwendung tatsächlich als
202 S. Wilm et al.
Tabelle 1 Niedergelassene Ärzte und psychologische Psychotherapeuten in der vertragsärztlichen psychosomati-schen/psychotherapeutischen Versorgung — befähigt zur Richtlinien-Psychotherapie.
Statistik der KBV, Stand 31.12.2008 Statistik der BAEK bzw.BPtK, Stand 31.12.2008
Anzahl weiblich in % Alter Ø
Fachärzte für PsychosomatischeMedizin und Psychotherapie
2.508 57 55 3.024
Fachärzte für Psychiatrie undPsychotherapie
1.917 46 50 2.824
Fachärzte für Nervenheilkunde(Neurologie und Psychiatrie)
2.567 32 56 2.312
ausschließlich psychotherapeutischtätige Ärzte*
2.176 71 51 k.A.
Psychologische Psychotherapeuten 13.023 68 52 > 12.000
Quelle: Grunddaten der KBV, 2009; Ärztestatistik der BAEK, 2008. *Ärzte, die mindestens 90 Prozent ihres Gesamtleistungsbedarfes ausden Leistungen des Abschnittes G IV und G V sowie den Leistungen nach den Nrn. 855 bis 858 des Abschnittes G III generieren.
therapeutisch in der Versorgung im Sinne unserer Eingangs-frage aufzufassen? Zahlen über die Häufigkeit der Gabe vonErnährungsempfehlungen, die Dauer von Gesprächen überAusdauertraining oder Stressbewältigung oder die darausresultierenden direkten/indirekten Kosten liegen für Haus-arztpraxen nicht vor. Therapeutisch wirksam sind bei derBehandlung etwa der COPD auch die Patient-Arzt-Gesprächeüber die Krankheitskonzepte des Patienten, seinen All-tagsumgang mit dem Kranksein, die Unterstützung seinerNikotinabstinenz und das Ansprechen seiner salutogenenRessourcen — alles Ansätze, die sich nirgendwo in Zahlenfassbar abbilden.
Die Depression von Herrn Bräsig wird nach Überwei-sung von einer Psychologin psychotherapeutisch behandelt.Wir kennen die Zahl der niedergelassenen Ärzte und psy-chologischen Psychotherapeuten in der vertragsärztlichenpsychosomatischen/psychotherapeutischen Versorgung [4](Tabelle 1).
Wir haben anhand der Psychotherapie-Berechtigungennach den Richtlinienverfahren eine ungefähre Vorstellungdavon, welche Therapeutengruppe eher welches Verfahrenanwendet [4] (Abbildung 1).
Aber wir können nicht einmal annähernd in Zahlen aus-drücken, wo und wie die 25-30% der Bevölkerung, diejährlich an psychischen und psychosomatischen Störun-gen erkranken (sollen), mit nicht-medikamentösen undnicht-technischen Behandlungsverfahren versorgt werden.Patienten ohne psychische Erkrankung, die befragt wurden,an wen sie sich wenden würden, wenn sie an Depres-sion litten, nannten (Mehrfachantworten möglich) zu 56,7%den Hausarzt, zu 25,6% den Facharzt für Psychosomati-sche Medizin und Psychotherapie, zu 23,8% den Facharzt fürPsychiatrie und Psychotherapie und zu 15,3% den Psychologi-schen Psychotherapeuten [4]. Es kann also zumindest davonausgegangen werden, dass ein Gutteil der psychisch oderpsychosomatisch erkrankten Patienten ambulant beim Haus-arzt behandelt wird. Zahlen zu der tatsächlichen Häufigkeit,Dauer und Art der verbalen Interventionen beim Hausarztoder bei fachärztlichen/psychologischen Psychotherapeu-ten sind sehr lückenhaft und spiegeln sich nicht valide inden Abrechnungsziffern der jeweiligen Professionen wider.
Die Erfassung der Qualität der Behandlungen zumindest inTeilbereichen beginnt gerade erst.
Die Kosten der Behandlung von Herrn Bräsig mit nicht-medikamentösen und nicht-technischen Therapien gegenarterielle Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2, COPDund Depression in verschiedenen Sektoren des Gesund-heitswesens verteilen sich entsprechend der skizziertenBeispiele in unbekanntem Umfang über verschiedenste Leis-tungsbereiche, von der ärztlichen Behandlung, Vorsorge-und Rehabilitationsleistungen, Prävention und Selbsthilfeüber Früherkennungsmaßnahmen bis hin zu Atemgymna-stik bei COPD während einer Krankenhausbehandlung [5](Abbildung 2).
Fall 2: Frau Sinn, 83 Jahre alt; in eingeschränktem All-gemeinzustand. Sie ist seit Jahren verwitwet und lebt beiihrem Sohn in der Einliegerwohnung; eine weitere Tochterlebt im Ausland. Frau Sinn wird von ihrem Hausarzt wegender Erkrankungen Polyarthrose mit eingeschränkter Gehfä-higkeit und milde, progrediente Demenz vom Alzheimertypbehandelt.
Als nicht-medikamentöse, nicht-technische Maßnahmenbei Polyarthrose und Demenz verschreibt der HausarztHeilmittel. Der gemeinsame Bundesausschuss definiertHeilmittel als ,,medizinische Dienstleistungen, die vonVertragsärzten verordnet und von speziell ausgebildetenTherapeuten erbracht werden‘‘ [6]. Zu den Maßnahmen zäh-len u.a. physikalische, Sprach- und Ergotherapie, die beiFrau Sinn zur Anwendung kommen und von Physiotherapeu-ten, Logopäden und Ergotherapeuten erbracht werden. ZumUmsatz im Heilmittelbereich gibt es genaue Zahlen der GKV[7] (Tabelle 2).
Die Ausgaben für Heilmittel in der GKV sind von2006 bis 2011 ähnlich steil gestiegen wie die Ausgabenfür Arzneimittel, wenn auch ihr Umfang nur ca. 17%der Arzneimittelausgaben beträgt (siehe Abbildung 2) undlediglich 2,89% der GKV-Gesamtausgaben 2011 [5]. Aberaußerhalb der G-BA-Definition werden z.B. passive undaktive Bewegungsübungen als nicht-medikamentöse undnicht-technische Therapie auch im Bereich der häuslichenKrankenpflege und in der stationären Altenpflege erbracht,ohne dass darüber Zahlen vorliegen.
Stellenwert nicht-medikamentöser und nicht-technischer Behandlungsverfahren in der Versorgung 203
Abbildung 1 Struktur der Psychotherapie-Berechtigungen nach den Richtlinien-Verfahren zum 31. 12. 2009. Quelle: Bundesarzt-register der KBV 2010, S. 37.
Nicht-medikamentöse und nicht-technische Therapiefor-men zur Behandlung der Demenz bei Frau Sinn sind u.a.Psychoedukation, Angehörigentraining, emotionsorientierteVerfahren (Validations- und Reminiszenztherapie), kognitiveÜbungsverfahren und aktivierungsorientierte Verfahren [8],die (bei fehlender starker Evidenz [9]) größtenteils erbrachtwerden von Pflegekräften, Sozialarbeitern, Betreuungsper-sonen mit therapeutischen Zusatzqualifikationen (häufignicht oder nur bedingt geschützt) sowie von Ehrenamtlichenund Angehörigen. Dabei standen (Bezugsjahr 2006) den Ärz-tinnen und Ärzten vier Mal so viele Beschäftigte in der Pflegegegenüber [10] (Tabelle 3).
Die Versorgung mit nicht-medikamentösen und nicht-technischen Demenztherapien erfolgt — soweit die proble-matische Datenlage dies abschätzen lässt — überwiegendin teil- oder vollstationären Versorgungseinrichtungen;lediglich 15% der zuhause lebenden Erkrankten erhal-ten nicht-medikamentöse Therapien, davon überwiegendPhysiotherapie [11]. Erkenntnisse zur Qualität der Behand-lungen fehlen völlig.
Die genannten nicht-medikamentösen und nicht-technischen Therapien bei Polyarthrose und Demenz durch
die verschiedenen Leistungserbringer im Gesundheits-wesen setzen zur optimalen Entfaltung ihres Nutzensfür den Patienten eigentlich eine berufsgruppen- undsektorenübergreifende Kooperation im multiprofessionel-len Team voraus; davon ist der Versorgungsalltag abersehr weit entfernt. Die Finanzierung der Therapien istüber die Sektoren des Gesundheitswesens und Bücherdes Sozialgesetzbuches (SGB V, XI und XII) zersplittert.Im Bereich der Pflegeversicherung finden sich die skiz-zierten nicht-medikamentösen und nicht-technischenBehandlungen in den verschiedensten Leistungsberei-chen, u.a. als Pflegesachleistung, Tages-/Nachtpflege,zusätzliche Betreuungsleistung, Kurzzeitpflege, stationäreVergütungszuschläge und vollstationäre Pflege.
• Fazit 4: Beim überwiegenden Teil der nicht-medikamentösen und nicht-technischen Behandlungenhandelt es sich um komplexe, fast immer auchkommunikative Interventionen.
• Fazit 5: Die Datenlage zur Erbringung nicht-medikamentöser und nicht-technischer Therapienist in Bezug auf Häufigkeit der Anwendung, zeitlichen
204 S. Wilm et al.
Abbildung 2 Ausgaben für einzelne Leistungsbereiche der GKV 2011 in Mrd. Euro.
Tabelle 2 Umsatzstärkste Heilmittel (2011).
Rang Heilmittel * Bruttoumsatzin Tsd. D
in % Anzahl derBehandlungs-einheiten
in% Behandlungseinheitenje Heilmittelleistung
1 0503 Krankengymnastik, EB 1.343.342 28,5 97.473.222 30,8 6,32 4103 Ergoth. (sensomotorisch/
perzeptiv), EB414.113 8,8 12.760.866 4,0 9,5
3 3103 Sprachtherapie, 45 Minuten, EB 413.785 8,7 12.620.605 4,0 9,34 1201 Manuelle Therapie 354.420 7,5 23.817.741 7,5 5,85 0704 Krankengymnastik-ZNS-
Erwachsene, EB338.873 7,2 18.155.043 5,7 10,9
6 9901 Hausbesuch eines Patienten 328.610 6,9 40.038.746 12,6 8,27 0201 Manuelle Lymphdrainage 45 min 261.004 5,5 12.590.402 4,0 7,98 0202 Manuelle Lymphdrainage 60 min 193.574 4,1 6.006.333 1,9 9,19 0106 Klassische Massagetherapie 155.839 3,3 16.543.308 5,2 5,7
10 1501 Warmpackungen 124.844 2,6 16.062.760 5,1 5,911 8003 Podologische Komplexbehandlung 101.040 2,1 4.068.515 1,3 3,612 4105 Ergoth. bei psychischen
Störungen, EB89.318 1,9 2.227.460 0,7 9,5
13 0703 Krankengymnastik-ZNE-Kinder, EB 89.162 1,9 3.722.256 1,2 9,614 4102 Ergoth. bei motorischen
Störungen, EB63.070 1,3 2.729.061 0,9 8,8
15 0507 Krankengymnastik.(gerätegestützte), EB
60.484 1,3 2.403.423 0,8 6,1
Stellenwert nicht-medikamentöser und nicht-technischer Behandlungsverfahren in der Versorgung 205
Tabelle 3 Beschäftigt ausgewählte Beruf im Gesundheitswesen nach Geschlecht Quelle: Statistisches Bundesamt.
Berufe 1997 2001 2006
Beschäftigtein 1000
davonFrauen
Beschäftigtein 1000
davonFrauen
Beschäftigtein 1000
davonFrauen
Gesundheits- undKrankenpflegerinnen/-pfleger einschließlichHebammen und Entbindungspfleger
694 85,0% 702 84,9% 717 85,6%
medizinische und zahnmedizinischeFachangestellte
490 98,9% 492 98,9% 522 99,1%
Ärztinnen/Ärzte 283 36,1% 298 37,4% 311 40,0%Gesundheits- und
Krankenpflegehelferinnen/-helfer202 75,9% 222 74,7% 223 74,6%
Altenpflegerinnen/Altenpfleger 199 87,2% 262 86,8% 321 87,3%Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten,
Masseurinnen/ Masseure, medizinischeBademeisterinnen/Bademeister
106 71,5% 121 73,4% 144 72,0%
Umfang der Anwendung, entstehende Kosten, Zahl deranwendenden Therapeuten und Bedeutung für denPatienten als Kriterien für ihren Stellenwert sehr dünn.
• Fazit 6: Die Erbringung der Therapien ist über Sektorenund Finanzströme im Gesundheitswesen breit verstreut.
• Fazit 7: Erkenntnisse zur Qualität der erbrachten Thera-pien fehlen fast vollständig.
Im therapeutischen Alltag aller Berufe im Gesund-heitswesen, die in der Versorgung von Patienten tätigsind, nehmen kommunikative therapeutische Interventionenin der Patient-Therapeut-Beziehung und die kommu-nikative Begleitung anderer nicht-medikamentöser undnicht-technischer Behandlungen eine zentrale Rolle ein.Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Thera-pien in diesem so schwer definierbaren Feld ein integralerBestandteil der Versorgung großer Teile der Bevölkerungsind. Sie machen den Kern und die Masse in der Versorgungvon Patienten aus.
Interessenkonflikt
Hiermit erklären wir, dass kein Interessenkonflikt gemäß Uni-form Requirements for Manuscripts Submitted to BiomedicalJournals vorliegt.
Literatur
[1] Gesundheitsforschungsrat (GFR) des Bundesministeriums fürBildung und Forschung (BMBF), Hrg. Diskussionsforum zur
Nutzenbewertung im Gesundheitswesen: Begriffsdefinitio-nen und Einführung. Dokumentation des ersten gemeinsamenWorkshops von GFR und IQWiG am 4. September 2007 in Berlin.http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/4860.php.(Zugriff 28.3.2013).
[2] http://www.aok.de/bundesweit/gesundheit/behandlung-nichtmedikamentoese-und-alternative-therapien-2488.php.(Zugriff 28.3.2013).
[3] Balint M. Der Arzt, sein Patient und die Krankheit. 11. Aufl.Stuttgart: Klett-Cotta; 2010.
[4] Kruse J, Herzog W. Zwischenbericht zum Gutachten ,,Zur ambu-lanten psychosomatischen/psychotherapeutischen Versorgungin der kassenärztlichen Versorgung in Deutschland — Formender Versorgung und ihre Effizienz‘‘. 2012.
[5] GKV-Spitzenverband (12/2012). http://www.gkv-spitzenverband.de/media/grafiken/gkv kennzahlen/121220GKV Kennzahlen L7-1.pdf.(Zugriff 28.3.2013).
[6] http://www.g-ba.de/institution/themenschwerpunkte/heilmittel/.(Zugriff 29.3.2013).
[7] GKV-Spitzenverband (2012). GKV-HIS. http://www.gkv-his.de/media/dokumente/his statistiken/2011 04/HIS-Bericht-Bund 201104.pdf.(Zugriff 29.3.2013).
[8] Mahlberg R, Gutzmann H. Demenzerkrankungen erkennen,behandeln und versorgen. Köln: Deutscher Ärzteverlag; 2009.
[9] IQWiG. Nichtmedikamentöse Behandlung der AlzheimerDemenz. Nr. 41. Abschlussbericht. Köln; 2009.
[10] Afentakis A, Böhm K. Beschäftigte im Gesundheitswesen.Gesundheitsberichterstattung des Bundes Heft 46. Berlin: RKI;2009.
[11] Lauterberg J, Großfeld-Schmitz M, Ruckdäschel S, Neubauer S,Mehlig H, Gaudig M, et al. Projekt IDA - Konzept und Umsetzungeiner cluster-randomisierten Studie zur Demenzversorgungim hausärztlichen Bereich. Z Arztl Fortbild Qualitätssich2007;101:21—6.