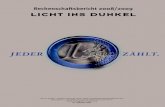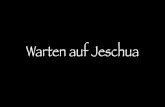Strategische Rohstoffe - warten bis es dunkel wird?
Transcript of Strategische Rohstoffe - warten bis es dunkel wird?
�Chemiewirtschaft�
Strategische Rohstoffe – warten bis es dunkel wird?
Rolf Jakobi
Abbauwürdige Metallvorkommen befinden sich überwiegend in Staaten, deren Wohlverhalten oder
deren politische Stabilität nicht sicher ist. Die Politik begreift nur langsam den Ernst der Lage und hofft
auf die Selbstorganisation der Wirtschaft. Einer Erpressung durch die Rohstoffstaaten haben einzelne
Länder und erst recht Unternehmen nichts entgegenzusetzen.
� Strategisch wichtige Rohstoffe sind solche, die für die Herstellung moderner Produkte wie Elektronik, Hochleistungswerkstoffe, medizi-nische Geräte oder Wehrtechnik als derzeit nicht substituierbar gelten. Auch wenn der Materialanteil oft ge-ring ist, sie sind unverzichtbar. Hier-zu gehören neben den Edelmetallen vor allem die Seltenen Erden und Legierungsmetalle wie Wolfram, Niob und Vanadium. Schätzungen des Umweltbundesamts sagen bei-spielsweise für Germanium, Gallium und Indium Versorgungslücken in-nerhalb der nächsten Jahrzehnte vo-
raus.1) Die metallischen Rohstoffe werden schneller erschöpft sein als Erdöl und Gas.
Würde die Versorgung unter-brochen, hätte dies nicht nur kata-strophale Folgen für die Industrie, sondern auch für sämtliche moder-nen Verteidigungssysteme. Die Hoffnung, dass die nationale Ver-sorgung durch höhere Zahlungs-bereitschaft gesichert werden könnte, ist reines Wunschdenken. Gerade in jüngster Zeit hat Japan dies durch den chinesischen Lie-ferstopp bei Seltenen Erden erfah-ren müssen.2)
Verfügbare Ressourcen
� Die Datenlage über Fördermen-gen, bekannte Ressourcen und ge-schätzte Reserven ist bei den metalli-schen Rohstoffen intransparent. Auch Angebot und die Nachfrage sind weltweit schwierig zu ermit-teln, da nicht unbedeutende Mengen über den Schwarzmarkt laufen.3) Die wohl umfangreichste Datensamm-lung hat derzeit die US Geological Society.4)
Primärdaten finden sich vorwie-gend bei den nationalen geologi-schen Instituten.5) Auf EU-Ebene wurden einige Arbeiten über die Vorkommen strategischer Rohstoffe in Auftrag gegeben, deren Mengen-angaben jedoch ebenfalls überwie-gend grobe Schätzungen sind.6–7) Die Fraunhofer-Institute IZT und ISI veröffentlichten ein umfangreiches Werk, welches die Einsatzgebiete strategischer Rohstoffe be-schreibt.8–9)
Zudem gibt es kaum verlässliche Angaben über Recyclingmengen. Es mangelt an der entsprechenden Lo-gistik und an wirtschaftlichen Me-thoden der Rückgewinnung. Es ist zu befürchten, dass der Elektronik-schrott bezüglich der Selten-Erd-Metalle nicht aufgearbeitet wird, sondern auf unbekannten Deponien oder in Schlacken verschwindet. Im-
Abb. 1. Oberflächennaher Tagebau der Tsumeb Mine in Namibia: Die polymetallische
Vererzung (Pb, Zn, Cu, Ge, Ga, Cd, As) wurde bis zum Jahr 1996 bis in 1500 m Teufe
abgebaut. (Foto: BGR Hannover)
440
Nachrichten aus der Chemie | 59 | April 2011 | www.gdch.de/nachrichten
merhin hat in jüngster Zeit die EU-Kommission ein Recycling dieser wichtigen Rohstoffe angemahnt.10)
Das Bundeswirtschaftsministeri-um hat eine Deutsche Rohstoffagen-tur gegründet,11) die vorerst beim Bundesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe angesiedelt ist.12) Pri-märe Aufgaben werden wohl die Da-tenerfassung und ein Statusbericht sein.
Das privatwirtschaftliche Unter-nehmen Deutsche Rohstoff möchte unterdessen mit der erneuten Er-schließung aufgegebener Rohstoff-quellen beginnen, die angesichts steigender Preise wieder wirtschaft-lich arbeiten könnten. Dazu hat das Unternehmen unter anderem in Sachsen mehrere Lizenzen erwor-ben. Mit einer Ausstattung von nur etwa 11 Millionen Euro Grundkapi-tal14) ist das Vorhaben allerdings er-klärungsbedürftig.
Hingegen hat die Mountain-Pass Mine (Molycorp) in Kalifor-nien, welche die Förderung von Seltenen Erden im Jahr 2002 we-gen Umweltproblemen und man-gelnder Wirtschaftlichkeit schloss, im letzten Jahr den Betrieb wieder aufgenommen und die dazu nöti-gen Bewilligungen erhalten. Die neue Unternehmensstrategie „mi-ne-to-magnets“ sieht die Weiter-verarbeitung eines Teils der Metall-oxide zu Permanentmagneten vor. Die geplante Fördermenge liegt bei etwa 20 000 Tonnen der Selten-Erd-Oxide, hauptsächlich Cer, Lanthan, Praseodym und Neo-dym.14) Auch bereits geschlossene amerikanische und australische Minen werden derzeit auf eine Neueröffnung hin geprüft. Dies ist auch in Afrika nicht auszuschlie-ßen (Abbildung 1).
Diese Maßnahmen erscheinen jedoch nicht ausreichend, um sich aus einer Abhängigkeit von chinesi-schen Ressourcen an Seltenen Er-den zu befreien. Je nach Quelle sol-len bis über 90 Prozent davon in China liegen.15) Neue Konzepte zum Recycling sind daher dringend erforderlich, damit wenigsten die schon geförderten und aufbereite-ten Metalle im Produktkreislauf
wieder zur Verfügung stehen. Wenn es ferner gelingt, Substitute zu fin-den, könnte sich die Lage etwas entspannen.
Abhängigkeit und Szenarien
� Die Konzentration der Rohstoff-ressourcen und damit die Abhängig-keit von einigen Ländern beschreibt der Herfindahl-Index.16) Dieser In-dex ist ein Maß für die Ungleichver-teilung der Ressourcen. Die Tabelle zeigt Germanium und dessen welt-weite Produktionsmengen. Der Her-findahl-Index errechnet sich daraus wie folgt:
Aus der totalen Produktionskapa-zität von 218 Jahrestonnen17) wer-den die länderspezifischen Quotien-ten ci berechnet und die Quadrate derselben addiert. Es ergibt sich:
mit c1 = 100/218; c2 = 65/218 etc. und c1
2 = 0,2104, c22 = 0,0889 etc.
Ab Hi 6 0,18 spricht man von ei-ner erheblichen Ungleichverteilung, was in diesem Beispiel eine starke
Abhängigkeit von China bedeutet. Es lassen sich nun vier Szenarien er-stellen: • China nutzt seine dominierende
Stellung aus und kürzt die Expor-te von Seltenen Erden. Damit kommen westliche Unternehmen in die Zwangslage, explodierende Preise akzeptieren und an die Ver-braucher weiterzugeben zu müs-sen oder ihre Produktion zu schließen. Als einziger Ausweg bliebe, in China selbst zu pro-duzieren.
• China bildet mit weiteren Län-dern ein Kartell für strategische Rohstoffe ähnlich der Opec und bestimmt damit erst recht das Ge-schehen.
Produktionsmengen des
Halbleitermetalls Germanium.
Land Menge [jato] China 100 USA 65 Ukraine 20 Mexiko 10 Kanada 10 Usbekistan 6 Russland 5 Kongo 2
Abb. 2. Weltproduktionsanteile, abhängig vom Korruptionsindex des Haupteignerlands der
Rohstoffe. Je höher der Index, desto geringer ist die wahrgenommene Korruption.
3133,08
1
2)(
n
iiGei CH
Nachrichten aus der Chemie | 59 | April 2011 | www.gdch.de/nachrichten
Chemiewirtschaft �Blickpunkt� 441
• China stoppt die Exporte und kauft die restlichen Märkte leer, insbesondere in Afrika, um den ei-genen Rohstoffhunger zu stillen.
• Der Westen bildet eine suprana-tionale Rohstoffagentur und da-mit zumindest ein organisatori-sches Gegengewicht zu China. Gleichzeitig müssen alle Kräfte gebündelt werden, um neue eige-ne und fremde Quellen langfristig zu erschließen.
Leider sind die potenziellen Vertrags-staaten nicht immer zuverlässig und deren Regierungen nicht immer von politischer Stabilität geprägt. Nimmt man den internationalen Korrupti-onsindex (corruption perception in-dex, CPI)18) als Kriterium, lässt sich das Versorgungsrisiko zumindest schätzen (Abbildung 2).19)
Wie die Knappheit oder der Aus-fall eines strategisch wichtigen Roh-stoffs wirkt, zeigt das Beispiel Indi-um. Als Indiumzinnoxid (indium tin oxide, ITO) steckt Indium in fast al-len elektronischen Anzeigeelemen-ten, Computerbildschirmen, in Touch screens und vielen Solarpa-nels. Aus etwa 600 Kilogramm Jah-resproduktion Indium ergibt sich bei den Endgeräten, die solche Bauteile enthalten, für die Summe aus Kon-sumgüterelektronik und Industrie-anwendungen ein Wert von ge-schätzt etwa 3,4 Billionen Dollar.20)
Diese Schätzung beruht auf dem Marktvolumen für Anzeigeelemente (Abbildung 3, mittlere Spalte) und in deren Folge auf dem kumulierten Volumen der Geräte, die wahr-scheinlich solche Anzeigeelemente enthalten. Wenn auch inhaltlich in winzigen Mengen, beeinflusst Indi-um durch seine extreme Verbreitung in der Elektronik dennoch ein Ge-schäftsfeld in Billionenhöhe. Ein Ausfall hätte dramatische Folgen.
Was zu tun ist
� Die einseitige Konzentration der westlichen Politik auf CO2-Emis-sionen und fossile Rohstoffe ist ge-fährlich und blendet näher liegende Gefahrenpotenziale aus. Eine euro-päische konzertierte Rohstoffpoli-tik mit einer supranationalen Roh-
stoffagentur erscheint dringend notwendig. Eine Rohstoffbörse, zu der nur Industrieunternehmen Zu-gang haben, die diese Materialien benötigen, würde zumindest speku-lative Preisverzerrungen ausschlie-ßen.
Als kurzfristige Maßnahme ist ferner angeraten, ähnlich dem Erd-ölbevorratungsgesetz21) oder dem US Stockpiling Act22) Pflichtreserven zu bilden, um die Wirtschaft vor Versorgungsausfällen zu schützen.
Geeignete logistische Recycling-verpflichtungen sollten per Gesetz in die Elektroschrottverordnung ein-gearbeitet werden.
Eine langfristige Lösung aus der Abhängigkeit von einzelnen Staaten jedoch muss durch eine reaktions-schnellere Außenpolitik unterstützt werden.
Rolf Jakobi vom Transferzentrum CER, Zürich,
studierte Chemie an der TU Darmstadt und
promovierte am Deutschen Kunststoff-Insti-
tut. Seit 1995 hat er eine Professur für interna-
tionales Management inne, zunächst an der
FH Hof, seit 2002 an der FH Ludwigshafen. Er
ist im erweiterten Vorstand der GDCh-Vereini-
gung für Chemie und Wirtschaft und forscht
zu Ressourcenmanagement..
Literatur
1) S. Berendt, M. Scharp et. al. in UBA For-
schungsbericht 363 01 124, 03/2007.
2) Le Monde Diplomatique (deutsche
Ausg.)12.11.2010.
3) M. Kamp, Schwarzmarkt in Wirtschafts-
woche 13.01. 2011.
4) www.usgs.gov
5) BGR Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe: Rohstoffwirtschaftli-
che Steckbriefe für Metall- und Nicht-
metallrohstoffe 01/2007.
6) European Commission: Critical Raw Ma-
terials fort he EU; June 2010.
7) Annex V to the Report of the ad-hoc Wor-
king Group on defining critical raw mate-
rials; June 2010.
8) Forschungsprojekt 09/2005 des BMWi: Ge-
meinschaftspublikation BGR, ISI und RWI;
Trends der Angebots- und Nachfragesi-
tuation bei mineralischen Rohstoffen.
9) G. Angerer et. al.; Fraunhofer-Institut für
System- und Innovationsforschung ISI:
Rohstoffe für Zukunftstechnologien, 2009.
10) EU Commission 02.02.2011; Tackling the
Challenges in Commodity Markets and
on Raw Materials.
11) BMWi, Pressemitteilung vom 04.10.2010;
Brüderle gibt Startschuss für Deutsche
Rohstoffagentur.
12) Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe; www.bgr.bund.de
13) Halbjahresbericht 2010, Deutsche Roh-
stoff; www.rohstoff.de
14) Cathy Proctor in Denver Business Journal,
13.12. 2010.
15) M. Rennberg; Homepage Landesfachaus-
schusses Außen- & Sicherheitspolitik der
FDP Rheinland-Pfalz, 06.01. 2011.
16) http://en.wikipedia.org/wiki/Herfin
dahl_index
17) BGR Commodity Top News Ausg. 33/09.
18) CPI siehe Transparency International,
www.transparency.org
19) Steinbeis Transfer Zentrum CER Chemical
Economics Research Zürich, 08/2010.
20) ibid 01/2011, Schätzung von CER mit Da-
ten ZVEI in Wirtschaftspolitik, Konjunktur
und Märkte Ausg. Mai 2010.
21) neugefasst durch Bek. v. 06.04.1998 I
679; zuletzt geändert durch Artikel 165
V. v. 31.10.2006 BGBl. I S. 2407; Geltung
ab 01.04.1988.
22) Act 50 U.S.C. 98h-2(a); www.globalsecuri
ty.org/military/agency/dod/dnsc.htm.
Abb. 3. Indium in der Wertschöpfungskette.
�Blickpunkt� Chemiewirtschaft 442
Nachrichten aus der Chemie | 59 | April 2011 | www.gdch.de/nachrichten