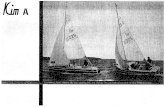ZFA 03 2018 - online-zfa.de · Typ-1-(H1-) und Histaminrezeptor-Typ-2-(H2-)Blockern der zweiten...
Transcript of ZFA 03 2018 - online-zfa.de · Typ-1-(H1-) und Histaminrezeptor-Typ-2-(H2-)Blockern der zweiten...
Z FAZeitschrift für Allgemeinmedizin
German Journal of Family Medicine
März 2018 – Seite 97-144 – 94. Jahrgang www.online-zfa.de
3 / 2018
Organ der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), der Gesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin (GHA), der Niederösterreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (NÖGAM), dem Österreichischen Institut für Allgemeinmedizin (ÖIfAM), der Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SAGAM), der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin (STAFAM), der Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SüGAM), der Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (TGAM) und der Vorarlberger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (VGAM)
Official Journal of the German College of General Practitioners and Family Physicians, the Austrian Institute of General Practitioners, the Lower Austrian College of General Practitioners, the Salzburg Society of Family Medicine, the Society of Professors of Family Medicine, the Southtyrolean College of General Practitioners, the Styrian College of General Practitioners, the Tyrolean College of General Practitioners and the Vorarlberg Society of Family Medicine
This journal is regularly listed in EMBASE/Excerpta Medica, Scopus and CCMED/LIVIVO
DP AG Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt – 4402 – Heft 3/2018 Deutscher Ärzteverlag GmbH – Postfach 40 02 65 – 50832 Köln
Im Fokus
Antihistaminika bei Histaminunverträglichkeit?
Menschen mit seltenen Erkrankungen
Fehlermanagement
Ethische Fallbesprechungen
Beendigung der Sondenernährung in einer Pflegeeinrichtung?
Leitlinie Nackenschmerzen
Spezialistische Versorgung
/präsentiert DGIM Jahrestagung 2018
moc – Ihre Online-Plattform für Kongressdokumentation zum 124. Kongress derDeutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. in Mannheim vom 14.04. bis 17.04.2018
Ein Produkt von
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos mit dem Code DGIM2018 auf www.moc-dgim.de
In Zusammenarbeit mit
// Komfortable Suchfunktion
// Interessante redaktionelle Beiträge
// Kongressarchiv von 2013 – 2017
// Hochwertig produzierte Webcasts
// Verfügbarkeit unmittelbar nach Kongressende
// Vorträge jederzeit abrufbar
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Jetztkostenlos
registrieren und
nichts verpassen:
www.moc-dgim.de
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
97EDITORIAL / EDITORIAL
Ans Herz gelegt: Automatisierte Externe Defibrillatoren (AEDs)
Es ist fast ein Jahr her, aber vielleicht werden manche Leserinnen und Leser sich noch an das Editorial aus Heft 4/2017 erinnern: Un-ter dem Titel „Kommt ein
Vogel geflogen“ hatte ich ein nicht allzu fernes Zukunfts-szenario beschrieben, bei dem es um per Drohnen an-gelieferte automatisierte externe Defibrillatoren (AED) ging.
An der Epidemiologie des Herzstillstandes außer-halb des Krankenhauses
(OHCA = out-of-hospital-cardiac-arrest) hat sich nichts geän-dert: Er gehört in Europa mit jährlich 300.000 Fällen und einer Mortalität von fast 90 % unverändert zu den häufigsten Todes-ursachen. Die im damaligen Editorial berichtete westschwedi-sche Studie berichtete von 24 % der betroffenen Patienten, die an Kammerflimmern litten. Laut vorliegenden internationalen Daten sind es jedoch an die 60 % der an öffentlichen Plätzen auftretenden OHCAs, die durch den Stromstoß eines Defibril-lators zu behandeln wären. Zu ergänzen wäre an dieser Stelle, dass die meisten Herzstillstände in privaten Wohnungen auf-treten; dort ist in den seltensten Fällen ein AED verfügbar. Hier können die Angehörigen nach Absetzen eines Notrufes „nur“ eine umgehende Herzmassage (bei Erwachsenen: ohne Beat-mung!) beginnen.
Die zunehmende Verfügbarkeit von AEDs an öffentlichen Plätzen wie Sportstadien, Bahnhöfen, Flughäfen oder Einkaufs-zentren hat klare Vorteile: In einer solchen Situation, in der je-de Minute zählt, kommen die Geräte (im optimalen Falle) oft schneller zum Einsatz als der Notarzt vor Ort ist. In der o.g. schwedischen Studie betrug die 30-Tage-Überlebenszeit für Pa-tienten nach Notarztwageneinsatz 31 %, für die vorher mit ei-nem lokalen AED behandelten Personen aber 70 %!
Ein bereits seit Jahren bestehender Zusammenschluss von sechs US-amerikanischen und drei kanadische Regionen (ROC = Resuscitation Outcomes Consortium) hat soeben seine
Vergleichsdaten von 2011 bis 2015 publiziert: Defibrillation durch Passanten versus geschulte Rettungsdienste (in Nord-amerika meist ohne begleitenden Arzt).
In den vier Jahren gemeinsamer prospektiver Erfassung und Auswertung der Daten ergaben sich 49.555 Fälle von Herz-stillstand außerhalb des Krankenhauses. 4.115 davon trugen sich in der Öffentlichkeit zu, von denen knapp 63 % defibril-lierbar waren. Primärer Endpunkt war ein normaler funktionel-ler Status bei Entlassung aus stationärer Behandlung (Rankin Score gleich oder kleiner als 2); sekundärer Endpunkt war das Überleben bis zur Entlassung.
Nach Ausschluss von u.a. fehlenden Datenbögen wurden 2500 Personen defibrilliert: 469 (18,8 %) von anwesenden Lai-en und 2031 (81,2 %) vom Rettungsdienst. Den primären End-punkt (funktioneller Status, Rankin-Score < 2) erreichten 57,1 % der „laienreanimierten“ und 32,7 % der „professionell reanimierten“ Patienten – ein hochsignifikanter Unterschied. Ähnlich war die Differenz für das Überleben bis zur Kranken-hausentlassung: 66,5 % vs. 43 %.
Aus den Daten geht klar hervor, dass die Effektivität des Ret-tungsdiensteinsatzes direkt mit der Länge der Anfahrtszeit zusam-menhing (je länger die Anfahrt, desto schlechter das Ergebnis).
In Schweden wird Laien immer wieder ein Training im Be-dienen eines AEDs angeboten, was von der Bevölkerung auch sehr positiv angenommen wird. Ärztinnen und Ärzte sollten dem natürlich nicht nachstehen ...
Es ist keine Schande, wenn man ein solches Gerät noch nie gesehen oder betätigt hat. Im Netz gibt es etliche, sehr instruk-tive Videos von wenigen Minuten Dauer: Wenn Sie z.B. in you-
tube nach „Wiederbelebung mit dem AED“ suchen, werden Sie schnell fündig. Für Smartphones gibt es entsprechende Apps, z.B. die „Rot Kreuz Defi und Notruf App“ des Bayerischen Roten Kreuzes, die sowohl einen sofortigen Notruf erlaubt als auch die verfügbaren AEDs in der Nähe Ihres aktuellen Standortes anzeigt (natürlich auch außerhalb Bayerns ...). Weitere Apps werden zunehmend auch von Städten und Regionen angebo-ten – so z.B. von Hamburg, Schleswig-Holstein oder Graz.HerzlichstIhr
Michael M. Kochen
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
98
ZFAZeitschrift für Allgemeinmedizin
Organ der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), der Gesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin (GHA), der Niederösterreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (NÖGAM), dem Österreichischen Institut für Allgemeinmedizin (ÖIfAM), der Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SAGAM), der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin (STAFAM), der Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SüGAM), der Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (TGAM), der Vorarlberger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (VGAM)
Official Journal of the German College of General Practitioners and Family Physicians, the Austrian Institute of General Practitioners, the Lower Austrian College of General Practitioners, the Salzburg Society of Family Medicine, the Society of Professors of Family Medicine, the Southtyrolean College of General Practitioners, the Styrian College of General Practitioners, the Tyrolean College of General Practitioners, the Vorarlberg Society of Family Medicine
Herausgeber/EditorsM. M. Kochen, Freiburg (federführend)H. Kaduszkiewicz, KielW. Niebling, FreiburgS. Rabady, WindigsteigA. Sönnichsen, Witten
Internationaler Beirat/International Advisory Board J. Beasley, Madison/Wisconsin, USA; F. Buntinx, Leuven/Belgien; G.-J. Dinant, Maastricht/NL; M. Egger, Bern/CH; E. Garrett, Columbia/Missouri, USA; P. Glasziou, Robina/Australien; T. Greenhalgh, London/UK; P. Hjortdahl, Oslo/Norwegen; E. Kahana, Cleveland/Ohio, USA; A. Knottnerus, Maastricht/NL; J. Lexchin, Toronto/Ontario, Kanada; C. del Mar, Robina/Australien; J. de Maeseneer, Gent/Belgien; P. van Royen, Antwerpen/ Belgien; F. Sullivan, Toronto/Ontario, Kanada; C. van Weel, Nijmegen/NL; Y. Yaphe, Porto/Portugal
Koordination/Coordination J. Bluhme-Rasmussen
This journal is regularly listed in EMBASE/Excerpta Medica, Scopus and CCMED/LIVIVO
Dieselstraße 2, 50859 KölnPostfach/P.O. Box 40 02 54,50832 KölnTelefon/Phone: (0 22 34) 70 11-0www.aerzteverlag.dewww.online-zfa.de
EDITORIAL / EDITORIAL 97..............................................................
EBM-SERVICE / EBM SERVICEAntihistaminika bei Histaminunverträglichkeit?Antihistamines in Histamine Intolerance?Anna Vögele 99..........................................................................................
DEGAM-BENEFITS / DEGAM BENEFITS 102......................................
ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPERMenschen mit seltenen Erkrankungen in der HausarztpraxisPeople with Rare Diseases in the Family PracticeAnne Lutz, Ute Schaaf, Marco Roos 104............................................................
ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPERFehlermanagement in der ambulanten PraxisError Management in Outpatient Settings Dania Gruber, Tatjana Blazejewski, Martin Beyer, Hardy Müller, Ferdinand M. Gerlach, Beate S. Müller 110.........................................................
ÜBERSICHT / REVIEWEthische Fallbesprechungen in der hausärztlichen Versorgung: Ein Leitfaden für die PraxisEthical Case Discussions in Family Medicine: a Guidance for Ambulatory Practice Georg Marckmann, Birgitta Behringer, Jürgen in der Schmitten 116............................
FALLBERICHT / CASE REPORTBeendigung der Sondenernährung in einer Pflegeeinrichtung: Eine ethische FalldiskussionTerminating Tube Feeding in the Nursing Home: an Ethical Case DiscussionGeorg Marckmann, Birgitta Behringer, Jürgen in der Schmitten 121............................
DEGAM-LEITLINIE / DEGAM GUIDELINENackenschmerzen ................................................................................125
ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPERAmbulante spezialfachärztliche Versorgung: Erste Erfahrungen von Patienten und HausärztenSpecialized Outpatient Care: First Experiences of Patients and Family PractitionersFlorian Kaiser, Ulrich Kaiser, Daniela Utke, Stefanie Schattenkirchner, Ursula Vehling-Kaiser 128.............................................................................
DER BESONDERE ARTIKEL / SPECIAL ARTICLEAllgemeinmedizinische Weiterbildung in England: Austausch mit dem Hippokrates-ProgrammFamily Medicine Vocational Training in England: Hippokrates Exchange ProgramMadeleine Kiderle 134..................................................................................
LESERBRIEFE / LETTERS TO THE EDITOR 140................................
DEGAM-NACHRICHTEN / DEGAM NEWS 142...................................
DEUTSCHER HAUSÄRZTEVERBAND / GERMAN ASSOCIATION OF FAMILY PHYSICIANS 143....................
IMPRESSUM / IMPRINT 144...............................................................
Titelfoto: Marlie-Luise Bertram
INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
99EBM-SERVICE / EBM SERVICE
Antihistaminika bei Histaminunverträglichkeit?Antihistamines in Histamine Intolerance?Anna Vögele1
FrageProfitiert eine Patientin mit Histaminunverträglichkeit von einer Einnahme von oralen Antihistaminika?
AntwortEin Nutzen von oral eingenommenen Antihistaminika bei vermuteter Histaminunverträglichkeit ist durch die derzeit verfügbare wissenschaftliche Evidenz nicht belegt. Aus dem Wirkmechanismus der Medikamente und einzelnen unkontrollierten Beobachtungsstudien ergibt sich jedoch, dass sie zur Behandlung einzelner Symptome der Histamin -unverträglichkeit geeignet sein könnten – zumindest im Rahmen akuter Belastungen (massive Diätfehler, z.B. bei Feierlichkeiten, Rotweinkonsum oder Scombroidvergif-tung2). Es erscheint daher gerechtfertigt, Patienten mit ei-ner vermuteten Histaminunverträglichkeit versuchsweise über einen definierten Zeitraum mit Histaminrezeptor-Typ-1-(H1-) und Histaminrezeptor-Typ-2-(H2-)Blockern der zweiten oder dritten Generationen zu behandeln, um zu überprüfen, ob sich das Beschwerdebild verändert.
Hintergrund
Unter Histaminunverträglichkeit ver-steht man im Allgemeinen eine Unver-träglichkeit von Histamin, welches durch die Nahrung aufgenommen wird. Die Symptome sind sehr vielfältig und reichen von klassischen Symptomen wie zum Beispiel plötzlichen Hautrötun-gen (Flush-Symptomatik), Juckreiz, Übelkeit, Diarrhoe, Kopfschmerzen und abdominalen Schmerzen bis hin zu re-spiratorisch kardiovaskulären Sympto-men wie Blutdruckabfall, Tachykardie oder Schwindel [1–3]. Laut Schätzungen sind 1–2 % der Bevölkerung von His-taminunverträglichkeit betroffen, wo-bei die Dunkelziffer um einiges höher zu liegen scheint [1]. Histamin ist ein bio-genes Amin und kommt endogen vor-
wiegend in Mastzellen und Basophilen vor. Es ist einer der wichtigsten Mediato-ren von Immunglobulin(Ig)E- und nicht-IgE-vermittelten klinischen Reak-tionen. Der Pathomechanismus der His-taminunverträglichkeit ist bislang nur unzureichend erklärt. Postuliert wird ein Mangel der histaminabbauenden Enzyme Diaminoxidase (DAO) und/oder Histamin-N-Methyltransferase (HNMT) bzw. ein Missverhältnis zwi-schen Zufuhr und Abbau des Histamins [2].
Wir wollen im Folgenden nun der Frage nachgehen, ob orale Antihistami-nika, die verschiedene Histaminrezepto-ren im Körper blockieren oder antagoni-sieren, Patienten mit Histaminunver-träglichkeit einen Nutzen bringen kön-nen.
Suchbegriffe
• Leitlinien und sekundäre Datenban-ken: histamin* OR intolerance
• PubMed: histamine intolerance [TIAB] AND antihistamine*
Ergebnisse
Leitlinien
In der Leitlinien-Datenbank der AWMF (Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlich Medizinischer Fachgesellschaften) wird auf die aktuelle Leitlinie zum Vorgehen
bei Verdacht auf Unverträglichkeit gegen-
über oral aufgenommenem Histamin ver-wiesen [4]. Diese Leitlinie wurde von der Deutschen Gesellschaft für Allergologie
QuestionDoes a patient affected from histamine intolerance bene-fit from oral intake of antihistamines?
AnswerEffectiveness of oral intake of antihistamines in patients with suspected histamine intolerance can not be proven by the currently available scientific evidence. According to the mechanism of action of antihistamines, they could be effective in the treatment of specific symptoms of his-tamine intolerance – at least in the context of acute events (massive dietary errors, e.g. at festivities, after red wine consumption or in case of scombroid poisoning2). Depending on the clinical symptoms, it could be at-tempted to treat patients with suspected histamine intol-erance for a determined period of time with histamine re-ceptor type 1 (H1) and histamine receptor type 2 (H2) blockers of the second or third generation to check whether the clinical picture changes.
1 EbM-Team der SAkAM (Südtiroler Akademie für Familienmedizin), Bozen2 Vergiftung durch verdorbenen Fisch, Scombridae = z.B. Thunfisch oder Makrele. Poisoning resulting from eating spoiled (decayed) fish,
scombridae = e.g. tuna or mackerel.
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
100 EBM-SERVICE / EBM SERVICE
und klinische Immunologie (DGAKI), der Gesellschaft für Pädiatrische Allergo-logie und Umweltmedizin (GPA) und dem Ärzteverband Deutscher Allergolo-gen (ÄDA) 2017 herausgegeben. In die-ser Leitlinie wird festgehalten, dass es als pragmatisches Vorgehen denkbar sei, Patienten mit einer vermuteten His-taminunverträglichkeit über einen defi-nierten Zeitraum mit Histaminrezeptor-Typ-1-(H1-) und Histaminrezeptor-Typ-2-(H2-)Blockern zu behandeln, um zu überprüfen, ob sich das Beschwerdebild verändert. Doppelblinde placebokon-trollierte prospektive Studien zur Wirk-samkeit von H1-/H2-Rezeptorblockern bei einer Unverträglichkeit von exogen zugeführtem Histamin liegen jedoch nicht vor. Die Autoren schreiben, dass es sich aus dem Wirkmechanismus der Me-dikamente ergebe, dass sie zur Behand-lung einzelner Symptome (z.B. Flush durch H1-Blocker oder Übelkeit/Erbre-chen durch H2-Blocker) geeignet sein sollten – zumindest im Rahmen akuter Belastungen (massive Diätfehler, z.B. bei Feierlichkeiten, oder Scombroidvergif-tung2) [5–7].
In den folgenden Datenbanken fan-den sich keine Leitlinien zum Thema: SNLG (Sistema Nazionale Linee Guida, ISS), NVL (Nationale Versorgungsleit-linien), DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familien-medizin), SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network), NICE (National Institute for Health and Care Excellence, London), NZGG (New Zealand Guideli-nes Group), NHMRC (National Health and Medical Research Council Aust-ralia), NCG (National Guideline Clea-ringhouse; Rockville, USA), CMA Info-base (Canadian Medical Association).
Sekundäre Datenbanken
In den finnischen EbM-Guidelines (The
Finnish Medical Society Duodecim) findet sich eine Leitline mit dem Titel Food al-
lergy and hypersensitivity in children von 2017 [8]. In dieser wird eine Unverträg-lichkeit auf biogene Amine bzw. His-tamin in Nahrungsmitteln angeführt. Antihistaminika als Behandlungsmaß-nahme werden jedoch nur bei allergi-schen Reaktionen auf Nahrungsmittel in der Akutbehandlung empfohlen.
In UpToDate findet sich eine Arbeit mit dem Titel Food intolerance and food
allergy in adults: An overview von 2017, in
der die Histaminintoleranz unter den „nicht bewiesenen Nahrungsmittelinto-leranzen“ geführt wird, sprich unter Nahrungsmittelintoleranzen, die nicht ausreichend durch wissenschaftliche Evidenz untermauert bzw. begründet sind. Es heißt weiter, dass es sinnvoll wä-re, Studien durchzuführen zu nicht-se-dierenden H1- und H2-Antihistaminika bei gastrointestinalen Symptomen bei Patienten, die eventuell unter Histami-nunverträglichkeit leiden. Es werden aber keine Studien zu dieser Thematik erwähnt oder identifiziert.
In der Cochrane Database of Syste-matic Reviews, der Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), in Clinical Evidence und der CDR Database (Centre for Reviews and Dissemination, Univer-sity of York, Institute for Health Re-search, NHS) fanden sich keine Arbeiten zum Thema.
Primäre Datenbank: PubMed
In PubMed ergab die Suche mit dem o.g. Suchbegriff fünf Treffer. Keiner davon war eine systematische Übersichtsarbeit oder randomisiert kontrollierte Studie. Zwei Arbeiten bezogen sich nicht auf unser Thema. Die drei verbleibenden werden im Folgenden behandelt [2, 9, 10].
In einem Übersichtsartikel (Review) mit dem Titel Histamine and histamine
intolerance von 2007 [2] schreiben die Autoren Folgendes: „Die Einnahme von histaminreichen Nahrungsmitteln, Al-kohol oder Medikamenten, die His-tamin freisetzen oder die DAO hemmen, können bei Patienten mit Hisatminun-verträglichkeit Kopfschmerzen, Diar-rhoe, rhinokonjunktivale Symptome, Asthma, Hypotension, Arrhythmien, Urticaria, Pruritus, Flush-Symptomatik und andere Beschwerden auslösen. Die-se Symptome können durch eine his-taminfreie Diät vermindert oder durch die Einnahme von Antihistaminika eli-miniert werden.“ Sie schreiben weiter, dass bei einer strikt eingehaltenen his-taminfreien Diät die Einnahme von An-tihistaminika keine weiteren Vorteile bringe.
Unter den einzelnen Kapiteln wird noch einmal:• die Besserung von Kopfschmerzen
durch Antihistaminika erwähnt. – Diese Aussage stützen die Autoren
auf eine Studie von Krabbe und Ole-
sen aus dem Jahr 1980 [11], in wel-cher drei Patientengruppen His-tamin i.v. zur Provokation von Kopf-schmerzen verabreicht wurde: erste Gruppe 13 Patienten ohne Kopf-schmerzen, zweite Gruppe zehn Pa-tienten mit chronischem Span-nungskopfschmerz, dritte Gruppe 25 Migränepatienten. In der ersten Gruppe entwickelte keiner der Pa-tienten Kopfschmerzen, in der zwei-ten Gruppe entwickelten alle Teil-nehmer pulsierende Kopfschmerzen und in der dritten Gruppe entwickel-ten 13 Patienten schwere, 9 Patien-ten mäßige und 2 Patienten milde pulsierende Kopfschmerzen. Eine Injektion mit dem H1-Blocker Me-pyramin beendete die Kopfschmer-zen laut den Autoren sofort („almost immediately“). Der H2-Blocker Ci-metidin war weniger effektiv, schnitt jedoch deutlich besser ab als Placebo. Zu dieser Arbeit ist zu sa-gen, dass es sich bei den beiden ver-wendeten Wirkstoffen um Antihis-taminika der ersten Generation han-delt, deren Gebrauch aufgrund star-ker Nebenwirkungen heute obsolet geworden ist.
• die Besserung nach Antihistaminika-gabe von Flush-Symptomatik, Kopf-schmerz, Niesen, Asthmaanfällen und anderen anaphylaktoiden Reaktionen, die durch Rotweinkonsum hervor-gerufen werden, erwähnt. Die Autoren verweisen hier auf drei Arbeiten der Autoren Wantke, Götz und Jarisch (bei der letzten hier angeführten Arbeit war Götz nicht beteiligt):– In einer unkontrollierten Beobach-
tungsstudie aus dem Jahr 1993 [12] wurde eine histaminfreie Diät als In-tervention an Patienten mit Hista -minunverträglichkeit untersucht. Die Symptome, die bei sechs Teilneh-merinnen nach Diätfehlern auftra-ten, waren durch Gabe der Antihis-taminika Terfenadin und Loratadin reversibel.
– In einer Interventionsstudie aus dem Jahr 1994 [13] wurden 22 Patienten, welche nach Rotweinkonsum erhöh-te Plasma-Histaminwerte aufwiesen und Symptomatik entwickelten, nach einer Prämedikation mit dem Antihistaminikum Terfenadin einer neuerlichen Rotweinprovokation unterzogen. Laut den Autoren elimi-nierte die Terfenadin-Gabe bei 10
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
101EBM-SERVICE / EBM SERVICE
von 12 Patienten die Symptome mit statistischer Signifikanz (p < 0,05).
– In einer Übersichtsarbeit von 1996 [9] wird eine Therapie mit Antihis-taminika bei Kopfschmerzen, die bei Patienten mit Histaminunverträg-lichkeit nach Rotweinkonsum auf-treten, empfohlen. Neben einer his-taminfreien Diät wird auch die Ein-nahme von einem H1-Antihistami-nikum für 14 Tage empfohlen. Ob sich diese Aussage auf wissenschaftli-che Erkenntnisse/Literatur stützt, ist nicht klar.
In einem Übersichtsartikel von Götz aus dem Jahr 1996 [10] wird beschrieben, dass die Diagnosestellung der Histamin -unverträglichkeit klinisch durch das Vorhandensein von chronischen Kopf-schmerzen, Diarrhoe, Erbrechen, Flush-Syptomatik, Urticaria, asthmaähnlichen Symptomen, Rhinitis u.a. erfolgt. His-taminarme Nahrungsmittel und bei Be-
darf zusätzlich H1-Antihistaminika seien effiziente Maßnahmen bei Histaminun-verträglichkeit. Auch bei dieser Aussage ist unklar, ob und ggf. auf welcher Art wissenschaftlicher Literatur sie basiert.
Kommentar
Die wissenschaftliche Evidenz zum The-ma Histaminunverträglichkeit ist all-gemein sehr spärlich. Noch spärlicher finden sich wissenschaftliche Artikel zu einer eventuellen Behandlung von His-taminunverträglichkeit mit Antihistami-nika, doppelblinde placebokontrollierte Studien zur Wirksamkeit von H1-/H2-Re-zeptorblockern zur Linderung der Symp-tomatik fehlen gänzlich. Die wenigen vorhandenen Studien sind Beobach-tungsstudien und Interventionsstudien ohne Kontrollgruppe. In den vorhande-nen Übersichtsartikeln werden Exper-tenmeinungen geäußert, von denen
nicht klar ist, ob und ggf. auf welcher Art von Studienevidenz sie begründet sind.
Aus dem Wirkmechanismus der Me-dikamente ergibt sich jedoch, dass sie zur Behandlung einzelner Symptome der Histaminunverträglichkeit geeignet sein könnten (z.B. Flush durch H1-Blo-cker oder Übelkeit/Erbrechen durch H2-Blocker) – zumindest im Rahmen akuter Belastungen (massive Diätfehler, z.B. bei Feierlichkeiten, Rotweinkonsum oder Scombroidvergiftung2). In Anbe-tracht weitgehend fehlender Studien-evidenz erscheint also ein Therapiever-such gerechtfertigt. In diesem Sinne ist es denkbar, Patienten mit einer ver-muteten Histaminunverträglichkeit über einen definierten Zeitraum ver-suchsweise mit Histaminrezeptor-Typ-1-(H1-) und Histaminrezeptor-Typ-2-(H2-)Blockern der zweiten oder drit-ten Generationen zu behandeln, um zu überprüfen, ob sich das Beschwerdebild verändert.
1. Jarisch R (Hrsg.). Histamin-Intoleranz. Histamin und Seekrankheit. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme, 2004
2. Maintz L, Novak N. Histamine and his-tamine intolerance. Am J Clin Nutr 2007; 85: 1185–96
3. Wöhrl S, Hemmer W, Focke M, Rap-persberger K, Jarisch R. Histamine into-lerance-like symptoms in healthy vo-lunteers after oral provocation with li-quid histamine. Allergy Asthma Proc 2004; 25: 305–11
4. Reese I, Ballmer-Weber B, Beyer K, et al. German guideline for the management of adverse reactions to ingested his-tamine: guideline of the German Socie-ty for Allergology and Clinical Immu-nology (DGAKI), the German Society for Pediatric Allergology and Environ-mental Medicine (GPA), the German Association of Allergologists (AeDA), and the Swiss Society for Allergology
and Immunology (SGAI). Allergo J Int 2017; 26: 72–9
5. Morrow JD, Margolies GR, Rowland J, Roberts LJ. Evidence that histamine is the causative toxin of scombroid-fish poiso-ning. N Engl J Med 1991; 324: 716–20
6. Steinbrecher I, Jarisch R. Histamin und Kopfschmerz. Allergologie 2005; 28: 85–91
7. Töndury B, Wüthrich B, Schmid-Gren-delmeier P, Seifert B, Ballmer-Weber B. Histaminintoleranz: Wie sinnvoll ist die Bestimmung der Diaminoxidase-Aktivität im Serum in der alltäglichen klinischen Praxis? Allergologie 2008; 31: 350–6
8. Kuitunen M. Food allergy and hyper-sensitivity in children. Evidence-Based Medicine Guidelines (EBM Guideli-nes). Duodecim Medical Publications: Helsinki; 2017. Article ID: ebm00299 (031.042). Verfügbar unter www.ebm-
guidelines.com (letzter Zugriff am 17.01.2018)
9. Jarisch R, Wantke F. Wine and head-ache. Int Arch Allergy Immunol 1996;110: 7–12
10. Götz M. [Pseudo-allergies are due to histamine intolerance]. Wien Med Wo-chenschr 1996; 146: 426–30
11. Krabbe AA, Olesen J. Headache pro-vocation by continuous intravenous infusion of histamine. Clinical results and receptor mechanisms. Pain 1980; 8: 253–9
12. Wantke F, Götz M, Jarisch R. Histami-ne-free diet: treatment of choice for his-tamine-induced food intolerance and supporting treatment for chronic head-aches. Clin Exp Allergy 1993; 23: 982–5
13. Wantke F, Götz M, Jarisch R. The red wi-ne provocation test: intolerance to his-tamine as a model for food intolerance. Allergy Proc 1994; 15: 27–32
Literatur
Ständig aktualisierte Veranstaltungstermine von den „Tagen der Allgemeinmedizin“ finden Sie unter
www.tag-der-allgemeinmedizin.de
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
102 DEGAM-BENEFITS / DEGAM BENEFITS
DEGAM-BenefitsDEGAM Benefits
Ausgewählt und verfasst von Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP, Freiburg
Schwere kardiale Störwirkungen durch Missbrauch von Loperamid Abuse of Loperamide: Severe Cardiac Side Effects
Die US-amerikanische Arzneimittel-behörde FDA warnt vor lebensbedrohli-chen kardialen Komplikationen, wenn das Antidiarrhoikum Loperamid (IMO-DIUM, Generika) in deutlich höheren Dosierungen als zugelassen eingenom-men wird, beispielsweise um Opioident-zugssymptome selbst zu behandeln oder euphorisierende Effekte zu erzielen.
Wegen der geringen systemischen Bioverfügbarkeit – durch erhebliche First-pass-Metabolisierung nur 0,3 % – und geringer Penetration der Blut-Hirn-Schranke wurde das Miss-brauchspotenzial von Loperamid zu-nächst als begrenzt angesehen. Die Halbwertszeit – üblicherweise 9 bis 13 Stunden – kann allerdings bei Hoch-dosierungen von 16 mg und höher auf 41 Stunden steigen.
Die FDA überblickt für den Zeit-raum 1976 bis 2015 48 Berichte über schwere kardiovaskuläre Ereignisse un-ter dem Opioidagonisten einschließ-lich Verlängerung des QT-Intervalls, Torsade de pointes oder andere ventri-kuläre Arrhythmien, Synkope und Herzstillstand. 31 Patienten mussten deshalb in eine Klinik aufgenommen werden, 10 Patienten starben. Mehr als die Hälfte der 48 Berichte stammt aus der Zeit nach 2010. Die Dunkelziffer nicht erfasster Missbrauchsfolgen dürf-te beträchtlich sein.
In den letzten drei Jahren sind auf-fällig viele Veröffentlichungen zu Lope-ramid-Missbrauch, auch mit längerer Einnahme von zum Teil extrem hohen Dosierungen von bis zu 800 mg (400 Tabletten zu 2 mg) pro Tag, erschienen. Die angewendeten Mengen entspre-chen dem bis zu 50-Fachen der zugelas-senen maximalen Dosis (für rezeptfreies
Loperamid maximal 12 mg [in den USA maximal 8 mg], für rezeptpflichtige Prä-parate 16 mg).
Durch Kombination mit anderen Wirkstoffen können auch in Verbin-dung mit üblichen Loperamiddosie-rungen erhöhte Serumspiegel entste-hen. Solche Kombinationen, beispiels-weise mit starken CYP 3A4-Hemmern wie Clarithromycin (KLACID, Generi-ka) oder CYP 2C8-Hemmern wie Gem-fibrozil (GEVILON), werden daher auch gezielt missbräuchlich eingenommen. Durch Kombination mit P-Glykopro-tein-Hemmern wie Chinin (LIMPTAR N) kann das zuvor kaum ZNS-gängige Loperamid die Blut-Hirn-Schranke ver-stärkt passieren.
Hinweise auf missbräuchliche Ver-wendung des Antidiarrhoikums (a-t 1993; Nr. 3: 29 und 1995; Nr. 3: 32) und auf Strategien, die Effekte von Lopera-mid zu steigern (10), gibt es seit Langem. Auch hat das Bundesinstitut für Arznei-mittel und Medizinprodukte (BfArM) 2013 die Notwendigkeit der Verschrei-bungspflicht für Chinin (vgl. at 2014; 45: 4) unter anderem mit dem besonde-
ren Missbrauchspotenzial der Kombina-tion mit Loperamid begründet. Folgen für den Status des Antidiarrhoikums hatte dies jedoch nicht.
In der UAW-Datenbank des BfArM finden wir in Verbindung mit Lopera-mid 157 Verdachtsmeldungen zum Komplex Missbrauch, Abhängigkeit und Entzug. In Fachinformationen feh-len Hinweise auf Missbrauchspotenzial und kardiale Toxizität von versehentli-chen oder beabsichtigten Überdosierun-gen. Fachkreise müssen jedoch darüber informiert sein und bei unerklärbaren kardialen Ereignissen auch an Lopera-mid als potenziellen Auslöser denken. Gegebenenfalls sollte Loperamid wieder generell unter die Verschreibungspflicht gestellt werden.
Redaktion arznei-telegramm
A.T.I. Arzneimittelinformation Berlin GmbH Bergstr. 38 A, Wasserturm, 12169 Berlin, Fax: +49 30–79 49 02–20E-Mail: [email protected]
Ab
b.:
wik
iped
ia/Y
ikra
zuul
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
103DEGAM-BENEFITS / DEGAM BENEFITS
Medizinische Fakultätsausgründungen westlicher Industriestaaten: Menschenrechte mit Füßen getretenWestern Medical Faculties Abroad: Human Rights Blatantly Violated
Mit der Etablierung von medizinischen Curricula im Ausland durch medizi-nische Fakultäten westlicher Industrie-staaten wird eine Menge Geld verdient. Solche Einrichtungen gibt es auch hier-zulande, z.B. den Asklepios Campus Hamburg als Teil der Medizinischen Fa-kultät der Semmelweis Universität in Budapest. Dort kostet ein Semester 7800 Euro.
Was geschieht, wenn Fakul-tätsausgründungen in einem Land stattfinden, das die Menschen-rechte mit Füßen tritt? Ein „schö-nes“ Beispiel ist die Irish Medical School
im Golfstaat Bahrain, gegründet 2004 und unterhalten vom Royal College of
Surgeons in Ireland. Geht man auf die Internetseiten der
Fakultät in Bahrain, ahnt man nichts Böses und bekommt den Eindruck, dass sich alles nur um gute Lehre und For-schung dreht. Selbst der englische Bot-schafter im Lande, Simon Martin (Mit-glied des Distinguished Order of Saint Mi-
chael and Saint George und vormals Pri-vatsekretär der königlichen Hoheiten, des Prince of Wales und der Duchess of Cornwall ...) stattete im April der Schule anlässlich des 200. Jahrestags der diplo-
matischen Beziehungen zwischen bei-den Ländern einen Besuch ab, um, wie es heißt, „die aktuellen Aktivitäten der Universität zu erörtern“.
Verhaftung und Folter von Ärzten, die verletzte Demonstranten medizi-nisch versorgen, ist nur eines von vielen Beispielen von gravierenden Menschen-rechtsverletzungen in Bahrain. Der Sal-
maniya Medical Complex, ein akademi-sches Lehrkrankenhaus der Fakultät, wird in Berichten von Human Rights
Watch, Ärzte ohne Grenzen und Physicians
for Human Rights explizit als einer der Orte bezeichnet, an denen Ärzte und Pa-tienten misshandelt wurden.Eine irische Nichtregierungsorganisati-on (Global Legal Action Network) hat nun eine Eingabe an das United Nations Hu-
man Rights Council (UNHRC) gemacht, in der sie dem irischen Staat einen Bruch des internationalen, aber auch des nationalen Rechts vor-wirft. Letzteres sieht vor, dass irische medizinische Einrichtungen den demo-kratischen Standards des eigenen Lan-des entsprechen müssen. Wird dagegen verstoßen, kann der Wissenschafts-minister des Landes der Einrichtung die Lizenz entziehen.
Das Royal College of Surgeons in Ire-
land gibt sich unschuldig und nichtwis-send. Wörtlich heißt es in einer Stel-lungnahme:
“We support the unequivocal right of
doctors to practice as enshrined in the Gene-
va Convention. Doctors have a responsibili-
ty to treat all patients, irrespective of their
background … We are entirely satisfied that
human rights abuses are not taking place in
any of the teaching hospitals in which our
students do their clinical training. Anything
less would not be tolerated by RCSI. Any re-
ports of human rights abuses would invoke
immediate action on our part. At no time has any such report been provided by any of our students.”
Der letzte Satz ist besonders zynisch, da die meisten Studenten der herrschen-den Schicht angehören und einen Teufel tun werden, kritische Berichte an die Universitätsleitung zu richten.
Das College hat nach eigenen Anga-ben rund 100 Millionen Pfund in seine medizinischen Einrichtungen in Bah-rain investiert – das wegen ein bisschen Folter und einiger unvermeidlicher To-desfälle aufs Spiel zu setzen, wäre ja in der Tat ein unverantwortlicher Umgang mit wertvollen Ressourcen ...
Herzstillstand in den obersten Stockwerken: Riskanter als unten!Cardiac Arrest in Upper Floors: Higher Risk than in Lower Ones!
Darf ich einmal neugierig fragen, in welchem Stockwerk diejenigen unter Ihnen wohnen, die kein ei-genes Haus haben? Abhängig von Ihrem Lebensalter kann ich nur hof-fen, dass sie nicht allzu hoch hinaus wollen ...
Eine retrospektive kanadische Stu-die untersuchte 8216 Personen, die ei-ne private Eigentumswohnung in ei-nem mehrstöckigen Haus bewohnten, und bei denen per Notfall-Nummer ein Sanitäterteam (paramedics) gerufen
wurde. Von diesen Patienten wohnten 5998 (73 %) unterhalb des dritten Stockwerks. Diejenigen, die im dritten Stock oder darü-
ber wohnten, • wiesen signifikant häufiger einen
Herzstillstand auf und seltener eine Rhythmusstörung, die elektrisch the-rapierbar war (13,3 % vs. 19 %),
• und konnten signifikant seltener le-bend das Krankenhaus verlassen, in das sie eingeliefert wurden (2,6 % vs. 4,2 %).
• Von den Bewohnern, die höher als im 25. Stock wohnten ... überlebte keiner.
• Die Zahlen lassen auf eine zeitlich ver-zögerte Ankunft des Notfallteams in höheren Stockwerken schließen (mittlere Zeit von Ankunft im Haus bis zum Patienten: 3,0 vs. 4,9 Minu-ten).
Die Originalarbeit (Canadian Medical As-
sociation Journal 2016) können Sie frei herunterladen: www.cmaj.ca/content/early/2016/01/18/cmaj.150544.full.pdf.
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
104 ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPER
Menschen mit seltenen Erkrankungen in der HausarztpraxisEinblicke am Beispiel des Prader-Willi-Syndroms
People with Rare Diseases in the Family Practice
Insights on the Example of Prader-Willi-Syndrome
Anne Lutz1, Ute Schaaf2, Marco Roos3
1 Gerolfingen 2 Fachärztin für Allgemeinmedizin, Absberg 3 Allgemeinmedizinisches Institut des Universitätsklinikums Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Peer-reviewed article eingereicht: 16.10.2017, akzeptiert: 15.01.2018 DOI 10.3238/zfa.2018.0104–0109
Hintergrund: Seltene Erkrankungen sind in der Haus-arztpraxis nicht selten. Medizinisches Wissen darüber ist allerdings nicht selbstverständlich. Diese Arbeit soll erfas-sen, wie Menschen mit seltenen Erkrankungen und deren Angehörige ihre Betreuung durch den Hausarzt empfin-den. Beispielhaft wird das Prader-Willi-Syndrom (PWS) untersucht.Methoden: Es wurden leitfadenstrukturierte Interviews mit Eltern oder gesetzlichen Betreuern geführt. Diese wurden in einer qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring von zwei verschiedenen Untersucher kodiert und kategorisiert.Ergebnisse: Langzeitbetreuung, gute Kenntnis des Pa-tienten und niederschwelliger Zugang zum Hausarzt wur-den positiv erwähnt. Wichtig schien die Kommunikation und Koordination mit und durch den Hausarzt zu sein. Besonders betont wurde die Bedeutung der Versorgung durch Hausärzte in Akutsituationen und das oft bestehen-de Gefühl des Alleingelassenwerdens der Betroffenen, vor allem bei Mangel an Informationen bei beiden Parteien.Schlussfolgerungen: Hausärzte sind aus Sicht der Be-fragten in einer wichtigen Position für die Versorgung sel-tener Erkrankungen. Potenzial zur Verbesserung der Be-treuung liegt in der Aneignung von Fachwissen über die Erkrankung. Daher muss jeder Hausarzt die Möglichkeit haben und kennen, adäquates und kompaktes Informati-onsmaterial zu beziehen, beispielsweise über Internetsei-ten wie www.orpha.net.
Schlüsselwörter: Hausarzt; seltene Erkrankungen; Versorgungsqualität; Prader-Willi-Syndrom
Background: Rare diseases are more common than gen-erally assumed by the public. The purpose of this study was to investigate how patients suffering from rare dis-eases and their parents perceive the family care provided by their medical practitioners. As an example for a rare disease, we chose the Prader-Willi-Syndrome (PWS).Methods: Open and standardized interviews were con-ducted with parents and/or caretakers of the patients. Ac-cording to the criteria of the qualitative content analysis as suggested by Mayring they were coded and categor-ized by two independent examiners.Results: According to the interview, long-term care of the patients, extensive knowledge about the patients’ medical history, and easy accessibility to doctors were the main elements that the caretakers regarded as the most important. The existence of a constant communication and coordination with their doctors was essential. Also, the family practitioners’ role in acute situations and the lack of information for both parties, which often leads to patient isolation, were particularly highlighted.Conclusions: From the interviewees’ point of view, family pracititioners as counterparts to outpatient clinics are crucial for the care of these patients. Potential for im-provement is to gain knowledge about these diseases ex-tensively. Each family practitioner needs to have an easy access to adequate and consolidate information, for example via webpages like www.orpha.net.
Keywords: family practitioner; rare disease; quality of medical care; Prader-Willi-Syndrome
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
105
Lutz, Schaaf, Roos:Menschen mit seltenen Erkrankungen in der Hausarztpraxis – Einblicke am Beispiel des Prader-Willi-SyndromsPeople with Rare Diseases in the Family Practice – Insights on the Example of Prader-Willi-Syndrome
Hintergrund
Allgemeinärzte leisten eine nieder-schwellige, patientenzentrierte und ganzheitliche Versorgung. Sie sind erster Ansprechpartner für ein unselektionier-tes Patientengut. Dadurch ist ein Groß-teil hausärztlicher Arbeit durch akute Beratungsanlässe und chronische Er-krankungen geprägt, die in der Bevölke-rung häufig sind. Wie steht es jedoch um das Seltene? Eine Erkrankung gilt als selten, wenn sie weniger als 5 von 10.000 Menschen betrifft [1]. Bei rund 8000 verschiedenen Entitäten ergibt sich in Deutschland summiert ein be-trächtliches Patientenkollektiv [1]. Ob-wohl im Einzelfall selten, sind seltene Erkrankungen insgesamt häufig; viele sind hereditären Ursprungs und verlau-fen chronisch [1]. Dies bedingt auf die Lebensdauer gerechnet viele Arztkon-takte, was die Wahrscheinlichkeit er-höht, dass jeder Hausarzt Patienten mit seltenen Erkrankungen betreut [2]. Bei-spiele sind Zystische Fibrose, Phenylke-tonurie und Prader-Willi-Syndrom (PWS).
Gemeinsam ist der heterogenen Gruppe seltener Erkrankungen ein lan-ger Weg bis zur Diagnosestellung, Feh-len etablierter Behandlungsstandards und die Suche nach kompetenten Ärz-ten [3]. Zahlreiche Studien belegen die Wichtigkeit von Spezialambulanzen, Forschung und internationaler Vernet-zung [4, 5].
Zur Rolle der hausärztlichen Pri-märversorgung ist der Forschungs-stand geringer. Englischsprachige Lite-ratur postuliert die zentrale Rolle des Hausarztes als Koordinator, psycho-sozialen Begleiter und Interessensver-treter im Gesundheitssystems für Pa-tienten mit seltenen Erkrankungen [6]. In einer Befragung von medizi-nischem Personal wurde ein Zusam-menhang zwischen Verfügbarkeit von Wissen um die Erkrankung und Be-handlungssicherheit erhoben [7]. Durch Mangel an Informationen zum Krankheitsbild wird die Arzt-Patien-ten-Beziehung belastet [8].
Zur Durchführung der Studie wurde PWS als Beispiel für eine seltene Erkran-kung gewählt. Aufgrund der hausärzt-lichen Betreuung eines ortsansässigen Heimes mit Schwerpunkt PWS besteht bei den Autorinnen hierzu ein hoher Er-fahrungsschatz. PWS ist mit einer Präva-
lenz von 1 auf 17.000, also circa 5000 Be-troffene deutschlandweit, eine seltene genetische Erkrankung. Zu den diversen Symptomen gehören muskuläre Hypo-tonie, erhöhter Körperfettanteil und Hy-perphagie [9]. Daraus resultieren Adipo-sitas und Diabetes mellitus [9]. Endokri-nologische Störungen verursachen Os-teoporose, Skoliose und anderes [9]. Meist liegen geistige Retardierung und Verhaltensauffälligkeiten vor [9]. An-hand von PWS wird deutlich, dass selte-ne hereditäre Erkrankungen oft mehrere Organsysteme affektieren. Hieraus er-gibt sich eine komplexe Behandlungs-situation, die einen multimodalen An-satz benötigt und eine Herausforderung in der Betreuung darstellt.
Diese Studie sollte erfassen, wie Menschen mit PWS und ihre Angehö-rigen die hausärztliche Betreuung empfinden. Wo und in welcher Form können Verbesserungen erzielt wer-den?
Methoden
Es wurde ein qualitativ explorativer An-satz gewählt, um in leitfadengestützten Interviews die Perspektive Erkrankter beziehungsweise ihrer Angehöriger er-gebnisoffen zu erheben. Die Fragen des Leitfadens wurden auf Basis einer Litera-turrecherche und den Erfahrungen der Autorinnen entworfen. Die systemati-sche Literaturrecherche erfolgte bis 31.09.2017 auf PubMed mit den Mesh Terms „rare disease“, „patient-centered care“, „general practitioner“, „primary care“.
Rekrutierung
Die Studienteilnehmer wurden auf dem Treffen der deutschen Selbsthilfegruppe für PWS am 7.11.2015 in Köln rekru-tiert. Einschlusskriterien waren Erwach-sene, an PWS erkrankte Menschen be-ziehungsweise deren Eltern oder gesetz-liche Betreuer. Aufgrund der geistigen Retardierung präferierten die teilneh-menden Erkrankten die Befragung der Eltern/gesetzlichen Betreuer als deren Fürsprecher. Das Projekt wurde vor Ort öffentlich bekannt gegeben. Zwölf Inte-ressenten willigten ein, direkt vor Ort interviewt zu werden. Weitere gaben Einverständnis zu einem Telefoninter-view.
Datengewinnung
Es wurden 13 Interviews in einem per-sönlichen oder in einem Fall telefo-nischen Gespräch mit der Erstautorin AL abgehalten. Befragt wurden zwölf El-tern und eine gesetzliche Betreuerin mit im Durchschnitt 57,2 Jahren (50–63 Jah-re) bezüglich 13 Erkrankter, davon zehn männlich und drei weiblich mit einem Durchschnittsalter von 26,3 Jahren (18–37 Jahre). Das Gespräch wurde er-öffnet mit der Bitte: „Schildern Sie Ihre Er-
fahrungen mit der hausärztlichen Betreu-
ung des Betroffenen.“ Kam es nicht zu ei-ner detaillierten Antwort, wurden offe-ne, erzählgenerierende Fragen gestellt, wie beispielsweise „Inwiefern hat Ihr
Hausarzt einen Überblick über das Krank-
heitsbild? Was sind Gründe für eine Haus-
arztkonsultation?“. Leitfaden und Ergän-zungen zur Methodik sind in der Tabel-le 1 zu finden.
Datenauswertung
Zur Analyse der Aussagen wurde die qualitative Inhaltsanalyse in Anleh-nung an Mayring angewandt. Zugrun-deliegend ist ein Kodiersystem, das im Verlauf der Textbearbeitung der ersten Interviews deduktiv entwickelt und konsekutiv unter Zunahme des Abstrak-tionsniveaus überarbeitet, revidiert und ergänzt wurde [10]. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit wurde sicher-gestellt, indem zwei Personen unabhän-gig voneinander induktiv Haupt- und Unterkategorien aus den Antworten der Befragten entwickelten [11]. Die Zuord-nungen wurden hierauf im Sinne einer konsensuellen Kodierung verglichen, diskutiert und ein gemeinsames Katego-riensystem entwickelt. Die Kodierungen der weiteren Interviews konnten zwang-los dem Kategoriensystem zugeordnet werden. Auswerter waren Erst- und Zweitautorin.
Ethikvotum
Die Ethikkommission der Universitäts-klinik Erlangen erklärte die Unbedenk-lichkeit zur Studie (U9_27.11.2015).
Ergebnisse
Die empfundene Qualität der Versor-gung von Menschen mit PWS kann hin-
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
106
Lutz, Schaaf, Roos:Menschen mit seltenen Erkrankungen in der Hausarztpraxis – Einblicke am Beispiel des Prader-Willi-SyndromsPeople with Rare Diseases in the Family Practice – Insights on the Example of Prader-Willi-Syndrome
Rekrutierung
Einschlusskriterien
Rekrutierungsort
Rekrutierungsmöglichkeit
Sampling
Beendung der Rekrutierung
Stichprobenmenge
Datengewinnung
Leitfaden
Soziodemografische Daten Befragte
Soziodemografische Daten Betroffene
Interviewdauer
Interviewerin
Datenauswertung
Verarbeitung
Kodierung
Verschlüsselung
Tabelle 1 Methodik: Rekrutierung, Datengewinnung, Datenauswertung
– Wurden bewusst frei gewählt: alle Erwachsenen an PWS erkrankten Menschen beziehungsweise de-ren Eltern oder gesetzliche Betreuer.
– Schließt auch die wenigen Betroffenen ein, die nicht unter gesetzlicher Betreuung stehen.– Tatsächlich wurden jedoch nur Angehörige oder gesetzliche Betreuer befragt.
– Tagung der deutschlandweit einzigen PWS-Selbsthilfegruppe – Kapazität zur Befragung ergab sich aus dem Angebot, an einem späteren Zeitpunkt ein Telefoninter-
view durchzuführen.
– Aufforderung zur Teilnahme am Treffen – Erstellen einer Telefoninterviewliste (Insgesamt acht Teilnehmer erklärten sich zu Telefoninterview be-
reit) – E-Mail Verteiler der Selbsthilfegruppe (750 Mitglieder deutschlandweit) musste nicht in Anspruch ge-
nommen werden.
– Einige Teilnehmer präferierten die Befragung per Telefon, um den Vorträgen der Tagung folgen zu können.
– Wer zuerst auf die Interviewer zu kam/das Interview vor Ort führen wollte, wurde befragt. Einige Teil-nehmer der Telefoninterviewliste wurden aufgrund der vorher erreichten Sättigung nicht mehr be-fragt. Es fand also kein purposeful sampling statt.
– Erfolgte bei Eintritt der Sättigung, die dadurch festgestellt wurde, dass im letzten Interview (Telefonin-terview) keine neuen Codes mehr generiert wurden.
– 13 Interviewte, zufällig ausgewählt aus 261 Anwesenden • davon 59 Menschen mit PWS, die primär nicht interviewt wurden/werden wollten. • Häufig mehrere Personen pro „Fall“ (im Mittel kamen geschätzt jeweils zwei der 202 Anwesenden
und Nicht-PWS-Betroffenen auf einen Menschen mit PWS) • Hohe Anzahl der Anwesenden zu minderjährigen Menschen mit PWS zugehörig (= Ausschlusskrite-
rium)
– Schildern Sie Ihre Erfahrung mit der hausärztlichen Betreuung des Betroffenen. • Wie umfassend kann Ihr Hausarzt auf die Gesamtheit der Erkrankung eingehen? • Inwiefern hat Ihr Hausarzt einen Überblick über das Krankheitsbild? • Womit sind Sie zufrieden, was könnte besser laufen?– Wofür braucht man eine Spezialambulanz? Kann der Hausarzt Aufgaben der Spezialambulanz über-
nehmen? • Was sind Gründe für eine Hausarztkonsultation? • Wie läuft die Versorgung in Akutsituationen?– Unter welchen Umständen fand der Übergang vom Kinderarzt zum Hausarzt statt? Bitte schildern Sie
diesen Prozess.– Wie erleben Sie die Kommunikation zwischen Ihnen und Hausarzt sowie zwischen Hausarzt und Spe-
zialambulanz?– Gibt es etwas, das in Ihren Augen zur Verbesserung der Versorgung beitragen könnte?
– Geschlecht: Sieben Frauen, drei Männer und drei Ehepaare (zwölf Eltern, eine gesetzliche Betreuerin)– Alter: 50 bis 63 Jahre mit einem Altersdurchschnitt von 57,2 Jahren und einem Median von 57 Jahren
– Geschlecht: Drei weibliche und zehn männliche Betroffene– Alter: 18 bis 37 Jahren mit einem durchschnittlichen Alter von 26,3 Jahren und einem Median von 24
Jahren
– Acht bis 23 Minuten, im Mittel 15 Minuten
– Medizinstudentin (Erstautorin), die die Studie zur Erlangung der Promotion durchführte– Vorangehend gründliche Einweisung in das Führen von Interviews durch das allgemeinmedizinische
Institut der Universität Erlangen
– Audioaufzeichnungen wurden verbatim transkribiert und anonymisiert.– Datenschutz wurde mithin gewährleistet.
– Erfolgte getrennt durch Erst- und Zweitautorin (Medizinstudentin und Allgemeinmedizinerin).– Vorangehende Anleitung und laufende Supervision durch das allgemeinmedizinische Institut der Uni-
versität Erlangen
– MB steht für Mutter eines Betroffenen.– VB steht für Vater eines Betroffenen.– BB steht für Betreuer/in eines Betroffenen.– AL steht für die Erstautorin (Initialen).
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
107
Lutz, Schaaf, Roos:Menschen mit seltenen Erkrankungen in der Hausarztpraxis – Einblicke am Beispiel des Prader-Willi-SyndromsPeople with Rare Diseases in the Family Practice – Insights on the Example of Prader-Willi-Syndrome
sichtlich verschiedener Aspekte des ärzt-lichen Handelns beurteilt werden. Die Aussagen der 13 Interviews ließen sich sechs Hauptkategorien zuordnen. Dabei wurden insbesondere Aspekte der Kate-gorien herausgearbeitet, die bei seltenen Erkrankungen vornehmlich zum Tragen kommen.
Langzeitbetreuung
Wichtiger Bestandteil der hausärztlichen Tätigkeit ist für Befragte die Langzeit-betreuung und gute Kenntnis des Patien-ten als Basis für fundierte Betreuung: „Wir bleiben bei unserem Hausarzt, weil er
wie gesagt <Name> von klein auf kennt, die
Problematiken kennt, sich damit auseinan-
dergesetzt hat und wir ja auch immer wieder
im Gespräch waren.“ (MB-10). Die Befrag-ten wünschen Beachtung der Eigenhei-ten der Erkrankungen auch im Kontext alltäglicher, banaler Krankheiten.
Niederschwelliger Zugang und schnelle Terminvergabe werden als Vor-zug des Hausarztes gelobt. In Notsitua-tionen wünschen sich die Befragten den Hausarzt als Ansprechpartner, der wis-sen müsse, wann es ernst wird. „War ein
bisschen unbefriedigend, weil wir einfach
nicht wussten, wo wir bleiben sollen, wo ich
mit meiner Tochter hingehen kann auch für
den Fall, dass mal etwas Akutes ansteht,
weil unsere Hausärztin […], die kennt das
PWS nicht wirklich und ist auch ein biss-
chen überfordert.“ (MB-03). Viele Befragte präzisieren, dass die Behandlung in Not-aufnahmen und bei Spezialisten keines-wegs zufriedenstellender sei, sodass hier eine Versorgungslücke empfunden wird: „Wir haben jetzt noch Glück, aber
wenn jetzt die Tochter, wo das Schmerzemp-
finden gering ist, mal einen Blinddarm hät-
te, da hätte ich Panik.“ (MB-02). Zudem wünschen sich Befragte engmaschige Prävention: „Aber ich will ja Krankheiten
und Folgeerkrankungen verhindern und
nicht erst behandeln, wenn das Kind im
Brunnen ist.“ (MB-02).
Koordination
Aufgrund der Komplexität der Erkran-kung sehen die Befragten Koordination als zentrale hausärztliche Aufgabe: „Ge-
rade der Hausarzt, das ist der zentrale An-
sprechpartner, wo ich grenzenloses Vertrau-
en haben sollte. Da sollen von den Fachärz-
ten alle Fäden zusammenlaufen.“ (MB-02). Die Lenkungsfunktion des
Hausarztes ist für Patienten mit unkla-ren Beschwerden oder Krankheitsbil-dern ein wesentliches Element der Kon-sultation. Dort, wo gute Kooperation von Hausarzt, Spezialist und Spezialzen-trum stattfindet, wird die Versorgung positiv wahrgenommen. „Denn die Be-
richte von <PWS-Expertin> sind ja gleich-
zeitig auch an unseren Hausarzt gegangen
und haben ihn sicherlich dadurch auch
noch gefordert, vielleicht hier und da auch
mal nachzuschlagen oder sich zu erkundi-
gen und sich zu informieren.“ (MB-10). Konsultation eines Spezialzentrums steht nicht im Widerspruch zur haus-ärztlichen Betreuung: „also eher der
Hausarzt der Lotse ist, und man dann für
das intensive Nachschauen der endokrino-
logischen Werte dann einmal im Jahr
fährt.“ (MB-13). Alle Befragten geben an, dass für eine gut koordinierte Behand-lung ein hohes Maß an Eigeninitiative erforderlich ist: „Das ist doch ein bisschen
anders, wie wenn man eine Mutter ist, die
darauf vertraut, was der Arzt sagt. Weil da
wäre bei uns schon viel schiefgegangen.“ (MB-13).
Kompetenz
Gewünscht für die hausärztliche Betreu-ung ist laut Interviewten die fachliche Auseinandersetzung mit der Erkran-kung: „Das Einzige ist natürlich: Er hat
nicht so viel Ahnung über PWS.“ (MB-06). Es wird gemutmaßt, dass es vielerorts so-wohl an Zeit wie auch an Kompetenz fehlt, sich in das Krankheitsbild einzuar-beiten. Daher wird der Wunsch nach ei-ner kompakten Information zur Kom-petenzerhöhung geäußert: „Ich denke es
ist sehr wichtig, dass die Ärzte sich irgend-
wo eine Rückmeldung oder dass es ein Netz-
werk geben würde, wenn man dem Arzt
sagt: Der Betroffene hat PWS und dem Arzt
sagt das relativ wenig, oder er hat keine Er-
fahrung, dass er sich irgendwo ein bisschen
Information holen könnte oder Unterstüt-
zung.“ (BB-11). Auch Unterstützung zur Durchsetzung sozialer Rechte und be-sonderer Behandlungen spielt eine Rol-le: „Hat sich aber unsere Hausärztin durch-
aus willens erklärt, diesen Verwaltungsakt,
mehrere Instanzen auch, mit zu begleiten.“ (VB-09).
Beziehungsebene
Die Befragten benennen Engagement und Umgangsweise mit Menschen mit
geistiger Behinderung und Verhaltens-auffälligkeiten als wichtigen Baustein der Arzt-Patienten-Beziehung. „Ja, er
geht auch sehr gerne hin, da hat er Vertrau-
en und das läuft jetzt wieder besser.“ (BB-11). Gelingt es dem Arzt nicht, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, wird dies als frustrierend wahrgenom-men. Als kritisch empfinden Befragte ei-ne starke Wissensdivergenz zwischen sich und Arzt: „Ich fühle mich schlecht,
wenn ich einem Arzt mehr Information ge-
ben muss, wie er mir geben kann.“ (MB-02). Auch das Gefühl der Hilflosig-keit und des Alleingelassenwerdens wird mehrmals thematisiert: „Also, wenn er
ausrastet, wenn nichts mehr zu machen ist,
wenn wir selbst nicht mehr weiterwissen.
Da bekommt man keine Hilfe.“ (MB-02).
Kommunikation
Gute Kommunikation ist für die Befrag-ten essentieller Bestandteil der Behand-lung, gerade bei Patienten, die aufgrund von geistiger Retardierung eine gesetzli-che Betreuung haben: „Kommunikation
ist das Wichtigste. Alles andere das ergibt
sich dann.“ (MB-13). Einige ziehen gute Kommunikation fachspezifischem Wis-sen vor: „Auf die Sachen, die wir da anspre-
chen, geht er schon ein […] und wir sind
auch nicht der Meinung, dass der Hausarzt
sich mit jedem Syndrom intensiv auseinan-
dersetzen kann.“ (MB-05). Problematisch ist es, wenn der Arzt nicht bereit ist, In-formationen von Laien aufzunehmen: „Aber er [Hausarzt] sagt selbst: Es ist ihm
auch nicht angenehm, wenn er von den El-
tern etwas gesagt bekommt.“ (MB-02).
Transition
Mehrfach werden Schwierigkeiten beim Übergang vom Kinderarzt zum Hausarzt geschildert: „Da war er 18 und alle Kinder-
kliniken machen dicht, alle Ansprechpart-
ner waren dicht, also wir kamen nicht wei-
ter und wir sind jetzt praktisch einfach nur
bei den normalen Hausärzten und norma-
len Fachärzten und ich muss überall das
PWS vorstellen.“ (MB-06).
Diskussion
Die Antworten der Befragten legen nahe, dass Hausärzte als wichtige Ergänzung zu Spezialambulanzen unerlässlich in der Versorgung seltener, komplexer chro-
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
108
Lutz, Schaaf, Roos:Menschen mit seltenen Erkrankungen in der Hausarztpraxis – Einblicke am Beispiel des Prader-Willi-SyndromsPeople with Rare Diseases in the Family Practice – Insights on the Example of Prader-Willi-Syndrome
nischer Erkrankungen sind. Die Sicht der Befragten zeichnet Unterschiede in der hausärztlichen Versorgung von Men-schen mit PWS. Das Ideal scheint ein Hausarzt zu sein, der nicht nur den Pa-tienten mit seinen Eigenheiten kennt, sondern sich zudem in das Krankheits-bild einarbeitet und Hilfestellung in bio-psychosozialen Belangen bietet. Als ne-gativ oder verunsichernd wird ein Haus-arzt empfunden, der wenig Bereitschaft zeigt, sich Kenntnisse über die seltene Er-krankung zu verschaffen. Er kann keine ausreichende Akutversorgung leisten und nur begrenzt Vertreter der Patienten-interessen im Gesundheitswesen sein.
Geschätzt wird die Unterstützung bei Interessensvertretung im Gesund-heitssystem [2]. Dies ist bei oft unge-wöhnlichen Therapieformen dieser un-gewöhnlichen Erkrankungen und der sozialmedizinischen Beurteilung nicht einfach.
Betroffene seltener Erkrankungen haben oft spezielle Bedürfnisse und wol-len sich damit an Spezialisten wenden. Es zeigt sich allerdings, dass ein gut infor-mierter Hausarzt mit den Qualitäten nie-derschwelliger Zugang und ganzheitliche Versorgung suffiziente Vorortversorgung leisten kann, insbesondere bei Zusam-menarbeit mit Spezialambulanzen [3].
Ein Basiswissen des Hausarztes zur Krankheit ist unerlässlich für Versor-gungsqualität, Krankheitskontrolle und Compliance [7]. Aus den Aussagen der Befragten kann man ableiten, dass ein erhöhtes Fachwissen des Hausarztes zu einer besseren gesundheitlichen Versor-gung und zur verstärkten Kooperation mit der Spezialambulanz beiträgt. Viele Routineuntersuchungen können in der Hausarztpraxis statt beim Spezialisten erfolgen. Denn gerade am Beispiel von PWS zeigt sich: Einhergehende Begleit-erkrankungen wie Diabetes oder Osteo-porose gehören zum hausärztlichen Re-pertoire [13]. Bereits Van Nipsen stellt fest, dass in vielen Fällen kein anderes Handwerkszeug angewendet werden muss, es muss nur auf fundiertem Kenntnisstand angewendet werden [13]. Daraus ergibt sich nicht nur Kos-teneffizienz, sondern auch Kenntnis des Patienten, die vor allem in Akutsituatio-nen essentiell ist. Bereits das Erkennen einer Notsituation kann eine Herausfor-derung darstellen. Denn scheinbar all-tägliche Symptome, wie bei PWS Fieber oder Erbrechen, sind vor dem Hinter-
grund der Erkrankung als Alarmsignale zu werten [9]. Ein gut informierter Haus-arzt berücksichtigt dies und leitet als Kenner der medizinischen Infrastruktur vor Ort den Betroffenen zielgerichtet weiter. Dabei kann er Spezialisten und Krankenhausärzten, die laut Befragten oft ebenso nicht mit dem Krankheits-bild vertraut sind, Hintergrundinforma-tion geben und somit zum Koordinator der komplexen Erkrankung werden.
Auch Betroffene und Angehörige su-chen Information. Grund hierfür ist Iso-lation, das Gefühl mangelnder Unter-stützung [12] und das Bedürfnis, Eigen-initiative zu ergreifen. Einige Befragte be-richten vom Eindruck, dass die Wissens-weitergabe vom Behandelten an den Arzt diesem widerstrebt. Den Befragten ist es im Gegenzug unangenehm, den Arzt zu belehren. Eine Lösungsmöglichkeit könnte sein, dass Hausärzten Informatio-nen von Experten bereitgestellt werden, die einfach, beispielsweise per Internet, abgerufen werden können [12]. Eine Plattform bietet die Seite www.orpha.net. Sie scheint Hausärzten jedoch wenig be-kannt zu sein. Bereits 1997 wurde das In-formationsdefizit bei seltenen Erkran-kungen erkannt [8]. Die zunehmende Di-gitalisierung schafft hier Verbesserungs-potenzial.
Weitere Forschung sollte der Frage nachgehen, wie konkrete Methoden zur Optimierung der hausärztlichen Betreu-ung von Menschen mit seltenen Erkran-kungen aussehen. Dabei könnte auf die oft als problematisch empfundene Tran-sition, der Übergang von der Kinderheil-kunde in die Erwachsenenmedizin, fo-kussiert werden. Der meist gut in das Krankheitsbild eingearbeitete Pädiater und die Ärzte in Spezialambulanzen für Kinder sind vertraute Bezugspersonen [3]. Der Wechsel zum Hausarzt, der oft ohne Übergabe des Krankheitsverlaufs und ohne das gleiche Vorwissen den Fall weiterführen soll, fällt beiden Parteien schwer [3]. Dies stellt eine Herausforde-
rung dar und sollte, da es nicht Gegen-stand dieser Studie war, weitere For-schung nach sich ziehen.
Stärken und Schwächen
Es ist kritisch zu hinterfragen, ob die Er-hebung an einer einzigen seltenen Er-krankung eine Verallgemeinerung für alle zulässt, zumal es sich bei den selte-nen Erkrankungen um ein äußerst hete-rogenes Feld handelt. Vor allem erwor-bene oder akute seltene Erkrankungen können abweichende Bedürfnisse in der Versorgung haben. Weitere Limitation der Arbeit ist die Selektion von 13 als sehr engagiert einzustufenden Befragten aus 750 Selbsthilfegruppenmitgliedern bei circa 5000 Betroffenen deutschland-weit. Hier ist ein Selektionsbias nicht auszuschließen. Die Antworten der Be-fragten spiegeln jedoch sowohl negative Erfahrungen wie auch Vorzüge der haus-ärztlichen Versorgung, was für ein geeig-netes Stimmungsbild von Interviewten spricht. Zudem könnte die Tatsache, dass keiner der Befragten ein an PWS-Er-krankter war, die Untersuchung beein-flusst haben. Damit stammen alle Aussa-gen von Dritten, die jedoch aufgrund des engen Bereuungsverhältnisses zu den Erkrankten eine deckungshohe Sichtweise auf die hausärztliche Versor-gungssituation haben.
Stärke dieser Arbeit ist, dass sie als ei-ne der wenigen Studien Angehörige von Patienten mit seltenen Erkrankungen in den Fokus rückt. Sie bot ihnen mit der offenen Befragung Raum, die unter-schiedlichen Aspekte und Erfahrungen der hausärztlichen Versorgung offen zu reflektieren.
Schlussfolgerungen
Voraussetzung für eine gute Betreuung von Menschen mit seltenen, chro-
... war während ihres Medizinstudiums, das sie im November
2017 abschloss, an eine ländliche Hausarztpraxis assoziiert.
Dort lernte sie im Rahmen der Betreuung eines ortsansässigen
Wohnheims die hausärztliche Versorgung von Menschen mit
seltenen Erkrankungen kennen. Aus der Praxiserfahrung heraus
entwickelte sich die Forschungsfrage.
Anne Lutz ...
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
109
Lutz, Schaaf, Roos:Menschen mit seltenen Erkrankungen in der Hausarztpraxis – Einblicke am Beispiel des Prader-Willi-SyndromsPeople with Rare Diseases in the Family Practice – Insights on the Example of Prader-Willi-Syndrome
Anne Lutz
Ringstraße 2a
91726 Gerolfingen
Tel.: 0157 30944936
Korrespondenzadresse
nischen Erkrankungen ist die Aneig-nung von Fachwissen zur Erkrankung. Dieses kann bei 8000 verschiedenen En-titäten an seltenen Erkrankungen nicht vorausgesetzt sein. Daher muss jeder Hausarzt die Möglichkeit haben und kennen, adäquates und kompaktes In-formationsmaterial zu beziehen, bei-spielsweise über Internetseiten wie www.orpha.net. Verbesserungsbedarf besteht bei der Transition. Hausärzte be-
sitzen eine Schlüsselfunktion, zum Bei-spiel als Ansprechpartner in Notsituatio-nen oder als Koordinator im Gesund-heitswesen, und sollten sich dieser auch bewusst sein.
Anmerkung: Die vorliegende Studie wurde im Rahmen der Dissertation zum „Dr. med.“ an der Friedrich-Ale-xander Universität Erlangen-Nürnberg erstellt.
Interessenkonflikte: keine angege-ben.
1. www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsge fahren/seltene-erkrankungen.html (letzter Zugriff am 5.12.2017)
2. Knight A, Senior T. The common pro-blem of rare disease in general practice. Med J Aust 2006; 185: 82–3
3. Reimann A, Bend J, Dembski B. Patient-centred care in rare diseases. A patient organisations‘ perspective. Bundes-gesundheitsbl 2007; 50: 1484–93
4. Mau V, Grimmer A, Poppele G, Felch-ner A, Elstner S, Martin P. Bessere Ver-sorgung möglich. Dtsch Arztebl 2015; 47: A1980–4
5. Scholz C, Zeidler C, Schmidtke J, Stuhr-mann-Spangenberg M. Rare disease
centre at Hannover Medical School: First experiences. Med Genet 2013; 25: 157
6. Elliott E, Zurynski Y. Rare diseases are a ‘common’ problem for clinicians. Aust Fam Physician 2015; 44: 630–3
7. Kessel, M., Hannemann-Weber H, Krat-zer J. Innovative work behavior in he-alth care: the benefit of operational gui-delines in the treatment of rare disea-ses. Health Pol 2012; 105: 146–53
8. Atherton A. Primary care for patients with rare chronic illnesses. Eur J Gen Pract 1997; 3: 58–61
9. Scheermeyer E. Prader-Willi syndrome – care of adults in general practice. Aust Fam Physician 2013; 42: 51–4
10. Mayring P. Qualitative Inhaltsanalyse. In: Flick U, von Kardoff E, Steinke I. Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 8. Aufl. Reinbeck bei Hamburg: Ro-wohlt, 2010: 468–75
11. Steinke I. Gütekriterien qualitativer For-schung. In: Flick U, von Kardoff E, Stein-ke I. Qualitative Forschung. Ein Hand-buch. 8. Aufl. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 2010: 319–31
12. Jaffe A, Zurynski Y, Beville L, Elliott E. Call for a national plan for rare disea-ses. J Pediatr Child Health 2010; 46: 2–4
13. Van Nipsen, R, Rijken, M. Ordinary ca-re for the extraordinary patient: rare diseases in general practice. Huisarts Wet 2007; 50: 349–55
Literatur
An 500 Euro interessiert? Autorinnen und Autoren für Fortbildungsartikel gesucht• Möchten Sie sich mit einem hausärztlichen Thema besonders intensiv beschäftigen oder haben Sie eventuell schon
Expertise?• Kennen Sie die diesbezügliche Literatur oder wollen sie kennenlernen?• Möchten Sie andere an Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen teilhaben lassen?
Dann schreiben Sie einen Fortbildungsartikel für die Zeitschrift für Allgemeinmedizin (ZFA)!
Die ZFA ist an Fortbildungsartikeln zu hausärztlichen Themen sehr interessiert und vergütet die Autorinnen und Autoren (zunächst in den Jahren 2018 und 2019) mit 500 Euro pro veröffentlichtem Artikel.
Einzelheiten zum Aufbau einer Fortbildungsarbeit finden Sie unter https://www.online-zfa.de/fileadmin/user_upload/media/Autorenrichtlinien_ZFA.pdf.
Wir beraten Sie gern! Wenn Sie eine Idee für einen Fortbildungsartikel haben, melden Sie sich gerne bei den Herausgeberinnen und Herausgebern. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der neuen Webseite unter https://www.online-zfa.de/herausgeber/.
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
110 ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPER
Fehlermanagement in der ambulanten PraxisFokusgruppen mit Ärztinnen, Ärzten und Medizinischen Fachangestellten
Error Management in Outpatient Settings
Focus Groups Involving Physicians and Medical Assistants
Dania Gruber1, Tatjana Blazejewski1, Martin Beyer1, Hardy Müller2, Ferdinand M. Gerlach1, Beate S. Müller1
1 Institut für Allgemeinmedizin, Goethe-Universität Frankfurt am Main 2 Wissenschaftliches Institut der TK für Nutzen und Effizienz im Gesundheitswesen (WINEG), Hamburg Peer-reviewed article eingereicht 21.12.2017, akzeptiert 31.01.2018 DOI 10.3238/zfa.2018.0110–0115
Hintergrund: Zur Förderung der Patientensicherheit sind Praxen gesetzlich durch die Qualitätsmanagement-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses verpflich-tet, Fehlermanagement durchzuführen. Insbesondere Fehlerberichts- und Lernsysteme werden als wichtiges In-strument betont. Wie Fehlermanagement in einzelnen Einrichtungen der ambulanten Versorgung umgesetzt wird, ist nicht bekannt. Praxisübergreifende Fehler-berichts- und Lernsysteme werden im ambulanten Sektor nicht flächendeckend eingesetzt. Ziel dieser Studie war es, die Wahrnehmungen und Einstellungen zum Fehler-management sowie zu Fehlerberichts- und Lernsystemen zu explorieren.Methoden: Im Rahmen eines übergeordneten Projekts führten wir in einem Ärztenetz drei Fokusgruppen mit ins-gesamt 16 Teilnehmenden durch. Zwei ärztliche Gruppen und eine Gruppe Medizinischer Fachangestellter sprachen über das praxisinterne Fehlermanagement und praxis-übergreifende Fehlerberichts- und Lernsysteme. Die Ge-spräche wurden aufgezeichnet, wörtlich transkribiert und mittels inhaltlich-strukturierender qualitativer Inhaltsana-lyse ausgewertet. Ergebnisse: Der Umgang mit kritischen Ereignissen vari-ierte zwischen den Praxen, wenige hatten jedoch ein strukturiertes System etabliert. Die Ursache von uner-wünschten Ereignissen wurde häufig in der Unachtsam-keit Einzelner gesehen. Die Auseinandersetzung mit sys-tembedingten Fehlerquellen blieb daher häufig aus. Auch praxisübergreifende Fehlerberichts- und Lernsysteme wur-den kaum genutzt. Barrieren bestanden u.a. in der Wahr-nehmung, dass eigene Fehler für andere Praxen nicht re-levant seien, sowie in einer hohen Arbeitsbelastung im Praxisalltag.
Background: To promote patient safety, outpatient practices are legally obliged to introduce error man-agement as part of quality management. Critical inci-dent reporting systems (CIRS) are considered import-ant tools in this respect. Little is known about the im-plementation of error management in outpatient set-tings. CIRS are not utilized comprehensively in ambula-tory care. The aim of this study was to assess percep-tions and attitudes regarding error management and CIRS. Methods: As part of a wider project, we conducted three focus groups, involving 16 members of a practice net-work. Two groups of physicians and one group of health care assistants talked about error management in their practice and the use of CIRS. The discussions were re -corded, transcribed and evaluated using qualitative con-tent analysis. Results: The handling of critical incidents varied be-tween practices, but few of them had established a sys-tematic approach. The cause of adverse events was fre-quently attributed to the carelessness of single staff members. The reflection on systemic error causes therefore often did not take place. CIRS were also rarely used. Barriers to their use included the assump-tion among participants that their errors were of no rel-evance to other practices, and the high workload in every day practice. Conclusions: As a basis for systematic error manage-ment, the awareness of risks and sources of errors in practice procedures is insufficient in many practices. Specific interventions are required to establish a safety culture that actively involves error management. Further research is needed to identify discipline-specific
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
111
Gruber et al.:Fehlermanagement in der ambulanten Praxis – Fokusgruppen mit Ärztinnen, Ärzten und Medizinischen FachangestelltenError Management in Outpatient Settings – Focus Groups Involving Physicians and Medical Assistants
Hintergrund
Patientensicherheit ist ein weltweites Anliegen in der Gesundheitsversorgung. Sie kann auch durch Fehlerberichts- und Lernsysteme verbessert werden [1]. In-ternationale Studien belegen die Wirk-samkeit dieser Systeme bei der Qualitäts-förderung [2, 3]. In Deutschland sind Praxen der ambulanten vertragsärzt-lichen Versorgung gemäß Sozialgesetz-buch V, § 135a und der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses dazu verpflichtet, Fehlermanagement als ein Instrument des Qualitätsmanagements (QM) einzuführen [4]. Die Rolle von Sys-temen, in denen Fehler bzw. kritische Er-eignisse berichtet und für Lernprozesse genutzt werden, wird dabei besonders betont. Vereinzelt wird die Nutzung die-ser Fehlerberichts- und Lernsysteme in Deutschland bereits in QM-Systemen wie EPA (Europäisches Praxisassess-ment) als Qualitätsindikator erfragt [5]. Von den Kassenärztlichen Vereinigun-gen wird regelmäßig stichprobenhaft geprüft, wie weit die Umsetzung des Qualitätsmanagements in den Praxen fortgeschritten ist. Die genutzten Instru-mente werden jedoch nicht erfasst, so-dass unbekannt ist, wie Fehlermanage-ment aktuell in ambulanten Praxen praktiziert wird und wie bzw. ob dabei Fehlerberichts- und Lernsysteme zum Einsatz kommen.
In der nationalen und internationa-len Literatur gibt es wenige Unter-suchungen zu Fehlermanagement und der Nutzung von Fehlerberichts- und Lernsystemen im ambulanten Sektor [6]. Eine Studie aus Großbritannien zeigt dabei, dass kritische Ereignisse durchaus praxisintern besprochen werden, solche
Besprechungen aber nicht in Berichte an praxisübergreifende Systeme mün-den [7]. Dies deckt sich mit der Tatsache, dass frei zugängliche Online-Systeme wie das hausärztliche Fehlerberichts- und Lernsystem „Jeder-Fehler-zaehlt.de“ in Relation zur Grundgesamtheit der ambulanten vertragsärztlich tätigen Praxen relativ wenig frequentiert wer-den [8]. Zwar ist die Nutzung praxisüber-greifender Berichtssysteme in Deutsch-land nicht verpflichtend, gerade in der praxisübergreifenden Sammlung und Analyse liegt aber das Potenzial, auch aus den Fehlern anderer zu lernen und Praxisabläufe zu verbessern, bevor ein entsprechendes kritisches Ereignis ein-tritt [1].
Das Ziel dieser qualitativen Studie war es daher, die aktuelle Umsetzung von Fehlermanagement in ambulanten Praxen zu erfassen, und zudem Barrieren und unterstützende Faktoren bei der Nutzung von Fehlerberichts- und Lern-systemen zu analysieren.
Methoden
Design
Um einen ersten explorativen Zugang zu einem bislang wenig untersuchten Feld zu gewährleisten, führten wir Fo-kusgruppendiskussionen mit Ärztin-nen, Ärzten und Medizinischen Fach-angestellten (MFA) durch. Die Studie fand im Rahmen der prozessbegleiten-den, formativen Evaluation eines über-geordneten Projekts statt („TK-CIRS“, Techniker Krankenkasse – Critical Inci-dent Reporting System). TK-CIRS hatte zum Ziel, im Nürnberger Gesundheits-
netz „Qualität und Effizienz e.G.“ ein netzinternes, praxisübergreifendes Feh-lerberichts- und Lernsystem zu imple-mentieren.
Rekrutierung
Die Rekrutierung der Ärztinnen, Ärzte und MFA fand als Gelegenheitsstichpro-be über Mitarbeiter des Netzmanage-ments statt. Dabei wurden potenzielle Teilnehmende per E-Mail zur Teilnahme im Rahmen von netzinternen Treffen eingeladen. Die Beteiligung an der Stu-die war freiwillig, es wurde keine Auf-wandsentschädigung gezahlt.
Eine Begutachtung durch die Ethik-kommission war nicht erforderlich, da keine Patientinnen oder Patienten in die Studie eingeschlossen wurden.
Datenerhebung
Die Fokusgruppen fanden im Herbst 2016 an zwei Terminen in den Räum-lichkeiten des Gesundheitsnetzes statt. Insgesamt erklärten sich elf Ärztinnen und Ärzte und fünf MFA zur Teilnahme bereit, sodass zwei ärztliche Fokusgrup-pen und eine MFA-Gruppe zustande ka-men. Die Diskussionsrunden wurden nach Berufsgruppen getrennt durch-geführt, um den Einfluss der Hierarchie zu vermeiden und insbesondere den MFA einen sanktionsfreien Diskurs zu ermöglichen. Die Gruppe mit den MFA wurde von zwei Projektmitarbeiterin-nen des Instituts für Allgemeinmedizin Frankfurt a.M. gemeinsam moderiert (DG, MA Soziologie und TB, Dipl. Doku-mentarin, langjährige Mitarbeiterin von www.jeder-fehler-zaehlt.de), die Grup-pen mit den Ärztinnen und Ärzten je-
Schlussfolgerungen: Die Erhebung hat gezeigt, dass das Bewusstsein für Risiken und Fehlerquellen in Praxis-abläufen als Basis für systematisches Fehlermanagement wenig ausgeprägt ist. Zur Etablierung einer Sicherheits-kultur, in der Fehlermanagement gelebt wird, sind spezi-fische Interventionen nötig. Weitere Erhebungen sind sinnvoll, um mögliche disziplinspezifische Unterschiede im Fehlermanagement zu explorieren und Best-Practice-Beispiele zu identifizieren.
Schlüsselwörter: Fehlermanagement; Patientensicherheit; Fehlerberichtssysteme; Primärversorgung; qualitative Forschung
differences in error management and best-practice examples.
Keywords: error management; patient safety; reporting system; primary healthcare; qualitative research
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
112
Gruber et al.:Fehlermanagement in der ambulanten Praxis – Fokusgruppen mit Ärztinnen, Ärzten und Medizinischen FachangestelltenError Management in Outpatient Settings – Focus Groups Involving Physicians and Medical Assistants
weils von einer der beiden Mitarbeite-rinnen.
Die Moderation der Diskussionen orientierte sich an einem semi-struktu-rierten Leitfaden basierend auf eigenen Vorarbeiten [8] und weiterer Literatur zum Thema [7], in dem die folgenden Bereiche thematisiert wurden: aktuelles praxisinternes Fehlermanagement, Nut-zung von praxisübergreifenden Critical Incident Reporting Systems (CIRS), Aus-gestaltung von Fehlerberichts- und Lernsystemen.
Zu Beginn jeder Fokusgruppe erfolg-te eine Kurzvorstellung von Moderato-ren(team) und Teilnehmenden, zudem wurden der Ablauf und das Daten-schutzprozedere erläutert. Als erster Ge-sprächsstimulus diente die Frage da-nach, ob die Teilnehmenden ein Risiko-managementsystem nutzten und die Bitte, dieses kurz zu skizzieren. Weitere Impulse wurden darauf aufbauend durch tiefergehende Fragen zum Thema gesetzt. Dabei wurden die Begriffe „Feh-ler“ und „kritisches Ereignis“ verwen-det, ohne entsprechende Definitionen vorzugeben. Die Teilnehmenden sollten so die Möglichkeit erhalten, ihre eige-nen Begriffsdefinitionen in das Ge-spräch einzubringen.
Auswertung
Alle Fokusgruppen wurden nach Einho-len des Einverständnisses der Teilneh-menden audiodigital aufgezeichnet und im Anschluss wörtlich transkribiert. Die Transkripte wurden den Teilnehmenden nicht vorgelegt. Die Auswertung erfolg-te anonymisiert durch zwei Projektmit-arbeitende (DG, MB) anhand der inhalt-lich-strukturierenden qualitativen In-haltsanalyse [9] mithilfe der Auswer-tungssoftware MAXQDA. Dabei wurden Kategorien sowohl aus dem Leitfaden abgeleitet als auch induktiv am Material gebildet, konzeptualisiert und modifi-ziert. Das gesamte Material wurde an-schließend anhand des entwickelten Ka-tegoriensystems kodiert.
In dieser Publikation wird eine über-greifende Ergebnisdarstellung aus allen drei Fokusgruppen präsentiert. Dabei werden wörtliche Zitate mit A (ärztliche Teilnehmende) oder mit M (MFA) ge-kennzeichnet. Da sich die Ansichten der Ärztinnen, Ärzte und MFA nicht wesent-lich unterschieden, werden diese in den Ergebnissen gemeinsam dargestellt.
Ergebnisse
Zusammensetzung der Stichprobe
Von den elf ärztlichen Teilnehmenden (A1–A11) waren neun in Gemein-schaftspraxen tätig, zwei führten eine Einzelpraxis. Sieben Allgemeinmedizi-nerinnen und Allgemeinmediziner oder hausärztliche Internistinnen und Inter-nisten nahmen teil, die weiteren vier Teilnehmenden übten eine Tätigkeit als Fachspezialist aus. Die erste ärztliche Gruppe bestand aus zwei Ärztinnen und drei Ärzten, die zweite aus sechs Ärzten. Alle MFA (M1–M5) waren weiblich, drei arbeiteten in Gemeinschaftspraxen, zwei in Einzelpraxen. Die Fokusgruppen dauerten 32 (Arztgruppe 2), 52 (MFA-Gruppe) und 67 (Arztgruppe 1) Minu-ten.
Praxisinternes Fehlermanagement
In den Äußerungen der Teilnehmenden zeigte sich, dass der Umgang mit Feh-lern und kritischen Ereignissen praxis-abhängig sehr unterschiedlich gestaltet wird.
Einige der teilnehmenden Ärztin-nen, Ärzte und MFA schätzten die Häu-figkeit und den Schweregrad von Feh-lern und kritischen Ereignissen in ihrer eigenen Praxis als sehr gering ein. So kä-men „Kleinigkeiten“ und „Banalitäten“ zwar vor, relevante Fehler mit Patienten-schaden seien aber selten bis nicht vor-handen.
„Ich würde sagen große Fehler finden
eigentlich nicht statt. […] Also grobe Fehler,
wo man dann sagen kann, das kann man
vielleicht als Systemfehler oder so […] das
sind nur Kleinigkeiten und nichts Systema-
tisches.“ (A11) „Wir haben noch nie eine falsche Sprit-
ze gesetzt. Gott sei Dank. Wir haben noch
nie ein falsches Medikament ausgegeben.“
(M3)Wenn doch ein kritisches Ereignis
auftrat, wurde laut Befragten in den meisten beteiligten Praxen offen damit umgegangen. Ereignisse würden primär sofort nach dem Auftreten besprochen.
„Bei uns ist es so wenn irgendwelche
Fehler passieren, dann wird das allerdings
sofort besprochen und geschaut, wie man es
dann halt besser machen kann.“ (M2)In einigen Praxen wurden kritische
Ereignisse auch in Teamsitzungen disku-tiert. Unabhängig vom Zeitpunkt folgte
die Besprechung und Aufarbeitung nur in wenigen Fällen einem strukturierten Schema.
„[Das Formular] besteht ja wer es mel-
det, was passiert ist natürlich, auch die
Klassifikation. Kritische Fehler, nicht kriti-
sche Fehler Konsequenzen, Lösungsvor-
schläge ja, grob ist es das.“ (A9) „Dann setzen wir uns alle zusammen,
besprechen den Fehler, analysieren: Welcher
Fehler ist es? Ist ein Patient zu Schaden ge-
kommen? […] wie schwerwiegend ist der
Fehler und wie kann man sozusagen verhin-
dern, dass der Fehler noch einmal passiert.
Und dann halt die Umsetzung sozusagen
Kontrolle. Ist der Fehler noch einmal auf-
getreten? Ja, nein. An was lag das? […] bis
wir eine Lösung gemeinsam gefunden ha-
ben […].“ (M5)Oft wurde die Ursache eines kriti-
schen Ereignisses auf der individuellen Ebene, insbesondere in der Unacht-samkeit einzelner Personen gesucht. Infolgedessen wurde auch eine klein-schrittige Analyse der Ursachen als zu umständlich und nicht notwendig er-achtet.
„[…] dann sage ich so und so und bes-
ser aufpassen und genauer schauen und
dann wird das sofort besprochen und dann,
ja.“ (M1)„Ja aber was analysiert man da? Man
hat es halt vergessen, man hat nicht ge-
guckt. Das ist ganz klar, da brauche ich
nichts zu analysieren.“ (A3)Im Umgang mit kritischen Ereignis-
sen kamen verschiedene Dokumentati-onsstrategien zum Einsatz. Problemati-sche Ereignisse wurden beispielsweise an einem allen Mitarbeitern zugäng-lichen Ort schriftlich festgehalten (in ei-nem Ordner oder einem Formular an ei-ner Pinnwand) und teilweise mit ent-sprechenden Beschlüssen aus Team-besprechungen ergänzt. Schriftliches Abzeichnen sollte dabei garantieren, dass alle Mitarbeitenden über die Be-sprechungen und die erarbeiteten Lö-sungen informiert wurden.
„Das wird aufgeschrieben, das Formu-
lar wird dann bei uns in die Küche an die
Pinnwand gehängt, dass das jeder lesen
kann und das wird dann auch in der Team-
besprechung [...] besprochen. Und dann
werden wird eben auch die Lösung, die man
sich dann sich erarbeitet in Anführungsstri-
chen wird dann auch im Protokoll fest-
gelegt. Das Protokoll muss jeder lesen, ab-
zeichnen und dann wird erwartet, dass das
dann funktioniert.“ (A9)
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
113
Gruber et al.:Fehlermanagement in der ambulanten Praxis – Fokusgruppen mit Ärztinnen, Ärzten und Medizinischen FachangestelltenError Management in Outpatient Settings – Focus Groups Involving Physicians and Medical Assistants
Zwei ärztliche Teilnehmende er-wähnten explizit ihr praxisinternes QM-System in diesem Zusammenhang. In ei-nem Fall konnte die Dokumentation von Besprechungen aber nicht praktika-bel über das QM-System realisiert wer-den:
„Wir versuchen diese Teamsitzungen
über dieses Qualitätsmanagement immer
zu dokumentieren. Funktioniert aus orga-
nisatorischen Gründen nicht, weil das ja
in die Ordner dann eingetragen wird.“
(A4)In dem anderen Fall waren Quali-
täts- und Risikomanagement miteinan-der verknüpft, sodass Fehler direkt im System erfasst wurden.
„Also wir haben bei uns ein zertifizier-
tes Qualitätsmanagement. Da ist das Risi-
komanagement mit drin, also Fehler werden
erfasst, werden dann auch natürlich in der
Teambesprechung besprochen […].“ (A9)Die teilweise von den Teilnehmen-
den beschriebenen Lösungen können als praxisinterne Fehlerberichts- und Lernsysteme betrachtet werden, auch wenn die Praxen sie nicht so titulierten. Zusammenfassend bleibt allerdings fest-zuhalten, dass die meisten Praxen für sich (noch) keinen strukturierten Um-gang mit kritischen Ereignissen im Sin-ne eines systematischen Fehlermanage-ments etabliert hatten.
Praxisübergreifende Fehlerberichts- und Lernsysteme
Die meisten Befragten waren sich einig, dass praxisübergreifende Fehlerberichts- und Lernsysteme dazu dienen können, Erfahrungen auszutauschen und für po-tenzielle Fehlerquellen zu sensibilisie-ren. Das Lernen aus den Fehlern anderer wurde als Vorteil gesehen, ebenso wie die mentale Entlastung durch die Erfah-rung, dass andere ebenfalls Fehler ma-chen.
„Das ist ja der Sinn der Sache, ja? Dass
wenn man Fehler publik macht, dass dann
andere nicht reintapsen.“ (A6)„Im Idealfall wäre das so, dass eine an-
dere Praxis das liest und vielleicht hätte da
die andere Praxis eine super Lösung für die.“
(M5)Trotz dieser Äußerungen gaben nur
zwei Ärzte und eine MFA an, ein inter-netbasiertes Fehlerberichtssystem – in diesem Fall www.jeder-fehler-zaehlt.de oder das netzinterne Berichtssystem – regelmäßig und aktiv zu nutzen.
„Also wir machen es systematisch, seit
10 Jahren mindestens. Wir haben einen
Ordner, wo alles reingeschrieben wird, ein-
fach der Reihe nach so wie es kommt. […]
Und dann wird das, was in dem Ordner drin
steht eben in der nächsten Teambespre-
chung durchgegangen und dann gucken wir,
ob es davon etwas gibt, was relevant ist.
Dass wir das in das ‚Jeder Fehler zählt‘ eben
einstellen.“ (A10)Die übrigen Teilnehmenden gaben
an, kein praxisübergreifendes Berichts-system zu nutzen, um eigene Erfahrun-gen weiterzugeben oder Meldungen an-derer Praxen zu lesen. Einige der Teil-nehmenden sagten aus, sich das netz-interne System zu Beginn des Projekts angeschaut, es dann aber nicht genutzt zu haben.
Nutzungsbarrieren
In den Diskussionen wurden verschie-dene Barrieren bei der Nutzung von pra-xisübergreifenden Fehlerberichts- und Lernsystemen ersichtlich. Ein Großteil sowohl der teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte als auch der MFA, erachteten die Probleme in ihren Praxen als zu spe-zifisch für ein praxisübergreifendes Be-richtssystem. Sie nahmen an, dass ein Bericht dieser Ereignisse für andere kei-nen Mehrwert darstelle.
„[…] natürlich passieren auch Fehler,
aber das sind eben die, wie schon gesagt, die
sich wiederholen durch neues Personal oder
weil jemand vielleicht einen Ablauf nicht
verstanden hat. Dann muss man es aber
konkret demjenigen erklären und dann
muss ich es ja nicht mit der ganzen Welt so
ungefähr klären, sondern das ist dann in
unserer Praxis.“ (M3)Als weitere Barriere gaben einige der
MFA an, dass sie nicht eigenständig be-richten dürften, sondern ärztlicherseits eine Kontrolle der Berichte verlangt würde. Dies wurde von den ärztlichen Teilnehmenden ebenfalls thematisiert und dadurch begründet, dass MFA die Berichte ihrer Ansicht nach nicht mit ausreichender Präzision und Verständ-lichkeit verfassen würden.
„Ich meine der Doktor ist bei solchen
Fehlern auch mit dabei, damit man es dann
eigentlich auch so konkret dann formuliert,
dass es dann jeder auch halt versteht, damit
der richtige Punkt dann angekreuzt ist.“
(M5)„Außerdem, also meiner Ansicht nach
zum großen Teil völlig falsch dargestellt,
wenn das durch die Helferin selber gemacht
wird […] ich würde es auch nicht unterstüt-
zen, dass die sozusagen selbstständig ir-
gendetwas reinschreiben.“ (A4)Organisatorische und administrati-
ve Aufgaben gehören zum Praxisalltag und erfordern spezifische Weiterbildung und Optimierung. Insbesondere die teil-nehmenden Ärztinnen und Ärzte be-schrieben diese konkurrierenden Aufga-ben als bedeutendes Hemmnis für die Nutzung von praxisübergreifenden Feh-lerberichts- und Lernsystemen. Dabei wird dem Fehlermanagement und spe-ziell der Nutzung eines praxisübergrei-fenden Berichtssystems häufig eine niedrige Priorität zugewiesen.
„Aber wissen Sie es ist auch ein Nutzen
im Ärzteblatt richtig zu lesen, oder? Und
auf Fortbildungen zu gehen und ich muss
mich einfach entscheiden, was mache ich
und was mache ich nicht? Und das ist was,
was bei mir einfach hinten runterfällt.“
(A1) Hinzu komme in vielen Fällen eine
Unterbesetzung der Praxis, die Beschäf-tigung vieler Teilzeitkräfte und häufige Personalwechsel. Die daraus resultieren-de Überlastung wurde insbesondere von MFA als Problem wahrgenommen.
„Ich habe die Zeit echt gar nicht. Ich sa-
ge ja wir waren ja permanent unterbesetzt
ja. Also ich war ich wüsste gar nicht,
wann.“ (M1)
Förderliche Faktoren
In den Diskussionen wurde ein Faktor deutlich, der die Nutzung von praxis-übergreifenden Berichtssystemen för-derte. Als elementar wichtig zeigte sich vor allem eine proaktive Einstellung der Praxisführung, gerade um das Engage-ment der MFA zu stärken.
„[…] ich wollte es vor zehn Jahren nicht
haben und der Chef hat gesagt: ‚Ok, es muss
gemacht werden‘ und ich habe mich da echt
durchgebissen und ich bin diejenige, die
wirklich skeptisch war am Anfang und die
wirklich gesehen hat, was für ein gutes
Werkzeug das ist und deswegen bin ich da
auch so begeistert.“ (M5)Die Teilnehmenden nannten zudem
mehrere Eigenschaften, die ein praxis-übergreifendes Berichtssystem ihrer An-sicht nach nutzerfreundlicher gestalten würden. Bei der Eingabe von Berichten empfahlen sie wenige (Freitext-)Felder, zudem solle die Eingabe per Handy er-möglicht werden. Eine Filterung der ein-
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
114
Gruber et al.:Fehlermanagement in der ambulanten Praxis – Fokusgruppen mit Ärztinnen, Ärzten und Medizinischen FachangestelltenError Management in Outpatient Settings – Focus Groups Involving Physicians and Medical Assistants
gegebenen Berichte nach Kategorien (z.B. nach betroffener Berufsgruppe, Ort des Ereignisses, Thema etc.) wurde als vorteilhaft erachtet. Zudem könne via E-Mail-Newsletter an die Berichtsabgabe erinnert werden. Die übersichtliche Zu-sammenstellung von Tipps und Lö-sungsvorschlägen wurde als sehr rele-vant angesehen, um einen Mehrwert der Plattform für die Praxisteams zu ge-nerieren.
Diskussion
Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass die meisten Praxen noch kein pra-xisinternes Fehlermanagement imple-mentiert hatten, auch nicht im Zusam-menhang mit einem QM-System. Der Umgang mit kritischen Ereignissen dif-ferierte zwischen den Praxen stark. Tra-ten kritische Ereignisse auf, wurden die-se in der Regel unmittelbar innerhalb der Praxis angesprochen. Die Bespre-chung und Aufarbeitung erfolgte eher weniger strukturiert. Praxisübergreifen-de Berichtssysteme wurden kaum ge-nutzt.
In der Literatur fanden sich kaum Untersuchungen zu Fehlermanagement und der Nutzung von Fehlerberichtssys-temen in der ambulanten Versorgung in Deutschland [8, 10]. Auch internationa-le Untersuchungen bezogen sich meist auf den stationären Sektor und ana-lysierten vor allem Barrieren für die Nut-zung einrichtungsübergreifender Be-richtssysteme [11–14]. Eine der wenigen Studien aus dem ambulanten Sektor zeigte, analog zu unseren Ergebnissen, dass die meisten Praxen über Ereignisse sprachen, oftmals wurden aber nur schwerwiegende Ereignisse intern ana-lysiert und/oder in praxisübergreifen-den Berichtssystemen dokumentiert. Ei-ne der am häufigsten genannten Barrie-ren stellte auch hier der Zeitmangel durch hohe Arbeitsbelastung dar. Die
Angst vor Sanktionen erwies sich hinge-gen weder in unserer Studie, noch in dieser Untersuchung als relevantes Hemmnis [7]. Sowohl in unseren Fokus-gruppen als auch in der internationalen Literatur wurde die Wichtigkeit eines unkomplizierten, nutzerfreundlichen Berichtsprozesses betont, damit interne Analysen auch einrichtungsübergrei-fend geteilt werden [15].
Fehleranfällige Organisationsabläu-fe und Kommunikationsprobleme ge-hören zu den häufigsten Quellen für kri-tische Ereignisse in ambulanten Praxen [2]. Die diesbezügliche Risikowahrneh-mung und das Verständnis für die Rele-vanz dieser Fehlerquellen für die Patien-tensicherheit sind die Grundlage für ein strukturiertes Fehlermanagement. In unserer Erhebung sahen die Befragten die Ursache von unerwünschten Ereig-nissen häufig in der Unachtsamkeit ein-zelner Mitarbeiterinnen und Mitarbei-ter, womit aus Sicht der Teilnehmenden die Suche nach weiteren fehlerbegüns-tigenden Faktoren überflüssig wurde. Diese eher auf einzelne Personen bezo-gene Sichtweise macht deutlich, dass in ambulanten Praxen offensichtlich noch Verbesserungspotenzial bezüglich der Risikowahrnehmung und des Verständ-nisses für systembedingte Fehlerquellen besteht.
Limitationen
Die Befragung fand als Teil eines überge-ordneten Projekts und daher mit einer kleinen Stichprobe statt. Aus diesem Grund kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle inhaltlichen Aspekte des Themas erfasst wurden. Die Stich-probe stellt darüber hinaus eine Gele-genheitsstichprobe aus einem engagier-ten Netz dar, deren Ergebnisse nicht re-präsentativ für die jeweilige Berufsgrup-pe sein müssen. Die Konzeption der Stu-die als qualitative Untersuchung konnte jedoch konkrete Erfahrungen und Ein-
stellungen explorieren. Das kann als Grundlage für weitere Erhebungen die-nen.
Schlussfolgerungen
Diese Erhebung ergänzt die bisher dürf-tige Studienlage zu Fehlermanagement im ambulanten Sektor. Unsere Ergebnis-se weisen darauf hin, dass in ambulan-ten Praxen eine umfassende Sicherheits-kultur [16], in der Praxisteams sich syste-matisch mit Risiken und Fehlerquellen in Praxisabläufen auseinandersetzen, nicht entwickelt ist. Somit fehlt auch die Grundlage für einen weiterführenden Austausch mittels praxisübergreifender Berichtssysteme.
Einigen Barrieren aufseiten praxis-übergreifender Berichtssysteme kann durch eine technische Umgestaltung, beispielsweise in Form einer Verschlan-kung des Online-Berichtsformulars, re-lativ einfach begegnet werden. Hemm-nisse auf Seiten der Praxen können hin-gegen nur durch aufwendige Interven-tionen bewältigt werden, eine alleinige Erwähnung oder Abfrage des Themas im Rahmen der QM-Umsetzung reicht of-fensichtlich nicht aus. Unsere Ergebnis-se legen nahe, dass Ärztinnen und Ärzte in ihrer Rolle als Vorgesetzte diejenigen sind, die in der Praxis eine Struktur für systematisches Fehlermanagement schaffen können. Daher sollten sich In-terventionen wie Qualitätszirkel, die ei-nen ersten Einstieg ins Thema bieten können, zunächst an die Verantwort-lichen, nämlich die Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber, richten. Elementar wichtig ist es, in diesem Rahmen die Be-deutung von Fehlermanagement für die Optimierung der Praxisabläufe und da-mit die sichere Patientenversorgung darzustellen. Zudem sollte die langfristi-ge Zeit- und Ressourcenersparnis durch strukturierte Vorgänge im Praxisalltag hervorgehoben werden [17].
Um strukturiertes Fehlermanage-ment in der gesamten ambulanten Ver-sorgung etablieren zu können, sind wei-tere Erhebungen mit Ärztinnen, Ärzten und MFA sinnvoll, auch um disziplin-spezifische Unterschiede im Fehler-management zu identifizieren. Es soll-ten zudem Best-practice-Beispiele defi-niert werden, die als Orientierung und Blaupause für andere Praxen dienen können.
… ist Soziologin und seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frank-
furt am Main. Derzeitige Schwerpunkte: qualitative Forschung
im Bereich pädiatrischer Palliativversorgung sowie Patientensi-
cherheit, insbesondere Fehlerberichts- und Lernsysteme.
Dania Gruber, M.A. …
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
115
Gruber et al.:Fehlermanagement in der ambulanten Praxis – Fokusgruppen mit Ärztinnen, Ärzten und Medizinischen FachangestelltenError Management in Outpatient Settings – Focus Groups Involving Physicians and Medical Assistants
Dania Gruber, M.A.
Institut für Allgemeinmedizin
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Tel.: 069 6301-7071
Korrespondenzadresse
1. World Alliance for Patient Safety. WHO draft guidelines for adverse event re-porting and learning systems: from in-formation to action. Geneva: World Health Organization, 2005
2. Crane S, Sloane PD, Elder N, et al. Re-porting and using near-miss events to improve patient safety in diverse pri-mary care practices. J Am Board Fam Med 2015; 28: 452–460
3. Fox MD, Bump GM, Butler GA, Chen LW, Buchert AR. Making residents part of the safety culture. J Patient Saf; Jan 30 [Epub ahead of print]
4. www.g-ba.de/downloads/62–492–1296/ QM-RL_2015–12–17_iK-2016–11–16.pdf (letzter Zugriff am 12.02.2018)
5. www.epa-qm.de/downloads/index.html (letzter Zugriff am 18.01.2018)
6. www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gp_specials/pro-dialog/article/ 855522/fehler-chance-praxis-zeigt- worauf-ankommt.html (letzter Zugriff am 20.12.2017)
7. Rea D, Griffiths S. Patient safety in pri-
mary care. Health Soc Care Communi-ty 2016; 24: 411–419
8. Beyer M, Blazejewski T, Güthlin C, et al. Das hausärztliche Fehlerberichts- und Lernsystem ‚ jeder-fehler-zaehlt.de‘ – Berichtsbestand und Nutzungsperspek-tiven. Z Evid Fortbild Qual Gesund-heitswes 2015; 109: 62–68
9. Kuckartz U. Qualitative Inhaltsanalyse. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, 2016
10. Hoffmann B, Rohe J. Patient safety and error management. Dtsch Arztebl Int 2010; 107: 92–99
11. Elder NC, Graham D, Brandt E, Hickner J. Barriers and motivators for making error reports from family medicine of-fices: a report from the American Aca-demy of Family Physicians National Research Network (AAFP NRN). J Am Board Fam Med 2007; 20: 115–123
12. Pfeiffer Y, Briner M, Wehner T, Manser T. Motivational antecedents of incident reporting: evidence from a survey of nurses and physicians. Swiss Med Wkly 2013; 143: w13881
13. Braithwaite J, Westbrook MT, Travaglia JF, Hughes C. Cultural and associated enablers of, and barriers to, adverse in-cident reporting. Qual Saf Health Care 2010; 19: 229–233
14. Vrbnjak D, Denieffe S, O’Gorman C, Pajnkihar M. Barriers to reporting me-dication errors and near misses among nurses: A systematic review. Int J Nurs Stud 2016; 63: 162–178
15. Pham JC, Girard T, Pronovost PJ. What to do with healthcare incident repor-ting systems. J Public Health Res 2013; 2: e27
16. Hoffmann B, Domanska OM, Müller V, Gerlach FM. Entwicklung des Fragebo-gens zum Sicherheitsklima in Hausarzt-praxen (FraSiK). Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes 2009; 103: 521–529
17. Slawomirski L, Auraaen A, Klazinga N. The economics of patient safety: strengthening a value-based approach to reducing patient harm at national le-vel. OECD Health Working Papers, No. 96. Paris: OECD Publishing, 2017
Literatur
Danksagung: Wir danken den Praxen und dem Netzmanagement von „QuE e.G. Nürnberg“ für ihr Engagement und P. Elliott für seine englischsprachige Un-terstützung.
Finanzielle Förderung und Inte-ressenkonflikte: Das Projekt wurde von der Techniker Krankenkasse (TK) fi-
nanziert und unterstützt. Die TK machte keine Vorgaben zur Konzeption oder Durchführung der Studie, noch hatte sie einen Einfluss auf die Entscheidung zur Publikation. Hardy Müller ist Angestell-ter des wissenschaftlichen Instituts der TK (WINEG).
DEGAM im Netz
www.degam.dewww.degam-leitlinien.dewww.degam-patienteninfo.dewww.tag-der-allgemeinmedizin.dewww.degam-kongress.dewww.online-zfa.dewww.degam-famulaturboerse.dewww.facebook.com/degam.allgemeinmedizin
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
116 ÜBERSICHT / REVIEW
Ethische Fallbesprechungen in der hausärztlichen Versorgung: Ein Leitfaden für die PraxisEthical Case Discussions in Family Medicine: a Guidance for Ambulatory Practice Georg Marckmann1, Birgitta Behringer2, Jürgen in der Schmitten3
Hintergrund
Nachdem Klinische Ethikkomitees in-zwischen in vielen deutschen Kranken-häusern etabliert sind [1], entstehen in den letzten Jahren auch im ambulanten Sektor zunehmend ethische Beratungs-angebote [2, 3]. Diese Entwicklung trägt der Tatsache Rechnung, dass Ärzte, Pfle-gende und Mitglieder anderer Berufs-gruppen auch in der ambulanten Ver-
sorgung oft mit ethischen Fragestellun-gen konfrontiert sind (für eine exempla-rische retrospektive Fallanalyse aus hausärztlicher Sicht vgl. [4]). Dabei bie-tet die Implementierung der Ethikbera-tung im ambulanten Bereich besondere Herausforderungen, da Mitarbeiter ver-schiedener regionaler Versorgungsein-richtungen eingebunden werden müs-sen. Ethikberatung in der Altenpflege [5], Behindertenhilfe [6] oder im Hospiz
[7] ist organisatorisch meist an die Ein-richtung oder deren Träger angegliedert. Andere Beratungsangebote entstehen in bereits existierenden regionalen Versor-gungsstrukturen, wie z.B. Hospiz- und Palliativnetzwerken [8] oder in eigens geschaffenen Netzwerken (z.B. das Netz-werk Ambulante Ethikberatung Göttin-gen oder die Ambulante Ethikberatung in Hessen e.V.). Das Ambulante Ethikko-mitee Bochum e.V. (AEB) hat sich bspw.
1 Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin, Ludwig-Maximilians-Universität München 2 FÄ für Innere und Allgemeinmedizin, Spezielle Palliativmedizin, Hausärztliche Geriatrie; Bochum 3 Institut für Allgemeinmedizin, Forschungsschwerpunkt Advance Care Planning, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Peer-reviewed article eingereicht: 13.12.2017; akzeptiert: 19.02.2018 DOI 10.3238/zfa.2018.0116–0120
Zusammenfassung: In den letzten Jahren entstehen in Deutschland auch im ambulanten Bereich zunehmend ethische Beratungsangebote. Die Unterstützung in schwierigen ethischen Entscheidungssituationen erfolgt in der Regel in einer strukturierten, von einem entsprechend geschulten Moderator geleiteten ethischen Fallbespre-chung, an der Vertreter der beteiligten Berufsgruppen (insbesondere der Hausarzt und die zuständigen Pfle-gekräfte) und auch die Angehörigen teilnehmen, sofern dies vom Patienten gewünscht oder der Patient nicht ein-willigungsfähig ist. Der vorliegende Beitrag stellt ein Mo-dell zur Strukturierung ethischer Fallbesprechungen vor, das sich bei der Bewertung an den vier klassischen medizi-nethischen Prinzipien Wohltun, Nichtschaden, Respekt vor der Autonomie und Gerechtigkeit orientiert. Diese prinzi-pienorientierte Falldiskussion hat sich für die Moderation ethischer Fallbesprechungen im klinischen und außerkli-nischen Setting bewährt, kann aber auch dem einzelnen Hausarzt als Leitfaden für die strukturierte Bearbeitung schwieriger ethischer Entscheidungssituationen dienen.
Schlüsselwörter: Ethik; Ethikberatung; Allgemeinmedizin; ambulante Versorgung; Altenheim
Abstract: Over the last years, ethical consultation ser-vices have been increasingly implemented also in the am-bulatory care sector in Germany. Support for difficult ethi-cal decisions is usually offered in structured ethical case discussions, guided by a moderator with specific training. Representatives from all professional groups involved in the care of the patient are invited to join these dis-cussions, in particular the family practitioner and the re-sponsible nurse, as well as the closest family member(s) if so desired by the patient or if the patient has lost decision making capacity. This article presents a model to structure ethical case discussions which bases the evaluation on the four classical principles of biomedical ethics: beneficence, non-beneficial effects, respect for autonomy and justice. This principle-based case discussion can be used both for the moderation of ethical case discussions in the inpatient and outpatient care setting and by family practitioners as guidance for the structured workup of difficult ethical decisions.
Keywords: ethics; ethics consultation; family medicine; ambulatory care; nursing home
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
117
Marckmann, Behringer, in der Schmitten:Ethische Fallbesprechungen in der hausärztlichen Versorgung: Ein Leitfaden für die PraxisEthical Case Discussions in Family Medicine: a Guidance for Ambulatory Practice
aus einem Qualitätszirkel des Palliativ-netzes entwickelt. Zu seinen Mitgliedern gehören Pflegekräfte, Pfarrer, Leitungen von Hospizdiensten, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen sowie (Pal-liativ-)Ärzte aus dem ambulanten und stationären Bereich.
Die ethische Entscheidungsunter-stützung erfolgt meist in einer struktu-rierten, von einem spezifisch qualifizier-ten Moderator geleiteten ethischen Fall-besprechung, an der Vertreter der jeweils beteiligten Berufsgruppen (insbesonde-re der Hausarzt und die zuständigen Pflegekräfte) und bei nicht einwil-ligungsfähigen Patienten auch die Ange-hörigen teilnehmen. Erlebte Anamnese, familienmedizinische Bezüge zu den Angehörigen, die gute Kenntnis des so-zialen Netzwerks, besonders der verfüg-baren Ressourcen und seine moderie -rende Rolle im multi-professionellen Team prädestinieren den Hausarzt für die Moderation einer ambulanten ethischen Falldiskussion. Beim AEB kön-nen Pflegekräfte, Ärzte oder Angehörige eine Fallbesprechung beantragen, die dann von entsprechend geschulten Mit-gliedern des AEB organisiert und mode-riert wird. Abhängig von den Gegeben-heiten finden die Gespräche in Pfle-geeinrichtungen, Wohnungen oder Arztpraxen statt. Die endgül tige Ent-scheidung zwischen medi zinisch ver-tretbaren Optionen (einschließlich des Unterlassens von Maßnahmen) trifft der Patient bzw. sein Vertreter nach Maßga-be des erklärten oder mutmaßlichen Pa-tientenwillens, falls der Patient aktuell nicht einwilligungsfähig ist. Formal ist das Ergebnis einer ethischen Fallbespre-chung nicht bindend; die darin heraus-gearbeiteten Entscheidungsgrundlagen, wie z.B. die Interpretation des Patienten-willens, sind aber ethisch wie rechtlich maßgeblich zu berücksichtigen.
Der vorliegende Beitrag stellt mit der prinzipienorientierten Falldiskussion ein Modell zur Strukturierung ethischer Fallbesprechungen vor [9]. Das Vorgehen hat sich für die Moderation ethischer Fallbesprechungen im klinischen [10] und außerklinischen Setting [8] bewährt und kann überdies auch dem einzelnen Hausarzt als Leitfaden für schwierige ethische Entscheidungssituationen die-nen (vgl. auch [11]). Der Fallbericht in dieser Ausgabe der ZfA bietet hierfür ein Anwendungsbeispiel (s. S. 121–124, die Zitierung finden Sie unter [12]).
Das Modell der prinzipien -orientierten Falldiskussion
Die zentrale Zielsetzung ethischer Fall-besprechungen besteht darin, in schwie-rigen ethischen Entscheidungssituatio-nen herauszuarbeiten, welches Vor-gehen ethisch am besten zu begründen ist. Mit der „prinzipienorientierten Me-dizinethik“ steht ein praxisnaher Ethik-ansatz zur Verfügung, der weithin zu-stimmungsfähig ist und in vielen Berei-chen der Medizin Anwendung findet. Er basiert auf den international etablierten vier medizinethischen Prinzipien [13], die die moralischen Verpflichtungen des Gesundheitspersonals definieren: Sie sollen die Selbstbestimmung des Patien-ten fördern und achten (Prinzip Respekt
vor der Patientenautonomie, idealtypisch als Ergebnis eines – meist als „gemein -same Entscheidungsfindung“/„shared decision making“ bezeichneten – Befä-higungsprozesses [14]), dem Patienten bestmöglich nutzen (Prinzip des Wohl-
tuns) und ihm keinen Schaden zufügen (Prinzip des Nichtschadens) sowie ver-schiedene Patienten und andere Betei-ligte gerecht behandeln (Prinzip der Gerechtigkeit). Die resultierenden Ver-pflichtungen gegenüber dem Patienten decken sich mit den rechtlichen Anfor-derungen der Indikationsstellung (Prin-zipien Wohltun und Nichtschaden) und der Einwilligung nach Aufklärung („in-formed consent“).
Beim Modell der prinzipienorien-tierten Falldiskussion wird schrittweise geprüft, welche der in der medizi-nischen Analyse herausgearbeiteten Handlungsstrategien gemäß den vier medizinethischen Prinzipien jeweils ge-boten ist. In der Synthese werden die drei Einzelbewertungen zu einer über-greifenden ethischen Bewertung zusam-mengeführt. Eine kritische Reflexion schließt die Falldiskussion ab (Tab. 1). Die prinzipienorientierte Falldiskussion ist dabei kein Ersatz für die gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Arzt und Patient, sondern setzt diese voraus: Nur so können die Behandlungswün-sche des Patienten in der Fallbespre-chung angemessen berücksichtigt wer-den. Bei nicht einwilligungsfähigen Pa-tienten sind vorab entsprechende Ge-spräche zur Ermittlung des Patienten-willens mit dem gesetzlichen Vertreter und ggf. anderen nahestehenden Per-sonen zu führen. Eine ethische Fall-
besprechung kann dann hilfreich sein, wenn in diesem Entscheidungsprozess die ethischen Verpflichtungen unklar bleiben (z.B. keine oder widersprüch -liche Information über den Patienten-willen, fragliche Einwilligungsfähigkeit, schwierige Prognoseabschätzung) oder konfligieren (z.B. dringender Patienten-wunsch nach einer Behandlung mit sehr ungünstigem Nutzen-Schadens-Verhält-nis).
Schritt 1: Medizinische Aufarbeitung des Falls
Die medizinische Aufarbeitung der Si-tuation umfasst zwei Teilschritte:
a. Zunächst muss die medizinische
Situation möglichst genau beschrieben werden, in der sich der Patient aktuell befindet, einschließlich der Vor-geschichte. Ziel ist eine gemeinsam ge-teilte, umfassende Sicht der Situation des Patienten, unabhängig vom jewei -ligen Vorwissen. Im Sinne eines bio-psy-cho-sozialen Modells von Gesundheit und Krankheit sind auch die psycho-sozialen Gegebenheiten zu erfassen, die für den Patienten und seine aktuelle Situation Bedeutung haben.
b. Anschließend gilt es, die verfüg-baren (Be-)Handlungsstrategien heraus-zuarbeiten, die sich aus etwaigen unter-schiedlichen Behandlungszielen erge-ben oder die – bei gleichem Behand-lungsziel – durch unterschiedliche Nut-zen-Schadens-Relationen gekennzeich-net sind. Hierbei ist insbesondere auch zu berücksichtigen (und entsprechend vorab zu ermitteln), welches Behand-lungsziel der Patient in der vorliegenden Situation anstrebt (bzw. anstreben wür-de). Für jede einzelne Handlungsstrate-gie ist dann der zu erwartende weitere Verlauf zu klären: Wie groß sind die Überlebenschancen des Patienten? Mit welcher Lebensqualität wird der Patient voraussichtlich weiterleben? Bei unsi-cherer Prognose kann es helfen, zumin-dest das beste und schlechteste zu erwar-tende Behandlungsergebnis zu beschrei-ben und die jeweilige Eintrittswahr-scheinlichkeit bestmöglich zu schätzen.
Schritt 2: Ethische Verpflichtungen gegenüber dem Patienten
In ethischen Fallbesprechungen hat es sich bewährt, bei der Bewertung der ver-fügbaren Handlungsstrategien mit der
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
118
Marckmann, Behringer, in der Schmitten:Ethische Fallbesprechungen in der hausärztlichen Versorgung: Ein Leitfaden für die PraxisEthical Case Discussions in Family Medicine: a Guidance for Ambulatory Practice
Wohlergehens-Perspektive zu beginnen, um zunächst unabhängig vom Patien-tenwillen zu prüfen, welches Vorgehen, also welches Behandlungsziel und wel-che korrespondierende(n) Maßnah-me(n), aus Sicht des Teams für den Pa-tienten am besten ist. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn es widersprüchli-che oder wenig verlässliche Informatio-nen über den Patientenwillen gibt. Im Prozess der gemeinsamen Entschei-dungsfindung mit dem Patienten hat diese Bewertungsperspektive die Funk-tion, den Patienten in seiner eigenen Ent-scheidungsfindung zu unterstützen und insbesondere dort zur gründlichen und selbstkritischen Abwägung anregen zu können, wo die Präferenzen des Patien-ten von der Nutzen-Schadens-Abwägung des Teams abweichen – nicht etwa mit der Zielsetzung, den Patienten umzu-stimmen, sondern um sich zu vergewis-sern, dass die Wünsche des Patienten wohlinformiert und im Einklang mit sei-nen grundlegenden und längerfris tigen Wertvorstellungen sind.
a. Wohltun und Nichtschaden: Bei diesem Bewertungsschritt ist zu überlegen, welche der verfügbaren Handlungsstrategien aus der Fürsor-geperspektive, d.h. aus Sicht des beteilig-ten Teams, für das Wohlergehen des Pa-tienten insgesamt am besten erscheint. Das betrifft das Therapieziel und die Ab-wägung des Nutzens und Schadens der entsprechenden Therapieoptionen. So
weit als möglich wird man sich hierbei an allgemein geteilten Wertvorstellun-gen orientieren („Best-interest-Stan-dard“). Letztere ergeben sich vor allem aus der Einschätzung bzw. Erfahrung, wie Patienten in vergleichbaren Situa-tionen die Therapieziele und das Nut-zen-Schadens-Verhältnis verschiedener Handlungsoptionen bewerten würden oder üblicherweise bewerten. Anders ausgedrückt: Welche Behandlungsstra-tegie würde man einem ratsuchenden Patienten aus Sicht des beratenden Teams empfehlen? Sofern eine eindeuti-ge Bewertung aus der Fürsorgeperspekti-ve heraus nicht möglich ist, sollte man prüfen, ob zumindest tendenziell eine Be-handlungsstrategie zu bevorzugen wäre.
b. Respekt der Autonomie: An-schließend ist zu klären, welche der ver-fügbaren Handlungsstrategien (Behand-lungsziele und korrespondierenden The- rapieoptionen) der Patient selbst bevor-zugt und wie dies im Kontext seiner per-sönlichen Werte, Präferenzen und Ein-stellungen begründet ist. Nach Möglich-keit sollte der Patientenwille bereits vor-ab im Rahmen eines ihn befähigenden Prozesses gemeinsamer Entscheidungs-findung ermittelt worden sein. Bei nicht einwilligungsfähigen Patienten ist dafür auf (1) eine vorliegende Patientenverfü-gung, (2) auf zuvor mündlich geäußerte Behandlungswünsche oder (3) den mutmaßlichen Patientenwillen zurück-zugreifen [16]. Eine Patientenver-
fügung, die idealerweise in einem Ad-vance-care-planning-Prozess (deutsch: Behandlung im Voraus planen) entstan-den ist [11, 17, 18], muss im Dialog mit dem gesetzlichen Vertreter bzw. den An-gehörigen sorgfältig und im Sinne des Patienten interpretiert werden. In diese Interpretation sind auch aktuelle ver -bale oder nonverbale Äußerungen des Betroffenen einzubeziehen.
Schritt 3: Ethische Verpflichtungen gegenüber Dritten
Im dritten Bearbeitungsschritt ist – gebo-ten durch das Prinzip der Gerechtigkeit – zu prüfen, welche Bedürfnisse anderer Personen für die Entscheidungsfindung relevant sind. Neben den Angehörigen und nahestehenden Personen (die z.B. noch etwas Zeit zum Abschiednehmen oder bis zum Eintreffen benö tigen) sind hierbei auch die Bedürfnisse anderer Pa-tienten zu berücksichtigen, wenn etwa mehrere Patienten um begrenzte Versor-gungskapazitäten konkurrieren. Auch Fragen des Ressourcenverbrauchs wären hier zu diskutieren, sofern sie für die vor-liegende Entscheidung relevant sind. Die Verpflichtungen gegenüber Dritten sind dabei den Verpflichtungen gegen-über dem Patienten (vgl. Bearbeitungs-schritt 2) prinzipiell nachgeordnet. In der hausärztlichen Praxis dient dieser Schritt vor allem dazu, die Bedürfnisse der Angehörigen bei der Umsetzung der für den Patienten besten Option nicht aus dem Blick zu verlieren.
Schritt 4: Synthese
Im vierten Bearbeitungsschritt sind die vorangehenden Einzelbewertungen zu ei-ner übergreifenden Situationsbeurteilung zusammenzuführen. Wenn die Ergebnis-se der drei Bewertungsperspek tiven – Wohlergehen des Patienten, Patientenwille und Verpflichtungen gegenüber Dritten – übereinstimmen, spricht aus ethischer Sicht alles dafür, die entsprechende Behandlungsoption zu er-greifen. Liegt hingegen ein ethischer Kon-flikt vor, ist eine begründete Abwägung der konfligierenden Verpflichtungen erfor-derlich. Dabei sind fallbezogene Gründe herauszuarbeiten, welche Verpflichtung Vorrang genießen soll. Im Fall der Ableh-nung einer medizinischen Maßnahme durch einen aufgeklärten, einwilligungs-fähigen Patienten hat dessen Selbst-
1. Analyse: Medizinische Aufarbeitung des Falls
a. Situation des Patienten (Anamnese, Befunde, Diagnosen, etc.)
b. (Be-)Handlungsstrategien mit ihren Chancen und Risiken (Prognose)
2. Bewertung I: Ethische Verpflichtungen gegenüber dem Patienten
a. Wohltun; Nichtschaden
b. Autonomie respektieren
3. Bewertung II: Ethische Verpflichtungen gegenüber Dritten: Familienangehörige, andere Patienten, Versichertengemeinschaft (Gerechtigkeit)
4. Synthese: Konvergieren oder divergieren die Verpflichtungen? Im Konfliktfall: begründete Abwägung Planung der Umsetzung der Entscheidung
5. Kritische Reflexion:
a. Was ist der stärkste Einwand gegen die ausgewählte Option?
b. Wie hätte der Konflikt möglicherweise vermieden werden können?
Tabelle 1 Übersicht: Das Modell der prinzipienorientierten Falldiskussion zur Strukturierung ethischer Fallbesprechungen [10, 15]
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
119
Marckmann, Behringer, in der Schmitten:Ethische Fallbesprechungen in der hausärztlichen Versorgung: Ein Leitfaden für die PraxisEthical Case Discussions in Family Medicine: a Guidance for Ambulatory Practice
Univ.-Prof. Dr. med. Georg Marckmann, MPH
Institut für Ethik, Geschichte und
Theorie der Medizin
Ludwig-Maximilians-Universität München
Lessingstr. 2, 80336 München
Korrespondenzadresse
bestimmung, aktuell oder durch einen eindeutigen zuvor erklärten bzw. mut-maßlichen Willen, ethisch wie rechtlich ausnahmslos Vorrang vor dem Fürsor-gebestreben Dritter. Wünscht ein Patient aus medizinischer Sicht zweitrangige oder gar fragwürdige Maßnahmen, gewinnen die ethischen Fürsorgeüberlegungen da-gegen tendenziell an Gewicht, etwa im Fall eines an einem metastasierten Krebs-leiden erkrankten, schon moribunden Pa-tienten mit verzweifeltem Lebens-wunsch, der auf der Durchführung einer aus medizinischer Sicht praktisch aus-sichtslosen erneuten Chemotherapie be-steht. Lässt sich bei einer ethischen Fall-besprechung in der Synthese keine Einig-keit erzielen, sind die unterschiedlichen Positionen jeweils mit ihrer ethischen Be-gründung zu dokumentieren. Anschlie-ßend sollte überlegt werden, welche wei-teren Schritte erforderlich sind, um das Ergebnis der Fallbesprechung umzuset-zen und ob gegebenenfalls ein erneutes Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll wäre. Das Ergebnis der Fall-besprechung sollte dokumentiert und den an der Versorgung des Patienten be-teiligten Personen und Institutionen mit-geteilt werden. Insbesondere erscheint es sinnvoll, Behandlungsentscheidungen für zukünftige gesundheitliche Krisensi-tuationen entsprechend der ermittelten Patientenpräferenzen im Voraus zu pla-nen [17]. Ein funktionierendes regional implementiertes System der Vorauspla-nung (Behandlung im Voraus planen, BVP) kann gewährleisten, dass die resul-tierenden Festlegungen verlässlich über
die verschiedenen Schnittstellen hinweg weitergegeben und beachtet werden.
Schritt 5: Kritische Reflexion
Als letzter Bearbeitungsschritt kann eine kritische Reflexion der Fallbesprechung sinnvoll sein: Worin besteht der stärkste Einwand gegen die favorisierte Hand-lungsoption? Und: Wie hätte der Ent-scheidungskonflikt möglicherweise ver-hindert werden können? Zum einen soll dadurch das Ergebnis der Fallbespre-chung noch einmal kritisch geprüft (und ggf. modifiziert) werden, zum anderen ist zu überlegen, ob man aus dem vorliegen-den Fall für zukünftige Fälle lernen kann.
Schlussfolgerungen
Ethische Fallbesprechungen bieten auch im außerklinischen Bereich eine gute Möglichkeit, die beteiligten Personen in schwierigen ethischen Entscheidungs-situationen zu unterstützen. Dies fördert nicht nur eine Befähigung des Patienten (bzw. seines Vertreters) zur autonomen Entscheidungsbildung sowie eine kon-sequente Orientierung der Entscheidung an (mutmaßlichem) Willen, Behand-lungswünschen oder dem besten Interes-se des Patienten, sondern entlastet zu-dem das Gesundheitspersonal und die Angehörigen. Eine klare Strukturierung dieser Fallbesprechungen sichert die ethische Qualität und rechtliche Vertret-barkeit des Ergebnisses. Zudem bietet die ethische Fallbesprechung eine gute
Kommunikationsplattform, um alle Be-teiligten auf die ethisch gebotene Hand-lungsstrategie einzustimmen (s.a. Fallbe-richt in dieser Ausgabe, S. 121–124, die Zitierung finden Sie unter [12]). Dabei ist es wichtig, alle für die Entscheidung rele-vanten Akteure einzubeziehen, damit das Ergebnis in der Folge von allen mit-getragen und umgesetzt werden kann. Hausärzte sind meist unverzichtbare Ak-teure in ambulanten ethischen Fall-besprechungen und können der „Mo-tor“ für entsprechende regionale Initiati-ven und Projekte sein. Wesentliche He-rausforderungen liegen vor allem im or-ganisatorischen Setting [3]. Für Hausärz-te bleibt offen, wie sie die zeitliche Inves-tition für eine Ethikberatung realisieren und wirtschaftlich abbilden können. Zu-dem stellt sich den Ethikberatern in manchen Fällen die Frage, wie die Um-setzung der Entscheidung angemessen begleitet werden kann, sofern entspre-chende Strukturen wie z.B. SAPV-Teams (Teams in der Spezialisierten ambulan-ten Palliativversorgung), Brücken-schwestern, Seelsorge oder Psychologen nicht verfügbar sind [8]. Insgesamt ver-deutlicht dies, wie gut aufeinander abge-stimmte Angebote an BVP, Ethikbera-tung und Palliativversorgung eine pa-tientenzentrierte Versorgung im ambu-lanten Bereich unterstützen können.
Interessenkonflikte: Georg Marck-mann arbeitet als Trainer für Ethikbera-tung im Gesundheitswesen und hat Ho-norare aus Ethikberatungs-Schulungen erhalten. Darüber hinaus geben die Au-toren an, dass keine Interessenkonflikte bestehen.
1. Schochow M, May AT, Schnell D, Steger F. Wird Klinische Ethikberatung in Krankenhäusern in Deutschland im-plementiert? Dtsch Med Wochenschr 2014; 139: 2178–2183
2. Coors M, Simon A, Stiemerling M (Hrsg.). Ethikberatung in Pflege und ambulanter Versorgung. Modelle und theoretische Grundlagen. Lage: Jacobs Verlag, 2015
3. Thiersch S, Jox RJ, Marckmann G. Außerklinische Ethikberatung: Unter-stützung bei ethischen Fragen in der ambulanten Versorgung. Dtsch Med Wochenschr 2017; 142: 453–456
Literatur
… hat Medizin und Philosophie an der Universität Tübingen
sowie Public-Health an der Harvard Universität studiert.
1998–2010 Mitarbeiter am Tübinger Institut für Ethik und
Geschichte der Medizin, 2003 Habilitation für das Fach
„Ethik in der Medizin“. Seit 2010 Leiter des Instituts für Ethik,
Geschichte und Theorie der Medizin an der LMU München, seit 2012 Präsident der Akademie für Ethik in der Medizin.
Prof. Dr. med. Georg Marckmann, MPH …
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
120
Marckmann, Behringer, in der Schmitten:Ethische Fallbesprechungen in der hausärztlichen Versorgung: Ein Leitfaden für die PraxisEthical Case Discussions in Family Medicine: a Guidance for Ambulatory Practice
4. Bruns F, Noack A, Döpfmer S. Ethik in der Hausarztmedizin: „Wer bin ich ei-gentlich, eine solche Entscheidung zu fällen?“ Z Allg Med 2017; 93: 319–323
5. Bockenheimer-Lucius G, Dansou R, Sauer T. Ethikkomitee im Altenpfle-geheim. Theoretische Grundlagen und praktische Konzeption. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2012
6. Schmid B. Ethikberatung in der Behin-dertenhilfe am Beispiel der Arbeit des Ethikkomitees der Stiftung Liebenau. In: Coors M, Simon A, Stiemerling M (Hrsg.). Ethikberatung in Pflege und ambulanter Versorgung Modelle und theoretische Grundlagen. Lage: Jacobs Verlag, 2015: 173–186
7. Riedel A. Ethikberatung im Hospiz. In: Frewer A, May AT, Bruns F (Hrsg.). Ethik-beratung in der Medizin. Berlin, Heidel-berg: Springer-Verlag, 2012: 167–181
8. Krause-Michel B, Klein A, Thiersch S. Außerklinische Ethikberatung. Ein Er-fahrungsbericht aus der Praxis. Bayer Arztebl 2014: 642–644
9. Marckmann G. Im Einzelfall ethisch gut begründet entscheiden: Das Modell der prinzipienorientierten Falldiskussi-on. In: Marckmann G (Hrsg.). Praxis-buch Ethik in der Medizin. Berlin: Me-dizinisch Wissenschaftliche Verlags-gesellschaft, 2015: 15–22
10. Marckmann G, Mayer F. Ethische Fall-besprechungen in der Onkologie: Grund -lagen einer prinzipienorientierten Fall-diskussion. Onkologe 2009; 15: 980–988
11. Gágyor I, Simon A, in der Schmitten J. Ethische Fragen und Konflikte in der Allgemeinmedizin. In: Kochen MM (Hrsg.). Allgemeinmedizin und Famili-enmedizin. 5. Aufl., Stuttgart: Thieme, 2017: 629–637
12. Marckman G, Behringer B, in der Schmitten J. Beendigung der Sonden-ernährung in einer Pflegeeinrichtung: eine ethische Falldiskussion. Z Allg Med 2018; 94: 121–124
13. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 7th ed. New York, Oxford: Oxford University Press, 2013
14. in der Schmitten J. Autonomie gewähren genügt nicht – Patienten-Selbstbestim-mung bedarf aktiver Förderung durch Ärzte. Z Allg Med 2014; 90: 246–250
15. McCullough LB, Ashton CM. A metho-dology for teaching ethics in the clinical setting: a clinical handbook for medical ethics. Theoret Med 1994; 15: 39–52
16. Marckmann G, Sandberger G, Wiesing U. Begrenzung lebenserhaltender Be-handlungsmaßnahmen: Eine Hand -reichung für die Praxis auf der Grund-lage der aktuellen Gesetzgebung. Dtsch Med Wochenschr 2010; 135: 570–574
17. Nauck F, Marckmann G, in der Schmit-ten J. Behandlung im Voraus planen – Bedeutung für die Intensiv- und Not-fallmedizin. Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2018; 53: 62–70
18. Coors M, Jox RJ, in der Schmitten J (Hrsg.). Advance Care Planning. Von der Patientenverfügung zur gesund-heitlichen Vorausplanung. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2015
DEGAM-Leitlinien frei im Netz
Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)
stehen frei im Internet zur Verfügung. Die wissenschaftlich fundierten und vor der Veröffent-
lichung in Praxen erprobten DEGAM-Leitlinien richten sich nicht nur an Hausärztinnen und
Hausärzte, sondern auch an Patientinnen und Patienten und Praxismitarbeiter/innen. Neben
der Langversion gibt es zu jeder Leitlinie eine Kurzfassung für die Anwendung im Praxisalltag.
Mehrere tausend Leitlinien-Sets werden in Praxen und Universitäten in der täglichen Arbeit
mit Patienten eingesetzt. Alle Module können auf der DEGAM-Leitlinien-Homepage
(www.degam-leitlinien.de) oder auf der Homepage der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, http://leitlinien.net/) bei Bedarf
heruntergeladen und ausgedruckt werden.
Kontakt:
Dr. Philipp Leson
DEGAM-Bundesgeschäftsstelle
Friedrichstraße 133
10117 Berlin
Tel.: 030 209669800
Fax: 030 209669899
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.degam.de
PD Dr. med. Anne Barzel
DEGAM-Geschäftsstelle Leitlinien
c/o Institut für Allgemeinmedizin
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52
20246 Hamburg
Tel.: 040 741059769
Fax: 040 741053681
E-Mail: [email protected]
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
121FALLBERICHT / CASE REPORT
Beendigung der Sondenernährung in einer Pflegeeinrichtung: Eine ethische FalldiskussionTerminating Tube Feeding in the Nursing Home: an Ethical Case DiscussionGeorg Marckmann1, Birgitta Behringer2, Jürgen in der Schmitten3
1 Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin, Ludwig-Maximilians-Universität München 2 FÄ für Innere und Allgemeinmedizin, Spezielle Palliativmedizin, Hausärztliche Geriatrie; Bochum 3 Institut für Allgemeinmedizin, Forschungsschwerpunkt Advance Care Planning, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Peer-reviewed article eingereicht: 13.12.2017; akzeptiert: 19.02.2018 DOI 10.3238/zfa.2018.0121–0124
Hintergrund: Bei Bewohnern in Senioreneinrichtungen, deren Gesundheitszustand regelmäßig durch hohes Alter, chronische Multimorbidität und resultierende Gebrech-lichkeit charakterisiert ist, stellt sich häufig die Frage, wel-che Zielsetzung die ärztlichen Bemühungen aus Sicht des Betroffenen verfolgen sollen. Zur Unterstützung schwieri-ger Entscheidungen haben sich in den letzten Jahren zu-nehmend auch im ambulanten Bereich Angebote der Ethikberatung etabliert.Fallbericht: Bei einem 85-jährigen Bewohner mit einer mehrjährigen psychiatrischen Krankengeschichte, der Essen und Trinken verweigert, wird kontrovers diskutiert, ob die bereits laufende Zufuhr von Nahrung und Flüssig-keit über eine PEG-Sonde fortgesetzt werden soll. Da der Patientenwille aufgrund der psychiatrischen Erkrankung schwierig zu ermitteln ist und da Pflegepersonal und An-gehöriger unterschiedliche Auffassungen über die Fort -setzung der Ernährungstherapie haben, erfolgt die Klä-rung des Therapieziels im Rahmen einer ethischen Fall-besprechung durch das regional verfügbare ambulante Ethikkomitee.Schlussfolgerungen: Bei schwierigen Entscheidungs-situationen kann eine moderierte ethische Fallbespre-chung hilfreich sein, die alle beteiligten Personen(grup-pen) einbezieht und dadurch (neben einer bestmöglichen Entscheidung im Sinne des Patienten) nicht zuletzt zu de-ren Entlastung beiträgt. Der Königsweg zur Vermeidung schwieriger Entscheidungssituationen mit relativ hoher verbleibender Entscheidungsunsicherheit bei fraglicher, eingeschränkter oder fehlender Einwilligungsfähigkeit bleibt eine frühzeitige Ermittlung und Dokumentation des Patientenwillens durch „Vorausplanung der Behandlung“ („Advance Care Planning“).
Schlüsselwörter: Ethikberatung; Allgemeinmedizin; ambulan-te Versorgung; Altenheim; Behandlung im Voraus planen
Background: The health status of nursing home resi-dents is usually characterized by old age, chronic multi-morbidity, and resulting frailty. In this population, the goal and scope of medical therapeutic efforts as judged from the perspective of the person concerned is often not easy to determine. To support difficult decisions, ethics consultation services have been increasingly implemented also in the ambulatory care sector over the last years.Case Report: In a 85 year old resident with a long-standing history of psychiatric illness who refuses to eat and drink, continuation of artificial nutrition and hy-dration via PEG tube becomes controversial. As the pa-tient’s wishes are difficult to determine due to the psychi-atric illness, and since nursing home staff and family have diverging opinions about continuing the tube feeding, the goal of care is clarified within an ethical case dis-cussion.Conclusions: In difficult situations, a moderated ethical case discussion can be helpful, leading to a decision that is not only as close as possible to the patient’s (presumed) wishes, but also acceptable for all parties and players in-volved in the process. However, early elicitation and documentation of the patient’s wishes, ideally facilitated by a qualified advance care planning process, remains the best available way to making patient-oriented decisions when decision-making capacity is unclear, limited or ab-sent.
Keywords: ethics consultation; family medicine; ambulatory care; nursing home; advance care planning
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
122
Hintergrund
Die Betreuung hochbetagter, multimorbi-der Patienten in Pflegeeinrichtungen stellt die betreuenden Hausärzte immer wieder vor ethische Herausforderungen. Im Vordergrund steht dabei häufig die Frage, wie lange potenziell lebensverlän-gernde Maßnahmen noch fortgesetzt werden sollen. Seit einigen Jahren werden zunehmend Ethikberatungsangebote etabliert, die die beteiligten Personen im Rahmen einer moderierten ethischen Fallbesprechung bei der Entscheidungs-findung unterstützen [1, 2]. Aus dem Am-bulanten Ethikkomitee Bochum wird be-richtet, dass die Ernährung via PEG bei nicht oder eingeschränkt einwilligungs-fähigen Patienten in 11 von 13 Ethikbera-tungen des Jahres 2017 Anlass für eine ethische Fallbesprechung war (persönli-che Mitteilung Dr. B. Behringer). Dies ent-spricht der Erfahrung anderer außerklini-scher Ethikberatungen [vgl. z.B. 3]. Wir berichten hier über einen 85-jährigen multimorbiden Altenheimbewohner, bei dem die Frage der fortgesetzten Sondener-nährung im Rahmen einer ethischen Fall-besprechung erörtert wurde.* Das dabei genutzte Modell der prinzipienorientier-ten Falldiskussion kann auch dem einzel-nen Hausarzt als Leitfaden für die struktu-rierte Bearbeitung schwieriger ethischer Entscheidungssituationen dienen (s. Übersichtsarbeit auf S. 116–120, die Zitie-rung finden Sie unter [4]). Basierend auf einer medizinischen Aufarbeitung des Falls wird schrittweise geprüft, welche der herausgearbeiteten Behandlungsstrate-gien gemäß den etablierten medizinethi-schen Prinzipien des Wohltuns und Nichtschadens, Respekt vor der Auto-nomie und Gerechtigkeit, das eine Gleichbehandlung der Patienten und ei-ne faire Verteilung begrenzter Ressourcen fordert, jeweils geboten sind. In der Syn-these werden die Ergebnisse der einzelnen Bewertungsperspektiven zu einer über-greifenden ethischen Beurteilung der Ent-scheidungssituation zusammengeführt.
Fallbericht
Ausgangssituation
Ein 85-jähriger multimorbider Bewoh-ner einer Pflegeeinrichtung verweigert
die Aufnahme von Nahrung und Flüs-sigkeit. Der Sohn des Patienten wünscht eine Beendigung der künstlichen Nah-rungs- und Flüssigkeitszufuhr mittels der seit 4 Jahren liegenden PEG-Sonde. Das Pflegepersonal des Wohnbereichs argumentiert dagegen, dass sich der Be-wohner nicht im Sterbeprozess befinde. Die Hausärztin fühlt sich von der Situa-tion überfordert, sodass die Entschei-dung bereits seit mehreren Monaten hinausgeschoben worden ist. Der Sohn ist zunehmend verzweifelt. Auf seinen Wunsch regt der inzwischen hinzugezo-gene Palliativmediziner eine ethische Fallbesprechung durch das regionale ambulante Ethikkomitee an. An dem Gespräch nehmen neben der Moderato-rin und einem weiteren Ethikberater die Hausärztin, die behandelnde Psychiate-rin, der Palliativmediziner, die Pflege-dienstleitung, die Bezugspflegekraft und der als gesetzlicher Betreuer für Gesund-heitsfragen eingesetzte Sohn des Bewoh-ners teil.
Medizinische Aufarbeitung
Aktuelle Situation und Vor-geschichte des Patienten: Bei dem 85-jährigen Patienten mit einer mehr-jährigen psychiatrischen Krankenge -schichte stand in den letzten Jahren eine schwere, medikamentös unzureichend behandelbare Depression im Vorder-grund. Das Verhalten und die kogniti-ven Fähigkeiten sprachen nicht für das Vorliegen einer Demenz. Seit einem fie-berhaften Infekt vor einigen Monaten spricht er nur noch wenig, seit etwa einem Monat lebt er vollständig in sich gekehrt. Er verweigert nun konsequent jegliche Nahrungsaufnahme und wird weiterhin über eine PEG-Sonde ernährt. Bis vor Kurzem hatte er die Mundpflege noch toleriert, jetzt kneift er auch dabei die Lippen zusammen. Die Beteiligten erleben den Patienten ruhig und ohne Leidensdruck. Er liegt viel im Bett, jeden Morgen wird er in den Rollstuhl mobili-siert. Wie viel er von Gesprächen ver-steht, ist schwer zu beurteilen, einfache Aufforderungen (z.B. Mund zur Mund-pflege öffnen) konnte er zuletzt noch befolgen. Neben der chronischen De-pression bestehen bei dem Patienten eine arterielle Hypertonie, eine leicht-gradige COPD, ein Zustand nach kurativ
behandeltem Kolonkarzinom sowie ein Zustand nach Prostatakarzinom.
Handlungsoptionen mit dem je-weils angestrebten Behandlungsziel und dem zu erwartenden weiteren Verlauf: Option 1: Fortsetzung der Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr über die PEG-Sonde mit dem Ziel der Lebensverlänge-rung, Fortführung der medikamentösen Therapie. Voraussichtlich kann das Leben des Patienten auf diese Weise für einige Monate oder auch Jahre verlän-gert werden. Nach Einschätzung der Psy-chiaterin wird sich der psychische Zu-stand des Patienten nicht mehr verbes-sern lassen, sodass er aller Voraussicht nach vollkommen in sich zurückgezo-gen und mutmaßlich in depressiver Stimmungslage weiterleben wird. Opti-on 2: Verzicht auf lebensverlängernde Behandlungsmaßnahmen mit dem Ziel, dem Patienten ein Sterben unter best-möglicher Palliativversorgung zu er-möglichen: Einstellung der Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr über die PEG-Sonde, Nahrung und Flüssigkeit oral an-bieten sowie ausschließlich leidenslin-dernde medikamentöse Therapie. Sofern der Patient dann weiter die angebotene Nahrung und Flüssigkeit konsequent verweigert, wird er in absehbarer Zeit (max. ca. 2 Wochen) versterben.
Ethische Verpflichtungen gegen-über dem Patienten I: Wohltun und Nichtschaden
Mit Option 1 kann das Leben des Patien-ten zwar für eine begrenzte Zeit verlän-gert, aber die eingeschränkte Lebens-qualität nicht verbessert werden. Die künstliche Ernährung sollte ursprüng-lich die – mutmaßlich – vorübergehende Nahrungsverweigerung während einer depressiven Phase überbrücken. Auch nach intensiver, mehrmonatiger psychi-atrischer Behandlung konnte das dama-lige Therapieziel aber nicht erreicht wer-den. Der Patient wird voraussichtlich weiter in seiner eigenen Welt leben, ohne am sozialen Leben teilzunehmen und – soweit man das von außen anhand seines Verhaltens beurteilen kann – ohne Lebensfreude und einen erkennbaren Lebenswillen. Insofern erscheint es aus der Fürsorgeperspektive zumindest fraglich, ob die Fortsetzung der lebensverlängernden Behandlungen
* Einige für diesen Bericht nicht relevante Details wurden verfremdet, um den Fall zu anonymisieren.
Marckmann, Behringer, in der Schmitten:Beendigung der Sondenernährung in einer Pflegeeinrichtung: Eine ethische FalldiskussionTerminating Tube Feeding in the Nursing Home: an Ethical Case Discussion
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
123
einschließlich der Nahrungs- und Flüs-sigkeitszufuhr des Patienten noch einen Nutzen bietet. Den ethischen Prinzipien des Wohltuns und Nichtschadens ge-mäß ist folglich am ehesten die Option 2, der Verzicht auf lebensverlängernde Behandlungsmaßnahmen geboten.
Eine Komplikation des Falls ist durch die schwere chronische Depressi-on gegeben. Für den Fall einer Depressi-on gilt grundsätzlich, dass zunächst eine (in diesem Fall ausschließlich medika-mentöse) Therapie versucht werden sollte, um dem aus psychiatrischen Gründen erloschenen Lebenswillen wie-der Raum und Nahrung zu geben. Die psychiatrische Erkrankung dieses Pa-tienten ist jedoch seit Jahren therapiere-fraktär. Es ist zwar nicht sicher, aber doch höchstwahrscheinlich, dass auch und gerade im jetzigen Stadium keine medikamentöse Heilung oder Lin-derung der Depression erreichbar sein wird.
Ethische Verpflichtungen gegen-über dem Patienten II: Respekt vor der Autonomie
Da der Patient seit 2 Monaten nicht mehr spricht, lässt sich schwer beurtei-len, inwieweit er aktuell versteht, was man ihm sagt. Ein von dem Patienten selbst konkret und explizit geäußerter Behandlungswille liegt somit nicht vor. Der Sohn berichtet, dass der Patient es in der Vergangenheit abgelehnt hatte, eine Patientenverfügung zu erstellen. Er habe früher bereits versucht, freiwillig auf Nahrung und Flüssigkeit zu verzich-ten, dies aber nie länger als einen Tag durchgehalten. Der Anlage der PEG-Sonde vor ca. 3 Jahren hatte der Patient unter der Voraussetzung zugestimmt, dass sie nur zur Medikamentengabe ge-nutzt werde; es lässt sich nicht eruieren, unter welchen Umständen und mit wel-cher Begründung die künstliche Ernäh-rung zwischenzeitlich ungeachtet dieses Vorbehalts begonnen und wie dies ge-genüber dem Patienten kommuniziert wurde. Da der Patient schon damals in einem besseren gesundheitlichen Zu-stand eine Nahrungs- und Flüssigkeits-zufuhr über die PEG-Sonde abgelehnt hatte, erscheint es sehr unwahrschein-lich, dass er ihr in der aktuellen Situati-on zustimmen würde. Vielmehr war schon die früher begonnene Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr rückblickend
nicht durch den Willen des Patienten legitimiert.
Zu berücksichtigen sind zudem die aktuellen Verhaltensäußerungen des Pa-tienten: Er verweigert konsequent die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit. Bis vor Kurzem hatte er dabei noch diffe-renziert: Beim Anreichen von Nahrung, nicht aber bei der Mundpflege kniff er die Lippen zusammen. Da es keinen Hin-weis auf eine Schluckstörung gibt (bei der der Patient möglicherweise aus Angst vor dem Verschlucken den Mund nicht geöffnet hätte), handelt es sich wahr-scheinlich um seine bewusste Entschei-dung, Nahrung und Flüssigkeit zu ver-weigern. Die Teilnehmer an der ethi-schen Fallbesprechung – insbesondere auch der Sohn – sind deshalb überzeugt, dass in der vorliegenden Situation der Verzicht auf eine Nahrungs- und Flüssig-keitszufuhr (Option 2) am ehesten dem Willen des Patienten entspricht.
Ethische Verpflichtungen gegen-über Dritten (Gerechtigkeit)
Bedürfnisse Dritter sind in der vorlie-genden Situation nicht erkennbar rele-vant für die Entscheidungsfindung. Eine emotionale Überlastung des Sohns durch ein fortgesetztes (vermeintliches) Leiden des Patienten (mit der Folge pro-jektiver Zuschreibungen und einer For-derung nach Therapieabbruch zur eige-nen Entlastung) ist prinzipiell vorstell-bar, im vorliegenden Fall findet sich da-rauf jedoch kein Hinweis.
Synthese und Planung des weiteren Vorgehens
Sowohl die Fürsorge- als auch die Auto-nomieverpflichtungen sprechen für Handlungsoption 2, d.h. eine Änderung des Therapieziels hin zu einer aus-schließlichen Leidenslinderung. Die Teilnehmer der ethischen Fallbespre-chung sind sich deshalb einig, dass die Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr über die PEG-Sonde eingestellt und die medi-kamentöse Therapie auf eine reine Symptomkontrolle beschränkt werden sollen. Die genaue Ausgestaltung der Therapie übernehmen die behandeln-den Ärzte. Dem Patienten soll weiterhin mehrmals täglich Nahrung und Flüssig-keit oral angeboten werden, damit er bei einem aufkommenden Hunger- oder Durstgefühl die Möglichkeit hat, seine
Nahrungsverweigerung aufzugeben. Für den Fall einer sich ändernden Situation wird eine weitere Ethikberatung ange-boten.
Kritische Reflexion
Im Rahmen der kritischen Reflexion ist noch einmal zu überlegen, wie verläss-lich die dem Ergebnis zugrundeliegen-den Argumente sind. Hier ist u.a. zu prü-fen, ob erstens bei der psychiatrischen Erkrankung des Patienten wirklich alle Behandlungsmöglichkeiten ausge -schöpft sind und ob zweitens der Patient Nahrung und Flüssigkeit nicht aus Angst vor dem Verschlucken (oder anderen einschlägigen Gründen, z.B. unbehan-delte Zahnerkrankung) verweigert. Si-cher wäre es günstig gewesen, bereits zu einem deutlich früheren Zeitpunkt eine ethische Fallbesprechung durchzufüh-ren, um mit Sohn, Pflegepersonal und Hausarzt zu klären, ob der Beginn bzw. die fortgesetzte Nahrungs- und Flüssig-keitszufuhr über die PEG-Sonde über-haupt durch das (mutmaßliche) Einver-ständnis des Patienten legitimiert war.
Weiterer Verlauf
Am Tag nach der ethischen Fallbespre-chung gibt es kontroverse Diskussionen mit einzelnen Pflegekräften des Wohn-bereichs, die (anders als die Bezugspfle-gekraft) nicht an der Besprechung teil-genommen haben, sich mit der Ent-scheidung schwertun und die Frage auf-werfen, ob nicht das Betreuungsgericht eingeschaltet werden müsste. Dies ist aber gemäß § 1904 BGB, Abs. 4 nur erfor-derlich, wenn sich der behandelnde Arzt und der gesetzliche Vertreter nicht eini-gen können, welche Behandlungsmaß-nahmen dem Willen des Patienten ent-sprechen. Da in der Fallbesprechung aber Einigkeit zwischen allen Beteiligten erzielt und nachdem dies auch den nicht an der Fallbesprechung beteiligten Pfle-gekräften verständlich gemacht wurde, beenden Hausärztin und Pflegeteam in Abstimmung mit dem Palliativarzt noch am selben Tag die Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit über die PEG-Sonde und passen Medikamente und pflegerische Maßnahmen dem nunmehr ausschließ-lich palliativen Behandlungsziel an. Der Patient verstirbt nach neun Tagen unter einer niedrig dosierten subkutanen In-jektionstherapie mit Morphin, Halope-
Marckmann, Behringer, in der Schmitten:Beendigung der Sondenernährung in einer Pflegeeinrichtung: Eine ethische FalldiskussionTerminating Tube Feeding in the Nursing Home: an Ethical Case Discussion
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
124
Univ.-Prof. Dr. med. Georg Marckmann,
MPH
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie
der Medizin
Ludwig-Maximilians-Universität München
Lessingstr. 2, 80336 München
Korrespondenzadresse
ridol und Midazolam, die zwei Tage vor seinem Tod begonnen wurde und eine effektive Symptomkontrolle gewährleis-tet. Der Sohn erlebt die Entscheidung auch im Nachhinein als richtig und ist erleichtert, dass so gehandelt wurde.
Diskussion
Im vorliegenden Fall steht die Frage der fortgesetzten Sondenernährung im Vor-dergrund. Letztlich geht es dabei aber – und das ist eine häufige Beobachtung bei Ethikberatungen – nicht primär um die Durchführung einer bestimmten Be-handlungsmaßnahme, sondern um die Frage, was in der vorliegenden Lebens- und Behandlungssituation für die be-troffene Person das für sie (mutmaßlich) richtige Behandlungsziel ist und welche Belastungen und Risiken sie (mutmaß-
lich) dafür bereit ist, in Kauf zu nehmen. So weit wie möglich ist diese Frage mit den Betroffenen jeweils selbst zu bespre-chen. Der vorliegende Fall verdeutlicht, wie schwierig diese Entscheidungen sein können, wenn die Patienten einge-schränkt oder nicht mehr einwilligungs-fähig sind. Bei prognostisch schwierigen Entscheidungssituationen oder einem nicht eindeutig auf die vorliegende Si-tuation anwendbaren Patientenwillen kann eine moderierte ethische Fall-besprechung mit allen beteiligten Perso-nen hilfreich sein, um eine Entschei-dung im besten Interesse des Patienten zu treffen. Der vorliegende Fall zeigt, wie wichtig es dabei ist, alle für die Entschei-dung relevanten Akteure einzubeziehen, damit das Ergebnis in der Folge auch von allen mitgetragen werden kann.
Frühzeitige Gespräche mit den Be-troffenen, wie sie mit entsprechend qua-
lifizierter Unterstützung im Rahmen von „Behandlung im Voraus planen“ („Ad-vance Care Planning“) regelhaft angebo-ten wird, können helfen, noch bei erhal-tener Entscheidungsfähigkeit die ange-strebten Ziele und gewünschten Maß-nahmen zu ermitteln und aussagekräftig zu dokumentieren [5]. Dies gewährleis-tet nicht nur bestmöglich die Selbst-bestimmung der Betroffenen, sondern kann überdies Entscheidungskonflikte wie im vorliegenden Fall vermeiden und die beteiligten Personen, v.a. die Ange-hörigen, erheblich entlasten [6].
Interessenkonflikte: Georg Marck-mann arbeitet als Trainer für Ethikbera-tung im Gesundheitswesen und hat Ho-norare aus Ethikberatungs-Schulungen erhalten. Darüber hinaus geben die Au-toren an, dass keine Interessenkonflikte bestehen.
1. Coors M, Simon A, Stiemerling M (Hrsg.). Ethikberatung in Pflege und ambulanter Versorgung. Modelle und theoretische Grundlagen. Lage: Jacobs Verlag, 2015
2. Thiersch S, Jox RJ, Marckmann G. Außerklinische Ethikberatung: Unter-stützung bei ethischen Fragen in der ambulanten Versorgung. Dtsch Med Wochenschr 2017; 142: 453–456
3. Krause-Michel B, Klein A, Thiersch S. Außerklinische Ethikberatung. Ein Er-fahrungsbericht aus der Praxis. Bayer Arztebl 2014: 642–644
4. Marckmann G, Behringer B, in der Schmitten J. Ethische Fallbersprechun-gen in der hausärztlichen Versorung: Ein Leitfaden für die Praxis. Z Allg Med 2018; 94: 116–120
5. In der Schmitten J, Nauck F, Marck-mann G. Behandlung im Voraus pla-
nen (Advance Care Planning): ein neu-es Konzept zur Realisierung wirksamer Patientenverfügungen. Palliativmedi-zin 2016; 17: 177–195
6. Detering KM, Hancock AD, Reade MC, Silvester W. The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial. BMJ 2010; 340: c1345
Literatur
Marckmann, Behringer, in der Schmitten:Beendigung der Sondenernährung in einer Pflegeeinrichtung: Eine ethische FalldiskussionTerminating Tube Feeding in the Nursing Home: an Ethical Case Discussion
… hat Medizin und Philosophie an der Universität Tübingen
sowie Public-Health an der Harvard Universität studiert.
1998–2010 Mitarbeiter am Tübinger Institut für Ethik und
Geschichte der Medizin, 2003 Habilitation für das Fach
„Ethik in der Medizin“. Seit 2010 Leiter des Instituts für Ethik,
Geschichte und Theorie der Medizin an der LMU München, seit 2012 Präsident der Akademie für Ethik in der Medizin.
Prof. Dr. med. Georg Marckmann, MPH …
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
125DEGAM-LEITLINIE / DEGAM GUIDELINE
DEGAM S1-Handlungsempfehlung – AWMF-Register-Nr. 053-007
AutorenM. Scherer, J-F. Chenot
Konzeption und wissenschaftliche RedaktionSLK-Leitungsteam
Nackenschmerzen
Nach Ätiologie
nicht spezifi sch spezifi sch
keine spezifi sch behandlungs- oderabklärungsbedürftige Ursache
Verdacht auf radikuläre Reizung, Trauma,Z.n. Operation, Systemerkrankung etc.
Osteoporose oder Langzeitmedikation mit Steroiden; Hinweis auf Systemerkrankung/Extravertebrale Ursache (Neoplasie, Infektion, Entzündung): Fieber, reduzierter Allgemein-zustand, Gewichtsverlust
Bei subakuten u. chronischen Nackenschmerzen kann Krankengymnastik angeboten werden.
Ruhigstellungen sollen nicht durchgeführt werden. Injektionstherapien sollen nicht durchgeführtwerden.
Muskelrelaxanzien sollen nicht empfohlen werden.
Defi nitionSchmerz in dem Gebiet, das nach oben durch die Linea nuchalis superior, nach unten durch den ersten Brustwirbel und seitlich durch die schultergelenksnahen Ansätze des Musculus trapezius begrenzt wird. Klinisch und anamnestisch sind Nackenschmerzen nicht immer von Schulterschmerzen abgrenzbar.
Epidemiologie/VersorgungsproblemNackenschmerzen sind mit einer Punktprävalenz von etwa 10–15 % ein häufi ger Beratungsanlass. In Hausarztpraxen machen Nackenschmerzen 4 % aller Beratungsanlässe aus. Unter dem Druck der eigenen und der Patientenerwartung werden häufi g Verfahren angewendet, die auf einen schnellen Behandlungserfolg zielen. Die Wirksamkeit und die Nachhaltigkeit der meisten Behandlungsmaß-nahmen sind jedoch häufi g fraglich und unzureichend durch klinische Studien gestützt. Wesentlich bei Nackenschmerzen ist es, abwendbar gefährliche Verläufe auszuschließen und die Schmerzen zu lindern. Dabei soll auf Therapien fokussiert werden, deren Wirksamkeit belegt ist.
Einteilung
Nach Dauer
akut 0–3 Wochen subakut 4–12 Wochen chronisch > 12 Wochen
Prognose/VerlaufWesentliche Bestandteile der Beratung sollten der zumeist harmlose Charakter der Nackenschmerzen, die hohe spontane Besserungstendenz und die Neigung zu Rezidiven sein. Die Grenzen von Diagnos-tik und Therapie sollten offen angesprochen werden. Patienten sollten auf mögliche Risikofaktoren für Nackenschmerzen aufmerksam gemacht (z.B. Übergewicht, Schwangerschaft und Arbeitssituation) und offen auf chronischen Stress, Depressivität oder Ängstlichkeit angesprochen werden. Patienten, die regelmäßig NSAR einnehmen, sollten auf mögliche Nebenwirkungen hingewiesen werden.
Hinweise auf abwendbar gefährliche Verläufe
Trauma, Zustand nach Operation Neurologie: radikuläre Symptomatik, sensible oder moto-rische Ausfälle, Parästhesien, Meningismus, Bewusstseinsstörung, gleichzeitige Kopf-schmerzen mit Übelkeit, Erbrechen, Schwindel
Diagnostik nicht spezifi scher Nackenschmerz Anamnese und körperliche Untersuchung (siehe Algorithmus auf Seite 2) Keine Bildgebung ohne Hinweis auf spezifi sche Ursache oder abwendbar gefährlichen Verlauf
Therapie nicht spezifi scher Nackenschmerz Beratung zum Selbstmanagement Bewegung soll empfohlen werden. Lokale Wärme kann empfohlen werden. Kurzfristig können NSAR empfohlen werden. Mobilisation (u.a. postisometrische Relaxation),
Manipulationen können angeboten werden.
DOI 10.3238/zfa.2018.0125–0126
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
126 DEGAM-LEITLINIE / DEGAM GUIDELINE
DEG
AM
Kurzversion
DEGAM-LeitlinienHilfen für eine gute Medizin
© DEGAM 2016www.degam-leitlinien.de
AWMF-Register-Nr. 053-007
Verdacht auf eine ernste Ursache
Überweisung/Einweisung
Neurologie/Orthopädie/Innere Medizin
Anamnese und Untersuchung
Schmerzcharakteristika Ausstrahlung in den Arm (dermatombezogen/dermatomübergreifend) Motorische Ausfälle/Taubheitsgefühl/Parästhesien (dermatombezogen) Eigene Behandlungsversuche (u.a. Medikamente) Allgemeinzustand Trauma in der Vorgeschichte Systemerkrankungen (Neoplasie, Osteoprose) Steroidmedikation Risikofaktoren für chronische Verläufe (Arbeit, Stimmungsanlage)
Inspektion: Haltung, Deformitäten, Verletzungszeichen, MobilitätPalpation: Dornfortsätze und Querfortsätze, muskuläre Verspannungen, HauttemperaturBeweglichkeitsprüfung: Ante-, Retrofl exion, Rotation und Seitneigung
Nichtspezifi sche Nackenschmerzen
Spezifi sch behandelbare Ursache unwahr-scheinlich, kein abwendbar gefährlicher Verlauf erkennbar
Spezifi sche Nackenschmerzen
Hinweis auf eine eindeutige Ursache der Symptome(Neurologie, Trauma, Systemerkrankung)
Weitere Diagnostik Bildgebung Labor Elektrophysiologie
Therapie
NSAR Frühe Wiederaufnahme der AktivitätBewegungsempfehlungMobilisation/Manipulation
NSARKrankengymnastik, Manipu-lation/Mobilisation Postiso-metrische Relaxation, Bewegungsempfehlung
Krankengymnastik,Manipulation/Mobilisation, Akupunktur,Erlernen eines Entspan-nungsverfahren,Verhaltenstherapie
Notfall
Abklärungsofort
Dauer
Akut0–3 Wochen
Subakut4–12 Wochen
Chronisch>12 Wochen
Jahrbuch :Ihr Blick über den Tellerrand
Ja, hiermit bestelle ich mit -tägigem Widerrufsrecht
Ex. Perspektiven Jahrbuch , €
€
Direkt bestellen: www.aerzteverlag.de/shop>Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands bei Online-BestellungE-Mail: [email protected] I Telefon: -
Herr Frau
Name, Vorname
Fachgebiet
Klinik/Praxis/Firma
Straße, Nr. PLZ, Ort
E-Mail-Adresse (Die Deutsche Ärzteverlag GmbH darf mich per E-Mail zuWerbezwecken über verschiedene Angebote informieren)
Datum Unterschrift
Deutscher Ärzteverlag GmbHKundenservicePostfach Köln
Ausfüllen und an den Deutschen Ärzteverlag senden.Fax und fertig:
02234 7011476oder per Post
IrrtümerundPreisänderungenvorbehalten.Preisezzgl.Versandkosten
€.DeutscherÄrzteverlagGmbH–SitzKöln–HRBAmtsgericht
Köln.Geschäftsführung:NorbertA.Froitzheim,JürgenFührer
In diesem Sammelband finden Sie alle Ausgaben der Perspektiven,die als Beilage im Deutschen Ärzteblatt erschienen sind. DasJahrbuch bietet Ihnen ein fächerübergreifendes Kurzkompendiumzu aktuellen Entwicklungen und Neuigkeiten:Eine kompakte Übersicht zu den dargestellten Fächern –mit direktem Praxisbezug!
▪ Diabetologie
▪ Infektiologie
▪ Kardiologie
▪ Neurologie
▪ Onkologie
▪ Pneumologie & Allergologie
> Bestellen Sie jetzt Ihren Sammelband mitwichtigen Neuigkeiten aus Ihren Nachbardisziplinen
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
128 ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPER
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung: Erste Erfahrungen von Patienten und HausärztenSpecialized Outpatient Care: First Experiences of Patients and Family PractitionersFlorian Kaiser, Ulrich Kaiser, Daniela Utke, Stefanie Schattenkirchner, Ursula Vehling-Kaiser
Klinik für Hämatologie und Medizinische Onkologie, Universitätsmedizin Göttingen Peer-reviewed article eingereicht 26.12.2017, akzeptiert 10.02.2018 DOI 10.3238/zfa.2018.0128–0133
Hintergrund: Als Weiterentwicklung des §116b SGB V trat im Jahr 2012 die gesetzliche Grundlage für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) von komplexen, selte-nen und schwer therapierbaren Erkrankungen in Deutsch-land in Kraft. Zielsetzung ist u.a. eine intensivierte interdis-ziplinäre Patientenversorgung – sowohl durch ambulant als auch stationär tätige Ärzte. In dieser Erhebung sollen nun erstmals die Erfahrungen mit einer „ASV für gastrointestinale Tumore und Tumore der Bauchhöhle“ aus Sicht von Haus-ärzten und Patienten systematisch erfasst werden. Methoden: Nach einem Jahr ASV-Tätigkeit wurden alle, im Einzugsgebiet der untersuchten ASV praktizierenden Hausärzte sowie alle vom 1.7.2015 bis zum 30.6.2016 durch die ASV versorgten Patienten in die Untersuchung eingeschlossen. Die Erfassung von Zufriedenheit und Er-fahrung mit der ASV erfolgte für Hausärzte mittels eines hierzu entwickelten Fragebogens und für die ASV-Patien-ten mittels des Fragebogens „Zufriedenheit in der ambu-lanten Versorgung – Qualität aus Patientenperspektive“.Ergebnisse: Von 160 behandelten ASV-Patienten konn-ten 71 in die Befragung eingeschlossen werden. Die ska-lierte (0–100) Zufriedenheit mit der ASV lag für die Di-mensionen „Organisation“ bei 82, „Information“ bei 78, „Interaktion“ bei 87, „Fachkompetenz“ bei 88 und „Ein-bindung in Entscheidungsprozesse“ bei 77. Von 163 an-gefragten Hausärzten nahmen 46 an der Untersuchung teil. 80 % war die ASV als Institution bekannt, 50 % kann-ten ein lokales ASV-Team. 78 % hatten Interesse an einer Zusammenarbeit mit der ASV und 76 % wünschten sich weitergehende Informationen.Schlussfolgerungen: Insgesamt zeigt sich – unter Be-rücksichtigung einiger Kritikpunkte – bei den befragten Pa-tienten ein positiver Trend in der Bewertung der ASV als neue Versorgungsstruktur im Gesundheitswesen. Von Sei-ten der Hausärzte konnte Interesse an einer interdisziplinä-ren Zusammenarbeit mit der ASV nachgewiesen werden.
Schlüsselwörter: ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV); Patientenzufriedenheit; Hausärzte
Background: As a further development of Section 116b of the German Social Code Book 5, the legal basis for specialized outpatient medical care (ASV) for complex, rare, and difficult-to-treat diseases became effective in Germany in 2012. The objective is, among others, to de-velop an intensified interdisciplinary patient care both by outpatient as well as inpatient doctors. In this survey, only the experiences with „specialized outpatient medical care for gastrointestinal tumors and tumors of the abdominal cavity“ are recorded from the point of view of family practitioners (FPs) and patients.Methods: After one year of ASV activity, all FPs from the area of specialized outpatient medical care as well as all patients treated using ASV from July 1, 2015 to June 30, 2016 were included in the assessment. The compilation of data on satisfaction and experience with ASV was done for FPs using a questionnaire and for ASV patients using the questionnaire „Satisfaction in Outpatient Care: Quality from the Patient‘s Perspective.“Results: Among the 160 patients treated with ASV, 71 were included in the survey. Satisfaction with the ASV was scaled (0–100) and was for „Organization“ 82, „In-formation“ 78, „Interaction“ 87, „Expertise“ 88, and „In-volvement in decision-making“ 77. Among the 163 FPs who were surveyed, 46 participated in the study. Ap-proximately 80 % of FPs knew about ASV, 50 % knew a local ASV team, 78 % were interested in working in the area of ASV, and 76 % wanted more information.Conclusions: Overall, among the surveyed patients, tak-ing into consideration some criticized points, there is a positive trend in the evaluation of ASV as a new health care structure. Interest on the part of FPs in an interdisci-plinary cooperation with ASV could be proven.
Keywords: specialized outpatient medical care; patient satisfaction; family practitioners
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
129
Hintergrund
Die Versorgung von Patienten mit kom-plexen, seltenen und schwer therapier-baren Erkrankungen erfordert häufig die Betreuung durch ein interdisziplinäres Ärzteteam, das hochspezialisierte Leistun-gen anbieten kann. Hierfür wurde im GKV-Versorgungsstrukturgesetz §116b SGB V ein neuer Versorgungsbereich ge-schaffen: die Richtlinie über die ambulan-te spezialfachärztliche Versorgung (ASV-RL) [1, 2] (§116b „neu“). Die ASV stellt ei-ne Weiterentwicklung des 2004 einge-führten §116b SGB V – Richtlinie über die ambulante Behandlung im Krankenhaus (ABK-RL) [3] – dar (§116 b „alt“). In der ASV werden Patienten seit 2012 von Ver-tragsärzten und Krankenhausärzten nach einheitlichen Rechtsvorschriften gemein-sam ambulant versorgt.
Die vom Gemeinsamen Bundesaus-schuss (GBA) geforderten Voraussetzun-gen zur Gründung eines ASV-Teams sind anspruchsvoll [1, 2]. Unter anderem müssen ein interdisziplinäres ASV-Team und hinzuzuziehende Fachärzte ein sehr breites Spektrum an spezialisierten me-dizinischen Leistungen abdecken.
Die ASV ist vorgesehen für Erkran-kungen mit besonderen Krankheitsver-läufen (inklusive schweren Verlaufsfor-men), seltene Erkrankungen und hoch-spezialisierte Leistungen [1, 2]. Der ASV-Leistungskatalog in der Onkologie um-fasst aktuell gastrointestinale (seit 07/2014) [4] und gynäkologische Tumo-re (seit 08/2016) [5].
Der Diskurs zur ASV wird zurzeit v.a. durch Expertenmeinungen bestimmt. Systematische Untersuchungen liegen bis dato kaum vor. Besonders kritisch werden hohe Anforderungen und büro-kratische Hürden bei der Gründung ei-nes ASV-Teams, starre Reglementierun-gen und ein komplexes Abrechnungs-wesen bewertet [6, 7]. Andererseits be-scheinigten bereits aktive ASV-Teams ei-nen positiven Effekt der ASV auf lokale Versorgungsstrukturen, insbesondere durch eine Verbesserung der intersekto-ralen Vernetzung und der Patientenver-sorgung [6, 8].
Für eine gelungene onkologische Versorgung ist neben kooperierenden Fachspezialisten auch die hausärztliche Versorgung entscheidend. Eine intersek-torale Verknüpfung wird gefordert [9, 10] und ist bei neu eingeführten Versor-gungsstrukturen im fachärztlichen Be-
reich von besonderer Bedeutung. Vo-raussetzung ist eine ausreichende Infor-mation und Akzeptanz. Über die Zusam-menarbeit von Hausärzten und ASV ist bisher wenig bekannt.
Aktuelle Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Zufriedenheit von Pa-tienten mit der onkologischen Versor-gung eine immer größere Bedeutung für die Krankheitsbewältigung spielt [11]. Besonders bei neuen Versorgungs-modellen sollte dieser Faktor berück-sichtig werden; für die ASV liegen kaum Daten vor.
Im Folgenden sollen Verhältnis und Kenntnisstand von Hausärzten zu einer ASV und die Zufriedenheit von Patien-ten mit der Betreuung in einer ASV un-tersucht werden.
Methoden
Ärztebefragung
Alle, im Einzugsgebiet der untersuchten ASV tätigen Hausärzte wurden schrift-lich (Fax/postalisch) zur Teilnahme an diesem Projekt eingeladen. Die Erfas-sung erfolgte über die Registrierung bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Auf Basis bisher publizierter Hausarzt-befragungen [10, 12] wurde ein Fragebo-gen (ja/nein-Fragen) mit zehn Items zu den Dimensionen “Kenntnisstand zur ASV“, “Zusammenarbeit mit der ASV“ und “Informationsbedarf zur ASV“ ent-wickelt. Weiterhin wurden strukturelle und soziale Daten (Alter, Geschlecht, Praxisstruktur, Ausbildung) erfasst.
Patientenbefragung
Nach einjähriger Tätigkeit eines ASV-Teams für die Betreuung gastrointestina-ler Tumore (07/2015–06/2016) wurden im Rahmen eines Qualitätssicherungs-projektes alle versorgten Patienten so-wie alle Hausärzte im Einzugsbereich der ASV befragt. Die Befragung erfolgte von 09–10/2016.
Die Befragung der ASV-Patienten er-folgte in schriftlicher Form mittels des „ZAP-Fragebogen zur Zufriedenheit in der ambulanten Versorgung – Qualität aus Patientenperspektive“ [13] in seiner neuesten Version (ZAP revisited) [14]. Der ZAP-Fragebogen wurde als standar-disiertes, patientenzentriertes Instru-ment zur Erfassung der Patientenzufrie-
denheit entwickelt. Er besteht aus 32 Items mit je vier Antwortmöglichkei-ten. Jeder Patient wurde über die Befra-gung informiert und erhielt den Fra-gebogen entweder persönlich oder pos-talisch zugestellt.
Die Auswertung der Fragebögen er-folgte mit dem Auswertungstool der Kas-senärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Neben der deskriptiven Auswertung wur-den die einzelnen Items thematisch in verschiedene Dimensionen gruppiert, die Antwortmöglichkeiten in Zahlenwer-te umcodiert und addiert. Dadurch wur-den je Dimension Skalenrohwerte er-stellt, die in eine Skala von 0–100 umge-rechnet wurden, wodurch einheitliche Wertebereiche ermöglicht werden [15].
Die ermittelten Daten wurden de-skriptiv mittels Microsoft Excel 2013 ausgewertet.
Die Ethikkommission Bayern wurde über das Projekt informiert, ein gesonder-tes Ethikvotum war nicht erforderlich.
Ergebnisse
160 Patienten wurden im untersuchten Zeitraum im Rahmen der ASV versorgt. Die Aufnahme erfolgte über die teilneh-mende onkologische Praxis (152 Patien-ten) und das teilnehmende Krankenhaus (acht Patienten). Von 160 ASV-Patienten waren 55 Patienten zum Untersuchungs-zeitpunkt verstorben, 34 Patienten lehn-ten die Teilnahme ab. 71 Fragebögen (68 %) wurden beantwortet und aus-gewertet. 42 Patienten waren männlich, 26 weiblich; bei drei lagen keine Angaben (k.A.) vor. 68 % der Patienten waren über 60 Jahre alt. Die häufigsten, in der ASV behandelten Karzinome waren lokali-siert in Kolon (25 %), Rektosigmoid (23 %), Magen (15 %) und Pankreas (14 %). Die Auswertung der ZAP-Bögen findet sich in Tabelle 1.
Von 163 befragten Hausärzten ant-worteten 29 % (n = 46). Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgeführt.
Diskussion
Im Fokus der vorliegenden Unter-suchung lag die Akzeptanz und Zufrie-denheit mit einer “ASV für gastrointesti-nale Tumore und Tumore der Bauch-höhle“ bei Patienten und Hausärzten. Die Untersuchung wurde – im Sinne ei-
Kaiser et al.:Ambulante spezialfachärztliche Versorgung: Erste Erfahrungen von Patienten und HausärztenSpecialized Outpatient Care: First Experiences of Patients and Family Practitioners
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
130
Kaiser et al.:Ambulante spezialfachärztliche Versorgung: Erste Erfahrungen von Patienten und HausärztenSpecialized Outpatient Care: First Experiences of Patients and Family Practitioners
Globale Zufriedenheit mit den ASV-Ärzten:
Qualität/Ausmaß der erhaltenen Informationen (Zufriedenheit als skalierter Mittelwert: 84)
sehr unzufrieden
0 % (n = 0)
Beteiligung an medizinischen Entscheidungen (Zufriedenheit als skalierter Mittelwert: 84)
sehr unzufrieden
0 % (n = 0)
Allgemeine Zufriedenheit (Zufriedenheit als skalierter Mittelwert: 87)
sehr unzufrieden
0 % (n = 0)
Vertrauen (als skalierter Mittelwert: 90)
kein Vertrauen
0 % (n = 0)
Qualität der Behandlung (Zufriedenheit als skalierter Mittelwert: 85)
sehr gering
0 % (n = 0)
Zufriedenheit der Patienten mit der ASV (Detailauswertungen):
Organisation (Zufriedenheit als skalierter Mittelwert: 82)
Wartezeit Arzttermin
Wartezeit Praxis
Freundlichkeit Praxispersonal
Atmosphäre
Information (Zufriedenheit als skalierter Mittelwert: 78)
Erkrankungsursachen
Erkrankungsverlauf
Therapie
Wirkung Medikamente
Eigenbeitrag
Verständlichkeit
Beachtung Nebenwirkungen
Behandlungsmöglichkeiten
Arzt-Patienten-Interaktion (Zufriedenheit als skalierter Mittelwert: 87)
Behandlung als Mensch
Geduld
Zuspruch/Unterstützung
Ernst genommen werden
Gewidmete Zeit
Menschlichkeit
Einfühlungsvermögen
Verständnis
Fachkompetenz ASV-Ärzte/Kooperationen (Zufriedenheit als skalierter Mittelwert: 88)
Zusammenarbeit mit Externen
eher unzufrieden
6 % (n = 4)
eher unzufrieden
4 % (n = 3)
eher unzufrieden
6 % (n = 4)
eher weniger Ver-trauen
7 % (n = 5)
eher gering
6 % (n = 4)
eher zufrieden
34 % (n = 24)
eher zufrieden
39 % (n = 28)
eher zufrieden
28 % (n = 20)
eher großes Ver-trauen
21 % (n = 15)
eher hoch
34 % (n = 24)
sehr unzufrieden
1 % (n = 1)
4 % (n = 3)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
sehr unzufrieden
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
1 % (n = 1)
sehr unzufrieden
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
sehr unzufrieden
0 % (n = 0)
sehr zufrieden
55 % (n = 39)
sehr zufrieden
54 % (n = 38)
sehr zufrieden
63 % (n = 45)
großes Vertrauen
69 % (n = 49)
sehr hoch
58 % (n = 41)
eher unzufrieden
7 % (n = 5)
25 % (n = 18)
1 % (n = 1)
1 % (n = 1)
eher unzufrieden
7 % (n = 5)
7 % (n = 5)
6 % (n = 4)
11 % (n = 8)
16 % (n = 11)
10 % (n = 7)
11 % (n = 8)
10 % (n = 7)
eher unzufrieden
6 % (n = 4)
4 % (n = 3)
7 % (n = 5)
3 %(n = 2)
8 % (n = 6)
1 % (n = 1)
3 %(n = 2)
0 % (n = 0)
eher unzufrieden
1 % (n = 1)
keine Angaben
6 % (n = 4)
k.A.
3 % (n = 2)
k.A.
3 % (n = 2)
Arzt zu kurz be-kannt
1 % (n = 1)
k.A.
3 % (n = 2)
eher zufrieden
41 % (n = 29)
31 % (n = 22)
7 % (n = 5)
34 % (n = 24)
eher zufrieden
48 % (n = 34)
42 % (n = 30)
41 % (n = 29)
44 % (n = 31)
42 % (n = 30)
41 % (n = 29)
37 % (n = 26)
44 % (n = 31)
eher zufrieden
20 % (n = 14)
24 % (n = 17)
30 % (n = 21)
28 % (n = 20)
20 % (n = 14)
25 % (n = 18)
35 % (n = 25)
38 % (n = 27)
eher zufrieden
39 % (n = 28)
k.A.
1 % (n = 1)
sehr zufrieden
48 % (n = 34)
35 % (n = 25)
89 % (n = 63)
62 % (n = 44)
sehr zufrieden
44 % (n = 31)
49 % (n = 35)
49 % (n = 35)
39 % (n = 28)
32 % (n = 23)
39 % (n = 28)
44 % (n = 31)
37 % (n = 26)
sehr zufrieden
70 % (n = 50)
65 % (n = 46)
56 % (n = 40)
63 % (n = 45)
65 % (n = 46)
68 % (n = 48)
56 % (n = 40)
56 % (n = 40)
sehr zufrieden
54 % (n = 38)
k.A.
3 % (n = 2)
4 % (n = 3)
3 %(n = 2)
3 %(n = 2)
k.A.
1 % (n = 1)
1 % (n = 1)
4 % (n = 3)
6 % (n = 4)
10 % (n = 7)
10 % (n = 7)
8 % (n = 6)
8 % (n = 6)
k.A.
4 % (n = 3)
7 % (n = 5)
7 % (n = 5)
6 % (n = 4)
7 % (n = 5)
6 % (n = 4)
6 % (n = 4)
6 % (n = 4)
k.A.
6 % (n = 4)
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
131
nes Qualitätssicherungsprojektes – mo-nozentrisch durchgeführt.
Patientenbefragung
Von 105 befragten Patienten nahmen 71 (68 %) an der vorliegenden Unter-suchung teil. Eine ausreichende Reprä-sentativität und Rücklaufquote ist gege-ben [15]. Ursächlich scheint die Art der Befragung zu sein, die z.T. mittels per-sönlicher Ansprache durch das ASV-Per-sonal erfolgte [15]. Die Häufigkeitsver-teilung der behandelten Tumorentitä-ten und ein vermehrtes Erkrankungs-alter über 60 Jahre decken sich weit-gehend mit den Daten des deutschen Krebsregisters [16].
Alle infrage kommenden Patienten stimmten der Aufnahme in die ASV zu. Dies könnte für den Wunsch der Patien-ten nach einer strukturierten und orga-nisierten Versorgung sprechen. Zuwei-sungen in die ASV erfolgten überwie-gend durch die onkologische Praxis. Einweisungen durch externe Ärzte bzw. Hausärzte erfolgten nicht und durch das teilnehmende Krankenhaus nur selten. Dies könnte durch die bereits bestehen-den lokalen Netzwerkstrukturen [17] be-gründet sein bzw. durch informelle und strukturelle Anfangsprobleme nach nur einem Jahr ASV-Tätigkeit.
Die globale Bewertung der ASV durch die Patienten zeigte prinzipiell sehr positive Resultate (Skalenwerte stets > 84). Vor allem die Kategorien “Allgemeine Zufriedenheit“ (Skalen-wert 87) und “Vertrauen“ wurden be-sonders gut bewertet. Eine grundsätzli-che Akzeptanz der ASV und ihrer Struk-turen scheint von Patientenseite gege-ben.
In Relation zu den ZAP-Standard-Re-ferenzwerten von fachärztlich betreuten
Patienten [15] zeigten sich vergleichbare Skalenwerte für die Patientenzufrieden-heit in den Dimensionen “Arzt-Patien-ten-Interaktion“ (ASV und Referenz [15] jeweils 87) und “Information“ (ASV 78 vs. Referenz 80 [15]). Damit messen ASV-Patienten dem Umgang zwischen Arzt und Patient sowie dem Informati-onsaustausch die gleiche Bedeutung und Güte zu wie Patienten der Norm-gruppe. Vor allem die “Behandlung als Mensch“ und die vermittelte “Mensch-lichkeit“ durch die Ärzte wurden als sehr zufriedenstellend bewertet. Die sozialen Grundvoraussetzungen einer gelun-genen Behandlung sind in der ASV gege-ben. Übereinstimmungen finden sich in den Bereichen “Fachkompetenz der ASV-Ärzte/Kooperationen“ (ASV 88 vs. Referenz 87 [15]) und Organisation (ASV 82 vs. Referenz 88 [15]). Kritisch ist die Wahrnehmung der Patienten zu beurtei-len: Im Gegensatz zu ASV-Ärzten [8] sa-hen Patienten keinen Unterschied im ärztlichen Überweisungs- und Koope-rationsverhalten sowie in der allgemei-nen Organisation im Vergleich zur Re-gelversorgung. Dies weist auf eine unter-schiedliche Wahrnehmung der Versor-gungsstrukturen durch Ärzte und Pa-tienten hin.
Analog zu einer Validierungsstich-probe der WINEG [18] trat die geringste Zufriedenheit bei ASV-Patienten in der Dimension “Einbindung in die Ent-scheidungsprozesse“ auf. Dies betraf die Gesamtbewertung und die Subitems. Bestmann begründete dies damit, dass sich ein vertrauensvolles Arzt-Patient-Verhältnis erst aufbauen muss [18]. Möglicherweise spielt dies bei Tumorpa-tienten, die erst maximal ein Jahr in der ASV behandelt wurden, eine Rolle. Den-noch fällt die Zufriedenheit in dieser Umfrage positiver als in der Referenz-
gruppe aus (Zufriedenheitsskala: ASV 77 vs. Referenz 73 [18]). Der multidiszipli-näre Therapieansatz der ASV, der eine in-tensivierte Kooperation der Beteiligten beinhaltet, scheint von den Patienten wahrgenommen zu werden. Von Bedeu-tung kann hier ein vermehrter interdis-ziplinärer Austausch der verschiedenen Behandler über den Patienten und die Patientenwünsche sein.
Hausarztbefragung
Nach deutschlandweiter Einführung der ASV im Jahr 2012 [1] hatten zum Er-hebungszeitpunkt (2016) 80 % der hausärztlich tätigen Ärzte von dem Be-stehen der ASV als Institution gehört. Zugrunde liegen dürften in erster Linie die, in den vorangegangenen vier Jahre publizierten Bekanntmachungen in der entsprechenden Fachliteratur. Aller-dings kannten erst 50 % der befragten Hausärzte ein ASV-Team in ihrem regio-nalen Einzugsgebiet, was am Ende auf die bis dato kurze Laufzeit der unter-suchten ASV zurückzuführen ist. Einge-schränkte Kenntnisse über die Möglich-keit einer lokalen ASV-Versorgung und wenig Erfahrung in der Zusammen-arbeit mit einer ASV (54 % der Befrag-ten) sind ein möglicher Grund für die fehlenden direkten ASV Zuweisungen durch Hausärzte. Die Diskrepanz zwi-schen dem “Wissen um eine ASV vor Ort“ (50 %) und der “Zusammenarbeit mit einer ASV“ (54 %) mag an Erfah-rungen außerhalb des untersuchten Einzugsgebietes liegen. Gleichzeitig be-steht ein großes Interesse der Hausärzte an einer Zusammenarbeit mit der ASV (78 %) sowie der Wunsch, über den Einschluss ihrer Patienten in die ASV informiert zu werden (83 %). Überein-stimmend konnte in verschiedenen In-
Kaiser et al.:Ambulante spezialfachärztliche Versorgung: Erste Erfahrungen von Patienten und HausärztenSpecialized Outpatient Care: First Experiences of Patients and Family Practitioners
Gründlichkeit und Sorgfalt
Überweisungsbereitschaft
Häufigkeit Einbindung in Entscheidungsprozesse (Zufriedenheit als skalierter Mittelwert: 77)
Angebot verschiedener Möglichkeiten
Diskussion der Vor- und Nachteile
Frage nach bevorzugter Möglichkeit
Einbindung in gewünschtem Maß
Tabelle 1 Zufriedenheit der Patienten in der ASV
0 % (n = 0)
0 % (n = 0)
sehr unzufrieden
1 % (n = 1)
0 % (n = 0)
1 % (n = 1)
0 % (n = 0)
4 % (n = 3)
1 % (n = 1)
eher unzufrieden
13 % (n = 9)
16 % (n = 11)
20 % (n = 14)
13 % (n = 9)
24 % (n = 17)
28 % (n = 20)
eher zufrieden
32 % (n = 23)
34 % (n = 24)
28 % (n = 20)
30 % (n = 21)
68 % (n = 48)
66 % (n = 47)
sehr zufrieden
45 % (n = 32)
44 % (n = 31)
42 % (n = 30)
51 % (n = 36)
4 % (n = 3)
4 % (n = 3)
k.A.
8 % (n = 6)
7 % (n = 5)
8 % (n = 6)
7 % (n = 5)
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
132
terviewstudien gezeigt werden, dass in-terdisziplinäre Kooperation als Grund-lage für eine gelungene onkologische Versorgung/Therapie angesehen wird [9]. Besonders Hausärzte scheinen nach
gemeinsamer Kommunikation [10] und Kooperation [19] mit Spezialisten zu streben. Hierfür spricht auch das In-teresse der Hausärzte (76 %) an wei-teren Informationen über die ASV. Eine
schriftliche Information scheint hier-bei im Vergleich zu Fortbildungsver-anstaltungen – a.e. aus zeitlichen/öko-nomischen Gründen – das probatere Medium zu sein.
Kaiser et al.:Ambulante spezialfachärztliche Versorgung: Erste Erfahrungen von Patienten und HausärztenSpecialized Outpatient Care: First Experiences of Patients and Family Practitioners
Soziale/Strukturelle Angaben
Alter
< 30
0 % (n = 0)
Geschlecht
Männlich
65,2 % (n = 30)
Praxisstruktur
Einzelpraxis
60,9 % (n = 28)
Tätigkeit als niedergelassener Arzt
Hausärztlicher Internist
4,3 % (n = 2)
Kenntnisstand zu ASV
ASV generell bekannt?
ja
80,4 % (n = 37)
ASV-Team in Umgebung bekannt?
ja
50 % (n = 23)
Zusammenarbeit mit ASV
Interesse an Zusammenarbeit mit ASV
ja
78,3 % (n = 36)
Bereits mit ASV-Team zusammengearbeitet?
ja
54,3 % (n = 25)
Informationsbedarf zu ASV
Interesse an weiterführenden Informationen zu ASV
ja
76,1 % (n = 35)
Wenn Interesse vorhanden, Art der Informationsweitergabe (Mehrfachantworten möglich, siebenmal genutzt)
Informationsabend
34,3 % (n = 12)
Information über Aufnahme eines mitbereuten Patienten in die ASV
ja
83 % (n = 38)
Tabelle 2 Untersuchungsergebnisse der Hausarztbefragung
30–40
0 % (n = 0)
Weiblich
35 % (n = 16)
Gemeinschaftspraxis/ MVZ/Praxisgemeinschaft
39 % (n = 18)
Allgemeinarzt
83 % (n = 38)
nein
20 % (n = 9)
nein
48 % (n = 22)
nein
13 % (n = 6)
nein
46 % (n = 21)
nein
22 % (n = 10)
Rundbrief
86 % (n = 30)
nein
13 % (n = 6)
40–50
15 % (n = 7)
Praktischer Arzt
9 % (n = 4)
k. A
2 % (n = 1)
k. A
9 % (n = 4)
k. A
2 % (n = 1)
k. A
4 % (n = 2)
50–60
57 % (n = 26)
k. A.
4 % (n = 2)
60–70
24 % (n = 11)
> 70
4 % (n = 2)
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
133
Dr. med. Florian Kaiser
Oberarzt
Klinik für Hämatologie und Medizinische
Onkologie
Universitätsmedizin Göttingen
Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen
Korrespondenzadresse
Grundsätzlich ist anzumerken, dass die ASV als Kooperation von Spezialis-ten konzipiert wurde, was sich auch im o.g. Einweisungsverhalten widerspie-gelt. Rolle und Miteinbindung des Haus-arztes in dieses System im Sinne einer gemeinsamen Patientenbetreuung wird weiterer Diskussion und Erforschung bedürfen.
Limitationen
Einschränkend sind folgende Limita-tionen zu berücksichtigen: bei einer Rücklaufquote von 29 % der befrag-ten Hausärzte ist ein Selektionsbias besonders interessierter Hausärzte
nicht auszuschließen. Allerdings sind Rücklaufquoten < 30 % bei verschick-ten Fragebögen ein häufig auftreten-des Phänomen [20]. Die Aussagekraft kann durch den geringen Rücklauf und den 20%igen Anteil der Befragten ohne Wissen um die ASV einge-schränkt werden. Die zitierten Refe-renzwerte beziehen sich nicht explizit auf Patienten mit gastrointestinalen Tumoren und bieten keine optimale Vergleichsgruppe. Knapp ein Drittel der eingeschlossenen Patienten war zum Untersuchungszeitpunkt ver-storben. Eine mögliche Verzerrung der Patientenaussagen wäre daher möglich.
Schlussfolgerungen
Zusammenfassend kann die ASV trotz bestehender Kritik [7] als positive Ent-wicklung und neue Chance für eine Stärkung der interdisziplinären Zusam-menarbeit [8, 21] im Gesundheitswesen gewertet werden. Allerdings müssen im Rahmen der ASV-Versorgung Strukturen entwickelt werden, die eine zuverlässige Information der Hausärzte gewährleis-ten. So kann eine gemeinsame, optimale Betreuung von onkologischen Patienten erreicht werden. Hierzu würden sich z.B. elektronische Plattformen anbieten.
Interessenkonflikte: keine angege-ben.
1. www.g-ba.de/downloads/62–492–1451/ ASV-RL_2017–07–20_iK-2017–10–11.pdf (letzter Zugriff am 23.11.2017)
2. www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zur-richtlinie/80/letzte-aenderungen/ (letzter Zugriff am 23.11.2017)
3. www.g-ba.de/downloads/62–492–576/ ABK-RL_2011–12–15_WZ-Seite-43–45_ rot.pdf (letzter Zugriff am 18.06.2017)
4. www.dkgev.de/media/file/17362.Anlage_ASV_Gastrointestinale_Tumoren_ Bekanntmachung.pdf (letzter Zugriff am 23.11.2017)
5. www.g-ba.de/downloads/39–261–2164/ 2015–01–22_ASV-RL_gyn-Tumoren_ 12–17_06–18_konsolidiert_BAnz.pdf (letzter Zugriff am 23.11.2017)
6. www.qualidoc.org/symposium-fuenf_ jahre_asv/ (letzter Zugriff am 8.7.2017)
7. Rieser S. Ambulante spezialfachärzt-liche Versorgung: Vertreterversamm-lung positioniert sich. Dtsch Arztebl 2015; 112: 806
8. www.qualidoc.org/wp-content/uploads/ 2017/01/A3_Folder_Auswertung_Einzel seiten_neu.pdf (letzter Zugriff am 23.2.2017)
9. Engler J, Güthlin C, Dahlhaus A, et al. Physician cooperation in outpatient cancer care. An amplified secondary analysis of qualitative interview data. Eur J Cancer Care 2017; 26: e12675
10. Mitchell G, Burridge L, Colquist S, Love A. General practitioners‘ perceptions of
their role in cancer care and factors which influence this role. Health Soc Care Community 2012; 20: 607–616
11. Prip A, Møller K, Nielsen D, Jarden M, Olsen M, Danielsen A. The patient- healthcare professional relationship and communication in the oncolo-gy outpatient setting: a systematic review. Cancer Nurs 2017; 27: doi: 10.1097/NCC.0000000000000533. [Epub ahead of print]
12. Lyngsø A, Godtfredsen N, Frølich A. In-terorganisational integration: health-care professionals’ perspectives on bar-riers and facilitators within the danish healthcare system. Int J Integr Care 2016; 16: 1–10
13. Bitzer EM, Dierks ML, Dörning H, Schwartz FW. Zufriedenheit in der Arztpraxis aus Patientenperspektive – Psychometrische Prüfung eines stan-dardisierten Erhebungsinstrumentes. Z Gesundheitswiss 1999; 7: 196–209
14. www.netzwerk-versorgungsforschung.de/uploads/Vortraege2011/Petrucci_M_ Zufriedenheit_in_der_ambulanten_ Versorgung.pdf (letzter Zugriff am 15.02.2016).
15. Bitzer EM, Dierks ML, Schwartz FW. ZAP – Fragebogen zur Zufriedenheit in der ambulanten Versorgung – Qualität aus Patientenperspektive (Handanwei-sung). Hannover: Medizinische Hoch-schule Hannover, 2002
16. Robert Koch-Institut, Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (Hrsg). Krebs in Deutschland 2011/2012. Berlin: Robert Koch-Institut, 2015
17. Kaiser F, Vehling-Kaiser U, Flieser-Hartl M, Weiglein T. Das onkologische und palliativmedizinische Netzwerk Lands-hut. Lösungsansatz für die zukünftige ambulante und stationäre Versorgung von onkologischen und palliativmedi-zinischen Patienten in sturkturschwa-chen ländlichen Gebieten. MMW-Fortschr Med 2014; 156: 79–83
18. www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/224246/Datei/1014/WINEG%20 Wissen%20-%20Patientenzufriedenheit .pdf (letzter Zugriff am 23.11.2017)
19. Hansen H, Pohontsch N, Bole L, Schä-fer I, Scherer M. Regional variations of perceived problems in ambulatory care from the perspective of general practi-tioners and their patients – an explora-tory focus group study in urban and ru-ral regions of northern Germany. BMC Fam Pract 2017; 18: 68
20. Schmalen H. Fragebogenrücklauf und Gewinnanreiz. MarkZFP 1989; 11: 187–193
21. www.aerzteblatt.de/nachrichten/63375/Ende-2016-wird-die-ASV-ganz-anders-dastehen-als-heute (letzter Zu-griff am 21.2.2017)
Literatur
Kaiser et al.:Ambulante spezialfachärztliche Versorgung: Erste Erfahrungen von Patienten und HausärztenSpecialized Outpatient Care: First Experiences of Patients and Family Practitioners
... ist Facharzt für Innere Medizin und Palliativmedizin.
Er ist Oberarzt an der Klinik für medizinische Onkologie
und Hämatologie der Universitätsmedizin Göttingen.
Dr. med. Florian Kaiser ...
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
134 DER BESONDERE ARTIKEL / SPECIAL ARTICLE
Allgemeinmedizinische Weiterbildung in England: Austausch mit dem Hippokrates-ProgrammFamily Medicine Vocational Training in England: Hippokrates Exchange ProgramMadeleine Kiderle
Als Ärztin in Weiterbildung (AiW) All-gemeinmedizin im vierten Jahr hatte ich die Gelegenheit, einen Einblick in den Praxisalltag einer Hausarztpraxis in England zu gewinnen. Das Hippokra-tes-Austauschprogramm (http://vdgm.woncaeurope.org/content/abouthippokrates) hat mir diese Erfahrung ermög-licht. Es ist ein europaweites Programm für Ärzte in der Weiterbildung (ÄiW) All-gemeinmedizin sowie in den ersten fünf Jahren nach der Facharztprüfung. Über den Verteiler der „Jungen Allgemeinme-dizin Deutschland“ in Hamburg (JADE, www.jungeallgemeinmedizin.de) habe ich von freien Plätze erfahren. Bereits während des Studiums habe ich mehre-
re Famulaturen und den Großteil des Praktischen Jahrs im englischsprachi-gen Ausland verbracht, u.a. in Irland, in den USA und auf den Philippinen. Die fortschrittliche Medizin in England mit jahrzehntelangem Fokus auf „evidence-based medicine“ interessiert mich seit-her. Einen Hippokrates-Austausch emp-fand ich als große Chance, einen Ein-blick in die Weiterbildung, das Gesund-heitssystem und den Beruf als Hausarzt in England zu bekommen. Eine E-Mail an die deutschen Koordinatoren ([email protected]) mit der Anga-be von gewünschtem Land und Zeit so-wie einem Lebenslauf auf Englisch hat die Gastgebersuche initiiert. Wenige
Monate später habe ich zwei Wochen lang bei der englischen Ärztin Dr. Ruth Skipper in Brighton gewohnt und sie während ihrer Arbeit in einer ländlichen Hausarztpraxis 20 Minuten außerhalb Brightons begleitet. Sie ist dort eine von zwei Ärztinnen in Weiterbildung All-gemeinmedizin.
Erster Eindruck von der Praxis
Hassocks Health Centre ist eine große, allgemeinmedizinische Gemeinschafts-praxis mit neun Fachärztinnen und -ärzten; es gibt weitere kleinere Partner-
Hamburg Peer-reviewed article eingereicht 15.11.2017, akzeptiert: 06.02.2018 DOI 10.3238/zfa.2018.0134–0139
Zusammenfassung: Ein zweiwöchiges Austauschpro-gramm hat mir Einblicke in hausärztliche Strukturen und die allgemeinmedizinische Weiterbildung in England er-möglicht. Aufgrund des strikten Primärarzt-Systems um-fasst der hausärztliche Aufgabenbereich dort ein breiteres Spektrum, als es in Deutschland üblich ist. In die Weiter-bildung integriert sind daher festgelegte Rotationen in mehrere Fachrichtungen. Ebenso gibt es ein Mentoring sowie ein begleitendes Lehrprogramm. Neben Ärzten können in der Hausarztpraxis auch speziell ausgebildete medizinische Fachangestellte bei verschiedensten Anlie-gen konsultiert werden. Außerdem gibt es eine gut etab-lierte, evidenzbasierte und patientenorientierte Online- Informationsplattform. Diese Komponenten geben Anre-gung zur Verbesserung der allgemeinmedizinischen Weiterbildung und Praxisorganisation in Deutschland.
Schlüsselwörter: Weiterbildung; England; Vereinigtes König-reich; Hippokrates-Austausch; Hausarztpraxis
Summary: A two-week exchange program gave me the opportunity to gain insight into family practice and family medicine training in England. Family doctors in England work within a much broader medical spectrum compared to Germany because they function as gatekeepers in the medical system. Hence, family medicine training includes many specialties in which trainees rotate. Furthermore, junior doctors benefit from mentoring and an associated teaching program. In family practice, patients can consult not only doctors but also practice nurses for various con-cerns. Moreover, an evidence-based, patient-friendly on-line reference guide is well established. These com-ponents provide inspiration to improve specialty training and practice organisation in family medicine in Germany.
Keywords: specialty training; United Kingdom; Hippokrates Exchange; family practice
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
135
Kiderle:Allgemeinmedizinische Weiterbildung in England: Austausch mit dem Hippokrates-ProgrammFamily Medicine Vocational Training in England: Hippokrates Exchange Program
Praxen in der Umgebung. Während des Austauschs konnte ich mehrere Ärztin-nen und Ärzte und eine speziell aus-gebildete medizinische Fachangestellte (MFA) („practice nurse“) während deren Sprechstunden begleiten.
Mein erster Eindruck von der Praxis, den Ärztinnen und Ärzten, den „prac -tice nurses“ sowie den Empfangsdamen war durchweg positiv. Die Abläufe sind klar strukturiert und bis ins Detail ge-plant. Für Akuttermine, kurzfristige Hausbesuche und Telefontermine gibt es in der Regel genügend Puffer bei Ärz-ten und MFAs. Während der Vormit-tags- und der Nachmittagssprechstunde ist jeweils eine Kaffeepause für alle fest eingeplant, bei der man sich in der Kaf-feeküche gut austauschen kann. Die At-mosphäre ist freundlich und entspannt.
Alltag der ÄiW in der englischen Hausarzt praxis
Auch der Alltag der ÄiW ist strukturiert und beinhaltet viel Zeit für die Weiter-bildung. Jeder AiW ist einem weiterbil-dungsbefugten Facharzt zur Supervision in der Praxis fest zugeteilt. Es gibt einen eigenen Raum für die Sprechstunde. Bei den ÄiW werden in der Regel zwanzig-minütige Konsultationen eingeplant (bei den Fachärzten zehnminütige). Wenn ein AiW während der Sprechstun-de einen Rat braucht, kann er über einen Messenger eine Nachricht an anwesen-de Fachärzte schicken, welche bei nächster Gelegenheit vorbeischauen, um einen zweiten Blick auf den Patien-ten zu werfen und gemeinsam Fragen zu klären. Nach jeder Sprechstunde be-spricht der AiW alle gesehenen Patien-ten kurz mit dem Weiterbilder. Jeder AiW hat einen Nachmittag pro Woche für das Selbststudium zur freien Ver-fügung. Zusätzlich ist circa einmal pro Woche anstatt der Sprechstunde eine Stunde Unterricht mit dem Weiterbilder terminiert, um besondere Fälle oder be-stimmte Themen detailliert zu bespre-chen. Dabei wird regelmäßig das für Ärz-te in England konzipierte, leitlinienori-entierte Online-Nachschlagewerk des NHS (National Health Service, staat -liches Gesundheitssystem im Vereinig-ten Königreich) hinzugezogen.
Es finden außerdem regelmäßig Analysen zum Patientengespräch statt. Entweder der Weiterbilder beobachtet
den AiW während seiner Sprechstunde oder es findet eine Videoaufzeichnung statt, welche im Anschluss gemeinsam analysiert wird. Es werden daraufhin ge-zielt Strategien zur Verbesserung des Pa-tientengesprächs erarbeitet.
Exkurs: Videoanalyse und Nachschlagewerke in deutschen Lehrpraxen
In Deutschland ist eine Überprüfung und Beratung der ÄiW in Bezug auf die Patientengespräche nicht üblich, ob-wohl bereits Werkzeuge zur Videoana -lyse für Weiterbilder vorhanden sind [1]. Auch die routinemäßige Anwendung von digitalen, leitlinienorientierten Nachschlagewerken für Ärzte in Praxen und Kliniken ist in Deutschland häufig nicht etabliert. Das empfinde ich in un-serer digitalen Gesellschaft in Zeiten der evidenzbasierten Medizin als großes Manko. An Möglichkeiten würde es hier nicht mangeln, denn es gibt bereits Online-Nachschlagewerke, auch spe-ziell für die Allgemeinmedizin, z.B. Deximed (www.deximed.de) [2] oder EBM-Guidelines (www.ebm-guidelines.de/DE/Die-Online-Version).
Das Primärarztsystem in England
Der zentrale Unterschied zwischen eng-lischem und deutschem Hausarzt-Sys-tem ist bedingt durch das strikte Primär-arzt-System in England. Es stellt die Schleuse von der primären zur sekundä-ren Gesundheitsversorgung dar. In Eng-land gibt es, im Gegensatz zum ambu-lanten Versorgungssystem in Deutsch-land, keine freie Arztwahl [3, 4]. Jeder Patient sucht mit (fast) jedem Anliegen (Notfälle ausgenommen) immer zu-nächst die ihm fest zugeteilte Hausarzt-praxis auf. Alle nicht-allgemeinmedizi-nischen Fachärzte sind in England ei-nem Krankenhaus angebunden und konsultieren dort neben den stationä-ren auch ambulante Patienten. Für die ambulante Versorgung ist eine Überwei-sung durch die Hausarztpraxis (fast) im-mer obligat. Das Empfangspersonal der Praxis stellt dazu eine Terminanfrage an die zuständige Klinik und der Patient wird von der Klinik über den Termin informiert. Für die Veranlassung einer Überweisung gibt es in vielen Fällen klar
definierte Kriterien. Hausärzte sind an-gehalten, sich an diese Kriterien zu hal-ten.
Auswirkungen des Primärarzt -systems in Europa
Das Primärarztsystem ist in Europa unterschiedlich stark vertreten [5]. Auswirkungen auf die Patientenver-sorgung können in diesem Kontext noch nicht abschließend bewertet werden [6, 7]. Jedoch scheinen vor al-lem Patienten mit chronischen und psychischen Erkrankungen sowie älte-re Patienten von einem Primärversor-gungssystem hinsichtlich einer Ver-besserung ihres Gesundheitsstatus zu profitieren. Ebenso kann ein solches System Gesundheitsausgaben im am-bulanten Sektor einsparen [8, 9]. Aller-dings ist die Patientenzufriedenheit in Ländern mit einem stark regulierten Primärarztsystem im Durchschnitt deutlich niedriger als in Ländern mit freier Arztwahl [7].
Persönliches Fazit zum Primär-arztsystem in England
1. Englische Hausärzte haben einen besseren Überblick über die Kran-kengeschichte der Patienten. Das ist bedingt durch die feste Anbindung der Patienten an eine Praxis und die hausärztliche Koordination der Facharztkonsultationen und Kran-kenhausaufenthalte mit meist zeit-nahem Eingang entsprechender Befunde. Dadurch ist häufig eine schnellere und faktenorientierte Be-handlung möglich.
2. „Ärzte-Hopping“, wie wir es in Deutschland finden, ist in England nicht möglich.
3. Patienten in England spielen durch die engen Strukturen des medizi-nischen Systems eine passivere Rol-le in ihrer ärztlichen Versorgung. Eine gewisse Autonomie und Eigen-verantwortung scheinen mir für Pa-tienten aber wichtig zu sein, weil sie sich dadurch selbst vor technischen oder menschlichen Fehlern schüt-zen können. Es überwiegt im Ver-gleich der Eindruck, dass Patienten in Deutschland durch die größere Autonomie und Eigenverantwor-tung in Gesundheitsfragen zufriede-ner sind.
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
136
Kiderle:Allgemeinmedizinische Weiterbildung in England: Austausch mit dem Hippokrates-ProgrammFamily Medicine Vocational Training in England: Hippokrates Exchange Program
Die Schwelle zum Hausarzt-besuch in England und Deutschland im Vergleich
Große Unterschiede zwischen England und Deutschland habe ich im Umgang mit einfachen Beschwerden (Erkäl-tungsbeschwerden, akuter Durchfall, etc.) bei sonst gesunden, erwachsenen Patienten beobachtet. In Deutschland habe ich Patienten mit Beschwerden dieser Art in der Hausarztpraxis jeden Tag gesehen. In England kam das in zwei Wochen nicht ein einziges Mal vor. Die-ser Unterschied im Patientenverhalten zwischen den beiden Ländern ist bereits bekannt [10].
Ein ausschlaggebender Punkt liegt meines Erachtens darin, dass in England erst nach dem siebten Krankheitstag ei-ne Bescheinigung für den Arbeitgeber notwendig ist. Sollten Patienten medizi-nischen Rat suchen, können sie sich im englischen Gesundheitswesen auf ver-schiedene Weise informieren, ohne sich zwangsläufig initial beim Hausarzt vor-stellen zu müssen:
1. Online-Informationsplattform:
Der NHS hat für Patienten eine Online-Informationsplattform („NHS Choices“, www.nhs.uk) bereitgestellt. Darin sind zu häufigen Beschwerden und Krank-heitsbildern strukturierte und evidenz-basierte Informationen mit Behand-lungsempfehlungen zu finden. Diese be-inhalten auch genaue Angaben darüber, wann es notwendig ist, den Hausarzt aufzusuchen oder den Notarzt zu rufen. Befragungen haben ergeben, dass junge, gesunde Patienten, welche „NHS Choi-ces“ verwenden, die ärztliche Grundver-sorgung seltener in Anspruch nehmen [11]. Es scheint also eine sinnvolle Alter-native zum wirren „Googeln“ für dieses Patientenklientel zu sein. In Deutsch-land sind evidenzbasierte Online-Infor-mationsseiten für Patienten zwar vor-handen (z.B. www.gesundheitsinformation.de oder www.patienten-information.de), jedoch treten sie durch die Infor-mationsflut des Internets in den Hinter-grund [12]. Da der NHS in der Bevölke-rung in England allgemein bekannt ist und als eigene Informationsplattform beworben wird, scheint der Zugang der Patienten zu verlässlicher Information deutlich einfacher zu sein als in Deutschland.
2. Apotheken:
Apotheken nehmen, wie auch in Deutschland, eine wichtige Rolle zur Be-handlung einfacher Beschwerden ein [13].
3. Speziell ausgebildete MFA („practice nurses“):
Patienten können in den Hausarztpra-xen speziell ausgebildete MFA konsultie-ren. Das sind examinierte MFA mit einer weiterführenden Ausbildung entspre-chend den zu übernehmenden Auf-gaben in der Praxis. Diese Zusatzqualifi-kationen können vor oder während der Anstellung in der Praxis erlangt werden. Je nach Ausbildungsstand und Kom-petenz der practice nurse ist eine höher-rangige Stelle innerhalb der Praxis bis hin zur Position eines „nurse practitio-ner“ möglich, welche ein autonomes Arbeiten mit eigenem Patientenstamm ermöglicht [14]. Zu den Konsultations-anlässen gehören u.a. einfache Akut-beschwerden, Laborbesprechungen, EKG-Kontrollen, Wundversorgung, (Reise-)Impfberatung, Beratung zur Kontrazeption sowie die Verordnung von entsprechenden Rezepten in deren Kompetenzrahmen. Außerdem gehören Beratung und Untersuchung bei chro -nischen Erkrankungen (COPD, Asthma, Diabetes mellitus, Herzinsuffizienz), ähnlich unserem DMP-Programm, so-wie die Durchführung der Gebärmutter-halskrebsvorsorge (zervikaler Abstrich) und die allgemeine Gesundheitsunter-suchung zum Aufgabenbereich der spe-ziell ausgebildeten MFA. Sollte ein Arzt hinzugezogen werden müssen, so findet entweder eine kurze Mitbeurteilung statt oder der Patient bekommt einen neuen Termin. Auswirkung auf die Patienten-gesundheit: Die Integration von spe-ziell ausgebildeten MFAs in das Haus-arztpraxis-Setting führt zu einer Verbes-serung der Patientengesundheit bei chronischen Erkrankungen [15, 16]. Situation in Deutschland: In Deutschland gibt es ebenfalls Weiterbil-dungen für MFA: VERAH (Versorgungs-assistentin in der Hausarztpraxis) und NäPA (nicht-ärztliche Praxisassistentin) entlasten und unterstützen den Haus-arzt innerhalb und vor allem außerhalb der Praxis z.B. durch eine Übernahme von Haus- und Heimbesuchen.
Eine bei den Patienten in Deutsch-land bekannte, verlässliche Informa -tionsplattform sowie ein weiterer Einbe-zug speziell ausgebildeter MFA in die Praxisabläufe könnten die Schwelle zur hausärztlichen Konsultation erhöhen und somit die Arbeit des Hausarztes in Deutschland entlasten.
Präventionsprogramme in der Hausarztpraxis in beiden Ländern im Vergleich
In England sind Arztkontakte zur Durchführung von präventiven Maß-nahmen stark limitiert. Die Gesund-heitsuntersuchung „NHS Health Check“ [17], welche ansatzweise mit dem deutschen Programm „Check-up 35“ vergleichbar ist, wird in der Regel von nicht-ärztlichem Praxispersonal durchgeführt. In Deutschland stellen Gespräche und Untersuchungen z.B. im Rahmen des „Check-up 35“ eine niedrigschwellige Möglichkeit für ei-nen regelmäßigen Arztkontakt dar. Vor allem der Einbezug sozialer und per-sönlicher Fragestellungen mit dem Ziel der Gesundheitsförderung verstärkt dabei meiner Meinung nach eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Bezie-hung.
Eine Reduktion von Morbidität und Mortalität durch Gesundheits-untersuchungen konnte in Studien nicht nachgewiesen werden [18].
Weiterbildung Allgemein -medizin in England und Deutschland im Vergleich
Während des Praxisaustauschs hatte ich die Gelegenheit, die deutsche mit der englischen Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin zu vergleichen. Da der Hausarzt in England in aller Regel der erste Arzt ist, der für jegliche Be-schwerden kontaktiert wird, deckt das Tätigkeitsfeld des Hausarztes einen brei-teren Bereich ab als in Deutschland. Es werden unter anderem auch gynäkolo-gische und pädiatrische Patienten initial immer vom Hausarzt gesehen, z.B. bei allen akuten Beschwerden, beim Sechs-Wochen-Säuglings-Check und bei einfa-chen Prozeduren wie bspw. dem Ein-legen von intrauterinen Spiralen zur Kontrazeption. Entsprechend beinhal-
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
137
Kiderle:Allgemeinmedizinische Weiterbildung in England: Austausch mit dem Hippokrates-ProgrammFamily Medicine Vocational Training in England: Hippokrates Exchange Program
tet die Weiterbildung ein breiteres Spek-trum an Fachrichtungen.
Struktur der Weiterbildung: England
Die Weiterbildung zum Hausarzt glie-dert sich in England in zwei Teile. In den ersten zwei Jahren („foundation trai-ning“) werden in drei- oder viermonati-gen Rotationen verschiedene Fachabtei-lungen des Lehrkrankenhauses durch-laufen. Dabei ist jeweils eine Rotation in Innere Medizin und Chirurgie obligat. Dieser Basisausbildung für alle ÄiW schließt sich die spezialisierte Facharzt-weiterbildung an („specialty training“). Für das Fach Allgemeinmedizin sind das drei Jahre, welche sich aufteilen in 18 Monate Weiterbildung in einer Haus-arztpraxis und 18 Monate in verschiede-nen Fachabteilungen des Krankenhau-ses. Letztere werden in drei- oder vier-monatigen Rotationen durchlaufen. Zu den Fächern gehören u.a. Gynäkologie und Geburtshilfe, Pädiatrie, Psychiatrie, HNO, Dermatologie, Augenheilkunde, Palliativmedizin und die Notaufnahme [19].
Jeder AiW bekommt für jedes Wei-terbildungsjahr einen festen, persön -lichen Rotationsplan zugeteilt, welcher keine zeitliche oder örtliche Flexibilität für den AiW zulässt, dafür aber eine gro-ße Anzahl an Fachrichtungen abdeckt. Es ist in England nicht möglich, sich als Internist hausärztlich niederzulassen.
Struktur der Weiterbildung: Deutschland
In Deutschland können wir unseren Weiterbildungsplatz frei wählen, sofern die Zeiten und Voraussetzungen der Weiterbildungsordnung entsprechen. Das weiß ich seit dem Austausch deut-lich mehr zu schätzen, denn man kann spezielle Interessen fördern und sich an einen Ort längerfristig binden.
Von Nachteil empfinde ich an unse-rem Weiterbildungssystem jedoch, dass es praktisch nicht umsetzbar ist, kürzere Rotationen selbst zu organisieren, um mehrere Fachrichtungen abzudecken. Zwar lässt das Curriculum eine Mindest-zeit von drei Monaten zu, jedoch sind kurzweilige Anstellungen von ÄiW auf-grund der unverhältnismäßig langen Einarbeitungszeit in Krankenhäusern und Praxen nicht gängig.
Durch die Verbundweiterbildungs-programme Allgemeinmedizin gibt es aber die Möglichkeit, Rotationen in kooperierenden Kliniken durch einen Arbeitsvertrag wahrzunehmen. Somit kann eine Rotation in verschiedene Fachabteilungen im stationären Bereich ermöglicht werden [20].
Dagegen steht eine Rotation in Arzt-praxen unterschiedlicher Fachrichtun-gen neben einigen chirurgischen und pädiatrischen Praxen nicht regelhaft zur Verfügung.
Allerdings suchen im Unterschied zu England in Deutschland viele Patien-ten aufgrund der freien Facharztwahl bei Anliegen, welche initial durch den Hausarzt betreut werden könnten, di-rekt den Facharzt in der Praxis auf. Diese Konsultationsanlässe und Krankheits-bilder unterscheiden sich teils stark von denen in den entsprechenden Fach-abteilungen der Krankenhäuser.
Daher könnten wir als zukünftige Hausärzte in Deutschland ein breiteres Kompetenzfeld aufbauen, wenn unsere Weiterbildung ein größeres Spektrum an Fachrichtungen auch im ambulanten Bereich beinhalten würde. Dieses würde ein souveränes Arbeiten im gesamten Aufgabenbereich des Hausarztes för-dern.
Lehre und Mentoring in der Weiterbildung: England
Neben vielen Rotationen ist in England auch die begleitende Lehre fest in die Weiterbildung integriert. In der Lehr-praxis arbeitet der AiW unter Supervisi-on eines erfahrenen Hausarztes, welcher eine pädagogische Zusatzausbildung er-fahren hat. Somit erhält der AiW wäh-rend seiner Weiterbildungszeit in der Hausarztpraxis einen personalisierten, strukturierten Unterricht.
Darüber hinaus treffen sich ÄiW ei-ner Region alle drei Wochen in ihrem Lehrkrankenhaus mit ihren festen zuge-teilten Mentoren für einen ganzen Vor-mittag unter der Woche, um Probleme, aktuelle Anliegen und besondere Fälle zu besprechen sowie ausgewählte Vor-träge zu hören. Ich konnte an einem die-ser Treffen mit circa 20 ÄiW teilnehmen. Das Thema war Resilienz und Arzt-gesundheit. Die nette Gemeinschaft und der engagierte Austausch zwischen den ÄiW untereinander und mit den Mentoren haben mich beeindruckt.
Lehre und Mentoring in der Weiterbildung: Deutschland
Bei uns gibt es bislang keine gesonderte, strukturierte Ausbildung neben dem Weiterbildungsplatz als festen Teil der Weiterbildung. Lehrangebote stehen uns regulär im Rahmen von freiwilligen Fortbildungen als eine themenspezi-fische, meist abendliche und häufig kos-tenpflichtige Freizeitangelegenheit mit allen Ärzten zur Verfügung. Für längere Fortbildungen haben wir offiziell fünf Fortbildungstage pro Jahr zur Ver-fügung, im Gegensatz zu 30 in England.
Für den personalisierten Unterricht der ÄiW durch die weiterbildungsbefug-ten Hausärzte in den Lehrpraxen gibt es in Deutschland keinen festgelegten Standard. Eine entsprechende Zusatz-ausbildung der Hausärzte ist für die Weiterbildungsbefugnis im Gegensatz zu England nicht notwendig.
Vor dem Hintergrund dieser Struk-turen entstanden in den letzten Jahren mehrere Initiativen, welche für ÄiW eine freiwillige Ergänzung der Weiterbil-dung darstellen; zudem gibt es auch für weiterbildungsbefugte Ärzte entspre-chende Angebote: Bei den monatlichen Treffen der JADE kommen ausschließ-lich ÄiW und Fachärzte in den ersten Jahren nach der Facharztprüfung zum Austausch und für selbst organisierte Fachvorträge in einzelnen Regional-gruppen zusammen. Des Weiteren be-finden sich in Deutschland „Kom-petenzzentren Allgemeinmedizin“ im Aufbau. Fast jedes Bundesland bringt durch Zusammenschluss der jeweiligen allgemeinmedizinischen Institute der Universitätskliniken eine ortsbezogene Plattform zur Unterstützung von ÄiW und weiterbildungsbefugten Ärzten während der Weiterbildung hervor. Ne-ben mehrmals im Jahr stattfindenden ganztägigen Seminarangeboten und Mentoring-Programmen für ÄiW gibt es Train-the-Trainer-Programme für Wei-terbilder. Die DEGAM (Deutsche Gesell-schaft für Allgemeinmedizin und Fami-lienmedizin) empfiehlt für die Teilnah-me an diesen Weiterbildungstagen ei-nen Freizeitausgleich [21].
Dieses Angebot ist in den Grundzü-gen in Bezug auf Ausbildung, professio-nellen Austausch und Mentoring ver-gleichbar mit den dreiwöchentlichen Treffen der ÄiW in England. Außerdem erweitert es pädagogische Kompeten-
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
138
zen der weiterbildungsbefugten Haus-ärzte. Somit fördert es eine hohe Quali-tät der Weiterbildung für ÄiW in Deutschland.
Wünschenswert wäre es nach eng -lischem Vorbild, das Angebot der Kom-petenzzentren für alle ÄiW in etwa monatlich, deutschlandweit (auch in ruralen Gebieten) sowie als Teil der Ar-beitswoche greifbar und verpflichtend zu machen. Eine obligate Grundausbil-dung für weiterbildungsbefugte Haus-ärzte würde sich dem Gedanken an-schließen.
Schlussfolgerung und Ausblick
Meiner Ansicht nach führte die deut-sche allgemeinmedizinische Weiterbil-dung bisher zu einer stark auf sich selbst bezogenen Arbeitsweise der ÄiW mit Fo-kus auf die Innere Medizin. Im Vergleich
dazu führt die englische Weiterbildung zu einer selbstkritischeren Arbeitsweise der ÄiW in einem breiteren Tätigkeitsbe-reich, welche von Mentoring und pro-fessionellem Austausch profitiert und soziale Kompetenzen schult.
Ein weiterer Ausbau der Kompetenz-zentren sowie das Ermöglichen von Rotationen in mehrere Fachrichtungen auch im ambulanten Bereich könnten die Qualität der Weiterbildung All-gemeinmedizin in Deutschland weiter verbessern.
Fazit zum Austausch
Während des Austauschs konnte ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutscher und englischer Hausarztpra-xen, Weiterbildungs- und Gesund-heitssysteme erleben. Das war eine
durchweg bereichernde Erfahrung für meine Tätigkeit als angehende All-gemeinmedizinerin. Der ausschlag-gebende Punkt dabei war, dass ich den Alltag einer englischen AiW begleiten konnte, welche auf dem gleichen Wei-terbildungsstand war wie ich und wel-che durch ihre offene und freundliche Art jede Diskussion belebt hat. Ich kann einen Hippokrates-Austausch wärmstens jedem angehenden All-gemeinmediziner empfehlen, der ei-nen Eindruck von unserem Arbeitsfeld außerhalb der gewohnten Strukturen gewinnen möchte.
Danksagung: Ich danke herzlich Frau Ruth Skipper, MD, und dem gesamten Team des Hassocks Health Center für den hervorragenden Austausch sowie den englischen und deutschen Koor-dinatoren des Hippokrates-Austausch-programms für das Ermöglichen dieser großartigen Erfahrung.
Interessenkonflikte: keine angege-ben.
Kiderle:Allgemeinmedizinische Weiterbildung in England: Austausch mit dem Hippokrates-ProgrammFamily Medicine Vocational Training in England: Hippokrates Exchange Program
Dr. med. Madeleine Kiderle
Korrespondenzadresse
1. Hammersen F, Böhmer K, von der Bey J, Berger B, Steinhäuser J. MAAS-Glo-bal-D: Instrument zur Messung und Schulung kommunikativer sowie me-dizinischer Kompetenzen. Z Allg Med 2016; 92: 13–18
2. NN. Deximed: Online-Enzyklopädie für die Allgemeinmedizin. Dtsch Arzte- bl 2017; 114: A-87
3. Loudon I. The principle of referral: the gatekeeping role of the GP. Br J Gen Pract 2008; 58: 128–130
4. § 76 SGB V Freie Arztwahl 5. Kringos D, Boerma W, Bourgueil Y, et al.
The strength of primary care in Europe: an international comparative study. Br J Gen Pract 2013; 63: e742–750
6. Velasco Garrido M, Zentner A, Busse R. The effects of gatekeeping: A systematic review of the literature. Scand J Prim Health Care 2011; 29: 28–38
7. van der Zee J, Kroneman MW. Bismarck or Beveridge: a beauty contest between dinosaurs. BMC Health Serv Res 2007; 7: 94
8. Hansen J, Groenewegen PP, Boerma W, Kringos DS. Living in a country with a strong primary care system is beneficial to people with chronic conditions. Health Aff (Millwood) 2015; 34: 1531–1537
9. Schneider A, Donnachie E, Tauscher M, et al. Costs of coordinated versus un-coordinated care in Germany: results of a routine data analysis in Bavaria. BMJ Open 2016; 6: e011621
10. van Loenen T, van den Berg MJ, Faber MJ, Westert GP. Propensity to seek healthcare in different healthcare systems: analysis of patient data in 34 countries. BMC Health Serv Res 2015; 15: 465
11. Murray J, Majeed A, Khan MS, Lee JT, Nelson P. Use of the NHS Choices website for primary care consulta -tions: results from online and general practice surveys. JRSM Short Rep 2011; 2: 56
12. Krüger-Brand HE. Patienteninforma -tion: Navigieren durchs Gesundheits-
Web. Dtsch Arztebl 2012; 109: A-1924/B-1566/C-1538
13. Dewsbury C, Rodgers RM, Krska J. Views of English pharmacists on pro -viding public health services. Pharma-cy (Basel) 2015; 3: 154–168
14. National Health System, Health Educa-tion England. General practice nurse. www.healthcareers.nhs.uk/explore- roles/nursing/roles-nursing/general-practice-nurse (letzter Zugriff am 28.01.2018)
15. Lukewich J, Edge DS, VanDenKerkhof E, Williamson T, Tranmer J. Association between registered nurse staffing and management outcomes of patients with type 2 diabetes within primary care: a cross-sectional linkage study. CMAJ Open 2016; 4: E264–270
16. Sutherland D, Hayter M. Structured re-view: evaluating the effectiveness of nurse case managers in improving health outcomes in three major chronic diseases. J Clin Nurs 2009; 18: 2978–2992
Literatur
... ist seit 2014 Ärztin in Weiterbildung Allgemeinmedizin in
Hamburg. Nach dem stationär-internistischen und hausärzt-
lichen Abschnitt ist sie aktuell in einer Kinderarztpraxis tätig.
Dr. med. Madeleine Kiderle …
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
139
Kiderle:Allgemeinmedizinische Weiterbildung in England: Austausch mit dem Hippokrates-ProgrammFamily Medicine Vocational Training in England: Hippokrates Exchange Program
17. National Health Service. NHS Health Check. www.healthcheck.nhs.uk (letz-ter Zugriff am 28.01.2018)
18. Krogsbøll LT, Jørgensen KJ, Grønhøj Larsen C, Gøtzsche PC. General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2012; 10: CD009009
19. National Health Service, Health Educa-tion England, GP National Recruit-
ment Office. The GP training program-me. https://gprecruitment.hee.nhs.uk/Recruitment/Training (letzter Zugriff am 28.01.2018)
20. Deutsche Gesellschaft für Allgemeinme-dizin und Familienmedizin (DEGAM). DEGAM-Konzept Verbundweiterbil-dung plus. www.degam.de/files/ Inhalte/Degam-Inhalte/Sektionen_ und_ Arbeitsgruppen/Sektion_Weiter bildung/DEGAM_Konzept_Verbund weiterbildung_plus_130718.pdf (letz-
ter Zugriff am 28.01.2018)21. Positionspapier der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin und Fami-lienmedizin (DEGAM). Kriterien für Kompetenzzentren Allgemeinmedizin. www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Presse/Presseordner_2015/ DEGAM-Positionspapier_Kriterien% 20fuer%20Kompetenzzentren%20 Allgemeinmedizin.pdf (letzter Zugriff am 28.01.2018)
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
140 LESERBRIEFE / LETTERS TO THE EDITOR
Dr. med. Waltraud Fink
3722 Straning 153
Österreich
Tel.: +43 (0)2984 37039
Korrespondenzadresse
Donner-Banzhoff N, Michiels-Corsten M, Bösner S. Diagnostizieren in der Allgemeinpraxis. Z Allg Med 2017; 93: 493–498
Leserbrief von Dr. Waltraud Fink
Diagnostik in der Allgemeinpraxis: Was gelehrt werden kann
Die Studie, der eine Videobeobachtung allgemeinärztlicher Konsultationen zu-grunde liegt, konzentriert sich auf den diagnostischen Prozess. Die Erkenntnisse sollen „die Lehre der Allgemeinmedizin unterstützen“. Dabei vermisst man eine Referenz zu den von Praxisforscher Ro-bert N. Braun geschaffenen Fachwissen und -begriffen. Braun beschäftigte sich intensiv mit der Diagnostik in der All-gemeinpraxis im Hinblick auf eine adä-quatere Ausbildung. Anfangs schaute er sich gleichsam selbst über die Schulter. Später analysierte er Praxis-Tonbandmit-schnitte, was am eindrücklichsten im ers-ten Lehrbuch dargestellt ist [1]. Zur Opti-mierung der Diagnostik erarbeitete er über 80 diagnostische Programme [2]. Das Neuartige bei Brauns wissenschaft -licher Arbeit war, dass er die Rahmenbe-dingungen berücksichtigte. Er nannte sie Handlungszwänge und subsumierte da-runter finanzielle, zeitliche Begrenztheit, den Einfluss der Gesellschaft, die Ge-sundheitsstörungen sowie die Patienten- und Arzt/Ärztin-Charakteristika.
Der Arzt soll Patienten beim Vor-bringen ihrer Beschwerden nicht unter-brechen. Gedanklich kann er jedoch sei-ne Diagnostik bereits folgendermaßen strukturieren [3]:• Scheint die Art des gesundheitlichen
Problems offensichtlich zu sein, versu-chen erfahrene Ärzte eine Direkte Diag-
nostik. • Ist es ein körperlich eingegrenztes Pro-
blem, wird eine Örtliche Routine ange-zeigt sein.
• Werden allgemeine Beeinträchtigun-gen geschildert, braucht es eine All-
gemeine Routine.
All diese Vorgehensweisen erfolgen pro-blemorientiert mit „intuitiv-individuel-ler“ Gestaltungsmöglichkeit. Wo eine Programmierte Diagnostik möglich ist,
setzt sie einen Qualitätsstandard für eine gezielte Anamnestik und für den Um-fang der Untersuchungen [4].
Im publizierten Aufsatz werden an-dersartige Begriffe verwendet, die aber ungefähr dieselben Sachverhalte, die hausärztliche Diagnostik betreffend, beschreiben wollen: Sie kommen damit einigen berufstheoretischen Begriffen inhaltlich nahe.
Die getriggerten Routinen sind in etwa der Problemorientierung gleichzusetzen. Beim hypothetiko-deduktiven Vorgehen werden Schablonen an das vorgebrachte Beschwerdebild angelegt: Sie ent-wickeln sich im Laufe der Aus- und Wei-terbildung und werden später durch die Erfahrung individuell modifiziert. Sie beinhalten typische Symptome und charakteristische klinische Befunde für eine bestimmte Krankheit.• Passt das präsentierte Leiden zu dieser,
zu jener Krankheit? Gibt es einen ein-deutigen Beweis, kann die Krankheit diagnostiziert werden?
• Handelt es sich nur um eine wohl-begründete Vermutung, dann wird das Bild dieser Krankheit klassifiziert, wo im Hintergrund immer die „Falsifizie-rung“ steht.
• Häufig kommt man nicht über die Symptomebene hinaus. Hier dient das Anlegen der Schablonen dem Aus-schluss von Diagnosen. All diese Fälle werden nach Braun meist abwartend offen als Symptome oder Symptom-gruppen klassifiziert. Langjährige Fäl-lestatistiken haben gezeigt, dass diese Art der Beratungsergebnisse die Hälfte aller Erkrankungen in der Allgemein-praxis ausmacht.
Die kasugraphischen Begriffe mit ihren Beschreibungen dienen ebenfalls als Schablonen, als diagnostisches Tool spe-ziell für Situationen, wo „sich keine prä-zise Erklärung für die Beschwerden des Patienten formulieren lässt“. Sie sind Fachbegriffe für allgemeinärztliche Bera-
tungsergebnisse [5]. Es wäre aufschluss-reich, die in der Studie analysierten Be-ratungsprobleme angeführt zu sehen.
Bei Kenntnis von Brauns berufs-theoretischer Arbeiten hätten die beob-achteten Mediziner ihr Vorgehen ent-sprechend beschreiben können. Die Stu-dienautoren könnten – auch nachträg-lich – das wertvolle Video-Material im Sinne der Braunschen berufstheoreti-schen Begrifflichkeit untersuchen und überprüfen. Es wäre ein Beitrag zur Ver-festigung der von Braun erarbeiteten Grundlagen und in der weiteren Folge zur Erweiterung des lehrbaren (Fach)wissens in der Allgemeinmedizin [6].
1. Braun RN. Lehrbuch der ärztlichen Allgemeinpraxis. München, Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg, 1970
2. Braun RN. Diagnostische Program-me in der Allgemeinmedizin. Mün-chen, Berlin, Wien: Urban & Schwar-zenberg, 1976
3. Braun RN, Fink W, Kamenski G. Lehrbuch der Allgemeinmedizin – Theorie, Fachsprache und Praxis. Wien: Berger, Horn, 2007
4. Fink W, Kamenski G, Konitzer M. Diagnostic protocols – a consul -tation tool still to be discovered. J Eval Clin Pract 2017; doi 10.1111/jep.12710 [Epub ahead of print]
5. Braun RN (neu hrsg. u. bearb. von Fink W, Kamenski G, Kleinbichler D). Braun Kasugraphie: (K)ein Fall wie der andere – Benennung und Klassifikation der regelmäßig häufi-gen Gesundheitsstörungen in der primärärztlichen Versorgung. 3. Auf-lage. Wien: Berger, Horn, 2010
6. Braun RN. Wissenschaftliches Arbei-ten in der Allgemeinmedizin. Ein-führung in die eigenständige For-schungsmethode. Berlin, Heidel-berg, New York, London, Paris: Springer, 1988
Literatur
MASSGESCHNEIDERTEJOBS SUCHEN UND FINDEN.
Neues
Design:
Jetzt einfach
er
suchenund
finden!
DIE INTELLIGENTE JOBSUCHE FÜRÄRZTINNEN UND ÄRZTEZahlreiche Stellenangebote und individuelle Suchfunktionen:
Verlassen Sie sich bei der Stellensuche auf ÄRZTESTELLEN,
dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblattes. Suchen
und finden Sie mit aerztestellen.de den perfekten Job – ganz
einfach, ganz komfortabel und in Ihrem Fachgebiet.
www.aerztestellen.de
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
142 DEGAM-NACHRICHTEN / DEGAM NEWS
Diskussion um DEGAM-Zukunftsthesen in der ZFA
Das Präsidium der Deutschen Gesell-schaft für Allgemeinmedizin und Fami-lienmedizin hat sich sehr über den Be-ginn einer Diskussion über die DEGAM-Zukunftsthesen in der Zeitschrift für All-gemeinmedizin gefreut. Wir möchten diese Diskussion weiterentwickeln und schlagen vor, beim diesjährigen DEGAM- Kongress, der vom 13. bis zum 15. Sep-tember in Innsbruck stattfindet, einen (pre-conference) Workshop durchzu -füh ren, der sich mit folgenden Aspekten beschäftigen könnte:
• Wo gibt es wichtige neue Entwicklun-gen?
• Wie müssen die einzelnen Punkte durch neue Erkenntnisse bzw. Litera-tur ergänzt oder modifiziert werden?
• Welche Thesen sind heute eventuell nicht mehr von hoher Relevanz …
• und welche müssen ggf. dazu kommen (z.B. bez. Digitalisierung)?
Anschließend an den Workshop könnte die Diskussion in einer Arbeitsgruppe aber auch in den Sektionen fortgeführt
werden. Danach sollte das Präsidium die Punkte zusammenführen und online stellen, um beim nächsten Kongress ei-ne überarbeitete Version zu verabschie-den.
Ernst-von-Bergmann-Plakette für DEGAM-Präsidentin
Prof. Erika Baum hat für ihre Ver-dienste um die ärztliche Fortbildung die Ernst-von-Bergmann-Plakette (gestiftet von der Bundesärztekammer) verliehen bekommen. Dr. med. Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach, Präsident der Landesärztekammer Hessen, übernahm die Ehrung. Erika Baum, ehemalige Lei-
terin der Abteilung für Allgemeinmedi-zin, Präventive und Rehabilitative Medi-zin der Universität Marburg, organisiert den Tag der Allgemeinmedizin in Kassel/Marburg und unterrichtet in der Weiter-bildung regelmäßig seit mehr als 20 Jah-ren: die Kursweiterbildung bei der drei-jährigen Weiterbildung Allgemeinmedi-
zin, danach die psychosomatische Grundversorgung und seit 2014 im Wei-terbildungskolleg in Hessen. Außerdem ist sie immer wieder Referentin bei Qua-litätszirkeln, der Practica, dem Institut für hausärztliche Fortbildung (IhF) und sie hat u.a. auch ein IhF-Modul zur Os-teoporose verfasst.
Achtung: Neuer Termin für WONCA Europe Conference 2020
Aufgrund von Terminüberschneidun-gen am Veranstaltungsort musste der Termin für die 25. WONCA Europe Conference 2020 und den darin inklu-dierten 54. Kongress für Allgemeinme-dizin und Familienmedizin in Berlin
kurzfristig geändert werden. Die Kon-ferenz findet nicht – wie ursprünglich vorgesehen – vom 17. bis 20. Juni 2020, sondern vom 24. bis 28. Juni 2020 statt. Der Veranstaltungsort (City Cube Berlin) ändert sich nicht.
Das Thema lautet: „Core Values of Family Medicine: Threats and Oppor-tunities“. Die DEGAM richtet zum ers-ten Mal die europäische Konferenz für Allgemeinmedizin und Familienmedi-zin aus.
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3) ■
143DEUTSCHER HAUSÄRZTEVERBAND / GERMAN ASSOCIATION OF FAMILY PHYSICIANS
Eine gute Note macht noch keinen guten ArztDie Abiturnote soll bei der Zulassung zum Medizinstudium künftig eine weni-ger gewichtige Rolle spielen. Das hat das Bundesverfassungsgericht jüngst mit ei-nem Urteil bekräftigt, das die aktuellen Auswahlverfahren zwar prinzipiell als verfassungskonform einstuft – jedoch auch deutlichen Nachbesserungsbedarf attestiert (1 BvL 3/14 und 1 BvL 4/14).
Dass mit dem Urteil Dynamik in die Reform der Studienzulassung kommt, ist wichtig. Denn die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass die Abiturnote allein nicht dafür ausschlaggebend ist, ob je-mand ein guter Arzt wird: Spätestens, wenn es darum geht, schwere Diagno-sen zu übermitteln oder komplexe The-rapieoptionen patientengerecht zu transportieren, sind Empathie und Kommunikationsfähigkeit entscheiden-de Kriterien. Darum begrüßt es der Deut-sche Hausärzteverband ausdrücklich, dass zukünftig neben dem Numerus Clausus (NC) weitere Faktoren wie bei-spielsweise Motivation, Erfahrungen als Pflegerin oder Pfleger oder Kommunika-tionsfähigkeiten im Auswahlverfahren zum Medizinstudium eine deutlich grö-ßere Rolle spielen sollen. Gerade für Hausärztinnen und Hausärzte sind so-ziale Kompetenzen im Zweifel wichtiger als ein 1,0-Abitur.
Die Verfassungsrichter haben dies mit ihrem Urteil unterstrichen. Der Auf-trag an Bund und Länder ist deutlich: So soll der Gesetzgeber bis zum 31. Dezem-ber 2019 sicherstellen, dass Hochschu-len Eignungstests „in standardisierter und strukturierter Weise“ durchführen. Bei der Auswahl Studierender sollen Hochschulen künftig zusätzlich min-
destens ein „eignungsrelevantes Kriteri-um“ anwenden, das nichts mit der Abi-turnote zu tun hat – etwa eine medizin-nahe berufliche Qualifikation.
Eine Länder-Arbeitsgruppe dis-kutiert bereits, wie die Zulassung zum Medizinstudium aufgrund des Urteils modifiziert werden kann. So könnte die Kultusministerkonferenz die Änderung oder Neufassung eines Staatsvertrages verfolgen, der die Studienzulassung re-gelt. Auf Anfrage bestätigte ein Sprecher der Kultusministerkonferenz zuletzt, dass dazu bereits Arbeitstreffen auf Staatssekretärsebene stattgefunden hät-ten.
Dass die Reform des Medizinstudi-ums damit Tempo aufnimmt, ist nur richtig. Denn nicht erst das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat den An-stoß gegeben, die bislang überaus starke Gewichtung der Abiturnote anzugehen. Auch der Masterplan Medizinstudium 2020 sieht explizit ein stärkeres Berück-sichtigen sozialer Faktoren vor: „Mit dem Masterplan soll die Zulassung zum Medizinstudium stärker auf die Anfor-derungen an ärztliche Tätigkeiten aus-gerichtet werden; sozialen, kommunika-tiven Kompetenzen und einer besonde-ren Motivation für das Medizinstudium werden wir stärkeres Gewicht verlei-hen“, heißt es im Beschlusstext der Stu-dienreform. Demnach sollen die Hoch-schulen bei der Studierendenauswahl neben der Abiturnote künftig sogar min-
destens zwei weitere Auswahlkriterien zugrunde legen.
Bislang ist das jedoch – wie große Tei-le des Masterplans – ein reines Lippenbe-kenntnis. An der Umsetzung der Reform vor Ort hakt es gewaltig. Erst im Oktober wird das Gutachten der Expertenkom-mission, die aktuell die Finanzierung und Umsetzung von sechs der insgesamt 41 Einzelmaßnahmen berät, erwartet. Und auch in jenen Punkten, die bereits ange-gangen werden könnten, herrscht bis-lang noch weitgehend Stillstand.
Dass die Länder nun möglicherweise eigenmächtig zur Tat schreiten wollen, ist ein wichtiges Signal. Der Masterplan Medizinstudium 2020 muss endlich auch umgesetzt werden!
Die Berücksichtigung berufsspezi-fischer Qualifikationen oder soziales En-gagements ist dabei ein wichtiger Bau-stein. Die „weichen“ Faktoren neben dem „harten“ Kriterium Abiturnote können zwar keine Garantie dafür ge-ben, dass am Ende des Studiums gute Allgemeinmediziner in die Versorgung gelangen. Doch in der hausärztlichen Versorgung sind soziale Faktoren, also etwa Empathie oder Kommunikations-fähigkeit, unverzichtbar. Das kennt je-der Hausarzt aus dem eigenen Praxisall-tag. Dort zeigt sich im Zweifel schnell: Eine gute Note allein macht noch kei-nen guten Arzt.
Jana Kötter
Leitung Politik „Der Hausarzt“
■ © Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (3)
144 IMPRESSUM / IMPRINT
Herausgebende Gesellschaft / Publishing InstitutionDeutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) // German College of General Practitioners and Family Physicians DEGAM-Bundesgeschäftsstelle Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, www.degam.de
Mitherausgebende Gesellschaften / AffiliationsGesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin (GHA; www.gha-info.de); Niederösterreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (NÖGAM; https://noegam.at/); Österreichisches Institut für Allgemeinmedizin (ÖIfAM; https://www.allmed.at/); Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SAGAM; https://sagam.at/); Steirische Akademie für Allgemeinmedizin (STAFAM; www.stafam.at/); Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SüGAM; www.suegam.it/); Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (TGAM; www.tgam.at/); Vorarlberger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (VGAM; https://vgam.at/)
Official Journal of the German College of General Practitioners and Family Physicians, the Austrian Institute of Gen eral Practitioners, the Lower Austrian College of General Practitioners, the Salzburg Society of Family Medicine, the Society of Professors of Family Medicine, the Southtyrolean College of General Practitioners, the Styrian College of General Practi -tioners, the Tyrolean College of General Practitioners, the Vorarlberg Society of Family Medicine
Herausgeber/innen / EditorsProf. Dr. med. Hanna Kaduszkiewicz Institut für Allgemeinmedizin Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Medizinische Fakultät Michaelisstraße 5, Haus 17, 24105 Kiel [email protected]
Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Allgemeinmedizin, Emeritus, Universitätsmedizin Göttingen Lehrbereich Allgemeinmedizin Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Ludwigstraße 37, 79104 Freiburg [email protected]
Prof. Dr. med. Wilhelm Niebling Facharzt für Allgemeinmedizin Lehrbereich Allgemeinmedizin Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Schwarzwaldstraße 69, 79822 Titisee-Neustadt [email protected]
Dr. med. Susanne Rabady Ärztin für Allgemeinmedizin Paracelsus Medizinische Privatuniversität Landstraße 2, A-3841 Windigsteig [email protected]
Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Allgemeinmedizin Institut für Allgemeinmedizin und Familienmedizin Universität Witten/Herdecke Alfred-Herrhausen-Straße 50, 58448 Witten [email protected]
Verantwortlicher Redakteur i. S. d. P. / Editor in ChiefProf. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Allgemeinmedizin Abt. Allgemeinmedizin (Emeritus) Universitätsmedizin Göttingen Lehrbereich Allgemeinmedizin Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Ludwigstraße 37, 79104 Freiburg [email protected]
Internationaler Beirat / International Advisory BoardJ. Beasley, Madison/Wisconsin, USA; F. Buntinx, Leuven/Belgien; G.-J. Dinant, Maastricht/NL;M. Egger, Bern/CH; E. Garrett, Columbia/ Missouri, USA; P. Glasziou, Robina/Australien;T. Greenhalgh, London/UK; P. Hjortdahl, Oslo/Norwegen; E. Kahana, Cleveland/Ohio, USA;A. Knottnerus, Maastricht/NL; J. Lexchin, Toronto/Ontario, Kanada; C. del Mar, Robina/Australien; J. de Maeseneer, Gent/Belgien;P. van Royen, Antwerpen/Belgien; F. Sullivan, Dundee/UK und Toronto/Kanada; C. van Weel, Nijmegen/NL; Y. Yaphe, Porto/Portugal
Verlag / PublisherDeutscher Ärzteverlag GmbHDieselstr. 2, 50859 Köln, Postfach 40 02 65, 50832 KölnTel.: +49 2234 7011-0 www.aerzteverlag.de
Geschäftsführung / Board of DirectorsNorbert A. Froitzheim (Verleger), Jürgen Führer
Leitung Produktbereich / Leader Product DivisionKatrin Groos
Produktmanagement / Product ManagerMarie-Luise Bertram, Tel.: +49 2234 [email protected]
Lektorat / Editorial OfficeJürgen Bluhme-RasmussenTel.: +49 2234 7011-512 [email protected]
Internetwww.online-zfa.de
Abonnementservice / Subscription ServiceTel.: +49 2234 7011-520, Fax: +49 2234 7011-470, [email protected]
Erscheinungsweise / Frequency11-mal jährlich,Bezugspreise (inkl. Inlandsporto und MwSt.):Jahresabonnement € 114,00Jahresabonnement für Studierende € 84,00Einzelheftpreis € 10,40Auslandsversandkosten (pro Heft) € 2,30Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum En-de des Kalenderjahres. Gerichtsstand Köln. Für Mitglieder der DEGAM. ist der Bezug im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Verantwortlich für den Anzeigenteil / Advertising CoordinatorKatja Höcker, Tel. +49 2234 7011-286, [email protected]
Verkaufsleiter Medizin / Head of Sales MedicineEric Henquinet, Tel. +49 172 2363754, [email protected]
Sales ManagementPetra Paul, Tel. +49 2234 70 11-239, [email protected]
Verlagsrepräsentanten Industrieanzeigen / Commercial Advertising Representatives
Non-Health: Eric Le Gall, Tel. +49 2202 9649510, Mobil +49 172 2575333, [email protected]
Herstellung / Production DepartmentBernd Schunk, Tel. +49 2234 7011-280, [email protected] Krauth, Tel. +49 2234 7011-278, [email protected]
Layout / LayoutMichael Nardella
Druck / PrintGrafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG,Gewerbering West 27, 39240 Calbe (Saale)
Bankverbindungen / AccountDeutsche Apotheker- und Arztebank, Köln, Kto. 010 1107410 (BLZ 370 606 15), IBAN: DE 2830 0606 0101 0110 7410, BIC: DAAEDEDD, Postbank Köln 192 50-506 (BLZ 370 100 50), IBAN: DE 8337 0100 5000 1925 0506, BIC: PBNKDEFF
Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 10, gültig ab 1.1.2018 Auflage 4. Quartal 2017 Druckauflage: 9.167 Ex. Verbreitete Auflage: 8.733 Ex. Verkaufte Auflage: 7.619 Ex.94. JahrgangISSN print 1433-6251ISSN online 1439-9229This journal is regularly listed in EMBASE/Excerpta Medica, Scopus and CCMED/LIVIVO.
Urheber- und Verlagsrecht / Copyright and Right of PublicationDiese Publikation ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Sie darf daher außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ohne vorherige, ausdrückliche, schriftliche Genehmi-gung des Verlages weder vervielfältigt noch über-setzt oder transferiert werden, sei es im Ganzen, in Teilen oder irgendeiner anderen Form.Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handels-namen und sonstigen Kennzeichen in dieser Publika-tion berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Zumeist handelt es sich da-bei um Marken und sonstige geschützte Kennzeichen, auch wenn sie nicht als solche bezeichnet sind.
Haftungsausschluss / DisclaimerDie in dieser Publikation dargestellten Inhalte die-nen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen weder Empfehlungen noch Handlungs-anleitungen dar. Sie dürfen daher keinesfalls unge-prüft zur Grundlage eigenständiger Behandlungen oder medizinischer Eingriffe gemacht werden. Der Benutzer ist ausdrücklich aufgefordert, selbst die in dieser Publikation dargestellten Inhalte zu prüfen, um sich in eigener Verantwortung zu versichern, dass diese vollständig sind sowie dem aktuellen Erkenntnisstand entsprechen und im Zweifel Spezialisten zu konsultieren.Verfasser und Verlag übernehmen keinerlei Verant-wortung oder Gewährleistung für die Vollständig-keit, Richtigkeit und Aktualität der in dieser Publi-kation dargestellten Informationen. Haftungs-ansprüche, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der in dieser Publikation dargestell-ten Inhalte oder Teilen davon verursacht werden, sind ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vor-sätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von Verfasser und/oder Verlag vorliegt.
© Copyright by Deutscher Ärzteverlag GmbH, Köln
Z FAZeitschrift für Allgemeinmedizin
German Journal of Family Medicine
März 2018 – Seite 97–144 – 94. Jahrgang www.online-zfa.de
Für alle OKI Druckerkostenlos nach Online-Registrierung!
ML 6300 FB-SC„Der Highclass-Drucker“Der leistungsstarke Flachbettdrucker mit automatischerPapierausrichtung.
Der neue ML 6 300SC-FB 24-Nadeldrucker ist ideal fürdie Arbeit in der Arztpraxis. Die automatische Papieraus-richtung korrigiert Papierschrägstellung – für fehlerfreieDruckergebnisse. Mehrfachsätze 1 Original + 5 Durch-schläge.
Die besten Praxis-Drucker vonProfitieren Sie von unserer OKI Tauschaktion!
shop.aerzteverlag.de
02234 7011-335
02234 7011-470
Menge: Preis: Modell:
€ 675,– OKI Drucker „Highclass“:OKI ML 6300FB-SC Nadeldrucker
€ 379,– OKI Drucker „Der Allrounder“:OKI ML 5100 FB Nadeldrucker
€ 199,– OKI Drucker „Der Sprinter“:OKI B432dn – LED-schwarzweißdruck
Deut
sche
rÄrz
teve
rlag
GmbH
,Sitz
Köln
,HRB
106,
Amts
geric
htKö
ln.
Gesc
häfts
führ
ung:
Norb
ertA
.Fro
itzhe
im,J
ürge
nFü
hrer
Irrtü
mer
und
Prei
sänd
erun
gen
vorb
ehal
ten.
Sola
nge
derV
orra
trei
cht.
Hiermit bestelle ich gemäß folgenden Angaben.
Alle Preise zzgl.19 % MwSt. Das Angebot ist gültig bis 30.04.2018.
Besteller/Anschrift (ggfs. Praxisstempel)
Weitere Modelle auf shop.aerzteverlag.deJetzt online bestellen!
Datum, Unterschrift
ML 5100FB„Der Allrounder“
Kompakter Flachbett-Nadeldrucker für die Arztpraxis.
Der OKI Microline 5100 Flachbett bietet hohe Zuverlässigkeitund hohe Qualität in einer extrem kompakten Bauweise.
Mehrfachsätze Original + 4 Durchschläge.
Alt gegen Neu! € 50,– Austauschprämie
statt € 429,–€ 379,–
(zzgl. 19 % MwSt.)
statt € 775,–nur € 675,–zzgl. 19 % MwSt.
Alt gegen Neu!
€ 100,–
Austauschprämie
B432dn„Der Sprinter“ NetzwerkdruckerDer B432 ist ein schneller, umweltfreundlicher LED schwarz-weiß Drucker.
Dank seiner Duplexeinheit und ergiebigem Verbrauchsmaterialhält der „OKI Sprinter“ die Betriebskosten niedrig und ist somitdie preisgünstige und dennoch produktive Lösung für jede Praxis.
Alt gegen Neu! € 50,– Austauschprämie
statt € 249,–€ 199,–
(zzgl. 19 % MwSt.)
Direkt bestellen: www.aerzteverlag.de/buecher>Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands bei Online-BestellungE-Mail: [email protected] I Telefon: 02234 7011-314
IrrtümerundPreisänderungenvorbehalten.Preisezzgl.Versandkosten
€4,50.DeutscherÄrzteverlagGmbH–SitzKöln–HRB106Amtsgericht
Köln.Geschäftsführung:NorbertA.Froitzheim,JürgenFührer
Herr Frau
Name, Vorname
Fachgebiet
Klinik/Praxis/Firma
Straße, Nr. PLZ, Ort
E-Mail-Adresse (Die Deutsche Ärzteverlag GmbH darf mich per E-Mail zuWerbezwecken über verschiedene Angebote informieren)
Datum Unterschrift
Ja, hiermit bestelle ich mit 14-tägigem Widerrufsrecht
Ex. Pinger, Repetitorium Kardiologie, € 99,99ISBN 978-3-7691-3650-0ISBN eBook 978-3-7691-3672-2
Kompakte Darstellung deraktuellen Kardiologie
Deutscher Ärzteverlag GmbHKundenservicePostfach 40024450832 Köln
Ausfüllen und an Ihre Buchhandlung oder den DeutschenÄrzteverlag senden. Fax und fertig:
02234 7011-476oder per Post
4. vollständig überarbeitete underweiterte Auflage 2018879 Seiten, 260 TabellenISBN 978-3-7691-3650-0ISBN eBook 978-3-7691-3672-2broschiert € 99,99
NEU!IN DER
4. AUFLAGE
A81154IM1//ZFA
▪ Hervorragend zur Vorbereitung auf die Facharztprüfunggeeignet
▪ Der Inhalt orientiert sich streng an der „evidenced basedme-dicine“ und den etablierten Leitlinien der Fachgesellschaften
▪ Klar und übersichtlich strukturiert
Sie finden die prägnante und gut verständliche Darstellungaller Krankheitsentitäten der Kardiologie sowie dieBeschreibung des Stellenwerts diagnostischer undtherapeutischerMaßnahmen. Nationale und internationaleLeitlinienwerden berücksichtigt. Das Buch dient alsWegweiser bei der Patientenbetreuung undNachschlagewerkfür die kardiologischeWeiterbildung.
Dr. med. Stefan PingerInternist und Kardiologe, Leitender Oberarztam St. Elisabeth-Krankenhaus, Geilenkirchen
> Sichern Sie sich jetztdas aktuelle Fachwissen!