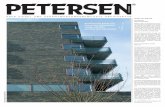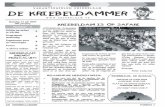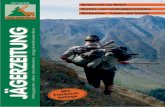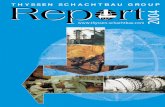16202246 Abiturprufung Deutsch 2004
-
Upload
hanswernerkaiser1 -
Category
Documents
-
view
185 -
download
4
Transcript of 16202246 Abiturprufung Deutsch 2004

1
ABITURPRÜFUNG DEUTSCH 2004 Redakteur: Winfried Bös AUFGABE I Interpretationsaufsatz mit übergreifender Teilaufgabe zu einer Pflichtlektüre (Werk im Kontext) Thema: Friedrich Schiller (1759 — 1805), Kabale und Liebe Theodor Fontane (1819 — 1898), Effi Briest Friedrich Schiller, Kabale und Liebe, IV,4
FERDINAND, nach einem langen Stillschweigen, worin seine 5 Züge einen schrecklichen Gedanken entwickeln.
FERDINAND. Verloren! Ja Unglückselige! — Ich bin es. Du bist es auch. Ja bei dem großen Gott! Wenn ich verloren bin, bist du es auch! - Richter der Welt! Fordre sie mir nicht ab. Das Mädchen ist mein. Ich trat dir deine ganze 10 Welt für das Mädchen ab, habe Verzicht getan auf deine ganze herrliche Schöpfung. Lass mir das Mädchen. - Richter der Welt! Dort winseln Millionen Seelen nach dir - Dorthin kehre das Aug deines Erbarmens - mich lass allein machen, Richter der Welt! (Indem er schrecklich die 15 Hände faltet.) Sollte der reiche vermögende Schöpfer mit einer Seele geizen, die noch dazu die schlechteste seiner Schöpfung ist? - Das Mädchen ist mein! Ich einst ihr Gott, jetzt ihr Teufel! (Die Augen gross in einen Winkel ge- worfen.) Eine Ewigkeit mit ihr auf ein Rad der Verdamm- 20 nis geflochten - Augen in Augen wurzelnd - Haare zu Berge stehend gegen Haare - Auch unser hohles Wim- mern in eins geschmolzen - Und jetzt zu wiederholen meine Zärtlichkeiten, und jetzt ihr vorzusingen ihre Schwüre - Gott! Gott! Die Vermählung ist fürchterlich - 25 aber ewig! (Er will schnell hinaus. Der Präsident tritt herein.)

2
Aufgabenstellung: - Fassen Sie das zum Verständnis dieser Szene Wesentliche aus der
vorangegangenen Handlung zusammen. - Untersuchen Sie, was in Ferdinand vorgeht, und analysieren Sie die sprachlich-
gestische Gestaltung der Szene. Schillers „Kabale und Liebe” und Fontanes „Effi Briest”: - Erklären und vergleichen Sie die Reaktion Ferdinands auf Luises vermeintliche
Untreue und die Reaktion Innstettens auf Effis Treuebruch. AUFGABE II Gestaltende Interpretation Thema: Theodor Fontane (1819-1898), Effi Briest, Kap.36 (Auszug)
Und ehe die Uhr noch einsetzte, stieg Frau von Briest die Treppe hinauf und trat bei Effi ein. Das Fenster stand auf und sie lag auf einer Chaise- longue, die neben dem Fenster stand. Frau von Briest schob einen kleinen schwarzen Stuhl mit drei goldenen Stäbchen in der Ebenholzlehne heran, nahm Effis Hand und sagte: 5 »Wie geht es dir, Effi? Roswitha sagt, du seiest so fiebrig.« »Ach, Roswitha nimmt alles so ängstlich. Ich sah ihr an, sie glaubt, ich ster- be. Nun, ich weiß nicht. Aber sie denkt, es soll es jeder so ängstlich nehmen wie sie selbst.« »Bist du so ruhig über Sterben, liebe Effi?« 10 »Ganz ruhig, Mama.« »Täuschst du dich darin nicht? Alles hängt am Leben und die Jugend erst recht. Und du bist noch so jung, liebe Effi.« Effi schwieg eine Weile. Dann sagte sie: »Du weißt, ich habe nicht viel gelesen und Innstetten wunderte sich oft darüber und es war ihm nicht 15 recht.« Es war das erste Mal, dass sie Innstettens Namen nannte, was einen großen Eindruck auf die Mama machte und dieser klar zeigte, dass es zu Ende sei. »Aber ich glaube«, nahm Frau von Briest das Wort, »du wolltest mir was 20 erzählen.« »Ja, das wollte ich, weil du davon sprachst, ich sei noch so jung. Freilich bin ich noch jung. Aber das schadet nichts. Es war noch in glücklichen Tagen,

3
da las mir Innstetten abends vor; er hatte sehr gute Bücher und in einem hieß es: Es sei wer von einer fröhlichen Tafel abgerufen worden und 25 am andern Tage habe der Abgerufene gefragt, wie's denn nachher gewe- sen sei. Da habe man ihm geantwortet: >Ach, es war noch allerlei; aber eigentlich haben Sie nichts versäumt.< Sieh, Mama, diese Worte haben sich mir eingeprägt – es hat nicht viel zu bedeuten, wenn man von der Tafel etwas früher abgerufen wird.« 30 Frau von Briest schwieg. Effi aber schob sich etwas höher hinauf und sagte dann: »Und da ich nun mal von alten Zeiten und auch von Innstetten ge- sprochen habe, muss ich dir doch noch etwas sagen, liebe Mama.« »Du regst dich auf, Effi.« »Nein, nein; etwas von der Seele heruntersprechen, das regt mich nicht 35 auf, das macht still. Und da wollt ich dir denn sagen: ich sterbe mit Gott und Menschen versöhnt, auch versöhnt mit ihm.« »Warst du denn in deiner Seele in so großer Bitterkeit mit ihm? Eigent- lich, verzeih mir, meine liebe Effi, dass ich das jetzt noch sage, eigent- lich hast du doch euer Leid heraufbeschworen. « 40 Effi nickte. »Ja, Mama. Und traurig, dass es so ist. Aber als dann all das Schreckliche kam und zuletzt das mit Annie, du weißt schon, da hab' ich doch, wenn ich das lächerliche Wort gebrauchen darf, den Spieß umgekehrt und habe mich ganz ernsthaft in den Gedanken hineinge- lebt, er sei schuld, weil er nüchtern und berechnend gewesen sei und 45 zuletzt auch noch grausam. Und da sind Verwünschungen gegen ihn über meine Lippen gekommen.« »Und das bedrückt dich jetzt?« »Ja. Und es liegt mir daran, dass er erfährt, wie mir hier in meinen Krankheitstagen, die doch fast meine schönsten gewesen sind, wie 50 mir hier klar geworden, dass er in allem recht gehandelt. In der Ge- schichte mit dem armen Crampas — ja, was sollt' er am Ende anders tun? Und dann, womit er mich am tiefsten verletzte, dass er mein ei- gen Kind in einer Art Abwehr gegen mich erzogen hat, so hart es mir ankommt und so weh es mir tut, er hat auch darin Recht gehabt. 55 Lass ihn das wissen, dass ich in dieser Überzeugung gestorben bin. Es wird ihn trösten, aufrichten, vielleicht versöhnen. Denn er hatte viel Gutes in seiner Natur und war so edel, wie jemand sein kann, der ohne rechte Liebe ist.«

4
Aufgabenstellung:
- Skizzieren Sie die Situation, in der dieses Gespräch stattfindet, und erklären Sie Effis Haltung.
- Gehen Sie von folgender Annahme aus: Einige Zeit nach Effis Tod verfasst Frau von Briest einen Brief an Baron von Innstetten. Sie setzt sich darin offen mit der Persönlichkeit ihrer Tochter und dem Scheitern der Ehe auseinander. Schreiben Sie diesen Brief.
AUFGABE III Literarische Erörterung Thema: „Die Welt ist einmal, wie sie ist, und die Dinge verlaufen nicht, wie wir wollen, sondern wie die andern wollen.” (Wüllersdorf, Kap.27) Zitat aus: Theodor Fontane (1819-1898), Effi Briest Aufgabenstellung: Erörtern Sie, ausgehend von Wüllersdorfs Aussage, das Verhältnis von Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Konvention an literarischen Werken Ihrer Wahl.

5
AUFGABE IV Interpretationsaufsatz zu einem Gedicht oder Gedichtvergleich Thema: Mascha Kaleko (1912 - 1975), Emigranten - Monolog (1945) Emigranten - Monolog Ich hatte einst ein schönes Vaterland – So sang schon der Flüchtling Heine. Das seine stand am Rheine, Das meine auf märkischem Sand. Wir alle hatten einst ein (siehe oben !) 5 Das fraß die Pest, das ist im Sturm zerstoben. O Röslein auf der Heide, Dich brach die Kraftdurchfreude. Die Nachtigallen werden stumm, Sahn sich nach sicherm Wohnsitz um. 10 Und nur die Geier schreien Hoch über Gräberreihen. Das wird nie wieder, wie es war, Wenn es auch anders wird. Auch, wenn das liebe Glöcklein tönt, 15 Auch wenn kein Schwert mehr klirrt. Mir ist zuweilen so, als ob Das Herz in mir zerbrach. Ich habe manchmal Heimweh. Ich weiß nur nicht, wonach ... 20 Erklärungen:, V.1: „Ich hatte einst ein schönes Vaterland”: Erster Vers von Heines Gedicht „In der Fremde III” V.7: „... Röslein auf der Heide”: Anspielung auf Goethes Gedicht „Heidenröslein” mit dem Refrain:
„Röslein auf der Heiden”. Darin bricht ein Knabe eine kleine Rose gewaltsam. V.8: „... Kraftdurchfreude”: eigentlich „Kraft durch Freude”; von den Nationalsozialisten
geschaffene, politisch organisierte Freizeitgestaltung Aufgabenstellung: Interpretieren Sie das Gedicht.

6
AUFGABE V Analyse und Erörterung nicht fiktionaler Texte (auch mit gestalterischer Teilaufgabe) hier: Erörterung Thema: Ulrich Beer, Autorität' in: chrismon - Das evangelische Magazin, 5/2002 „Tante, müssen wir heute wieder, tun, was wir wollen?”, fragte ein Mädchen in einem Hamburger Kinderladen die Erzieherin. Verständlich, dass die verdutzt dreinschaute. Denn mit dem Konzept antiautoritärer Erziehung verträgt sich eine solche Frage schlecht. Danach soll der Mensch sich selbst verwirklichen und selbst bestimmen. Und um das zu lernen, muss' ein Kind tun dürfen, was es will. Doch damit dreht sich 5 die antiautoritäre Erziehung im Kreise, denn der Mensch kann seine Lebensziele nicht nur aus sich heraus entwickeln. Sonst wäre er dem Drängen seiner Triebe und der Macht seiner Wünsche ausgeliefert. Braucht er darum nicht Grenzen? Dies scheint das pädagogische Thema zu sein, das die Eltern heute am meisten bewegt. Ja, der Mensch, vor allem das Kind, braucht 10 Grenzen, aber noch nötiger braucht es Ziele, Inhalte, Werte. Sie werden vor allem durch Liebe, Nähe und Vorbild vermittelt. Autorität hat nicht der, der etwas zu verbieten hat, sondern der, der etwas zu bieten hat: Darum ist nicht nur der Vater Autoritätsperson, sondern die Mutter scheint noch wichtiger zu sein. Aus amerikanischen Untersuchungen über Familienmilieu und 15 Jugendkriminalität ist bekannt, dass dabei überstrenge Väter und autoritätsschwache Mütter eine unselige Rolle spielen. Auch die Pisa-Bildungsstudie beklagt verbreitete Gleichgültigkeit, das Fehlen von Nähe und Autorität bei heutigen Eltern. Es scheint, als hätten viele Eltern vor der erdrückenden Erziehungskonkurrenz der Medien und der Freizeitindustrie kapituliert. Viele Pädagogen fordern mehr Mut zur Erziehung im 20 personalen Bereich, mehr Mut zu Autorität. Doch wenn heute der Ruf nach mehr Autorität ertönt, ist damit peinlicherweise meistens mehr Gewalt gemeint. ,Wirkliche Autorität ist aber kein Verhältnis der Machtausübung, sondern der Wertevermittlung, ist nicht Gewalt, sondern Vertrauensmacht. In diesem Sinne unterschieden die Römer treffend zwischen 25 "auctoritas", die Gewalt ausschließt, und "potestas" (Macht). Die „auctoritas” bedarf der freien Anerkennung, um Autorität zu sein. Gewalt kann sich einseitig durchsetzen und ihr Objekt zerkleinern und vernichten. Autorität kennt nur Partner. Sie hat Gewalt nicht nötig und verliert sich gerade in dem Maße, in dem sie durch Gewalt ersetzt wird. Dem sprachlichen Ursprung nach leitet sich Autorität von lateinisch "augere" 30 (mehren) her. Sie bezeichnet das Verhältnis zwischen einem, der mehr Wissen, Erfahrung oder Güte hat, zu einem, der noch mehr davon braucht. Sie fördert und ermutigt seine Fähigkeiten und sein Wachstum. Sie besitzt, um zu geben.

7
Wer Angst hat, seine Autorität zu verlieren, hat sie schon verloren. Wer sie um jeden Preis wieder herstellen möchte, ist in der Gefahr, Zuflucht zur Gewalt zu suchen. 35 Autorität scheint etwas zu sein wie das Glück oder die Persönlichkeit - dadurch, dass man sie um jeden Preis anstrebt, verfehlt man sie am sichersten. Man kann sie nicht beanspruchen. Zu ihr gehören Partner, die sie anerkennen. Eltern und Erzieher haben es heute unbestreitbar schwerer als in Zeiten, in denen die Werteordnungen und mit ihnen die Hierarchien stabiler waren. Partnerschaft ist 40 menschlicher, aber eben auch schwerer als Patriarchat. Damals wurde die Autorität aus Gott abgeleitet und floss über den Landesvater dem Familienvater zu. Auf den Trümmern dieser Pyramide muss um Autorität, ohne die es keine Führung und keine Erziehung gibt, immer neu gerungen werden: Wie lange dürfen die Kinder vor dem Bildschirm sitzen, in der Disco tanzen, auf der Party feiern? Nicht das Machtwort, das 45 harte Grenzen zieht, ist Ausdruck wirklicher Autorität, sondern die Überzeugungskraft des Erfahreneren, vor allen der erfahreneren Mutter, die ihre Tochter sowohl verstehen wie beschützen möchte. Es wäre vermessen, allgemein gültige Ratschläge zu erteilen. Jeder, der mit Kindern größer und älter geworden ist, weiß, wie viel vom Reifestand der Kinder, vom Wohnmilieu, vom Freundeskreis 50 abhängt. Für die einen ist mehr Freiheit eine Chance, für andere kann sie eine Überforderung bedeuten. Nicht nur Eltern müssen ihr Verhältnis zu Autorität und Macht neu bedenken, sondern auch Politiker, denen ja schon von Amts wegen Autorität zugestanden wird. Jedenfalls hängt in der Demokratie ihr Einfluss entscheidend von ihrer Glaub-55 würdigkeit ab. Die Meinung, Demokratie schlösse Autorität aus, beruht auf einem Missverständnis. Sie erst macht Autorität möglich. Demokratie ist legalisierte Machtausübung, die auf Anerkennung beruht und sich ständig rechtfertigen muss. Dazu gehört - und das gilt genauso für Geistliche, Lehrer und andere Funktions- und damit Vertrauensträger -, dass Autorität ausgefüllt werden muss. Bestechlichkeit, 60 Machtmissbrauch und Wahlkampftheater gefährden, ja zerstören das Autorität begründende Vertrauen. Das erleben wir zurzeit in erschreckendem Maße. Autorität ist im Übrigen nicht auf ewig verliehen. Sie ist abrufbar. In der Erziehung erfüllt sie ihren Auftrag gerade in dem Maße, in dem sie sich zurücknimmt. Wenn man das anerkennt, werden auch die erzieherischen Konflikte um die Autorität 65 nicht mehr unlösbar sein. Eine solche Autorität will sich nicht um jeden Preis erhalten. Sie handelt nach dem biblischen Motto: Du musst wachsen, ich aber muss abnehmen. Sie weiß, dass es völlig natürlich ist, wenn der Fünfjährige sagt: Vater kann alles, der 15-Jährige: Der Alte war schon besser, der 25-Jährige: Er hat sich in der letzten Zeit ganz gut gemacht, der 35-Jährige: Das bespreche ich am besten mit 70 Vater, der 45-Jährige: Wenn ich jetzt noch einmal Vater fragen könnte!

8
Aufgabenstellung: - Arbeiten Sie den Kerngedanken des Autors heraus und zeigen Sie, wie er ihn
entwickelt
Wählen Sie eine der folgenden beiden Arbeitsanweisungen: - Erörtern Sie das Spannungsverhältnis zwischen „Autorität” und „Macht” in
verschiedenen Lebensbereichen; beziehen Sie Ihre Erfahrungen ein. oder - Gehen Sie von folgender Annahme aus: Die SMV Ihrer Schule veranstaltet für Eltern, Lehrerkollegium und Schülerschaft eine Podiumsdiskussion zum Thema „Autorität und Macht in der Erziehung”. Formulieren Sie als Schülersprecher/in den Einführungsvortrag.

9
LÖSUNGSHINWEISE AUFGABE I Thema: Friedrich Schiller, Kabale und Liebe Theodor Fontane, Effi Briest Hinweise zur Aufgabenstellung Die „schrecklichen Gedanken” Ferdinands kündigen das tragische Ende des Trauerspiels an. Die dreiteilige Aufgabenstellung erfordert eine knappe Einordnung des Monologs, eine Inhalts- und Formanalyse sowie eine aspektbezogene vergleichende Betrachtung. Um diese Teilaufgabe entsprechend bearbeiten zu können, ist ein kurzer Dramenauszug ausgewählt. Hinweise auf mögliche Ergebnisse 1. Arbeitsanweisung: Zunächst sind die Ursachen für die tragische Entwicklung der Liebesbeziehung zwischen Ferdinand und Luise zu skizzieren. Gesellschaftliche Faktoren und persönliche Anlagen der beiden Hauptfiguren wirken dabei ineinander. Eine Rolle spielen: der Standesunterschied; die Korruptheit und Intriganz des Adels, die Wurms Kabale ermöglichen; die Normgebundenheit im patriarchalischen Kleinbürgerhaus; Ferdinands Ichbezogenheit und Realitätsferne; Luises Konflikt zwischen Selbstbestimmung, Vaterbindung, Standesdenken und Religion. 2. Arbeitsanweisung: Ferdinand fordert in seinem Monolog Luise als sein Eigentum: „Das Mädchen ist mein.“ (Z.6) Diese Verfügungsgewalt wiederholt er später (Z. 14). Dahinter verbirgt sich Hybris, denn er spielt sich auf als „ihr Gott“ und „jetzt ihr Teufel“ (Z. 14f). Er stellt sich damit auf die Stufe des Schöpfers, mit dem er auf gleicher Ebene „verhandelt“. Die Begründung ist fadenscheinig, da ein Zirkelschluss: Weil er sie anfangs vergöttert habe (mit „Verzicht“ auf die „ganze herrliche Schöpfung“ – Z. 7f), sei sie ihm jetzt ausgeliefert. Obwohl er Gott zweimal als „Richter der Welt“ (vgl. Z. 5 u. 9) anspricht, erhebt er sich über ihn und maßt sich genau diese Kompetenz an. Dabei ist er von niedrigen Beweggründen gesteuert: durch die Intrige Wurms und sein eigenes Misstrauen verblendet, will er die Untreue Luises rächen und sie zu einer „fürchterlichen Vermählung“ (Z. 21) führen. Die Vermählung ist ein „Rad der Verdammnis“ (Z.16f), das sie „ewig“ verschmelzen soll.

10
Abgesehen von seiner Ichbezogenheit und Selbstüberhebung dokumentiert sich in seinen Ausführungen, dass Luise auch nach dem angeblichen Verrat elementar für ihn ist. Der Monolog Ferdinands beginnt mit „einem langen Stillschweigen“ (Z.1), die seine innere Aufgewühltheit vermuten lässt. Außerdem erhöht die Pause die Spannung. Die emotionale Spannung entlädt sich mit Ausrufen, die sich erst nach und nach zu Aussagen formen. Ausrufe, Imperative, Ellipsen, Wiederholungen, Aufzählungen, Parallelismen, Antithesen, rhetorische Fragen, Vergleiche, Metaphern sind als sprachliche Mittel zu benennen und funktional zuzuordnen, wobei keine Vollständigkeit erwartet wird. Zentral ist, dass Ferdinand sogar die „Hände faltet“, um die Apokalypse seiner Beziehung zu gestalten, was als Sakrileg zu werten ist. 3. Arbeitsanweisung: Wichtig ist, dass Ferdinands oben beschriebene Reaktionen auf den Geniekult seiner Zeit zurückzuführen sind. Das Ideal einer absoluten Liebe (vgl. I/4, III/4) ist dabei ebenso wichtig wie die Idee von der Allmacht eines autonomen Ichs. Beides führt in die Irre, weil Ferdinand blind für die Realität Luises und die Intrige wird. Die Egozentrik bedingt Vermessenheit, die sich nur in den Kategorien des eigenen Anspruchs bewegt. Leben und Tod werden damit verfügbar und ohne moralische Skrupel zur Disposition gestellt. So wie Ferdinand sein Leben an die Liebe zu Luise bindet, bindet er sie an sein Leben bzw. seinen Tod. Auch Innstetten verstößt Effi; er vergiftet sie zwar nicht, liefert sie aber dem Tod aus, indem er sich von ihr distanziert und ihr die eigene Tochter entfremdet, so dass sie daran zerbricht. Als Gründe spiegelt er Ehrgefühl, Pflichtbewusstsein und Prinzipientreue vor, aber im Hintergrund entpuppt sich das Ganze doch auch als Akt der Gewalt, indem er sich einmal mit dem Nebenbuhler duellieren muss. Zum andern: Obwohl er seine Frau noch liebt und „zum Verzeihen geneigt” (Kap.27) ist, opfert er sein persönliches Lebensglück auf dem Altar des Götzen „Ehre”. Er nimmt zwar von „Hass oder gar von Durst nach Rache” (Kap. 27) Abstand, doch bleibt seine Reaktion die typisch Männliche, indem er seine persönlichen Verletzungen („ich bin gekränkt, schändlich hintergangen“) mit gesellschaftlichen Konventionen kaschiert. Der Treuebruch Luises ist nur Schein, während Effi Innstetten wirklich hintergeht, allerdings nur für kurze Zeit und nicht auf Dauer. Briefe spielen dabei eine zentrale Rolle. Beide „Betrogenen“ fragen nicht nach der eigenen Verantwortung und Schuld; sie suchen nicht das Gespräch mit den Frauen und damit die Beweggründe, die sie angestiftet haben. Ferdinand flüchtet sich in seine Rachephantasien, Innstetten in seine Ehre. Er überlegt ja mit Wüllersdorf, handelt nicht aus dem Affekt, findet sogar genügend Aspekte gegen ein Duell und die Verstoßung seiner Frau und entscheidet sich wider besseres Wissen. Immerhin reflektiert er danach und spricht von einer „Komödie“ die er spielt. Auch später möchte er aus der „ganzen Geschichte heraus“, aber wie glaubwürdig sind seine Bekenntnisse, wenn er jetzt die Karriereleiter erklommen hat, die ihm immer so wichtig war?

11
AUFGABE II Thema: Theodor Fontane, Effi Briest, Kap. 36 (Auszug) Die folgenden Hinweise enthalten häufig den Zusatz „abweichend vom offiziellen Erwartungshorizont“, weil der Verfasser wichtige Aussagen der Vorlage nicht übernehmen konnte. Ich bitte um Ihr Verständnis, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Hinweise zur Aufgabenstellung Effi beauftragt ihre Mutter, Innstetten von ihrer späten Einsicht wissen zu lassen; so ist sie autorisiert, ihm eine briefliche Mitteilung zu machen. Frau von Briest verhält sich im Konflikt mit ihrer Tochter sehr konventionell. Weil sie selbst keine Unbeteiligte ist, ist der subjektive Gestaltungsspielraum für Inhalt und Tonlage des Schreibens an Innstetten eng begrenzt - abweichend vom offiziellen Erwartungshorizont. Hinweise auf mögliche Ergebnisse 1. Arbeitsanweisung Die Ausführungen sollten gleich mit der Scheidungs- und Lebenssituation Effis in Berlin beginnen. Neben der Trennung von Innstetten belastet Effi vor allem die „Umerziehung“ ihrer Tochter, die auf deutliche Distanz zu ihrer Mutter gehalten wird. Auch die Eltern verhalten sich distanziert, um das gesellschaftliche Leben in ihrem Hause nicht einschränken zu müssen. Erst die Vermittlung ihres Arztes führt dazu, dass die Eltern der Schwerkranken die Rückkehr nach Hohen-Cremmen erlauben. Dort findet schließlich eine Aussprache zwischen Mutter und Tochter statt. Anlass des Besuches sind Befürchtungen des Dienstmädchens. Effi gibt sich zwar betont gelassen und spielt ihren Zustand herunter, doch hat sie sich gewandelt, was einen nahen Tod befürchten lässt. Sie hat mit ihrem Leben abgeschlossen und denkt über Versöhnung und Verzeihung nach. Zum ersten Mal spricht sie von Innstetten und beichtet ihrer Mutter, dass ihr Zorn und ihre Bitterkeit über sein Verhalten unberechtigt waren und er in allem richtig gehandelt habe. Sie distanziert sich von ihrem damaligen Zornesausbruch und rehabilitiert Innstetten, allerdings mit der Einschränkung, dass er „ohne rechte Liebe” (Z.58f.) sei. Effi bittet ihre Mutter, nach ihrem Tod Innstetten von ihrer Wandlung wissen zu lassen, in der vagen Hoffnung, dies werde ihn „trösten, aufrichten, vielleicht versöhnen” (Z.57). Die Erklärung von Effis Wandlung lässt sich - abweichend vom offiziellen Erwartungshorizont - als eigenständige Interpretation ausbauen.

12
Effi findet - möglicherweise - zurück zu ihrer christlichen Tradition, die von ihr verlangt, die Menschen „versöhnt“ hinter sich zu lassen, und sich nicht mit Hass aus der Welt zu verabschieden. Ein zweiter Gedanke wäre das Harmoniebedürfnis Effis. Sie ist wohlbehütet aufgewachsen und sieht auch in der großen Welt mehr eine Bühne des schönen Scheins als die Realität des Daseins. So nimmt es nicht wunder, wenn sie auch im Angesicht des Todes diesen Schein einer heilen Welt zu wahren sucht. Die Beichte Effis könnte aber auch als Provokation empfunden werden, die belegt, wie unselbstständig und unpersönlich sie aus dem Leben scheidet. Sie hat die gesellschaftlichen Konventionen so internalisiert, dass sie ihrem Mann, der ja - nach eigenen Angaben - nur aus gesellschaftlichem Antrieb so handelte, in allem folgt, was die Gesellschaft vorgibt, auch wenn es jeder Menschlichkeit widerstreitet. Sie stilisiert sich damit in eine Opfer- oder gar Märtyrerrolle, die gerade die Abhängigkeit der Frau in dieser Gesellschaft grell hervortreten lässt. Dabei käme es darauf an, das Klischee- und Rollenhafte der Abschiedszene herauszuarbeiten. Jedenfalls sollte auch für solche kritische Gedanken den Schülern Raum gegeben werden. 2. Arbeitsanweisung: Mit dem Brief Frau von Briests an Innstetten erfüllt diese Effis Wunsch. Die Aufgabenstellung verlangt, dass Frau von Briest sich „offen” mit der Persönlichkeit ihrer Tochter und dem Scheitern der Ehe auseinander setzt. Dies ist eine Schreibvorgabe, die ich - abweichend vom offiziellen Erwartungshorizont - so nicht übernehmen kann. Denn „Offenheit“ ist keine Eigenschaft, die Frau von Briest aus- und kennzeichnet. Ihr Hauptaugenmerk gilt gesellschaftlichen Konventionen, deren Inhumanität sie weitgehend verdrängt. Ihrem Mann gegenüber gibt es Ansätze zur Offenheit; sie lassen aber die Verdrängungsmechanismen nur deutlicher hervortreten. So wird sie auch – abweichend vom offiziellen Erwartungshorizont - nicht unbedingt Verantwortung übernehmen, denn sie hat die Ehe aus gesellschaftlichen Gründen gestiftet, ist also mitverantwortlich für das, was geschehen ist. Freilich kann sie sich selbstkritisch dazu äußern, aber sie wird es halbherzig und zögerlich tun. Der gestalterische Spielraum muss deswegen als begrenzt angesehen werden, will man Frau von Briest einigermaßen in Kongruenz zum Roman sehen, sie also nicht zu einer anderen, neuen Figur stilisieren. So wird sie höchstens aus ihrer Perspektive ein Bild von der zu jungen „Tochter der Luft” (Kap.1) zeichnen, von ihrer Naivität und dem Bemühen, sich in gesellschaftliche Konventionen zu fügen. Da sie Innstetten selbst favorisiert hat, kann sie ihm keine Vorwürfe machen, geschweige denn sich mit seiner Persönlichkeit auseinander setzen - abweichend vom offiziellen Erwartungshorizont; höchstens kann sie ihn auf die Unvereinbarkeit seines Lebensstils, den Effi immer als langweilig eingestuft hat, hinweisen. Der Brief ist also eher Bilanz einer verfehlten Beziehung, die sich konventionell an die (allzu bekannten) Vorgaben des Romans anschließt. Für eigene Schwerpunktsetzung ist da - abweichend vom offiziellen Erwartungshorizont - wenig Raum.

13
Der Stil des Briefes kann auch nicht sehr persönlich sein, weil Frau von Briest ihren sozialen Stand nicht verleugnet, sondern eher peinlich beachtet. Dazu kommt, dass sie selbst im Angesicht des Todes ihrer Tochter nicht die Contenance verliert, sondern sehr kontrolliert und selbstbeherrscht damit umgeht. Eine Schwerpunktsetzung der Aufgaben zugunsten der letzten halte ich - abweichend vom offiziellen Erwartungshorizont – nicht für zulässig, weil sie nicht aus der Aufgabenstellung hervorgeht. AUFGABE IV Thema: Mascha Kaleko (1912 – 1975), Emigranten – Monolog (1945) Hinweise zur Aufgabenstellung Das Gedicht gestaltet allgemeine und persönliche Exilerfahrungen. Die Gedichtform bietet Anreize zur Beobachtung und interpretatorischen Auswertung. Die Aufgabenstellung eröffnet Freiräume für das eigene Vorgehen. Hinweise auf mögliche Ergebnisse Die Strophen heben sich gut und klar voneinander ab. Strophe eins beginnt mit einer persönlichen Erinnerung, die in der zweiten verallgemeinert wird („Ich hatte einst ein schönes Vaterland -“ - „Wir alle hatten einst...“ – V.1 u. 5). Strophe drei geht als Mittelstrophe ganz in einem Naturbild auf, wobei das Verstummen der Nachtigallen (V.9) mit dem „Schreien“ der Geier kontrastiert. Die vierte Strophe prophezeit die Zukunft („Das wird nie wieder,...“ – V. 13); die fünfte klingt mit einem persönlichen Fazit oder Resümee aus. Sprechhaltung und Zeitbezüge ändern sich so über die Strophen hinweg. Vers eins beginnt mit einem Zitat Heines; es wird ihm nämlich im folgenden Vers (V.2) zugeordnet, obwohl es ohne Anführungszeichen steht. So entsteht gleich eine historische Klammer zwischen Exilerfahrung im 19. und 20. Jahrhundert. Es geht um deutsche Exilerfahrung, denn beide Dichter werden geographisch genau zugeordnet (V. 3 u.4). Das eigene Emigrantenschicksal könnte so zumindest emotional relativiert werden; durch eine Silbe zuviel (vgl. V.2) stolpert der Leser aber eher über Heine. Er wird so zum Signal und Spiegel einer noch viel schlimmeren Erfahrung. Das Vaterland ist jetzt im „Sturm zerstoben“, die Pest hat es aufge-„fressen“. Der Nationalsozialismus wird einer personifizierten Krankheit gleichgesetzt. Als besondere Leistung kann gelten, wenn der Schüler die Parallelität von Zeitbezügen entdeckt und gestaltet. Der amerikanische Präsident Roosevelt hat nämlich in seiner Quarantäne-Rede vom

14
5. Oktober 1937 auch das Bild einer „Seuche der Gesetzlosigkeit“, einer Epidemie bemüht. Der Krieg als „ansteckende Krankheit“ gehöre unter Quarantäne gestellt. Mit dem Goethe-Zitat (V.7) wird die literarische Tradition der Klassik und Romantik angetippt, um sie jetzt den Nationalsozialisten preiszugeben. Naturverbundenheit und Tradition klingen in dem Vers (V.7) an; sie wurden von den Nazis missbraucht, um die Menschen zu blenden und an sich zu ziehen (die Zusammenschreibung der „Kraft durch Freude“ versinnbildlicht die gewaltsame, teils auch gewinnende Verführung). Das Zerstörungswerk ist vollkommen, denn auch die Natur bleibt nicht verschont. Nachtigallen verstummen (V.9) und finden keinen Unterschlupf mehr; Aas-„Geier“ bestimmen das Bild, das in Zusammenhang mit den Gräberreihen wie die Apokalypse selbst wirkt. Tod und Vernichtung sind so extrem, dass – gleich einem Wahlspruch – nichts „wieder“ so werden kann „wie es war“ (V.13). Eine schonungslosere Abrechnung mit der eigenen Gegenwart ist kaum denkbar. Der „Gesang“ Heines ist damit in weite Ferne gerückt, und ob es in Zukunft so etwas wie Heilung oder gar Versöhnung geben könnte, wird stark bezweifelt. Die anaphorisch und parallel gebauten Einschränkungen („auch wenn“ – V. 15,16) unterstreichen das aussichtslose Bemühen, etwas von der Vergangenheit zu retten oder wieder auferstehen zu lassen. So arbeitet das Gedicht mit starken Bildern, Kontrasten und sentenzartigen Zuspitzungen, die die Dimension des Geschehenen widerspiegeln soll. Der Versuch einer eigenen Bilanz orientiert sich an der romantischen, volksliedhaften Tradition. Der Vergleich „Mir ist zuweilen so, als ob...“ (V.17), bleibt in der Schwebe, weil er eigentlich nicht weiter geführt werden kann, weil es kein persönliches Erfahrungsbild gibt, das dem vorher entwickelten Grauen entspräche. Deswegen folgt der traditionelle Topos des „zerbrochenen Herzens“, wohl auch, weil der Mensch nie alles Unheil der Welt in sich aufnehmen kann. Die Entfremdung und Perspektivlosigkeit mündet dann noch in das „Heimweh“; auch ein romantisches Bild, aber spezifisch verfremdet, denn die Verstörung wird darin sichtbar, dass es keine Orientierung mehr gibt, wo das Bewahrenswerte und Gute geblieben ist. So klingt der Schlussvers harmloser und unverbindlicher aus, als er existenziell gemeint ist. Als besondere Leistung kann und muss gewertet werden, wenn der Schüler als Grundmuster des Gedichts die Volksliedstrophe erkennt und in Kontrast dazu die spezifischen Abwandlungen Kalekos thematisiert (Anspielungen, Zitate, Metaphorik, Topoi und Reimschema).

15
AUFGABE V Thema: Ulrich Beer, Autorität Hinweise zur Aufgabenstellung: Der Text setzt sich mit dem Thema „Autorität“ auseinander; der Autor entwickelt und problematisiert seine diesbezüglichen Gedanken am Beispiel der Erziehung, um sie dann auch auf ihre Relevanz für Demokratie und Politik zu befragen (Z. 53ff). Dass Autorität im Erziehungsprozess wie auch in der demokratischen Gesellschaft notwendig ist, muss vom Schüler als zentrale Textaussage erkannt und in den Argumentationszusammenhang gestellt werden (1. Arbeitsanweisung). Die Unter-scheidung zwischen Autorität und Macht ist hier konstitutiv; sie ist der Grundstock für die im Erörterungsteil geforderte Darstellung beider Ver-haltensweisen in der Praxis und ihre kritische Bewertung (Arbeitsanweisung 2a). Die Gestaltungsaufgabe (2b) zielt als Rollentext auf verschiedene Standpunkte, die in dem vorgegebenen situativen Kontext einen Diskussionshorizont erschließen sollen. Der Adressaten-bezug und der Charakter als „Einführung“ stehen hier anstelle einer differenzierten Erörterung im Vordergrund. Hinweise auf mögliche Ergebnisse: 1. Arbeitsanweisung: Autorität ist - nach dem Autor - für jede Gesellschaft konstitutiv, weil es ohne sie „keine Führung und keine Erziehung“ gebe (Z.43f.). „Führung“ verbindet der Autor dabei mit Kompetenz und Vertrauen: „Autorität hat nicht der, der etwas zu verbieten hat, sondern der, der etwas zu bieten hat:“ (Z.13f.) So gründet Autorität in „Erfahrung, Werten und Wissen“ (Z.31f., 24). Die Macht, die von einer solchen Autorität ausgehe, sei „Vertrauensmacht“, die ohne Gewalt auskomme (Z.28f) und auf freier Anerkennung beruhe (Z. 26f. u. 37f). Das Verhältnis der Beteiligten sei somit partnerschaftlich, indem die „Überzeugungskraft des Erfahreneren“ (Z.47) Fähigkeiten des zu Erziehenden „fördere und ermutige“ (Z.32f.). Ulrich Beer entwickelt seine Gedanken in Abgrenzung zu antiautoritärer Erziehung, die junge Menschen nur ihren „Trieben“ und „der Macht“ der „Wünsche“ (Z.7f.) ausliefere. Auch fordert er mit den Pädagogen „mehr Mut zu Erziehung (Z.20f.), weil die „Gleichgültigkeit“ (Z.18) von Eltern ebenso problematisch sei wie „überstrenge Väter und autoritätsschwache Mütter“ (Z.16f.). „Angst“ (Z.34) sei in der Erziehungsarbeit aber ein schlechter Ratgeber, wie er auch zugibt, dass Autorität und Erziehung heute nicht mehr nach alten Hierarchien und allgemein gültigen Ratschlägen erfolgen könne, sondern sich differenziert auf den „Reifestand der Kinder“ (Z.50) einstellen müssten.

16
Der Autor bemüht dabei die Etymologie wie auch die historische Erfahrung. Am Ende verallgemeinert er, dass Demokratie und Autorität nicht im Widerspruch stünden, da hier Autorität „legalisierte Machtausübung“ sei, die aber auch durch „Bestechlichkeit, Machtmissbrauch und Wahlkampftheater“ (Z. 60f.) bedroht sei. 2. Arbeitsanweisung (2a): Die Gegensätze von Autorität und Macht (Z.22-30) bilden den Ausgangspunkt für eigene und weitere Gedanken. In der Praxis sind diese Gegensätze so oft schwer oder nicht zu unterscheiden. Die Schülerinnen und Schüler müssen gleichwohl zu einer differenzierten Abwägung kommen, dass richtig verstandene Autorität auch auf Macht angewiesen sein kann, wie umgekehrt Machtausübung auch mit legitimierter Überzeugungskraft einher gehen kann. Als Fragen sind denkbar: Unter welchen Voraussetzungen entsteht wirkliche Autorität, kommt sie ohne Einsatz von Machtmitteln aus, welche Konsequenzen hat der Verzicht auf Macht, warum fehlt politischer oder wirtschaftlicher Macht häufig die Überzeugungskraft, so dass es zu Konflikten kommt? Wohin können Konflikte, die auf fehlenden oder überstarken Autoritäts- bzw. Machtelementen beruhen, führen? Der persönlichen Erfahrungsbereich der Schüler sollte mit Blick auf gesellschaftliche Institutionen wie Parteien, Kirchen, Medien oder auch den demokratischen Staat überschritten werden. Die Beispiele aus verschiedenen Lebensbereichen wie Familie, Schule und Freizeitgruppen können nicht nur das Verhalten zwischen Erwachsenen und Jugendlichen analysieren und bewerten, sondern ebenso den Umgang von Jugendlichen miteinander. Für die Bewertung der Leistung ist nicht die Zahl der Beispiele entscheidend, sondern deren Ergiebigkeit sowie die Differenziertheit und Schlüssigkeit der Argumentation. 2. Arbeitsanweisung (2b): Die Funktion als Einführungsvortrag in eine Podiumsdiskussion ist sehr wichtig. So sollte die Reichweite des Themas umrissen, verschiedene Konfliktfelder benannt und Möglichkeiten kontroverser Beurteilung aufgezeigt werden. Zur Motivierung der Diskussionsteilnehmer sind auch Fragen denkbar, die jeweils auf die Situation von Schülern einerseits und Eltern und Lehrern andererseits Bezug nehmen. Zu erwarten ist eine dialektische Struktur, die im Kern anregend und provozierend wirkt, und keine abgewogene Bilanz, die mögliche Ergebnisse oder Kompromisse vorweg-nimmt. Wohl sind Hinweise auf die Art der Diskussion (oder der Diskussionsteilnehmer) möglich wie auch auf den Anlass der Veranstaltung. Die Rolle des Schülersprechers bedingt als Maßstab eine angemessene sprachliche Gestaltung wie einen differenzierten Blick auf Thema und Adressatenkreis.