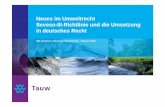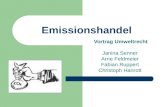Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht
-
Upload
hans-peter -
Category
Documents
-
view
229 -
download
1
Transcript of Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht

Der Begriff des „Betreibers“ einer Anlage ist einer der zentralen Be-griffe des Umweltrechts. Der Beitrag zeigt die rechtliche Bedeutung der Betreiber-Eigenschaft als Anknüpfungspunkt für die ordnungs-rechtliche Verantwortlichkeit, die zivilrechtliche Haftung sowie als strafrechtliches Zurechnungskriterium auf. Es folgt eine Bestands-aufnahme gesetzlicher und unionsrechtlicher Legaldefinitionen des Betreiber-Begriffs. Sodann wird dieser anhand der einschlägigen Rechtsprechung fallbezogen herausgearbeitet. Der Beitrag schließt mit einer zusammenfassenden Darstellung von Haupt- und Hilfs-kriterien des Betreiber-Begriffs.
A. Betreiber-Eigenschaft als zentrales Zurechnungs-kriterium ordnungsrechtlicher Verantwortlichkeit und zivilrechtlicher Haftung im Umweltrecht
Die Eigenschaft, Betreiber einer Anlage zu sein, ist das zentrale Zurechnungskriterium, an das sowohl ordnungs-rechtliche Pflichten nach dem Umweltverwaltungsrecht (z. B. § 62 Abs. 1 Satz 1 WHG, § 4 Abs. 3 BBodSchG, § 5 BImSchG) als auch die zivilrechtliche Haftung (z. B. § 89 Abs. 2 WHG, UmweltHG, § 24 Abs. 2 BBodSchG) an-knüpfen. Zudem spielt die Betreiber-Eigenschaft für Fra-gen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit im Zusam-menhang mit dem Anlagenbetrieb eine nicht unerhebliche Rolle. Im Einzelnen:
I. Anknüpfungspunkt für die ordnungsrechtliche Verantwortlichkeit
Das geltende Umwelt-Verwaltungsrecht knüpft in den ein-schlägigen Fachgesetzen (WHG, BBodSchG, BImSchG) an zahlreichen Stellen für die Frage, wer Adressat ordnungs-rechtlicher Rechtspflichten ist, an die Betreiber-Eigen-schaft an.
Am deutlichsten wird dies bei den sog. Betreiber-Pflich-ten in Bezug auf genehmigungsbedürftige Anlagen nach § 5 BImSchG. Hier lautet bereits der amtliche Titel der Vorschrift: „§ 5 Pflichten der Betreiber genehmigungs-bedürftiger Anlagen“. Auch das immissionsschutzrechtli-che Sanktions-Instrumentarium der Untersagung, Stillle-gung und Beseitigung nach § 20 BImSchG knüpft daran an, dass der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Anlage Auflagen, Anordnungen oder Rechtspflichten nicht nach-kommt. „Adressat der Verfügung nach § 20 Abs. 2 BIm-SchG ist der Anlagenbetreiber.“ 1
Auch die wasserhaushaltsrechtlichen Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach Ab-schnitt 3 des WHG haben als Zuordnungssubjekt stets den Betreiber der Anlage (arg.: „müssen so … betrieben wer-den, dass“ in § 62 Abs. 1 Satz 1 WHG). Augenfällig spricht das untergesetzliche Regelwerk, die Verordnung über An-lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen be-reits in der Überschrift von § 1 ausdrücklich von Betrei-ber-Pflichten.
Das Bodenschutzrecht knüpft in § 4 Abs. 3 Satz 1 Alter-native 1 BBodSchG an den Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast als den ordnungsrechtlich Verantwortlichen an. Die verwaltungsgerichtliche Recht-
Dr. Hans-Peter Vierhaus, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Lehrbeauftragter an der Universität Potsdam, Berlin, Deutschland
sprechung durchzieht jedoch wie ein roter Faden, dass bei anlagenbezogenen Altlasten stets derjenige als Verursacher qualifiziert wird, der Betreiber der entsprechenden Anlage ist, auf deren Betriebsgrundstück sich die Kontamination findet. Hierzu einige Beispiele aus der obergerichtlichen Rechtsprechung:
In einem Mineralöl-Schadensfall urteilte der VGH Mün-chen am 15. 3. 1999: „Die Klägerin betrieb auf dem von ihr gemieteten Grundstück Fl-Nr. 6123 der Gemarkung A (Eigentümer: Manfred H.) von etwa 1962 bis 1984 eine Tankstelle. (…) Die Klägerin hat die Gefahr einer Grund-wasserverunreinigung zumindest zu einem weit überwie-genden Teil zurechenbar verursacht, was ausreicht. Dies geschah durch ihren Tankstellenbetrieb. Die genannten Bodenverunreinigungen sind nach Einschätzung des Was-serwirtschaftsamts ‚offensichtlich‘ auf Überfüllschäden bei der Befüllung der Tanks zurückzuführen, die als sol-che mangelfrei waren (Schreiben vom 27. 8. 1992). (…) Der schadensursächliche Tankstellenbetrieb ist der Klägerin zu-zurechnen; sie hat ihn von 1962 bis 1984 im Rahmen ih-rer gewerblichen Tätigkeit veranstaltet. Allenfalls kommt ein untergeordneter Verursachungsbeitrag der Firma Au-tohaus A in Betracht (…). Selbst wenn die Firma Auto-haus A als untergeordneter Mitverursacher anzusehen sein soll, begegnet die Inanspruchnahme der Klägerin keinen Bedenken.“ 2 In seinem Beschluss vom 23. 6. 2004 – 22 Cs 04.1048 – hat der VGH München diese Rechtsprechung fortgesetzt und zur Verantwortlichkeit einer Mineralöl-Gesellschaft für eine schädliche Bodenveränderung und Grundwasserverunreinigung auf einem Tankstellengrund-stück Folgendes entschieden: „Die bestehenden Wissens-lücken hinsichtlich der Kausalketten, die zu der schädli-chen Bodenveränderung und Grundwasserverunreinigung geführt haben, geben keinen Anlass zur Bewertung, dass die Antragstellerin nicht als Verursacherin im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 BBodSchG verpflichtet werden kann. Ent-scheidend ist, dass die Gefahrenquelle in ihrem Tankstel-lenbetrieb durch ihre Befüllungsmaßnahmen und damit in ihrem Verantwortungsbereich überschritten worden sein muss, durch welche konkrete Ursache dies auch immer ge-schehen sein mag (so auch VGH München vom 15. 3. 1999, BayVBl. 2000, 149/150). Für die Lieferung einwandfreier Zapfsäulen und deren Wartung (…) trug die Antragstellerin die Verantwortung. Dies gilt auch für die Vermeidung von Überfüllungsschäden im Bereich der unterirdischen Tanks, für die sie als Befüllerin im Sinne von § 19 k WHG verant-wortlich war, zumindest aber als Betreiberin Verantwor-tung trug.“ 3
Der VGH Mannheim hatte mit Urteil vom 19. 10. 1993 – 10 S 2045/91 – die ordnungsbehördliche Heranziehung des Gesamtrechtsnachfolgers eines Betreibers eines Gas-werks für gaswerkstypische Kontaminationen mit der fol-genden Begründung bestätigt: „Bei dieser Sachlage be-steht für den Senat kein Anhalt dafür, dass neben der
DOI: 10.1007/s10357-014-2588-5
Der Betreiber-Begriff im UmweltrechtHans-Peter Vierhaus
© Springer-Verlag 2014
123
98 NuR (2014) 36: 98–104
1) OVG Münster, Beschl. v. 27. 11. 2008 – 8 B 1476/08, Rdnr. 4; ebenso: VG Halle, Urt. v. 29. 9. 2011 – 4 A 47/11, Rdnr. 40; VG München, Urt. v. 15. 2. 2011 – M 1 K 10.4520, Rdnr. 30; VG Aa-chen, Beschl. v. 11. 1. 2010 – 6 L 319/09, Rdnr. 61.
2) VGH München, Urt. v. 15. 3. 1999 – 22 B 95.2164, Rdnr. 1 und 44 f.
3) VGH München, Beschl. v. 23. 6. 2004 – 22 Cs 04.1048, Rdnr. 19–21.

CV-GmbH, die spätestens 1901 und sodann bis 1976 in der Eigenschaft als Pächterin des Grundstücks den Betrieb eigenverantwortlich geführt und betrieben hatte, für die gesamte Produktion und damit für den Umgang mit al-len Einsatzstoffen wie allen Produktionsrückständen und auch für die Teerwanne und ihren Inhalt verantwort-lich war, für die maßgeblichen Bodenverunreinigungen noch ein weiterer Verursacher in Betracht zu ziehen sein könnte. (…) Es liegt auch für den Senat auf der Hand, dass, jedenfalls was die hier zu beurteilenden weiteren Erkun-dungsmaßnahmen nach § 9 Abs. 2 BBodSchG betrifft, die CV-GmbH bis spätestens 1976 alle wesentlichen Bedin-gungen dafür gesetzt hat, dass ihr weitere Erkundungs-maßnahmen hätten aufgegeben werden können. Was die Teergrube betrifft, so besteht für den Senat kein vernünf-tiger Zweifel, dass sie jedenfalls von der CV-GmbH be-trieben wurde, auch wenn diese möglicherweise nicht von ihr errichtet worden war.“ 4 Aus dem letzten Halbsatz folgt im Übrigen die – zutreffende – Erkenntnis, dass die Bau-herren-Eigenschaft in Bezug auf eine Anlage lediglich ein Hilfskriterium ist, dem jedenfalls keine ausschlaggebende Bedeutung zukommt.
Auch das OVG Lüneburg vertritt diese Rechtsprechung und verknüpft die Verursacherverantwortlichkeit mit der Betreiber-Eigenschaft, „wenn gewichtige Indizien vor-handen sind, die den Schluss auf einen ursächlichen Zu-sammenhang zwischen der Führung des Betriebs durch den in Anspruch Genommenen und dem Eintritt jeden-falls eines erheblichen Teils der festgestellten Bodenverun-reinigungen rechtfertigen (vgl. VGH Mannheim, Beschl. v. 30. 9. 2002 – 10 S 957/02, NVwZ-RR 2003, 103). So verhält es sich hier. Die Antragstellerin hat an dem fragli-chen Standort in den Jahren 1982 bis 1984 eine chemische Reinigung und damit einen Betrieb geführt, in dem sie regelmäßig mit LCKW-haltigen Reinigungsmitteln um-gegangen ist. Derartige Stoffe sind in den Betriebsräumen nicht nur gelagert, sondern auch umgefüllt worden. Der Antragsgegner hat ferner festgestellt, dass die Antragstel-lerin Reinigungsmittel in ihrer neuen Betriebsstätte noch im Jahre 1988 nicht in hinreichend sicherer Weise gelagert hat, so dass auch für den hier fraglichen Zeitraum von einer entsprechend unzulänglichen Lagerung am alten Betriebs-standort ausgegangen werden muss.“ 5 Folgerichtig hat das VG Düsseldorf als dasjenige Verwaltungsgericht, in dessen örtliche Zuständigkeit das hier zu betrachtende Tanklager der Mandantin fiele, in seinem Urteil vom 29. 9. 2009 – 17 K 4572/08 – die Verursacher-Eigenschaft an die Betrei-ber-Eigenschaft gekoppelt (zit. nach Juris, Rdnr. 65–67): „Danach kann die Klägerin als (Mit-)Verursacherin der Altlast nach § 4 Abs. 3 Satz 1 BBodSchG auf dem Grund-stück ‚B 245‘ in E-F und der davon ausgehenden Gewäs-serverunreinigungen in Anspruch genommen werden. Die Klägerin war (Mit-)Betreiberin des Tanklagers. Sie hatte deshalb für einen gefahrlosen Betriebsablauf zu sor-gen. Die aus dem Betreiben des Tanklagers resultierenden Pflichten hat die Klägerin nicht erfüllt und Sorgfaltsan-forderungen nicht eingehalten. Für den entstandenen Schaden ist sie (mit-)verantwortlich im ordnungsrechtli-chen Sinne. (…) Entscheidend ist, dass die Kontaminati-onen aus dem Tanklagerbetrieb beruhen, durch welche konkrete Ursache – undichte Tanks, undichte Rohrlei-tungen, Handhabungsverluste und/oder Überfüllungen – dies auch immer geschehen sein mag, vgl. VGH München, Beschl. v. 23. 6. 2004 – 22 CS 04.1048, juris. Die Klägerin war (Mit-)Betreiberin des Tanklagers.“ 6
II. Anknüpfungspunkt für die zivilrechtliche Haftung
Die Eigenschaft, Betreiber einer Anlage zu sein, ist über-dies Anknüpfungspunkt für die zivilrechtliche Haftung für Schäden, die beim Anlagenbetrieb verursacht werden. Im Einzelnen:
1. Wasserrechtliche Gefährdungshaftung
Die wasserrechtliche Gefährdungshaftung nach § 89 Abs. 2 WHG – bis zur Neuregelung des WHG: § 22 Abs. 2 WHG a. F. – ist eine reine Betreiber-Haftung: „Gelangen aus ei-ner Anlage, die bestimmt ist, Stoffe herzustellen, zu verar-beiten, zu lagern (…) derartige Stoffe in ein Gewässer, ohne in dieses eingebracht oder eingeleitet zu sein, und wird da-durch die Wasserbeschaffenheit nachteilig verändert, so ist der Betreiber der Anlage zum Ersatz des daraus einem an-deren entstehenden Schadens verpflichtet.“ Der Gesetzge-ber hat dies mit der Neufassung des WHG im Rahmen der Föderalismusreform vom 31. 7. 2009 sogar noch dadurch verdeutlicht, dass er den im alten § 22 WHG verwende-ten Begriff des „Inhabers“ einer Anlage 7 angepasst und durch den Begriff „Betreiber“ ersetzt hat. Bereits nach alter Rechtslage wurden die Begriffe „Inhaber“ im Sinne von § 22 WHG und „Betreiber“ im Sinne des Umweltrechts synonym verwendet, was damit zusammenhängt, dass die Begriffsdefinition des Betreiber-Begriffs „sich offenkundig an die eine längere Tradition aufweisende Rechtsprechung des BGH für den Inhaberbegriff nach § 22 WHG anlehnt“. 8
2. Anlagen-Haftung nach Umwelthaftungsgesetz
Auch die zivilrechtliche Anlagen-Gefährdungshaftung nach dem Umwelthaftungsgesetz vom 10. 12. 1990 9 knüpft als Anspruchsgegner an den „Inhaber der Anlage“ (so aus-drücklich § 1 UmweltHG), also an deren Betreiber an. Die zentrale Regelung der Ursachenvermutung in § 6 Um-weltHG verweist insbesondere auf die Frage der Einhal-tung der Betriebspflichten, welche wiederum dem Betrei-ber obliegen.
3. Bodenschutzrechtlicher Ausgleichsanspruch
Schließlich stellt die zivilgerichtliche Rechtsprechung für die Frage, wer richtiger Anspruchsgegner des zivilrechtli-chen Ausgleichsanspruchs bei Sanierungsaufwendungen für Altlasten nach § 24 Abs. 2 BBodSchG ist, 10 für die Bejahung der Verursacher-Eigenschaft im Sinne von § 4 Abs. 3 Satz 1 Alternative 1 BBodSchG maßgeblich auf die Betreiber-Ei-genschaft ab. So hat das LG Düsseldorf 11 mit Grund- und Teilurteil vom 11. 2. 2011 – 1 O 20/07 – einer Klage zur Durchsetzung eines Ausgleichsanspruchs nach § 24 Abs. 2 BBodSchG stattgegeben und dabei sowohl den alleinigen „Beschicker“ eines Tanklagers als auch den örtlich agieren-den Lageristen als Verursacher zur Zahlung verurteilt. Ent-scheidendes Zurechnungskriterium war dabei nach Ansicht des LG Düsseldorf, dass beide Beklagte Mit-Betreiber der-selben Anlage waren, weshalb sie als Gesamtschuldner zum Ausgleich der Sanierungsaufwendungen an den Grund-stückseigentümer verpflichtet wurden. Es handelt sich dabei übrigens um die Parallelentscheidung zu dem verwaltungs-gerichtlichen Urteil des VG Düsseldorf vom 29. 9. 2009 – 17 K 4572/08 –, das die ordnungsrechtliche Verursacher-
NuR (2014) 36: 98–104 99Vierhaus, Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht
123
4) VGH Mannheim, Urt. v. 18. 12. 2007 – 10 S 2351/06, Rdnr. 42.5) OVG Lüneburg, Beschl. v. 18. 4. 2005 – 7 ME 29/05.6) VG Düsseldorf, Urt. v. 29. 9. 2009 – 17 K 4572/08, Rdnr. 38,
65–67.7) Vgl. dazu z. B. BGH, Urt. v. 8. 1. 1981 – III ZR 157/79, BGHZ
80, 1.8) Spindler, Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht: Gesellschafts-
und zivilrechtliche Einflüsse, in: Czajka/Hansmann/Reben-tisch, Hrsg., Festschrift für Feldhaus, Immissionsschutzrecht in der Bewährung, 1999, S. 25 ff., Rdnr. 28.
9) BGBl. I S. 2634.10) Eingehend: Wagner/Vierhaus, in: Fluck (Hrsg.), Kreislaufwirt-
schafts-, Abfall- und Bodenschutzrecht, Stand: Okt. 2004, § 24 BBodSchG Rdnr. 85 ff.; zur Verjährung des Ausgleichsanspruchs eingehend: Vierhaus, NWVBl. 2009, 419 ff.; dem folgend: BGH, Urt. v. 18. 10. 2013 – III ZR 312/11, BGHZ 195, 153.
11) LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 2. 2011 – 1 O 20/07, StoffR 2011, 183.

Inanspruchnahme des „Beschickers“ betraf. In dem Urteil wird deutlich, dass das LG Düsseldorf die Verursacher-Ei-genschaft maßgeblich aus der Betreiber-Stellung folgert. Beide Düsseldorfer Gerichte – Verwaltungs- und Land-gericht – sehen diese Rechtsfrage also völlig parallel.
Auch das LG Bielefeld hat in seinem Urteil vom 21. 5. 2010 – 8 O 465/07 – einem Grundstückseigentümer Aufwendungsersatzansprüche aus § 24 Abs. 2 BBodSchG wegen Verursachung einer Altlast – dort: durch einen städ-tischen Gaswerksbetrieb – zugesprochen. Für die Frage, wer Verursacher, also Anspruchsgegner – ist, argumentiert das LG Bielefeld – „(…) ändert dies nichts daran, dass die Beklagte Verursacherin der durch die gaswerkstypischen Schadstoffe herbeigeführten Bodenverunreinigungen und -belastungen ist. Denn die Beklagte hat das Gaswerk be-trieben und auf dem Grundstück befinden sich unabhängig davon, wann und durch wen eine Aufhöhung des Geländes und eine Verteilung der Bodenmassen stattgefunden hat, gaswerkstypische Schadstoffe.“ 12
III. Strafrechtliches Zurechnungskriterium beim unerlaubten Betreiben von Anlagen im Sinne von § 327 StGB
Auch für die Frage der Strafbarkeit nach den Bestimmungen des 28. Abschnitts des StGB (Straftaten gegen die Umwelt) spielt die Betreiber-Eigenschaft eine entscheidende Rolle. Zentrales Merkmal ist bei zahlreichen Straftatbeständen des Umweltstrafrechts (so z. B. § 324 a StGB: Bodenverunreini-gung; § 325 StGB: Luftverunreinigung) die Verletzung ver-waltungsrechtlicher Pflichten (§ 330 d Abs. 1 Nr. 4 StGB), 13 zu denen insbesondere die gesetzlichen Betreiber-Pflich-ten z. B. aus § 5 BImSchG, § 62 WHG zählen. Nach § 327 Abs. 2 StGB wird bestraft, wer insbesondere eine geneh-migungsbedürftige Anlage nach BImSchG (sowie andere dort bezeichnete Anlagen) ohne die dafür nach dem Ge-setz erforderliche Genehmigung oder entgegen einer voll-ziehbaren Untersagung betreibt. Das besondere an diesem Straftatbestand ist: Da eine Verletzung oder Gefährdung ei-nes Rechtsgutes nicht vorausgesetzt wird, handelt es sich um eine reine Pönalisierung von Verwaltungsungehorsam. 14 Der Straftatbestand des unerlaubten Betreibens von Anlagen gemäß § 327 StGB knüpft bereits begrifflich an den Betrieb der genehmigungsbedürftigen Anlagen an und stellt damit darauf ab, wer die Anlage betreibt: 15 „Bei den Vorschriften der §§ 325, 327 StGB handelt es sich um Sonderdelikte, die eine besondere umweltrechtliche Pflichtenstellung voraus-setzen. Eine solche [setzt stets eine] unmittelbare Zugehö-rigkeit zur Betreiberin der genehmigungsbedürftigen An-lage“ voraus. 16 Da das deutsche Strafrecht allerdings keine Unternehmens-Strafbarkeit kennt, sind dann innerhalb des Betreiber-Unternehmens personale Verantwortliche (also natürliche Personen) auszumachen, denen die strafrechtli-che Verantwortung zuzurechnen ist. 17
B. Definition des Betreiber-Begriffs
I. Definition des Betreiber-Begriffs in Rechtsvorschriften 1. BImSchG und WHG
Die beiden umweltrechtlichen Kerngesetze, das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und das Wasserhaus-haltsgesetz (WHG) verwenden zwar an zahlreichen Stellen den Begriff des Betreibers einer Anlage (z. B. § 89 Abs. 2 WHG, §§ 5, 12 Abs. 2 lit. c Satz 1, 15 Abs. 3 Satz 1, 20 Abs. 1, 20 Abs. 1 lit. a Satz 1, 20 Abs. 3 Satz 2, 22, 25 Abs. 1 BImSchG). Den Begriff „Betreiber“ definieren diese Ge-setze jedoch nicht. Auch in den Begriffs-Bestimmungen des § 3 BImSchG sucht man den Betreiber-Begriff vergebens.
2. Richtungsweisende Legaldefinition in § 3 Nr. 2 TEHG
Erstmals hat der deutsche Gesetzgeber nunmehr in § 3 Nr. 2 Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) 18 den
Begriff „Anlagenbetreiber“ legal definiert. Diese gesetzli-che Begriffsdefinition lautet: „Anlagenbetreiber [ist] eine natürliche oder juristische Person oder Personengesell-schaft, die die unmittelbare Entscheidungsgewalt über eine Anlage innehat, in der eine Tätigkeit nach Anhang 1 Teil 2 Nummer 1 bis 32 durchgeführt wird, und die dabei die wirtschaftlichen Risiken trägt; (…)“.
Die Legaldefinition des „Anlagenbetreibers“ in § 3 Nr. 2 TEHG ist insoweit richtungsweisend, als sie zwei wesent-liche Merkmale des Betreiber-/Verantwortlichen-Begriffs herausarbeitet: Erstens die unmittelbare Entscheidungsge-walt und zweitens das Tragen von wirtschaftlichen Risiken des Anlagenbetriebs. 19
Damit handelt es sich – wie sogleich zu zeigen sein wird – um Kriterien, die im Wesentlichen mit denjeni-gen übereinstimmen, die die deutsche höchstrichterliche Rechtsprechung des BVerwG und des BGH über mehrere Jahrzehnte als kennzeichnend für den Betreiber-/Inhaber-Begriff heraus gearbeitet hat.
3. Legaldefinition „Betreiber“ in Art. 2 lit. 13 der IVU-Richtlinie
Zuerst definierte das Unionsrecht den Betreiber-Begriff, nämlich in der IVU-Richtlinie und der Umwelthaftungs-richtlinie. Die Legaldefinition des „Anlagenbetreibers“ in § 3 Nr. 2 TEHG ist derjenigen des „Betreibers“ in Art. 2 lit. 13 der IVU-Richtlinie zwar teilweise angenähert, aber nicht deckungsgleich. 20
Die Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 1. 2008 über die integrierte Vermei-dung und Verminderung der Umweltverschmutzung 21 – kurz: IVU-RL – definiert den „Betreiber-Begriff“ wie folgt: „Art. 2 lit. 13 IVU-Richtlinie: ‚Betreiber‘ [ist] jede natürli-che oder juristische Person, die die Anlage betreibt oder be-sitzt oder der – sofern in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen – die ausschlaggebende wirtschaftliche Verfü-gungsmacht über den technischen Betrieb der Anlage über-tragen worden ist.“ Dabei ist die erste Alternative – Betreiber ist derjenige, der die Anlage betreibt – naturgemäß ein Zir-kelschluss. Das sachenrechtliche Kriterium des „Besitzens“ der Anlage ist nach nationalem Recht jedenfalls deutlich nachrangig, worauf zurückzukommen sein wird. Entschei-dend ist hingegen, dass auch die IVU-Richtlinie maßgeblich auf die wirtschaftliche Verfügungsmacht abstellt.
4. Legaldefinition „Betreiber“ in Art. 2 lit. 6. der Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG vom 21. 4. 2004)
Die Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden vom 21. 4. 2004 22, die in Deutschland durch das Umweltschadensgesetz umgesetzt
Vierhaus, Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht
123
100 NuR (2014) 36: 98–104
12) LG Bielefeld, Urt. v. 21. 5. 2010 – 8 O 465/07, Rdnr. 102, NWVBl. 2010, 367 = AbfallR 2010, 215.
13) Dazu: Kloepfer/Vierhaus, Umweltstrafrecht, 2. Aufl. 2002, Rdnr. 26 ff.
14) Kloepfer/Vierhaus, Umweltstrafrecht, 2. Aufl. 2002, Rdnr. 37 m. w. N.
15) OLG Köln, Beschl. v. 19. 2. 1999 – Ss 610/98–278, Rdnr. 31; LG Münster, Beschl. v. 17. 3. 2011 – 9 Us 6/11 u. a., Rdnr. 10, 12, 17.
16) OLG Karlsruhe, Beschl. v. 3. 1. 1995 – 1 Ws 192/94, Rdnr. 29.17) Näher: Kloepfer/Vierhaus, Umweltstrafrecht, 2. Aufl. 2002,
Rdnr. 63–68.18) Vom 21. 7. 2011 (BGBl. I S. 1475), zuletzt geänd. durch Art. 2
Abs. 24 G zur Änd. zur Vorschriften über Verkündung und Be-kanntmachungen sowie die ZPO, des EGZPO und der AO v. 22. 12. 2011 (BGBl. I S. 3044).
19) Eingehend zur vorangegangenen Legaldefinition des Begriffs „Verantwortlicher“ in § 3 V TEHG v. 8. 7. 2004: Vierhaus, in: Körner/Vierhaus, TEHG, 2005, § 3 TEHG Rdnr. 27–35.
20) Vierhaus, in: Körner/Vierhaus, TEHG, 2005, § 3, Rdnr. 28.21) ABl. Nr. L 24 S. 8.22) ABl. Nr. 134 S. 56.

worden ist, enthält ebenfalls eine – an die IVU-Richt-linie angelehnte – Legaldefinition des Betreiber-Begriffs. Sie lautet wie folgt: „Art. 2 lit. 6. Umwelthaftungsricht-linie: ‚Betreiber‘[ist] jede natürliche oder juristische Per-son des privaten oder öffentlichen Rechts, die die berufli-che Tätigkeit ausübt oder bestimmt oder der – sofern dies in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen ist – die ausschlaggebende wirtschaftliche Verfügungsmacht über die technische Durchführung einer solchen Tätigkeit über-tragen wurde, einschließlich des Inhabers einer Zulassung oder Genehmigung für eine solche Tätigkeit oder der Per-son, die die Anmeldung oder Notifizierung einer solchen Tätigkeit vornimmt.“ 23
Auch hier wird der Betreiber-Begriff maßgeblich an die wirtschaftliche Verfügungsmacht angekoppelt. Vorrangig ist das Verständnis des nationalen Rechts. Nur soweit die-ses es ausdrücklich vorsieht, ist Betreiber auch der Geneh-migungs-Adressat. Nach deutschem Begriffs-Verständnis ist die Tatsache, wen der Bescheid, mit dem die Anlagen-genehmigung erteilt wurde, zum Adressaten hat, gerade nicht ausschlaggebend, weil die rechtliche Subsumtion der Behörde unter dem materiell-rechtlichen, wertenden Be-treiber-Begriff unzutreffend gewesen sein kann und unter Umständen lange Jahre zurückliegt. 24 Zudem ist die Ad-ressierung des Genehmigungsbescheides in der Regel re-flexartig allein daran orientiert, welche Person seinerzeit den Genehmigungsantrag gestellt hat. 25 Die Tatsache, wer Adressat des Bescheides ist, mit dem die Behörde die erfor-derliche Anlagen-Genehmigung erteilt, ist somit für das Erfülltsein des materiellen Betreiber-Begriffs nicht maß-geblich; ihr kann allenfalls untergeordnete, indizielle Be-deutung zukommen. Dass die letztgenannte Rechtsauffas-sung richtig ist, zeigt folgendes Beispiel: Beginnend mit dem Jahre 1965 ff. wurde ein Tanklager entwickelt. Im Laufe der historischen Abläufe haben immer wieder andere Bauherren bei der Bauaufsicht Genehmigungsanträge für Lagerbehälter gestellt und erhalten. Bei einem komplexen, durch Gesellschafts- und sonstige vertraglichen Strukturen geprägten Betriebs-Modell ist das Kriterium des Genehmi-gungsinhabers daher absolut nachrangig. 26
5. Legaldefinition „Deponiebetreiber“ in § 2 Nr. 12 DepV
Die Deponieverordnung (DepV) des Bundes vom 27. 4. 2009 27 enthält in § 2 Nr. 12 eine Legaldefinition für ei-nen speziellen Betreiber-Begriff, nämlich für denjenigen des Deponiebetreibers. Diese lautet: „§ 2 Nr. 12 DepV: De-poniebetreiber: Natürliche oder juristische Person, die die rechtliche oder tatsächliche Verfügungsgewalt über eine Deponie inne hat.“ Diese Legaldefinition zeichnet sich in-haltlich durch Unbestimmtheit aus. Aufgrund der alternati-ven Regelungstechnik („oder“) ist die Legaldefinition recht diffus und stimmt – wie zu zeigen sein wird – mit den Kri-terien der höchstrichterlichen Rechtsprechung für den im-missionsschutzrechtlichen und wasserhaushaltsrechtlichen Betreiber-Begriff nicht überein. Denn nach der Recht-sprechung kommt es nicht so sehr auf die rechtliche Verfü-gungsgewalt an, sondern auf eine wertende wirtschaftliche Gesamt-Betrachtung. 28 Festzustellen ist, dass der Begriff des Deponiebetreibers in § 2 Nr. 12 DepV nicht dem in der ver-waltungsgerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Be-treiber-Begriff entspricht. 29 Bei personellem Auseinander-fallen von rechtlicher und tatsächlicher Verfügungsgewalt können u. U. sogar Doppelungen der Betreiber-Eigenschaft ohne gesellschaftsrechtliche Verbundenheit der verschiede-nen „Betreiber“ entstehen, was im Hinblick auf den Betrei-ber-Begriff des Krw-/AbfG bedenklich erscheint. 30
II. Betreiber-Begriff in der Rechtsprechung
Die zentrale Rolle bei der Ausformung des Betreiber-Be-griffs nahm und nimmt die Rechtsprechung ein, zumal die ersten gesetzlichen und unionsrechtlichen Legaldefinitio-
nen erst – wie gezeigt – sehr jungen Datums sind. Im Ein-zelnen:
1. Bundesverwaltungsgericht („Insolvenzverwalter-Fall“)
Zur Auslegung der einschlägigen umweltverwaltungs-rechtlichen Fachgesetze (WHG, BImSchG, BBodSchG etc.) ist in letzter Instanz das Bundesverwaltungsgericht ( BVerwG) berufen. In seinem Urteil vom 22. 10. 1998 – 7 C 38/97 – hat das BVerwG sein Verständnis vom Betrei-ber-Begriff wie folgt gekennzeichnet: „Das Aluminium-schmelzwerk ist nach § 4 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 BImSchG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 der 4. BImSchV und Nr. 3.4 der Spalte 1 des Anhangs zu dieser Verordnung eine genehmigungsbedürftige Anlage. Betreiberin der An-lage war zunächst die Gemeinschuldnerin; denn sie führte diese in ihrem Namen, auf ihre Rechnung und in eigener Verantwortung. Mit der Eröffnung des Konkurses ging die Betreiberstellung auf den Kläger über. Dabei kann dahin-gestellt bleiben, ob ein Konkursverwalter nach § 6 Abs. 2 KO ohne weiteres in die Betreiberstellung einrückt, also auch dann, wenn er die Anlage sofort stilllegt; denn hier hat er sie kraft eigenen Rechts und im eigenen Namen fortgeführt, so daß er das Schmelzwerk bis zu dessen Ver-pachtung im immissionsschutzrechtlichen Sinne betrieben hat.“ 31 Die obergerichtliche Rechtsprechung folgt dem; das OVG Münster bringt es in seinem Urteil vom 1. 6. 2006 – 8 A 4495/04 – wie folgt auf den Punkt: „Betreiber ei-ner Anlage im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist diejenige natürliche oder juristische Person oder Per-sonenvereinigung, die die Anlage in ihrem Namen, auf ihre Rechnung und in eigener Verantwortung führt. Da-bei kommt es vor allem darauf an, wer den bestimmenden bzw. maßgeblichen Einfluss auf die Lage, die Beschaffen-heit und den Betrieb der Anlage ausübt. Das ist regelmäßig derjenige, der die tatsächliche Verfügungsgewalt über die Anlage besitzt.“ 32
2. Bundesgerichtshof („Unkrautvernichtungsmittel-Fall“)
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mehrfach zu dem – dem „Betreiber“-Begriff synonymen – Begriff des „In-habers“ im Sinne von § 22 Abs. 2 WHG a. F. geäußert. In einem mit Urteil vom 21. 5. 2007 vom BGH entschiedenen Fall nahmen die Inhaber von Mineralwasserquellen u. a. die Rechtsnachfolgerin der Deutschen Bundesbahn auf Scha-densersatz für Grundwasserverunreinigungen in Anspruch, die durch das jahrelange Besprühen von Gleisen mit chemi-schen Unkrautvernichtungsmitteln verursacht worden sein sollen. 33 Der BGH bejahte die Voraussetzungen für eine Anlagenhaftung nach § 22 Abs. 2 WHG a. F. gegen den Inhaber (= Betreiber) der gewässergefährdenden Anlage. Dabei hat der BGH mit der Rechtsprechung des BVerwG übereinstimmende Kriterien zur Anwendung gebracht:
NuR (2014) 36: 98–104 101Vierhaus, Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht
123
23) Eingehend dazu: Wagner, VersR 2005, 177 ff. (Ziff. VII.).24) Vierhaus, in: Körner/Vierhaus, TEHG, 2005, § 3 TEHG,
Rdnr. 31; Müggenborg, DVBl. 2001, 417, 421.25) Vierhaus, in: Körner/Vierhaus, TEHG, 2005, § 3 TEHG,
Rdnr. 31.26) Vgl. näher: Wagner, Die gemeinschaftsrechtliche Umwelthaf-
tung, VersR 2005, 177 – Ziff. VI.1.27) I. d. F. v. 17. 10. 2011.28) So ausdrücklich: VG Düsseldorf, Urt. v. 29. 9. 2009 – 17 K
4572/08, Rdnr. 65. ff.29) Franßen, AbfallR 2007, 106–111.30) Franßen, AbfallR 2007, 106–111.31) BVerwG, Urt. v. 22. 10. 1998 – 7 C 38/97, Rdnr. 10, BVerw GE
107, 299; eingehend zu den umweltrechtlichen Pflichten des In-solvenzverwalters: Vierhaus, ZInsO 2005, 127–133 (Teil I) und ZInsO 2005, 1026–1031 (Teil II).
32) OVG Münster, Urt. v. 1. 6. 2006 – 8 A 4495/04, Rdnr. 53 un-ter Berufung auf BVerw GE 107, 299; ähnlich: VGH Mannheim, Beschl. v. 17. 4. 2012 – 10 S 3127/00, Rdnr. 4.
33) BGH, Urt. v. 31. 5. 2007 – III ZR 3/06, BGHZ 172, 287.

„Inhaber einer Anlage im Sinne des § 22 Abs. 2 WHG ist derjenige, der sie für eigene Rechnung in Gebrauch hat und die Verfügungsgewalt besitzt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt; dies kann auf mehrere Beteiligte zugleich zu-treffen (Senatsurteile BGHZ 80, 1, 4; 142, 227, 231, 234 und vom 6. 5. 1999 – III ZR 89/97, NJW 1999, 3203; Czy-chowski/Reinhardt, a. a. O., § 22 Rdnr. 50; Zeitler in Sie-der/Zeitler/Dahme/Knopp, a. a. O., Stand Juli 2000, § 22 Rdnr. 41).“ 34 Dies entspricht ständiger Rechtsprechung des BGH. 35
3. Verwaltungsgericht Düsseldorf („Chemikalien-Tanklager-Fall“)
Das VG Düsseldorf hat sich mit Urteil vom 29. 9. 2009 – 17 K 4572/08 – für den Fall eines in Düsseldorf gelege-nen Chemikalien-Tanklagers wie folgt zum Betreiber-Be-griff geäußert: „Wer Betreiber einer Anlage zum Lagern von Stoffen ist, kann nicht allein nach formalrechtlichen Gesichtspunkten entschieden werden, sondern nur unter Berücksichtigung sämtlicher konkreten rechtlichen, wirt-schaftlichen und sonstigen Gegebenheiten. Maßgebend ist die tatsächliche und rechtliche Verfügungsmacht, die es er-möglicht, über die Anlage die notwendigen Entscheidun-gen zu treffen, als auch die wirtschaftliche Stellung, die den Verfügenden die Nutzungen der Anlage (zumindest zu einem nicht unwesentlichen Anteil) ziehen lässt und ihm gleichzeitig zumindest anteilig die Kosten der Anlage so-wie die Verantwortlichkeit für die Anlage aufbürdet. Auch bei Fehlen der rechtlichen Verfügungsmacht aus Eigen-tum oder Vertrag kann Betreiber sein, wer eine Anlage zu seinen betrieblichen Zwecken und auf eigene Rechnung nutzt. Vgl. Gößl, in: Sieder-Zeitler-Dahme, WHG, § 19 i Rdnr. 2; Czychowski/Reinhardt, WHG, 9. Aufl., § 19 i Rdnr. 4; VGH Mannheim, Beschl. v. 6. 10. 1995 – 10 S 1389/95, juris.“ 36
4. Landgericht Düsseldorf („Chemikalien-Tanklager-Fall“)
In dem parallel zum vorgenannten Verwaltungsprozess 37 geführten Zivilrechtsstreit um Ausgleichsansprüche des Eigentümers gegen den Verursacher nach § 24 II BBod-SchG – die dortige Beklagte zu 1) war Klägerin des Ver-waltungsrechtsstreits – hat das LG Düsseldorf 38 mit Urteil vom 11. 2. 2011 – 1 O 20/07 – den Betreiber-Begriff über-einstimmend zu der Entscheidung des VG Düsseldorf an-genommen. Das LG Düsseldorf hat beide Beklagte, d. h. den Chemiekonzern als Financier und „Beschicker“ und den örtlichen Lageristen als den vor Ort mit seinem Per-sonal tatsächlich Handelnden als Mit-Betreiber gewertet und daher als Gesamtschuldner des Ausgleichsanspruchs dem Grunde nach zur Zahlung der bisher aufgelaufenen Sanierungskosten von rund 5 Mio. EUR verurteilt. Ferner wurden beide Beklagte gesamtschuldnerisch verurteilt, die Klägerin von künftigen Kosten für Maßnahmen nach dem BBodSchG im Hinblick auf die Altlast freizustellen. Den Streitwert setzte das LG Düsseldorf auf 13 Mio. EUR fest. Dabei geht das LG Düsseldorf – in Übereinstimmung mit dem VG Düsseldorf – von folgenden zentralen Überlegun-gen aus: „Die Beklagten sind als Mitbetreiber des Tankla-gers in gleicher Weise Verursacher der Bodenverunreini-gung. Betreiber einer Anlage zum Lagern von Stoffen ist derjenige, der bei wertender Betrachtung die tatsächliche und rechtliche Verfügungsgewalt über die Anlage hat und diese zum eigenen Nutzen betreibt (Reinhardt, in Wasser-haushaltsgesetz, 9. Aufl., § 19 i, Rdnr. 4). Diese Wertung ist unter Berücksichtigung aller Umstände und nicht aus-schließlich nach formalrechtlichen Gesichtspunkten vor-zunehmen (VG K, Urteil vom 29. 9. 2009, 17 K 4572/08). (…) Die Beklagten sind als Betreiber der Anlage Verursa-cher der Bodenverunreinigung und der Gewässerschäden, die auf den Anlagenbetrieb zurückzuführen sind. Insoweit sind sie als Gesamtschuldner der Klägerin gegenüber, die
als Eigentümerin nur Zustandsstörerin ist, zum Ausgleich verpflichtet.“ 39
5. Mitbetreiber-Fälle
Das Umweltverwaltungsrecht schließt es grundsätzlich nicht aus, dass – ausnahmsweise – mehrere Unternehmen gleichzeitig Betreiber ein und derselben Anlage (Mit-Be-treiber) sind, eine Möglichkeit, die der BGH in ständi-ger Rechtsprechung zur wasserrechtlichen Gefährdungs-haftung bejaht. 40 Ebenso hat beispielsweise das VG Berlin in einem Beschluss vom 6. 11. 2007 – VG 34 A 122.06 – entschieden: „Es kommt hinzu, dass sich das Amt für Um-welt und Natur des Antragsgegners möglicherweise un-zutreffend davon hat leiten lassen, es sei seine Aufgabe, ‚den‘ Betreiber der zu prüfenden Anlagen in Anspruch zu nehmen. (…) Die dem möglicherweise zugrunde liegende Sichtweise vernachlässigt jedoch, dass Betreiber im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes und der Landeswassergesetze durchaus mehrere Personen nebeneinander sein können.“ 41
Das VG Düsseldorf hat in dem zitierten Tanklager-Urteil vom 29. 9. 2009 – 17 K 4572/08 – die Frage der Mit-Be-treiber-Stellung des örtlichen Lageristen zwar aufgeworfen und auch eine gewisse Sympathie dafür erkennen lassen, sie jedoch im Ergebnis offen gelassen. Die entscheidende Pas-sage des Urteils hierzu lautet: „Unschädlich ist ferner, wenn die Beigeladene ebenfalls als Betreiberin anzusehen sein sollte. Dafür spricht, dass sie die Anlage für ihre eigenen betrieblichen Zwecke – Durchführung des Tanklagerge-schäfts, Lagerung anderer Materialien für Drittunterneh-men – und auf ihre Rechnung genutzt – alle Bauarbei-ten einschließlich der Fundamente und des Einbringens der Behälter gingen zu ihren Lasten, sie trug die Kosten des La-gerbetriebs (Personal) – und dafür eine Vergütung erhalten hat. Das Befüllen der Tankbehälter und Umfüllen in Ge-binde und Tanklaster hat die Beigeladene selbstständig mit ihren eigenen Mitarbeitern durchgeführt. Nur sie war auf dem Gelände anwesend und übte die Kontrolle über die tatsächlichen Vorgänge aus. Ob auch die Beigeladene das Tanklager betrieben hat, kann jedoch offen bleiben. An der Betreiberstellung der Klägerin ändert das nichts. Es kön-nen auch mehrere Personen nebeneinander Betreiber einer Anlage sein.“ 42 Das LG Düsseldorf hat – wie gezeigt – im Zivilprozess die Mitbetreiber-Eigenschaft bejaht und beide Beklagte als Gesamtschuldner verurteilt. 43
6. Verwaltungsgericht München („Personengesellschaften als Betreiber?“)
Im hier interessierenden Zusammenhang erscheint ferner ein Urteil des Verwaltungsgerichts München (VG Mün-
Vierhaus, Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht
123
102 NuR (2014) 36: 98–104
34) BGH, Urt. v. 31. 5. 2007 – III ZR 3/06, Rdnr. 21, BGHZ 172, 287–298.
35) BGH, Urt. v. 8. 1. 1981 – III ZR 157/79, BGHZ 80, 1 Ls. 1 (dort auch zum Mit-Betreiber-Begriff ); BGH, Urt. v. 22. 7. 1999 – III ZR 198/98, Rdnr. 9, BGHZ 142, 227.
36) VG Düsseldorf, Urt. v. 29. 9. 2009 – 17 K 4572/08, Rdnr. 68–69.37) VG Düsseldorf, Urt, v. 29. 9. 2009 – 17 K 4572/08.38) LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 2. 2011 – 1 O 20/07.39) LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 2. 2011 – 1 O 20/07, Rdnrn. 84–86
und 99. Die Beklagten haben gegen das Urteil Berufung einge-legt, über das OLG Düsseldorf noch nicht entschieden hat.
40) BGH, Urt. v. 8. 1. 1981 – III ZR 157/79, BGHZ 80, 1; BGH, Urt. v. 31. 5. 2007 – III ZR 3/06, BGHZ 172, 287, 295 Rdnr. 21; BVerwG, Urt. v. 30. 6. 2004 – 4 C 9/03, NVwZ 2004, 1235, 1236; VG Düsseldorf, Urt. v. 29. 9. 2009 – 17 K 4572/08; En-gelhardt/Ruchay, Gewässerschutz und Abwasser, § 90 i WHG Rdnr. 2.
41) VG Berlin, Beschl. v. 6. 11. 2007 – VG 34 A 122.06, S. 4; vgl. BGH, Urt. v. 8. 1. 1981 – III ZR 157/79, BGHZ 80, 4; Reinhardt, Wasserhaushaltsgesetz, 9. Aufl., § 19 i Rdnr. 4 zum Pächter einer Tankstelle und der Mineralölgesellschaft als Eigentümerin.
42) VG Düsseldorf, Urt. v. 29. 9. 2009 – 17 K 4572/08, Rdnr. 78.43) LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 2. 2011 – 1 O 20/07.

chen) vom 20. 8. 2002 – M 16 K 99.4960 – von Interesse, wonach eine Personengesellschaft – dort: eine KG – Betrei-berin einer Anlage im Sinne des Umweltrechts sein kann. Das VG München führt in diesem Urteil aus: „Die Klä-gerin ist Betreiberin der Anlage und damit taugliche Ad-ressatin einer auf § 20 Abs. 3 Satz 1 BImSchG gestützten Anordnung. Betreiber einer Anlage ist diejenige natürliche oder juristische Person, die den bestimmenden Einfluss auf den Anlagenbetrieb ausübt, d. h. derjenige, der entscheidet, in welcher Weise die Anlage betrieben wird, und der die rechtliche oder tatsächliche Verfügungsgewalt über sie be-sitzt (Hansmann, a. a. O., Rdnr. 58 zu § 20; Jarass, a. a. O., Rdnr. 46 zu § 20 mit Weiterverweisung auf Rdnr. 8 zu § 20 und Rdnr. 81 zu § 3). Die Frage, wer – ausgehend von dieser Begriffsbestimmung – bei Kommanditgesellschaften Anlagenbetreiber ist, wird im Schrifttum nicht einheitlich beantwortet. (…) Nach Auffassung des Verwaltungsge-richts ist aus § 52 a Abs. 1 Satz 1 BImSchG herzuleiten, dass auch eine Personengesellschaft Betreiberin einer Anlage im Sinne des Immissionsschutzrechts sein kann. Denn der nach dieser Vorschrift zu benennende eine von mehreren vertretungsberechtigten Gesellschaftern einer Personenge-sellschaft nimmt alsdann „für die Gesellschaft“ die Pflich-ten des Betreibers der genehmigungsbedürftigen Anlage wahr. Diese Bestimmung kann schwerlich anders als da-hingehend verstanden werden, dass das Gesetz Personenge-sellschaften selbst als Betreiber immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftiger Anlagen ansieht. Denn wenn § 52 a Abs. 1 Satz 1 BImSchG davon ausgeht, dass der zu be-nennende Mitgesellschafter die Betreiberpflichten „für die Gesellschaft“ wahrnimmt, muss daraus erschlossen werden, dass diese Pflichten originär der Personengesellschaft selbst zukommen, die sie freilich nur durch ihre Organe (d. h. die vertretungsberechtigten Gesellschafter) wahrnehmen kann.“ 44
Das VG München 45 begründet diese seine Rechtsauffas-sung insbesondere mit dem erwägenswerten Argument, dass der Gesetzgeber des BImSchG in § 52 a Abs. 1 Satz 1 BImSchG a. F. ( jetzt: § 52 b Abs. 1 Satz 1 BImSchG) selbst Folgendes geregelt hat: „§ 52 a BImSchG Mitteilungspflich-ten zur Betriebsorganisation: I 1 Besteht bei Kapitalge-sellschaften das vertretungsberechtigte Organ aus meh-reren Mitgliedern oder sind bei Personengesellschaften mehrere vertretungsberechtigte Gesellschafter vorhanden, so ist der zuständigen Behörde anzuzeigen, wer von ih-nen nach den Bestimmungen über die Geschäftsführungs-befugnis für die Gesellschaft die Pflichten des Betreibers der genehmigungsbedürftigen Anlage wahrnimmt, die ihnen nach diesem Gesetz und nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und allgemei-nen Verwaltungsvorschriften obliegen. 2 Die Gesamt-verantwortung aller Organmitglieder oder Gesellschafter bleibt davon unberührt.“ Mit anderen Worten: Betreiber im Sinne des Umweltverwaltungsrechts ist „nach außen“ zwar die Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft als solche. Innerbetrieblich ist jedoch eine bestimmte vertre-tungsberechtigte Person für die Wahrnehmung der Be-treiber-Pflichten in Bezug auf die genehmigungsbedürftige Anlage verantwortlich.
7. Verwaltungsgericht Magdeburg („Auftragnehmer eines öffentliches Auftrages“)
Ebenfalls mit einer praxisrelevanten Konstellation befasst sich die folgende, jüngere Entscheidung des VG Magde-burg 46 zum Betreiber-Begriff, der folgender Sachverhalt zugrunde lag: Ein Gewässerunterhaltungsverband (im Folgenden: „Verband“) schrieb im Rahmen eines von der EU erheblich geförderten ökologischen Projekts Bauleis-tungen zur Entschlammung eines Gewässers öffentlich aus. Bereits in der Ausschreibung machte der Verband de-taillierte Vorgaben für Inhalt und Durchführung der Ent-schlammungsmaßnahme. Hinzu kam, dass der Verband als
Auftraggeber „besondere Vertragsbedingungen“ zum Be-standteil der Zuschlagserteilung machte, die dem Auftrag-nehmer im Einzelnen vorgaben, wie die Arbeiten „zu or-ganisieren“ sind, welche „Abfahrtswege zu nutzen“ sind und „dem AN die Ausführungspläne“ bindend vorgaben. Durchführungsarbeiten durften zudem „nur mit Zustim-mung der Bauoberleitung an Subunternehmer weiterge-geben werden“. Diese Tatsachen könnten für die Betrei-berstellung des Verbandes kraft Letztentscheidungs- und Weisungsbefugnis sprechen. Ein weiteres Indiz für die Betreiber-Eigenschaft des Verbandes als Auftraggeber und gegen diejenige des Auftragnehmers könnte Folgen-des sein: Als Schwierigkeiten mit der Zwischenlagerung der ausgebaggerten Schlämme aufkamen, war es der Ver-band, welcher den Auftragnehmer bindend anwies, die ausgebaggerten Schlämme ab sofort nur noch an einer be-stimmten Stelle zwischenzulagern sowie zeitnah zu ent-sorgen. Gegen die Betreiber-Eigenschaft des Auftragneh-mers hätte also gesprochen, dass (nur) derjenige Betreiber einer Anlage sein kann, der selbstständig, d. h. vor allem weisungsfrei über das „Ob“ und das „Wie“ des Anlagen-betriebs entscheiden kann. Gleichwohl qualifizierte das Gericht allein das vom Verband mit der Durchführung beauftragte, weisungsgebundene Unternehmen als Betrei-ber des Zwischenlagers; der Auftragnehmer habe – so das VG Magdeburg – die Anlage errichtet und führe sie in seinem Namen, auf seine Rechnung und in eigener Ver-antwortung. Hier komme es vor allem darauf an, wer die tatsächliche Verfügungsgewalt, die tatsächliche Sachherr-schaft über die Anlage besitze. 47
8. GbR als möglicher Betreiber („Fahrschul-Fall“)
Dass eine GbR als solche rechtsfähig ist – und damit Be-treiber einer Anlage und damit Zurechnungsobjekt für umweltverwaltungsrechtliche Pflichten sein kann – folgt auch aus der Grundsatzentscheidung des BGH zur Rechts-fähigkeit der GbR. 48 Aus der Rechtsprechung des BVerwG ergibt sich nichts anderes; so hat das BVerwG für eine öf-fentlich-rechtliche Erlaubnis – hier: Fahrschulerlaubnis – nämlich entschieden: „auch wenn der Fahrschulbetrieb durch eine von den beiden Fahrschulerlaubnisinhabern nach außen geführte BGB-Gesellschaft betrieben wird, ist dies zulässig“. 49 Richtigerweise sind „daher im Umwelt-recht Personengesellschaften als Betreiber anzusehen, nicht deren Komplementäre bzw. vertretungsberechtigte Gesell-schafter“. 50
III. Betreiber-Begriff in der Literatur
Allgemein anerkannt ist in der Literatur, 51 dass Betreiber diejenige natürliche oder juristische Person ist, die „den bestimmenden Einfluss auf die Errichtung, die Beschaf-
NuR (2014) 36: 98–104 103Vierhaus, Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht
123
44) VG München, Urt. v. 20. 8. 2002 – M 16 K 99.4960, Rdnrn. 51 und 53.
45) VG München, Urt. v. 20. 8. 2002 – M 16 K 99.4960, Rdnr. 53.46) VG Magdeburg, Beschl. v. 15. 1. 2013 – 2 B 333/12. 47) VG Magdeburg, Beschl. v. 15. 1. 2013 – 2 B 333/12, Rdnr. 23.48) BGH, Urt. v. 29. 1. 2001 – II ZR 331/00, Ls. 1 sowie Rdnr. 4–13,
BGHZ 146, 341.49) BVerwG, Urt. v. 24. 11. 1992 – 1 C 9/91, Rdnr. 17.50) Spindler, Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht: Gesellschafts-
und zivilrechtliche Einflüsse, in: Deutsches Anwaltsinstitut, Brennpunkte des Verwaltungsrechts. Verwaltungsrechtliche Jah-resarbeitstagung 2010, Vortrag am 29. 1. 2010 im BVerwG, Leip-zig, Tagungsband, S. 101, 120.
51) Spezialliteratur: Friedrich, NVwZ 2012, 1174 zu industriellen Großstandorten; Franßen, AbfallR 2007, 106 zum Deponiebe-treiber; Spindler, in: Feldhaus-FS 1999, 25–48 zu gesellschafts- und zivilrechtlichen Einflüssen auf den Betreiber-Begriff im UmweltR; Vierhaus, ZInsO 2005, 127 zur Betreiber-Eigenschaft des Insolvenzverwalters.

fenheit, den Betrieb oder die Stilllegung der Anlage aus-übt“. 52 Demgemäß soll die Eigenschaft als Betreiber da-von abhängen, welcher Vertragspartei nach den konkreten Vertragsregelungen der bestimmende Einfluss auf das „Ob“ und „Wie“ des Anlagenbetriebs zukommt. 53 Ent-scheidend soll ferner sein, wer nach außen hin, insbeson-dere gegenüber den Behörden, die Verpflichtung zur Be-schaffung von Genehmigungen, zur Instandhaltung und Überprüfung etc. übernommen hat. 54 Wird eine Anlage in einem Betrieb bzw. Unternehmen eingesetzt, ist re-gelmäßig der Betriebs- bzw. Unternehmensinhaber An-lagenbetreiber; als Betriebs- bzw. Unternehmensinhaber ist derjenige anzusehen, der den Betrieb bzw. das Un-ternehmen selbständig führt. 55 Für die Beurteilung des zentralen Merkmals der Selbständigkeit sind drei Krite-rien anerkannt: Es kommt darauf an, dass der Betreffende die Tätigkeit erstens im eigenen Namen, zweitens auf ei-gene Rechnung (unternehmerisches Risiko) und drittens in eigener Verantwortung (Weisungsfreiheit) ausübt. 56 Bei Vorliegen von zwei der drei Kriterien wird die Selbstän-digkeit in der Regel bejaht, wobei besonderes Gewicht auf das Kriterium der eigenen Verantwortung gelegt wird. 57 Diese Kriterien decken sich mit dem Betreiber-Verständ-nis des Art. 3 lit. f der Richtlinie 2003/87/EG, 58 denn weisungsfrei wird letztlich derjenige handeln können, der „die ausschlaggebende wirtschaftliche Verfügungsmacht“ über den Betrieb der Anlage hat. Nicht maßgeblich ist fer-ner, wer die Anlage ursprünglich einmal errichtet hat, 59 zumal dies Jahre oder sogar Jahrzehnte zurückliegen kann und über die maßgeblichen Kriterien, wer aktuell das un-ternehmerische Risiko trägt und die Anlage weisungsfrei führt, überhaupt nichts aussagt.
Für die verwaltungsrechtliche Qualifikation als Betrei-ber einer Anlage ist somit nicht entscheidend, wer sachen-rechtlich das Eigentum an der Anlage inne hat. 60 Ebenfalls nicht ausschlaggebend ist die Tatsache, wen der Bescheid, mit dem die immissionsschutzrechtliche Anlagengeneh-migung erteilt wurde, zum Adressaten hat; 61 denn die rechtliche Subsumtion der Behörde unter den materiell-rechtlichen Betreiber-Begriff kann unzutreffend gewesen sein, liegt u. U. lange Jahre zurück und wird in der Regel reflexartig daran orientiert sein, welche Person den Ge-nehmigungsantrag gestellt hat. Bei einer typischen Ver-pachtung oder Vermietung von Anlagen ist grundsätzlich der Pächter oder Mieter Betreiber der Anlage. 62 Spind-ler kommt in seiner jüngeren Untersuchung zum Betrei-ber-Begriff vor dem Hintergrund gesellschafts- und zi-vilrechtlicher Einflüsse zutreffend zu folgendem Schluss: „Der Betreiberbegriff zeigt sich damit als vielschichtiger Komplex verschiedenster Konstellationen, dem mit einem einfachen Sammelsurium an Kriterien kaum griffige Kon-turen verliehen werden können. Zivil- und gesellschafts-rechtliche Ansätze müssen auch im öffentlichen Recht Be-rücksichtigung finden, indem Merkmale der selbständigen Wahrnehmung von Aufgaben oder der Weisungsfreiheit auf ihren zivil- und gesellschaftsrechtlichen Gehalt unter-sucht werden. Dabei zeigt sich oft, daß mit Hilfe dieses In-strumentariums Lösungen gefunden werden können, die nicht in Konflikt mit dem zivil- und gesellschaftsrechtli-chen System, etwa des Konzernrechts, stehen.“ 63
IV. Zusammenfassung1. Hauptkriterien
Zusammenfassend lassen sich folgende Hauptkriterien für das Erfülltsein des Betreiber-Begriffs aufstellen:
ausschlaggebende wirtschaftliche Verfügungsmacht über den technischen Betrieb einer Anlage, insbeson-dere– wirtschaftliche Verantwortung,– Kostentragung,– wirtschaftlicher Nutzen,
selbstständiges Führen des Betriebs, d. h. – Tätigkeit im eigenen Namen,– auf eigene Rechnung (unternehmerisches Risiko)
und– in eigener Verantwortung (Weisungsfreiheit)
keine formalrechtliche Betrachtung, sondern wertende „Berücksichtigung sämtlicher konkreten rechtlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Gegeben heiten“.
2. Hilfskriterien
Demgegenüber sind folgende Kriterien lediglich Hilfskri-terien für die Bestimmung der Betreiber-Eigenschaft:
sachenrechtliches Eigentum an der Anlage, Besitz (tatsächliche Sachherrschaft) an der Anlage, Adressat des Genehmigungsbescheides (schwaches
Hilfskriterium) und Bauherren-Eigenschaft (schwaches Hilfskriterium).
Vierhaus, Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht
123
104 NuR (2014) 36: 98–104
52) Dietlein, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, § 5 BImSchG Rdnr. 28; Jarass, BImSchG, § 3 Rdnr. 81; Roßnagel, in: Koch/Scheuing, GK-BImSchG, § 5 Rdnr. 11; Fluck, in: Ule/Laubinger, BImSchG, § 16 Rdnr. C 3.
53) Wasielewski, GewArch 1993, 103, 104.54) Wasielewski, GewArch 1993, 103, 104.55) Jarass, BImSchG, § 3 Rdnr. 83.56) BVerwG, Urt. v. 22. 10. 1998 – 7 C 38/97, NJW 1999, 1416,
1417; Jarass, BImSchG, § 3 Rdnr. 83; kritisch zu den beiden erst-genannten Kriterien Spindler, in: Feldhaus-FS, 5. 25, 36.
57) Jarass, BImSchG, § 3 Rdnr. 83.58) Vom 13. 10. 2003 über ein System für den Handel mit Treib-
hausemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Ände-rung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, ABl. EU L 275, 32 v. 25. 10. 2003.
59) So aber unzutreffend: VG Magdeburg, Beschl. v. 15. 1. 2013 – 2 B 333/12, Rdnr. 23.
60) Fluck, in: Ule/Laubinger, BImSchG, § 16 Rdnr. C 3; Müggenborg, DVBl. 2001, 417, 421.
61) Müggenborg, DVBl. 2001, 417, 421.62) Müggenborg, DVBl. 2001, 417, 421; Spindler, in: Feldhaus-FS,
S. 25, 3, bei geleasten Anlagen ist grundsätzlich der Leasing-nehmer Betreiber; Roßnagel, in: GK-BImSchG, § 5 Rdnr. 13; Spindler, Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht: Gesellschafts- und zivilrechtliche Einflüsse, in Czajka/Hansmann/Rebentisch, Hrsg., Festschrift für Feldhaus, Immissionsschutzrecht in der Be-währung, 1999, S. 31.
63) Spindler, Der Betreiber-Begriff im Umweltrecht: Gesellschafts- und zivilrechtliche Einflüsse, in: Deutsches Anwaltsinstitut, Brennpunkte des Verwaltungsrechts. Verwaltungsrechtliche Jah-resarbeitstagung 2010, Vortrag am 29. 1. 2010 im BVerwG, Leip-zig, Tagungsband, S. 101 ff., 130.