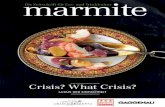Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität?; The Global Financial Crisis in Latin...
Transcript of Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität?; The Global Financial Crisis in Latin...

Z Außen Sicherheitspolit (2013) 6:141–160DOI 10.1007/s12399-013-0377-5
Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität?
Joachim Becker · Johannes Jäger · Bernhard Leubolt
Zusammenfassung: Der Einbruch des Wirtschaftswachstums in Lateinamerika angesichts der Krise von 2008/2009 war vergleichsweise gering. Mithilfe eines modifizierten regulationstheo-retischen Zugangs und dependenztheoretischer Überlegungen wird analysiert, warum die Krise hier nicht zu Finanzkrisen geführt hat. Die rasche Erholung und das folgende kräftige Wachstum hängen wesentlich mit Änderungen der monetären Regulation und den hohen Rohstoffpreisen zusammen. Auch die zum Teil binnenorientierten Entwicklungsstrategien und Industrialisierungs-prozesse wirken stabilisierend.
Schlüsselwörter: Lateinamerika · Weltfinanzkrise · Finanzialisierung · Rohstoffe
The Global Financial Crisis in Latin America: Fragile Stability?
Abstract: During the crisis of 2008/2009 Latin America suffered a relatively weak reduction of economic growth. Based on a modified regulationist perspective and on insights of dependency theory the paper analyses why the crisis has not led to financial crises. The quick recovery and the following strong growth are mainly explained by changes in the monetary restriction and the still high level of raw material prices. In some cases, inward-oriented development strategies and processes of industrialisation contribute to stabilising the economy.
Keywords: Latin America · World financial crisis · Financialization · Raw materials
Online publiziert: 08.11.2013 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
Ao. Prof. Dr. J. Becker ()WU Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung,Welthandelsplatz 1, D4, 1020 Wien, ÖsterreichE-Mail: [email protected]
Prof. (FH) Mag. Dr. J. JägerFachhochschule des bfi Wien, Wohlmutstr. 22,1020 Wien, ÖsterreichE-Mail: [email protected]
Dr. des. B. LeuboltWU Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Regional- und Umweltwirtschaft,Welthandelsplatz 1, D4, 1020 Wien, ÖsterreichE-Mail: [email protected]

142 J. Becker et al.
1 Einleitung
Lateinamerika zeigte sich vom weltwirtschaftlichen Einbruch 2009 vorerst erstaunlich wenig betroffen. Schon 2010 und insbesondere 2011 konnten wieder relativ hohe Wachs-tumsraten verzeichnet werden. 2012 schwächte sich das Wachstum jedoch deutlich – vor allem in Brasilien und Argentinien – ab. Angesichts der historischen Erfahrungen mit bis-herigen Krisen überrascht die relative Stabilität Lateinamerikas. Es stellt sich daher nicht nur die Frage, warum Lateinamerika von der Weltwirtschaftskrise vergleichsweise gering betroffen war, sondern insbesondere, ob Lateinamerika auch mittelfristig vor krisenhaf-ten Entwicklungen verschont bleiben wird. Diese Frage stellt sich umso dringlicher, da in Europa wie auch in den USA neuerlich rezessive Tendenzen offensichtlich werden und die Krise alles andere als überwunden scheint. Um die strukturellen Entwicklungsdyna-miken der lateinamerikanischen Ökonomien jenseits von konjunkturellen Entwicklungen zu erfassen, wird zunächst kurz der theoretische Rahmen – ein modifizierter regula-tionstheoretischer Zugang in Kombination mit dependenztheoretischen Überlegungen – dargestellt. Dies erlaubt es zu erklären, warum die bisherige Krise in Lateinamerika nicht zu Finanzkrisen geführt hat und welche Rolle dabei insbesondere eine Änderung der monetären Regulation gespielt hat. Darauf aufbauend werden knapp die Transmis-sionsmechanismen der Krise und die unterschiedlichen Wirkungen auf einzelne Länder/Regionen in Lateinamerika analysiert. Die rasche Erholung nach 2009 und das folgende kräftige Wachstum in Lateinamerika hängen wesentlich mit dem fortgesetzten Boom der Rohstoffpreise zusammen. Aber auch hier gibt es deutliche Unterschiede. Während manche Ökonomien primär auf Rohstoffexport setzen, was heute unter dem Titel des Neuen Extraktivismus vielfach diskutiert wird, zeigen sich ebenso Ansätze zu stärker binnenorientierten Entwicklungsstrategien und Industrialisierungsprozessen. Inwieweit tatsächlich eine Abkopplung von Entwicklungen im Norden möglich ist, bleibt trotz sich ändernder wirtschaftspolitischer Strategien in Lateinamerika und weltwirtschaftlicher Strukturen fraglich.
Die Regulationstheorie geht davon aus, dass Wachstum nicht automatisch erfolgt, son-dern kapitalistische Entwicklung widersprüchlich ist und es daher entsprechender Insti-tutionen bzw. institutioneller Formen bedarf, um die Widersprüche zumindest kurz- bis mittelfristig einzuhegen (Boyer und Saillard 1995; Jessop und Sum 2006). Eine zentrale strukturelle Form, die entsprechende Widersprüche behandelt, ist das Lohnverhältnis, das die Arbeit-Kapital-Beziehungen umfasst. Ökonomisch bedeutsam für die Stabilität von Wachstum ist dabei insbesondere die Form und Höhe der Lohnfestsetzung. Neben dem Lohnverhältnis ist auch das Konkurrenzverhältnis, das die Beziehungen zwischen Kapi-talien behandelt, wichtig. Im Zuge der Finanzkrisen zeigt sich die zentrale Bedeutung von Geld für den Akkumulationsprozess. Entsprechend wird in der Regulationstheorie der Ausgestaltung der monetären Restriktion eine zentrale Rolle für die Stabilisierung von Akkumulationsprozessen zuerkannt. Überdies ermöglicht es der regulationstheore-tische Zugang zwischen unterschiedlichen Formen von Wachstumsprozessen zu unter-scheiden. Wichtig für das Verständnis lateinamerikanischer Entwicklungen ist dabei die Unterscheidung zwischen produktiver Akkumulation einerseits und fiktiver bzw. finanz-ialisierter Akkumulation andererseits. Während produktive Akkumulation auf einer tat-sächlichen Ausweitung der Mehrwertproduktion baut, erfolgt fiktive Akkumulation vor

Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität? 143
allem durch die Anhäufung von fiktivem Kapital und Schuldtiteln (Becker 2002). Die Stärke des dependenztheoretischen Ansatzes liegt darin, dass er sowohl die ökonomi-schen als auch die politischen Dimensionen der Interaktion von asymmetrischen Ent-wicklungsmodellen in Zentrum und Peripherie erfassen kann. Insbesondere geht es dabei um die Frage, inwieweit unter Bedingungen von struktureller Abhängigkeit Entwicklung möglich ist (Cardoso und Faletto 1976). Sowohl Regulationstheorie als auch Dependenz-theorie betonen die Notwendigkeit einer historischen Perspektive. Im Folgenden geben wir daher zunächst einen knappen Überblick über die Entwicklungen der letzten Deka-den. Daran anknüpfend erfolgen eine Analyse Lateinamerikas in der jüngsten Krise und eine Einschätzung möglicher mittelfristiger Entwicklungspfade.
2 Entwicklungsmodelle und Krisen in Lateinamerika
Mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems und der Liberalisierung des Kapitalverkehrs in den 1970er Jahren hat in Lateinamerika eine neue Ära instabiler Entwicklungen Ein-zug gehalten. Ab 1979 konnte die USA Dank der Durchsetzung der von Peter Gowan (1999) als Dollar-Wall Street Regime (DWSR) bezeichneten neuen Form der interna-tionalen monetären Restriktion die eigene Position wieder stärken und den Zufluss von Kapital garantieren. Struktureller Hintergrund für diese Veränderung war das Stocken der produktiven Akkumulation im Zentrum der Weltökonomie. Dies hat auch dazu geführt, dass US (und EU)-Kapital zunehmend Anlagemöglichkeiten in der Finanzsphäre gesucht hat (Arrighi 1994). In Lateinamerika äußerte sich das vor allem in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre in Form von Kreditzuflüssen. Die Finanzzuflüsse erlaubten einen kur-zen Zyklus finanzialisierter Entwicklungsmodelle, welche in Mexiko, Chile, Argentinien und Uruguay besonders ausgeprägt waren. Im Kontext weitgehend fixer Wechselkurse, einer Überbewertung der Währung und eines hohen Zinsdifferentials gelang es Banken und Kapitalgruppen kurzfristig hohe Gewinne zu schöpfen. Vielfach war dieses auf spe-kulativen Kapitalzufluss orientierte Modell auch mit einem Bau- und Immobilienboom verbunden. Die Überbewertung und die gleichzeitig stattfindende Liberalisierung des Warenverkehrs setzten die einheimische Produktion unter Druck und führten zu Deindus-trialisierung. Gleichzeitig kam es durch eine Veränderung des Lohnverhältnisses aufgrund von Repressionen im Rahmen der Militärdiktaturen zu einer Reduktion der Nachfrage. Mit der Durchsetzung des DWSR, das durch die radikale Anhebung der Zinsen in den USA ab 1979 und den damit verbundenen Höhenflug des Dollars seinen Anfang nahm, wurde der Schuldendienst schlagartig verteuert. Viele private SchuldnerInnen in Lateinamerika, wie beispielsweise Banken, konnten ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Kapi-talzuflüsse blieben schlagartig aus und Kapitalabflüsse setzten ein. Die Schulden hatten sich im Zeitraum zwischen 1978 und 1982 noch verdoppelt (Ffrench-Davis et al. 1997, S. 393). Lateinamerika war 1982 offiziell in einer Schuldenkrise. Die zum größten Teil privaten Auslandsschulden wurden – nicht zuletzt auf Druck des IWF im Rahmen von Strukturanpassungsprogrammen – verstaatlicht. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Schulden weiter bedient werden konnten. Dies war notwendig, um die Stabilität der Gläubigerbanken in den USA sicherzustellen. Mit den Strukturanpassungsprogrammen gingen Abwertungen und eine massive Reduktion der Binnennachfrage einher, um die

144 J. Becker et al.
Importe zu drosseln. Gleichzeitig wurde versucht, Exporte zu forcieren, um durch einen Handelsbilanzüberschuss Ressourcen für die Bedienung des explodierenden Schulden-dienstes freizumachen. Eine tiefe und lange Krise war die Folge. Am Ende der 1980er Jahre war das BIP deutlich gesunken. Es wird von einer verlorenen Dekade gesprochen. Trotz eines Nettokapitalabflusses ins Ausland stiegen die Auslandsschulden auch in den 1990er Jahren, wenn auch weniger deutlich (Ffrench-Davis et al. 1997, S. 393).
2.1 Kapitalzufluss, Boom und Krise in den 1990er Jahren
Der Periode des forcierten Kapitalabflusses folge zu Beginn der 1990er Jahre eine neu-erliche Periode des Kapitalzuflusses. Lateinamerika versprach neuerlich Wachstum und kam als Anlageregion für Finanzkapital ins Blickfeld. Auch hier wurden zum Teil wie-der finanzialisierte Wachstumsmodelle unterstützt, wenn auch in unterschiedlicher Aus-prägung. Während Länder wie Argentinien oder Brasilen sehr stark auf finanzialisierte Wachstumsmodelle bauten, waren andere Länder – allen voran Chile – dieses Mal deut-lich vorsichtiger (Becker et al. 2010). Im Unterschied zu den 1970er Jahren waren es nun-mehr jedoch weniger Bankkredite als vielmehr Anleihen, die zu Kapitalzufluss und zur Erhöhung der Auslandsschulden führten (Schvarzer 2003, S. 36–37). Insbesondere die Mercosur-Länder und Mexiko hatten diesen Weg der Auslandsverschuldung eingeschla-gen. Über 90 % der lateinamerikanischen Anleihen waren von diesen Ländern begeben worden (Griffith-Jones und Cailloux 1997, S. 88), gleichzeitig war der Finanzialisie-rungsprozess hier sehr ausgeprägt. Dieser wurde von Seiten des Finanzsektors sowie von Teilen der Mittelschicht mitgetragen. Im Kern der finanzialisierten Modelle stand eine Bindung an den US-Dollar, die zu einer Überbewertung der Währung führte. Der Zufluss von Kapital, welcher durch hohe Zinsen unterstützt wurde, ermöglichte die Finanzierung eines erheblichen Handelsbilanzdefizits. Ähnlich wie in den 1970er Jahren waren eine stark steigende Auslandsverschuldung, hohe Leistungsbilanzdefizite und eine weitere Deindustrialisierung die Folge. Kurzfristig relativ dynamisches Wachstum und eine deut-liche Reduktion der Inflation schienen dieses Modell jedoch zunächst für breite Schich-ten attraktiv zu machen. Ebenso ermöglichte es den teilweise kreditfinanzierten Import günstiger Konsumgüter. Der Finanzialisierungsprozess war vor allem in Argentinien und auch in Uruguay mit einer deutlichen Zunahme der Dollarisierung verbunden (Becker und Jäger 2005). Diese neuerlich durch Finanzialisierung charakterisierten Modelle stießen unterschiedlich rasch an ihre Grenzen. Zunächst war es die Krise in Mexiko ab 1994, die die Probleme eines derartigen Wachstumsmodells aufzeigte. Ab 1998 folgte Brasilien, dann Uruguay und Argentinien ab 2001. In allen diesen Ländern stellte sich schlussendlich eine Abwertung der Währung als unerlässlich heraus. In Argentinien dau-erte aufgrund des hohen Grades an Dollarisierung im Rahmen eines Quasi-Currency Boards, welches den Wechselkurs zwischen argentinischem Peso und dem US-Dollar mit 1:1 gesetzlich festgelegt hatte, besonders lange, bis trotz tiefer Krise der überbewertete Wechselkurs aufgegeben wurde. Das abrupte Ende des Finanzialisierungsprozesses ging in Mexiko sowie in Uruguay und Argentinien auch mit Bankenkrisen einher. Nicht jedoch in Brasilien, wo eine flexiblere Wechselkurspolitik verfolgt und eine offene Dollarisie-rung weitgehend verhindert worden waren (Becker 2010, S. 126–130).

Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität? 145
Es gab jedoch auch Länder, die trotz des nach Lateinamerika drängenden Finanzkapi-tals in den 1990er Jahren eine Finanzialisierung weitgehend vermeiden konnten. Dabei sticht besonders Chile hervor. In diesem Land war die Krise in den 1980er Jahren am tiefs-ten ausgefallen. Als Konsequenz waren zunächst striktere, später weniger rigide Formen der Kapitalverkehrskontrolle eingesetzt worden. Letztere zielten insbesondere darauf, kurzfristige spekulative Kapitalzuflüsse durch eine Hinterlegungspflicht eines Teils des Kapitals bei der Zentralbank zu reduzieren. In der Tat konnte damit eine übermäßige Auf-wertung der Währung verhindert werden. Das Wachstumsmodell in Chile war deutlich stärker auf produktive Akkumulation aufgebaut und eine neuerliche Finanzkrise konnte damit verhindert werden (Correa und Jäger 2007). Das produktive Akkumulationsmo-dell in Chile ist als extensives, auf dem Export von Rohstoffen basierendes, Modell zu bezeichnen. Damit hat es gewisse Ähnlichkeiten mit anderen Andenländern wie Peru, Bolivien, Ecuador und Venezuela, die ebenfalls stark vom Rohstoffexport abhängen. Allesamt zeigten sich die Wachstumsmodelle dieser Länder vor allem von der Preisent-wicklung der Rohstoffe abhängig. Der drastische Preisverfall der meisten Rohstoffe in den 1980er Jahren, der durch die Forcierung des Exports im Zuge der Strukturanpas-sungsprogramme getrieben wurde (Raza 2000, S. 48–51), hatte die Krise noch vertieft. In den 1990er Jahren stabilisierten sich die Preise für Rohstoffe, was einer stabileren ökono-mischen Entwicklung in den betroffenen Ländern zuträglich war. Zu Beginn der 1990er Jahre kam es damit angesichts von Wachstumsprozessen zu einer leichten Verringerung der extremen Armut.
Spätestens mit dem zweiten großen Krisenzyklus zwischen 1994 und 2002 wurde die Problematik finanzialisierter Entwicklungsmodelle überdeutlich. Die Gefahren eines liberalisierten Kapitalverkehrs, einer Währungsaufwertung, einer Leistungsbilanzver-schlechterung, die in der Regel in einem raschen Kapitalabzug mündet und das Land in eine Krise stürzt, wurden nun offen diskutiert. Änderungen in der Wirtschaftspolitik, insbesondere im Bereich der monetären Restriktion, waren in vielen Ländern die Folge. Neben milden Formen der Kontrolle spekulativer Kapitalzuflüsse versuchten Zentralban-ken ihre ausländischen Währungsreserven aufzubauen, um gegen spekulative Attacken besser gewappnet zu sein. Überdies wurde im Rahmen einer flexiblen Wechselkurspolitik versucht, eine übermäßige Währungsaufwertung und damit verbundene Verschuldungs-dynamiken und Leistungsbilanzdefizite aufzuhalten. Vielfach erfolgte auch eine striktere nationale Regulierung und Kontrolle des Finanzsektors. Eine zentrale Voraussetzung für die vorgenommenen Veränderungen in der Regulierung des Finanzsektors war die wie-dergewonnene Unabhängigkeit gegenüber internationalen Finanzinstitutionen. So waren die Regierungen bestrebt, IWF-Kredite möglichst rasch zurückzubezahlen, um wieder mehr Unabhängigkeit in der Wirtschaftspolitik zu erlangen (Görgl et al. 2011). Der Auf-bau von Devisenreserven, vor allem in US-Dollar, bedeutete jedoch, dass damit das Leis-tungsbilanzdefizit der USA finanziert wurde und Ressourcen in den Norden abflossen. Eine Betrachtung der Nettokapitalflüsse zeigt, dass dies eine wichtige Komponente für den Kapitalabfluss aus Entwicklungsländern und insbesondere aus Lateinamerika dar-stellte (Küblböck und Jäger 2011; CEPAL 2013a).

146 J. Becker et al.
2.2 Der Wachstumszyklus von 2002–2008
Ab 2002 begann in Lateinamerika ein neuerlicher Wachstumszyklus, dessen Dynamik nicht vom Finanzsektor sondern von den produktiven bzw. extraktiven Sektoren der Ökonomie ausging. In den meisten Ländern war diese Verschiebung Teil einer breiteren politischen und ökonomischen Reorientierung. In Brasilien, Uruguay und Argentinien delegitimierte die Krise der Jahre 1998–2002 das vorherige finanzialisierte Wirtschafts-modell und die mit ihm verbundenen neo-liberalen Politiken. Für den WählerInnenum-schwung zu den Mitte-Links-Parteien war vor allem eine politische Reorientierung eines Teils der MittelschichtwählerInnen von zentraler Bedeutung (Boris et al. 2008, S. 323). Allerdings war in Brasilien auch markant, dass ein Teil des Industriekapitals immer mehr auf Distanz zur finanzialisierungsfreundlichen Politik der Regierung Cardoso gegan-gen war und im Vorfeld der Wahlen 2002 sogar offen zur Wahl Lulas aufrief (Diniz und Boschi 2007, S. 64). Hier kam also zur Reorientierung der Mittelschichten ein zuneh-mender Dissens zwischen unterschiedlichen Kapitalfraktionen hinzu. Die Pressionsmög-lichkeiten der Finanzgruppen waren auch nach dem Wahlsieg Lulas beträchtlich. Dies ist einer der Gründe dafür, warum eine Abkehr von der Hochzinspolitik in Brasilien nur sehr zögerlich erfolgte (Faria 2010, S. 185). Sowohl ParteigängerInnen einer eher finanz-freundlichen neo-liberalen Politik als auch eines Entwicklungskeynesianismus waren in den Regierungen Lula vertreten (Schmalz 2008, S. 115–119). Mit der Zeit verschoben sich die Gewichte zugunsten der entwicklungskeynesianischen Fraktion (Schmalz und Ebenau 2011, S. 74–75). Über das eingelöste Versprechen von Stabilität und sozialer Bes-serstellung für die armen Bevölkerungsgruppen vermochte sie große Teile der Armuts-bevölkerung, die zuvor für die Rechte gestimmt hatte, auf ihre Seite zu ziehen und somit ihre Wählerbasis verbreitern. Dies war ein wesentlicher Grund für das starke Abschnei-den Lulas bei seiner Wiederwahl im Jahr 2006 (Singer 2009).
In Argentinien erfolgte die Richtungsänderung im Gegensatz zu Brasilien oder Uru-guay in einer offenen politischen Krise, als das finanzialisierte Modell der Convertibili-dad, das auf einem Currency Board und einer fixen Bindung des argentinischen Peso an den US-Dollar gegründet war, kollabierte. ParteigängerInnen einer Währungsabwer-tung, die von den großen grupos ecónomicos mit substanziellen Exportaktivitäten, aber auch von Teilen der Gewerkschaften getragen wurde, und einer Komplettdollarisierung, die ihre AnhängerInnen vor allem beim transnationalen Kapital in Dienstleistungssekto-ren sowie in der Spitze der Zentralbank hatte, trafen aufeinander (Castellani und Schorr 2004). Im Tauziehen um die Nachfolge des unter dem Eindruck einer massiven Pro-testbewegung zurückgetretenen Staatspräsidenten de la Rúa setzte sich Anfang 2002 mit Duhalde ein Vertreter der Abwertungsoption durch. Dieser erreichte zumindest eine rela-tive Stabilisierung, so dass in den nachfolgenden Wahlen eine Mitte-Links-Strömung des Peronismus in den Wahlen reüssieren konnte.
In Brasilien, Uruguay und Argentinien erfolgte die Wende nach Links im Rahmen der bestehenden Institutionen. In einem Teil der andinen Länder mit ihrer extremen Abhängigkeit vom Rohstoffexport war die Delegitimierung der bestehenden politi-schen Ordnung hingegen viel weiter vorangeschritten. Auch hier gewann die Linke in Präsidentschaftswahlen in Venezuela, Bolivien und Ecuador nach zum Teil anhaltenden Protestzyklen die Mehrheit. In Venezuela sah Chávez nach seinem ersten Wahlsieg die

Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität? 147
Möglichkeit zu einer Neu-Fundierung der politischen Ordnung über eine grundlegende Verfassungsreform, erst dann folgten sozio-ökonomische Veränderungen. Die Linksre-gierung Bolivien und Ecuadors folgten später dem Beispiel des chavistischen Venezuela. Speziell die Regierungen Chávez und Morales sahen sich massiven Destabilisierungs-versuchen – bis hin zum Putschversuch bzw. paramilitärischen Provokationen – seitens großer Teile der Bourgeoisie ausgesetzt. Rechte Destabilisierungsbestrebungen wurden aktiv – oft über zwischengeschaltete Think Tanks – durch die US-Regierungen Bush und Obama gefördert (Livingstone 2011, S. 30, 38–39; Tsolakis 2011, S. 136–138). Es gelang den Regierungen Chávez und Morales jedoch, diese Gruppen politisch zu isolieren und die maßgeblichen Sektoren des Militärs auf ihre Seite zu ziehen. In Honduras und Para-guay wurden hingegen Mitte-Links-Präsidenten aus dem Amt geputscht. Dies zeigt die Fragilität der (Mitte-)Links-Regierungen, speziell in den andinen Ländern, an.
Die Veränderung der monetären Restriktion – vielfach im Kontext des Erstarkens linker Parteien – war für den neuen Wachstumszyklus ein zentraler Eckpfeiler. Linke Regierungen begünstigten zum Teil auch stärker auf Binnenorientierung ausgerichtete Wachstumsmodelle – allen voran in Brasilien. Hier kann von der Rückkehr des Entwick-lungsstaates gesprochen werden (Novy 2008). Brasilien ist allein ob seiner Größe mit einem Exportanteil von nur ca. 13 % vergleichsweise weniger außenabhängig. Dennoch zeigt sich auch für dieses Land, dass der Export von Primärgütern, wie etwa Soja, und damit deren Preisentwicklung einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Entwicklungsdy-namik hatte. Dies galt noch mehr für andere Länder, die stärker von (Rohstoff-)Exporten abhängig sind. Ab 2002 stiegen die Preise für Rohstoffexporte und Agrargüter markant an (CEPAL 2012, S. 29) und begünstigten das Wachstum in vielen Ländern. Gleichzeitig führte es zu einer Reprimarisierung der Exportstruktur, was die Länder von Rohstoff-preisentwicklungen noch abhängiger machte. Es waren vor allem linke Regierungen, wie in Venezuela und später in Bolivien und Ecuador, die versuchten sich einen größeren Teil der Rohstoffrente anzueignen um damit Sozialausgaben aber auch produktive Investitio-nen zu fördern (Stefanoni 2012). In diesem Zusammenhang wird auch von einem Neuen Extraktivismus gesprochen (Gudynas 2010; Svampa 2012). Dieser unterschied sich vom traditionellen Extraktivismus dahingehend, dass die Rohstoffrente nicht abfloss, sondern eben im jeweiligen Land zu einem wichtigen Teil durch den Staat angeeignet und ver-wendet wurde (Jäger und Leubolt 2013). Diese neue Rohstofforientierung wurde nicht zuletzt seitens der CEPAL (2010a) kritisiert, da sie neuerlich zur Vertiefung problema-tischer Abhängigkeit vom Preis eines oder einiger weniger Rohstoffe führe. Überdies wurde die Ausrichtung auf den Rohstoffexport mit Hinblick auf die damit verbundenen ökologischen Implikationen problematisiert (Gudynas 2010).
Auch Argentinien schlug nach der Krise von 2002 einen alternativen Weg zur neo-liberalen Wirtschaftspolitik ein. Wichtige Voraussetzung dafür war die Durchsetzung einer Schuldenreduktion und die damit verbundene Schaffung wirtschaftspolitischer Spielräume. Binnenorientierung und Re-Industrialisierung wurden durch eine Reihe heterodoxer Maßnahmen, insbesondere im Bereich der monetären Restriktion, gefördert. Besonders zentral war die Abwertung des Peso und die über einen längeren Zeitraum ver-folgte Politik einer tendenziellen Währungsunterbewertung (Curia 2011). Diese Art der Währungspolitik schuf speziell für den Industriesektor einen Schutzmechanismus, da die Importe verteuert wurden. Die argentinische Industrieproduktion erholte sich stark. Nach

148 J. Becker et al.
einem Prozess der Deindustrialisierung zwischen 1976 und 2003 hat das Land in den letz-ten Jahren eine „Reindustrialisierung“ (Salama 2012, S. 68) erreicht. Die Branchen, die durch die De-Industrialisierung der neo-liberalen Phase besonders stark betroffen waren, wuchsen in der Aufschwungphase 2003–2007 besonders stark, ohne dass sich das indust-rielle Profil grundsätzliche änderte (Schorr 2012). Auch die industriellen Exporte stiegen an (Salama 2012, S. 101–102). Zusätzlich konnte Argentinien von den ab 2003 stark steigenden Preisen für landwirtschaftliche Güter profitieren.
Der Erdölpreisverfall zu Beginn der 1980er Jahre und der weiterhin niedrige Preis während der 1990er Jahre bescherte Venezuela zwei durch Krisen gekennzeichnete Dekaden. Trotz der Versuche, bis Anfang der 1970er Jahre importsubstituierende Indus-trialisierungsprojekte voranzutreiben, waren die Erfolge sehr bescheiden geblieben und Venezuela blieb eine Erdölökonomie. Dies zeigt sich insbesondere bei den Exporten, die beinahe ausschließlich aus Erdöl und Erdölprodukten bestanden. Strukturanpassungspro-gramme in den 1990er Jahren führten zur Delegitimierung des Establishments und Chá-vez wurde 1999 zum Präsidenten. Unter seiner Regierung wurde versucht, die Kontrolle über den staatlichen Erdölsektor, der als Staat im Staat galt, wieder zu erlangen. Damit konnte auch auf Erdölrenten zugegriffen werden, die eine zentrale Finanzierungsquelle für den Ausbau der Sozialpolitik wurden. Überdies wurden eine Reihe heterodoxer Maß-nahmen ergriffen. Diese hatten zum Ziel, den Finanzsektor zu stabilisieren und diesen durch erhebliche staatliche Lenkung zu einer günstigen Quelle für die Finanzierung von produktiven Investitionen zu machen. Ebenso wurde durch rigide Kapitalverkehrskon-trollen versucht, Kapitalflucht einzudämmen. Trotz dieser Maßnahmen konnte jedoch Kapitalflucht nur eingeschränkt vermieden werden. Auch wenn sich Chávez bereits nach seinem Amtsantritt für eine bessere Koordination und Einhaltung der Förderquoten in der OPEC eingesetzt hatte, so kann jedoch nicht genau eingeschätzt werden, inwieweit dies wirklich kausal für den deutlichen Anstieg des Erdölpreises ab 2002 war. Unzweifel-haft waren die hohen Erdölpreise wichtig für das dynamische Wirtschaftswachstum bis 2008 (Görgl et al. 2011). Die begrenzte administrative Kapazität des Staates wie auch die ablehnende Haltung eines Teils der Staatsbediensteten gegenüber der angestrebten Trans-formation erwies sich bei der Umsetzung wirtschafts- und sozialpolitischen Neuerungen als erkennbares Hindernis (Stefanoni 2012, S. 53, 56–57).
Chile, in dem bereits in den 1980er und 1990er Jahren Modifikationen der monetären Restriktion erfolgt waren, konnte entsprechend Ende der 1990er Jahre und Anfang der 2000er Jahre eine tiefe Krise vermeiden, auch wenn aufgrund der Reduktion der Roh-stoffpreise im Zuge der Krise 2001 das Wachstum deutlich eingebrochen war. Aufgrund der Ausrichtung der chilenischen Ökonomie auf mineralische Rohstoffe (vor allem Kup-fer) mit einem Anteil an den Exporten von ca. 70 %, sowie Agrarprodukten konnte auch Chile vom Höhenflug der Preise zwischen 2002 und 2008 profitieren und die Wirtschaft entsprechend wachsen. Im Unterschied zu Linksregierungen in anderen lateinameri-kanischen Staaten gab es jedoch nur sehr zaghafte Bestrebungen, über den Staat einen größeren Teil der Rohstoffrente anzueignen und für soziale oder produktive Zwecke zu verwenden. Vielmehr flossen die Gewinne vor allem an ausländische KapitalbesitzerIn-nen. Insgesamt ergab sich damit ein erheblicher Nettotransfer von Ressourcen ins Aus-land, die sich 2007 sogar auf über 10 % des BIP beliefen (Görgl et al. 2011).

Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität? 149
In Mexiko erfolgte hingegen nach der Krise von 1994 keine substanzielle Änderung des Wachstumsregimes und auch die neo-liberale Orientierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik blieb unverändert. Ebenso wurde mit finanzialisierten Aspekten der Akku-mulation nicht gänzlich gebrochen. Im produktiven Bereich blieb die enge Verflechtung mit den USA in Form einer verlängerten Werkbank bestehen. Auch Arbeitsmigration und entsprechende Überweisungen waren für die mexikanische Ökonomie von Bedeutung. Entsprechend war Mexikos Konjunktur auch direkt von der Entwicklung in den USA abhängig (Pimmer 2010, S. 19). Auch wenn Mexiko bis vor der Krise von 2007 von der relativ hohen Nachfrage in den USA profitieren konnte, so kam es ökonomisch aufgrund der Konkurrenz aus China zunehmend unter Druck (Dussel Peters 2009, S. 326).
Mittelamerika ist ökonomisch eng mit Mexiko und damit indirekt aber ebenso direkt mit der US-Ökonomie verflochten. Entsprechend sind die ökonomischen Entwicklungen auch ähnlich, auch wenn der Export von Agrarprodukten meist eine bedeutendere Rolle einnimmt als in Mexiko. Zwischen 2003 und 2008 konnten die meisten Länder in der Regel relativ hohe Wachstumsraten verzeichnen. Besonders wichtig für viele Ökonomien Mittelamerikas – aber auch für Mexiko – waren die Überweisungen von Arbeitsmig-rantInnen vor allem aus den USA. Ihre Zahl stieg bis 2008 deutlich an (CEPAL 2013a, S. 52; 60).
Wenn sich zwischen den einzelnen Ländern Lateinamerikas auch deutliche Unter-schiede feststellen ließen, so war ihnen doch gemein, dass sie bis 2008 sehr hohe Wachs-tumsraten aufweisen konnten. Mit der Weltfinanzkrise zeigte sich die Stabilität aber auch die Verwundbarkeit der einzelnen Ökonomien.
3 Die Krise 2009, der kurze Boom und der einsetzende Abschwung
Die Weltfinanzkrise begann vorerst im finanzialisierten Wachstumsregime der USA, über-trug sich aber schnell auch auf Europa und andere Weltregionen. Erstens gab es Anste-ckungseffekte, die direkt über den Finanzsektor liefen, da sich aus den USA stammende Anlageprodukte und Bankgarantien plötzlich als wertlos herausstellten. Zweitens brach die Exportnachfrage der USA ein. Auch Lateinamerika wurde grundsätzlich über diese beiden Kanäle von der Krise in den USA und später in Europa erfasst. Überdies waren manche Länder von rückläufigen Überweisungen von ArbeitsmigrantInnen sowie von Kürzungen der Mittel der Entwicklungszusammenarbeit negativ betroffen (Becker 2012).
Im Krisenjahr 2008 betrug das Wirtschaftswachstum in Lateinamerika und der Kari-bik noch 4 %. Im Jahr 2009 war es mit einem Wert von − 1,9 % deutlich negativ. Bereits 2010 wendete sich jedoch das Blatt und die Wirtschaft wuchs mit einem Rekordwert von 5,9 %. 2011 war das Wachstum mit 4,3 % leicht rückläufig. 2012 ging es auf 3,1 % zurück. Damit zeigte sich das Wirtschaftswachstum in Lateinamerika insgesamt von der Krise mit dem Ausnahmejahr 2009 nicht ausgesprochen negativ betroffen (CEPAL 2013a, S. 52). Es war vor allem der Exportkanal der 2009 zu erheblichen Rückgängen im Volumen aber vor allem in den Exportpreisen führte und Lateinamerika in Mitleiden-schaft zog. Die Exporte reduzierten sich 2009 um knapp 14 %, wobei rund 3/4 des Rück-gangs auf Preiseffekte und nur 1/4 auf Mengeneffekte rückführbar waren. Gleichzeitig war der Anstieg der Exporte auch für die rasche Erholung von zentraler Bedeutung. 2010

150 J. Becker et al.
betrug das Wachstum knapp unter 20 %, 2011 lag es sogar über 20 %. Auch hier waren Preiseffekte hauptverantwortlich für den Anstieg. 2012 waren das Exportwachstum zwar noch deutlich positiv, die Preiseffekte jedoch schon negativ (CEPAL 2012, S. 30). Über den Finanzkanal gab es kaum nennenswerte direkte Ansteckung durch Verluste bei US oder EU-Wertpapieren, denn Firmen aus Lateinamerika hatten sich insgesamt nicht sehr stark auf den Derivatmärkten engagiert. Einige Großunternehmen aus Mexiko, Brasilien und Kolumbien erlitten dennoch im Zuge der Krise hohe Verluste durch Devisenspeku-lation (Farhi und Cintra 2009, S. 117–123). Trotzdem war mit dem Ausbruch das übliche Krisenverhalten an den Finanzmärkten erkennbar. Die Risikoprämien stiegen für Latein-amerika im Schnitt von 254 Punkten 2007 auf 537 Punkte 2008 und 728 Punkte 2009 und reduzierten sich 2010 wieder deutlich auf 433 Punkte, sind mittlerweile aber wieder leicht gestiegen (CEPAL 2012, S. 32). Nach diesen Ausführungen der generellen Krisenbetrof-fenheit Lateinamerikas, soll im Folgenden auf die Entwicklungspfade und spezifischen Krisenverlauf einzelner Länder gesondert eingegangen werden.
3.1 Mexiko und Mittelamerika: Starker Wachstumseinbruch durch enge Verknüpfung mit der US-amerikanischen Wirtschaft
Mexiko konnte bereits 2008 nur mehr ein leicht positives Wachstum von 1,2 % ver-zeichnen und erlitt mit − 6 % einen besonders starken Einbruch des BIP im Jahr 2009. Allerdings konnte bereits 2010 der Wirtschaftseinbruch mit einem Wachstum von 5,6 % praktisch wieder aufgeholt werden. Auch 2011 und 2012 belief sich das Wachstum noch auf knapp unter 4 %. Der markante Wirtschaftseinbruch hing vor allem mit der engen Ver-knüpfung der Wirtschaft mit den USA und hier vor allem mit dem Einbruch der Export-preise und der Exportvolumen zusammen, die sich beide deutlich reduzierten (CEPAL 2011a, S. 156). Mit der Stabilisierung der US-Wirtschaft stiegen die Exporte wieder auf das ursprüngliche Niveau und die mexikanische Ökonomie stabilisierte sich. Trotz eines Anstiegs des Risikoaufschlages blieb Mexiko von übermäßigen spekulativen Kapital-abflüssen in der Krise verschont. Seitens der USA wurden Kreditlinien zur Verfügung gestellt (Ocampo 2009, S. 57). Die Direktinvestitionen reduzierten sich jedoch um gut ein Viertel. Die Kreditrestriktionen schlugen sich auf internationale Firmen relativ stark durch und trugen damit zu einer Verschärfung der Krise bei (Moreno-Brid 2009, S. 73–74). Im Endeffekt erhöhte sich damit im Krisenjahr 2009 der Stand der mexikanischen Auslands-schulden sprunghaft von 125 auf 162 Mrd. USD (CEPAL 2011a, S. 159–160).
Mittelamerika zeigte in der Krise ein ähnliches Muster wie Mexiko. Im Jahr 2009 erlebten die meisten Länder eine Phase der Stagnation oder negativen Wachstums. 2010 und 2011 erholten sich die Ökonomien in der Regel leicht. 2012 schwächte sich das Wachstum wieder deutlich ab. Verschärft wurde die Krise durch das Ausbleiben der Überweisungen von ArbeitsmigrantInnen. Diese gingen seit 2009 zurück, im Jahr 2012 brachen sie richtiggehend ein(CEPAL 2013a, S. 52; 60).

Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität? 151
3.2 Die Mercosur-Länder: Schwächere Krisenbetroffenheit durch stärkere Binnenorientierung
In den Mercosur-Ländern wie Brasilien, Argentinien und Uruguay trugen Binnenorien-tierung und die Diversifizierung der Exporte dazu bei, dass der Einbruch in der Krise weniger stark ausfiel. In Argentinien war beispielsweise die Dollarisierung stark zurück-gedrängt worden. Dies machte Abwertungen weniger problematisch. Damit konnten sowohl die binnenorientierte Industrie besser geschützt als auch größere Handelsbilanz-defizite in der Krise vermieden werden. Es war damit weniger der Finanzierungskanal als vielmehr der Handelskanal der Krisen auf Lateinamerika übertrug, wie Ocampo (2009, S. 56) festhält: „Wenngleich es der Region gelang, ihre finanzielle Verwundbarkeit abzu-bauen, ist ihre Verwundbarkeit beim Handel höher als in der Vergangenheit“.
In Brasilien war die Krise einerseits aufgrund der vergleichsweise geringeren Außen-abhängigkeit, andererseits aufgrund entschiedener Gegenmaßnahmen nur schwach spür-bar. Die Regierung Lula setzte die expansiven Politiken der Vorkrisenzeit fort und ergriff überdies ausgeprägte antizyklische Maßnahmen (Schmalz und Ebenau 2011, S. 70–75), um Massenkonsum und Investitionen zu stabilisieren. Öffentliche Banken – und damit die spezifische Ausformung der monetären Restriktion in Brasilien – hatten einen wesent-lichen Anteil in der Ausweitung der Investitionsfinanzierung. Im Jahr 2009 schrumpfte das BIP um 0,3 %. Im Jahr darauf wuchs die brasilianische Wirtschaft bereits wieder mit 7,5 % und expansive Maßnahmen wurden zurückgenommen. Daraufhin schwächte das Wachstum mit 2,7 % im Jahr 2011 und 1,2 % im Jahr 2012 wieder spürbar ab. Neben dem Rückgang der Exporterlöse zeigte sich insbesondere auch ein Einbrechen der pro-duktiven Investitionen (CEPAL 2013a, S. 10; 52). Negativ auf das Wachstum wirkte sich eine Reduktion der fiskalpolitischen Spielräume bei einer Verschuldung von knapp unter 60 % des BIP in Zusammenhang mit einem nach wie vor sehr hohen Zinsniveau aus. Die Wachstumsproblematik wurde durch eine starke Aufwärtsentwicklung der Währung, die durch einen Fluchtwährungseffekt aufgrund der Schwäche von US-$ und € ausgelöst wurde, verschärft. Dies wirkte sich negativ auf Exporte aus und billige Importe, insbe-sondere aus China, hemmten die industrielle Entwicklung in Brasilien. Besonders negativ sind die arbeitsintensiven Industriebranchen betroffen (Salama 2012, S. 81–83). Trotz der Besteuerung von Kapitalzuflüssen gelang es nicht, diesen Zustrom wesentlich zu stop-pen. Der Nettoressourcenzufluss betrug zwischen 2009 und 2012 jährlich zwischen 37 und 64 Mrd. USD. Die Kontrolle der spekulativen Kapitalzuflüsse erwies sich als zu zaghaft. Es waren aber auch ausländische Direktinvestitionen, die 2011 und 2012 mit 68 und 65 Mrd. USD jeweils Rekordwerte erreichten. Auch wenn die Zentralbank versuchte, den Zustrom durch Aufkäufe am Devisenmarkt teilweise zu sterilisieren und dadurch die Währungsreserven erheblich anstiegen, haben sich die Auslandsschulden seit Beginn der Krise um rund 50 % erhöht. Zwischen 2009 und 2012 stiegen sie von 198 Mrd. USD auf knapp 302 Mrd. USD (CEPAL 2013a, S. 57; 60–62; 80). Durch die hohen Währungsre-serven ist Brasilien netto jedoch internationaler Gläubiger (die netto Auslandsverschul-dung betrug im Dezember 2012 − 14,04 % des BIP; www.ipeadata.gov.br). Insgesamt bleibt abzuwarten, ob die ökonomischen Turbulenzen das bis 2009 äußerst erfolgreiche keynesianisch konturierte Projekt eines „inklusiven Entwicklungsstaates“ beenden oder ein vorübergehendes Intermezzo darstellen werden (Leubolt 2013).

152 J. Becker et al.
Argentinien zeigte sich von der Krise 2009 ebenfalls deutlich betroffen und begann fis-kalisch gegenzusteuern. Das Wachstum fiel von 6,8 % 2008 auf nur 0,9 %. Die Regierung versuchte, öffentlich staatliche Investitionen zu stabilisieren und die Kreditvergabe ins-besondere für die Produktion dauerhafter Konsumgüter und auch für die Bauwirtschaft zu steigern. Die Sozialpolitik wurde ausgeweitet: So machte die argentinische Regierung im Oktober 2008 die Privatisierung der Pensionsversicherung rückgängig und führte das weniger finanzmarktabhängige Umlageverfahren bei Pensionen wieder ein, auch wurden neue sozialpolitische Instrumente (z. B. einkommensabhängiges Kindergeld) umgesetzt (Musacchio 2012, S. 24–25). Die expansive Budgetpolitik wurde bis einschließlich 2012 fortgesetzt. Die Staatsausgaben erhöhten sich kontinuierlich als Anteil des BIP von 21,9 % 2009 auf 25 %. Bei gleichzeitiger Steigerung der Einnahmen belief sich das Budgetdefizit zuletzt 2012 aber nur auf 1,6 %. Bereits 2010 wuchs die Wirtschaft wieder mit 9,2 %, 2011 mit 8,9 % (CEPAL 2013a, S. 52; 77–79). Allerdings ließ die argentinische Regie-rung eine deutliche reale Aufwertung des argentinischen Peso zu. Sie fiel mit einer realen Aufwertung von 36,4 % zwischen Januar 2007 und Dezember 2010 sogar noch stärker als in den Nachbarländern aus (Schorr 2012, S. 123–124). Dies erodierte den wichtigs-ten wirtschaftspolitischen Pfeiler der argentinischen Wirtschaftspolitik seit der Krise von 2002 und wirkte sich tendenziell dämpfend auf die industrielle Dynamik aus. Die Wirt-schaftspolitik war in Argentinien insgesamt weniger strategisch als in Brasilien. Eine Industriepolitik fehlte gänzlich. Beginnend mit der Militärdiktatur war auch die Kapa-zität des Staates zu einem wichtigen Ausmaß zerstört worden. Überdies führen die seit vielen Jahrzehnten fortbestehenden instabilen Kräfteverhältnisse zu einer nur kurzfristig gedachten Wirtschaftspolitik. Die hohe politische Konfliktivität spiegelt sich – ähnlich wie in Venezuela – in hoher Kapitalflucht wider (Becker 2012). Während Argentinien 2011 noch ein ausgesprochen hohes Wachstum verzeichnen konnte, so brach das Wachs-tum 2012 ein und belief sich auf nur mehr 2,2 %. Auch hierfür war ähnlich wie in Bra-silien eine Verschlechterung der Austauschbeziehungen sowie eine Reduktion privater Investitionen verantwortlich (CEPAL 2013a, S. 10–11). Um einer weiteren Verschlechte-rung der Zahlungsbilanz sowie weiterer Kapitalflucht etwas entgegenzusetzen, ergriff die Regierung zuletzt immer schärfere administrative Maßnahmen der Devisenkontrollen. Die pro-industrielle und interventionistische Ausrichtung der Wirtschaftspolitik werden vor allem von Sektoren um den agro-industriellen Sektor herum, aber auch von Teilen der großstädtischen Mittelschicht angegriffen. (Wirtschafts-)Politisch ist ein Ausschlagen des Pendels in die Gegenrichtung nicht auszuschließen, was ganz in der Kontinuität der dis-kontinuierlichen Wirtschaftsgeschichte Argentiniens wäre (Curia 2011).
3.3 Die Andenländer: Krisenbetroffenheit durch Rohstoffexportorientierung
In der Gruppe der rohstoffexportierenden Andenländer erfolgten die Transmission der Krise und der anschließende Aufschwung vor allem vermittelt über die Rohstoffpreise. Ab Mitte 2008 brachen die Preise für mineralische Rohstoffe, Metalle aber auch für Agrarprodukte schlagartig ein. Zum Teil reduzierten sich diese innerhalb von zwei bis drei Quartalen um mehr als die Hälfte und fielen damit auf die Werte von 2005 bzw. 2006 zurück. Damit lagen sie aber noch deutlich über den Werten von 2002 zu Beginn der Rohstoffhausse (CEPAL 2012, S. 29). Die Reduktion der Rohstoffpreise war eine Folge

Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität? 153
des Nachfragerückgangs in der Krise im Zuge des Einbruchs der Industrieproduktion im Norden. Gleichzeitig wurde die Preisentwicklung jedoch auch von Spekulation getrieben. Bereits 2009 verzeichneten Rohstoffpreise wieder einen starken Anstieg. Rohstofffonds erlebten einen Boom, da sie als sicherer Anlagehafen galten. Bedeutend war auch die steigende Nachfrage aus China (Švihlíková 2011, CEPAL 2011b, S. 13). Gleichzeitig führte diese höhere Nachfrage auch zu Preissteigerungseffekten vor allem bei metalli-schen und mineralischen Rohstoffen und bei Erdöl (Jenkins 2011, S. 90). Die Exporte nach China waren jedoch nicht für alle Rohstoffe und damit für alle Länder in Lateiname-rika gleichbedeutend. Es waren vor allem mineralische Rohstoffe, Erdöl und Soja. Damit konnten vor allem die Andenländer aber auch Brasilien profitieren. Die Krise fiel daher 2009 nicht so tief aus. Vielmehr kam es ab dem zweiten Quartal 2009 zu einem neuer-lichen Preisanstieg, der jedoch nur von kurzer Dauer war (Abb. 1). Die Preise erreichten 2011 eine ähnliche Höhe wie knapp vor Ausbruch der Krise im Jahr 2008. Es war vor allem dieser Rohstoffboom, der spekulative Kapitalzuflüsse in die betroffenen Länder anregte. Ende des ersten Quartals 2011 begann die Preise jedoch wieder deutlich, wenn auch nicht abrupt zu sinken. Eine Tendenz, die sich bis heute fortsetzt, auch wenn das Preisniveau nach wie vor als relativ hoch einzuschätzen ist (CEPAL 2012, S. 29). Damit ging auch eine Abschwächung des Wachstums in Lateinamerika ab 2011 einher. Eine weitere deutliche oder gar abrupte Reduktion der Rohstoffpreise könnte nicht nur über die Reduktion der Exporterlöse, sondern auch über eine Umkehrung der Kapitalzuflüsse in Kapitalabflüsse sehr negative Konsequenzen für die betroffen Länder nach sich ziehen (Akyüz 2011).
Besonders deutlich zeigt sich der Zusammenhang zwischen Wachstum und Rohstoff-preisentwicklung im Fall von Venezuela. Es war das lateinamerikanische Land, das nach Mexiko am zweitstärksten von der Krise betroffen war. Der Rückgang des BIP betrug 2009 3,2 %. 2010 schrumpfte das BIP um weitere 1,5 % (CEPAL 2013a, S. 52). Dies hing mit dem rapiden Verfall der Erdölpreise zusammen. Währungspolitisch wurde rela-tiv spät auf diese Entwicklung reagiert. Erst 2010 erfolgte eine deutliche Abwertung und damit eine Korrektur der Währungsüberbewertung. Für einen Zeitraum von knapp einem Jahr wurde überdies ein gespaltener Wechselkurs beibehalten, der den Import von Grund-nahrungsmitteln und Investitionsgütern nach wie vor zu einem präferenziellen Wechsel-
Abb. 1: Rohstoffpreise, 2000–2013. (Quelle: IMF 2013)

154 J. Becker et al.
kurs erlaubte (Görgl et al. 2011). Die relative hohe Inflationsrate führte allerdings rasch wieder zu einer realen Aufwertung der venezolanischen Währung, so dass Anfang 2013 eine erneute starke Abwertung erforderlich wurde (O.V. 2013). Fiskalpolitisch wurde ver-sucht, über ein Budgetdefizit von 5 % im Krisenjahr 2009 und etwas geringer in den Folgejahren die Wirtschaft zu stabilisieren. Jedoch war es vor allem die Reduktion der erdölabhängigen Staatseinnahmen, die dieses Defizit verursacht hatte. Diese gingen von 24,9 % des BIP 2008 auf 19,7 % des BIP im Jahr 2010 zurück (CEPAL 2010, S. 90). Die Staatsschulden beliefen sich Ende 2012 auf 21,4 % des BIP. Der folgende Anstieg der Erdölpreise ging mit Wachstumsraten von 4,2 % 2011 und 5,3 % im Jahre 2012 einher (CEPAL 2013a, S. 52; 80). Damit zeigt sich, dass in Venezuela schon ein relativ kur-zer, wenn auch drastischer Preiseinbruch des Erdölpreises, relativ starke Auswirkungen auf die Staatsfinanzen hat. Längerfristige massive Preisreduktionen würden wohl eine längerfristige Kontraktion mit sich ziehen und angesichts der erdölabhängigen Einnah-menstruktur auch dämpfend auf die Staatsausgaben wirken. Damit ist indirekt auch die Sozialpolitik von der Entwicklung des Erdölpreises abhängig. Achillessehne des Modells bleiben überdies die nach wie vor sehr hohe Kapitalflucht und die steigende Auslandsver-schuldung. Der jährliche Nettoressourcenabfluss belief sich zuletzt 2012 auf über 28 Mrd. USD. Im Zeitraum zwischen 2008 und 2012 erhöhten sich die Auslandsschulden von 54 Mrd. USD auf 101 Mrd. USD. Vor dem Hintergrund der weitgehend stabilen Staats-schuldenentwicklung deutet dies darauf hin, dass hier auch die private Verschuldung trotz Kapitalverkehrskontrollen stark stieg, was sich aus dem durch hohe Nominalzinsen ergebenden beträchtlichen Zinsdifferential ergibt. Überdies kann die Verzehnfachung der Börsenwerte zwischen 2008 und 2012 als ein deutlicher Hinweis auf vorliegende Finanz-ialisierungtendenzen gewertet werden (CEPAL 2013a, S. 60–64). Gleichzeitig hat die Regierung Chávez nach einer ersten Nationalisierungswelle auch in der Krise die staat-liche Kontrolle über wirtschaftliche Schlüsselsektoren ausgeweitet (Ellner 2012, S. 18). Nach dem Tod Chávez’ Anfang 2013 steht das chavistische Projekt vor der Herausforde-rung sowohl einer wirtschaftlichen Diversifizierung als auch einer verstärkten Institutio-nalisierung. Der Wahlsieg von Maduro, dem Nachfolger Chávez‘, im April 2013 war mit 50,75 % gegenüber dem Vertreter der Rechten, Capriles, mit 48,97 %, unerwartet knapp. Im Vergleich zu den wenige Monate zuvor von Chávez gewonnenen Präsidentschafts-wahlen wanderten ca. 700.000 WählerInnen von der Linken zur Rechten (Herrera 2013, S. 58). Dies zeigt Grenzen der Institutionalisierung des Chavismus auf. Dieser ist zudem eine sozial und politisch durchaus ausdifferenzierte Bewegung, die von der städtischen Marginalbevölkerung, über einige linke Mittelschichtssektoren bis hin zu einigen pro-chavistischen Kapitalgruppen, der sogenannten „Boliburguesía“ reicht (Burbach et al. 2013, S. 71; Ellner 2008, Kap. 6). Wilpert (2013, S. 21) sieht es für die politische Zukunft des chavistischen Projektes als essenziell an, dass der neue Staatspräsident die „Schlüs-selsektoren“ des Chavismus, für ihn die chavistischen Sektoren der Zivilgesellschaft, des Militärs und der Industrie (vor allem die staatliche Ölindustrie), zusammenhält. Die militant-rechte Opposition sucht in diese, speziell das Militär, einen Keil zu treiben. Sie genießt das offensichtliche Wohlwollen der Regierung in Washington (Herrera 2013, S. 59). Der erneut zugespitzte politische Konflikt in Venezuela hat Bedeutung weit über das Land hinaus für den gesamten Sub-Kontinent, sind doch die Veränderungen in den

Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität? 155
Eigentumsstrukturen und politischen Partizipationsformen in diesem Land besonders weit vorangetrieben worden.
Chile zeigte sich in der Krise ökonomisch stabiler. Einerseits trug dazu die zumindest im Vergleich zu Venezuela doch deutlich differenziertere Exportstruktur bei. Anderer-seits spielt der staatliche Stabilisierungsfonds, der aus den Kupfererlösen gespeist wurde, eine wichtige Rolle. Entsprechend wurde auch fiskalisch 2009 deutlich gegensteuert. Die Krise fiel mit einem Rückgang des BIP um 1 % relativ mild aus. Im Unterschied zu Venezuela waren die Staatseinnahmen insgesamt auch deutlich weniger von Rohstoffen abhängig. Vielmehr waren allgemeine Steuereinnahmen von größerer Bedeutung. Dies bedeutet jedoch auch, dass im Unterschied zu Venezuela nur ein wesentlich geringerer Teil der Rohstoffrente abgeschöpft und entsprechend eine Umverteilung der Rente in kleinerem Ausmaß vorgenommen wurde. Die Privatisierung der Schürfrechte in den 1990er und 2000er Jahren erhöhte den Anteil ausländischen Eigentums in diesem Sektor drastisch. Dies führte nicht nur zu einer Reduktion der potenziellen Einnahmen, sondern verschärfte zudem die Problematik des strukturellen Kapitalabflusses (Riesco 2008; Jäger und Leubolt 2014; CEPAL 2013a, S. 60; 78–80). Während es in der Krise zu Kapital-abflüssen aus Chile gekommen war, kam es 2011 neuerlich zu erheblichen Kapitalzu-flüssen. Durch den Aufbau von Währungsreserven wurde versucht, diese zu sterilisieren und die Auswirkungen auf den Wechselkurs zu dämpfen. Das Wirtschaftswachstum war 2012 mit 5,5 % nach wie vor relativ hoch. Wesentlich dafür war die relative Stabilität der Exportpreise, die durch eine entsprechende Entwicklung des Wechselkurses begünstigt wurde. Die Auslandsschulden stiegen jedoch 2009 und 2010 sehr stark und erhöhten sich insgesamt von 64 Mrd. USD 2008 auf 105 Mrd. 2012. Die Staatsschulden sind allerdings ausgesprochen niedrig, was gewisse Spielräume schafft, um zukünftigen Abschwüngen entgegenzuwirken (CEPAL 2013a, S. 52–58; 62). Dennoch bleibt durch die von Roh-stoffen und Agrarprodukten gekennzeichnete Exportstruktur und damit das chilenische Modell für Preisschwankungen am Weltmarkt sehr anfällig. Trotz potenzieller Instabilitä-ten und der extremen sozialen Ungleichheit ist mittelfristig jedoch nicht von einer Abkehr von diesem Wirtschaftsmodell auszugehen. Es wird nach wie vor von etablierten aber vielfach delegitimierten politischen Parteien im Rahmen einer neoliberalen Verfassung abgesichert. Die erstarkenden sozialen Proteste konnten bislang keine nennenswerte Ver-änderung der Kräfteverhältnisse erreichen.
3.4 Veränderung der außenwirtschaftlichen Verflechtung Lateinamerikas
Außenwirtschaftlich und politisch zeigten sich in den letzten zehn Jahren deutliche Ver-änderungen: Der Anteil Chinas an den lateinamerikanischen Exporten hatte bereits in der Vorkrisenzeit deutlich zugenommen. Ebenso stiegen auch die Importe aus China. Diese Tendenz wurde durch die Krise nochmals deutlich verstärkt. China wurde damit im Ver-gleich zu den USA und Europa für Lateinamerika immer wichtiger. Gleichzeitig lässt die Struktur des Handels ein traditionelles Nord-Süd-Muster erkennen. Während Latein-amerika Rohstoffe exportierte, wurden aus China Industrieprodukte importiert (Gallag-her und Porzecanski 2010). Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die bedeutendste Destination für Exporte aus Lateinamerika nach wie vor mit Abstand die USA sind, wenn auch regional wichtige Unterschiede bestehen. Während Mexiko oder

156 J. Becker et al.
Venezuela vor allem in die USA exportierten, war für Länder wie Chile mit dem Haupt-exportgut Kupfer bereits China der wichtigste Abnehmer. Aber auch der inter-lateiname-rikanische Handel gewann deutlich an Gewicht. Gleichzeitig reduzierte sich vor allem der Anteil der lateinamerikanischen Exporte nach Europa. Besonders drastisch war der Einbruch des brasilianischen Exportvolumens nach Europa, welches sich im Krisenjahr 2009 um 40 % reduzierte, dann zwar wieder stieg, aber noch bei weitem nicht das Vor-krisenniveau erreichte und 2012 wieder leicht negative Entwicklungen aufwies (CEPAL 2012, S. 30–31). Dieser – nicht zuletzt der europäischen Krise geschuldete – Trend wird begleitet von zunehmenden ökonomischen Verflechtungen innerhalb Lateinamerikas, die maßgeblich von Brasilien vorangetrieben werden. Allerdings weist der intra-regionale Handel in Südamerika erhebliche Schwankungen auf. So lag der intra-regionale Han-delsanteil bei den Mercosur-Ländern mit 13,8 % in den Jahren 2005–2007 deutlich unter dem Anteil von 21,9 % in den Jahren 1994–1997 (Gómez-Mera 2012, S. 24). Während 2010 und 2011 der Handel innerhalb Lateinamerikas insgesamt um 27,5 % bzw. 23,6 % gestiegen war, so stieg er zuletzt 2012 nur um 1,4 % (CEPAL 2013b, S. 4). Auf politischer Ebene ist die Kooperation in Südamerika deutlich gestärkt geworden. Eine Neuausrich-tung der ursprünglich liberal konzipierten regionalen Integration, speziell des Mercosur, ist allerdings bislang nicht erfolgt (Becker 2008, S. 39–42). Zudem führt die dominante Rolle Brasiliens, das gleichzeitig die Beziehung zu den anderen BRICS-Ländern forciert, zu Spannungen (Gómez-Mera 2012, S. 21). Zukünftige Entwicklungen müssen abgewar-tet werden, um abschätzen zu können, ob es sich hierbei um das bloße Erstarken eines brasilianischen Sub-Imperialismus (Campos 2009) oder einen Impuls für die Stärkung Lateinamerikas gegenüber den internationalen Hegemonialmächten handelt.
4 Schlussfolgerungen und Ausblick
Lateinamerika wurde in den letzten Jahrzehnten regelmäßig von Krisen erfasst. Die hier getroffene Unterscheidung zwischen produktiven und finanzialisierten Wachstumsmo-dellen stellte sich als zentral für die Einschätzung von Wachstumsdynamik und Stabili-tät heraus. Trotz des vor allem durch einen 2002 einsetzenden Rohstoffpreisbooms war es gelungen, Finanzialisierungsprozesse zu begrenzen und zum Teil sogar eine Binnen-orientierung zu stärken, womit es tendenziell auch zu einer Reduktion der Ungleichheit kam. Ebenso wurden Maßnahmen ergriffen, um gegen spekulative Kapitalflüsse besser gewappnet zu sein. Für alle diese Maßnahmen war ein höherer Grad an Autonomie in der Wirtschaftspolitik – insbesondere die Unabhängigkeit von Krediten des IWF und dessem wirtschaftspolitischen Diktat – entscheidend. Damit wurde in der Krise 2009 fiskalpolitisch in der Regel dezidiert gegen den Einbruch des Wachstums interveniert. Eine neuerlich einsetzende Hausse der Rohstoffpreise begünstigte die Trendumkehr und Lateinamerika zeigte ab 2010 wieder sehr hohe Wachstumsraten, die sich allerdings 2012 deutlich abschwächten. Die CEPAL (2012, S. 8, 22–29; 40–46) geht davon aus, dass Lateinamerika trotz potenzieller Risiken und einem globalen ökonomischen Abwärts-trend im Vergleich zu den USA und Europa mittelfristig deutlich höhere Wachstumsraten aufweisen wird. Begründet wird dies nicht zuletzt auch mit dem Hinweis auf ausrei-chende fiskalische Spielräume in den meisten Ländern die für die Bekämpfung eines

Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität? 157
weiteren Abschwungs zur Verfügung stehen. Risiken sind vor allem durch den Export-kanal aber auch über den Finanzsektor gegeben. Der Versuch, Finanzialisierungsprozesse weitgehend zu vermeiden, dürfte sich positiv auf die weitere Stabilität auswirken. Eine noch deutlich stärkere und dauerhafte Kontrolle des grenzüberschreitenden Kapitalver-kehrs wäre für die Stabilität in peripheren Ländern zentral (Akyüz 2011). Zusätzlich sind auch Maßnahmen zur Eindämmung destabilisierender Rohstoffpreisspekulation, wie sich in den 1970er Jahren noch intensiv diskutiert worden waren, wichtig (UNCTAD und Arbeiterkammer Wien 2011). Die Durchsetzung derartiger Maßnahmen auf internationa-ler Ebene scheint zumindest mittelfristig jedoch nicht sehr realistisch. Länder wie Vene-zuela oder auch Chile haben daher eigene Stabilisierungsfonds eingerichtet, die es ihnen erlauben, Reserven, die in Perioden hoher Rohstoffpreise angehäuft werden, in Zeiten von Preiseinbrüchen zur Stabilisierung zu verwenden. Die Handelsbilanz ist zwar in den meisten lateinamerikanischen Ländern positiv. Weit weniger gilt dies – speziell in den letzten Jahren – für die Leistungsbilanz. Bei der Leistungsbilanz schlagen deutlich stei-gende Gewinnrepatriierungen negativ zu Buche, die aus den hohen Auslandsinvestitio-nen in Lateinamerika resultieren (Salama 2012, S. 107). Nur vereinzelt gibt es Tendenzen zu einer Renationalisierung der Eigentumsstrukturen (v. a. in Venezuela), die Mehrheit der Mitte-Links-Regierungen bleibt jedoch auf ausländische Direktinvestitionen – trotz des damit verbundenen Kontrollverlustes und der steigenden Gewinnrepatriierungen – orientiert. Generell wären eine stärkere Binnenorientierung sowie eine stärkere Orientie-rung auf den regionalen lateinamerikanischen Markt strategisch wichtig. Dies würde eine Verringerung der Außen- und Rohstoffabhängigkeit bedeuten und könnte von deutlichen umverteilenden Politiken wie höheren Mindestlöhnen etc. begleitet sein. Möglicherweise könnte eine neuerliche deutliche Abkühlung der Weltkonjunktur den Anstoß für stärker binnenorientierte Entwicklungsmodelle und vertiefte lateinamerikanische Integration bieten.
Literatur
Akyüz, Y. (2011). Capital flows to developing countries in a historical perspective: Will the current boom end with a bust? South Centre, Research Paper 37.
Arrighi, G. (1994). The long twentieth century. Money, power, and the origins of our times. London: Verso.
Becker, J. (2002). Akkumulation, Regulation, Territorium. Zur kritischen Rekonstruktion der fran-zösischen Regulationstheorie. Marburg: Metropolis.
Becker, J. (2008). Crisis financieras e integración regional: el caso del MERCOSUR. Ciclos, 17(33/34), 19–49.
Becker, J. (2010). Crisis financieras en los noventa y sus salidas: Argentina, Brasil y Uruguay en comparación. Indicadores Econômicos FEE, 37(4), 121–141.
Becker, J. (2012). Lateinamerika und die globale Krise: Verwundbarkeiten, Dynamiken, Gegenstra-tegien. In I. Lesay & B. Leubolt (Hrsg.), Lateinamerika nach der Krise: Entwicklungsmodelle und Verteilungsfragen (S. 35–54). Wien: LIT.
Becker, J., & Jäger, J. (2005). Geld und Legitimität. Monetäre Strategien in Argentinien, Uruguay und Brasilien. In D. Boris, S. Schmalz, & A. Tittor (Hrsg.), Lateinamerika: Verfall neolibera-ler Hegemonie? (S. 87–111). Hamburg: VSA.

158 J. Becker et al.
Becker, J., Jäger, J., Leubolt, B., & Weissenbacher, R. (2010). Peripheral Financialization and Vul-nerability to Crisis: A Regulationist Perspective. Competition & Change, 14(3–4), 225–247.
Boris, D., Gerstenlauer, Th., Jenns, A., Schank, K., & Schulten, J. (2008). Sozialstrukturtendenzen und politische Artikulation in Lateinamerika. Schlussfolgerungen, Thesen, Reflektionen. In D. Boris, Th. Gerstenlaufer, A. Jenns, K. Schank, & J. Schulten (Hrsg.), Sozialstrukturen in Lateinamerika. Ein Überblick (S. 317–335). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Boyer, R., & Saillard, Y. (Hrsg.). (1995). Théorie de la régulation: L’état des savoirs. Paris: La Découverte.
Burbach, R., Fox, M., & Fuentes, F. (2013). Latin America’s Turbulent Transitions. The Future of Twenty-First-Century Socialism. London: Zed Books.
Campos, P. H. P. (2009). O imperialismo brasileiro nos séculos XX e XXI: uma discussão teó-rica. XII Annual Conference of the International Association of Critical Realism, Universidade Federal Fluminense Niterói, Brasil.
Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1976). Abhängigkeit und Entwicklung in Lateinamerika. Frankfurt: Suhrkamp.
Castellani, A., & Schorr, M. (2004). Argentina: convertibilidad, crisis de acumulación y disputas en el interior del bloque de poder económico. Cuadernos del Cendes, 21(57), tercera época, 55–81.
CEPAL. (2010a). Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. Crisis originada en el centro y recuperación impulsada por las economías emergentes. Santiago de Chile: CEPAL.
CEPAL. (2011a). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2010. San-tiago de Chile: CEPAL.
CEPAL. (2011b). La República Popular China y América Latina y el Caribe. Hacia una nueva fase en el vínculo económico y comercial. Santiago de Chile: CEPAL.
CEPAL. (2012). La crisis financiera internacional y sus repercusiones en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL.
CEPAL. (2013a). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2012. San-tiago de Chile: CEPAL.
CEPAL. (2013b). Comercio exterior de bienes en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Boltin Estadístico No. 10.
Correa, J. A., & Jäger, J. (2007). Sistema financiero, regulación y crisis: La experiencia chilena. In J. Becker (Hrsg.), El golpe del capital. Las crisis financieras en el Cono Sur y sus salidas (S. 137–152), Montevideo: Coscoroba.
Curia, E. L. (2011). El modelo de desarrollo en Argentina. Los riesgos de una dinámica pendular. Buenos Aires: FCE.
Diniz, E., & Boschi, R. R. (2007). A difícil rota do desenvolvimento. Empresários e a Agenda Pós-Neoliberal. Belo Horizonte: Editora UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJ.
Dussel Peters, E. (2009). The Mexican case. In R. Jenkin & E. Dussel Peters (Hrsg.), China and Latin America. Economic relations in the twenty-first century (S. 279–394). Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.
Ellner, S. (2008). Rethinking Venezuelan Politics. Class, Conflict and the Chávez Phenomenon. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
Ellner, S. (2012). Au Venezuela, un chavisme sans Chávez? Le Monde diplomatique, 59(702), 18–19.
Farhi, M., & Cintra, M. A. M. (2009). Crisis financiera internacional: contagio y respuestas regula-torias. Nueva Sociedad, 224, 104–127.
Faria, L. A. E. (2010). Política econômica e crescimento no Brasil de Lula. Indicadores Econômi-cos FEE, 37(4), 163–188.

Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität? 159
Ffrench-Davis, R., Muñoz, Ó., & Palma, J. G. (1997). Las economías latinoamericanas, 1950–1990. In T. Halperín Donghi et al. (Hrsg.), História económica de América Latina. Desde la independencia a nuestros días (S. 323–401). Barcelona: Editorial Critica.
Gallagher, K. P., & Porzecanski, R. (2010). The Dragon in the Room. China & and the Future of Latin American Industrialization. Stanford: University Press.
Gómez-Mera, C. (2012). Latin American economic integration: causes and consequences of regime complexity. In A. Najam & R. Thrasher (Hrsg.), The future of South-South economic relations (S. 11–33). London: Zed Books.
Görgl, D., Imhof, K., Jäger, J., & Leubolt, B. (2011). Transformation monetärer Restriktionen: Nationale Strategien und regionale Kooperation in Lateinamerika. Journal für Entwicklungs-politik, 27(2), 67–91.
Gowan, P. (1999). The global gamble. Washington’s Faustian bid for world dominance. London: Verso.
Gudynas, E. (2010). Si eres tan progresista ¿Por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas. Ecuador Debate, 79, 61–81.
Griffith-Jones, S., & Cailloux, J. (1997). Nuevos flujos de capitales europeos hacia América Latina. Ciclos, 7(13), 67–107.
Herrera, R. (2013). La révolution continue avec Maduro. Afrique Asie, Mai, 58–59.IMF. (2013). Charts. Indices of primary commodity prices, 2000–2013. http://www.imf.org/exter-
nal/np/res/commod/Charts.pdf. Zugegriffen: 19. März 2013.Jäger, J., & Küblböck, K. (2011). Entwicklungsfinanzierung im Umbruch – Entwicklungsstaaten
im Aufbruch? Journal für Entwicklungspolitik, 27(2), 4–27.Jäger, J., & Leubolt, B. (2013). Rohstoffe und Entwicklungsstrategien in Lateinamerika. In S.
Claar, C. May, & A. Nölke (Hrsg.), (Wieder-)Aufstieg des Globalen Südens. Hamburg. VS Verlag für Sozialwissenschaften. i.E.
Jenkins, R. (2011). El „efecto china“ en los precios de los productos básicos y en el valor de las exportaciones de América Latina. Revista de la Cepal, 103, 77–93.
Jessop, B., & Sum, N.-L. (2006). Beyond the regulation approach: Putting capitalist economies in their place. Cheltenham. Edward Elgar.
Leubolt, B. (2013). „Entwicklungsstaat“ statt „Hühnerflug“? Bürger im Staat, 1/2–2013, 13–22.Livingstone, G. (2011). The United States of America and the Latin American right. In F. Domin-
guez, G. Lievesley, & S. Ludlam (Hrsg.), Right-wing politics in the New Latin America (S. 26–43). London: Zed Books.
Moreno-Brid, J. C. (2009). La economía mexicana frente a la crisis internacional. Nueva Sociedad, 220, 60–83.
Musacchio, A. (2012). Her mit der Kohle! Wandel und Rückwandel des argentinischen Renten-systems. Kurswechsel, 4, 19–26.
Novy, A. (2008). Die Rückkehr des Entwicklungsstaates in Brasilien. Das Argument, 50(276), 361–373.
Ocampo, J. A. (2009). La crisis económica global: impactos e implicaciones para América Latina. Nueva Sociedad, 224, 48–66.
O.V. (2013). Maduro devaluó el bolívar. www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elmundo/4- 213531-2013-02-09.html. Zugegriffen: 9. Feb. 2013.
Pimmer, S. (2010). Neun Jahre PAN-Regierung in Mexiko: von der passiven Revolution zur Krise der Hegemonie. Journal für Entwicklungspolitik, 26(1), 12–41.
Raza, W. G. (2000). Desarrollo sostenible en la periferia neoliberal: una mirada a Bolivia desde afuera. La Paz: Plural Editores.
Riesco, M. (2008). Acerca de „Rentas Mineras y Desarrollo Social en Chile“. Santiago de Chile: CENDA.
Salama, P. (2012). Les économies émergentes latino-américaines. Entre cigales et fourmis. Paris: Armand Colin.

160 J. Becker et al.
Schmalz, S. (2008). Brasilien in der Weltwirtschaft. Die Regierung Lula und die neue Süd-Süd-Ko-operation. Münster: Westfälisches Dampfboot.
Schmalz, S., & Ebenau, M. (2011). Auf dem Sprung – Brasilien, Indien und China. Zur gesell-schaftlichen Transformation in der Krise. Berlin: Karl Dietz.
Schorr, M. (2012). Argentina: ¿nuevo modelo o „viento de cola“? Nueva Sociedad, 237, 114–127.Schvarzer, J. (2003). Convertibilidad y deuda externa. Buenos Aires: Editorial Universidad de Bue-
nos Aires.Singer, A. (2009). Raizes sociais e ideológicas do Lulismo. Novos Estudos Cebrap, 85, 83–102.Stefanoni, P. (2012). Posneoliberalismo cuesta arriba. Los modelos de Venezuela, Bolivia y Ecua-
dor en debate. Nueva Sociedad, 239, 51–64.Svampa, M. (2012). Resource Extractivism and Alternatives: Latin American Perspectives on
Development. Journal für Entwicklungspolitik, 28(3), 43–73.Švihlíková, I. (2011). Die Rolle der Spekulation bei der Entwicklung der Rohstoff- und Nahrungs-
mittelpreise. Kurswechsel, 3, 7–18.Tsolakis, A. (2011). Multilateral lines of conflict in contemporary Bolivia. In F. Dominguez, G.
Lievesley, & S. Ludlam (Hrsg.), Right-wing politics in the New Latin America (S. 130–147). London: Zed Books.
UNCTAD & Arbeiterkammer Wien. (2011). Price formation in financialised commodity markets: the role of information. New York/Genf: UNCTAD.
Wilpert, G. (2013). Scénarios pour l’avenir du mouvement bolivarien. Le Monde diplomatique, 60(709), 20–21.