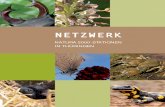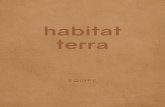EU-Richtlinie Fauna-Flora-Habitat: Umsetzungsprobleme und Erklärungsansätze
Transcript of EU-Richtlinie Fauna-Flora-Habitat: Umsetzungsprobleme und Erklärungsansätze

This article was downloaded by: [Tufts University]On: 17 October 2014, At: 14:43Publisher: RoutledgeInforma Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41Mortimer Street, London W1T 3JH, UK
disP - The Planning ReviewPublication details, including instructions for authors and subscription information:http://www.tandfonline.com/loi/rdsp20
EU-Richtlinie Fauna-Flora-Habitat: Umsetzungsprobleme undErklärungsansätzeDr. Tobias Chilla aa Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geografischen Institut der Universität zu KölnPublished online: 01 Nov 2012.
To cite this article: Dr. Tobias Chilla (2005) EU-Richtlinie Fauna-Flora-Habitat: Umsetzungsprobleme und Erklärungsansätze, disP - ThePlanning Review, 41:163, 28-35, DOI: 10.1080/02513625.2005.10556938
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/02513625.2005.10556938
PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE
Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in thepublications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations orwarranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinionsand views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsedby Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified withprimary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings,demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectlyin connection with, in relation to or arising out of the use of the Content.
This article may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction,redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expresslyforbidden. Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions

28 disP 163 · 4/2005 EU-Richtlinie Fauna-Flora-Habitat: Umsetzungsprobleme und ErklärungsansätzeTobias Chilla
Dr. Tobias Chilla ist Wissenschaft-licher Mitarbeiter am Geografi -schen Institut der Universität zu Köln.
Abstract: The Habitats Directive of the Euro-pean Council was adopted in 1992 and aims to protect wild fauna and fl ora as well as to con-serve their habitats on a transboundary Euro-pean scale. Jointly with the areas of the 1979 Bird Protection Directive, the selected areas will make up the Natura 2000 Network, which is the most important outcome of the European bio-diversity policy.The site selection process is now being brought to an end in most member states of the Euro-pean Union. In most countries, including Ger-many, the implementation was characterized by delays and confl icts, especially on the local and regional levels. This gives reason to analyze the process of implementation of this directive in retrospective. The article at hand discusses the explanations of the respective literature (e.g., openness of the directive, its tight schedule, the practices of participation). Subsequently, the question is raised if explanations other than technical or institutional may contribute to the understanding of these space-related confl icts. Both nature and space are not only material en-tities, but also communicated, negotiated and thereby socially constructed categories.
1. FFH-Richtlinie
Bereits im Mai 1992 verabschiedete der Mi-nisterrat der Europäischen Union einstimmig
die Richtlinie zum Schutz von Fauna, Flora und Habitaten, deren Ziel der europaweite und grenzüberschreitende Schutz der Artenvielfalt ist (im Folgenden FFH-Richtlinie; Rat der Eu-ropäischen Gemeinschaften 1992). Die gemäss dieser Richtlinie ausgewiesenen Areale wer-den gemeinsam mit den Gebieten der Vogel-schutzrichtlinie (Rat der Europäischen Gemein-schaften 1979) ein kohärentes Netz geschützter Gebiete mit der Bezeichnung NATURA 2000 bilden, das den Kern der europäischen Natur-schutzpolitik darstellt.
Europaweit ist die Umsetzung der FFH-Richt-linie jedoch mit vielfältigen Problemen einher-gegangen: Der vorgegebene Zeitplan der Richt-linie wurde weithin verfehlt, zudem wurde der Prozess durch vielfältige Konfl ikte insbesondere auf regionaler und lokaler Ebene geprägt.
In Deutschland kommt in diesen Monaten nun der Prozess der Gebietsauswahl zum Ab-schluss. Dies erscheint als guter Zeitpunkt, eine Zwischenbilanz der bisherigen Umsetzungspra-xis zu ziehen: Der folgende Beitrag gibt auf Ba-sis der einschlägigen Literatur einen Überblick über die bisherige Implementationsgeschichte und stellt vor diesem Hintergrund die bislang formulierten Erklärungsversuche zur Diskus-sion. Abschliessend wird die Frage aufgewor-fen, inwiefern über die institutionellen Zusam-menhänge hinaus auch spezifi sch inhaltlichen Aspekten der FFH-Richtlinie eine Bedeutung zukommt.
Abb. 1: Die Verzögerungen des FFH-Prozesses in Deutschland.(Eigener Entwurf; vgl. Kehrein 2002: 4; Leibenath 2003: 7)
1992 ‘95 ‘98‘93 ‘94 ‘96 ‘97 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05
Umsetzungin nationales
Recht
Bewertung derListen und
Festlegung durchdie Kommission
Aufstellung vonVorschlagslisten
durch dieMitgliedsstaaten
Ausweisung der Schutzgebiete durchdie Mitgliedsstaaten
Zeitplander FFH-Richtlinie
Ausweisung derSchutzgebiete
Aufstellung der nationalen Vorschlagslisten(in diversen Tranchen durch die Bundesländer)
Tatsächlich erfolgteUmsetzung
in Deutschland
Umsetzung der RLin nationales Rechtdurch Novellierung
BNatSchG
Gemein-schaftliche
Bewertung
Dow
nloa
ded
by [
Tuf
ts U
nive
rsity
] at
14:
43 1
7 O
ctob
er 2
014

disP 163 · 4/2005 291.1 Die Umsetzung in Deutschland
Gemäss dem Zeitplan der FFH-Richtlinie sollte deren Umsetzung in nationales Recht bis Mai 1994 erfolgen. Bis Mai 1995 war die Erarbeitung der Gebietslisten der jeweiligen Nationalstaaten vorgesehen, die auf Basis der Richtlinien-An-hänge nach naturschutzfachlichen Kriterien zu erstellen sind (s. Abb. 1). Bis Mai 1998 sollten diese nationalen Listen auf EU-Ebene bewertet werden, wonach – wiederum unter nationaler Regie – diese Gebiete bis Mai 2004 unter Schutz zu stellen waren. Langfristige Berichts- und Mo-nitoringpfl ichten sollen sodann die Schutzziele der Richtlinie sichern.
Der Zeitplan der Richtlinie wurde jedoch nicht eingehalten – für Deutschland lässt sich die Umsetzungschronologie folgendermas-sen zusammenfassen: Die Umsetzung in na-tionales Recht erfolgte erst mit der Novellie-rung des Bundesnaturschutzgesetzes 1998, dem eine Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof vorangegangen war (Gellermann 2001: 138). Die Erarbeitung der Gebietslisten erfolgt in Deutschland, da hier Naturschutz der Rahmengesetzgebung untersteht, durch die Länder. Diese sind durchweg verspätet und zu-meist in mehreren Tranchen den Anforderun-gen der Richtlinie gefolgt. Auf Grund dieser Verspätungen ist Deutschland im September 2001 ein zweites Mal vom Europäischen Ge-richtshof verurteilt worden (vgl. Kehrein 2002). In so genannten Bewertungsseminaren hat die Kommission zu den inzwischen erarbeiteten na-tionalen Gebietslisten Stellung genommen und konkrete Defi zite benannt. Im Januar 2004 fand dann ein bilaterales Treffen zwischen EU-Kom-mission und Vertretern von Bund und Ländern statt. Auf diesem Treffen wurde der abschlies-sende Klärungsbedarf defi niert, sodass sowohl das Verfahren zur Gebietsauswahl als auch die gemeinschaftliche Bewertung nun im Wesentli-chen abgeschlossen sind (BMU 2004).
Eine zentrale Funktion im Schutzregime der FFH-Richtlinie übernimmt die so genannte FFH-Verträglichkeitsprüfung, die über die Zu-lässigkeit so genannter erheblicher Eingriffe ent-scheidet. Im Zuge dieses Prüfverfahrens wer-den die erwartbaren Beeinträchtigungen durch projektierte Vorhaben mit den Schutzzielen der Richtlinie abgewogen. Bei überwiegendem In-teresse können die Vorhaben – gegebenenfalls unter der Aufl age bestimmter Ausgleichsmass-nahmen – gestattet werden. Obwohl dieses Prüf-verfahren grundsätzlich erst mit abschliessen-der Unterschutzstellung erforderlich wird, ist diesem Instrument bereits in dem unerwartet
langen Prozess der Gebietsausweisung einige Bedeutung zugekommen, indem von der Recht-sprechung die Kategorie der «potenziellen FFH-Gebiete» entwickelt wurde. Diese sind zwar noch nicht offi ziell als FFH-Gebiete gemeldet, müssen aus naturschutzfachlichen Gründen vo-raussichtlich jedoch unter dieses Schutz regime gestellt werden, sodass bereits im Vorfeld ein so genanntes Verschlechterungsverbot gilt. Vor diesem Hintergrund haben zahlreiche Pla-nungsträger eine «freiwillige» Verträglichkeits-prüfung durchgeführt, um Planungssicherheit zu erlangen (vgl. Gellermann 2002).
Mit den drastischen Verspätungen in der Umsetzung gehen vielfältige Konfl ikte auf po-litischer und gesellschaftlicher Ebene einher. Insbesondere im Zuge der – parzellenscharfen – Abgrenzung der zu meldenden Gebiete ent-zündeten sich zahlreiche Konfl ikte auf lokaler und regionaler Ebene. Während Naturschutz-verbände so genannte Schattenlisten aufstell-ten und der behördliche Naturschutz sukzessive eine konkrete Methodik zur naturschutzfachli-chen Auswahl der Gebiete entwickelte, fühlten sich zahlreiche Grundstückseigentümer und Vorhabenträger vom FFH-Prozess regelrecht bedroht. Ob Agrarwirtschaft, Autobahnbau oder kommunale Bauleitplanung – Beispiele für konfl ikthafte Auseinandersetzungen in diesem Bereich lassen sich reichlich fi nden (z.B. Stoll-Kleemann 2001). Für einiges Aufsehen haben beispielsweise die Planungen zur Ostseeauto-bahn oder zur DASA-Erweiterung in das Müh-lenberger Loch gesorgt (Spreen 2005). Die nun anstehende Unterschutzstellung der genannten Gebiete wird mit weiteren juristischen und po-litischen Klärungsprozessen einhergehen (vgl. Spreen 2005).
1.2 Die Umsetzung im europäischen Vergleich
Die Implementationsgeschichte der FFH-Richt-linie stellt sich nicht nur in Deutschland pro-blematisch dar, wie ein Blick auf die erfolgten Verletzungsverfahren und Urteile zeigt (May-er 2004; Diaz 2001). Sowohl die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht als auch die fristgerechte Erstellung der Gebietslisten ist in kaum einem Mitgliedstaat reibungslos erfolgt. • Besonders Frankreich, das die Gebietsauswei-sung recht früh in Angriff genommen hat, blickt auf eine problematische Umsetzungsgeschich-te zurück. Die mit der Gebietsausweisung be-trauten staatlichen Behörden waren mit einer sich formierenden Koalition von pressure groups
Dow
nloa
ded
by [
Tuf
ts U
nive
rsity
] at
14:
43 1
7 O
ctob
er 2
014

30 disP 163 · 4/2005 aus Waldbesitzern, Bauern und Jägern konfron-tiert, die zunehmend die mediale Öffentlich-keit und Demonstrationen mit bis zu 150 000 Teilnehmern mobilisierte. Im Jahr 1996 wurde der Prozess der Gebietsausweisung von Pre-mierminister Juppé gestoppt und anschliessend mit neuen Verfahrensweisen erneut begonnen (Alphandéry/Fortier 2001; Pinton 2001; Rémy/Mongenot 2002).• In Finnland sorgte vor allem ein Hungerstreik durch betroffene Waldbesitzer für erhebliches mediales Aufsehen und letztlich für eine Anpas-sung der Gebietsauswahl (Hiedanpää 2002).• Auch aus Grossbritannien (Ledoux et al. 2000) und den Niederlanden werden erhebliche Pro-bleme berichtet (Bennett/Ligthart 2001).
Inwieweit die im Jahr 2004 beigetretenen Staaten aus den bisherigen Erfahrungen pro-fi tieren können und einer problemloseren Im-plementation entgegensehen, erscheint zu-mindest ungewiss (vgl. für Polen Fizek 2004; zur Problematik in Grenzregionen Leibenath 2003). Angesichts der bis heute zahlreichen Ver-letzungsverfahren in Bezug auf die verschiede-nen Umsetzungsstadien betrachtet auch die Eu-ropäische Kommission den Umsetzungsprozess als durchaus problematisch (European Com-mission 2004a, b).
Insgesamt also ist die Implementation der FFH-Richtlinie europaweit mit vielfältigen Ver-spätungen und Konfl ikten einhergegangen, so-dass dieser Prozess niemanden – ungeachtet der Zugehörigkeit zu Interessensgruppierun-gen – zufrieden stellen kann. Im Folgenden wird der Frage nach den Ursachen nachgegangen, indem allgemeine Erkenntnisse der Implemen-tationsforschung im Bereich der EU-Umweltpo-litik zu den Literaturberichten über den FFH-Prozess in Beziehung gesetzt werden.
2. Erklärungsansätze zur Implementationsproblematik
Gerade im Bereich der Umweltpolitik wird häufi g festgestellt, dass europäische Politik-vorgaben zögerlich, widerstrebend oder über-haupt nicht umgesetzt werden – innerhalb der EU-Forschung hat sich hier ein eigener For-schungsstrang etabliert (vgl. den Überblick bei Jordan 2002; Knill 2003: 161ff.; Weale et al. 2000: 297ff.). Ein Ausgangspunkt der Imple-mentationsproblematik ist, dass auf EU-Ebene zahlreiche und zugleich politisch sehr ambitio-nierte Politikvorgaben formuliert werden, die im nachfolgenden Implementationsprozess auf
Hürden treffen, denen sie häufi g nicht gewach-sen sind. Die Richtlinie ist in der europäischen Umweltpolitik die zentrale Rechtsnorm. Diese Normenart bedarf der Umsetzung in nationa-les Recht sowie der ausgestaltenden Konkreti-sierung und trägt hierbei dem Subsidiaritäts-grundsatz Rechnung (ausführlich in Grant et al. 2000: 10ff.). Die grundsätzliche Offenheit dieses Instruments birgt allerdings auch Risiken. Das Erfordernis des politischen Konsens oder gar der Einstimmigkeit, das für die FFH-Richtlinie Anwendung fand, mündet häufi g in sehr offe-nen «Kompromissformeln». Hinzu kommt, dass im Laufe der 1990er-Jahre eine zunehmende Offenheit in der Formulierung von Richtlinien festgestellt wurde, die als Reaktion auf Vorwür-fe des Bürokratismus und der Eurokratie ge-wertet wurde (vgl. Knill/Lenschow 1999). Diese Tendenzen zur Offenheit verstärken im Zusam-menspiel jedoch die Gefahr, nicht nur umstrit-tene Details, sondern auch wesentliche Fragen auszusparen.
2.1 Offenheit in Bezug auf naturschutzfachliche Auswahlverfahren
Die Regelungen der FFH-Richtlinie bleiben zunächst abstrakt im Hinblick auf das natur-schutzfachliche Auswahlverfahren, das der Konkretisierung und Operationalisierung be-darf (vgl. Ssymank et al. 1998). Dies ist in Form nationaler Handbücher, Verwaltungsvorschrif-ten, Arbeitshilfen und der sich etablierenden Praxis geschehen. Dieser Prozess erwies sich offenbar als unerwartet komplex, denn erst auf Grund der sich abzeichnenden Umsetzungspro-bleme in den Mitgliedsstaaten veröffentlichte die Kommission Interpretationshilfen (siehe u.a. European Commission 2000); nicht weni-ge Unklarheiten sind zudem durch die Recht-sprechung beigelegt worden (siehe unten). In der Literatur wird neben dieser Unterschätzung der Komplexität angeführt, dass zugleich eine Überschätzung eines rein naturwissenschaftli-chen Vorgehens verbreitet gewesen sei. Ein Aus-wahlverfahren, das zumindest langfristig recht-liche Konsequenzen für Grundbesitzer und Vorhabenträger hat und bei diesen vielfältige Befürchtungen weckt, stösst schnell auf Unver-ständnis, wenn es sich rein auf naturschutz-fachliche Kriterien beruft und partizipatorische Fragen zu diesem Zeitpunkt für nachrangig er-achtet. So ist aus französischer Perspektive die-ses Problemfeld in der Frage pointiert artiku-liert worden: «Can a territorial policy be based on science alone?» (Alphandéry/Fortier 2001).
Dow
nloa
ded
by [
Tuf
ts U
nive
rsity
] at
14:
43 1
7 O
ctob
er 2
014

disP 163 · 4/2005 312.2 Partizipation und Abwägung?
Die FFH-Richtlinie fordert in Artikel 2 Absatz 3 explizit, dass die zu treffenden Massnahmen den «Anforderungen von Wirtschaft, Gesell-schaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung zu tragen» haben, sodass bereits hier die Notwendigkeit von Abwägung und Ermessensausübung ange-legt ist. Zugleich stehen die bereits erfolgen-den Nutzungen sowie die planungsrechtlich gesicherten Vorhaben in (zukünftigen) FFH-Gebieten unter Bestandsschutz, sodass es auf den ersten Blick überrascht, dass von Seiten der Eigentümer und Nutzer derart vehementer Widerstand erwächst. Eine zentrale Erklärung hierfür ist der Zeitpunkt der Abwägung. So war es zunächst sehr umstritten, ob bereits im Zuge der Erstellung von Gebietslisten, die zur ge-meinschaftlichen Bewertung nach Brüssel ge-geben werden, andere als naturschutzfachliche Belange zu berücksichtigen sind. Für Klarheit hat hier schliesslich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes gesorgt, wonach andere als naturschutzfachliche Kriterien in diesem Verfahrensschritt nicht zu berücksichti-gen sind (Urteil von 1996 mit der Bezeichnung C-44/95 und zwei Jahre später C-3/96, vgl. Ben-nett/Ligthart 2001). Diese Weichenstellung hat weit reichende Konsequenzen für die Fragen der Partizipation in diesem Stadium des FFH-Prozesses. Zwar sind verschiedene Anhörungs- und Informationsveranstaltungen institutionali-siert worden, eine weiter gehende Partizipation in dem Sinne, dass andere als naturschutzfach-liche Anliegen Einfl uss auf die Entscheidung hätten nehmen können, war nicht zulässig. In der Phase der Unterschutzstellung verbessert sich insbesondere der Rechtsschutz der betrof-fenen Bürger, eine vollständige Abwägung aller vorgebrachten und relevanten Einwände gegen die Rechtswirkung des FFH-Status allerdings fi ndet erst – recht spät – im Zuge der FFH-Ver-träglichkeitsprüfung statt. Diese wird nicht sel-ten als bürokratische Hürde empfunden, die dem Vorhabenträger in der Regel zudem einige Kosten aufbürdet.
Gerade diese Aspekte jedoch – der Zeitpunkt der Abwägungsvorgänge und das Ausmass der vorgesehenen Partizipation von Planungsbe-troffenen – stellen zentrale Kritikpunkte im öf-fentlichen Diskurs dar (z.B. Krott et al. 2000). In dem nun anstehenden Prozess der Unter-schutzstellung der mit Brüssel abgestimmten FFH-Gebiete sind Fragen der Abwägung – ins-besondere bei der Wahl des Schutzstatus – von Interesse.
2.3 Kompensation?
Nicht nur die FFH-Verträglichkeitsprüfung verursacht Kosten, die auf nationalstaatlicher Ebene geregelt werden müssen, ohne dass von europäischer Ebene entsprechende Kompensa-tionen gestellt werden könnten. Die fi nanziel-len Implikationen des FFH-Status sind vielfältig und reichen von vertraglich vereinbartem Nut-zungsverzicht in der Forstwirtschaft bis hin zu Mehrausgaben auf Grund geänderter Strassen-führungen. Ein eher kleiner Beitrag kann durch verschiedene Programme der europäischen Ebene abgedeckt werden, in der Regel müssen die Kosten auf nationalstaatlicher Ebene mit den betroffenen Nutzern und Eigentümern ge-regelt werden (o.A. 2004; vgl. Jordan 2002: 303). Die EU verfügt insgesamt über einen begrenz-ten Haushalt, und die eher geringen Mittel im Bereich der Umweltpolitik sind insbesondere nicht zu vergleichen mit denen der Agrarpolitik oder der Strukturförderung.
Die Tatsache, dass zahlreiche Verfahrensfra-gen sowie insbesondere die Frage fi nanzieller Kompensationen von der Richtlinie offen ge-lassen werden, nimmt Paavola (z.B. 2004) zum Ausgangspunkt, die grundsätzlichere Frage der Gerechtigkeit zu thematisieren, die auf Grund fehlender Finanzierungsvorgaben in der Richt-linie ausgespart worden sei. Er stellt die The-se auf, dass die diesbezügliche Offenheit der Richtlinie ein nicht zulässiger Mangel sei, da Gerechtigkeit ein zentrales Anliegen der Nor-mengebung sein müsse. Indem dieser wesentli-che Regelungsgehalt auf «umsetzende» Ebenen verlagert wird, sind langwierige Aushandlungs-prozesse vorprogrammiert, die die beteiligten Institutionen rasch überforderten.
2.4 Einfl ussmöglichkeiten von Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
Die Politikformulierung auf europäischer Ebe-ne erfolgt sowohl in einiger geografi scher sowie politischer Entfernung zu den Umsetzungsebe-nen. Diese «Entfernungen» bewirken zum ei-nen, dass bevorstehende Barrieren schwer vor-hersehbar sind, zum anderen können sie dazu verleiten, erwartbare Hemmnisse und Wider-stände bewusst zu ignorieren.
Diese Form der Distanz zwischen Politik-formulierung und -umsetzung führt darüber hinaus auch dazu, dass es «Reibungsverluste» geben kann, wenn politische Inhalte von ei-ner politischen Ebene des EU-Mehrebenensys-tems zur nächsten «transportiert» werden. Dies
Dow
nloa
ded
by [
Tuf
ts U
nive
rsity
] at
14:
43 1
7 O
ctob
er 2
014

32 disP 163 · 4/2005 lässt sich beispielhaft festmachen an den un-terschiedlichen Einfl usspotenzialen von Nicht-regierungsorganisationen auf den jeweiligen Ebenen. Das Regieren im europäischen Mehr-ebenensystem ist geprägt durch einen hohen und wachsenden Einfl uss nichtstaatlicher Inte-ressengruppen, deren Lobbyarbeit tendenziell umso erfolgreicher ist, je früher im Prozess der Politikformulierung angesetzt wird (vgl. Schwarz 2002: 64ff., Gillies 1998).
In Bezug auf den FFH-Prozess wird – em-pirisch gestützt – die These aufgestellt, dass es den Umweltverbänden gelungen sei, auf euro-päischer Ebene effi zient Einfl uss zu nehmen. Am Beispiel der Forstwirtschaft wird nachvoll-zogen, dass die ENGOs (environmental non-govern mental organizations) nicht nur während der Politikformulierung, sondern nachfolgend auch während der Umsetzungsphase auf euro-päischer Ebene recht wirkungsvoll agiert ha-ben, indem länderübergreifend Schattenlisten initiiert werden, juristische Verfahren ange-strengt werden usw. (Weber/Christophersen 2002). Dem stehen jedoch auf nationaler und regionaler Ebene deutlich geringere Einfl uss-möglichkeiten der ENGOs gegenüber, so dass die Umsetzung der FFH-Politik hier nur sehr widerstrebend erfolgt. Die Nichtwahrnehmung der FFH-Thematik durch forstwirtschaftliche Verbände in der Phase der Politikformulierung kann durch Lobbyarbeit im Nachhinein den-noch kaum mehr kompensiert werden (Chris-tophersen 2001).
Die «by-pass-These» lenkt hierbei den Blick darauf, dass die ungleichen Machtverhältnisse auf den jeweiligen Ebenen gelegentlich durch Koalitionen genutzt werden. Beispielsweise können lokale Interessenvertreter eine Koaliti-on mit Kommissionsvertretern bilden, um nati-onalstaatliche Autoritäten zu umgehen.
Dieser Erklärungsansatz geht somit davon aus, dass die Übergänge zwischen den Hier-archieebenen des europäischen Mehrebenen-systems insofern «Schwachstellen» bilden, die gerade auch den NGOs neue Einfl ussmöglich-keiten bieten. An diesen Punkten kristallisie-ren sich insofern unvorhergesehene Aushand-lungsprozesse, Konfl ikte und Verzögerungen heraus.
2.5 Beschränkt wirksame Durchsetzungsinstrumente
Wenn im Umsetzungsprozess Barrieren re-levant werden – wie etwa die Untätigkeit na-tionaler Regierungen, Fehlinterpretationen,
Be völkerungsproteste usw. –, so sind die Reak-tionsmöglichkeiten beschränkt. Sanktions- und Steuerungsmöglichkeiten der EU sind eher mit-telbarer Natur. In dezentral organisierten Staa-ten wie beispielsweise der föderalistisch struk-turierten Bundesrepublik Deutschland tritt dieses Problem besonders deutlich zu Tage, da der Nationalstaat für europäische Institutionen der Ansprechpartner bleibt, der Bezug zu regio-nalen Planungsbehörden jedoch kaum gegeben ist (siehe Grant et al. 2000: 73; Weale et al. 2000: 303; Rat von Sachverständigen für Umweltfra-gen 2004).
Vertragsverletzungsverfahren gegen die na-tionalstaatlichen Vertreter sind beispielsweise recht langwierige Verfahren, deren erwünsch-te Wirkungen nicht zwingend eintreten. Gera-de am Beispiel der FFH-Richtlinie zeigt Mayer (2004) anhand eines europaweiten Vergleichs, dass die Länder auf eine Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof sehr unterschiedlich reagiert haben. Diese Feststellung ist zugleich ein Hinweis darauf, dass rechtliche Zwangsmit-tel keine Ideallösung darstellen.
2.6 Ehrgeiziger Zeitplan
Indem die FFH-Richtlinie die Artenvielfalt auf europäischem Massstab schützen soll, enthält sie sehr ambitionierte Ziele. Im Zuge der Um-setzung in nationales Recht bedeuten diese Vorgaben z.T. einen deutlichen Eingriff in be-stehende institutionelle Arrangements (allge-mein hierzu vgl. Knill 2003; für das Fallbei-spiel Spanien Fernandez 2003). Zugleich zielt die FFH-Richtlinie darauf, einen erheblichen Teil der Landesfl äche unter Schutz zu stellen – der «Erwartungswert» EU-Kommission wird auf etwa 10–15 % beziffert (Kehrein 2002:6). Vor diesem Hintergrund wird der straffe Zeit-plan der FFH-Richtlinie als ein wichtiger Erklä-rungspunkt für die Umsetzungsschwierigkeiten genannt, da in dem Zeitraum zwischen 1992 und 1995 viele der bereits angesprochenen Herausforderungen gelöst werden sollten. Ne-ben der Verankerung des FFH-Regimes in na-tionalem Recht musste eine naturschutzfach-liche Methode zur Gebietsidentifi zierung und -abgrenzung sowohl entwickelt als auch an-gewandt werden. Darüber hinaus waren Wege zu fi nden, wie den betroffenen Nutzern und Eigentümern einschlägiger Flächen in dieser Phase zu begegnen sei. Vor dem Hintergrund, dass Naturschutz – insbesondere durch die im-plizierten Eingriffe in Eigentumsrechte – ein traditionell konfl iktträchtiges Politikfeld ist,
Dow
nloa
ded
by [
Tuf
ts U
nive
rsity
] at
14:
43 1
7 O
ctob
er 2
014

disP 163 · 4/2005 33erscheint der gesamte Zeitplan der FFH-Richt-linie, insbesondere aber die vorgesehenen drei Jahre zur Erstellung der nationalen Gebietslis-ten, als sehr eng bemessen (Alphandéry/Fortier 2001; Faibrass/Jordan 2001).
3. «Naturbezogene Raumbilder» als politische Variable?
Den hier vorgestellten Erklärungsansätzen ist gemeinsam, dass sie die Implementationspro-blematik primär mittels institutioneller und «technischer» Aspekte des Politikprozesses be-trachten. Inhaltliche Aspekte hingegen blei-ben weit gehend ausgeblendet, sodass die FFH-Problematik grundsätzlich ähnlich erklärbar erscheint wie die Implementation der Verpa-ckungs- oder der Feinstaubrichtlinie. Hierbei wird jedoch übersehen, dass es sich bei den Auseinandersetzungen im FFH-Prozess – zu-mindest auch – um raumbezogene Konfl ikte, also um ein klassisch-geografi sches Thema handelt. Weite Teile dieses Politikfeldes han-deln davon, wer, was, wo «machen» darf. Die Erklärung derartiger Konfl ikte rein durch insti-tutionelle und normentechnische Aspekte er-scheint – trotz der zahlreichen plausiblen Er-kenntnisse – verengt, da sie die inhaltlichen Auseinandersetzungen der politischen und pla-nerischen Akteure gleichsam als black box be-handelt. Dabei erscheint es durchaus relevant, dass die Diskussionen um Gebietsausweisun-gen phasenweise beinahe als Grabenkämpfe anmuteten, wenn beispielsweise um die Einbe-ziehung bzw. Aussparung einzelner Stallungs-bauten in den relevanten Plänen erbittert ge-stritten wurde.
Während allerdings auf der einen Seite eine rein naturwissenschaftliche Betrachtung die-ser Prozesse unbefriedigend erscheint, fällt es auf der anderen Seite schwer, in der Analyse eine weit gehend neutrale Beobachterhaltung zu bewahren. Allzu schnell erwächst gerade auf Grund der Konfl ikthaftigkeit der Materie die Gefahr, bereits «besetzten» Argumentationsgän-gen ungewollt zu folgen und entsprechenden «Lagern» zugerechnet zu werden. Vor diesem Hintergrund kann eine konstruktivistisch ori-entierte, diskursanalytisch vorgehende Heran-gehensweise hilfreich sein, die – obwohl in den Gesellschaftswissenschaften recht intensiv dis-kutiert – im planerisch-angewandten Bereich bislang wenig rezipiert worden ist (vgl. aber Reuter 2000).
3.1 «Raum» als diskursives Konstrukt
Aus konstruktivistischer Perspektive ist «Raum» nicht nur als materielles Objekt zu verstehen, sondern vor allem als eine Kategorie, der in gesellschaftlichen, politischen usw. Diskursen vielfältige Bedeutungen zugewiesen werden. Da diese Bedeutungszuweisungen nicht zuletzt die konkreten, raumabhängigen Verwertungsmög-lichkeiten entscheiden, gehen mit den entspre-chenden Aushandlungen vielfältige Konfl ikte einher. Eine Möglichkeit, derartige Konfl ikte umfassender zu verstehen, stellt die Identifi -kation von «Subjektivierungen» (im Sinne von Reuber 1999) dar. Dieser Perspektive zufolge ist zunächst von einer subjektiven und sehr se-lektiven Wahrnehmung von Raum durch ver-schiedene Akteure auszugehen. Beispielsweise hat ein Brüsseler Lobbyist eines Naturschutz-verbandes tendenziell eine andere Raumwahr-nehmung als der IHK-Vertreter vor Ort. Des Weiteren divergieren die – wiederum subjekti-ven – Zielvorstellungen in Bezug auf die raum-bezogene Entwicklung. In einem dritten Schritt der Subjektivierung stehen sich verschiedene strategische Deutungen des Raumes gegenüber, die in öffentlichen Diskursen bewusst einge-setzt werden. Beispielsweise steht der Argumen-tation der Abgrabungsindustrie, sie schaffe eine attraktive «Kulturlandschaft» mit zugleich gros-ser Artenvielfalt, der Vorwurf des «Landschafts-verbrauchs» gegenüber.
3.2 «Natur» als diskursive Kategorie
Die Akteure verfügen nicht nur über divergie-rende Raumauffassungen. Ähnlich wie die Kate-gorie Raum wird auch die Kategorie Natur nicht aus sich selbst heraus verständlich, sondern wird auf spezifi sche Weisen wahrgenommen, mit Be-deutungsinhalten versehen und entsprechend kommuniziert. Die Frage, ob Natur primär als «bedrohtes Erbe», «wirtschaftliche Ressource» oder als «identitätsstiftende Heimat» aufgefasst wird, kann eine wichtige Variable im Politikpro-zess darstellen (vgl. Körner et al. 2003; Flitner 2003).
Raum- und Naturkonstruktionen sind in po-litischen und planerischen Prozessen eng mit-einander verschränkt. Gerade im europäischen Mehrebenensystem ist hierbei von besonderem Interesse, auf welche Massstabsebenen hierbei Bezug genommen wird. Im FFH-Prozess ist die Unterschutzstellung von Buchenwäldern ein an-schauliches Beispiel. Während in Deutschland die Schutzbedürftigkeit von Buchenwaldarten
Dow
nloa
ded
by [
Tuf
ts U
nive
rsity
] at
14:
43 1
7 O
ctob
er 2
014

34 disP 163 · 4/2005 bis zur Verabschiedung der FFH-Richtlinie kei-ne prominente Rolle gespielt hat, änderte sich dies durch die Massstabserweiterung im EU-bezogenen Diskurs (vgl. Ssymank et al. 2000: 14 ff.). Aus dieser Perspektive erscheinen nun die deutschen Vorkommen – gerade auf Grund ihrer grossen gesamteuropäischen Bedeutung – als besonders schützenswert (weiterführend zur «Scales»-Debatte siehe Swyngedouw 2004; Arts 2004).
3.3 Ausblick
Eine Ergänzung der in der Implementationsli-teratur bereits aufgestellten Erklärungsansätze zum FFH-Prozess um diese konstruktivistisch orientierten Überlegungen erscheint hilfreich. Erst die Berücksichtigung von Politikinhalten in ihrer Rezeption und Verhandlung durch die beteiligten Akteure ermöglicht ein vertieftes Verständnis der häufi g zunächst überraschend konfl ikthaften und langwierigen Auseinander-setzungen. Dies kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine entsprechende Ana-lyse sich vielfältigen Herausforderungen ge-genübersieht. Die methodischen Überlegun-gen, anhand welcher Materialien und mittels welcher diskursanalytischen Strategien die rele-vanten naturbezogenen Raumbilder retrospek-tiv zu identifi zieren sind, seien nur stellvertre-tend genannt.
Diesen Herausforderungen stellt sich derzeit ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes Projekt an der Universität zu Köln, das den Titel «Die ‹Biografi e› naturbezo-gener Raumbilder. Zur Bedeutung von Institu-tionen und Policy-Netzwerken am Beispiel der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Nordrhein-Westfalen» trägt. In diesem Projekt analysieren Politikwissenschaftler und Geografen die Um-setzung der FFH-Richtlinie aus interdisziplinä-rer Perspektive. Dieses Projekt möchte unter anderem einen Beitrag dazu leisten, die derzeit vor allem auf theoretischer Ebene diskutierten Ansätze des Konstruktivismus für implementa-tions- und planungstheoretische Überlegungen fruchtbar zu machen (siehe auch http://www.raumbilder.uni-koeln.de).
LiteraturAlphandéry, P.; Fortier, A. (2001): Can a territorial
policy be based on science alone? The system for creating the natura 2000 network in France. In: Sociologia Ruralis 41 (3): 311–328.
Arts, B. (2004): The global-local nexus: NGOs and
the articulation of scale. In: Tijdschrift voor Eco-nomische en Sociale Geografi e 95 (5), 498–510.
Bennett, G.; Ligthart, S. (2001): The implementa-tion of international nature conservation agree-ments in Europe: the case of the Netherlands. In: European Environment 11 (3), 140–150.
BMU – Bundesumweltministerium (2004): Natur-schutz-Netz «Natura 2000» gilt. Pressmitteilung Nr. 227/04, Berlin.
Christophersen, T. (2001): Natura 2000 und Forst-wirtschaft. Augsburg.
Diaz, C.L. (2001): The EC Habitats Directive ap-proaches its tenth anniversary: An overview. In: RECIEL 10 (3), 187–295.
European Commission (2000): Managing Natura 2000 sites: The provisions of Article 6 of the Habi-tats Directive 92/43/EEC. Luxemburg.
European Commission (2004a): Fifth annual survey on the implementation and enforcement of Com-munity environmental law. Brüssel.
European Commission (2004b): Report from the Commission on the implementation of Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and fl ora. Brüssel.
Fairbrass, J.; Jordan, A. (2001): European Union environmental policy and the UK government: a passive observer or a strategic manager. In: Environmental Politics 10 (2), 1–21.
Fernandez, S. A. (2003): Spanish coordination in the European Union. The case of the habitats directive. In: Administration and Society 34 (6), 678–699.
Fizek, A. (2004): Der Naturschutz im Rahmen der EU-Osterweiterung. Das Beispiel «Internati-onalpark Unteres Odertal». In: RaumPlanung 114/115, 143–147.
Flitner, M. (2003): Kulturelle Wende in der Um-weltforschung? – Aussichten in Humanökolo-gie, Kulturökologie und Politischer Ökologie. In: Gebhardt, H.; Reuber, P.; Wokersdorfer, G. (Hg.), Kulturgeographie. Heidelberg/Berlin, 213–228.
Gellermann, M. (2001): Natura 2000. Europäisches Habitatschutzrecht und seine Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin u.a.
Gellermann, M. (2002): FFH-Verträglichkeitsprü-fung auf unsicherem Boden? UVP-Report Son-derheft zum UVP-Kongress, 101–104.
Gillies, D. (1998): Lobbying and European Com-munity environmental law. In: European Envi-ronment 8: 175–183.
Grant, W.; Matthews, D.; Newell, P. (2000): The effectiveness of European Union environmental policy. London.
Hiedanpää, J. (2002): European-wide conservation versus local well-being: the reception of the Natura 2000 reserve network in Karvia, SW-Finland. In: Landscape and Urban Planning 61: 113–123.
Jordan, A. (2002): The implementation of EU en-vironmental policy: a policy problem without a political solution? In: Jordan, A. (Hg.): Environ-
Dow
nloa
ded
by [
Tuf
ts U
nive
rsity
] at
14:
43 1
7 O
ctob
er 2
014

disP 163 · 4/2005 35mental policy in the European Union. London, 301–328.
Kehrein, A. (2002): Aktueller Stand und Perspekti-ven der Umsetzung von Natura 2000 in Deutsch-land. In: Natur und Landschaft 77 (1): 2–9.
Knill, C. (2003): Europäische Umweltpolitik. Steue-rungsprobleme und Regulierungsmuster im Mehr-ebenensystem. Opladen.
Knill, C.; Lenschow, A. (1999): Neue Konzepte – alte Probleme? Die institutionellen Grenzen effektiver Implementation. In: Politische Viertel-jahrsschrift 40 (4): 591–617.
Körner, S.; Nagel, A.; Eisel, U. (2003): Naturschutz-begründungen. Bonn.
Krott, M. (2000): Voicing Interests and Concerns: NATURA 2000 – An ecological network in con-fl ict with people. In: Forest Policy and Economics 1: 357–366.
Ledoux, L. et al. (2000): Implementing EU bio-diversity policy: UK experiences. In: Land Use Policy 17: 257–268.
Leibenath, M. (2003): Natura 2000: Grenzüber-schreitender Naturschutz aus einem Guss? In: Forum Geoökologie 14 (2): 27–30.
Mayer, R. (2004): Die Wirkung von Vertragsverlet-zungsverfahren auf die Umsetzung von Natura 2000. Unveröffentlichte Diplomarbeit Konstanz.http://www.ub.uni-konstanz.de/v13/volltex-te/2004/1372//pdf/DA123.pdf
o.A. (2004): Die Finanzierung des Netzwerks Natu-ra 2000. In: Generaldirektion Umwelt (Hg.): News letter Natura 2000 Nr. 17: 2–4. http://europa.eu.int/comm/environment/news/natura/nat17_de.pdf.
Paavola, J. (2004): Protected areas governance and justice: theory and the European Union’s Habi-tats Directive. In: Environmental Sciences 1 (1): 59–77.
Pinton, F. (2001): Conservation of biodiversity as a European directive: the challenge for France. In: Sociologia Ruralis 41 (3): 329–342.
Rat der europäischen Gemeinschaften (1979): Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogel-arten. http://europa.eu.int/eur-lex/de/consleg/pdf/1979/de_1979L0409_do_001.pdf.
Rat der Europäischen Gemeinschaften (1992): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pfl anzen. http://eu-ropa.eu.int/eur-lex/de/consleg/pdf/1992/de_1992L0043_do_001.pdf.
Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (2004): Umweltgutachten 2004. Drucksache Deutscher Bundestag 15/3600.
Rémy, E.; Mougenot, C. (2002): Inventories and maps: cognitive ways of framing the nature po-licies in Europe. In: Journal of Environmental Policy & Planning 4: 313–322.
Reuber, P. (1999): Raumbezogene Politische Konfl ik-te. Geographische Konfl iktforschung am Beispiel von Gemeindegebietsreformen. Stuttgart.
Reuter, W. (2000): Zur Komplementarität von Dis-kurs und Macht in der Planung. In: DISP 141: 4–16.
Schmidt, A. (2000): Mitwirkung der Raumordnung bei der Bestimmung von FFH- und Europäi-schen Vogelschutzgebieten. In: Raumforschung und Raumordnung 5: 382–388.
Schwarz, S. (2002): Die Europäisierung der Umwelt-politik. Politisches Handeln im Mehrebenensys-tem. Berlin.
Spreen, H. (2005): Folgeprobleme der nationalen Unterschutzstellung von FFH-Gebieten. Rechts-schutzmöglichkeiten von Bürgern und Kommu-nen. In: Umwelt- und Planungsrecht UPR 1: 8–11.
Stoll-Kleemann, S. (2001): Opposition to the desi-gnation of protected areas in Germany. In: Jour-nal of Environmental Planning and Management 44 (1): 109–128.
Ssymank, A. et al. (1998): Das europäische Schutz-gebietssystem NATURA 2000. BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richt-linie (92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG). Bonn.
Swyngedouw, E. (2004): Scaled Geographies: Na-ture, Place, and the Politics of Scale. In: Shep-pard, E.; McMaster, R.B. (Hg.), Scale and Geo-graphic Inquiry. Oxford, 129–153.
Weale, A. et al. (2000): Environmental Governance in Europe. Oxford.
Weber, N.; Christophersen, T. (2002): The infl u-ence of non-governmental organizations on the creation of Natura 2000 during the European Policy process. In: Forest Policy and Economics 4, 1–12.
Dr. Tobias ChillaGeografi sches InstitutUniversität zu KölnAlbert-Magnus-PlatzD-50923 Kö[email protected]
Dow
nloa
ded
by [
Tuf
ts U
nive
rsity
] at
14:
43 1
7 O
ctob
er 2
014