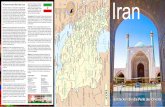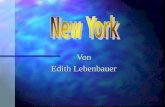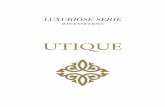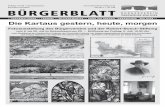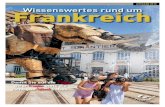Franz Hermann Enk: Ohne Druck zum Druck. Wissenswertes zu Print und Promotion
-
Upload
raabe-verlag -
Category
Documents
-
view
4.932 -
download
0
description
Transcript of Franz Hermann Enk: Ohne Druck zum Druck. Wissenswertes zu Print und Promotion

H 3.6
1
Ohne Druck zum Druck Wissenswertes zu Print und Promotion
Franz Hermann Enk
In jeder Einrichtung, in jedem Betrieb ist mindestens eine Person mit Aufgaben der Kommunikation befasst – und somit über kurz oder lang auch mit Fragen zu Druckerzeugnissen. Diese Mitarbeite-rinnen und Mitarbeiter sind jedoch in der Regel keine Druck-Experten. Das müssen und sollen sie auch gar nicht sein. Dennoch gibt es manches, das sie unbedingt oder bedingt wissen sollten. Diese wissenswerten Dinge „rund um Druck“ wurden für den nachfolgenden Beitrag zusammengetragen und sind übersichtlich aufgeführt. Somit eignet sich der Beitrag1 insbesondere dafür, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, um sich auf das Gespräch mit Agenturen und Produzenten vorzubereiten.
Gliederung Seite
1. Druckvorstufe 2
2. Datentechnik in der digitalen Medienvorstufe 5
3. Tipps und Regeln zur PDF-Datenerstellung 6
4. Farbmanagement 8
5. Arbeiten mit Datenbanken in InDesign 13
6. Druckverfahren 15
7. Drucktechnik im Offset 19
8. Druckweiterverarbeitung 27
9. Papier 31
10. Druck-Briefing 35
1 Mit freundlicher Genehmigung der Enk & Media GmbH, Bocholt, entnommen aus der Publikation „Druckplaner 2010“

H 3.6 Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2
1. Druckvorstufe
Viele der heute gebräuchlichen Schriften sind aus historischen Ent-würfen hervorgegangen, die teilweise schon im Mittelalter entstanden sind. Um die Größe einer Schrift, den Schriftgrad, zu bezeichnen, verwenden Setzer den typografischen Punkt. Ein typografischer Punkt nach Didot entspricht 0,376 mm. Dieser Text ist zum Beispiel in einer 11-Punkt-Schrift gesetzt. Früher folgten die Schriftgrade in festen
Abständen aufeinander (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, etc.). Heute kann eine beliebige Punkt-größe gewählt werden. Der Schriftgrad ist die Höhe eines Kleinbuchstabens mit Oberlänge (b, k, l etc.) plus die Unterlänge eines Buch-stabens in derselben Schriftart (g, p) – die sogenannte Kegelgröße oder Vertikalhöhe. Ein Typometer erleichtert es, den Schriftgrad zu bestimmen.
Beim Blocksatz sind alle Zeilen gleich lang. Die Wortzwischenräume sollten dabei mög-lichst einheitlich sein. Als Faustregel gilt: Sie sollten etwa einem Drittel der Schriftgröße entsprechen. Beim Flattersatz sind die Texte in unterschiedlich langen Zeilen gesetzt. Bei schmalem Satzspiegel werden häufige und schwer lesbare Trennungen vermieden. Der Flattersatz kann links- oder rechtsbündig an-geordnet werden. Und schließlich: Beim „Satz auf Mitte“ „flattern“ die Zeilen auf beiden
Seiten des Textes. Diese Satzart ist nicht gut zu lesen und sollte des-halb nur bei kurzen Texten angewendet werden.
Der Satzspiegel ist der Raum auf einer Seite, den Text und Bilder ein-nehmen. Er wird von einem Rand aus freien Flächen umgeben, die Stege genannt werden. So wird der Satzspiegel zum Beispiel nach dem Goldenen Schnitt auf der Fläche platziert. Er ist ein gedachtes Rechteck, das die bedruckten Teile einer Seite umgibt. Marginalien, Bogensignatur und Seitenzahl liegen außerhalb des Satzspiegels, Fuß-noten wiederum gehören ebenso dazu wie eventuelle Kolumnen. Be-stehen Drucksachen aus beidseitig bedruckten Seiten, spricht man von einem doppelseitigen Satzspiegel, bei einseitig bedruckten Seiten von einem einseitigen Satzspiegel.
Schriftgrade
Schriftgrößen
Konsultationsgrößen: Schriftgrößen bis 8 Punkt für Randbemerkungen (Marginalien), Fußno-ten, aber auch bei Nachschlagewerken wie Stadtplänen, Telefonbüchern, Lexika etc.
Lesegrößen: Schriftgrößen von 8 bis 12 Punkt für Bücher, Briefe und sonstige Druck- und Screenprodukte, die zum Lesen aus der Nähe bestimmt sind.
Schaugrößen: Schriftgrößen bis zu 48 Punkt für Überschriften, Titel und für Texte, die auch auf größere Distanz lesbar sein sollen, z. B. Plakate.
Satzspiegel

Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit H 3.6
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
3
Ein Gestaltungsraster erleichtert das Organisieren von Texten und Bildern auf der Seite. Es teilt den Satzspiegel in kleinere rechteckige Module als Untereinheiten ein. Die Breite eines Moduls entspricht bei einspaltigem Layout der Breite des Satzspiegels. Soll der Text weiter gegliedert werden, können zusätzlich Vertikalen eingefügt werden – zum Beispiel wenn viele Bildelemente vorgesehen sind. Eine vertikale Teilung entsteht automatisch, wenn der Satz mehrspaltig ist. Das so erstellte Gestaltungs-raster ist nun die Grundlage für die Platzie-rung von Texten und Bildern. Die Höhe eines Textblockes ist nur vom Satzspiegel begrenzt, seine Breite richtet sich nach den Modulen. Ebenso orientieren sich Bilder an Breite, Hö-he und Position der Module, können sich aber auch über mehrere Module erstrecken.
Helligkeit und Farben eines Bildes können nicht bis in ihre kleinsten Nuancen wiederge-geben werden: Jedes Bild wird deshalb in 256 Graustufen und Tonwerte von 1 bis 100 Pro-zent eingeteilt. Im Druck erscheinen sie als Rasterung – kleine Punkte, die nur bei starker Vergrößerung sichtbar sind. Als Faustformel gilt: Je geringer ihr Abstand ist, desto schärfer wird das Bild. Diese Feinheit des Rasters ist die Rasterfrequenz oder Rasterweite. Sie wird in „lines per inch“ (lpi) gemessen, wobei ein Inch 2,54 cm entspricht. Diese Maßeinheit kollidiert mit der Messung des Rasters in Zentimetern, wie es teilweise in Deutschland üblich ist.
Auch das Papier hat einen Einfluss auf die Wahl des Rasters. Beim Scannen bzw. Belich-ten der Daten muss ein geeigneter Wert einge-stellt werden. Der Wert der Rasterfrequenz beeinflusst wiederum die Höhe der Auflösung bei der Belichtung. Bei einer hohen Raster-frequenz wird das Bild mit einer entsprechend hohen Auflösung belichtet. Ähnliches muss beim Scannen des Dokuments berücksichtigt werden: Soll eine feine Rasterfrequenz erzielt werden, muss die Auf-lösung des Bildes entsprechend hoch sein. Ein Rasterzähler hilft, die Rasterfrequenz von gedruckten Bildern schnell und einfach zu ermit-teln. So müssen nicht die einzelnen Rasterpunkte unter der Lupe ge-zählt werden.
Die ersten Prototypen der Digitalkamera wurden 1988 vorgestellt. Doch bis etwa 1995 war das digitale Fotografieren mehr oder weniger den Profis vorbehalten, denn die Anschaffung der Kameras war noch zu teuer. Als die Preise fielen, kamen auch die Hobbyfotografen schnell auf den Geschmack. Heute haben Digitalkameras einen hohen Entwicklungsstand erreicht und inzwischen werden wesentlich mehr
Gestaltungsraster
Goldener Schnitt
Der Goldene Schnitt entsteht, wenn eine Ge-samtstrecke „A“ so in zwei Teil strecken unter-teilt wird, dass die größere Teilstrecke „B“ sich proportional zur Gesamtstrecke verhält wie die kleinere Teilstrecke „C“ zur größeren Teilstre-cke „B“.
Raster
60er-Raster = 60 Linien pro cm = ca. 150 lpi
(60 x 2,54 = 152,4)
Das digitale Fotografieren

H 3.6 Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4
digitale als analoge Kameras verkauft. Der Unterschied zu einer Ana-logkamera besteht darin, dass anstelle eines Films bei einer Digital-kamera ein Bildsensor verwendet wird. Dieser wandelt die Helligkeit des Lichts punktweise in elektrische Ladung um. Der Bildsensor ent-hält mehrere Millionen Bildpunkte, auch Pixel genannt. Diese Pixel nehmen keine Farbe wahr, sondern nur Helligkeit. Ein Netz von win-
zigen Farbfiltern ist deshalb nötig, damit die Farberkennung ermöglicht wird. Danach wer-den die analogen Daten des Bildsensors im Analog-Digital-Wandler in digitale Signale umgerechnet. Diese verarbeitet der Prozessor dann zu Bilddaten, die auf einer Speicherkarte festgehalten werden. Zum Betrachten der Fotos werden die Bilddaten von der Kamera über ein Kabel oder von der Speicherkarte in einen Computer geladen. Hier können die Bilder begutachtet, bearbeitet und beispiels-weise auf eine Harddisk oder eine CD-ROM gespeichert werden. Die Bilder können auf einem Fotodrucker ausgedruckt, ins Internet gestellt und per E-Mail versandt werden.
Scanner und Digitalkameras verwenden nicht CMYK-Farben sondern ein Farbmodell, das RGB (Rot/Grün/Blau) genannt wird und ein anderes Farbspektrum umfasst als CMYK. Will man RGB-Daten für den Druck verwen-
den, müssen sie zuerst in CMYK-Farben umgerechnet werden. Dies geschieht mit einem Modell, das beide Farbräume umfasst: dem LAB-Farbmodell.
Schwarz-Weiß-Bilder wirken besonders edel, wenn Schwarz um eine Schmuckfarbe ergänzt wird. Bei klassischen Duplexverfahren wird ein
Grau- oder Braunton gewählt. Wie beim Vier-farbdruck entsteht die Wirkung durch den Zusammen- oder Übereinanderdruck der bei-den Farben. Und auch hier werden die Farben in unterschiedlichen Winkeln gerastert (z. B. 45° und 75°). Für schwarz und die Duplexfarbe werden zwei verschiedene Gradationskurven festgelegt. Neben grau und braun sind auch andere Farbkombinationen möglich. Sie wir-ken in der Regel zu aufdringlich, werden aber für bestimmte Effekte durchaus verwendet.
Scannen
Beim Scannen wird eine Bildvorlage elektro-nisch erfasst, um dann weiterbearbeitet und schließlich gedruckt werden zu können. Zwei Faktoren bestimmen die spätere Druckqualität des Bildes und sollten schon vor dem Scannen festgelegt werden:
1. Rasterfrequenz
2. Vergrößerungsfaktor (d. h., wie groß das Bild im endgültigen Druck dargestellt wird)
Gute Ergebnisse werden in der Regel mit einer Auflösung von 1.200 dpi erzielt (Vergröße-rungsmaßstab 1:1).
CMYK
CMYK nach DIN ISO 12647 ist das Farbsys-tem, das in der Druckindustrie verwendet wird. Farbbilder werden fast ausschließlich in CMYK gedruckt. Es umfasst die drei Grundfarben und Schwarz.