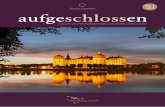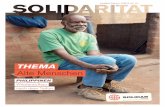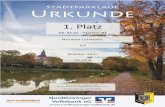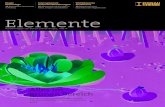glueckauf-1-2014
description
Transcript of glueckauf-1-2014

glück auf Die Zei tung für Mit ar bei ter, Kun den und Freun de der GMH Gruppe
1/2014
Ideen regieren die Welt – und bestimmen das Schicksal vieler Unternehmen, die auf gute Ideen angewiesen sind. Ob Produkt-entwicklung, Arbeitsorganisation, Marketing oder Kundenbetreuung: Wer sich als Unter-nehmen weiterentwickeln will, ist auf inno-vatives Denken angewiesen. Welche Aspekte dabei eine Rolle spielen können, beleuchtet unser Schwerpunktthema „Ideen“
R auf den Seiten 6 bis 9
Galaktische LegierungETE · Cronidur® 30 ist ein Stahl für viele Anwendungsfälle. Neuerdings wird er sogar in Navigationssatelliten verbaut.
S tickstofflegierte Stähle aus Essen sind aus dem tägli-
chen Leben nicht wegzuden-ken. Ob in Flugzeugen für die Höhen- und Seitenruderver-stellung, als Lagerwerkstoff in der Formel 1, in Zahnarztboh-rern oder Abfüllanlagen für Getränke: Überall da, wo eine spezielle Werkstofflösung ge-sucht wird, bietet die Energie-technik Essen (ETE) mit ihren HNS-Werkstoffen (High Nitro-gen Steel) oft die passende Lö-sung.
Diese Sonderstähle weisen nicht nur eine hohe Härte, sondern auch eine gute Korro-sionsbeständigkeit und Zähig-
keit auf. Hergestellt werden sie in einer Druck-Elektroschla-cke-Umschmelzanlage – einer Technologie, die maßgeblich bei ETE in Essen mitentwickelt wurde.
Neuerdings geht der Werk-stoff Cronidur® 30 auch „außerirdische Wege“. Denn er wird im europäischen Raum-fahrtprogramm „Galileo IOV“ verwendet. Doch was genau prädestiniert diesen Werkstoff aus Essen fürs Weltall? Welche Funktion übernimmt er dabei?
Verbaut wird er in Naviga-tionssatelliten, die ähnlich dem GPS-System auf der Erde jedem „heimleuchten“, der
Orientierung braucht. Croni-dur® 30 wird hier für Zahnrä-der eingesetzt, die im Antrieb der Solarpaneele eingebaut sind, dem sogenannten Solar Array Drive Mechanism. Die-ser Antrieb richtet die Solarpa-neele nach der Sonne aus und sichert so die Stromversorgung des Satelliten.
Pro Satellit sind acht Zahn-räder aus Cronidur® 30 ver-baut. Derzeit umkreisen bereits vier dieser Galileo-Naviga-tionssatelliten die Erde.
Dr. Roman Ritzenhoff
Für die freundliche Unterstützung bedan-ken wir uns bei der RUAG Schweiz AG.
Weitere Infos finden Sie unter: http://tinyurl.com/ cvpt554
Foto: ©panthermedia.net/paulfleet
Schwerpunkt //
idee
Entscheidende Wochen für die deutsche StahlindustrieEEG-Gesetz steht sowohl in Berlin als auch in Brüssel auf dem Prüfstand.
D ie Verunsicherung in der deutschen Stahlindustrie
ist groß. Denn die in Berlin und Brüssel anstehenden Entschei-dungen der kommenden Wo-chen werden zukunftsweisend sein:
Zum einen will Energiemi-nister Sigmar Gabriel das Erneu-erbare-Energien-Gesetz (EEG) grundlegend reformieren, da-mit es in diesem Jahr am 1. Au-gust in Kraft treten kann. Der Entwurf der Gesetzesnovelle zur EEG-Reform geht am 8. April zur ersten Lesung in den Bun-destag.
Zum anderen hat die EU gegen Deutschland ein Verfah-ren eingeleitet, weil die energie-intensiven Unternehmen hier-zulande von den Kosten für die Umlage der EEG befreit oder teilbefreit sind.
Darüber hinaus profitieren einige Unternehmen von ge-
kürzten Netznutzungsent-gelten. Beides wird in Brüs-sel sehr kritisch gesehen und soll nun durch das eingelei-tete Beihilfeverfahren geklärt werden.
Die deutsche Stahlindus-trie ihrerseits fordert seit Jahren eine klare und ziel-definierte Energie- und Kli-mapolitik, die die indus-triellen Interessen stärker berücksichtigt. Die jährlich steigenden Ausgaben, mit denen das EEG zur Förderung der regenerativen Energiege-winnung die Industrie belastet, haben ein Maß erreicht, das für die energieintensive Industrie nicht mehr tragbar ist.
Der deutsche Sonderweg ist teuer und beschert den Unter-nehmen, die im internationa-len Wettbewerb stehen, erheb-lich Kostennachteile. Rund 43 Prozent des gesamten Strom-
preises gehen auf Entscheidun-gen von Politik und Staat zu-rück. Damit die Energiewende in Deutschland aber gelingen kann, müssen auch zukünftig die energieintensiven Unter-nehmen, die sich im internatio-nalen Wettbewerb behaupten müssen, von der Belastung der EEG-Umlage befreit bleiben.
Würde diese Befreiung für die sechs energieintensiven Unter-
nehmen der GMH Gruppe wegfallen, dann kämen auf diese Unternehmen jährli-che Mehrkosten von rund 50 Millionen Euro zu, die voll ergebniswirksam wären.
„Mehrkosten aus der EEG-Umlage“, betont Peter van Hüllen, Vorsitzender der Ge-schäftsführung der GMH Holding, „könnten dazu führen, dass Investitionen in unsere deutschen Stand-orte zurückgeführt oder gar
nicht realisiert werden können. Deutschland hat heute schon die zweithöchsten Strompreise in Europa.“
Ein negativer EU-Bescheid, so van Hüllen weiter, könne zu einer Deindustrialisierung in Deutschland führen: „Insofern erwarten wir von der EU, dass das Beihilfeprüfverfahren ein-gestellt wird.“
ikw
Die neuen AzubiPages sind da! Sie berichten über Azubis, die ihre Ausbildung beendet oder begonnen haben, begleiten Azubis auf Fahrten und Messen, dokumentieren eine 100-Tage-Bilanz und lassen im Azubi-Inter-view einen jungen Mann zu Wort kommen, der einen Traumstart hingelegt hat. Zudem werden die Azubis erstmals zu einer kleinen Umfrage aufgerufen: „Hotel Mama“ – Zahlt Ihr in die Haushaltskasse?
Die Aktualität der energiepoliti-schen Situation in Deutschland und das anstehende EU-Verfahren haben die Redaktion der glückauf veran-lasst, in dieser Ausgabe anstelle des Leitartikels ein Gespräch mit Peter van Hüllen zu dem Thema „EEG-Gesetz“ zu führen. siehe dazu Interview auf Seite 3

GMH Gruppe
glück auf · 1/2014 ........... 2
CaçapavaBrasilie n
China
Russland
Sydney
Indianapolis
KocaeliJapan
Indien
ED iTor iAL
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Ein milder Winter liegt hinter uns – was sicherlich die eine oder andere Energiebilanz in der GMH Gruppe positiv beeinflussen dürfte. Der anbrechende Frühling verspricht ebenfalls, mild zu werden. Und den-noch ist die Stimmung allenthalben verhagelt. Grund ist die politische Großwetterlage, die ein anwach-sendes Tiefdruckgebiet über Krim und Schwarzem Meer verzeichnet. Inwieweit sich dieses Tief auf das Wirtschaftsklima auswirken wird, weiß niemand. Die erste glückauf des Jahres kann noch viele High-lights, erfreuliche Nachrichten und positive Trends vermelden. Bleibt zu hoffen, dass die glückauf 2/2014 ebenfalls überwiegend Positives zu berichten hat.
Ihr Redaktionsteam
AuS DEm inhALT
Gröditzer Werkzeugstahl Burg · Wenn es hart auf weich geht: Werkzeugstahl an BMW für Karbonteil-Fertigung geliefert. Lesen Sie mehr darüber
auf Sei te 5
Gmhütte · Mehr Anwendungs-orientierung geht nicht: Stahlwerk entwickelt mit Kunden neue Werk-stoffe. Lesen Sie mehr darüber
auf Sei te 10
Friedrich Wilhelms hütte · Auf großer Seefahrt: Getriebegehäu-se aus Gusseisen für Tanker gefer-tigt. Lesen Sie mehr darüber
auf Sei te 11
Bochumer Verein · Jetzt läuft es richtig rund: Neue Räderlinie bringt auch Kunden jede Menge Vorteile. Lesen Sie mehr darüber
auf Sei te 11
„Genieße gerade die Sonne …“Stilbrüche bei der automatischen E-Mail-Anwort kommen nicht immer gut: Wer es besser machen will, sollte drei einfache Tipps beachten.
Gerade wird Frühling. Aber schon jetzt dürfen wir uns auf
den Sommer und den wohlver-dienten Urlaub freuen – und damit auch auf die Zeit, in der so man-cher Stilbruch als automatische E-Mail-Abwesenheitsnotiz in den Posteingang flattert. Zum Beispiel:
„Segeln ist Mühsal und Segeln ist Wonne, Segeln ist Regen und Segeln ist Sonne. Bin auf Segeltörn in kroatischen Gewässern und er-hole mich von der anstrengenden Arbeit.“
Sicher haben sich die Autoren dieser oder ähnlicher Zeilen viel Mühe gegeben. Aber ob sie pas-
send sind, steht auf einem anderen Blatt. Von der Außenwirkung ganz zu schweigen.
Automatische E-Mail-Antworten sind sinnvoll: Der Absender wird umgehend über Ihre Abwesenheit informiert und wartet nicht um-sonst auf eine kurzfristige Rück-meldung. Wie Sie feststellen, ob Ihre Antwortmail gut ist? Stellen Sie sich vor, Sie haben selbst eine E-Mail mit einem dringenden An-liegen an jemanden geschickt. Werden Sie dann aus Ihrer Antwort schlau? Wenn nicht, stimmt da was nicht. Hier drei Tipps für eine mustergültige Antwort:
Schreiben Sie, bis wann Sie nicht erreichbar sind.
Machen Sie deutlich, ob jemand in Ihrer Abwesenheit die E-Mails liest und weiterbearbeitet.
Geben Sie an, wer Sie vertritt bzw. an wen man sich bei dringen-den Fragen wenden kann.
Zum Beispiel so: Guten Tag, bis einschließlich 20. Juni 2014 bin ich nicht im Büro. Meine E-Mails werden nicht weitergeleitet. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Max Mustermann, Telefon 0123.456-789, E-Mail: [email protected].
mw
Für menschen mit handicapGmh Gruppe · Die Aufgaben eines Schwerbehindertenvertreters erfordern fundiertes Fachwissen – aber auch den Blick dafür, was alles möglich ist.
Erstmals trafen sich Schwer-behindertenvertreter aus der
GMH Gruppe zum Erfahrungs- und Ideenaustausch. Gastgeberin Mo-nika Friebe begrüßte die Teilneh-mer am 19. Februar in der GMHüt-te. Das Treffen bot die Gelegenheit, sich über Förderwege, Fördermittel und gelungene Umgestaltungen von Arbeitsplätzen zu informie-ren. So konnten die Vertreter neue Ideen kennenlernen und ggf. auf das eigene Unternehmen übertra-gen, um eine dauerhafte berufli-che Integration von Menschen mit Handicap zu befördern.
Arbeitsdirektor Harald Schar-tau ging in seiner Präsentation auf die ganze Bandbreite der Rech-te, Pflichten und Aufgaben der Schwerbehindertenvertreter ein. Dazu gehöre beispielsweise, Arbeit-geber zu beraten und zu unterstüt-zen, wenn es etwa um die Beantra-gung von Förderleistungen geht.
„Die Integration schwerbehin-derter Mitarbeiter in die normalen betrieblichen Abläufe ist das Ziel“, so der Arbeitsdirektor. Aus Mitteln der Ausgleichabgabe könnten neue behindertengerechte Arbeitsplätze geschaffen oder bereits vorhande-
ne behindertengerecht umgestaltet werden.
Die Schwerbehindertenvertreter durchschauen die Gegebenheiten vor Ort am besten und erkennen frühzeitig Probleme und Möglich-keiten. Zusammen mit den Fach-leuten aus den Integrationsämtern können sie dann gemeinsam krea-tive Lösungen für schwerbehin-derte oder gleichgestellte Kollegen entwickeln. Allerdings ist dabei der Rückhalt durch das Unternehmen unerlässlich.
Sabine Vogel
Ein herz für KinderPhilippinen: Spenden für die Taifun-Opfer.
Der Taifun „Haiyan“ hat im No-vember vergangenen Jahres
mit unvorstellbarer Wucht die Phi-lippinen heimgesucht. Der Insel-staat hat schon viele Katastrophen erlebt, aber keine, die so viel zer-störte. Das Leid der Menschen hat die Arbeitsgemeinschaft der Be-triebsräte bewogen, in der GMH Gruppe eine Spendenaktion zu or-ganisieren. Allein bei der GMHüt-te kamen mehr als 9.000 Euro und bei Dieckerhoff Guss, wo sich die Kollegen immer besonders enga-gieren, 3.300 Euro zusammen. Ins-gesamt wurden rund 21.000 Euro gesammelt.
Die Geschäftsführung der Hol-ding wird diesen Betrag auf 30.000 Euro aufstocken und an terre des hommes, einen langjährigen Ko-operationspartner, überweisen. Die Organisation leistet Nothilfe in abgelegenen Regionen der Insel Samar und auf der Insel Manicani.
Auf Manicani und Tubabaw werden 850 Familien medizinisch versorgt – u. a. mit Impfstoff gegen Tetanus, Medikamenten gegen Lungenentzündung und Durchfall,
proteinhaltigen Nahrungsmitteln, Moskitonetzen, Decken, Solar-lampen und Hygieneartikeln wie Seife und Windeln. Bewährter Pro-jektpartner ist die Medical Action Group mit einem Netzwerk von rund 250 Ärzten, Gesundheitsfach-kräften, Krankenschwestern und Psychologen.
terre des hommes unterstützt zudem Projekte zum Kinderschutz und zur psychosozialen Betreuung traumatisierter und verängstigter Kinder. Philippinische Koopera-tionspartner haben in der Stadt Tacloban begonnen, Schutzpro-gramme für Kinder aufzubauen.
In San Jose haben philippini-sche Experten Räume für 960 Kin-der eingerichtet. Dort können sie sicher medizinisch versorgt wer-den. Speziell geschulte Freiwillige betreuen Kinder, die Angehörige verloren haben oder unter Ängsten leiden. Zudem erneuert man Well-blechdächer von Privathäusern und fördert den Wiederaufbau des Krankenhauses in Tacloban und der Grundschule auf Manicani.
Wilfried Brandebusemeyer
Dank allen Spendern, die sich mit großen oder kleinen Beträgen beteiligt haben und dadurch ermöglichen, diesen Kindern zu helfen. Foto: terre des hommes
Windhoff · Ein guter Ruf geht um die Welt: Werkstattausrüstung nach Neuseeland geliefert. Lesen Sie mehr darüber
auf Sei te 13
iAG magnum · Geschichten, die das Leben schreibt: Knochen-mark-Empfängerin trifft ihren Le-bensretter. Lesen Sie mehr darüber
auf Sei te 12
Gmh Gruppe · Das sollte man sich näher ansehen: Neue Schutz-brillen helfen auch bei Weitsicht weiter. Lesen Sie mehr darüber
auf Sei te 12

glück auf · 1/2014 ........... 3
GMH Gruppe
EEG-härtefallregelung ist ein muss Ohne Stahl keine Industrie, ohne Industrie keinen Wohlstand und ohne Wohlstand keine Stabilität.
i nTErV iEW
die deutsche Wirtschaft steht vor einer großen Herausforderung, was die energie- und Klimapoli-tik betrifft. denn noch ist nicht geklärt, wie man die energie-wende meistern will. die deut-sche Stahlindustrie fordert des-halb seit Jahren eine offene de-batte über eine energie- und Kli-mapolitik, die die industriellen interessen hierzulande stärker berücksichtigt. Hohe energie-kosten, die im europäischen Ver-gleich kaum wettbewerbsfähig sind, und das Verfahren der euro-päischen Union gegen die Öko-stromrabatte des erneuerbare- energien-Gesetzes (eeG) belasten die heimische Wirtschaft stark. glückauf sprach darüber mit Pe-ter van Hüllen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Georgsma-rienhütte Holding GmbH:
glückauf: Das Jahr 2013 verlief für die deutsche Stahlindustrie unerfreu-lich, manche sprechen sogar von einem Krisenjahr. Wie beurteilen Sie das vergangene Jahr?Peter van hüllen: 2013 war in der Tat ein schwieriges Jahr für die hie-sige Stahlindustrie. Das hat meh-rere Gründe. Zunächst einmal sei die wirtschaftliche Situation in Europa genannt, die sich auch auf die Stahlindustrie auswirkte. Rück-läufige Nachfrage in den Märkten hat zu einem Überangebot und dadurch zu einem erheblichen Er-lösdruck geführt. Demgegenüber standen im gleichen Zeitraum stei-gende Vormaterial- und Rohstoff-preise. Wenn auf der einen Seite die Einnahmen wegbrechen und auf der anderen die Kosten steigen, entsteht ein Ungleichgewicht, das nur schwer zu kompensieren ist. Ein weiterer Grund liegt im außer-europäischen Raum. In den soge-nannten BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China war die bisher boomende Konjunktur 2013 leicht rückläufig.
Der Ifo-Geschäftsklima-Index – Stim-mungsindikator der deutschen Wirt-schaft – zeigt nach oben. Wie stabil schätzen Sie die prognostizierte kon-junkturelle Erholung für 2014 ein?van hüllen: Es gibt erste Anzei-chen für eine Belebung der Nach-frage. Die steigenden Exporte aus Deutschland werden im Moment vor allem von der hiesigen Auto-mobilindustrie angetrieben. Im Januar ist die Pkw-Produktion um 11 Prozent gegenüber dem Vorjah-resmonat gestiegen. Diese erfreu-liche Entwicklung zeigt sich aller-dings nicht in allen Branchen. Im Maschinen- und Großmotorenbau ist das Bestellverhalten nach wie vor unbefriedigend. Die Offshore-Industrie als ein Treiber der Ener-giewende ist nahezu zum Erliegen gekommen. Es zeigt sich also ein zweigeteiltes Bild. Von einer alle Märkte übergreifenden konjunk-turellen Erholung gehe ich derzeit deshalb nicht aus.
Die deutsche Energiepolitik beschäf-tigt die Industrie und ganz besonders die energieintensive Stahlindustrie. Vielfältige Eingriffe in den Markt haben die Kosten der Energiewende deutlich in die Höhe getrieben. Ist eine sichere, bezahlbare und ökologisch
verträgliche Energieversorgung in Deutschland überhaupt möglich? van hüllen: Als Unternehmens-gruppe in der Grundstoffindustrie sind wir in unseren Stahlwerken, Schmieden und Gießereien da-rauf angewiesen, im internatio-nalen Wettbewerb konkurrenzfä-hige Strompreise zu haben. Es ist in höchstem Maße unredlich, die Wahrheit über die Energiewen-de zu verschweigen: Sie wird eine Menge Geld kosten. Damit das energiewirtschaftliche Zieldreieck – Versorgungssicherheit, Preiswür-digkeit und Umweltverträglichkeit – nicht aus dem Lot gerät, muss die Politik für alle drei Aussagen ver-bindliche und verlässliche Zielvor-gaben definieren, auf deren Basis nachhaltige unternehmerische Entscheidungen getroffen werden können. Wenn Energie am Stand-ort Deutschland bezahlbar bleibt und auf internationalem Niveau kein komparativer Wettbewerbs-nachteil besteht, hat die Stahl-industrie in Deutschland eine Zu-kunft.
Die Kabinettsvorlage zur EEG-Novel-le geht im Bundestag Anfang April in die erste Lesung. Wie beurteilen Sie die Pläne der Großen Koalition zur Reform des EEG-Gesetzes?van hüllen: Das Gesetz muss von Grund auf reformiert und an die veränderte Situation angepasst werden. Es kann nicht sein, dass immer mehr Umlage bezahlt wer-den muss, aber gleichzeitig der CO2-Ausstoß steigt. Das derzeiti-
ge System führt die durchaus gu-ten und ehrenhaften Ziele der Energiewende ad absurdum und ist von kaum noch jemandem zu verstehen – weder von den Fach-leuten aus der Industrie, noch von den Bürgerinnen und Bürgern. Die Große Koalition muss dringend Maßnahmen ergreifen, um die Hö-henflüge der Belastungen zu brem-sen, aber auch Regelungen finden, wie energieintensive, im interna-tionalen Wettbewerb stehende In-dustrien ohne Nachteile auch in Zukunft am Standort Deutschland produzieren können.
In welchen Dimensionen bewegen sich die Belastungen für die Gruppe?van hüllen: Lassen Sie mich ein-fach ein paar Zahlenbeispiele geben, um deutlich zu machen, worüber wir hier sprechen: Die Energiekosten in der GMH Gruppe betrugen 2013 mehr als 200 Mio. Euro inklusive EEG, ohne Strom-steuer. 6 der 47 Unternehmen der GMH Gruppe fallen derzeit unter die Härtefallregelung des EEG, also unter die Teilbefreiung. Fällt die-se Teilbefreiung weg, werden die-se sechs Unternehmen mit rund 50 Mio. Euro Mehrkosten belastet. Bei aller Anstrengung: Diese Kos-ten kann keiner kompensieren.
Was erwarten Sie von der Politik im Hinblick auf das EU-Beihilfeverfahren zu den Ausnahmeregelungen von der EEG-Umlage?van hüllen: Das von der EU-Kom-mission eingeleitete Untersu-chungsverfahren wegen unzu-lässiger Beihilfen im Rahmen des EEG-Gesetzes ist eine Bedrohung für den Industriestandort Deutsch-land. Die Härtefallregelung, die eine Entlastung für energieinten-sive Unternehmen von der Um-lage für erneuerbare Energien vorsieht, ist erforderlich. Nur so lassen sich Wettbewerbsnachteile ausgleichen, die deutsche Unter-nehmen gegenüber Mitbewerbern
in solchen Ländern haben, in denen vergleichbare Kosten aus der Förderung erneuerbarer Ener-gien nicht anfallen. Nach unserer Auffassung handelt es sich bei der Härtefallregelung nicht um eine staatliche Beihilfe. Ein Wegfall der Härtefallregelung oder sogar eine Rückzahlung wäre für viele Indus-trieunternehmen existenzbedro-hend und für den Industriestand-ort Deutschland eine Katastrophe. Die wirtschaftliche Leistungskraft, der Wohlstand unseres Landes und Abertausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.
Haben Sie dafür Zahlenbeispiele?van hüllen: Über 50 Prozent der deutschen Warenexporte entfal-len auf stahlintensive Güter wie zum Beispiel Automobile, Metall-waren, Maschinenbau. 75 Prozent des deutschen Außenhandelsüber-schusses – rund 245 Milliarden Euro – werden in Branchen erzielt, die auf innovative, hochleistungs-fähige Stähle angewiesen sind. Sie sehen, die Zukunft des Industrie-standortes Deutschland ist unmit-telbar an wettbewerbsfähige Ener-giekosten gekoppelt. Elektrostahl-produzenten wie die Georgsma-rienhütte, die ja seit jeher perfekte Recyclingbetriebe sind, können auf die Ausnahmen bei der EEG-Um-lage nicht verzichten, um unter wettbewerbsfähigen Bedingun-gen in Deutschland zu produzie-ren. Deshalb erwarte ich von der Politik einen konsequenten und nachdrücklichen Einsatz für die Beibehaltung der bisher praktizier-ten Härtefallregelung. Um Rechts-sicherheit zu schaffen, muss dieses unnötige Verfahren so schnell wie möglich mit einer Bestätigung der Härtefallregelung beendet werden. Alles andere ist für die energiein-tensiven Industrien in Deutsch-land existenzgefährdend.
Wie geht die GMH Gruppe gegen die steigenden Energiekosten an?
van hüllen: Die Unternehmen der GMH Gruppe arbeiten seit Jahren intensiv daran, die Prozess- und die Energieeffizienz zu verbessern: Energiekosten gab es schon immer! Mit Blick auf die knapper werden-den Ressourcen, die steigenden Energiepreise und die zu schützen-de Umwelt haben wir schon immer – und bereits lange vor der Ener-giewende – investiert, Energiever-bräuche reduziert und die Effizienz gesteigert. Als jüngstes Beispiel sei hier eine Maßnahme im Stahl-werk Georgmarienhütte genannt. Seit 2009 ermöglicht eine noch-mals verbesserte Abgasanlage am Elektroofen die Nutzung von aus Abwärme erzeugtem Dampf. Wir gewinnen jetzt so viel Dampf, dass wir ihn beim Betrieb der Vakuum-Stahlentgasung einsetzen können. Damit entfällt zu einem Groß-teil die sonst notwendige separate Dampferzeugung mit Erdgas. Aus diesem System wurden und werden heute zudem Heizungssysteme ge-speist. Zahlreiche weitere Einzel-bausteine fügen sich im Energiema-nagement zusammen. So wurden zum Beispiel Isolierungen verbes-sert, Heizsysteme optimiert, unnö-tige Einschaltzeiten bei Maschinen reduziert und Beleuchtungen opti-miert, alles gute Beispiele für intel-ligente und ressourcenschonende Energieeffizienzverbesserung.
Hat denn die Belegschaft mitgezogen?van hüllen: Ein Großteil nahm an Energieschulungen teil und wurde so für das Thema sensibilisiert. Als erstes Stahlwerk in Deutschland wurde 2010 die Georgsmarienhütte GmbH gemäß der ISO-Norm 50001 zertifiziert. Weitere Unternehmen der GMH Gruppe wie Stahlwerk Bous, Schmiedewerke Gröditz, Energietechnik Essen, Dieckerhoff Guss und Harz Guss Zorge folgten. Aber: Die Stahlerzeugung stößt auch an physikalische Grenzen, sodass ein weiteres großes Einspar-potenzial in diesem Bereich tech-nisch kaum noch zu generieren ist.
Aus Unternehmersicht: Welche Forde-rung haben Sie an Deutschland?van hüllen: Als Unternehmer be-finden wir uns derzeit in Deutsch-land in einem Handlungsvakuum. Auf welcher energiepolitischen Ba-sis können wir verantwortungsbe-wusst Entscheidungen über Inves-titionen treffen? Deshalb sehe ich eine der großen Herausforderun-gen für unser Land darin, schnellst- möglich die Ziele, die Umsetzungs-maßnahmen und die Zeitfaktoren der Energiewende klar zu definie-ren und gleichzeitig die Stärkung des Industriestandortes Deutsch-land voranzutreiben. Denn: Ein einmal – an einen anderen Stand-ort auf der Welt – verlorener Indus-triearbeitsplatz kommt so schnell nicht zurück.
Welche einschneidenden Folgen hätte eine De-Industrialisierung?van hüllen: Dies sieht man ja am Beispiel Großbritannien. Wenn wir also auch in Zukunft Arbeits-plätze in der Industrie haben wol-len, müssen wir hierzulande für Rahmenbedingungen sorgen, die ein wettbewerbsfähiges Agieren auf den internationalen Märkten ermöglichen. Mein Credo lautet: Ohne Stahl keine Industrie, ohne Industrie keinen Wohlstand und ohne Wohlstand keine stabilen ge-sellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Wer sollte dies aus der eigenen Geschichte besser wis-sen als wir Deutsche?
Vielen Dank für das Gespräch.
Peter van Hüllen, Vorsitzender der Geschäftsführung Foto: Uwe Lewandowski
Bisher
EEG- Umlage 2014
Zukünftig möglich …
Entlastung bes. Ausgleichsregelung
AusnahmeEigenstromerzeugung
Gesamt-Belastungca. 1.600
ca. 3
00
in mio.
Wegfall der EEG-Entlastungen führt in der Stahlindustrie zu erheblichen Kostensteigerungen
Bis
heri
ge E
ntla
stun
gen
Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl: Eigene Berechnungen auf Basis 2014
Grafik: elemente designagentur
ca. 7
00
ca. 6
00

glück auf · 1/2014 ........... 4
GMH Gruppe
Stahl bleibt „Werkstoff Nr. 1“Weshalb Karbon im Automobilbau nur eine Nebenrolle spielen kann.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GMH Gruppe, liebe Leserinnen und Leser,
wenn Dinge bewegt oder angetrieben werden, spielt das Gewicht von Werkstoffen in der industriellen Fertigung eine große Rolle. Ob Automobil-, Schiffs- und Flugzeugbau oder Windenergie: Je leichter, desto besser. Logisch, dass man per-manent nach alternativen Werkstoffen sucht, die noch leichter, wirtschaftlicher, umweltfreundlicher – und dennoch technisch sicher sind.
Das gilt natürlich auch für den Automobilbau. Denn dort versprechen leichtere Werkstoffe eine deutliche Reduzierung des Gesamtgewichts – und damit des Kraftstoffverbrauchs.
Neuester Hoffnungsträger sind karbonfaserverstärkte Kunst-stoffe (CFK). Aus der Formel 1 sind sie bereits seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Die Frage ist nur, ob und wie sie im Auto-mobilbau Fuß fassen und welche anderen Werkstoffe sie ver-drängen können.
Gehört Stahl im Automobilbau bald „zum alten Eisen“? Ich behaupte: Stahl wird auch in Zukunft Werkstoff Nr. 1 in der Automobilindustrie bleiben. Dies gilt vor allem für die Stahlsor-ten, die in Georgsmarienhütte produziert werden: hoch- und höchstfeste Stähle für den Power Train und Sicherheitsteile wie z. B. Lenkungen in Fahrzeugen.
Doch warum ist dieser Stahl auch zukünftig so konkurrenz-fähig? Weil nur Stahl die Kraftübertragung zwischen einzel-nen Komponenten gewährleisten und die Anforderungen an Hochsicherheitsteile im Antriebsstrang erfüllen kann. Weil Stahlbauteile wesentlich wirtschaftlicher zu produzieren sind. Weil Recycelbarkeit und ökologischer Fußabdruck eine konkur-renzlos gute Ökobilanz aufweisen. Und weil Stahl mit seinen Potenzialen – übrigens auch was das Gewicht für Bauteile angeht! – noch lange nicht am Ende ist, wie Einsparungen und Weiterentwicklungen hoch- und höchstfester Stähle beweisen. Die Initiative „Massiver Leichtbau“ hat gerade errechnet, dass 40 kg Gewichtsersparnis pro Fahrzeug mit massiven Stahl-leichtbauteilen möglich sind.
Deshalb nehmen CFK-Bauteile bislang lediglich einen Nischenplatz gegenüber anderen Konstruktionswerkstoffen ein (2012 wurden rund 70.000 t CFK hergestellt, davon weniger als 10 Prozent für die Automobilindustrie). Und vielleicht wer-den sie sich ähnlich wie Aluminium zwar nicht als Stahlalterna-tive, aber bei speziellen Anwendungen etablieren können.
Ein detaillierter Vergleich zwischen den beiden Werkstoffen zeigt, warum:
Beim CFK gilt es zunächst einmal zwischen zwei Anwen-dungen zu unterscheiden: Karosserie und Antriebsstrang.
• Im Karosseriebau wird bereits seit Langem der Einsatz von Karbon entwickelt und erprobt. Als eines der ersten Serien-fahrzeuge ist unlängst der BMW i3 mit einer Karbon-Außen-haut an den Start gegangen.
• Im Antriebsstrang ist bereits heute der Einsatz von Karbon vorstellbar – bis hin zu ganzen Radaufhängungen. Teils wird er bereits praktiziert. So lässt sich beispielsweise problemlos eine Kardanwelle aus Karbon fertigen und einbauen, da hier lediglich Zug- und Scherkräfte wirken. Aber schon bei der Kraftübertragung auf andere Komponenten stoßen karbon-faserverstärkte Kunststoffe an ihre Grenzen – beispielsweise bei der Drehbewegung vom Getriebe auf die Kardanwelle und von der Welle auf das Achsgetriebe. Hier sind Zahnrad-ritzel aus Stahl unerlässlich. Denn nur Stahl kann die hohe Flächenpressung an den Zahnflanken „verkraften“. Auch alle anderen Bauteile lassen sich grundsätzlich kom-
plett aus Karbon fertigen – wenn man zwei gravierende Nach-teile in Kauf nimmt: das deutlich größere Volumen der Bau-teile (und damit ein wesentlich höherer Platzbedarf!) und die erheblich höheren Kosten sowohl für die Faser- als auch für die Bauteilherstellung.
Eine Studie von Roland Berger und VDMA zeigt die Grö-ßenordnungen: Die Gesamtkosten eines im RTM-Verfahren (Spritzpressen) hergestellten CFK-Bauteils liegen gegenwärtig noch um 500 bis 600 Prozent über denen eines Stahlbauteils. Daran dürfte sich absehbar wenig ändern (die Studie legt für
die CFK-Bauteilherstellung bis 2020 ein Kostensenkungspoten-zial von etwa 30 Prozent zugrunde). Allein schon diese hohen Kosten verhindern, dass Karosserie- und Antriebskomponenten in Mittel- und Großserie aus CFK gefertigt werden.
Doch selbst in ihrer ureigenen Domäne – dem geringen Gewicht – kann sich CFK nicht sicher sein: Schon seit Jahren entwickeln und arbeiten Stahlhersteller und Forschungseinrich-tungen erfolgreich an innovativen Stahlwerkstoffen: hoch- und höchstfeste Stähle. Ihre speziellen Eigenschaften erfüllen nicht nur Anforderungen nach noch mehr Sicherheit: Sie ermög-lichen auch, das Gewicht von Stahlbauteilen deutlich zu redu-zieren – und dadurch den Kraftstoffverbrauch zu senken.
Auch in Sachen Umweltverträglichkeit ist Stahl gegenüber Karbon einzigartig. Denn Stahl lässt sich sowohl primär als auch sekundär mit einem deutlich geringeren Energieeinsatz und niedrigeren CO2-Emissionen herstellen. Und Stahl ist voll-ständig ohne Qualitätsverlust immer wieder recycelbar und in den Werkstoffkreislauf zurückzuführen.
Für Bauteile aus Karbon dagegen gibt es noch kein ver-gleichbares, funktionierendes Recycling-Konzept. Karbon lässt sich zurzeit, wenn überhaupt, nur thermisch verwerten.
Aber es gibt noch einen weiteren maßgeblichen Faktor. Er könnte langfristig darüber mitbestimmen, welche der verschie-denen Leichtbauwerkstoffe Stahl, Aluminium und Karbon mit welchen Anteilen zukünftig im Fahrzeug verbaut werden: der ökologische Fußabdruck.
Von vielen Seiten wird gefordert, die Besteuerung von Fahr-zeugen auf eine neue Grundlage zu stellen. Anstelle nur den CO2-Ausstoß pro gefahrenen Kilometer zu bewerten („end of pipe“, also das, was aus dem Auspuff herauskommt), muss man eine Lebenszyklusanalyse des Fahrzeugs erstellen, bei der sowohl der Bau des Fahrzeugs, seine Nutzung wie auch die spätere Entsorgung bzw. Wiederverwendung einbezogen wer-den. Das nennt man LCA, Life Cycle Analysis.
Gerade vor diesem Vergleich muss sich Stahl nicht scheuen. Denn im Vergleich zu allen anderen Konstruktionswerkstoffen weist Stahl den kleinsten ökologischen Fußabdruck aus.
Fazit: Vor allem hochfeste Stähle sind gegenüber CFK deut-lich im Vorteil – technologisch, wirtschaftlich, ökologisch. Somit ist Stahl nach wie vor der Werkstoff der Wahl, wenn es darum geht, auch in Zukunft bezahlbare Mobilität für die brei-te Masse der Automobilkäufer weltweit sicherzustellen.
Und genau darum geht es doch.
Glück aufIhr
Foto: Paul Ripke
HIER SPRICHT DER GESELLSCHAFTER
KurznEWS
DrahtigHGZ · Die Gießerei hat eine neue Drahtbehandlung für GJV- und GJS-Legierungen in Betrieb ge-nommen. Dadurch ist eine Ferti-gung mit bisher nicht bekannter Prozesssicherheit möglich. Zudem reduzieren sich die arbeitsplatzspe-zifischen Belastungen um mehr als 50 Prozent. Der besondere Clou: Die Anlage wurde überwiegend in Eigenleistung erstellt.
>>> Bericht auf Seite 18
BeweglichKranbau Köthen · Kleine Krane können technisch genauso an-spruchsvoll sein wie große Krane. Für die Vallourec Deutschland GmbH in Düsseldorf haben die Köthener gleich zwei solcher Kra-ne gefertigt. Trotz beengter Platz-verhältnisse können mit ihnen auch längere Lasten unterhalb der Brücke mit dem Kran gedreht wer-den – und das bei angeschlagener Lasttraverse.
>>> Bericht auf Seite 18
BeruhigtBVV · Güterwagen erzeugen vor allem auf Bahntrassen, die hohl-wegartig umgrenzt sind, Lärm, der den Anwohnern nicht zuzumuten ist. Jetzt hat der Bochumer Verein eine Rad-Schallabsorber-Lösung entwickelt, die – obwohl noch nicht alle Möglichkeiten ausgereizt sind – deutlich mehr Lärm dämpft als bisherige Lösungen.
>>> Bericht auf Seite 19
Antriebig
iAG Magnum · Seit mehr als zwei Jahrzehnten liefert das Unter-nehmen Zahnstangen, die bei der Herstellung nahtloser Rohre für Antrieb sorgen. Dabei kann es Segmentlängen von bis zu 18 m anbieten (mit geschlossener Pfeil-verzahnung). Ob von Schwester-
unternehmen oder mit externen Partnern gefertigt: IAG Magnum begleitet und überwacht den ge-samten Fertigungsprozess.
>>> Bericht auf Seite 19
GeodätischKranbau Köthen · Höchste Prä-zision für die Qualitätssicherung: Mit ihrer neuen 3-D-Messtechnik inklusive SA-Software und geodäti-schen Ansätzen können die Kran-bauer den gesamten Fertigungspro-zess mess- und analysetechnisch ganzheitlich begleiten – von der 3-D-Konstruktion über Zuschnitt, Zusammenbau und Schweißen bis hin zu Auslieferung und Montage.
>>> Bericht auf Seite 20
zweckdienlichMannstaedt · Bei einem Workshop trafen sich Mannstaedt-Experten mit dem Konzern-Arbeitskreis „Hubgerüste“ der Jungheinrich AG – des weltweit drittgrößten Ga-belstaplerherstellers. Gemeinsam erarbeitete man Optimierungen für die Mastprofile der Hubgerüste. Zugleich präsentierte Mannstaedt Verfahren zur Weiterveredelung
von Profilen, die bei den Gästen auf positive Resonanz stießen.
>>> Bericht auf Seite 21
zwiespältig
SWG/GWB · Die Teilnahme an der EuroMold 2013 (Weltmesse für Werkzeug- und Formenbau, Design und Produktentwicklung) war für die Gröditzer durchaus erfolgreich. Dennoch diskutierte man, ob es Alternativen zur EuroMold gäbe – und entschied sich letztlich dafür, erneut daran teilzunehmen.
>>> Bericht auf Seite 22
StimmigSWG/GWB · Die EUROGUSS 2014 stellte einen neuen Aussteller- und
Besucherrekord auf. Von der guten Stimmung profitierten auch die Schmiedewerke Gröditz und die Gröditzer Werkzeugstahl Burg, die dort mit einem Messestand vertre-ten waren. Wegen der guten Reso-nanz will man 2016 erneut an der EUROGUSS teilnehmen.
>>> Bericht auf Seite 22
neugierigGMHütte · Arbeitssicherheitsspe-zialisten des Stahlwerks besuchten die Arbeitsschutzmesse A+A in Düsseldorf. Ihr besonderes Augen-merk galt einem belüfteten Schutz-helm der neuesten Generation – einer Kombination aus Kopf-schutz, Augenschutz, Staubmaske und Hitzeschutzmaske, die derzeit im Stahlwerk eingeführt wird.
>>> Bericht auf Seite 22
WählerischGMHütte · Wie jedes Jahr muss-ten Schülerinnen und Schüler der Realschule Georgsmarienhütte für die letzten beiden Schuljahre ihren Schwerpunkt wählen. Dabei standen Französisch, Gesundheit & Soziales, Wirtschaft oder Technik

glück auf · 1/2014 ........... 5
GMH Gruppe
KurznEWS
CFK-Serienfertigung als absolute novitätGWB · BMW-Elektroauto trägt CFK-Karosserie – gefertigt mithilfe von Gröditzer Werkzeugstahl.
2013 präsentierte BMW sein brandneues vollelektrisches i3-
Fahrzeug der Öffentlichkeit. Die absolute fertigungstechnische Be-sonderheit dieses Fahrzeuges: sei-ne superleichte, aus Karbonfasern (CFK) bestehende Kunststoff-Ka-rosserie, die erstmals in Großserie hergestellt wurde.
Die Serienreife musste über jah-relange Entwicklungsarbeit vorbe-reitet werden. Daran beteiligt war
auch die Gröditzer Werkzeugstahl Burg. Sie lieferte den Werkstoff für die speziell hergestellten, schweren RTM-Werkzeuge (Harz-Transfer-Formen).
Dazu waren mehrere Tausend Tonnen des in Gröditz geschmie-deten und wärmebehandelten Werkzeugstahls erforderlich. Die schweren hochfesten Stahlplatten der Güte 2738 wurden anschlie-ßend exakt nach Zeichnung in
Burg vorbearbeitet und an BMW ausgeliefert. Dort haben speziali-sierte Werkzeugbauer die Konturen des späteren Karosserieteils präzise in jeweils zwei große Werkzeug-stahlplatten hineingearbeitet.
Bei der Produktion wurde dann in riesigen Pressenanlagen eine zu-geschnittene Karbon-Fasermatte in das geöffnete Werkzeug eingelegt und in die Form gepresst. Direkt im Anschluss hat man dann ein spezielles Harz unter Hochdruck in die Form gefüllt. Das gepresste Kar-bon-Teil musste dann bei 100 Grad Celsius im Werkzeug noch kurzzei-tig aushärten.
Mit diesem Verfahren wurde er-möglicht, was bislang nicht mög-lich war: die industrielle Serien-fertigung von CFK-Teilen für den automobilen Leichtbau – unter der Mitwirkung von hochwertigem Werkzeugstahl aus Gröditz.
Die CFK-Bauteile werden üb-rigens sowohl im BMW-Kompo-nenten-Werk in Landshut als auch direkt im neuen Montagewerk in Leipzig gefertigt.
Walter Grimm
BMW i3: Leichtbau mit Karbon-Karosserie. Quelle: BMW Group
Herstellung von Karbon-Karosserieteilen im BMW-Werk Landshut Quelle: BMW Group
zur Wahl. Um ihnen die Entschei-dung zu erleichtern, hatte ihnen die GMHütte ermöglicht, in der Ausbildungswerkstatt Praxiserfah-rungen zu sammeln.
>>> Bericht auf Seite 23
FreigiebigSWG · Angehende Schüler und Studierende wollen umworben sein. Deshalb nahmen die Schmie-dewerke erneut an der Orientie-rungsmesse ORTE der TU Bergaka-demie Freiberg teil. „Im Gepäck“ hatte man jede Menge Praktika und Praxissemester sowie Themen-vorschläge zu Bachelor-, Master-, Diplom- und Studienarbeiten. Dadurch fiel es dem SWG-Team leicht, den Nachwuchs für sein Unternehmen zu interessieren.
>>> Bericht auf Seite 23
PraktischMannstaedt · „Fliegender Berufs-start e.V.“ ermöglicht Schulab-gängern, mehr Klarheit über ihre Berufswahl zu gewinnen. Sie ab-solvieren dabei auch eine Grund-bildung und ein Praktikum. Mann-staedt unterstützt das Projekt und bietet Praktikumsplätze für zwei der Jugendlichen an.
>>> Bericht auf Seite 23
GegenwärtigSWG · Auch die Schmiedewerke waren auf der gemeinsamen Aus-bildungsbörse von Arbeitsagentur Riesa und Jobcenter Landkreis Meißen im BSZ Riesa. Mit rund 50 anderen regionalen Unternehmen, Kammervertretern und Vermitt-lungsfachkräften des Arbeitgeber-Service standen sie den Jugend-lichen Rede und Antwort. Mit im SWG-Team: zwei Azubis.
>>> Bericht auf Seite 23
ElektrischGMHütte · Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GMHütte können neue Entwicklungen im Auto-mobilbau im wahrsten Sinne des Wortes selbst „erfahren“. Das Unternehmen bietet ihnen die Möglichkeit, ein Elektrofahrzeug zu erproben. Dieses Mal ist es der BMW i3. Bereits 2011 hatten sie den eWolf DELTA1 des Deutschen Forschungszentrums für Künstli-che Intelligenz und 2012 mit dem Opel Ampera eines der ersten Se-rienfahrzeuge testen können.
>>> Bericht auf Seite 23
hitzigGMHütte · Bei einem Übergussver-such im Stahlwerk wurde deutlich: Die dort getragenen Schmelzer-stiefel schützen die Füße der Mit-arbeiter – selbst wenn 1.550 Grad Celsius heißer Stahl in den Stiefel-bereich zwischen Schaft und Fuß-rücken läuft. Die Arbeitssicherheit
hat somit die Gewissheit, das rich-tige Schuhwerk gewählt zu haben.
>>> Bericht auf Seite 24
Beharrlich
SHB · Nach einem Jahr intensiver Vorbereitung wurde die Saalfelder Hebezeugbau erfolgreich nach SCC-Checkliste zertifiziert – kom-biniert mit einem QM-Rezertifizie-rungsaudit nach ISO 9001.
>>> Bericht auf Seite 24
FachkundigMannstaedt · Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Umwelt-beauftragten der GMH Gruppe trafen sich bei Mannstaedt in Troisdorf zu einem Informations- und Erfahrungsaustausch. Wäh-rend man Betriebsbesichtigung und Kulturprogramm gemeinsam absolvierte, ging man in den Fach-klausuren getrennte Wege.
>>> Bericht auf Seite 24
ErfinderischMWL · Brasilien erlebte einen be-sonders heißen Sommer, der vor allem den Mitarbeitern in den Werkshallen zu schaffen machte – bis der Kollege Jobair Rodrigue in Aktion trat. Er optimierte das dor-tige Fensteröffnungssystem, indem er ein neues Gestänge konzipierte und anfertigte – und sorgte da-durch für frischen Wind.
>>> Bericht auf Seite 25

glück auf · 1/2014 ........... 6
schwerpunkt :
iDEEn, DiE DiE WELT VEränDErT hABEn
EINE BILDERREISE
heureka – ich hab’s!Ideen sind der Treibstoff, der Innovationen voranbringt. Fragt sich nur, wie man auf Ideen kommt – vor allem für innovationsabhängige Unternehmen.
W ie kommen Sie auf Ideen, wenn Sie welche brauchen?
Gehen Sie mit der Aufgabe, die Sie lösen wollen, spazieren? Sezieren Sie Ihr Problem mit System? Ver-lassen Sie sich auf Ihren Bauch? Brauchen Sie einen Gegenüber, der Ihnen geduldig zuhört, damit Sie das Problem erläutern und dabei Lösungen entwickeln können? – eine Methode, die bereits Heinrich von Kleist in seinem 1805 veröf-fentlichten Aufsatz „Über die all-mähliche Verfertigung der Gedan-ken beim Reden“ anempfahl.
Andere wiederum setzen auf Be-wegung, um ihren Erfindungsgeist in Gang zu bringen. Sie gehen jog-gen, waschen Geschirr ab oder räu-men im Zimmer umher – alles Auf-gaben, die ihr Körper im Standby-Modus erledigen kann, ohne allzu viel Konzentration abzuziehen. So kann sich ihr Kopf in aller Ruhe der Ideenfindung widmen – ähn-lich wie Mütter, die ihre Kinder im Kinderparadies abgeben, um unge-stört shoppen gehen zu können.
Andere haben die besten Ideen kurz vorm Einschlafen, im Nie-mandsland zwischen Traum und Wirklichkeit. Und damit nichts
verloren geht, legen sie sich Notiz-buch und Stift auf den Nachttisch. Eine Methode mit Tücken, wie eine Anekdote des Regisseurs Bil-ly Wilder zeigt. Er hatte im Halb-schlaf die Anfangsszene für seinen nächsten Film notiert und gratu-lierte sich noch im Wegdämmern für seine oscarreife Idee – bis er am nächsten Morgen sein Gekrakel als „Boy meets Girl“ entzifferte.
Was aber, wenn Ihnen nichts einfällt? Für Sie als Privatmensch mag das in der Regel nicht lebens-wichtig sein. Für viele Unterneh-men aber sind gute Ideen unerläss-lich, um innovative Produkte, Dienstleistungen, Marketingstrate-gien, Produktionsabläufe und an-deres mehr zu entwickeln. Bleiben sie aus, droht die Krise.
Kreativitätstechniken verspre-chen Abhilfe. Zugegeben: Jahr-hundertelang sind die Spitzenleute in Forschung, Wissenschaft und Technik ohne Kreativitätssitzun-gen, Workshops, Coachings und Berater ausgekommen. Ein Archi-medes, Leonardo da Vinci oder Ko-pernikus musste sich mit dem be-gnügen, was ihm intuitiv an Krea-tivität zuflog. Fachliteratur war
nicht aufzutreiben, der Austausch mit Kollegen schwierig. Aber sie mussten auch nicht fortgesetzt Ideen auf Knopfdruck produzieren. Denn das will gelernt sein.
Einst galt Kreativität (creare = erschaffen, schöpfen) als Chefsa-che, weil den Göttern vorbehalten, menschliche Schöpfungskraft als Ausdruck göttlicher Gnade. Heute gilt: „Jeder Mensch ist kreativ“ – so der programmatische Schlacht-ruf aus den 1950er Jahren, geprägt vom amerikanischen Psychologen Joy Paul Guilford, einem der Pio-niere der Kreativitätsforschung.
Damals setzte auch die Entmys-tifizierung kreativer Prozesse ein, als US-Psychologen die Kreativi-tätsforschung für sich entdeckten. Dass ihre Ergebnisse so schnell in Umlauf kamen, verdankten sie dem „Sputnik-Schock“, als die UdSSR ihren Satelliten vor den USA ins All schoss. Amerikanische Mili-tärs und Wirtschaft nutzten alles, was versprach, den vermeintlichen technologischen Rückstand zur So-wjetunion so schnell wie möglich wettzumachen – auch Ergebnisse der Kreativitätsforschung: Kreativi-tätstechniken machten Karriere.
Es ist noch gar nicht so lan-ge her, da hatten im öffentlichen Bewusstsein Werbeagenturen die Kreativität für sich gepachtet. De-ren Mitarbeiter galten als „Kreative par excellence“. Heute weiß man, dass kreatives Potenzial in allen Unternehmen schlummert. Des-halb gehen immer mehr Unterneh-men dazu über, ihre Mitarbeiter in die Ideenfindung einzubinden. Ob Schreibtisch oder Werkbank: Für ein Innovationsmanagement sind alle Bereiche und Ebenen poten-zielle Ideenquellen.
Mit gutem Grund. Denn noch nie war die Chance so groß wie heute, seiner Kreativität bzw. Ideen mit neuen Methoden auf die Beine zu helfen. Ungezählte Webseiten öffnen kostenlos ihre Trickkisten und zeigen, wie man Ideen entwi-ckeln kann. Allein www.mycoted.com listet rund 350 Kreativitäts-techniken auf – von A wie „AIDA“ über S wie „SCAMMPERR“ bis hin zu W wie „Working with Dreams and Images“.
Die zwei wichtigsten Fragen beantworten solche Webseiten al-lerdings nicht: Welche dieser Me-thoden passt für welche Art von Mitarbeitern, um welches Problem zu lösen bzw. welche Ideen zu ent-wickeln? Und wie wende ich die Methode richtig und effizient an? Ohne professionelle Hilfe kommt man da kaum weiter.
Doch wie gehen diejenigen da-mit um, denen all diese Ideen ab-verlangt werden: die Mitarbeiterin-nen und Mitarbeiter? Wie verkraf-ten sie die neue Herausforderung?
Um den Ideenstrom zu organi-sieren, stützen sich viele Unterneh-men auf KVP, Ideenmanagement oder andere Innovationsstrategien: All diese Optimierungskonzep-te funktionieren letzten Endes als Endlosschleife. Im Klartext: Der Prozess, den sie anstoßen, ist nie abgeschlossen. Immer wieder heißt es für Mitarbeiter, von vorn begin-nen, neue Ideen entwickeln, den nächsten Schritt tun. Immer wie-der sollen sie Altes verwerfen und Neues suchen. In immer schneller kreisenden Innovationszyklen.
Nicht wenige fühlen sich da-durch überfordert und bestraft wie einst Sisyphos. Dem hatten die Götter, so erzählt die Sage, als Buße eine unlösbare Aufgabe zugedacht: Er war dazu verdammt, einen schweren Fels aus dem Tal auf den Gipfel eines steilen Berges zu wuchten. Doch immer wieder, kurz vor dem Gipfel, entgleitet ihm der Fels und rollt ins Tal zurück – und die Tortur beginnt von vorn.
Doch der französische Philo-soph Camus kann diese (Erzähl-)Perspektive nicht teilen. Für ihn gehört der immerwährende Neube-ginn essenziell zur menschlichen Existenz. Er sieht darin das, was menschliche Freiheit überhaupt erst ausmacht: neu beginnen, sich ausprobieren, dem Leben Sinn ge-ben. Er sieht darin keine Strafe, sondern ein Privileg: „Wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Men-schen vorstellen.“
Wenn das mal keine schöne Idee ist …
pkm
Dampfmaschine | 1712
Thomas Newcomen · Die erste funktionierende Dampfmaschine entwickelte Newcomen 1712, um Wasser aus Kohlegruben abzupum-pen (1551 hatte bereits der osma-nische Gelehrte Taqi ad-Din eine Dampfturbine zum Antrieb eines Grillspießes beschrieben). James Watt verbesserte den Wirkungsgrad der Machine derart, dass sie in der Industrie und vor allem auch zum Antrieb von Schiffen und Eisenbah-nen genutzt werden konnte.
Buchdruck | 1440
Johannes Gutenberg · Etwa um 1440 entwickelte Gutenberg aus dem Kon-zept der beweglichen Lettern, das auf frühere koreanische und chinesische Erfinder zurückgreift, und aus der in Deutschland weitverbreiteten Spindel-presse die Druckerpresse. Bis zu dieser Erfindung war die Kopie eines Schrift-werkes ein Monopol von Spezialisten, die zumeist in Klöstern saßen. Der Zu-gang zu Schriften bzw. Büchern wurde somit vereinfacht und verweltlicht.
Foto
s: ©
pan
ther
med
ia.n
et/G
elpi
Jos
é M
anue
l und
Yur
iy C
haba
n; w
ww
.shu
tters
tock
.com
/Hod
ag M
edia
idee

glück auf · 1/2014 ........... 7
schwerpunkt: idee
iDEEn, DiE DiE WELT VEränDErT hABEn
EINE BILDERREISE
Glühbirne | 1876
Thomas Alva Edison · Edison gilt allgemein als Er-finder der Glühlampe. Er hat jedoch lediglich das Konzept der Lichterzeugung mit Strom so wesent-lich verbessert, dass sich die Erfindung gegen die damals vorherrschende Art der Licht-erzeugung
mit Gas durchsetzen konnte. Seine Arbeit baute auf den Ideen vieler anderer Forscher auf, z. B. James Bowman Lindsay, William Robert Grove, Frederick de Moleyns, John Wellington Starr, Alexander Nikolaje-
witsch Lodygin und Joseph Wilson Swan. Bereits 1801 zeigte Louis Jacques Thénard, dass man Metalldrähte durch den galvani-schen Strom zur hellen Glut bringen kann.
Telefon | 1876
Alexander Graham Bell · Die Grundlage zur Entwick-lung des Telefons legte bereits 1837 Samuel F. B. Morse, als er mit dem Morsetelegrafen die Übermittlung von Signalen über elektrische Leitungen umsetzte. Es folg-ten Entwicklungen von funktionie-renden Telefonen u. a. durch In-nocenzo Manzetti, Antonio Meucci, Tivadar Puskás, Philipp Reis, Elisha Gray und Alexander Graham Bell, der schließlich das Wettrennen um die Pa-tentanmeldung gegen Elisha Gray für sich ent-schied.
Stahlerzeugung | 1850–1860
Henry Bessemer · Er entwickelte zwischen 1850 und 1860 ein Verfahren, bei dem ge-schmolzenes Roheisen mithilfe eines Luftge-bläses – der sogenannten Bessemerbirne – in großen Mengen zu Stahl veredelt werden konnte.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die richtung ändern kannWarum Ordnung und eine anregende Arbeitsumgebung so wichtig für kreative Prozesse sind.
Kreativität und Ideenreichtum am Arbeitsplatz – Unterneh-
men rufen danach und Kreative könnten sie gebrauchen. Doch oft herrschen Frust oder dumpfe Rou-tine vor. Dabei reicht nicht sel-ten eine Handvoll Dinge, um sich doch noch kreativ und ideenreich zwischen Büro und Werkbank aus-zutoben – ohne gleich die eigene Arbeitswelt auf den Kopf zu stellen.
„Kein festes Büro, keine festen Arbeitszeiten, keine festen Re-geln“, so stellen sich Experten den Arbeitsplatz der Zukunft vor. Das Fraunhofer Institut Stuttgart er-forscht beispielsweise, wie das Bü-ro der Zukunft aussehen könnte – und probiert es gleich mal aus.
Das „Office21“, in dem die Fraunhofer-Angestellten auch selbst arbeiten, gleicht eher einem gestylten Café als einem Arbeits-
platz: bunte Farben, weiche Möbel sowie Sitzgruppen zum Treffen und Plaudern.
Auch andere Unternehmen ha-ben dies bereits verinnerlicht. Zum Beispiel Google: Seit Jahren gilt der Suchmaschinenanbieter als Vorzei-ge-Arbeitgeber. Wer bei dem Unter-nehmen arbeitet, kann sich am Ki-ckertisch entspannen, während der Arbeit auf bunten Sesseln fläzen und in Hängematten liegen oder bei einer kostenlosen Limo mit den Kollegen in bunter Umgebung das nächste Projekt besprechen.
Zugegeben: Eine Lounge-Atmo-sphäre mit kreativen Sitzkissen wird es wohl auf den Leitständen und in den Betrieben unserer Unter-nehmen nie geben. Und auch den Ideenreichtum damit zu fördern, dass man kommt, wann man will, wird in der Schichtarbeit sicher-
lich nicht hilfreich sein. Dafür sind diese Arbeitsplätze nicht geeignet. Aber trotzdem gibt es auch in den Unternehmen der GMH Gruppe viele Möglichkeiten, für eine ange-nehme und damit auch kreativere Atmosphäre zu sorgen.
Was häufig schon hilft, ist ganz einfach: aufräumen. Viele glauben, dass Kreativität und Chaos zusam-mengehören. Aber unser Gehirn ist ein Gewohnheitstier und hasst ständige Suchaktionen und Umsta-peleien. Die Zeit und Energie, die es hier reinstecken muss, geht der Kreativität verloren. Ist das Chaos vom Arbeitsplatz verbannt, ist der Kopf auch frei für Ideen. Gleichzei-tig wird dabei ein weiteres notwen-diges Ziel erreicht: das Wohlerfüh-len am Arbeitsplatz.
Als Jürgen Großmann 1993 die Georgsmarienhütte GmbH über-
nahm, gehörte zu einer seiner ers-ten Maßnahmen, das Werksgelän-de aufzuräumen und die Büroräu-me mit frischer Farbe zu versehen. Es klingt banal, aber vielen geht schon deshalb jeder kreative Geis-tesblitz verloren, weil sie in unsau-beren, verstaubten, stocknüchter-nen, kurzum verhassten Räumen ausharren müssen.
In einer Umgebung, in der man sich nicht gerne aufhält, kann ein-fach keine Lust an der Arbeit und damit keine Lust an neuen Ideen entstehen. Ein wenig frische Farbe, ein freundliches Bild an der Wand, eine aufgeräumte und „verschlank-te“ Pinnwand, ein wenig Ordnung bei den Zetteln, Stiften und ande-ren ständig benötigten Utensili-en – das geht fast überall, im Büro ebenso wie im Leitstand oder auf der Steuerbühne.
Viele Unternehmen unserer Gruppe nutzen hierfür einen „Auf-räumtag“. Aber vielleicht lässt sich ja auch in der Abteilung oder der Schicht eine gemeinsame Aktion organisieren. Schließlich profitie-ren alle von dem Ergebnis.
Um auf neue Ideen zu kommen, hilft übrigens auch der gemeinsa-me Austausch: Wer ständig „im eigenen Saft schmort“, gewinnt keine neuen Eindrücke, kann nicht über neue Ideen diskutieren und kann auch nicht anderen Input für neue Ideen geben.
Manche unserer Unternehmen haben deshalb Infopoints in ihren Betrieben eingerichtet, wo sich die Mitarbeiter für ein kurzes Ge-spräch zusammenfinden können. Oder aber sie gestalten die Aufent-halts- und Pausenräume so attrak-tiv, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier gerne ihre Pause verbringen und das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen su-chen. Schnell wird hier nicht nur über Privates, sondern auch über Probleme und deren Lösung dis-kutiert – ein Ideenpool, der unsere Unternehmen weiterbringen kann.
mw
Foto
s: ©
pan
ther
med
ia.n
et /
Mar
c D
ietr
ich;
Dav
id K
osch
eck
„irgendwas geht immer“Was in Eugen Schnabel vorgeht, wenn er seine Ideen entwickelt.
i nTErV iEW
eugen Schnabel hat seine Ausbil-dung zum industriemechaniker (Fachrichtung Betriebstechnik) bei der Rohstoff Recycling Os-nabrück absolviert und 2004 er-folgreich abgeschlossen. Seitdem arbeitet er in der instandhaltung. der industriemechaniker ist für seine hochwertigen Verbesse-rungsvorschläge bekannt. dirk Strothmann befragte ihn dazu, wie er diese ideen entwickelt.
glückauf: Wie viele Ideen bzw. Ver-besserungsvorschläge haben Sie bis-lang eingereicht? Eugen Schnabel: Seit 2010 habe ich fünf Vorschläge eingereicht.
Verbesserungsvorschläge, die auch al-le umgesetzt wurden?Schnabel: Die auch alle umgesetzt wurden.
Fangen wir einmal ganz von vorne an: Was bringt Sie eigentlich dazu, über einen Verbesserungsvorschlag nachzudenken?Schnabel: Ich versuche, mir die Arbeit so einfach und angenehm wie möglich zu machen.
Beispiel?Schnabel: Das sehr häufige Wech-seln des Staublamellenvorhanges am Aufgabebunker in der NE-Se-paration. Hier war es so, dass man immer in einer Höhe von etwa vier Metern aus dem Staplerkorb he-raus jede einzelne Schraube, mit der die einzelnen Lamellen be-festigt waren, lösen musste. Das war recht mühsam. Hinzu kamen – je nach Wetter – Wind, Regen, Schnee, Hitze, Kälte, Staub und die Unterbrechungen durch den Be-schickungsvorgang. Also dachte ich darüber nach und entwickelte einen „Schnellverschluss“, um die Lamellenleiste abnehmen zu kön-nen. Jetzt können wir die Lamellen schneller und weit weniger müh-sam austauschen.
Also angenehmer arbeiten?Schnabel: Aber nicht nur. Auch Störungen oder Reparaturen, die immer wieder auftreten, kosten viel Zeit und sind gefühlt unange-nehm. Die versuche ich auch aus-zumerzen beziehungsweise zu ver-bessern.
Wie denken Sie über die Lösung nach: bei der Arbeit, beim Frühstück, beim Joggen?
Schnabel: Wenn es während der Reparatur nicht so rich-tig klappt, dann mache ich mir schon währenddessen meine Gedanken. Oft skiz-ziere ich mir schon mal was auf. Und dann denke ich am Feier-abend weiter darü-ber nach, wenn ich den Kopf frei habe.
Beziehen Sie auch Ihre Kollegen bei der Lösung des Problems mit ein?Schnabel: Meine Vor-schläge betreffen ja nicht nur mich. Sie sol-len ja auch die Arbeit meiner Kollegen verein-fachen. Deshalb spreche ich oft mit meinen Kolle-gen über meine Ideen.
Und wie kommt die zünden-de Idee? Aus heiterem Him-mel?Schnabel: In den meis-ten Fällen kommen mir die Einfälle beim Arbeiten. Oder ich erin-nere mich daran, schon mal etwas Vergleichbares gesehen zu haben. Meine Er-
fahrungen als Instandhalter helfen mir sicherlich dabei, nicht alles als gegeben hinzunehmen. Denn In-standhalter wissen: Irgendwas geht immer.
Wie stellen Sie fest, ob Ihre Lö-sung richtig ist?Schnabel: Ich stelle mir dann oft vor, wie etwas funk-tionieren würde, wenn mein
Verbesserungsvorschlag umgesetzt wäre. Das ist dann wie ein Film, der im Kopf abläuft. Oder ich skizziere so einen Ablauf. Durch einen Versuch wird man dann nur schlauer.
Was können Sie Kolle-gen raten, die auch mal einen Verbesserungsvor-
schlag erarbeiten wollen?Schnabel: Wichtig ist, dass man nicht
nur stumpf seine Arbeit macht. Spätes-
tens dann, wenn man sich bei bestimmten
Arbeiten immer wieder quält, muss man mal
den Kopf gebrauchen, um zündende Ideen
zu bekommen. Wenn etwas schlecht läuft,
ist man auch mo-tivierter, etwas zu
ändern. Mit ein bisschen Fantasie,
offenen Augen und
der Bereitschaft, einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen, kann man schon viele Ideen ent-wickeln.
Und wovor sollte man sich hüten?Schnabel: Die Vorschläge sollten auch realistisch sein.
Haben Sie auch eine Lieblingsidee?Schnabel: Da fällt mir sofort die Spannvorrichtung für den Stem-pel der Brikettieranlage ein. Diese Anlage verpresst ja Schleifschläm-me und Metallspäne zu einem Bri-kett. Diese Mischung wird in eine Form gepresst. Die Form und der Stempel müssen verschleißbedingt regelmäßig getauscht werden. Für diesen Austausch hatten wir erst nur eine Montageplatte. Da musste man mühsam den Stempel erst mal mit vielen Schrauben und Muttern verklemmen, bevor man mit der eigentlichen Arbeit am Stempel beginnen konnte. Hierfür habe ich einen neuen Tisch gebaut. Jetzt legt man den Stempel mit dem Kran von oben in die Tischhalbschalen. Danach legt man Spannbügel um. Mit einer Hydraulik wird der Stem-pel dann so fest fixiert, dass wir sofort mit dem Tausch des Stem-pelkopfes beginnen können. Das bringt echte Zeitersparnis. Zudem wurde das persönliche Gefähr-dungsrisiko vermindert, das sich durch Abrutschen oder Verlängern von Steckschlüsseln immer ergab.
Vielen Dank für das Gespräch. Foto: ds

glück auf · 1/2014 ........... 8
schwerpunkt: idee
Kubismus | 1907
Pablo Picasso & Georges Braque · Der Kubismus ent-stand aus einer Bewegung der Avantgarde ab 1907 in Frankreich. Weitere Vertreter der Kunstrichtung waren u. a. Juan Gris, Fernand Lé-ger, Marcel Duchamp und Robert Delaunay. Heute sieht man im Kubismus die revo-lutionärste Neuerung in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Der Einfluss kubistischer Werke auf die nachfolgenden Stilrichtungen war sehr groß.
Automobil | 1885/86
Benz/Daimler/Maybach · Das Jahr 1886 gilt mit dem Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 von Carl Benz als das Geburtsjahr des modernen Automobils mit Verbrennungsmotor. Allerdings handelt es sich nach heutiger Definition nicht um einen Personen-kraftwagen, da er nur drei Räder besitzt. Bereits 1885 baute Gottlieb Daimler zusammen mit Wilhelm Maybach ein vierrädriges Kraftfahrzeug mit Viertakt-motor.
heisenberg’sche unschärferelation | 1927
Werner Heisenberg · Der Heisenberg’schen Unschärferelation verdanken wir u. a. die Erkenntnis, dass sich Licht sowohl wie eine Welle als auch wie ein Teilchen verhalten kann, und das in Abhängigkeit des Betrachters. Beobachten wir das Teilchen, verhält es sich anders, als wenn wir es nicht beobachten! Die Unschärferelation ist die Basis der Quantenmechanik, welche heute eine der fundamentalen Theorien für die Beschreibung unserer physikali-schen Welt ist.
Wandel braucht auch gute Führung „Unendliche Geschichte“ geht weiter: das Beispiel der „Guten Tonne“ bei der GMHütte.
n ichts ist beständiger als der Wandel. Dieser und ähnliche
Sätze sind nicht neu und begleiten uns bereits unser ganzes Berufsle-ben. Immer wieder müssen wir uns als Unternehmen und als einzel-ne Mitarbeiter hinterfragen, unser Umfeld beobachten und analysie-ren. Fragen, die wir uns immer wie-der stellen, sind u. a.: •Wie werden wir von unseren
Kunden wahrgenommen?•Wie ist unser Marktauftreten?•Wie verändern sich Fertigungs-
prozesse und Qualitätsansprüche unserer Kunden?
• Sind unsere Qualitätsleistung und Liefertreue überdurch-schnittlich? Pflegen und inten-sivieren wir unsere Kundenbin-dung im notwendigen Maße?
•Was ist mit unseren Geschäfts- und Fertigungsprozessen? Sind sie ausreichend beschrieben und werden sie immer wieder auf den Prüfstand gestellt?
•Leben und pflegen wir Qualität?•Leben und pflegen wir Arbeitssi-
cherheit?
•Wie gehen wir miteinander um?•Wie führen wir?
Neben dem „Können“ – wir sind zu mehr als 80 Prozent aus-gebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter – und dem „Dürfen“ – die Geschäftsführung verlangt von uns ausdrücklich selbstständi-ges Handeln – ist vor allem unser „Wollen“ die Voraussetzung.
Als eine „nahezu unendliche Geschichte“ könnte man die Ent-wicklung der GMHütte seit der Übernahme im Jahre 1993 durch Jürgen Großmann beschreiben. Denn seitdem gab es im Laufe der Jahre eine Reihe markanter Meilen-steine auf dem Weg zum Prozess der „Guten Tonne“. Dazu gehören beispielsweise die Einführung und Zertifizierung der Q-Systeme, das Implementieren komplexer DV-Systeme, die Entwicklung eines Leitbildes und das große Arbeits-sicherheitsprojekt „Unsere Hütte – meine Sicherheit“.
Dass ein ständiger Verbesse-rungsprozess die Voraussetzung für eine Prozess- und damit unmittel-
bar verbundene Produktexzellenz ist, war uns immer schon bewusst – und zwar über alle Ebenen hinweg: von der Geschäftsführung über die Leiter/-innen in den technischen und administrativen Bereichen bis hin zu denjenigen, die diese Quali-tät vor Ort produzieren. Damit wir eine höhere Exzellenzstufe errei-chen können – darüber herrschte Einigkeit –, musste man einen sol-chen Prozess neu aufsetzen, ohne Bewährtes über Bord zu werfen.
Die ganzheitliche Betrachtungs-weise, dass eine „Tonne“ nur dann auch eine „Gute“ ist, wenn sie oh-ne Arbeitsunfall, ohne unnötige Nacharbeit und ohne Qualitäts-mängel sicher verladen und ter-mingenau unsere Kunden erreicht, ist eine neue Sicht der Dinge. Denn sie korrigiert die starke gedankliche Ausrichtung auf ein reines Men-gendenken.
Letztlich bilden Prozessquali-tät, Produktivität und Arbeitssi-cherheit einen Dreiklang, der den Unternehmenserfolg auch langfris-tig sicherstellt.
Die „Gute Tonne“ ist ein organi-sierter Prozess, um vorangegange-ne Projekte weiter zu entwickeln. Sie hilft, methodisch und abge-stimmt unsere Prozesskette zu be-trachten und immer wieder zu verbessern. Eine der wichtigsten Aufgaben besteht darin, auf diesem Weg die Mitarbeiter/-innen zu in-tegrieren, um ihr geballtes Wissen und ihre Ideen abzurufen. Steuer-, Regel- und Expertengruppen sind die Säulen, die das Projekt stützen. Prozesskoordinatoren und Prozess-förderer in den Betrieben fungie-ren als Bindeglieder zwischen den Kreisen.
Maßgeblich Einfluss auf den Erfolg der „Guten Tonne“ haben auch die Kompetenzen und das Verhalten der Führungskräfte der Betriebe und Abteilungen. Wichti-ge Bausteine dafür sind ein klares Bekenntnis zum Projekt, das För-dern der Experten- und Arbeits-kreise, der ständige Austausch von Informationen, die Aufnahme von Ideen und die Weiterentwicklung bzw. Qualifizierung der eigenen
Mitarbeiter. Ein vorbildliches Ver-halten der Führungskräfte und eine persönliche Ansprache der Mitarbeiter sind ein weiterer Er-folgsfaktor, deren Engagement zu gewinnen.
Führen auf Augenhöhe bei gegenseitiger Wertschätzung ist gefragt. Dazu zählen auch das be-wusste Zuhören, wenn Verbesse-rungsvorschläge von Kolleginnen und Kollegen kommen, und klar definierte Ziele. So schafft man bei allen Akteuren den Willen und die nötige Akzeptanz, Veränderungen zu erkennen und mitgestalten zu wollen. Gelingt dies, sind die Über-nahme und der Ausbau von Eigen-verantwortung unserer Mitarbeiter die logische Konsequenz.
„Hütte“ und „Gute Tonne“ sind auf einem sehr guten Weg, wie vie-le mit Erfolg abgeschlossene Pro-jekte zeigen. Wichtig aber ist, dass die ständige Weiterentwicklung der Kollegen ihr Selbstbewusstsein erheblich stärkt, die Identifikation mit dem Produkt erhöht und die Verbindung zum Unternehmen steigt. In dieser Weise bringt ein derart gesteuerter und ernst ge-meinter „Gute Tonne“-Prozess alle Beteiligten ständig auf ein höheres Exzellenzniveau.
Denn eines ist klar: Fertig sind wir nie!
hgr
Foto
: © D
aim
lerC
hrys
ler
AG
Foto
: © B
unde
sarc
hiv
Porträt Pablo Picasso von Juan GrisQuelle: The Art Institute of Chicago
/ The Bridgeman Art Library
515 Ew./km2
201 Ew./km2
163 Ew./km2
285 Ew./km2
296 Ew./km2
177 Ew./km2
220 Ew./km2
innovationsspiegel
Spieglein, Spieglein, an der Wand, welches Bundes-land hat das größte Innovationspotenzial im gan-
zen Land? Einen Hinweis darauf geben könnten drei wichtige Faktoren, wenn es um Innovationen geht: der Studentenanteil an der Gesamtbevölkerung, das Venture Capital pro Einwohner und die Patentanmeldungen pro 1 Million Einwohner.
3.785 Ew./km2
Studentenanteil an der Gesamtbevölkerung
Venture Capital pro Einwohner (z. B.: 1,51 €)
Patentanmeldungen pro 1 Mio. Ew.
mit Ping-Pong-Taktik ins zielTechnische Entwicklungen: Dem Ingenieur ist bekanntlich nichts zu schwer.
Er hat das Bild des Erfinders geprägt wie nur wenige: Da-
niel Düsentrieb. Der Ingenieur aus Entenhausen, dem nichts zu „schwör“ ist, soll 139 Erfindungen angemeldet haben, darunter den lautlosen Raketenantrieb, den un-vergessbaren Regenschirm und den pneumatischen Schuhbinder.
Doch seine Kolleg/-innen aus Fleisch und Blut sind nicht weni-ger produktiv. Laut Europäischem Patentamt gab es 2013 in Deutsch-land 26.645 Patentanmeldungen – bezogen auf die Bevölkerungs-zahl Platz 6 hinter der Schweiz (1), Schweden (2), Finnland (3) Dänemark (4) und den Niederlan-den (5). In Deutschland – so das Deutsche Patent- und Markenamt – hatten im Jahr 2013 (bezogen auf je hunderttausend Einwohner) Ba-den-Württemberg (136) und Bay-ern (109) die Nase vorn. Rang drei belegte abgeschlagen Nordrhein-Westfalen (40).
Wenn Techniker Produkte ent-wickeln, dann oft in Teamarbeit.
Und oft ist es nicht die geniale Idee, die alle Probleme auf einen Schlag löst. Vielmehr nähert sich das Team im „Ping-Pong-Verfah-ren“ stetig der idealen Lösung.
Ein Beispiel dafür ist ein Schall-absorber für Güterwagen, den der
Bochumer Verein entwickelt. Dabei sind abwechselnd zu unterschied-lichen Phasen unterschiedliche Fachleute beteiligt – Ingenieure, Konstrukteure, Physiker, Akustiker, technische Zeichner und externe Experten (TH Aachen). Sie suchen eine möglichst einfache und kos-tengünstige technische Lösung, die auch alle Sicherheitsaspekte und andere Vorgaben erfüllt. Prototy-
pen, die man im Praxistest erprobt, spiegeln den Zwischenstand.
Die Messergebnisse sind – eben-so wie Modellrechnungen – Fin-gerzeige für die weitere Entwick-lungsarbeit. BVV-Akustiker Martin Fehndrich: „Hat man die Akustik verbessert, schaut man, wie sich dies auf Stabilität, Haltbarkeit und Kosten auswirkt. Ob alle Normen erfüllt werden. Wie aufwendig eine Produktion wäre. Je nach Bewer-tung muss der Absorber überarbei-tet werden – was sich vielleicht ne-gativ auf das akustische Verhalten auswirkt. Also muss man eine neue Optimierungsschleife beginnen.“
Dabei stets im Blick: die Kosten. Denn schließlich steht der Güter-verkehr im harten Konkurrenz-kampf mit dem Speditionsgewerbe.
Irgendwann ist mit der kontinu-ierlichen Entwicklungsarbeit aller-dings Schluss: wenn man die ideale technische Lösung gefunden hat – und sie im Idealfall beim Patent-amt anmelden kann.
pkm
q Das könnte Sie auch interessieren:
Vom richtigen „Swing“lesen Sie auf Seite 19
Que
llen:
sta
tista
.com
/DPM
A/BV
K/EP
AG
rafik
: ele
men
te d
esig
nage
ntur
110 Ew./km2
134 Ew./km2
178 Ew./km2
69 Ew./km2
83 Ew./km2
387 Ew./km2

glück auf · 1/2014 ........... 9
schwerpunkt: idee
Schwerpunktthema 2/2014:
FEHLER
Currywurst | 1949
Hertha Heuwer · Ihr wird die Erfindung der Cur-rywurst zugeschrieben, die sie nach eigenen An-gaben erstmals am 4. September 1949 an ihrem Imbissstand in Berlin-Charlottenburg anbot: eine gebratene Brühwurst mit einer Sauce aus Toma-tenmark, Currypulver, Worcestershiresauce und weiteren Zutaten. Der Autor Uwe Timm verlegte die Erfindung der Currywurst in einer Novelle nach Hamburg. Er erinnerte sich daran, bereits 1947 am Imbissstand einer Frau auf dem Großneumarkt eine Currywurst gegessen zu haben.
Potenziale auf AbrufKreativität muss willkommen sein und auf fruchtbaren Boden fallen.
unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Ob
globale Erderwärmung, Euro-Krise oder Energiewende: Man wird das Gefühl nicht los, dass die Probleme zunehmend schwieriger werden. Auch viele Unternehmen haben Probleme. Die Märkte werden un-beständiger, die Kunden sprung-hafter, die Konkurrenten stärker. Dies bekommt auch die GMH Gruppe zu spüren.
Die gute Nachricht ist: Das Potenzial zur Lösung all unserer Probleme ist da! Die schlechte: Die-ses Potenzial wird meist nicht er-kannt!
Das Potenzial ist unser Gehirn. Formal gesehen ist es ein komple-xes Netzwerk mit bis zu 100 Billio-nen Nervenzellverbindungen (zum Vergleich: Das gesamte World Wide Web hat momentan etwa 40 Mil-liarden Verbindungen zwischen Webseiten). Neben der Steuerung von lebenserhaltenden Prozessen
(wie z. B. der Atmung) ist es in der Lage, Wissen zu speichern, zu ver-knüpfen, anzuwenden und Ideen zu entwickeln.
Ob ein Mensch allerdings seine kreativen Möglichkeiten nutzt, ob er seinen eigenen Ideen überhaupt Bedeutung beimisst, wird ebenfalls über das Gehirn gesteuert. Wer mit der eigenen Kreativität schlech-te Erfahrungen gemacht hat, wird sie nämlich unterdrücken. Er wird unbewusst entscheiden, dass es für ihn weder sinnvoll noch nütz-lich ist, Ideen zu entwickeln, zu verfolgen und in einem veränder-ten Verhalten umzusetzen. Ent-sprechend skeptisch kommentiert er neue Ideen: „Das wird sowieso nix“, „Das Alte hat sich bewährt“, „Lass uns erst mal abwarten“, „Das lässt sich nicht umsetzen“, „Das ist nicht unsere Kernkompetenz“.
Es liegt auf der Hand, dass die-se Einstellung jede Kreativität im Keim erstickt. Doch eine Hoffnung
bleibt: Unser Gehirn ist bis ins ho-he Alter formbar. Und es gibt Mit-tel und Wege, die Kreativität jedes Einzelnen zu „reanimieren“.
Man nehme: eine entsprechen-de Motivation. Hier sind Prämien im IdeeM ein erster guter Schritt, vor allem, wenn sie der Wertschät-zung einzelner Ideen folgen. Das IdeeM greift jedoch in seiner jetzi-gen Konstruktion zu kurz. Die Prä-mie bietet zwar einen Motivations-anreiz, lässt aber den Arbeitneh-mer mit seiner Idee allein – bis er sie fertig entwickelt hat und dem System zur Beurteilung anvertraut.
Kreative Umgebungen in Unter-nehmen müssen anders gestrickt sein. Unternehmen müssen den Mitarbeitern Raum geben, sich auszutauschen. Am besten inter-disziplinär. So können sie Ideen ge-meinsam entwickeln, ausprobieren und aus Fehlern lernen.
Der Zugang zu Wissen sollte da-bei möglichst einfach sein. Dann
können sich die Gehirne der Mit-arbeiter quasi vernetzen. Die indi-viduellen Unterschiede im Gehirn, die unterschiedlichen Erfahrun-gen, die unterschiedliche Bewer-tung von Fakten und die unter-schiedlichen Lösungsstrategien sind es, die solch ein kollektives Netz so wertvoll machen.
Voraussetzung dafür ist eine Unternehmenskultur, die dem Arbeitnehmer signalisiert: „Deine Kreativität ist hier willkommen.“ Gefragt sind interdisziplinär zu-sammengesetzte Teams, die sich in einem durch Regeln gesicherten Prozess kreativ mit Problemen be-fassen (z. B. mit der Methode „De-sign Thinking“). Methoden, die Mitarbeiter auch emotional einzu-binden wissen.
Denn auch Emotionen zäh-len. Das Gefühl der Verbunden-heit zum Team gibt Sicherheit, die kreative Aufgabe gibt die Chan-ce zu wachsen – und bedient das menschliche Grundbedürfnis nach Autonomie. Und wenn es dann richtig läuft, wenn die Ideen nur so sprudeln, wenn man sich gegensei-tig befeuert, ja dann macht es auch noch Spaß!
Damit das funktionieren kann, bedarf es eines neuen Führungs-
stils. Es geht um „Führen auf Au-genhöhe“ (siehe auch Beitrag auf Seite 8), um Vertrauen ins Team, um Motivation und Moderation. Viele Unternehmen – besonders in der IT- und Startup-Szene – haben das inzwischen begriffen.
Google benutzt Management-Methoden, die denen des Design Thinking entsprechen. Apple folgt im Bereich Forschung und Ent-wicklung keinem linearen Was-serfallmodell, sondern bringt von Anfang an die Bereiche Design, Engineering, Herstellung und Mar-keting quasi an einen Tisch. SAP, Siemens, die Deutsche Bank – all diese Unternehmen wenden De-sign Thinking als Innovations- und Management-Methode an.
Es besteht also Hoffnung auf eine innovativere Unternehmens-kultur. Ohne Veränderungen funk-tioniert das aber nicht. Doch ob im individuellen oder erst recht im kollektiven Bereich: Wie schwierig es ist, Veränderungen umzusetzen, zumal wenn sie umfassend sind, wissen glückauf-Leser – spätestens seit der Lektüre des Schwerpunktes „Veränderung“ aus der glückauf 3/2013.
Thomas Hesselmann-Höfling
ziemlich weit vorne Das Ideenmanagement der GMHütte kann sich sehen lassen.
W ie leistungsfähig das IdeeM der GMHütte ist, beweist der
Jahresbericht 2013. Demnach ha-ben sich 294 Belegschaftsmitglie-der am IdeeM beteiligt, 564 Ver-besserungsvorschläge wurden ein-gereicht, 630 abgeschlossen (teils aus den Vorjahren in Umsetzung). Für die GMHütte ergab sich ins-gesamt ein wirtschaftlicher Vorteil von 1.060.300 Euro. Die Gesamt-prämie aller Vorschläge lag bei 125.040 Euro. Bei den zwölf Verlo-sungsaktionen wurden 3.600 Euro ausgeschüttet – bei der Jahresverlo-sung am 3. Dezember sogar ein To-yota Yaris Life Hybrid, ein E-Bike, ein Reisegutschein über 1.000 Euro und weitere Preise verlost. Netto-Höchstprämie: 9.130 Euro (netto = GMHütte zahlt Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeitrag), Wirt-schaftlichkeit pro prämiertem Vor-schlag: 2.930 Euro im Schnitt. Dass das Deutsche Institut für Betriebs-wirtschaft das IdeeM der GMHüt-te bereits zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet hat, zeigt, dass es auf einem guten Weg ist.
Ralf Kübeck
ErfolgsstorysFeo-reststoffhandling: Auf dem GMHütte-Werksgelände fallen jährlich etwa 25.000 t eisenhaltige Reststoffe an. Abhängig vom Eisenoxidgehalt wurden diese Stoffströme an unterschiedlichen Stellen entsorgt bzw. verwertet. Dabei fielen nicht unerhebliche Kosten an. Aufgrund eines Verbesserungsvorschlages fließen einige Reststoffströme in andere Verwertungswege – was jährlich über 170.000 Euro einspart. Die Idee brachte eine Vorschlagsprämie von 25.700 Euro.Energieeinsparung durch weniger Pumpen: In der Rückkühlanlage 1 und 2 laufen bei der Produktion im Primär- und Sekundärkreislauf immer zwei Betriebspumpen. Sie kühlen den E-Ofen und die dazugehörenden Anlagen. Die Verbesserung lag darin, in den Stillständen nicht mehr alle Pumpen weiterlaufen zu lassen, wenn es die Temperaturen in den Kreisläufen zulassen. Ersparnis: 63.550 Euro pro Jahr. Nettoprämie: 9.535 Euro.optimierung von gebremsten Getriebemotoren: In mehreren Bereichen der Prüf- und Richtstrecke S50 kam es häufig zu Störungen der Bremsen an Getriebemotoren. Obwohl sie nur als Haltebremsen gedacht sind, kam es durch stoßartige Belastungen von anprallendem Material dazu, dass die dünnen Befestigungsschrauben der Bremsen abrissen und das Getriebegehäuse beschädigt wurde. Es wurden anschraubbare Verbindungsbügel angefertigt, die das Gehäuse mit der Bremse stabil verbinden. Seit dem Umbau ist kein Schaden mehr aufgetreten. Vorteile: höhere Standzeiten, Kosteneinsparung, geringerer Reparaturaufwand, höhere Anlagenverfügbarkeit, keine Folgeschäden. Wirtschaftlichkeit: 9.310 Euro. Nettoprämie: 1.400 Euro.
Antibabypille | 1951
Gregory Pincus und John Rock · Bereits 1921 publi-zierte der Innsbrucker Physiologe Ludwig Haberlandt als Erster ein Konzept der hormonellen oralen Ver-hütung. Anfang der 50er Jahre entwickelten Gregory Pincus und John Rock mit finanzieller Unterstützung der Frauenrechtlerin Margaret Sanger das Produkt Envoid. Das Medikament gegen Menstruationsbeschwerden erhielt 1960 die Zulassung als Verhütungsmittel. So konnten die „wilden 60er“ kommen – und mit ihnen die „sexuelle Revulo-tion“.
Fotos: © shutterstock.com/stockfoto-graf; © panthermedia.net/Kati Neudert und © shutterstock.com/rvlsoft
World Wide Web | 1989–1992
Tim Berners-Lee · Aufbauend auf der offenen Plattform des Internets – das Vinton Cerf 1971 in Zusammenarbeit mit anderen Computerwissenschaft-lern und unterstützt durch das US-Vertei-digungsministerium entwarf – entwickelte Berners-Lee am CERN quasi im Alleingang und nebenbei die Software-Architektur des heutigen WWW: die Verknüpfung von Seiten über HTML. Berners-Lee erstellte die erste Webpräsenz unter http://info.cern.ch. Sie erläuterte unter anderem, was das World Wide Web sein sollte, wie man an einen Web-browser kommt und wie man einen Webserver aufsetzt.
BuChT iPP
Wo kommen gute ideen her? Steven Johnson zeigt in seiner fabelhaften Geschichte der Innovation, dass kreative Durch-brüche nicht Ergebnis einsam vor sich hinschaffender Genies sind, sondern dass die meisten Erfindun-gen im Kollektiv entstehen – und zumeist ohne große finanzielle Anreize. Sie benötigen vielmehr passende Umgebungen sowie gut entwickelte soziale und kulturelle Netzwerke.
Steven Johnson: Wo gute Ideen herkommen
Scoventa Verlag, Bad Vilbel 2013,ISBN 9783942073103,gebunden, 320 Seiten, 19,99 €

GMH Gruppe
glück auf · 1/2014 ......... 10
KurznEWS
zielstrebigMWL · Das brasilianische Unter-nehmen will im gesamten Werk das Toyota-Produktionssystem praktizieren. Erster Schritt dahin war die Einführung von 6S und Visuellem Management an der Linsinger Knüppel-Kreissäge und im Stahlwerk. Hinzu kommen Set-up-Verbesserungen in der mecha-nischen Bearbeitung von Rädern und eine Studie über die Optimie-rung des Arbeitsflusses in der Ach-senherstellung.
>>> Bericht auf Seite 25
hellhörigGeissler · Zwei Azubis von Hein-rich Geissler sind Leckagen auf der Spur. Mit extra angeschafften Ultraschall-Detektoren erkunden sie wöchentlich Betrieb und Ver-sand des Unternehmens, um die Energieverschwendung aufzu-spüren und einzudämmen. Da es bei der Suche auf ein gutes Gehör ankommt, ist diese Aufgabe für Azubis genau das Richtige.
>>> Bericht auf Seite 25
VerbindlichStahl Judenburg · In einem Work-shop hat sich das Top-Manage-ment des Unternehmens mit dem Thema „Teamarbeit“ auseinander-gesetzt. Am Ende wurde schriftlich vereinbart, welche Optimierungs-maßnahmen bis zu welchem Zeit-punkt umgesetzt werden sollen. In einem weiteren Workshop im Sommer will man dann weitere Er-kenntnisse gewinnen und weitere Verbesserungen erzielen.
>>> Bericht auf Seite 25
urteilsfähigGMHütte · 15 kaufmännische und 28 gewerblich-technische Ausbildungsbeauftragte des Unter-nehmens trafen sich in diesem Jahr erstmals zu einem Erfahrungs-austausch. Sie wollten sich unter professioneller Anleitung Tech-niken für Beurteilungsgespräche aneignen, an denen sie künftig teilnehmen werden. Dabei ging es auch darum, einen Beurteilungs-bogen korrekt einzusetzen.
>>> Bericht auf Seite 26
FeinfühligGMHütte · Im Finalbetrieb ist ein neuer Sicherheitsbeauftragter am Werk: Dirk Ballmann. Für seine Aufgabe ist er hoch sensibilisiert. Denn vor etwa drei Jahren wurde er bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt, sodass er seinen Arbeits-platz wechseln musste.
>>> Bericht auf Seite 26
FörderlichGMHütte · Neun Ausbilder haben ihre Ausbildung zum Lernprozess-begleiter beendet. Das Ausbil-dungskonzept setzt unter anderem darauf, Azubis kein fertiges Wissen vorzusetzen, sondern sie zu moti-vieren, über eigene Recherche eige-ne Lernwege zu gehen und dabei intensiver zu lernen.
>>> Bericht auf Seite 27
EinheitlichPleissner Guss · Ein Integriertes Managementsystem soll die vier bisherigen Systeme effizient bün-deln. Die Bestandsaufnahme ist abgeschlossen. Nach den Prozess-beschreibungen will man mit dem Training der Mitarbeiter beginnen.
Bereits im November muss sich das neue System bewähren.
>>> Bericht auf Seite 27
EhrgeizigMannstaedt · Von 2010 bis 2012 waren die Unfallzahlen deutlich gestiegen. 2013 wurde daraufhin ein neues Arbeitssicherheitskon-zept umgesetzt. Aktuelle Zahlen zeigen: Die Gesamtzahl der Unfäl-le sank um 10 Prozent, die Anzahl der schweren Unfälle sogar um 75 Prozent. Jetzt will man den Trend nachhaltig sichern.
>>> Bericht auf Seite 27
Sportlich Stahl Judenburg · Eine zweitägige Radtour führte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stahlwerks durchs Salzkammergut und ins Salzbergwerk im Altaussee.
>>> Bericht auf Seite 28
BehilflichGWB · Die Gröditzer Werkzeug-stahl Burg hatte für einen Mit-
arbeiter, der beim Elbe-Hochwasser für Hilfsarbeiten im Überschwem-mungsgebiet freigestellt war, Verdienstausfall bekommen. Sie vervierfachte den Betrag auf 1.000 Euro und spendete das Geld der Gemeinde Wust-Fischbeck für den Wiederaufbau. Sie war nach einem Deichbruch für mehrere Tage fast vollständig überflutet worden.
>>> Bericht auf Seite 28
GesprächigStahl Judenburg · Geschäftsfüh-rung und Führungskräfte der Stahl Judenburg und der VTK Krieglach trafen sich wie jedes Jahr zum Skifahren. In entspannter Atmo-sphäre konnte man auch aktuelle Probleme diskutieren.
>>> Bericht auf Seite 29
BeidseitigSWG · Studierende der Akademie für Bergbau und Hüttenwesen Kra-kau waren bei den Schmiedewer-ken zu Gast. Hintergrund: Sie wa-ren Gäste des deutsch-polnischen metallurgischen Seminars an der TU Bergakademie Freiberg.
>>> Bericht auf Seite 29
Entwicklungspotenzial noch nicht ausgereiztGmhütte · Eine anwendungsbezogene Werkstoffentwicklung ist auch eine Frage der Kooperation.
i nTErV iEW
ein wesentlicher erfolgsfaktor für eine energieeffiziente und kostenoptimierte Bauteileferti-gung ist die optimale Zusammen-arbeit zwischen Stahlherstellern, Weiterverarbeitern und endkun-den. dies weiß auch die GMHüt-te und entwickelt gemeinsam mit ihren Kunden anwendungs-orientierte neue Werkstoffe und Verfahren. glückauf sprach dar-über mit dr. Robert Lange (Lei-ter technische Kundenberatung) und Oliver Rösch (Leiter Anwen-dungsentwicklung):
glückauf: Alle sprechen beim Auto von Gewichtsreduktion und Energie-effizienz. Gibt es da wirklich noch Spielraum?robert Lange: Ja, denn die Mög-lichkeiten des Werkstoffs Stahl sind hier bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Was das Leichtbau-potenzial angeht, so wurde der An-teil an massiv umgeformten Bau-teilen im Automobil kürzlich ana-lysiert, und zwar im Rahmen der
Initiative „Massiver Leichtbau“. Dabei entwickelten Experten aus 30 Unternehmen der Stahl- und Schmiedeindustrie innovative Vor-schläge, wie bei handelsüblichen Pkw Gewicht einzusparen wäre. Diese reichten von adaptierten Konstruktionen bis hin zu neuen Werkstoffen.
Und diese neuen Werkstoffe entwi-ckeln Sie zusammen mit Ihren Kun-den?
oliver rösch: Richtig, denn mit neuen Werkstoffkonzepten lassen sich einzelne Prozessschritte ein-sparen und sogar bessere Eigen-schaften des Materials erzielen. Beim Stahl ist das Entwicklungs-potenzial noch nicht ausgeschöpft.
Wie können mit einem neuen Werk-stoff Produktionsschritte in Zukunft wegfallen?Lange: Es ist heute zum Beispiel möglich, bei speziell entwickel-
ten Stählen mit bainitischer Mik-rostruktur den Fertigungsprozess deutlich zu verkürzen. Bei neuen Bauteilen können so Glühen und Richten entfallen. Dadurch lassen sich Prozess- und Bauteilekosten erheblich reduzieren.
… und wie steht es um den späteren Kraftstoffverbrauch? Fällt der denn auch geringer aus?rösch: Weniger ist mehr, wenn es um Energieverbrauch und Ressour-
cen geht – sowohl beim Produzie-ren als auch beim Fahren. Um den Kraftstoffverbrauch zu senken, ent-wickeln wir Stahl, der leichter, prä-ziser und langlebiger ist.
Kann denn in der Fertigung einfach ein anderer Werkstoff verwendet wer-den? Oder müssen dafür auch andere Parameter verändert werden?Lange: Um Leichtbauideen zu nut-zen, muss man werkstoff- und um-formtechnische Potenziale früh in eine System- oder Bauteilentwick-lung einbeziehen. Vormaterial und Umformungsprozess müssen ge-nau aufeinander abgestimmt sein – was eine umfassende Zusammen-arbeit vom Stahlhersteller über den
Stahlverarbeiter bis hin zum Automobilher-steller erfor-dert. Als Part-ner arbeiten wir gemeinsam an der Werkstoff-lösung, wobei uns unter ande-rem vielfältige
Simulationsprogramme weiterhel-fen.
Können Sie ein Beispiel aus der Praxis nennen?rösch: Die Hirschvogel Automo- tive Group hat gemeinsam mit der GMHütte den lufthärtenden bai-nitischen Stahl H2 – die Zwei steht für Hirschvogel-Schmelze Nr. 2 – entwickelt. Dieser Stahl verfügt über gleiche Festigkeiten und bes-sere dynamische Eigenschaften im Umlaufbiegeversuch als der vergü-tete 42CrMo4. Untersuchungen im Labormaßstab und im industriel-len Einsatz beweisen: Die Zerspan-barkeit des H2-Stahls ist ähnlich gut wie beim 42CrMo4 – und we-sentlich besser als beim 50CrMo4. Der H2-Stahl ist somit eine sehr attraktive und nachhaltige Alterna-tive zu den aktuellen Werkstoffen beispielsweise für die Dieselein-spritzung.
Vielen Dank für das Gespräch.
Robert Lange (Leiter technische Kundenberatung) und Oliver Rösch (Leiter Anwendungsentwicklung) Foto: vl
hätten Sie’s gewusst
BainitEin Stahlgefüge, das bei der Wär-mebehandlung von kohlenstoff-haltigem Stahl durch isotherme Umwandlung oder kontinuierliche Abkühlung entsteht. Wirkt sich vor allem auf Zähigkeitseigen-schaften des Stahls aus.
mehr informationen zu den Möglichkeiten, bei herkömmlichen Pkw Gewicht einzusparen, finden Sie unter: www.massiverleichtbau.de

glück auf · 1/2014 ......... 11
GMH Gruppe
Fliegender WechselBochumer Verein · Meilenstein: Produktionsverlagerung von der alten auf die neue Räderlinie.
Der Bochumer Verein moder-nisiert schrittweise seine Pro-
duktionsanlagen. Kürzlich schloss er eine wesentliche Etappe ab: die sogenannte Räderlinie für die Pro-duktion von Rädern für Schienen-fahrzeuge. Zu dem Kernaggregat gehören Drehherdofen, Vorform-presse, Räderwalzwerk, Kümpel-presse, Lasermesseinrichtung und Stempelmaschine.
Der Modernisierungsprozess startete bereits 2008. Als Erstes hatte man die Vorformpresse um-fassend überholt sowie den Dreh-herdofen mit einer neuen Ofen-steuerung und einer energiespa-renden Regenerativbrennertech-nik bestückt. Danach wollte man hinter der Vorformpresse einen komplett neuen Fertigungsstrang errichten, der parallel zu den be-stehenden Anlagen verläuft.
Mit dem Aufbau einer neuen Räderwalzanlage und einer neuen Kümpelpresse hat man kürzlich diesen großen Modernisierungs-schritt abgeschlossen:
Die Räderwalzanlage der Bauart DRAW 1450 ist in der Lage, Eisen-bahnräder mit einem Außendurch-messer bis zu 1.450 mm und einem Gewicht bis maximal 1.500 kg zu walzen, und zwar im dornlosen Walzverfahren. Bei diesem Verfah-ren wird das Rad nicht wie bisher über einen Dorn, sondern durch vertikal und seitlich angeordnete Zentrierrollen geführt.
Die Kümpelpresse der Bauart PRv 5000 K hat eine integrierte Lochvorrichtung zum Auslochen der Radnabe. Sie kann eine Press-kraft von max. 50 MN entwickeln.Der Vorlauf für dieses Projekt be-gann bereits 2010. Einige Vor-
arbeiten wurden auch während des Blockstillstandes im Sommer 2012 erledigt.
Den Zuschlag für die Liefe-rung der Räderwalzanlage und der Kümpelpresse hatte nach vielen Gesprächen und Verhandlungen im September 2012 die SMS Meer GmbH erhalten. Zudem sollte das Unternehmen umfangreiche Um-bauarbeiten tätigen, die Medien-versorgung anpassen, neue Förder-anlagen integrieren und die Auto-matisierungstechnik der gesamten Linie optimieren.
Die Produktionsausfallzeiten sollten minimal bleiben. Vorgabe war, die neuen Anlagen möglichst bei laufendem Betrieb der alten Anlagen vorzubereiten, aufzu-bauen und in Betrieb zu nehmen. Nachdem man die Planungsarbei-ten abgeschlossen und diverse be-hördliche Genehmigungen ein-
geholt hatte, konnte im Frühjahr 2013 die Umsetzung beginnen.
Zunächst waren umfangreiche Bauarbeiten erforderlich. Die ers-te große Herausforderung war, die Fundamente für das Walzwerk und die Presse zu legen: Der Unter-grund war sehr schwierig und im-mer wieder für eine Überraschung gut. Die wie geplant weiterlaufen-de Produktion machte die Sache nicht leichter. Und erschwerend kam hinzu, dass in dieser Zeit ein Hallenanbau realisiert wurde, in dem heute Hydraulikstation, Kühl-werk und eine neue Trafo-Station untergebracht sind.
Mit dem Blockstillstand im Au-gust 2013 begann dann die „hei-ße Phase“: Zunächst wurde das Räderwalzwerk mit einem speziel-len Hubgerüst auf die vorgesehe-ne Position gefahren, um 90 Grad gedreht und dann auf dem Fun-
dament abgestellt. Anschließend wurden die Hauptkomponenten der Kümpelpresse mit zwei Schwer-lastkränen durch eine Öffnung im Hallendach an ihre Position ge-bracht und montiert.
Gleichzeitig musste man die „normalen“ Instandsetzungsarbei-ten an der verbleibenden 80-MN-Vorformpresse durchführen sowie Lasermessmaschine, Stempelma-schine und diverse Handlingsro-boter umsetzen. Vorgabe war, dass sie auch mit den neuen Aggrega-ten genutzt werden konnten. Diese Aufgabe war besonders anspruchs-voll.
Am Ende waren alle Beteiligten glücklich: Einerseits standen die neuen Anlagen an ihrem Platz, an-dererseits konnte die Produktion auf der alten Räderlinie pünktlich wieder starten. Die beiden neuen Maschinen mussten nur noch mit hydraulischen, elektrischen und mechanischen Komponenten ver-kabelt werden. Gleichzeitig wurde ein neuer Linearroboter errichtet, der die Räder von der Räderwalze zur Kümpelpresse befördert.
Ab Oktober 2013 begann dann die Inbetriebnahme.
Zunächst testete man die Funk-tionen im kalten Zustand, an-schließend mit heißen Rädern. Außerdem absolvierten die Mit-arbeiter ein umfangreiches Schu-lungsprogramm.
Die letzte Phase umfasste eine Serie von Abnahmetests und Prü-fungen unter Serienproduktionsbe-dingungen. Unter anderem musste der Lieferant nachweisen, dass die Maßhaltigkeit der Räder eingehal-ten wird, die vereinbarten Zyklus-zeiten erreicht werden, die Verfüg-barkeit der Anlage gegeben ist und die Werkzeugwechselzeiten den Vorgaben entsprechen. Alle Tests endeten positiv und die Serienfer-tigung konnte beginnen. Stufen-weise wird jetzt die Produktion al-ler Radtypen von der alten auf die neue Räderlinie verlagert.
Der Abschluss dieses Projektes ist ein Meilenstein, was die weitere erfolgreiche und langfristige Posi-tionierung des Bochumer Vereins Verkehrstechnik im weltweiten Wettbewerb betrifft. Jetzt kommt es darauf an, die Effekte in der Pra-xis umzusetzen und weitere Poten-ziale zu erschließen.
Jörg Villmann
Getriebegehäuse. Die Renk AG gehört zu den weltweit führenden Herstel-
lern von Getrieben für Sonderfahrzeuge, Industrieanlagen und Schiffe. An ihrem Standort in Rheine werden u. a. Antriebskomponenten für die größ-ten und modernsten Flüssiggastanker der Welt hergestellt. Die Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss (FWHE) erhielt den Auftrag, Getriebegehäuse aus Gusseisen mit Lamellengrafit zu fertigen. Die Leistung dieses Getriebes (RSH) liegt bei 13.600 kW. Der Auftrag umfasste auch die Herstellung der erforderlichen Kombinationsmodelleinrichtung. Das Modellkonzept wurde gemeinsam mit der Konstruktion in Rheine ausgearbeitet, um einen opti-malen Fertigungsprozess zu gewährleisten. Diese Modelleinrichtung ist für verschiedene Getriebegrößen mit Wechselteilen ausgelegt. Die bereits gefertigte Type misst 4.950 x 3.040 x 700 mm und hat ein Stückgewicht von etwa 13.000 kg. Diese Gussteile müssen von verschiedenen autorisier-
ten Abnahmegesellschaften (LRS, BV etc.) abgenommen und zur Lieferung freigegeben werden. Das neue Bauteil bereichert die FWHE-Pro-
duktpalette, da es sich um ein Serienteil handelt,
das kontinuierlich benötigt wird.
Peter Preusse
links: Werksfoto Renk AGrechts: Werksfoto (FWHE)
Das Rohmaß stimmt – erfolgreich gewalzte und gekümpelte Räder von der neuen Räderlinie. Foto: em
RationalisierungseffekteDie neue Räderlinie bringt eine Vielzahl von Rationalisierungseffekten mit sich, unter anderem:•Materialeinsparung durch verbesserte Walzgenauigkeit• Erhöhter Automatisierungsgrad•Verringerter Instandhaltungsaufwand•Verringerung des beim Einrichten anfallenden Ausschusses•Verringerung der Rüstzeiten•Verringerung ungeplanter Störungen•Durchsatzerhöhung durch verringerte Taktzeiten •Reduzierung der Werkzeugkosten an der Kümpelpresse•Herstellung tangential gewellter Räder in einer Hitze
FriEDriCh WiLhELmS-hüTTE

glück auf · 1/2014 ......... 12
GMH Gruppe
rE iSET iPPS Von JEnn iFEr hArmS
Laptop weiterhin in GepäckablageÜber neue Allianzen, tragbare elektronische Geräte und einen expandierenden Flughafen.
TAm: neue Allianz mit oneworld. Die brasiliani-sche Fluggesellschaft TAM tritt am 31. März 2014 der Oneworld bei. Die Star Alliance verliert damit ein sehr wichtiges Mitglied in Südamerika. Dies ist bereits der zweite superschnelle Wechsel zwischen zwei Airline-Allianzen. Überraschend ist der Schritt nicht. TAM hat sich nämlich mit der südamerikani-schen Airline-Gruppe LAN unter der Holding Latam zusammengeschlossen. Die LAN-Gruppe gehört be-reits zu Oneworld. TAM ist eine bedeutende Größe im südamerikanischen Luftverkehr mit einem guten Langstreckennetz. Die Flotte umfasst 161 Flugzeuge
und bedient über 50 Destinationen inklusive Europa.
uniTED: mehr Spielraum für elektronische Geräte. Nachdem die US-Luftfahrtbehörde zugestimmt hat, dürfen Reisende ihre tragbaren elekt-ronischen Geräte (z. B. Tablets, Spiele oder Mobiltelefone) in allen Phasen des Fluges angeschaltet lassen. Die Geräte dürfen jedoch nicht empfangs-bereit sein! Größere Geräte (z. B. Laptops) müssen bei Start und Landung nach wie vor in den Gepäckablagen bleiben. Die neue Regelung ist nur für die Hauptflotte gültig und trifft z. B. nicht für United Express zu.
EmirATES: Täglich nach Tokio-haneda. Tokios Flughafen Haneda wird für Emirates die mittlerweile 131. Destination. Er liegt deutlich näher zum Stadtzentrum als der zweite Flughafen Narita. Nachdem man eine vierte Startbahn in Betrieb genommen und 2010 einen internationalen Terminal eröffnet hatte, wurde er zunehmend für internationale Fluggesellschaften attraktiv. Haneda gilt als einer der verkehrsreichsten Flughäfen in Asien. Das aktuelle Streckennetz der Emirates finden Sie unter: http://www.emi-rates.com/de/german/flash/route_map.aspx
Jennifer Harms Foto: Senator Reisen
Am anderen Ende der Welt Windhoff · In Neuseeland mit Werkstattausrüstung erfolgreich.
im März 2012 wurde Windhoff von Auckland Transport (AT) mit
dem Bau und der Lieferung diver-ser Werkstattausrüstungen für das neue Wiri-MSF-Depot beauftragt, bestehend aus Unterflur-Hebean-lage, Hebeböcken, 2-Wege-Rangier-fahrzeug und Drehgestell-Dreh-scheibe. Es war der erste Auftrag aus Neuseeland – und der Beginn einer Erfolgsgeschichte.
Auf 4,4 ha Grundfläche hatte AT eine hochmoderne Wartungshalle mit einer Fläche von 7.650 m² und insgesamt 7 km Gleisanlage erbaut. Dort sollten insgesamt 57 drei-teilige Züge abgestellt und gewar-tet werden. Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit wurde das De-pot von Aucklands Bürgermeister Len Brown im Juni 2013 offiziell eröffnet.
Doch mit der Auslieferung der Werkstattausrüstung und der offi-ziellen Eröffnung war das Projekt für Windhoff noch lange nicht abgeschlossen. Schließlich sollten die ersten Züge des spanischen Herstellers CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) erst im August aus Spanien eintreffen – ein Termin, der für Windhoff die heiße Phase der Inbetriebnahme einläu-tete. Denn nun musste sich zeigen, ob die Ingenieurleistung „made in Germany“ den hohen Anforderun-gen des Kunden und der Betreiber des Depots (CAF und Transdev) ge-recht werden würde.
Und Anforderungen gab es je-de Menge – beispielsweise die An-kupplung des Windhoff-2-Wege-Rangierfahrzeugs (Typ ZRW 35 AEM) an die neuen Züge. Als man in Rheine mit der Fertigung des Fahrzeugs begann, wurden bei CAF immer noch die Details der Züge konstruiert. Folge: Fehlende Infor-mationen und ständige Änderun-gen der Anforderungen gehörten zum Tagesgeschäft.
Vor allem die im 2-Wege-Ran-gierfahrzeug integrierte Druck-luftanlage musste präzise den Ge-gebenheiten des Zuges angepasst werden. Schließlich wird sie voll-automatisch mit der Bremsanlage
des Zuges verbunden und ist daher ein wesentlicher Bestandteil zum sicheren Rangieren der Schienen-fahrzeuge.
Schwierigkeiten bereitete auch eine weitere Schnittstelle von es-senzieller Bedeutung: die Daten-kommunikation zwischen statio-närer UFD (Unterflurdrehbank) und mobilem Rangierfahrzeug. Hintergrund: Eine der wesentli-chen Aufgaben ist das Rangieren der dreiteiligen CAF-Züge über die Unterflur-Drehmaschine. Sie wird zum Reprofilieren der Radsätze ge-
nutzt, wenn sie verschlissen sind. Die Datenkommunikation soll ver-hindern, dass der Zug mittels ZRW bewegt wird, während die UFD das Rad reprofiliert.
Windhoff löste das Problem mit einer speziellen Funkanlage. Jetzt kann das 2-Wege-Rangierfahrzeug im Bereich der UFD ausschließlich per Funk, also völlig fahrerlos, be-trieben werden. Da die Funkanlage mit der elektronischen Steuerung der UFD kommuniziert, wird eine gegenseitige Anlagenverriegelung sichergestellt.
Eine weitere Herausforderung: Unterflur-Hebeanlage und Hebebö-cke mussten erdbebensicher sein. Neuseeland liegt auf zwei archi-tektonischen Platten und hat mit mehr als 50 Erdbeben pro Jahr zu kämpfen. Zwar ist die Nordinsel, auf der Auckland liegt, weit we-niger davon betroffen als die Süd-insel, dennoch galt es, das Personal bestmöglich zu schützen. Schließ-lich arbeitet man tagein, tagaus unter den angehobenen, fast 140 t schweren Zügen.
Windhoffs Projektleiter Wolf-gang Klein-Katthöfer musste viele Gespräche mit den Experten von Auckland Transport und dem Fahr-zeughersteller CAF führen. Dann konnte er schließlich eine über-zeugende Lösung präsentieren: Die angehobenen Züge ruhen mit den Lastaufnahmepunkten in entspre-chenden dreiseitig geschlossenen Taschen. Dies verhindert, dass bei bebendem Boden die Züge durch die Vibration von den Hebeanla-gen herunterbewegt werden.
Der spannendste Augenblick des ganzen Projektes war jedoch, als zum allerersten Mal in Neuseeland ein Zug mit einer Windhoff-Unter-flur-Hebeanlage angehoben wurde – im Beisein der gesamten CAF-Mannschaft, AT-Projektleiter Tim Barrett und Windhoff-Baustellen-leiter Michael Brinkmann. Majes-tätisch und problemlos erhob sich das 70 m lange und 140 t schwere Gefährt fast völlig geräuschlos in die Höhe. Und so konnte Wind-hoff einmal mehr einen Kunden von den technischen Möglichkei-ten des Unternehmens aus dem Münsterland überzeugen.
Wolfgang Klein-Katthöfer
Der HärtetestWie gut das Windhoff-2-Wege-Rangierfahrzeug funktioniert (und wie einfach die Bedienung ist), davon konnte sich CAF direkt bei der Anlieferung der ersten Züge überzeugen. Die Züge wurden per Schwertransport angeliefert, auf die Schiene gestellt, mit dem Windhoff-ZRW durch das neue Depot rangiert und in die Wartungs-halle befördert. Siehe YouTube: http://tinyurl.com/lmodcs4
Unterflur-Hebeanlage von Windhoff Foto: Wolfgang Klein-Katthöfer
Foto: vl
Jahrestreffen. Mitte Dezember letzten Jahres trafen sich erneut die Einkaufsleiter der Grup-penunternehmen der GMH Gruppe. Diesmal waren sie in Georgsmarien-
hütte zu Gast. Im Fokus des Treffens stand eine ausführliche Bewertung der Leistungsfähigkeit des neuen Mobil-funkpartners Telekom. Seit Anfang Oktober wurden gut 2.200 Sprach- und Datenkarten auf den neuen Anbieter umgestellt – eine Aktion, die nahezu reibungslos vonstattenging. Mit den neu verhandelten Tarifen wird für die Gruppenunternehmen das mobile Telefonieren und Arbeiten im Internet um etwa 20 Prozent günstiger. Seit Beginn des neuen Jahres wird zudem sukzessive das Festnetz aller Gruppenunternehmen auf die Telekom umge-stellt. Weitere Schwerpunkte des Einkaufsleitertreffens waren ein neu aufgelegtes Kostensenkungsprogramm der Einkaufsabteilungen und die aktuelle Marktentwicklung im Energie- und im Rohstoffbereich. Ein weiterer Tages-ordnungspunkt konnte sogar sofort vor Ort umgesetzt werden: die Gründung einer Arbeitsgruppe, die sich mit SAP-Abläufen in den Einkaufsabteilungen befassen wird. Dabei soll untersucht werden, ob und wie man bestimm-te Abläufe vereinfachen oder möglicherweise sogar standardisieren könnte. Bei dem Projekt haben Christian de Veen (GMHütte) und Thorsten Lippmann (IAG Magnum) gemeinsam mit Christoph Schmitz (GMH Systems) die Federführung in der Hand.
bmz
Gmh GruPPE

glück auf · 1/2014 ......... 13
GMH Gruppe
TrefflichGMHütte · Die Personalleiter der GMH Gruppe trafen sich in Georgsmarienhütte mit Harald Schartau, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der GMH Hol-ding. Diskutiert wurden u.a. Aus- und Weiterbildung, Nachwuchs-kräfte, Gesundheitsmanagement und Juristisches zu befristeten Arbeitsverhältnissen und Zeit-arbeit.
>>> Bericht auf Seite 29
regelmäßig GMHütte · Rund 580 Kolleginnen und Kollegen spenden seit 2011 regelmäßig 49 Cent ihres monat-lichen Gehalts für einen guten Zweck. Insgesamt kamen dabei 8.888,88 Euro zusammen, ein Be-trag, den die Holding auf 17.778 Euro verdoppelt hat. Die Spende kam terre des hommes zugute.
>>> Bericht auf Seite 29
FachlichStahlwerk Bous . Eine Fahrt zur MEWA in Saarlouis und zur Dil-linger Hütte stand kürzlich auf dem Weiterbildungsprogramm der Arbeitssicherheits-, Umwelt- und Energiebeauftragten des Stahlwer-kes. Bei den Gastgebern konnten sie sich unter anderem auch mit anderen Fachkollegen über ihr je-weiliges Fachgebiet austauschen.
>>> Bericht auf Seite 31
FeierlichHGZ · Die Harzer Gussexperten konnten ihr bislang erfolgreichstes Geschäftsjahr in der Unterneh-mensgeschichte feiern. Grund genug, die Belegschaft mit einem Familientag zu verwöhnen.
>>> Bericht auf Seite 31
Azubi PagesSchützenhilfeGMHütte · Lehren heißt auch lernen: Diese Erfahrung machten jetzt vier Mechatroniker im 2. Lehrjahr bei einer Projektwoche. Sie unterstützten Achtklässler der Realschule Georgsmarienhütte dabei, einen LED-Würfel zu löten und zu verdrahten. Sie hatten jede Menge Spaß und profitierten da-von auch in beruflicher Hinsicht.
>>> AzubiPages Seite 1
ErweiterungKranbau Köthen · Die Aus-bildungswerkstatt kann ihren Azubis neue Räumlichkeiten zur Verfügung stellen: einen Schu-lungs- und Unterweisungsraum für die theoretische Ausbildung und Ausbildungsplätze für die „Grund-lagenausbildung Metall“.
>>> AzubiPages Seite 2
Präsentation Stahl Judenburg · Einmal im Jahr präsentieren die Lehrlinge der Stahl Judenburg, was sie in den letzten zwölf Monaten gelernt und geleistet haben. Im Publikum sa-ßen auch Eltern, Ausbildungspart-ner der Berufsschulen, Führungs-kräfte des Schulungszentrums Fohnsdorf, Vertreter des Arbeits-marktservice und jede Menge Mit-arbeiter des Unternehmens.
>>> AzubiPages Seite 2
Azubi-AwardJudenburg/Bous · Melanie Mayer und Manuel Klemmer von Stahl Judenburg holten sich den Azu-bi-Award 2013 der GMH Gruppe im Bereich „Stahlerzeugung und Stahlverarbeitung“. Ihr Preis: ein Gutschein für ein Wochenende in München für jeweils zwei Perso-nen inkl. Taschengeld und Besuch des Technischen Museums. Dritter Gewinner war Patrick Bach vom Stahlwerk Bous. Er hatte zudem seine Ausbildung zum Verfahrens-mechaniker (Fachrichtung Eisen- und Stahlmetallurgie) als Sieger auf Landesebene abgeschlossen.
>>> AzubiPages Seite 2 und 4
FreisprechungBVV-ilsenburg · Gute Traditionen sollte man auch nach einer Um-strukturierung beibehalten: Nach der offiziellen Freisprechung lud man in Ilsenburg drei Jungfach-arbeiter zu einer unternehmens-internen Freisprechungsfeier ein. Dabei wurden auch allen dreien die Arbeitsverträge überreicht.
>>> AzubiPages Seite 5
TeamfähigkeitRulle · Azubis von GMHütte, RRO und IAG Magnum trafen sich zu einem Einführungseminar in Rulle. Dabei mussten sie unter an-derem in einem Kletterwald ihre Teamfähigkeit unter Beweis stel-len – und einen Kollegen, dem die Augen verbunden waren, in 3 m Höhe über einen Balken lotsen.
>>> AzubiPages Seite 5
hautpflegeMannstaedt · Hauterkrankungen liegen bei Azubis an erster Stelle. Deshalb hat Mannstaedt in einem fachmännisch begleiteten Kurs die Jugendlichen für das Thema sensibilisiert. Dabei gab es viele In-formationen über Hautprobleme, mögliche Schutzmaßnahmen und -mittel sowie einen überzeugenden Praxistest.
>>> AzubiPages Seite 5
zwischenbilanzKranbau Köthen · Was Politiker können, können Azubis schon lan-ge: Pascal Barth, angehender Kons-truktionsmechaniker, zieht nach 100 Tagen eine Zwischenbilanz seiner bisherigen Ausbildung.
>>> AzubiPages Seite 5
hilfe für Andria: Tränen des GlücksiAG magnum · Knochenmarkspende fand außergewöhnlich schnell passende Empfängerin: Amerikanerin zu Besuch bei Lebensretter in Georgsmarienhütte.
Andria O’Day Lee wird es ihr ganzes Leben lang nicht ver-
gessen: Vor sieben Jahren hat eine Stammzellenspende aus Deutschland ihr Leben gerettet, genauer gesagt aus Georgsma-rienhütte. Der damalige Spender war Andreas Olbricht, Mitarbei-ter der IAG Magnum, wohnhaft in Kloster Oesede.
Im Jahr 2006 hatte sich der 28-Jährige anlässlich einer Ak-tion der Petra-Stiftung typi-sieren lassen. Er konnte nicht ahnen, dass seine Stammzellen schon bald ein Leben retten wür-den. Die weltweit vernetzte Kno-chenmarkspender-Datei (DKMS) sollte ihn als idealen Spender aus-filtern: für die an Leukämie er-krankte US-Amerikanerin Andria O’Day Lee aus dem Bundesstaat Colorado.
Sie hatte Glück im Unglück. Denn es war erst rund zwei Mona-te her, dass man bei ihr eine Blut-krebserkrankung diagnostiziert hatte. Dass so schnell der passen-de genetische Zwilling für eine Stammzellentransplantation ge-funden wurde, war ein riesengro-ßer Glücksfall.
Die Knochenmarkspenderdatei gibt strenge Regeln vor, was die Beziehung zwischen Stammzellen-Spender und Stammzellen-Emp-fänger angeht. Denn bevor sie mit-einander den Kontakt suchen dür-fen, müssen zwei Jahre vergehen.
Doch nicht alle Spender und Empfänger wollen diesen Kontakt. Aber Andria und Andreas wollten. 2008 kontaktierten sie sich erst-mals per Mail. Vor knapp zweiein-
halb Jahren traf man sich in den Staaten. Jetzt gehören beide wie selbstverständ-lich zur Familie des ande-ren. Ende letzten Jahres
kam Andria O’Day Lee zu Besuch nach Georgsmarienhütte, um An-dreas Olbricht zu besuchen. Dabei wurde die 35-jährige Amerikanerin gemeinsam mit Vertretern der Pe-tra-Stiftung auch im Georgsmari-
enhütter Rathaus empfangen – ein Termin, der mit sehr viel Emotio-nen verbunden war. Denn als man auf die schwere Zeit vor sieben Jah-ren zu sprechen kommt, kann An-dria sich der Tränen nicht erweh-ren. Denn noch heute übermannt sie das Glück, „das mir dank Andy gegeben ist“.
Sandra Sciborski
Petra ist einmaligSeit 1992 hat „Hilfe für Petra“ in der Region bei Typisierungsaktionen mehr als 52.000 potenzielle Lebensspender rekrutiert, die inzwischen alle in der DKMS-Datei registriert sind. Jeder 65. Typisierte, der bei einer „Hilfe für Petra“-Aktion erfasst worden ist, wurde später zum Lebensretter – was mehr als 850 Fällen entspricht, wo Krebskranke durch die Arbeit der GMHütter Stiftung einen Stammzellenspender gefunden haben.
mehr Durchblick für die ganze GruppeDie Abteilung Arbeitssicherheit der GMHütte möchte alle Kollegen in der ganzen Gruppe darauf hinweisen, dass es inzwischen neue Standard-Schutz-brillen mit einem Ausschnitt für den Nahbereich gibt. Es handelt sich um Bifokal-Polycarbonatglä-ser. Das untere Sehfeld ermöglicht durch den Vergrößerungseffekt nicht nur das Lesen, sondern auch präziseres Arbeiten. Der Schutz gegen Fremd-körper, die im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen können, ist dadurch unbenommen. Die Brillen der Serie BX Readers sind in den Sehstärken + 1.50, + 2.00 und + 2.50 Dioptrien erhältlich. Für den perfekten Sitz sorgen weiche Bügelenden sowie eine in drei Stu-fen verstellbare Bügellänge und Schei-
benneigung. Erhältlich ist der Augenschutz über den PSMarket Place. Nähere Informationen gibt es bei Carsten Große-Börding, Fachkraft für Arbeitssicher-heit bei der GMHütte, Telefon: 05401.39-4123.
vl
„Zum Zeitpunkt der Typisierung habe ich nicht erwartet, jemandem damit helfen zu können. Als Andria den Kontakt zu mir aufgenommen hat, woll-te ich sie gerne in den USA treffen. Dort bin ich sehr herzlich empfangen wor-den. Dort ist mir erst bewusst gewor-den, dass Andria durch meine Spende weiterleben konnte. Als Kinder wurden wir beide „AndyO“ genannt. Das war nur eine von vielen Gemeinsamkeiten, die wir herausgefunden haben.“
A N D R E A S O L B R I C H T
„Etwas Vergleichbares wie Hilfe für Petra gibt es in den USA nicht. Ich habe durch Andy sowie jetzt bei meinem Aufenthalt in Deutschland viel über die Arbeit der Stiftung erfahren. Es ist toll, was hier durch ehrenamtliches Engagement geleistet wird, um Leukämiekranken zu helfen.“
A N D R I A O ’ D AY L E E
KurznEWS
Wurden zu besten Freunden: Andria und Andreas. Foto: privat
Foto: 3M

glück auf · 1/2014 ......... 14
GMH Gruppe
G A S T K O L U M N E : roBErT hArT inG
Jeder hat mindestens eine gute IdeeOder: Weshalb Risiko eher Chance als Gefahr bedeutet.
D ie Angst vor dem Verlieren und Versagen ist die größte Barriere, neue Wege zu gehen.“ Das hat
Stefan Raab in einem seiner seltenen Interviews 2012 gesagt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich finde, er hat recht.
Vor diesem Hintergrund ist die Startseite meiner Homepage zu verstehen, auf der als Erstes THE NEW ECONOMY SPORTS KID zu lesen ist. Weshalb, muss ich erklären: „New Economy“ bezeichnet eine Wirt-schaftsphase zwischen 1998 und 2001, als Internet-basierte Unternehmen Börse und Wirtschaft eroberten. Damals galt es, Neues zu wagen – ohne Angst und ohne Respekt vor dem Risiko.
Ich war zu dieser Zeit 15 Jahre alt und habe mir diese Haltung zu eigen gemacht – eine Haltung, die für mich heute noch gilt: bewusst Risiko gehen. Denn im Risiko sehe ich nicht die Gefahr des Scheiterns, sondern die Chan-ce für den Erfolg.
Dies ist meine Lebenshaltung. Sie erleich-tert mir auch, mit Ideen spielerisch umzu-gehen. Dazu zählt auch die Idee, mit einer Deutschen Sportlotterie* (DSL) den deut-
schen Spitzensport wieder effektiver zu machen, um die Sehn-sucht der Menschen nach Spitzenleistungen und Medaillen zu stillen. Solche Ideen fallen gerade heute auf fruchtbaren Boden, weil gerade heute viel mehr möglich ist als früher.
Und wie geht die Wirtschaft mit Ideen um? Jeder Beschäf-tigte eines jeden Unternehmens hat mindestens eine gute
Idee. Stellt sich nur die Frage, ob sich die Unterneh-men dessen bewusst sind. Ich behaupte: Nein!
Werfen wir einmal einen Blick in die digitale Welt. Dort stoßen wir heute auf ein Entwick-
lungstempo, das es sehr schwer macht mit-zukommen. Das gilt für Arbeitnehmer und ihre Fähigkeit, Schritt zu halten, und das gilt für Unternehmen und ihre Fähigkeit, an der Spitze zu bleiben.
Wir entdecken dort Unternehmen, die auf den Rat und den Bedarf ihrer „Nutzer“, also Konsu-menten, eingehen. Und die auch auf die Ideen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen. Sie errei-chen damit nicht nur ein enorm schnelles und effek-tives Wachstum. Sie kreieren damit auch eine interne Organisations-Kultur, die unter den Beschäftigten eine irrsinnige Zufriedenheit schafft.
Zurück zur Deutschen Sportlotterie und dem Potenzial, das in einer Idee steckt. Der tiefere Sinn für das DSL-Entwicklungsteam lag auch darin, Vorreiter
und Meinungsführer in Sachen Sport für eine ganze Nation zu werden. Auch für den Breitensportler. Doch Voraussetzung für diese Idee war, zunächst überhaupt zu erkennen, dass es Lücken im System gab.
Deshalb: Wenn Sie Lücken, Fehler, Schwachstellen in Ihrem Unternehmen erkennen und wenn Ihnen wenige Synapsen-Sprünge später die Lösung dazu einfällt, können Sie sicher sein: Das Ding kann rocken. Gehen Sie sofort zu Ihrem Vorge-setzten und bitten ihn um ein Gespräch.
Doch bedenken Sie: Die beste Idee bringt nichts, wenn man die Verantwortlichen nicht davon überzeugen kann. Bevor Sie also Ihre Idee anderen präsentieren: Verpacken Sie sie bitte auch so, dass sie jedes Kind versteht :)
* Robert Harting hat mit anderen Spitzenathleten die Deutsche Sportlotterie (DSL) initiiert. Ziel ist, Spitzenathleten finanziell stärker zu unterstützen als bisher, damit die sich ganz auf den Sport konzentrieren können. 35 Prozent der Einnahmen sollen in die Sportförderung fließen. Die Sportlotterie ist eine gemeinnützige GmbH (gGmbH). Somit ist die Ausschüttung an eine vom Staat vorgeschriebene Verteilung gebunden. Geld allein wird nicht viel bewirken. Doch sowohl die Art der Verteilung als auch die Investitionen in Motivations-strecken für Sportler oder Teams wird vieles bewegen.
Eingang und Kirche wieder vis-à-visUmbau rückt TU mehr in den öffentlichen Blick.
Schon 2003 hatte sich der da-malige niedersächsische Wis-
senschaftsminister Lutz Stratmann (CDU) über dessen Standort mo-kiert: „Die TU Clausthal-Zellerfeld ist die einzige Hochschule des Lan-des, die nur über einen Hinterein-gang zu betreten ist.“ Und Jürgen Großmann glaubte sich bei seinem Anblick an eine Discounter-Filiale erinnert. Gemeint war der Haupt-eingang des über 100 Jahre alten Hauptverwaltungsgebäudes der TU in Clausthal-Zellerfeld. Den hatte man nämlich 1958 beim Umbau
des Gebäudes zugemauert, um ihn in einer Seitenstraße zu platzieren. Dadurch verlor die Hochschule auch die städtebauliche Anbin-dung an den zentral gelegenen und gut besuchten Marktkirchen-platz, auf dem die größte Holzkir-che Deutschlands steht. Seit An-fang 2014 ist der Haupteingang wieder an alter Stelle – wenn auch moderner, großzügiger und reprä-sentativer denn je. Die Stiftung hat zu dem Umbau 150.000 Euro beigesteuert.
pkm
TU-Präsident Professor Thomas Hanschke und Jürgen Großmann bei der offiziellen Eröffnung des Haupteingangs Foto: TU Clausthal
Diskus überholt rennwagenNur einer kann gewinnen: Robert Harting wird nach 2012 auch Sportler des Jahres 2013.
robert Harting ist zum zwei-ten Mal in Folge zum Sportler
des Jahres gewählt worden. Bei der Abstimmung unter mehreren Hundert Sportjournalisten siegte der Diskuswerfer mit 2.920 Punk-ten vor dem vierfachen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (2.788 Punkte). Zur Sportlerin des Jahres wurde Speerwurf-Weltmeis-terin Christina Obergföll gewählt. Mannschaft des Jahres wurde Trip-lesieger FC Bayern München.
„Ich bin ganz baff. Diese Wahl macht mich sehr stolz“, sagte Har-ting bei der Preisverleihung be-wegt, der eigentlich Vettel ganz vorne erwartet, ihn dann aber wie schon 2012 abgehängt hatte. An-gesichts des erneuten Titelgewinns
zerriss sich Harting das Hemd aber nicht. Für 2014 hat sich der Athlet schon wieder viel vorgenommen: Dem dritten WM-Gold will er den zweiten EM-Titel folgen lassen.
Auch glückauf findet: ein ver-dienter Sieg! Denn Robert Harting ist nicht nur in seiner Disziplin ein herausragender, international an-erkannter Leistungssportler; er ver-steht es auch, sich außerhalb der Kampfbahn mit seinen klaren, aber auch konstruktiv kritischen Aussa-gen zum Leistungssport und sport-politischen Themen ganz vorne zu platzieren.
Das Zusammenspiel dieser bei-den Eigenschaften ist den Sport-journalisten bei ihrer Wahl wichtig und vorrangig gewesen. Genau aus diesem Grunde ist ihm die Ehrung zuteilgeworden. Die GMH Grup-pe freut sich, mit Robert Harting einen Sportler als Partner an der Seite zu haben, der unverkrampft und mutig unbequeme Fragen stellt, sich für seinen Sport und die dortige Nachwuchsförderung ein-setzt und dabei immer bodenstän-dig bleibt.
ikw
hätten Sie’s gewusst?
robert harting ist nicht nur während seiner Wettkämpfe ein Ausnahmesportler, sondern auch bei der Auszeichnung „Sportler des Jahres“: Er siegte in der Geschichte der Wahl als 15. Leichtathlet und wiederholte als erster Sportler seit Tennis-Ikone Boris Becker (1989/90) einen Wahlerfolg aus dem Vorjahr. Zudem ist Harting nun der erste Leichtathlet seit dem ehemaligen Speerwerfer Klaus Wolfermann (1972/1973), der den Titel zwei-mal hintereinander gewinnen konnte.
„Wir gratulieren Robert Harting zu seiner verdienten Auszeichnung und wünschen ihm für das Sportjahr 2014 viel Erfolg.“
glückauf- R E D A K T I O N S T E A M
Verlängerung↦ Die Stiftung hat 2014 die Förderung diverser Projekte ver-längert. Sie unterstützt zum Bei-spiel das Projekt „Chancen aus-loten – Übergänge meistern“ seit 2007 mit insgesamt 58.000 Euro, das Projekt „Suchtprävention in der Schule“ seit 2008 mit ins-gesamt 25.000 Euro, das Projekt „Deutsch lernen im Zoo“ seit 2009 mit insgesamt 33.000 Euro und die Herbstakademie seit Jahren mit 4.000 Euro. .......... lesen Sie mehr auf Seite 30

glück auf · 1/2014 ......... 15
GMH Gruppe
Eins plus eins gleich dreiBilder, die von den beiden Künstlern Annette Reichardt und Stewens Ragone in ihrem Atelier in Wesseling gemalt werden, entstehen seit Jahren in Teamarbeit. Eines davon hängt seit Dezember 2013 im Büro des RRO-Geschäftsführers Wolfgang Zimmermann.
W ie oft im Leben sind es meist Zufälle, die dazu führen, das
eigene Leben anders als bisher fort-zuführen. So erging es auch Annet-te Reichardt und Stewens Ragone.
Vor ihrer zufälligen Begegnung studierten beide Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK) – er bis Ende der 1980er, sie bis Mitte der 1990er. Er war nach seinem Studium Meis-terschüler bei H.P. Zimmer, bekam 2002 ein Stipendium der Künstler-häuser Worpswede und arbeitete viele Jahre mit dem Bildhauer Mi-chael Denkler zusammen an farbi-gen Holzskulpturen. Sie übernahm nach dem Studium für mehrere Jahre die künstlerische Leitung der Glaswerkstatt der HBK.
2006 kam es schließlich zu be-sagter Begegnung: Annette Rei-chardt und Stewens Ragone trafen sich zufällig in einem Atelier und nutzten die Zeit, um über dieses und jenes zu plaudern. Dabei lief im Hintergrund Musik von „die-sem Crossover-Musiker“ Frank Zappa, wie Ragone ihn charakte-risiert. „Crossover“ deshalb, weil er in seiner Musik verschiedene Stile – beispielsweise Elemente aus Pop, Jazz und Klassik – miteinan-der vermischen würde. Zappa in-spirierte die beiden Künstler dazu, bei laufender Musik eine Serie von gemeinsamen Skizzen und Zeich-nungen zu erstellen – vollkommen unvorhersehbar und ungeplant,
angeregt durch das Plaudern und Musikhören.
Daraus entstand die Idee, ge-meinsam ein Projekt umzusetzen. Der Name dafür war schnell gefun-den: fifty/fifty. Beide Künstler soll-ten an der Entstehung quasi je zur Hälfte beteiligt sein. So ist es bis heute. Und so sind in den letzten acht Jahren gemeinsam unzählige Arbeiten entstanden.
Einer ihrer Kataloge ist über-schrieben mit den Worten: „Tap-pen Sie nicht in die Harmoniefal-le!“ – ein deutlicher Hinweis auf
Stil und Deutung ihrer Bilder. Man könnte sie als skurril, schräg oder in gewisser Weise als doppelbödig bezeichnen. „Wenn man unsere Bilder anschaut“, so Annette Rei-chardt, „kann es zunächst zu einer gewissen Verunsicherung des Be-trachters kommen. Aber, so sagten uns viele, die unsere Werke auf sich wirken ließen, irgendwie be-ginnt man, durch die Motive an-geregt, weiterzudenken.“
Genau diese Erfahrung mach-te ich beim Betrachten des Bildes „Toller Hecht sucht flotten Hasen“.
Es zeigt einen Hai mit der Sprech-blase: „Ich suche eine liebe und warmherzige Partnerin. In meiner Freizeit schwimme und reise ich gerne. Ich mag Kunst, Musik und gut essen gehen.“
Der Hai löst beim Betrachter auf den ersten Blick ein leichtes Gefühl der Bedrohung aus. Die Sprechblase „durchkreuzt“ die-se Empfindung, verdrängt sie mit einer Portion Humor und gibt der Bildaussage eine neue Richtung. Genau dies ist die oben erwähnte Doppelbödigkeit.
Auch einen Brückenschlag zur modernen Mediengesellschaft er-möglicht dieses Bild. So hört man leider immer wieder von Fällen, die sich in sozialen Netzwerken zu-getragen haben: Erwachsene geben sich als Jugendliche oder Kinder aus und kommunizieren unter die-sen falschen Identitäten oder tref-fen sich sogar im realen Leben mit ihnen. Vor diesem Hintergrund wird der gerade noch zum „netten Hai“ mutierte Raubfisch wieder zum Furcht einflößenden Wesen.
Dieser Art sind viele Bilder von Reichardt & Ragone. Sie appellie-ren mit Humor und einer gewissen Ernsthaftigkeit an das „kollektive Gedächtnis“, ziehen den Betrach-ter sozusagen ins Bild hinein und regen ihn zum Nachdenken an.
Ihre Motive finden die beiden Künstler meist in der Werbung. Sie durchforsten aufmerksam im-mer wieder zahllose Zeitungen und Zeitschriften oder lassen sich durch Werbeblöcke im Fernsehen und Internet inspirieren. Durch den ständigen aktuellen Input sind ihre Kunstwerke sozusagen immer „up to date“ und modern.
Bei der Frage, was sich für die beiden seit der intensiven Zusam-menarbeit künstlerisch verändert hätte, antworten sie fast im Ein-klang: „Zu zweit zu arbeiten ist irgendwie entspannter. Zudem ist es eine Bereicherung der künstleri-schen Tätigkeit. Es führt uns über eigene Grenzen hinaus. Sich allein weiterzuentwickeln, ist schwierig bzw. irgendwann ist man in einer Art Sackgasse angelangt. Zu zweit existiert plötzlich ein zusätzlicher Duktus: Es ist sozusagen ein dritter Maler hinzugekommen.“
In Düren hatten sie seinerzeit ihre erste gemeinsame Ausstellung. Schon damals konnten einige Kri-tiker kaum glauben, dass zwei Künstler so in sich geschlossene, wie aus einem einzigen Duktus he-raus entstandene Bilder gestalten können – und sprachen von einem „dritten Ich“, das „starke Bilder“ erschafft. Derart begann 2006 das fifty/fifty-Projekt – und ein Ende ist nicht abzusehen.
mk
kunstimwerk
DiE KünSTLEr
Foto: Annette Reichardt/Stewens Ragone
Annette Reichardt1962 geboren in Peine1987–95 Studium freie Kunst an der HBK Braunschweig bei Prof. Johannes Brus, Prof. Hans Peter Zimmer und Prof. Thomas Virnich1995 Diplom für freie Kunst
Stewens Ragone1960 in Ilsede geboren1983–1989 Studium an der HBK Braunschweig bei Prof. Hans Peter Zimmer und Lienhard von Monkiewitsch1989 Meisterschüler bei Prof. Hans Peter Zimmer2002 Stipendium der Künstler-häuser Worpswede2003 „Artist in residence“, Neuer Kunstverein, Aschaffenburg2001–2006 „DOPPELPOP“ Zusammenarbeit mit dem Bild-hauer Michael Denkler
AusstellungenZahlreiche gemeinsame Ausstel-lungen, unter anderem in Düren, Berlin, München, Mannheim, Lübeck, Oldenburg, Aschaffen-burg, Celle, Köln, Karlsruhe und Ulm.
Weitere infos: www.ragonereichardt-fiftyfifty.de/ home.html
Foto: mk
Unten: „Kölner Block“ – 36 Bilder, ca. 11 x 1,50 m
Foto: Stewens Ragone
Furchterregend, humorig, doppelbödig: das Bild „Toller Hecht sucht flotten Hasen“. Foto: Stewens Ragone
Wolfgang Zimmermann und die beiden Künstler vor dem Bild „Höhenflug“ Foto: mk

glück auf · 1/2014 ......... 16
DIE ETWAS ANDERE SEITE
Ich heiße José António Correia de Freitas und komme aus Portugal. Chamo-me José António Correia de Freitas e sou de Portugal.
António de Freitas ist 51 Jahre alt, spricht deutsch und portugiesisch und hat die portugiesische Staatsangehörigkeit. Er arbeitet seit dem Gründungsjahr 2001 als Rohstoffhändler bei der Rohstoff Recycling Dortmund GmbH, Abteilung Ein- und Verkauf. Religion: römisch-katholisch. Hobbys: Familie, Haus und Garten, Fußball und Reisen.
António de Freitas tem 51 anos, fala alemão e português e tem a nacionalidade portuguêsa. Trabalha na companhia Rohstoff Recycling Dortmund GmbH como comerciante de materiais segundarios desde 2001 (ano de fundação), departamento compra e venda. Religão: católico. Passatempos: a fámilia, casa e jardim, futebol e fazer viagens.
Wann sind Sie nach Deutschland bzw. wann sind ihre Eltern nach Deutschland gekommen?Ich bin seit 1967 in Deutschland, mein Vater seit 1965 und meine Mutter seit 1966.
Welche Ausbildung haben Sie durchlaufen?Handelsschule, 1980–1982 Ausbildung zum Groß-und Außenhandelskaufmann, 1984 Handelsfachwirt
Was mögen Sie an Deutschland?Das geregelte Gesundheits- und Sozialwesen
Was mögen Sie an ihrem heimatland?Gastfreundschaft, Freundlichkeit, Wetter
Was mögen Sie an Deutschland gar nicht?Hektik, Bürokratie, Schul- und Bildungssystem
Was mögen Sie an ihrem heimatland gar nicht?Mangelnde Ausbildungs- und Berufsaussichten für Jugendliche
Was ist typisch deutsch?Gartenzäune
Was ist typisch an Portugal?Fado, gutes Essen, Kinderfreundlichkeit, Strand und Meer
Was würden Sie in der Ausländerpolitik ändern, wenn Sie „König von Deutschland“ wären?Einführung des Wahlrechts für in Deutschland lebende und arbeitende Ausländer
Was ist wichtig für ein friedliches zusammenleben unterschiedlicher nationaler mentalitäten?Gleichheit und Toleranz
ihr Lebensmotto?Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag.
Quando imigrou você e os seus pais para a Alemanha?Estou desde 1967 na Alemanha, o meu pai desde 1965 e minha mãe desde 1966.
Que tipo de treinamento completou?Escola de comercio, 1980 – 1982 formação para comerciante, 1984 comercial econômico
o que você gosta na Alemanha?A saúde regulamentada e a assistência social
o que você gosta no seu país natal?A hospitalidade, a simpatia, o tempo
o que você não gosta na Alemanha?Héctica, burocracia, sistema de escolar e ensino
o que você não gosta no seu pais natal?Falta de treinamento e oportunidades de carreira para a juventude
o que é típico alemão?Barreiras no jardim
o que é tipico português?Fado, comida boa, ser bom para crianças, a praia e o mar
o que você mudaria na política externa se fosse o „rei da Alemanha“ ?Introdução do sufrágio para estrangeiros que vivem e trabalham na Alemanha
o que é importante para a coexistência pacífica de diferentes mentalidades nacionais?Igualdade e tolerância
o seu lema da vida?Um dia sem rir é um dia perdido.
Foto: mk
raten Sie mal!Sie weiß nicht nur (Schreib-)Fehler zu beheben, sondern auch Rätsel auf-zugeben: Vor welchem Gebäude in welchem Land steht Dorothea Raspe (Lektorin der glückauf) mit der glückauf? Manche werden beim Anblick des Gebäudes „Wat ist datt denn?“ fragen – und sich damit schon die halbe Antwort selbst gegeben haben. Wer die erste Hälfte des Namens vor Ort suchen wollte, müsste – wenn man Herrn K. Alauer glauben darf – mit dem Schiff im Golf von Thailand vor Angkor gehen.Senden Sie die richtige Antwort an [email protected] oder (mit einer Postkarte) an Matthias Krych, Rohstoff Recycling Osnabrück GmbH, Rheinstraße 90, 49090 Osnabrück. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2014. Gehen mehrere richtige Antworten ein, entscheidet das Los. Der Gewin-ner erhält einen Gutschein für den GMH-Fan-Shop. und wo bleibt ihr Foto? Möchten Sie auch ein Bilderrätsel einreichen? Machen Sie einfach ein Foto mit der glückauf im Vordergrund. Im Hinter-grund müssen genügend charakteristische Details zu erkennen sein, um erraten zu können, wo bzw. in welcher Stadt das Foto geschossen wurde. Mailen Sie Ihr Foto einfach an [email protected].
haben Sie’s gewusst? In unserem letzten Rätsel stand Walter Lehmkuhl (ehemaliger Mit-arbeiter der Logistik der GMHütte) vor dem Königspalast in Bangkok. Unter den richtigen Einsendungen (vielen Dank für Ihre Teilnahme!) wurde als Gewinnerin Cornelia Börger (GMHütte) ausgelost. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.) Wir gratulieren!
glück auf unterwegs
Foto: privat
AnDErE LänDEr , AnDErE S i TTEn
Ob China, Indien, Russland oder Japan: Wer für sein Unternehmen im Aus-land unterwegs ist, hat es nicht immer leicht. Denn der Umgang mit fremden Kulturen ist oft nicht einfach. Und wer einmal in den Fettnapf getreten ist, wird sich sein Leben lang daran erinnern. Wie steht es um außergewöhnliche Sitten und Gebräuche zum Beispiel in …
norwegen ?•Prinzipiell ist die norwegische Kultur der deutschen sehr ähnlich. Es wird
Wert auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit gelegt.•Die Begrüßung fällt meist nicht sehr herzlich aus. Man begrüßt sich mit
einem einfachen „Hei“ oder förmlich mit Handschlag.•Mitarbeiterzufriedenheit und Work-Life-Balance sind wichtige Themen.
Viele Unternehmen bieten ihren Beschäftigten neben familienfreund-lichen Arbeitszeiten auch Berghütten, Segelboote oder andere Freizeit-angebote, die sie kostenfrei nutzen können.
•Lädt Sie ein Norweger zum Abendessen ein, so seien Sie darauf gefasst, dass dies bereits zwischen 16 und 17 Uhr stattfinden könnte. In Norwe-gen wird die Hauptmahlzeit (sogenannter Middag) nachmittags serviert.
•Sollten Sie sich in Norwegen ein Bier bestellen, seien Sie nicht verwun-dert, wenn dies schnell 80 Kronen (etwa 10 Euro) kostet. Ein Bargeld-engpass ist aber nicht zu befürchten. Es ist üblich, alle Rechnungen – ob im Supermarkt, Bar oder Taxi – mit Kreditkarte zu bezahlen.
DIE ETWAS ANDERE SEITE
imPrESSum
Den ken Sie da ran: Ih re Le ser brie fe, Ar ti kel, An re gun gen und Kri tik für die nächs te Aus ga be müs sen recht zei tig bei Ih ren An sprech part nern vor lie gen. Letz-ter mög li cher Ter min ist der:
30.4.2014He raus ge ber:Ge orgs ma ri en hüt te Hol ding GmbHNeue Hüt ten stra ße 149124 Ge orgs ma ri en hüt tewww.gmh-gruppe.de
V.i.S.d.P.:Iris-Kath rin Wil ckens
Re dak ti ons team:Norbert Hemsing (nh), Markus Hoffmann (mh), Sarah-Fee Kim (sfk), Ina Klix (ik), Matthias Krych (mk), Dr. Ulrike
Libal (li), Ve ra Loo se (vl), Eberhard Mehle (em), Julia Pehla (jp), Hans-Gün-ter Ran del (hgr), Oliver Santelli (os), Dirk Strothmann (ds), René Surma (rs), Iris-Kath rin Wil ckens (ikw), Marcus Wolf (mw), Dr. Be a te-Ma ria Zim mer mann (bmz)
Pro duk ti on und Gra fik:elemente designagentur, www.elemente-designagentur.ms
Text be ar bei tung:Pe ter Karl Mül ler (pkm)
Lektorat:Dorothea Raspe, Münster
Her stel lung:STEIN BA CHER DRUCK GmbH, Os na brück; auf 100% Re cy cling pa pierDie glückauf erscheint viermal im Jahr.
Foto: privat
Ideelles
Zitate regieren unsere Medien-Welt. Manches Zitat wurde bewusst lanciert, manches zufällig kreiert, manches sollte man ken-nen, manches darf man getrost wieder vergessen. Lesen Sie dies-mal Bedenkenswertes zu unserem Schwerpunktthema „Ideen“:
„Eine gute Idee kann man daran erken-nen, dass sie geklaut wird.“rudi Carrell, verstorbener Entertainer
„Wenn wir schon kein Geld haben, dann brauchen wir wenigs-tens gute Ideen.“oskar Lafontaine, Politiker
„Ein Mann mit einer neuen Idee ist ein Narr – so lange, bis die Idee sich durchgesetzt hat.“mark Twain, amerikanischer Schriftsteller
„Wenn dir jemand erzählt, deine Idee sei verrückt – höre nicht auf ihn.“michael Dell, Präsident IT-Unternehmen Dell Inc.

glück auf Berichte aus den unternehmen1/2014
PROdUKtiOn & innOVAtiOn
Auf den zahn gefühltIAG Magnum produziert bereits seit Jahrzehnten hochwerti-ge Zahnstangen. Die Besonderheit liegt in der geschlossenen Pfeilverzahnung, die nur wenige Firmen mittels Fräsverfahren in der geforderten, hohen Verzahnungsqualität beherrschen und anbieten können. Da die Werkzeuge in der Stoßbank bei der Rohrherstellung ständig im hoch beanspruchten Einsatz sind, unterliegen sie einem relativ hohen Verschleiß. Umso wichtiger ist eine sorgfältige Ultraschallprüfung vor der Fer-tigbearbeitung. ............................ Seite 19
Eigenleistung sei DankHGZ · Neue Drahtbehandlung reduziert Belastungen und erhöht Prozesssicherheit. Um die Investitionskosten so niedrig wie möglich zu halten, haben die Mitarbeiter vieles selbst in die Hand genommen. ............... Seite 18
Kleine Krane, große AnforderungKranbau Köthen · Für den Laien scheinen große Krane leichter zu bauen zu sein als kleine. Aber auch kleine müs-sen kundenspezifische Vorgaben erfüllen. ...... Seite 18
Vom richtigen „Swing“BVV · Neue Lösungen packen Lärmübel direkt an der Wur-zel: Man dämpft die Schwingungen bei Güterwagen dort, wo sie entstehen: am Rad. ................... Seite 19
Präzision der dritten DimensionKranbau Köthen · 3-D-Mess-System und neue Software eröffnen für die Kranbauer ein neues Kapitel in der Quali-tätssicherung. ............................... Seite 19
PARtneR & MäRKte
Berufsorientierung ist allesMannstaedt · „Fliegender Berufsstart“ sorgt für mehr Sicherheit bei der Berufswahl: Schüler können erproben, ob ein technischer Beruf das Richtige für sie wäre. .... Seite 21
Proaktiv statt reaktivMannstaedt · Wie Profil-Experten gezielt Hubgerüste optimieren: Workshop mit Jungheinrich bringt spürbare Verbesserungen und positive Resonanz. ........... Seite 21
zwiespältiges ErfolgsgefühlSWG/GWB · EuroMold feiert 20-jähriges Jubiläum – ein Grund zum Feiern? .............................. Seite 22
Lohnenswerter messe-StressKranbau Köthen · Messestatistik belegt Aufwärtstrend: Die EUROGUSS, ihre Aussteller und Fachbesucher hatten allen Grund, zufrieden zu sein. ........................ Seite 22
„Fachentscheidung“ stellt WeichenGMHütte · Ausbildungswerkstatt unterstützt Schülerinnen und Schüler der Realschule, um ihnen die Wahl ihres neuen Fachs zu erleichtern. ............................. Seite 23
QUALität & QUALiFiKAtiOn
Worst CaseGMHütte · Stahlwerk geht in puncto Arbeitssicherheit auf Nummer Sicher: Schmelzerstiefel überstehen 1.550-Grad-Übergussversuch unbeschadet. ................... Seite 24
Legaler LauschangriffGeissler · Wer Druckluft-Leckagen entdecken will, braucht feine Ohren. Deshalb machen sich in Witten Azubis auf die Suche nach undichten Leitungen. ................. Seite 25
mission possibleMWL Brasil · Flächendeckend sollen Lean Management und 6S eingeführt werden. ........................... Seite 25
„Bitte arbeitet vorsichtiger!“GMHütte · Ein Unfall, bei dem er schwer am Fuß verletzt wurde, hat Dirk Ballmann für das Thema Arbeitssicherheit besonders sensibilisiert. Jetzt ist er neuer Sicherheits beauf-tragter im Finalbetrieb. .......................... Seite 25
Alles wegen guter FührungGMHütte · Lernprozessbegleiter helfen Azubis, richtigen Weg zu finden. ....................................... Seite 27
MenScHen & KOntAKte
Biken im SalzkammergutStahl Judenburg · Alljährlicher Radausflug im Salzkammergut führte geradewegs ins Salzbergwerk. .............. Seite 28
Wer den Cent nicht ehrt …GMHütte · Kleinvieh macht sehr viel Mist: Eine Rest-Cent-Aktion bringt zweimal 8.888,88 Euro für die Kinderhilfsorganisation terre des hommes. ......... Seite 29
Skifahren beflügelte KreativitätStahl Judenburg · Wenn Privates auch Geschäftlichem zugutekommt: In entspannter Atmosphäre kann man schwierige Themen oft leichter ausdiskutieren. ..... Seite 29
regionale TalentschmiedeStiftung · Die Herbstakademie ist nur an den Besten interessiert: Gymnasiasten präsentierten im Kreishaus Osnabrück ihre Forschungsarbeiten. .............. Seite 30
Tierisch gut Deutsch lernenStiftung · Stiftung unterstützt Sprachförderungsprojekt im Zoo Osnabrück, das vor allem Kindern mit Migrationshintergrund zugutekommt. ............ Seite 30
Foto: Marcus Klimek

glück auf · 1/2014 ......... 18
produktion & innovation
Kleine Krane entpuppen sich oft als große herausforderung Kranbau Köthen · Für den Laien scheinen große Krane leichter zu bauen zu sein als kleine. Aber auch kleine müssen kundenspezifische Vorgaben erfüllen.
i nTErV iEW
experten wissen: Kranbau Kö-then ist ein Spezialist für große Krananlagen mit hohen trag-fähigkeiten und großen Spann-weiten. Aber auch „kleine“ Krane mit einer traglast und Spannwei-te von 20 t x 12.023 mm bzw. 25 t x 14.000 mm sind nicht zu unter-schätzen. Sie können ebenso gro-ße technische Herausforderun-gen mit sich bringen wie große – oder gar noch größere. dies gilt vor allem, wenn hüttenwerks-technisch ähnliche Ausführun-gen gefordert oder die Hallen-verhältnisse extrem eng sind. Andreas Kuck (Projektingenieur Vertrieb) beschreibt zwei Beispie-le im glückauf-interview:
glückauf: Wann haben Sie den letz-ten Kran dieser Art hergestellt?Andreas Kuck: Letztes Jahr. Da ha-ben wir der Vallourec Deutschland GmbH in Düsseldorf gleich zwei Krane dieser Art für die Rohrferti-gung geliefert.
Was war deren Besonderheit?Kuck: Die kleinen Anfahrmaße zur Hallenseite hin, die statischen Ge-gebenheiten in der Halle und die beengten Einbaumaße.
Und wie haben Sie diese Probleme letztlich gelöst?Kuck: Wir haben den gesamten Hubwerksrahmen unter das Dreh-werk verlegt und die Kranräder entsprechend der Kranbahnsta-tik verteilt angeordnet. Jetzt kann man trotz beengter Verhältnisse auch längere Lasten unterhalb der Brücke mit dem Kran drehen – und das bei angeschlagener Lasttraver-se. Diese Lösung haben wir übri-gens in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Vallourec-Projekt-leitern entwickelt.
Für die komplette Montage der bei-den Krane hatten Sie jeweils nur zwei
Wochen Zeit – nämlich während des Winter- beziehungsweise während des Sommerstillstands …Kuck: … nicht zu vergessen die Wochenenden und Feiertage, an denen wir nicht arbeiten konnten!
Wie war das in der kurzen Zeit dann überhaupt zu schaffen?Kuck: Wir haben alle Maßnahmen zur Inbetriebnahme – dazu gehö-ren beispielsweise auch die End-schalter- und Umrichter-Einstel-lungen – vorweg abgewickelt. Ge-nauer gesagt: Wir haben die beiden Krane komplett bei uns im Werk in Betrieb genommen und durch-getestet. Auf diese Weise konnten wir beide Krane termingerecht den Kunden übergeben – zu deren vollsten Zufriedenheit.
Und wann gingen die Schulungen der Mitarbeiter über die Bühne?Kuck: Die Mitarbeiterschulun-gen fanden jeweils mit der ersten Schicht nach den Werksstillstän-den am funktionsbereiten Kran statt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Sachverständigen bereits die U.V.V.-Prüfung durchgeführt. Eine Produktionsbeeinträchtigung für den Kunden fand also trotz der knappen Montagezeit nicht statt.
Vielen Dank für das Gespräch.
Eigenleistung sei Dankharz Guss · Neue Drahtbehandlung reduziert Belastungen und erhöht Prozesssicherheit.
Der Kontinuierliche Verbesse-rungsprozess zeitigt bei Harz
Guss Zorge (HGZ) nicht nur klei-ne, sondern ab und zu auch gro-ße Fortschritte. Jüngstes Beispiel ist die Verbesserung des Behand-lungsprozesses für die Werkstoff-sorten GJS und GJV.
In Kooperation mit der OCC Gesellschaft für physikalische Messtechnik und kybernetische Systeme mbH aus Mönchenglad-bach hat man eine modifizierte Drahtbehandlungsstation mit zwei Kabinen erstellt. Dort wird eine simultane Impf- und Mag-nesiumbehandlung des Flüssig-eisens durchgeführt.
Geschaffen hat man eine sehr effiziente Parallellösung. Sie unterstreicht den Anspruch von HGZ, zu den Technologieführern und Innovatoren der Branche zu gehören.
Die Gießerei kann mit der neuen Drahtbehandlung GJV- und GJS-Legierungen in bisher nicht bekannter Prozesssicher-
heit herstellen. Da man OCC-gestützte Drahtbehandlung, Schmelzbetrieb (E-Ofenbereich, Eisentransport und Labor) und Mecana-Vergießeinrichtung mit-einander verknüpft hat, konnte man zudem die Qualitätssiche-rung signifikant verbessern.
Aber auch der Gesundheits-aspekt kam nicht zu kurz. Denn während der Behandlung kommt es zu Behandlungsdämpfen und Blendeffekten. Die neue Anlage reduziert diese arbeitsplatzspezi-fischen Belastungen um mehr als 50 Prozent.
Der besondere Clou der neu-en Anlage: Das Projekt ist auch ein gelungenes Beispiel für die bekannte Redewendung „Hilfe durch Selbsthilfe“. Denn auf-grund der herrschenden wirt-schaftlichen Rahmenbedingun-gen war für Harz Guss Zorge von Anfang an klar: Man wollte die Investitionskosten möglichst niedrig halten.
Entsprechend viel musste in Eigenleistung angepackt und umgesetzt werden. Deshalb übernahmen die Mitarbeiter der HGZ-Instandhaltung den me-chanischen und elektrischen Umbau der Anlage.
Die Programmiertechnik hin-gegen überließ man der OCC aus Mönchengladbach. Die von ihren Experten entwickelte OCC-Software ist ein selbstkor-rigierendes, modulares Behand-lungsprogramm, das sich bei Bedarf auf weitere Prozessschrit-te im Schmelzbetrieb ausweiten lässt. Insofern ist noch Luft nach oben.
Die Arbeitsteilung zwischen OCC und HGZ hat sich übrigens bereits bestens bewährt: Die Ver-fügbarkeit der Anlage und ihrer Komponenten liegt bei nahezu 100 Prozent.
Laura Hansen
Verfügbarer denn je: die neue Drahtbehandlung in Betrieb. Foto: Markus Hoffmann
hätten Sie’s gewusst?
GJS Abkürzung für Gusseisen mit Kugelgrafit (Sphäroguss). Werk-stoff mit hervorragenden mecha-nischen Eigenschaften, relativ kostengünstiger Herstellbarkeit, guter Bearbeitbarkeit.
GJVAbkürzung für Gusseisen mit Ver-miculargrafit (Graphitausbildung überwiegend in „Würmchen“-Form). Gute Kombination aus Zugfestigkeit, Zähigkeit, Tempe-raturleitfähigkeit, Temperatur-wechselbeständigkeit, Bearbeit-barkeit und Vergießbarkeit.
Andreas Kuck Werksfoto

glück auf · 1/2014 ......... 19
produktion & innovation
Vom richtigen „Swing“Bochumer Verein · Neue Lösungen packen Lärm an der Wurzel: Man dämpft die Radschwingungen.
musik wird oft nicht schön ge-funden, weil sie stets mit Ge-
räusch verbunden“, reimte einst Wilhelm Busch. Was sich hier scherzhaft auf Musik bezieht, gilt sicherlich mit vollem Ernst für den Güterwagen-Bahnverkehr – besonders auf hohlwegartig um-grenzten Fahrtstrecken mit Trich-tereffekt wie zum Beispiel dem Rheintal. An solchen Bahntrassen, die besonders nachts von vielen Güterwagen frequentiert werden, sind Beschwerden und Proteste von Anwohnern an der Tagesord-nung.
Bahnlärm ist auch ein Thema im Koalitionsvertrag der neuen Bun-desregierung. Die Koalition möch-te, dass „der Stand der Technik zur Geräuschminderung konsequenter in die Praxis eingeführt wird und dass ab 2020 laute Güterwagen das deutsche Schienennetz nicht mehr befahren dürfen.“ Sie will sich dar-über hinaus für ein EU-weites Ein-satzverbot von lauten Güterwagen einsetzen.
Damit will man vor allem den begonnenen Wechsel von Grau-gussklotzbremsen auf Verbund-material K oder LL-Sohlen (Flüster-bremsen), die den Lärmpegel der Güterwagen um 8–10 dB(A) senken sollen, fördern und beschleunigen. Die bisherigen „Klotzbremsen“ führen nämlich zu einer Aufrau-ung der Radlaufflächen – was die besonders große Lärmanregung bei Güterwagenrädern verursacht.
Für Güterwagen, die nicht um-gerüstet sind, müssen seit letztem
Jahr höhere Preise beim Befahren dieser Bahntrassen bezahlt wer-den. Mit den Einnahmen werden Umrüstungen subventioniert. Ab 2020 dürfen sogar laute Güterwa-gen nicht mehr durch die Schweiz fahren.
Natürlich könnte man bei Gü-terwagen wie beim ICE auch Rad-schallabsorber statt Scheiben-bremssysteme anstatt Klotzbrem-sen einsetzen – was die Laufgeräu-sche der Räder massiv reduzieren würde. Der Bochumer Verein bietet zudem Güterwagenradsätze mit Radschallabsorbern an, entwickelt
im Rahmen des Forschungsvorha-bens „LZarG – Leiser Zug auf rea-lem Gleis“.
Aber diese beiden Lösungen wären für die breite Masse des Güterverkehrs zu teuer. Denn im Gegensatz zu Personenwagen ha-ben Güterwagen eine geringere Laufleistung. Mit anderen Worten: Sie haben viel längere Stillstands-zeiten, in denen kein Geld damit verdient werden kann.
Dies erklärt den hohen Kos-tendruck und die Zurückhaltung, wenn es um Investitionen geht – zumal man konkurrenzfähig blei-
ben muss gegenüber dem Güter-verkehr auf der Straße.
Hinzu kommen technische Herausforderungen bei klotzge-
bremsten Rädern. Bei solchen Rä-dern können durch langdauern-des Bremsen bei einer Bergabfahrt auf der Lauffläche des Rades über 600 Grad Celsius entstehen. Aber am Absorber darf die Temperatur von etwa 300 Grad Celsius nur kurzzeitig überschritten werden, weil ansonsten die Dämpfungswir-kung abnimmt.
Gesucht ist also ein Kompro-miss: eine preisgünstigere und temperaturbeständige Lösung, die gleichzeitig keine große Leistungs-reduzierung mit sich bringt.
Eine erste Idee war, einen tel-lerförmigen Radschallabsorber zu entwerfen, also einen Radkap-penabsorber, der einen Teil des er-zeugten Schalls quasi „einsperrt“ (dämmt). Diese Maßnahme allein könnte den Lärm aber nur gering-fügig reduzieren. Denn ein Teil des Rades bleibt immer sichtbar – und der dort abgestrahlte Schallpegel dadurch ungedämmt.
Wirksamer ist, die Schwingun-gen des Rades zu dämpfen. Denn
diese Schwingungen sind es, die den Lärmpegel verursachen. Auf diesem Prinzip beruhen auch die herkömmlichen Radschallabsorber des Bochumer Vereins: Man redu-ziert die Schwingungsamplituden auf einen Bruchteil – und entspre-chend weniger Schallenergie kann abgestrahlt werden.
Nach ersten Entwicklungsarbei-ten wurde eine Reihe verschiede-ner Räder und Radkappenabsorber getestet, zusammen mit dem Ins-titut für Schienenfahrzeuge an der RWTH Aachen. Der Güterwagen-betreiber VTG organisierte dafür Fahrversuche an einem Versuchs-zug. Dazu wurde ein Waggon mit Prototyprädern und ersten Radkap-penabsorbern ausgerüstet und auf Testfahrt geschickt.
Gemäß den Zulassungsbedin-gungen (TSI Lärm) für Schienen-fahrzeuge dürfen bei einer Vorbei-fahrt die gemessenen Luftschallpe-gel einen vorgegebenen Grenzwert nicht übersteigen. Testergebnis: Während ein mitgemessenes Refe-renzfahrzeug mit herkömmlichen Rädern und Verbundstoffsohlen nur knapp den Grenzwert ein-halten konnte, lag der Pegel der mit Absorbern gedämpften Räder 3 dB(A) darunter.
Rad und Absorber wurden da-nach weiterentwickelt. Die im La-bor gemessene Eigendämpfung des Rades hat inzwischen eine Größen-ordnung erreicht, die der Wirkung der herkömmlichen Radschallab-sorber nahekommt und eine Grö-ßenordnung von 5–8 dB wie bei den Absorbern des ICE erwarten lässt.
Noch ist die Entwicklung nicht abgeschlossen. Doch die Spezia-listen beim Bochumer Verein sind zuversichtlich, auf dem richtigen Entwicklungsweg zu sein.
Martin Fehndrich
zahnstangen garantieren den erforderlichen AntriebiAG magnum · Zahnstangentechnologie: jahrzehntelange Erfahrung.
i nTErV iEW
Um nahtlose Rohre herzustellen, kommen verschiedene Verfahren zur Anwendung, unter anderem das Stoßbankverfahren. Für die dafür erforderlichen Rohrstoß-bänke und deren Antriebsele-ment bietet die iAG Magnum die neufertigung und Komplettliefe-rung von einbaufertigen Zahn-stangen. Was es damit genau auf sich hat, berichtet Michael eng-berding (Leiter technische Kun-denberatung) im glückauf-inter-view:
glückauf: Auf welche Bauteile kommt es bei einer Stoßbank besonders an?michael Engberding: Auf das An-triebselement, wozu im Wesent-lichen die Zahnstange und zwei Ritzelwellen gehören. Eine Zahn-stange besteht aus mehreren Seg-menten und stellt eine durchaus beträchtliche Investition für den Anwender dar. Die Gesamtlänge beträgt je nach Anlage 35 bis gut 50 Meter. Sowohl die Zahnstange als auch die einteiligen Ritzelwel-len werden aus legiertem Schmie-destahl hergestellt.
Was ist das Besondere der Fertigung?Engberding: Die Besonderheit liegt in der geschlossenen Pfeil-verzahnung, die nur wenige Fir-men mittels Fräsverfahren in der geforderten, hohen Verzahnungs-qualität anbieten können. Da die Werkzeuge in der Stoßbank bei der Rohrherstellung ständig im hoch beanspruchten Einsatz sind, unter-liegen sie einem relativ hohen Ver-schleiß. Sie müssen nach einer ge-wissen Anzahl von Lastwechseln
repariert und nach drei bis vier Einsatzperioden komplett ausge-tauscht werden.
Weshalb sollten Interessenten gerade mit der IAG Magnum zusammen-arbeiten?Engberding: Weil wir unseren Kun-den eine Reihe von Mehrwerten bieten.
Zum Beispiel?Engberding: Die komplette Her-stellung aller für eine Zahnstan-ge benötigten Schmiedestücke – von der Stahlerzeugung über das Schmieden, Vergüten und Fertig-bearbeiten einschließlich Mon-tage der Zubehörteile. Das erfolgt komplett in der GMH Gruppe oder auch mit langjährigen qualifizier-ten Partnern. Wir begleiten und überwachen dabei den gesamten Herstellungsprozess.
Wie lang sind die Zahnstangen?Engberding: Zahnstangen ha-ben eine Gesamtlänge von bis gut 50 Metern und bestehen bei mo-dernen Anlagen aus maximal drei Einzelsegmenten. Wir können Seg-mentlängen von bis zu 18 Metern liefern. Das ist wichtig, um die Seg-
mentanzahl und damit die Anzahl an Verbindungsstellen niedrig zu halten. Diese Stellen sind die kri-tischen Bereiche der Gesamtkons-truktion einer Zahnstange. Dort entstehende Anrisse führen bei weiterem Betrieb zu Brüchen oder Komplett-Abrissen.
Und wenn es mal zu An- und Abris-sen kommt?Engberding: Bei einem kompletten Abriss gibt es nur die Möglichkeit einer Neufertigung. Deshalb ist es besonders wichtig, eine Zahnstan-ge nach jeder Einsatzperiode zu überprüfen, Anrisse auszuschleifen und bei Bedarf zu schweißen sowie alle Verbindungsstellen instand zu setzen. Des Weiteren werden ver-schlissene Zubehörteile erneuert oder repariert. Solche Arbeiten
werden komplett von uns ausge-führt.
Welcher Kundenkreis gehört zur IAG Magnum?Engberding: Man kann sagen: sämtliche namhaften Nahtlosrohr-hersteller, die das Stoßbank- oder CPE-Verfahren einsetzen bezie-hungsweise Anlagen herstellen.
Kommt es dabei auch zu technischen Kooperationen?Engberding: Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten und äußerst er-folgreich. Gemeinsam mit unseren Kunden optimieren wir laufend so-wohl konstruktive als auch werk-stofftechnische Aspekte, um die Lebensdauer zu erhöhen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Michael Engberding, Leiter technische Kundenberatung Foto: Marcus Klimek
Greift perfekt ineinander: Pfeilverzahnung Foto: Marcus Klimek
Der Radkappenabsorber wird in einer Nut in der Nabe des Rades befestigt und wirkt wie eine auf das Rad drückende Tellerfeder, die dreißig am Absorber befestigte Reibelemente auf die Radfläche presst. Das Foto zeigt einen Teil der Aufspanneinrichtung mit einer speziell für das Versuchsrad abschraubbaren Nabe. Werksfoto
q Das könnte Sie auch interessieren:
Mit Ping-Pong-Taktik ins Ziellesen Sie auf Seite 8

glück auf · 1/2014 ......... 20
produktion & innovation
Präzision der dritten DimensionKranbau Köthen · Genauigkeit im Hundertstel-Millimeter-Bereich über gesamte Produktion hinweg: 3-D-Mess-System und Mess- und Analysesoftware eröffnen ein neues Kapitel in der Qualitätssicherung.
in modernen Industriebetrieben ist eine Produktion oder Qua-
litätssicherung ohne moderne Messhilfsmittel kaum noch denk-bar. Bis vor einigen Jahren wurden hochgenaue Messmittel fast aus-schließlich im Flugzeug- und Auto-mobilbau oder auch in der Präzi-sionsmechanik eingesetzt (z. B. im Turbinenbau). Heute finden sich diese Messgeräte zunehmend in der Schwerindustrie, im Schiffbau und verschiedenen anderen Indus-triebereichen.
Den gleichen Ansatz verfolgt Kranbau Köthen mit dem Einsatz der 3-D-Messtechnik von Leica in Kombination mit der Mess- und Analysesoftware von Spatial Ana-lyzer (SA-Software). Sonderkrane aus Köthen sind Krane für den Ein-satz im hochdynamischen Bereich, arbeiten unter extremen Tempera-turbedingungen, speziell und auf Kundenwunsch angepasst.
Aufgabe ist es, mit der 3-D-Messtechnik ein Qualitätssiche-rungssystem zu implementieren, das durch die messtechnische Be-gleitung der Bauteile eine „genaue Fertigung“ gewährleistet, indem die geforderten Toleranzen von Anfang an besser kontrolliert und realisiert werden – beginnend mit dem Zuschnitt über die Vorfer-tigung und Fertigung bis hin zur Montage.
Aufwendige Mess-, Bau-, und Anpassarbeiten sollen minimiert, komplette Fertigungsabläufe ge-strafft und verbessert werden. Letztlich will man dadurch in der Fertigung die Projektdurchlauf-zeiten verkürzen, um die Basis für mehr Durchsatz zu schaffen. Eine besondere Bedeutung kommt in
der Vorfertigung der einzelnen Baugruppen den Kastenträgern (Haupt-, Neben- und Kopfträgern) zu. Die tonnenschweren Bautei-le müssen logistisch und vorrich-tungstechnisch anspruchsvoll, mil-limetergenau räumlich platziert, ausgerichtet, abgelängt und inein-andergefügt werden.
Mit der 3-D-Messtechnik und SA-Software in Verbindung mit geodätischen Ansätzen ist man in der Lage, bereits in der Vor-fertigung einen ganzheitlichen Fertigungsprozess zu realisieren.
Ganzheitlich heißt, dass von der 3-D-Konstruktion über Zuschnitt, Zusammenbau und Schweißen bis hin zu Auslieferung und Montage des fertigen Produktes die einzel-nen Verfahrensschritte ineinan-dergreifen und aufeinander ab-gestimmt sind – und dass sie von Anfang an mess- und analysetech-nisch begleitet werden.
Die Schweißkonstruktionen werden so bereits in der Vorferti-gung im CAD gegen null vermes-sen, abgeglichen und ohne auf-wendiges Zusammenstellen im
„Best Fit“ vorbereitet. Zudem kön-nen für den räumlichen Aufbau des Krankarrees Vorrichtungselemente (z. B. Böcke und Träger) exakt mit den tatsächlichen Fertigungstole-ranzen im CAD bestimmt, in der Halle angepasst und beim Aufbau positioniert werden.
3-D-Messtechnik und SA-Soft-ware wurden nicht nur ausge-wählt, weil man große Objekte mit wenigen relevanten Punkten in Echtzeit vermessen kann. Die Ent-scheidung für dieses System basier-te auch auf dessen kompakten Ab-
messungen, da es häufig transpor-tiert werden muss. Schließlich sind die anfallenden Einsatzgebiete sehr vielfältig (Anbau und Vorbereitung – Messen von zyklischen Einsätzen – bzw. Zustandsbewertungen von Arbeitsprozessen und deren Aus-wirkungen).
Weitere Vorteile sind:•Das mobile Mess-System ist in
wenigen Minuten aufgebaut und einsatzbereit.
•Der Lasertracker hat sich bereits besonders bei der Vermessung der Form- und Lagetoleranzen von Kopf- und Kastenträgern be-währt.
•Der Lasertracker kann zudem steil nach oben oder unten mes-sen, was einen bauteilnahen Ein-satz auch in beengten Umgebun-gen zulässt. Dadurch kann nahe-zu überall gemessen werden.
•Der größte Vorteil ist das berüh-rungslose Messen online im di-rekten Vergleich zum CAD-Mo-dell.
•Die Systemgenauigkeit bewegt sich im Hundertstel-Millimeter-Bereich.Das Messen kann unterbrochen
und durch die Einmessung über die Referenzpunkte zu jeder Zeit wie-derholt werden (Wiederholungs-messungen von zu überwachenden Bauteilen oder Deformationsanaly-sen).
Das Gerät ist IP54-zertifiziert und somit extrem robust für den Einsatz in der Fertigung, der De-montage und Montage sowie bei der Inbetriebnahme von Kranen.
Die SA-Software arbeitet mit so-genanntem Postprocessing. Dies ermöglicht, die entstandenen Datenmengen in verständliche Darstellungsformen umzuwandeln und in geeignete Messprotokolle zur Dokumentation zu überführen.
Kranbau Köthen hat Qualitäts-management und Fertigungskon-trolle durch die Anschaffung des laserbasierten Mess-Systems ausge-weitet und aufgewertet.
Karsten Freytag
AuF E in FAChWorT
Das geodätische Netz Aus vermessungstechnischer Sicht ist der permanente Ab-
gleich des konstruktiven Solls mit dem gefertigten Ist eines Bauteils für den Fertigungsprozess unabdingbar. Um einerseits lang gestreckte voluminöse Bauteile (Kastenträger, Kopfträ-ger) und andererseits hochpräzise geometrische Bedingungen (Spurbreiten, Stürze) in geforderter Genauigkeit homogen und ganzheitlich aufmessen zu können, bedarf es besonderer Vor-aussetzungen sowie modernster Mess- und Auswerteverfahren.
Wegen der baulichen Situation der Fertigungshalle (fester Untergrund, massive Stützpfeiler) musste man nach vielen intensiven Gesprächen zwischen Geschäftsleitung von Kranbau Köthen, Fertigung und Konstruktion sowie Soft- und Hard-warefirmen sowohl aus vermessungstechnischer als auch aus fertigungstechnischer Sicht Neuland betreten.
Grundlage der Messungen ist ein homogen ausgeglichenes dreidimensionales Festpunktfeld (Abbildung), das aus derzeit 86 Punkten besteht. Die Anforderungen an das geodätische Netz sind:
Die Punkte müssen so gewählt sein, dass sie gut anvisier-bar sind (Pfeilerecken, Stirnseiten, versenkbare Bodenpunkte), damit an jeder Stelle der Halle mindestens vier Punkte für die Standortbestimmungen gewährleistet sind. Diese Punkte müs-sen stabil sein (35-mm-Einschlaghülsen in vorbereiteten Kern-bohrungen).
Das Netz muss unter fehlertheoretischen Gesichtspunkten optimal konfiguriert sein („Best fit“).
Die Netzpunkte wurden durch klassische geodätische Strecken- und Winkelmessung miteinander zu einem Netz verknüpft. Durch den Einsatz spezieller Wartungssoftware konnten unprozessierte Daten aus dem Instrument ausge-
lesen werden, um der Ausgleichung unverfälschte Rohdaten zuzuführen. Das Netz wurde homogen, dreidimensional und zwangsfrei ausgeglichen. Durch die funktionalen und stochas-tischen Methoden der Netzausgleichung wird eine Punkt-genauigkeit des Netzes erreicht, die es ermöglicht, das Mess-instrument an jeder beliebigen Stelle in der Halle mit einer Genauigkeit von 0,2 mm zuverlässig zu positionieren.
Die praktische Erfahrung mit dem Netz hat die vorausbe-rechneten Ergebnisse bestätigt und zeigt, dass die erwartete Stationierungsgenauigkeit erreicht wird. Um etwaige Setzun-
gen und Driftbewegungen der Halle zu beobachten, soll eine Revisionsmessung des Netzes erfolgen, bei der weitere Punkte eingefügt werden sollen, um die Verfügbarkeit noch einmal zu verbessern.
Das ermöglicht, die Einzelkomponenten eines Krans unab-hängig von ihrer Lage in der Fertigungshalle virtuell im Aus-werteprogramm, in dem auch das dreidimensionale Modell aus der Konstruktion hinterlegt ist, zusammenzufügen. Das erspart das aufwendige und zeitintensive gegenseitige iterati-ve Ausrichten von Bauteilen, beispielsweise zum Zwecke der Ablängung von Kastenträger-Enden.
Das Verfahren bedarf eines speziellen vermessungstechni-schen Instrumentariums, spezieller Auswertesoftware und gut geschultem Personal. Instrumentell kommt ein Absolute Tracker der Firma Leica zum Einsatz, der als mobiles und kompaktes Gerät höchste Genauigkeit auch auf längere Ent-fernungen bis 100 m ermöglicht (absolute Winkelgenauigkeit: 0,07 Bogensekunden; absolute Distanzgenauigkeit: 0,000.1 mm).
Damit eignet sich das Gerät nicht nur für den festen Einsatz in der Fertigungshalle, sondern auch für den mobilen Einsatz beim Kunden zu Montage-, Service- und Wartungsarbeiten. Durch umfangreiches Spezialzubehör sind selbst schwer zugängliche Stellen an den Bauteilen messbar.
Die 3-D-Auswertesoftware ermöglicht quasi in Echtzeit merkmalbasiert gemessene Punkte und Geometrien gegen das Soll des Konstruktionsmodells zu vergleichen und Abweichun-gen zu dokumentieren. Neben vermessungstechnischem Wis-sen sind umfangreiche Kenntnisse im Stahlbau nötig, um die-ses System zur Optimierung von Arbeitsprozessen einzusetzen.
Rudolf Wehmeyer
5-Träger-Brückenkran in der Fertigungshalle Werksfoto
Der etwas „andere Blick“ in die Fertigung: Die 86 stabil in der Halle verankerten Messpunkte wurden durch klassische geodätische Strecken- und Winkelmessung miteinander zu einem Netz verknüpft: dem geo-dätischen Netz.
Quelle: VMT GmbH

glück auf · 1/2014 ......... 21
partner & märkte
Proaktiv statt reaktivmannstaedt · Wie Profil-Experten gezielt Hubgerüste optimieren: Workshop mit Jungheinrich bringt spürbare Verbesserungen und positive Resonanz.
unter dem Motto „Profil der Zukunft“ fand im November
letzten Jahres ein eineinhalbtägi-ger Workshop in Troisdorf statt. Dabei trafen Experten von Mann- staedt auf den Konzern-Arbeits-kreis „Hubgerüste“ der Junghein-rich AG – des weltweit drittgrößten Gabelstaplerherstellers. Schwer-punkt des Treffens war, alle tech-nischen Aspekte in der seit Langem bestehenden Geschäftsbeziehung zu beleuchten.
Konkret hatte sich der Arbeits-kreis zum Ziel gesetzt, die Hubge-rüste der Gabelstapler technisch und kostenmäßig zu optimieren. Dabei fällt den von Mannstaedt ge-lieferten Mastprofilen eine Schlüs-selrolle zu. Schließlich sind sie die wichtigste Komponente in einem Hubgerüst.
Und so analysierten die Teilneh-mer des Workshops die vielfältige Mannstaedt-Profilpalette, um An-forderungen für kommende neue Produkte zu definieren. Als eine der Konsequenzen daraus werden nun mehrere Profilzeichnungen
angepasst, was zu spürbaren Ver-besserungen in der weiteren Ver-arbeitung bei Jungheinrich führen wird.
Die Gäste absolvierten natürlich auch einen Betriebsrundgang. Da-bei konnten sie sich davon über-zeugen, wie proaktiv Mannstaedt daran arbeitet, gegenwärtige und
zukünftige Anforderungen von Kunden aus der Gabelstapler-In-dustrie zu erfüllen.
Dies belegten unter anderem eindrucksvoll zwei neue Anschaf-fungen: die Laser-Messanlage zur Warmvermessung von Profilen an der Walzstraße und die laserba-sierten Messanlagen zur Erfassung
der Geradheit im Kaltsägezentrum. Sie ermöglichen Mannstaedt, Pro-file zu liefern, deren Eigenschaf-ten bzw. Qualität gleichbleibender sind als bisher. Und sie erlauben, mit dem Kunden engere Toleran-zen zu vereinbaren.
Doch Mannstaedt schaut auch über den eigenen Tellerrand hin-aus. Denn man optimiert nicht nur den Walzprozess. Im Fokus sind auch die nachgelagerten Prozes-se, die das Walzprofil noch weiter veredeln. Dem Arbeitskreis wurde ein entsprechendes Verfahren vor-gestellt, das speziell die Hubmast-profile für Premiumfahrzeuge er-heblich verbessert. Die Resonanz der Gäste war äußerst positiv. Alle waren sich einig: Man will gemein-sam weiter an der Produktionsreife dieses Verfahrens arbeiten.
Guido Glees und Franz-Dieter Philipp
hätten Sie’s gewusst?
ProaktivProaktiv steht im Gegensatz zu reaktiv. Während „reaktiv“ ein abwartendes, defensives Verhalten bezeichnet (man wartet ab, bis etwas passiert, und agiert dann), bezeichnet „proaktiv“ ein initiati-ves, offensives Handeln (man war-tet nicht ab, sondern agiert).
Tube & WireGmhütte · Alle zwei Jahre findet in der Messehal-le Düsseldorf die „Wire“ statt. „Sie hat sich in der Draht-, Rohr- und Stabstahlindus-trie als internationale Weltleit-messe etabliert. Auf wachsender Ausstellungsfläche und an immer akttraktiveren Messeständen kann sich die Fachwelt über Innovatio-nen und aktuelle Trends rund um das Thema Draht und Kabel infor-mieren. In diesem Jahr findet die Messe vom 7. bis 11. April statt. Er-wartet werden nach Angaben der Messeleitung rund 38.000 Fach-besucher. Wie in den vergange-nen Jahren sind in Halle 12 viele Unternehmen aus dem Bereich der Hersteller von Langprodukten ver-treten. Auch die GMHütte ist auf Stand C33 mit von der Partie. Dort präsentiert sie sich gemeinsam mit GMH Blankstahl, Stahl Judenburg, Wista und Heinrich Geissler mit einem eigenen und neu konzipier-ten Messestand – auf zwei Etagen und einer Messefläche von insge-samt 165 m². Die Unternehmen der GMH Gruppe freuen sich heu-te schon auf fünf spannende Mes-setage.
Jonas Werner
„Fliegender Berufsstart“mannstaedt · Berufsorientierung ist alles – und sorgt für mehr Sicherheit bei der Berufswahl.
Bekanntlich ist ein Haus nur so stabil wie das Fundament, auf
dem es steht! Was dies für die be-rufliche Laufbahn bedeutet, haben die Teilnehmer des diesjährigen „Fliegenden Berufsstarts e.V.“ be-reits erfahren dürfen.
Es begann im November letzten Jahres. Mehrere Jugendliche, die nach dem Schulabschluss auf der
Suche nach einem Ausbildungs-platz und technikinteressiert wa-ren, starteten mit Vollgas in ein umfangreiches Programm.
Zunächst wurden ihnen eine fundierte theoretische und prak-tische Metallgrundbildung sowie elektro- und kunststofftechnische Kenntnisse vermittelt. Die Feder-führung hatte dabei die „Dr. Rei-
nold Hagen Stiftung“ in Bonn. Da-nach absolvierten sie verschiedene Tests, deren Ergebnisse sie dabei unterstützen werden, die richtige Berufswahl zu treffen.
Seit Anfang des Jahres stehen für die Teilnehmer mehrwöchige Praktika zur Berufserprobung in unterschiedlichen Unternehmen auf dem Programm. Hier wird sich
letzten Endes zeigen, wie sehr sich bei den Jugendlichen das Lernfun-dament schon gefestigt hat. Auch Mannstaedt – das Unternehmen ist förderndes Mitglied dieser außer-gewöhnlichen Maßnahme – freut sich über zwei Praktikanten. Einer der Teilnehmer kann derzeit ver-schiedene technische Bereiche er-proben. Ein anderer hat zwischen-
zeitlich seine IT-Affinität entdeckt. Ihn fördern die Troisdorfer im Rah-men seines Praktikums mit span-nenden IT-Aufgaben.
Und wer weiß: Vielleicht kann Mannstaedt am Ende der Maßnah-me den einen oder anderen Berufs-starter im neuen Ausbildungsjahr hier in Troisdorf begrüßen.
Ute Pellenz
Lernen von der Praxis für die Praxis (von links nach rechts): Dennis Günter und Thomas Reiter (Dr. Reinold Hagen Stiftung) sowie die Praktikanten Lennart Warkus und Dennis Stibing.
Foto: Ute Pellenz
Eine gelungene Veranstaltung – was man auch den augenscheinlich positiv gestimmten Teilnehmern ansieht. Foto: Monika Hansen

glück auf · 1/2014 ......... 22
partner & märkte
„Nur das Beste ist für uns gut genug“carsten Große-Börding über die Arbeitsschutzmesse A+A:
Ende letzten Jahres fuhr ich mit den Kollegen Frank Huning, Mar-kus Beckmann und Ingo Kammler zur Arbeitsschutzmesse A+A nach Düsseldorf. Die Fahrt dorthin nutzten wir um festzulegen, wel-che PSA-Bereiche uns wichtig wa-ren und was wir uns ansehen woll-ten. Nach gut zwei Stunden Fahr-zeit hatten wir das Ziel erreicht. Gut, dass wir vorab den Messeplan studiert hatten. Denn die vielen Aussteller, die uns interessierten, waren auf mehrere Messehallen verteilt.
Auf unserem Besuchsplan stan-den die Firmen 3M, Atlas und Greven-Physioderm. Dabei war uns der Augenschutz- und Staub-schutz-Spezialist 3M besonders wichtig. Denn wenn wir auf der Hütte unsere Fremdkörper-Verlet-zungen weiter reduzieren wollen, brauchen wir für die Kolleginnen und Kollegen den besten Augen-schutz, der angeboten wird.
Wichtig gerade bei der per-sönlichen Schutzausrüstung sind Handhabbarkeit und Komfort. Ein positives aktuelles Beispiel dafür sind die belüfteten Schutz-helme, die vor Kurzem in der GSG Instandhaltung Stahlwerk eingeführt wurden. Die nahmen wir am 3M-Stand neben anderen Modellen nochmals gründlich in Augenschein. Der 3M-belüftete Schutzhelm gehört der neuesten
Generation an. Das Besondere daran ist: Er kombiniert Kopf-schutz, Augenschutz, Staubmaske und Hitzeschutzmaske. Derzeit versorgen wir bei Bedarf die Mit-arbeiter im Stahlwerk mit diesen neuen Helmen.
Das Prinzip, wonach wir uns bei allen Maßnahmen der Arbeitssi-cherheit richten, ist ganz einfach: Wenn die Anlage keine techni-schen Möglichkeiten bietet, die Kollegen zu schützen, dann ist ei-ne sehr gute Persönliche Schutz-ausrüstung gefragt.
Wir von der Abteilung Arbeits-sicherheit testen die neue PSA übrigens immer erst bei unseren Kollegen. Nur so bekommen wir aussagekräftige Aussagen und Ein-schätzungen für eine fundierte Be-urteilung und letztlich Entschei-dung. Denn erst wenn sich die PSA bei den Kollegen im Test be-währt, wird sie auch angeschafft.
Steckbrief nAmE: Carsten Große-Börding
ALTEr: 50 Jahre
ArBEiTSPLATz: seit 1979 bei der GMHütte, seit 2005 bei der Arbeitssicherheit der GMHütte
WAS mir An mEinEr ArBEiT GE-FäLLT: täglich neue Herausfor-derungen; rege Diskussionen mit Geschäftsführung und Betriebs-leitern; es macht Spaß, Erleichte-
rungen und Verbesserungen im Arbeitsschutz zu schaffen, das mo-tiviert die Kollegen; ihr Lob sind kleine Erfolgserlebnisse für mich; es freut mich, wenn ich auf die-sem Gebiet etwas bewegen kann.
FAmiLiE: verheiratet, zwei erwach-sene Kinder
FrEizEiT & EnTSPAnnunG: Haus und Garten, Gartenarbeit und meine Gartenliege
Carsten Große-Börding (Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der GMHütte)
Werksfoto
Kurz notiert
A + A Die A+A ist die weltweit größte und wichtigste Fachmesse für Arbeitsschutz und Arbeitssicher-heit. Im Fokus stehen dabei dementsprechende innovative Produkte, neueste Trends und wis-senschaftliche Erkenntnisse.
zwiespältiges ErfolgsgefühlSWG/GWB · EuroMold feiert 20-jähriges Jubiläum – ein Grund zum Feiern?
zur EuroMold 2013 nach Frank-furt am Main waren 1.056 Aus-
steller und 58.673 Besucher aus 83 Ländern gekommen. Die Weltmes-se für Werkzeug- und Formenbau, Design und Produktentwicklung übertraf damit die Besucher- und Ausstellerfrequenz des Vorjahres.
Auch bei ihrem 20-jährigen Ju-biläum präsentierte die EuroMold dem Fachpublikum vielfältige Exponate, interessante Themen-foren, Sonderschauen, Konferen-zen, zahlreiche Innovationen und Highlights. „Sie löste damit eine ausgesprochen positive Resonanz beim Fachpublikum aus“, wie der Messeveranstalter Demat in einer Pressemitteilung verlauten ließ.
Auch die Schmiedewerke Grö-ditz (SWG) und die Gröditzer Werkzeugstahl Burg (GWB) nah-
men an der EuroMold teil. Zu fin-den waren sie wie im Vorjahr in Halle 8 – am gleichen Platz mit gleichem Stand in gleicher Größe. Wieso sollte man auch ein bislang erfolgreiches Konzept verändern?
Die erste Messebilanz allerdings fiel zwiespältig aus: Einerseits herrschte beim SWG/GWB-Messe-team der Eindruck vor, dass in Hal-le 8 die Freiflächen immer größer werden und die Besucherfrequenz nachgelassen hat. Andererseits war man mit den Gesprächen auf dem eigenen Messestand überaus zufrie-den, weil sie qualitativ hochwertig waren.
Nach der Messe war man trotz dieser Bilanz unschlüssig, wie es weitergehen soll. Rechtfertigen Kosten und Aufwand weiterhin einen Besuch der EuroMold?
Diskutiert wurden verschiedene Optionen: Sollte man beim nächs-ten Mal die Standfläche verklei-nern? Könnte man das Geld nicht wirkungsvoller investieren – bei-spielweise in einen Kundenevent, den man im eigenen Unternehmen organisiert? Sollte man die Messe nur alle zwei Jahre besuchen? Oder sollte man weiterhin wie bisher jährlich daran teilnehmen?
Inzwischen sind die Würfel in Gröditz gefallen: Einmal geht noch. Die Anmeldung für 2014 wurde bereits verschickt.
Bernd Romeikat und ik
Lohnenswerter messe-StressSWG/GWB · Messestatistik belegt Aufwärtstrend: Die EUROGUSS, ihre Aussteller und Fachbesucher hatten allen Grund, zufrieden zu sein.
zum 10. Mal traf sich die inter-nationale Druckguss-Branche
Mitte Januar in Nürnberg auf der europaweit größten Fachmesse für Druckguss: der EUROGUSS. Waren es 2012 insgesamt 8.415 Besucher, konnte die Messe in diesem Jahr 11.187 verbuchen (davon gut 30 Prozent international); waren es 2012 insgesamt 383 Aussteller, wa-ren es in diesem Jahr 470.
Laut Messegesellschaft kam rund die Hälfte der Messebesucher aus der Automotive-Industrie, also dem Automobil- und Fahrzeugbau sowie deren Zulieferindustrien. Maschinen- und Anlagenbau, die
Elektro- und Elektronikindustrie, der Formenbau und Druckgießerei-en zeigten ebenfalls großes Interes-se an ihrem Branchen-Event.
Unter den Gästen und Ausstel-lern der EUROGUSS herrschte eine ausnehmend optimistische Stim-mung, die unter anderem dem der-zeitigen Boom in der Automobil-industrie zu verdanken war. Auch die Schmiedewerke Gröditz (SWG) und die Gröditzer Werkzeugstahl Burg (GWB), die sich erneut auf
einem Gemeinschaftsstand prä-sentierten, profitierten davon. So registrierte das SWG/GWB-Messe-team eine größere Resonanz, als es erwartet hatte. So konnte man mit vielen (potenziellen) Kunden in Dialog treten und inhaltlich sehr hochwertige Gespräche führen – wobei sich der Mittwoch als stärks-ter Tag erwies.
Messefazit: Das Timing stimmt. Es sind alle zwei Jahre drei inten-sive und lohnenswerte Messetage. Auch 2016 will man der EURO-GUSS die Treue halten.
Bernd Romeikat und ik
Foto: Autobild Klassik
Goggo. Das E-Goggo-
Projekt der Initiative ProAus-bildung hat es nun sogar in die Autobild Klassik geschafft. In einem Bericht über den Umbau von Young- und Oldtimern zu E-Autos hat die Redaktion auch die Aktivitäten der Azubis von KME, Stadtwer-ken Osnabrück und GMHütte vorgestellt. Wer mit eigenen Augen sehen will, wie das Projekt fortschreitet, kann dies unter www.facebook.com/eGoggo tun.
Christian Bloom
GmhüTTE

glück auf · 1/2014 ......... 23
partner & märkte
„Fachentscheidung“ stellt Weichen für die zukunftGmhütte · Ausbildungswerkstatt unterstützt Schülerinnen und Schüler der Realschule, um ihnen die Wahl ihres neuen Fachs zu erleichtern.
zum Ende der 8. Klasse stehen die Schülerinnen und Schüler
der Realschule Georgsmarienhüt-te immer vor einer schweren Ent-scheidung: Sie müssen ihr Profil für die 9. und 10. Klasse wählen – und damit den Grundstein für ihren späteren Berufsweg legen. Bei ihrer Entscheidung werden sie dabei seit vier Jahren tatkräftig von der Ausbildungswerkstatt der GMHütte unterstützt.
Zur Auswahl stehen „Franzö-sisch“, „Gesundheit & Soziales“, „Wirtschaft“ oder „Technik“. In diesen Fächern werden die Jugend-lichen in den letzten beiden Schul-jahren insgesamt zwei oder vier Stunden pro Woche unterrichtet. „Die Kurse sind Vorbereitung und Spezialisierung auf den zukünfti-gen Ausbildungsberuf. Die Schüler müssen wählen, was ihren Inter-
essen und Fähigkeiten am besten entspricht“, so Realschullehrer Björn Windmann. Das herauszu-finden sei aber nicht immer ganz so einfach.
Ein Besuch der Ausbildungs-werkstatt der GMHütte hilft dabei weiter, wie GMHütte-Ausbildungs-leiter Christian Bloom weiß: „Im Rahmen einer Projektwahlwoche kommt jeden Vormittag eine Schü-lergruppe zu uns und erhält einen Einblick in die technische Ausbil-dung.“ Die Schüler durchlaufen die Stationen Elektrotechnik, Zer-spanungstechnik, Schweißtechnik und Metalltechnik. Ihnen immer zur Seite: erfahrene Ausbilder und Auszubildende.
„Ganz wichtig dabei ist die Pra-xis. Denn die wird auch im späte-ren Unterricht und in der Ausbil-dung einen hohen Anteil haben“,
betont Bloom. „Die jungen Leute können deshalb hier selbst Hand anlegen und handwerklich aktiv werden.“ Sie fertigen im Laufe des Vormittags unter anderem einen Kugelschreiberständer mit blin-kendem Logo, greifen aber auch mal zu Feile, Schweißgerät und Lötkolben.
Bei den Schülerinnen und Schü-lern kommt das Angebot gut an: „Ich finde es toll, dass man hier einfach mal ausprobieren kann, ob einem das Handwerkliche und Technische liegt“, meint Fabricio Froncek.
Ob er sich letzten Endes für das Fach „Technik“ entscheidet, weiß er allerdings noch nicht. Aber der Einblick in die Ausbildungswerk-statt wird bei seiner Entscheidung sicherlich helfen.
mw
Werksfoto
Ausbildungsbörse. Die Berufswelt ist stän-dig im Wandel. Umso
wichtiger ist es, Unternehmen und Jugendliche regelmäßig zusammen-zubringen, damit sie sich austauschen können. Gelegenheit dazu bot die Ausbildungsbörse der Agentur für Arbeit Riesa und des Jobcenters Land-kreis Meißen. Sie fand bereits zum fünften Mal statt. Rund 50 regionale Unternehmen, Vertreter der Kammern und Vermittlungsfachkräfte des Arbeitgeber-Service standen diesmal mit eigenen Ständen im Berufsschul-zentrum für Technik (BSZ) in Riesa Rede und Antwort. Dabei konnten interessierte Schülerinnen und Schüler unkompliziert mit Personalverant-wortlichen und Auszubildenden ins Gespräch kommen. Sie informierten sie über ihr Unternehmen und die dortigen Ausbildungsmöglichkeiten. Natürlich beantworteten sie darüber hinaus alle allgemeinen Fragen rund um das Thema Ausbildung. Zeitgleich hatte das Berufsschulzentrum für Technik seine Türen geöffnet, um die vielfältigen Angebote der Schule vorzustellen. Auf der Ausbildungsbörse waren auch erneut die Schmiede-werke Gröditz vertreten. Um ihr umfangreiches Ausbildungsangebot opti-mal zu kommunizieren, waren sie mit vier Mitarbeitern vor Ort: Andreas Donat (Ausbilder), Victoria Apitz (SB Aus- und Weiterbildung), dem Aus-zubildenden Philipp Wolf (Verfahrensmechaniker im dritten Ausbildungs-jahr) und der Auszubildenden Jessica Tege (Werkstoffprüferin im dritten Ausbildungsjahr). Das Foto zeigt Victoria Apitz und Philipp Wolf bei der Beratung von Vater und Sohn.
Victoria Apitz und jp
Flirten mit dem nachwuchs SWG · TU organisierte Orientierungsmesse für Schüler und Studierende. Authentisches Messeteam ermöglichte viele Gespräche auf Augenhöhe.
Anfang 2014 begrüßte die TU Bergakademie Freiberg erneut
zahlreiche Schüler und Studieren-de zur Orientierungsmesse ORTE. Präsentieren konnten sich dabei erstmals über 80 Aussteller. Ermög-licht wurde dieser Rekord, weil die 13. Auflage der halbjährlichen Messe in der großräumigen Sport-halle Ulrich-Rülein-von-Calw statt-fand.
Der Fokus der Messe mit dem Motto „Nimm Kontakt auf“ lag auf den unterschiedlichen Arbeits-platzprofilen, Einstiegsmöglichkei-ten und Rahmenbedingungen, die kleine, mittelständische und große Unternehmen zu bieten haben.
Und so führten rund 2.500 Gäste – ebenfalls ein neuer Rekord – zwi-schen 10 und 16 Uhr vielverspre-chende Gespräche bei potenziellen Arbeitgebern oder besuchten einen der vielen Fachvorträge.
Bereits zum dritten Mal präsen-tierten sich auf der Orientierungs-messe auch die Schmiedewerke Gröditz den Besuchern. Zu ihrem dreiköpfigen Messeteam gehörten Anja Preis (Personalreferentin), Ja-nine Schuster (Produktingenieurin Anwendungstechnik) und Steffen Krahl (Produktingenieur Auftrags-zentrum).
Sie informierten zahlreiche In-teressenten über die verschiedenen
Möglichkeiten für Praktika und Praxissemester in Gröditz. Zudem führten sie zahlreiche Themen-vorschläge zu Bachelor-, Master-, Diplom- und Studienarbeiten im Gepäck. Insofern hatten sie alle Trümpfe in der Hand, die Schmie-dewerke als attraktiven Arbeitge-ber vorzustellen und angehende Ingenieure für einen Einstieg in Gröditz zu begeistern. Als ehema-lige Freiberger Studenten konnten dabei vor allem die beiden Inge-nieure mit ihren persönlichen Er-fahrungen gezielt und authentisch über die Einstiegsmöglichkeiten in Gröditz berichten.
jp
Fahrt „watt ihr volt“ Gmhütte · E-Autos sind ökologisch im „grünen Bereich“. Doch bestehen sie auch im Praxistest?
Gehört den E-Fahrzeugen die Zu-kunft? Welche Antriebstechnik
wird sich in den kommenden Jah-ren und Jahrzehnten durchsetzen? Wie fahren sich solche Fahrzeuge? Welche Unterschiede im Fahrver-halten gibt es zwischen elektro- und kraftstoffbetriebenen Autos?
Diese und viele andere Fragen werden bei der Diskussion um die Mobilität immer wieder aufgewor-fen und diskutiert – Fragen, die im Übrigen auch nicht unerheblich für die GMHütte sind. Schließlich zählen die Automobilindustrie und deren Zulieferer zu den Hauptkun-den des Stahlwerks, dessen Stahl im Antriebsstrang von Fahrzeugen verbaut wird.
Aus diesem Grund informiert sich das Unternehmen nicht nur
in der Theorie regelmäßig über die neuesten Entwicklungen auf diesem Sektor. Immer mal wieder macht man auch den Praxistest. Bereits 2011 hatte man den Typ eWolf DELTA1 des Deutschen For-schungszentrums für Künstliche Intelligenz und 2012 den Opel Ampera – eines der ersten Serien-fahrzeuge überhaupt – getestet. Dieses Mal stand der BMW i3 auf dem Prüfstand.
Mitarbeiterinnen und Mit-arbeiter konnten jetzt im wahrs-ten Sinne des Wortes ihre eigenen Er„fahr“ungen sammeln, Fahrwei-se und Technik prüfen und eigene Schlussfolgerungen über Fahrweise und Tauglichkeit von Elektrofahr-zeugen ziehen.
Björn Schulze
q Das könnte Sie auch interessieren
Entwicklungshilfe macht Spaß lesen Sie auf den AzubiPages S. 1
SChmiEDEWErKE GröDiTz
Mit Eifer beim Ausprobieren: Im Rahmen der Projektwahlwoche fertigen die Schüler in der Ausbildungswerkstatt der Georgsmarien-hütte GmbH unter anderen einen Kugelschreiberständer mit blinkendem Logo. Foto: vl
Kurz noT iErT
Ausbildung hautnah. Unter dem Motto „Ausbildung hautnah“ geben die Auszubildenden der Georgsmarienhütte GmbH am Samstag, den 12. Juli 2014 einen Einblick in ihre Ausbildungsberufe. Von 10 bis 15 Uhr öffnet die Ausbildungswerkstatt des Stahlwerks an der Malberger Straße ihre Tore und Türen. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler, die sich über die Ausbildung beim Stahlwerk und die verschiedenen Berufe informieren möchten. Aber auch die Eltern sind selbstverständlich herzlich willkommen, wenn sie mehr erfahren möchten über mögliche Berufspers-pektiven ihrer Kinder.

glück auf · 1/2014 ......... 24
qualität & qualifikation
Worst Case Gmhütte · Stahlwerk geht in puncto Arbeitssicherheit auf Nummer Sicher: Schmelzerstiefel überstehen 1.550-Grad-Übergussversuch unbeschadet.
i nTErV iEW
Bekanntlich ist Vertrauen gut, Kontrolle aber besser. dies dach-te sich auch die Betriebsleitung des Stahlwerks und führte einen Übergussversuch an den Schmel-zerstiefeln durch, die dort getra-gen werden. Über das ergebnis berichten Ulrich Raßfeld (Stahl-werk) und carsten Große-Bör-ding von der Arbeitssicherheit im glückauf-interview:
glückauf: Erfüllen die Schmelzerstie-fel im Stahlwerk denn nicht die DIN-Normen, Herr Raßfeld?ulrich raßfeld: Natürlich erfüllen sie alle vorgegebenen DIN-Nor-men. Aber trotzdem: Gerade beim Arbeitsschutz wollen wir nichts dem Zufall überlassen. Deshalb hatten wir entschieden, diesen Übergussversuch durchzuführen. Wir wollten mit eigenen Augen se-hen, ob das Material der Stiefel der immensen Hitze standhält, wenn sie flüssigem Stahl ausgesetzt sind.
Carsten Große-Börding: Wir sind ja nicht in einer Kuchenbäckerei, sondern im Stahlwerk, wo man sich ernsthaft verletzen kann.
Worum ging es bei dem Übergussver-such?Große-Börding: Wir wollten ein-fach sehen: Was passiert im Worst Case? Was passiert, wenn sich ein Schwall Flüssigstahl über den Schuh ergießt? Brennt der Stiefel? Schlägt der Flüssigstahl durch? Brennt er ein Loch rein?
raßfeld: Also haben wir bei einer Versuchsanordnung mit einem Probenlöffel 1.550 Grad Celsius heißen Stahl über den Stiefelbe-reich zwischen Schaft und Fußrü-cken gegossen. Das ist eine beson-ders kritische Stelle.
Und das Ergebnis?raßfeld: Die begossenen Stiefelflä-chen fingen an zu brennen – aber das ist bei dieser Temperatur ganz normal. In dem Moment, in dem der Stahl vom Stiefel abgelaufen war, erlosch auch die Flamme wie-der und der Stiefel brannte nicht mehr weiter. Große-Börding: Da war nicht mal das kleinste Loch drin.
Das beruhigt sicher alle Beteiligten.Große-Börding: Unser Stahlwerks-personal und wir von der Arbeits-sicherheit waren natürlich von
dem Ergebnis begeistert. Ganz zu schweigen von Jürgen Vrankar, dem Geschäftsführer der ATLAS Schuhfabrik, die uns die Stiefel liefert. Der war auch beim Test da-bei. Die Kollegen wissen jetzt: Sie haben den bestmöglichen Schutz. Und wir von der Arbeitssicherheit wissen: Wir haben den richtigen Schuh gewählt.
Führen Sie des Öfteren solche Praxis-tests durch?raßfeld: Machen wir. Ob Schu-he, Helm, Silberware, Schutzbril-len: Wir wollen den Kollegen die beste Schutzausrüstung bieten. Deshalb beziehen wir sie oft in die Tests mit ein. Das Beste ist, was sich in der Praxis bewährt. Da kommt es auch nicht auf ein paar Euro an.
Vielen Dank für das Gespräch.
Beharrlichkeit zahlt sich ausShB · Erfolgreiche SCC-Zertifizierung
D ie Mitarbeiter der SHB Saal-felder Hebezeugbau hatten
sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie wollten in einem Audit nach-weisen, dass ihr Unternehmen die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen ent-sprechend der SCC-Checkliste (SCC**-Regelwerk 2011) erfüllt. Ein Jahr lang mussten sie sich intensiv darauf vorbereiten. Dann hat der TÜV Thüringen im Rahmen eines Verbundaudits – kombiniert mit einem QM-Rezertifizierungsaudit nach ISO 9001 – das Unterneh-men auf Herz und Nieren geprüft. Ende letzten Jahres konnte die SHB
ihr Zertifikat in Empfang nehmen. Es dokumentiert, dass die Mitarbei-ter die Anforderungen des SCC-Regelwerkes erfüllen und dass die geltenden Dokumente damit kon-form gehen. Bezogen ist es auf die drei Bereiche „Montage/Inbetrieb-nahme und Wartung von Kran- anlagen“, „Komponenten“ und „Parksysteme“. Die SHB-Kunden freut’s ebenfalls. Denn jetzt haben sie es quasi „amtlich“, dass die gut geschulten SHB-Mitarbeiter ihre Aufträge jederzeit motiviert, zuver-lässig und sicher abwickeln.
Kirsten Müller
Heißes Experiment: Der Stiefel hat zur Freude aller Beteiligten dem extremen Überguss-versuch standgehalten. Foto: Norbert Kölker
Erfahrungsaustausch mit Einsichten aus erster handmannstaedt · Experten für Arbeitssicherheit und Umwelt zu Gast
Erfahrungen auszutauschen ist wichtig. Aus diesem Grund tref-
fen sich sowohl Sicherheitsfach-kräfte als auch Umweltbeauftragte der GMH Gruppe regelmäßig in einem der Gruppenunternehmen – zuletzt für zwei Tage bei Mann- staedt. Um die Mittagszeit trafen als Erstes die Umweltbeauftragten ein, um gleich in Klausur zu gehen. Vorträge zu Themen wie IED-Aus-gangszustandsbericht, BVT-Merk-blätter, Umweltinspektion und Rechtskataster waren eine ideale Grundlage, um anschließend aktu-elle Informationen auszutauschen und zu diskutieren.
Am Abend kamen die Fachkräf-te für Arbeitssicherheit hinzu. Bei einer gemeinsamen Führung erkun-dete man das Industriemuseum in der Burg Wissen – und erlebte eine sehr anschauliche Reise durch die Vergangenheit der Stadt Troisdorf.
Der zweite Tag begann mit einer gemeinsamen Werksbesichtigung von Walzwerk und Logistikzent-rum. Während die Umweltbeauf-tragten danach die Heimreise an-traten, begann das Fachtreffen der Arbeitssicherheitsexperten.
In drei Fachvorträgen referier-ten Mannstaedt-Mitarbeiter über Sicherheitsaktivitäten ihres Unter-
nehmens. Schwerpunktthemen waren das Mannstaedt-Arbeits-sicherheitskonzept, das Gesund-heitsmanagement „Individueller Gesundheits-Check für Schicht-Mitarbeiter“ und das Logistikzen-trum-Konzept. Wie immer disku-tierten die Fachkräfte für Arbeits-sicherheit zum Abschluss aktuelle Themen und spezielle Unfälle, die sich in den Unternehmen ereignet haben. Um neue Erfahrungen und Einsichten bereichert, machten sich die Teilnehmer anschließend auf die zum Teil lange Heimreise.
Otto Stockhausen und Andrea Schlüter

glück auf · 1/2014 ......... 25
qualität & qualifikation
Dem Teamgeist auf der SpurStahl Judenburg · Gute Teamarbeit will erst einmal gelernt sein.
Geschäftsführung und Füh-rungskräfte der Stahl Juden-
burg trafen sich in Schladming zu einem Workshop, um sich mit „Teamentwicklung“ zu befassen. Moderiert wurde der Workshop von zwei Trainern, die das Unter-nehmen schon seit vielen Jahren begleiten: Helga Pesserer mit dem Schwerpunkt „Gesundes Führen“ und Thomas Humer mit dem Schwerpunkt „Team-Entwicklung und Outdoor-Training“.
Beide Schwerpunkte verspra-chen eine spannende Kombination und kamen während der zwei Ta-ge voll zum Tragen. Denn für die Teilnehmer ging es nicht nur dar-um, ihre eigene Situation zu ana-lysieren, Erfahrungen auszutau-schen und ihr Wissen zu erweitern.
Trotz herbstlich-nebeligem Wetter mussten sie auch immer wieder ins Freie.
Dort erwartete sie jeweils eine Übung, deren Verlauf danach im Warmen analysiert, diskutiert und ausgewertet wurde. Brauchbare Er-kenntnisse daraus flossen in mög-liche Maßnahmen ein.
Erstaunlich war der Praxisbezug der Übungen: Sie konnten nicht nur die betrieblichen Strukturen, sondern auch persönliche Verhal-tensmuster widerspiegeln.
Am Ende des Workshops dann die „Gretchenfrage“: „Welche Er-kenntnisse mit welchen Maßnah-men setzen wir bis wann um?“ Die Ergebnisse wurden in entsprechen-den Vereinbarungen schriftlich festgehalten.
Fazit der beiden Tage: Die Teil-nehmer konnten sich intensiv da-mit befassen, wie ihr Team arbei-tet. Dabei wurde ihnen klar, wo die Stärken ihres Teams liegen – aber auch, was man noch verbessern kann. Darüber hinaus stieg das Verständnis für Themen und Pro-bleme der Kollegen aus anderen Bereichen. Dazu beigetragen hat sicherlich auch, dass man sich am Abend über Persönliches austau-schen konnte. Die Stahl Judenburg will das Thema „Teamarbeit“ nach-haltig vertiefen. Deshalb ist für das Sommerhalbjahr 2014 ein weite-rer Trainingsblock geplant. Dann will man besprechen, welche Fort-schritte man gemacht hat – und was man weiter verbessern kann.
Klaus Seybold
„Eine wirklich gute idee!“mWL Brasil · Der diesjährige Sommer in Brasilien hatte es wirklich in sich! Wir hatten über 35 Grad Celsius am Tag. Und nachts kühlte es höchstens auf 27 Grad ab. Es war der heißeste und trockenste Som-mer seit Jahrzehnten. Die normalen, alltäglichen
Wärmegewitter blieben fast ganz aus. Wir alle litten unter der Hitze. Da kam mir
die Idee, uns frischen Wind zu verschaffen: Ich ersetzte die alten Fensteröffnungsstangen in der Werkstatt durch ein
neues Hebelsystem, das ich selbst ent-wickelt und ge-fertigt habe. Es ist wesentlich einfa-cher zu bedienen und sicherer als das alte. Unser Ge-
schäftsführer Herr Geissler belohnte mich dafür mit einem Ein-kaufsgutschein und ermutigte die Kollegen, ebenfalls Ideen für Ergonomie, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu entwickeln.
Legaler LauschangriffGeissler · Wer Druckluft-Leckagen entdecken will, braucht feine Ohren.
Jeden Freitag startet bei der Fir-ma Heinrich Geissler in Witten
der große Lauschangriff. Ausgerüs-tet mit einem Ultraschall-Suchge-rät und Kopfhörern, streifen zwei Auszubildende mit gespitzten Oh-ren durch den Betrieb. Denn sie sind bislang unentdeckten Druck-luft-Leckagen auf der Spur.
Heinrich Geissler ist ein Tradi-tionsunternehmen der Stahlindus-trie. Seit 1903 wird am Wittener Standort Stahl bearbeitet. Man setzt dabei erhebliche Mengen Druckluft ein. Umso wichtiger ist daher, dass die komprimierte Luft als Energieträger auch dort bleibt, wo sie hingehört – in den Anlagen. Denn Leckagen können erhebliche Kosten verursachen.
„Aus meinen bisherigen Arbeits-gebieten ist mir bekannt, wie viel Geld einem Betrieb verloren geht, wenn Druckluft-Leckagen nicht entdeckt und beseitigt werden“, sagt Jean Frédéric Castagnet, tech-nischer Leiter seit 2010. Dem Tech-niker mit umfangreichen Bran-
chenkenntnissen ist bewusst, dass die allermeisten Unternehmen viel auf Energieeinsparung achten – die Druckluft dabei häufig vernachläs-sigen. Aber nicht nur er weiß, dass gerade hier viel Energie im wahrs-ten Sinne des Wortes „verpfeift“.
„Im Lärm des laufenden Be-triebs“, erklärt Waldemar Donis, „nehmen die Mitarbeiter die Pfeif-geräusche, die Druckluft-Lecka-gen erzeugen, gar nicht wahr.“ Der 22-Jährige absolviert gerade bei Geissler sein zweites Ausbil-dungsjahr und bildet mit Tomacz Depta (19) das Abhörteam. Ausge-rüstet mit extra angeschafften Ul-traschall-Detektoren, erkunden sie wöchentlich Betrieb und Versand.
„Wir finden in sämtlichen An-lagen undichte Stellen. Oft sind es veraltete Kupplungen oder Venti-le, ausgeleierte Riegel oder Gewin-de“, erklärt Depta. Alles, was pfeift, wird säuberlich notiert und per Foto dokumentiert. Somit weiß die Instandhaltung, an welchen Stel-len genau sie tätig werden muss.
Jean Frédéric Castagnet erkennt in der „Abhörtätigkeit“ seines Nachwuchses vielerlei Vorteile: „Wir sparen bares Geld und die Auszubildenden lernen jede Ecke und jeden Winkel des Betriebs ken-nen. Zudem hören Jugendliche die extrem hohen Töne, die bei Druck-luft-Leckagen entstehen, weitaus besser als ältere Mitarbeiter.“ Nicht zu vergessen der Spaß, den der Rundgang den beiden macht.
Übrigens: Heinrich Geissler nimmt derzeit am ÖKOPROFIT-Projekt im Ennepe-Kreis teil – und dies, obwohl man bereits erfolg-reich nach der Umweltmanage-ment-Norm 14001 zertifiziert ist. Dass sich dieses Engagement für das Unternehmen dennoch lohnt, liegt für Castagnet auf der Hand: „Wir suchen den Erfahrungsaus-tausch und nach Einsparpotenzia-len – also nach konkreten Hinwei-sen, auf die man selber noch nicht gekommen ist.“
Britta Worms
Pfeifft da was? Die Azubis Waldemar Donis (mit Kopfhörer) und Tomasz Depta auf der Suche nach Leckagen. Werksfoto
mission possiblemWL Brasil · Flächendeckend sollen Lean Management und 6S eingeführt werden.
eliane Rosa Silva ist die neue As-sistentin von Frank W. Geissler, Geschäftsführer der MWL Brasil. Sie trat Mitte Januar ihre Arbeit an – rechtzeitig, um die imple-mentierung des Lean Manage-ment und 6S-Systems mit zu be-gleiten. Hier ihr Bericht über den Stand der dinge:
Angefangen haben wir mit der Ein-führung von 6S an der Linsinger Knüppel-Kreissäge. Dort wurden die Mitarbeiter mit 6S vertraut ge-macht und in Visuellem Manage-ment trainiert. Wir wollten sie mo-tivieren, „ihr Haus“ aufzuräumen, mit neuen Ideen ihren Arbeitsall-tag zu verbessern und potenzielle Unfallrisiken zu beseitigen.
Mitte Februar folgte dann die „Wegwerf-Aktion“. Dabei räum-ten die Mitarbeiter alle unnötigen Gegenstände aus ihrem Arbeits-
umfeld, reinigten den Fußboden und verpassten ihm nebst Schrän-ken und Geräten einen neuen An-strich. Jetzt war ihr Arbeitsbereich für den nächsten Schritt vorberei-tet: die Umsetzung von TPM (To-tal Productive Maintenance). Denn das ist das übergeordnete Ziel: die Einführung des Toyota Produkti-onssystems in der gesamten Fabrik.
Folgerichtig wurde auch die Stahlwerksmannschaft in 6S und Visuellem Management trainiert. Für sie stand die „Wegwerf-Aktion“ im Stahlwerk auf dem Programm. Hier wurden ebenfalls für den Pro-zess unnötige Gegenstände ent-fernt, sauber gemacht, die Arbeiten neu organisiert und standardisiert. Damit die Prozessverbesserungen effizient und nachhaltig sind, hat Frank W. Geissler persönlich mit seinen Managern die Bereiche au-ditiert.
Doch das ist noch nicht alles. Wir haben bereits Arbeitsgruppen gestartet, um Setup-Verbesserun-gen in der mechanischen Bearbei-tung von Rädern zu erzielen. Und wir beginnen eine Studie über die Optimierung des Arbeitsflusses in der Achsenherstellung.
Für Verbesserungen ist nicht ei-ne einzelne Person verantwortlich, sondern wir alle. Wir werden agi-ler, wenn wir den Mitarbeitern zu-hören und jeden Einzelnen in sei-nem jeweiligen Arbeitsbereich mit einbeziehen, um gemeinsam Ver-besserungen zu erzielen. Der Fokus sollte sein, sich stärker darauf zu konzentrieren, den Kunden besser und schneller zu beliefern und si-cherer und ohne Verschwendung zu produzieren.
„Für mich ist Lean Management kein Ereignis, sondern ein Prozess, der Teil der Unternehmenskultur sein sollte – und der durch die Menschen und mit ihnen umgesetzt werden soll.“
E L I A N E R O S A S I LVA
hätten Sie’s gewusst?
Von 5S zu 6SJapanisches Konzept. Will Arbeits-plätze inkl. Umfeld sicher, sauber und übersichtlich gestalten. Steht für fünf Regeln, die im Japanischen alle mit „S“ begin-nen. Im Deutschen: 5A-Methode für Aussortieren, Aufräumen (Arbeitsmittel ergonomisch anordnen), Arbeitsplatz sauber halten, Anordnung zur Regel machen und Alle Punkte einhal-ten und verbessern. MWL ergänzt „Arbeitssicherheit beachten“.
Lean managementMitarbeiter werden in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich bestärkt, Verbesserungsvorschläge ein-zubringen und umzusetzen. Im Fokus stehen Arbeitssicherheit, kürzere Set-up-Zeiten beim Werk-zeug- und Werkstückwechsel, kontinuierlicher Arbeitsfluss, zel-luläre Fertigung, organisierte und saubere Prozesse, Total Productive Maintenance, Value Stream Map-ping und Visuelles Management.
SteckbriefnAmE: Jobair Rodrigue
ALTEr: 56 Jahre
ArBEiTSPLATz: Werkzeugherstellung
FAmiLiE: verheiratet, zwei Kinder
hoBBy: Reisen

glück auf · 1/2014 ......... 26
qualität & qualifikation
„Bitte arbeitet vorsichtiger!“ Gmhütte · Ein Unfall, bei dem er schwer am Fuß verletzt wurde, hat Dirk Ballmann für das Thema Arbeitssicherheit besonders sensibilisiert. Jetzt ist er neuer Sicherheitsbeauftragter im Finalbetrieb.
i nTErV iEW
Sicherheitsbeauftragte müs-sen besonders motiviert sein. Schließlich übernehmen sie diese Aufgabe freiwillig – und bürden sich damit jede Menge Arbeit auf. Weshalb dirk Ball-mann diesen Job seit Kurzem im Finalbetrieb übernommen hat, haben Vera Loose und Markus Beckmann (Arbeitssicherheit) im glückauf-interview herausgefun-den.
glückauf: Sie sind der neue Sicher-heitsbeauftragte der GMHütte. Wo sind Sie beschäftigt, Herr Ballmann?Dirk Ballmann: Im Finalbetrieb, und zwar seit 2011. Vorher war ich Mitarbeiter von WBO und in Arbeitnehmerüberlassung an die GMHütte ausgeliehen. Dort be-kam ich das Angebot für eine Fest-anstellung und hatte am 1. April 2011 meinen ersten Arbeitstag auf der Hütte. Ich hatte mich wahnsin-nig gefreut, endlich einen festen Arbeitsvertrag in der Tasche zu ha-ben, und ging voller Euphorie an meine Arbeit.
Aber Ihre Freude hat tragischerweise nicht lange angehalten?Ballmann: Ich war in der Verla-dung Halle 12 als Transporteur ein-gesetzt – und da ist es passiert. Wir waren gerade dabei, auf dem Trans-portwaggon abgelegte Doppel-bunde zu vereinzeln. Dabei brach ein Unterlagenholz und ein Bund rutschte ab. Ich wurde vom Bund getroffen, stürzte und verletzte mich schwer am Fußgelenk.
Wie hat dieser Unfall ihr Leben ver-ändert?Ballmann: Mein Fuß ist trotz meh-rerer Operationen nur noch ein-geschränkt beweglich. Ein Einsatz
in der Verladung ging leider nicht mehr. Zum Glück bekam ich die Chance, in der Gütesicherung im Finalbetrieb zu arbeiten.
Wie sind Sie Sicherheitsbeauftragter geworden?Ballmann: Das war im Herbst ver-gangenen Jahres. Bei einem der re-gelmäßigen Viertelstundengesprä-che wurde uns der Film „Freunde“ gezeigt. Er weist auf Fehlverhalten und Arbeitssicherheitsaspekte im Betrieb hin. Dieser Film hat mich emotional sehr stark berührt, weil er mein furchtbares Erlebnis wider-
spiegelt. Dann wurde für unsere Schicht ein neuer Sicherheitsbeauf-tragter gesucht. Spontan bot ich mich für den Posten an.
Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als Sicher-heitsbeauftragter?Ballmann: Ich möchte Ansprech-partner und Bindeglied für Kolle-gen und Betriebsleitung sein, und ich will meine Erfahrungen an die Kollegen weitergeben und dadurch Sicherheit vermitteln. Deshalb wei-se ich die Kollegen auf Gefahren hin, wenn sie sich falsch verhal-ten, unvorsichtig arbeiten, keine
Schutzbrille tragen oder sonst wie nachlässig sind. Zudem nehme ich an Sicherheitsveranstaltungen und Begehungen teil.
Weshalb haben Sie diese zusätzliche Aufgabe angenommen?Ballmann: Nach meinem Unfall se-he ich jetzt viel mehr die Unfall-gefahren. Davor will ich die Kol-legen schützen. Sicheres Arbeiten liegt mir einfach am Herzen. Ein unachtsamer Moment – und schon kann sich das gesamte Leben ver-ändern, auch das private. Ich glau-be, viele sind sich dessen gar nicht
recht bewusst. zudem kann ich da-bei meine Erlebnisse aufarbeiten.
Was ist Ihr Ziel?Ballmann: Ganz einfach: keine Unfälle. Es wird viel bei uns im Finalbetrieb dafür getan: regelmä-ßige Unterweisungen, monatliche Viertelstundengespräche, Aushän-ge, Begehungen und vieles mehr. Trotzdem: Es bleibt der Faktor „Mensch“. Einfache Arbeiten und Routine verführen zur Nachlässig-keit, sind Quelle vieler Unfälle. Die Gedanken „Mir passiert schon nichts. Ich habe ja Erfahrung. Das habe ich schon oft so gemacht.“ müssen aus unseren Köpfen.
Gehen die Kollegen auf Ihre Hinweise und Verbesserungsvorschläge ein?Ballmann: Manche machen es mir nicht leicht, aber die meisten neh-men meinen Rat an.
Wie unterstützt Sie Ihr Betrieb dabei?Ballmann: Die Kooperation mit dem Meister ist super. Ich finde immer ein offenes Ohr. Und die Betriebsleitung stellt die Sicher-heitsbeauftragten für Infoveran-staltungen, Begehungen und Si-cherheitsausschusssitzungen frei. Bald habe ich meinen ersten Lehr-gang „Sicherheitsbeauftragter Teil 1“. Darauf freue ich mich schon. Ich bin offen für neue Anregungen und den Gedankenaustausch mit Kollegen anderer Firmen.
Was ist Ihr Wunsch an die Kollegen?Ballmann: Dass sie meine Ratschlä-ge ernst nehmen und dass sie mehr Respekt entwickeln vor den überall und täglich lauernden Gefahren. Bitte arbeitet vorsichtiger!
Haben Sie noch einen Gedanken, den Sie loswerden möchten?Ballmann: Die Kollegen sollten mehr verinnerlichen: „Arbeits-sicherheit geht vor Produktion. Nichts ist es wert, sich zu verlet-zen!“ Zwei Minuten für die Sicher-heit sind immer drin – ohne dass die Produktivität leidet. Das bewei-sen die Kennzahlen der letzten Jah-re deutlich. Und eigenes Verhalten ändern kostet ebenfalls kein Geld!
Vielen Dank für das Gespräch.
Gut gefragt ist halb gewonnenGmhütte · Ausbildungsbeauftragte werden künftig an Halbzeitgesprächen teilnehmen. Ein Beurteilungsbogen hilft dabei, das Gespräch auszuwerten.
regelmäßig treffen sich die kaufmännischen und gewerb-
lich-technischen Ausbildungs-beauftragten der GMHütte zum Informationsaustausch. Das erste Treffen in diesem Jahr stand ganz im Zeichen einiger Neuregelungen im Ausbildungsablauf. Doch bevor es im Landhotel Buller in Hagen zur Sache ging, wies GMHütte-Arbeitsdirektor Felix Osterhei-der auf die Bedeutung der Aus-bildung für das Stahlwerk hin – und wie wichtig die Rolle der Ausbildungsbeauftragten sei.
Danach stellten Ausbildungs-leiter Christian Bloom und Be-triebsrat Ralf Peistrup kurz vor, welche Neuerungen im Ausbil-dungsablauf man gemeinsam erarbeitet hatte: Zukünftig gibt es mit den Azubis ein intensives Halbzeitgespräch, an dem auch die Ausbildungsbeauftragten teil-
nehmen. Das Gespräch wird mit-hilfe eines Beurteilungsbogens aus-gewertet, der neu gefasst und ver-einfacht wurde.
Doch ein Beurteilungsgespräch ist keine leichte Sache. Deshalb konnten die Ausbildungsbeauf-tragten den restlichen Tag über
mit dem neuen Beurteilungsbogen intensiv üben – aufgeteilt in drei Gruppen. Professionell angeleitet wurden sie von einem Dozenten-team des BNW (Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH), das je-de Menge zusätzlicher Infos und Tipps zu bieten hatte.
Die Fragen der Teilnehmer kreis-ten vor allem um Gegenstand, In-halt und Schwierigkeiten der Be-urteilung. Wie bereitet man sich inhaltlich und organisatorisch auf ein (Beurteilungs-)Gespräch vor? Aus welchen wesentlichen Be-standteilen setzt sich eine kons-truktive Gesprächsführung zu-sammen? Wie hört man aktiv zu? Welche Fragetechniken gibt es? Wie geht man mit Konflikten um? – Fragen, bei denen man auch das Spannungsfeld zwischen Tagesge-schäft und Aufgaben des Ausbil-dungsbeauftragten streifte.
Nach einem gemeinsamen Mit-tagessen stand der zweite Teil des Workshops an. Man befasste sich u. a. mit situativen und themati-schen Fallbeispielen im allgemei-nen Umfeld und wie man den Be-urteilungsbogen konkret einsetzt.
Elisabeth Husemann
Der neue Sicherheitsbeauftragte Dirk Ballmann bei der Arbeit – natürlich in seiner persönlichen Schutzausrüstung. Foto: vl
„Mir passiert schon nichts, ich habe ja Erfahrung – solche Gedanken müssen aus unseren Köpfen.“
15 kaufmännische und 28 gewerblich-technische Ausbildungsbeauftragte Foto: vl
„Ein positiver Aspekt des Treffens war auch der freie Austausch mit den Kollegen.“
E L I S A B E T H H U S E M A N N , Ausbildungsbeauftragte

glück auf · 1/2014 ......... 27
qualität & qualifikation
4 unter einem Dach Pleissner Guss · Neues Managementsystem
D ie Zertifizierungsgeschichte von Pleissner Guss ähnelt der
vieler Unternehmen: Vor vielen Jahren hatte man mit dem Quali-tätsmanagement nach ISO 9001 begonnen und nach und nach weitere Bereiche zertifiziert – in diesem Fall das Umweltmanage-mentsystem nach ISO 14001, die Schweißtechnischen Qualitätsan-forderungen nach ISO 3834 und schließlich das Energiemanage-ment nach ISO 50001.
Spätestens hier war der Punkt erreicht, sich von den vier meist nebeneinander arbeitenden Syste-men zu verabschieden. Sinnvoller war, alle Systeme in einem schlan-ken Integrierten Managementsys-tem zusammenzuführen – um zu-künftig effizienter zu arbeiten.
Im Herbst 2013 fiel bei Pleissner Guss der Startschuss. Dazu muss-ten nicht nur alle Prozesse auf den Prüfstand. Auch die Art der Dar-stellung erforderte eine Frischzel-lenkur. Nach der Definition der Prozessbereiche begann man, die Kernprozesse neu zu beschreiben und in einem grafischen System darzustellen: als Flussdiagramm.
Dieses Diagramm hat viele Vor-teile: Statt lange Texte zu lesen, können die Mitarbeiter die Pro-zessabfolge mit wenigen Blicken optisch erfassen – und Verflech-tungen innerhalb der Prozesse leichter erkennen. Hinzu kommt: Üblicherweise sind Prozesse abtei-lungsübergreifend. Kommunizie-ren die entsprechenden Abteilun-
gen zu wenig miteinander, kommt es zu Informationsverlusten oder gestörten Abläufen. Hier zeigt das Diagramm neuen Mitarbeitern oder solchen mit neuen Aufgaben, wo die Schnittstellen liegen.
Pleissner Guss hat inzwischen die Kernprozesse fast vollständig erfasst, beschrieben und darge-stellt. Derzeit arbeitet man an der Beschreibung der Unterstützungs-prozesse. Nach Abschluss der Pro-zessbeschreibungen will man im Frühjahr mit dem Training der Mitarbeiter beginnen. Schließlich soll auch die Belegschaft das neue System zu 100 Prozent akzeptieren. Moderiert wird dieses Vorhaben von Maike Süthoff von der goING GmbH & Co. KG, Aachen.
Das neue ganzheitliche Manage-mentsystem soll sich beim nächs-ten ISO-Überwachungsaudit im November erstmals bewähren.
li
hätten Sie’s gewusst?
imSDas Integrierte Managementsys-tem fasst Methoden und Instru-mente zur Einhaltung von Normen und Rechtsvorschriften aus ver-schiedenen Bereichen in einer ein-heitlichen Struktur zusammen. Zu diesen Bereichen zählen u. a. Qua-lität, Umwelt- und Arbeitsschutz, Energie und Sicherheit.
Alles wegen guter FührungGmhütte · Lernprozessbegleiter helfen Azubis, richtigen Weg zu finden.
neun Ausbilder der GMHütte, der KME Germany und der
Stadtwerke Osnabrück haben ihre Ausbildung zum „Lernprozess-begleiter“ abgeschlossen. Ein ent-sprechendes IHK-Zertifikat wur-de ihnen nun in den Räumen der
KME Academy überreicht. Was es mit den Lernprozessbegleitern auf sich hat, erläuterte dabei Christian Bloom, Leiter der Aus- und Wei-terbildung der GMHütte: „Früher gaben die Ausbilder den Azubis den Weg vor. Heute, als Lernpro-
zessbegleiter, helfen sie den jungen Leuten, selbst ihren richtigen Weg zu finden.“ Lars Schönball, Aus-bildungsleiter bei KME Germany, erklärte, was sich für die Ausbilder zudem verändert hat: „Die Ausbil-der müssen heute viel mehr als frü-
her auch als Ansprechpartner bei Fragen außerhalb der eigentlichen Berufsausbildung zur Verfügung stehen. Auch darauf sind sie als Lernbegleiter besser vorbereitet.“
Dementsprechend lernen die Ausbilder in den mehrtägigen Se-minarblöcken unter anderem, wie sie Lernprozesse bei Jugendlichen anstoßen und begleiten können – aber auch, wie sie die dabei er-brachten Lernleistungen der Azu-bis bewerten können.
Florian Pörtner, Ausbilder bei der GMHütte, ist einer der neun
frischgebackenen Lernprozessbe-gleiter. Wie bewertet er seine neue Rolle und was hat ihm die Ausbil-dung gebracht?
„Ich habe das Gefühl, nun viel besser auf neue Situationen reagie-ren zu können.“ Und die Azubis würden das neue Rollenverständ-nis ihrer Ausbilder nicht nur wahr-nehmen, sondern inzwischen auch akzeptieren: „Sie vertrauen sich uns nun öfters bei familiären Pro-blemen an.“
Was das Lernen angeht – und darum geht es letztlich –, sind die ersten Erfahrungen für Pörtner ebenfalls sehr vielversprechend: „Beim Lernen sind die Azubis viel motivierter, wenn sie nicht alles vorgegeben bekommen und auch mal länger an einer Aufgabe tüf-teln. Ich begleite sie dabei und merke, wie viel besser das Erlernte dann auch gespeichert bleibt.“
mw
Verantwortliche und Lernprozessbegleiter der drei „ProAusbildung“-Partner GMHütte, KME Germany und Stadtwerke Osnabrück
Foto: Oliver Pracht
ProAusbildungDas Projekt „Lernbegleiter“ ist Teil der Initiative „ProAusbil-dung“, das auf die Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchs-kräfte setzt. Daran beteiligt sind neben der GMHütte auch KME Germany und die Stadtwerke Osnabrück. Informationen zu den aktuellen Projekten der Initiative können Sie unter www.pro-ausbildung.info abrufen.
unfalltrend zeigt abwärtsmannstaedt · Neues Arbeitssicherheitskonzept zeigt erste Erfolge.
i nTErV iEW
Arbeitssicherheit hat einen ho-hen Stellenwert bei Mannstaedt. Umso mehr ehrgeiz legte man an den tag, als vor drei Jah-ren die Zahl der Arbeitsunfälle stieg: Man entwickelte ein neues Arbeitssicherheitskonzept. Wie es aussieht und was es gebracht hat, erläutert thomas Voß (Be-reichsleiter instandhaltung, Wei-terverarbeitung, Zerspanungs-zentrum) im glückauf-interview:
glückauf: Weshalb ein neues Arbeits-sicherheitskonzept, Herr Voß?Thomas Voß: Weil sich unsere Un-fallzahlen in den Jahren 2010 bis 2012 negativ entwickelt hatten. Daraufhin haben wir zwar erheb-liche Anstrengungen unternom-men, um die Situation zu verbes-sern. Aber unsere Analysen zeigten: Technische Maßnahmen oder eine verstärkte Schulung allein schaffen keine Abhilfe. Erfolg versprechen-der war, das Sicherheitsbewusst-sein der Belegschaft zu steigern.
Wie haben Sie das geschafft?Voß: Wir haben Anfang 2013 ein neues Sicherheitskonzept erarbei-tet und im Mai verabschiedet. Mit im Boot bei der Entwicklung waren – neben externer Unterstützung – alle betrieblichen Führungskräfte, die Sicherheitsbeauftragten und der Betriebsrat. Das Konzept be-nannte drei Hauptziele, die wir
erreichen wollten: die Arbeitssi-cherheit stärker als Führungsauf-gabe zu verankern, die Sicherheits-kommunikation zu verbessern und
die intensivere Beteiligung aller Mitarbeiter – was auf ganz unter-schiedlichen Ebenen geschieht und sicherlich Zeit braucht.
Haben Sie auch kurzfristige Instru-mente entwickelt?Voß: Haben wir. Da sind beispiels-weise die gemeinsam erarbeiteten Sicherheitsgrundsätze oder auch effektive Methoden zur Wahrneh-mung und Analyse von Gefähr-dungen. Dazu zählen zum Beispiel das Kurzgespräch, die Ereignisana-lyse oder auch das System „Bruders Hüter“. Mit der Umsetzung dieser Werkzeuge haben wir umgehend in allen Betrieben begonnen.
Jetzt mal „Butter bei die Fische“: Was hat das neue Sicherheitskonzept kon-kret gebracht? Voß: Der Rückblick auf 2013 zeigt, dass erste Verbesserungen erreicht wurden. So konnten wir die Ge-samtzahl der Unfälle um 10 Pro-zent, die Anzahl der schweren Un-fälle sogar um 75 Prozent verrin-gern.
Können Sie damit zufrieden sein?Voß: Das ist sicher ein erster Erfolg. Aber wenn wir unsere Unfallzahlen langfristig und nachhaltig senken wollen, müssen wir weiter daran arbeiten, unsere Sicherheitskultur zu verbessern. Mannstaedt versteht eben Arbeitssicherheit eher als Ma-rathon – und nicht nur als Sprint!
Vielen Dank für das Gespräch.
hätten Sie’s gewusst?
Bruders hüterEin Vorgesetzter macht abwech-selnd einen Mitarbeiter zum „Bru-ders Hüter“. Der spricht bei einem Rundgang seine Kollegen auf Arbeitssicherheitsfragen an. Das Ergebnis teilt er dem Vorgesetzten mit, der ggf. Verbesserungen ein-leitet. Ziel ist eine offene Arbeits-sicherheitskultur, in der alle auf sich gegenseitig aufpassen, „ohne anklagenden Ton“ Arbeitssicher-heit miteinander diskutieren, die dadurch wie selbstverständlich zum Tagesgeschäft gehört.
Thomas Voß Foto: Monika Hansen

glück auf · 1/2014 ......... 28
menschen & kontakte
Ein Praktikum in GermanyWalter hundhausen · Von Milton Keynes nach Schwerte an der Ruhr
Ende Januar absolvierte die 18-jährige Jaqueline Prempeh
von der Denbigh School in Mil-ton Keynes (Großbritannien) – der Partnerstadt von Schwerte an der Ruhr – ein fünftägiges Praktikum in der Personalabteilung von Wal-ter Hundhausen.
Hintergrund: Denbigh School und Gesamtschule Schwerte tau-schen seit 22 Jahren regelmäßig Schüler und Praktikanten aus. Das Besondere an dem Austausch: Die Jugendlichen beider Nationen ha-ben nicht nur die Möglichkeit, ihre
Fremdsprachenkenntnisse vor Ort zu erproben und Land und Leute kennenzulernen. Sie können auch jeweils Einblicke in die Arbeitswelt des anderen Landes werfen. Eines dieser Unternehmen in Deutsch-land ist die Gießerei Walter Hund-hausen, die seit Jahren recht er-folgreich mit der Gesamtschule Schwerte kooperiert.
Treibende Kraft und Organisato-rin auf englischer Seite ist die eng-lische Lehrerin Judith Heinemann, die seit über 20 Jahren mit einem deutschen Ingenieur aus Schwer-
te verheiratet ist. Sie fördert die Schulkooperation maßgeblich und organisiert die Unterbringung in den Gastfamilien gemeinsam mit ihren deutschen KollegInnen.
Jaqueline Prempeh wurde als Tochter ihrer aus Ghana stam-menden Eltern in Deutschland ge-boren, wo sie bis zu ihrem 13. Le-bensjahr auch lebte und zur Schule ging. Deshalb spricht sie perfekt deutsch. Inzwischen fühlt sie sich in Großbritannien zu Hause. Ein-ziger Wermutstropfen: Die Süßig-keiten in Deutschland schmecken ihr besser als die englischen.
Dank ihrer Deutschkenntnisse konnte sie ihr Praktikum im „Per-sonalwesen“ voll auskosten. Doch eigentlich schlägt ihr Herz für die „Welt der Zahlen“. Mit einem Sti-pendium der internationalen Wirt-schaftsprüfungsgesellschaft Delo-itte möchte sie Statistik und Wirt-schaftswissenschaften studieren. Mit einer „1“ in Mathematik – oder „A“, wie die Engländer sagen – ste-hen die Chancen dafür recht gut.
Jaqueline nahm übrigens auch an einer Verhandlung des Lan-desarbeitsgerichtes in Hamm teil. Dabei konnte sie feststellen, dass die Richter dort – im Gegensatz zu ihren englischen Kollegen – keine weißen Perücken tragen.
nh
StaffelwechselKranbau Köthen · Gewöhnlich verbindet man mit Freitag, dem 13. weniger freudige Ereignisse. Doch für Ausbilder Karl-Heinz Lucht kenn-zeichnete dieses Datum seinen letzten Arbeitstag und war so gesehen ein Tag der Freude – auch wenn er mit einem weinenden Auge in die Ruhe-phase der Altersteilzeit geht. Er verabschiedete sich mit der Überzeugung, dass bei seinem Nachfolger Detlef Zwicker die Ausbildung bei Kranbau Köthen in besten Händen ist. Zukünftig will Karl-Heinz Lucht alle die Interessen pflegen, die in der Hast des Alltags bislang zu kurz kamen.
Hendrik Siemionek
Biken im SalzkammergutStahl Judenburg · Alljährlicher Radausflug führte ins Salzbergwerk.
Der Weg ist das Ziel – unter diesem Motto stiegen bereits
zum 9. Mal Mitarbeiter der Stahl Judenburg auf ihr Mountainbike, um einen zweitägigen Ausflug der sportlichen Art zu verbringen. Ziel war Bad Aussee, eine wunderschö-ne Gegend im steirischen Salz-kammergut. Perfekt organisiert hatte den Ausflug der Arbeiterbe-triebsrat.
Damit auch wirklich jeder mit-radeln konnte, standen zwei Tou-ren zur Wahl: eine flache entlang der Flüsse und Seeufer und eine hügelige quer durch die Bergland-
schaft, bei der man schon kräftig in die Pedale treten musste.
Abends trafen sich beide Grup-pen zu einem gemütlichen Zu-sammensein. Dabei konnte man bei Speis und Trank die abge-strampelten Kalorien nachtanken und ausführlich über die zurück-gelegten Kilometer diskutieren.
Am nächsten Tag war nach einem kräftigen Frühstück Kul-tur angesagt. Man beschloss, das Salzbergwerk im nahegelegenen Altaussee zu besuchen. In den Museumsräumen erwarteten die Besucher Mineralien, Werkzeuge,
Fertigprodukte und ein Drahtmo-dell des Stollensystems.
Über eine Rutsche ging es dann bergab zum beleuchteten Salzsee mit Bühne, auf der regelmäßig Theateraufführungen, Konzerte und Lesungen stattfinden. Nach einer aufschlussreichen Stol-lenführung radelte man zurück Richtung Judenburg. Nun bleibt gespannt abzuwarten, welches besondere Ausflugsziel sich der Arbeiterbetriebsrat für das zehn-jährige Radler-Jubiläum im nächs-ten Jahr einfallen lässt.
René Stranimaier
GröDiTzEr WErKzEuGSTAhL BurG
Belegte Auslandserfahrung: Stolz nimmt Jaqueline Prempeh aus Milton Keynes ihr „Praktikumszeugnis“ von Personalleiter Norbert Hemsing entgegen. Werksfoto
Guter Dinge: die Radgruppe beim Start kurz vor Bad Aussee. Foto: Traugott Hofer
Foto: Ingo Freihorst
Wiederaufbauhilfe. Im Juni 2013, knapp elf Jahre nach der „Jahrhun-
dertflut“, suchte ein ähnlich großes Hochwasser die Anwohner der Elbe heim – und verursachte erneut großes persönliches Leid und hohe finan-zielle Schäden. War 2002 vor allem Sachsen betroffen, traf es 2013 auch Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen-An-halt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Neben der Elbe traten zudem zahlreiche weitere Flüsse über ihre Ufer, sodass in 55 deutschen Landkrei-sen Katastrophenalarm ausgerufen werden musste. Traurige Berühmtheit erlangte die sächsisch-anhaltinische Gemeinde Wust-Fischbeck. Sie wurde nach einem Deichbruch für mehrere Tage fast vollständig überflutet. Da die Gemeinde nur etwa 45 km von Burg entfernt liegt, dem Standort der Gröditzer Werkzeugstahl Burg (GWB), beschloss deren Geschäftsführung, die Gemeinde beim Wiederaufbau zu unterstützen. GWB hatte für einen Mitarbeiter, den sie für Hilfsarbeiten im Überschwemmungsgebiet frei-gestellt hatte, einen Verdienstausfall erhalten. Das Unternehmen vervier-fachte den Betrag auf 1.000 Euro und spendete ihn der Gemeinde. Der Fischbecker Bürgermeister Bodo Ladwig (rechts) freute sich sehr, als ihm GWB-Werksleiter Jens Hammecke den Scheck überreichte.
Jens Hammecke

glück auf · 1/2014 ......... 29
menschen & kontakte
Wer den Cent nicht ehrt …Gmhütte · Nur die Menge zählt: Eine Rest-Cent-Aktion bringt zweimal 8.888,88 Euro für die Kinderhilfsorganisation terre des hommes.
Dass Kleinvieh auch Mist macht, ist landläufig bekannt. Dass bei
kleinen Spenden vieler Unterstüt-zer besonders viel herauskommen kann, durfte jetzt Stephan Stolze erleben, Leiter des Spendenreferats bei terre des hommes. Ihn über-raschte die GMHütte mit einem Scheck über 17.778 Euro, der durch eine Rest-Cent-Aktion zusammen-gekommen war.
„Rund 580 Kolleginnen und Kollegen beteiligen sich derzeit an der Aktion, die bereits seit 2005
läuft“, erklärt Rainer Witt von der Personalabrechnung der GMHütte. „Jeder spendet von seinem monat-lichen Gehalt 49 Cent – einen Be-trag, der keinem wehtut. Aber gera-de mit diesen zahlreichen kleinen Beträgen kommt unheimlich viel für die gute Sache zusammen.“
Und so haben sich seit 2011, dem Zeitpunkt der letzten Scheck-übergabe, insgesamt 8.888,88 Euro angesammelt. Die GMH Holding hat den Betrag dann auf 17.777,76 Euro verdoppelt.
„Das ist eine enorme Summe, die viel Gutes bewirken wird“,
freut sich Stephan Stolze von terre des hommes. Ein herzlicher Dank gehe deshalb an die Belegschaft und das Unternehmen – auch für die jahrelange Partnerschaft mit der Hilfsorganisation. Stolze: „Es ist keine gewöhnli-che Aktion und auch kein gewöhnliches Ergebnis.“
Verwendet wird das Geld nun in Projekten gegen Kinderarbeit und Kinderarmut in In-dien. Dort werden Tau-sende Kinder ausgebeutet, indem sie in Eisenerzminen arbei-ten müssen. Die Helfer von terre des hommes sprechen mit deren Eltern, holen die Kinder aus den
Eisenerzminen und bieten ihnen einen Platz in einer Zeltschule. Dort bekommen sie auch Essen und medizinische Betreuung. „Mit einem Betrag von 60 Euro“, so Stephan Stolze, „können wir den
Schulbesuch eines Kindes ein Jahr lang finanzieren und
ihm den Weg in eine bes-sere Zukunft ebnen.“
Dass die GMH Hol-ding das Engagement des Stahlwerks ebenfalls ger-
ne unterstützt, betont Per-sonalleiter Bernhard Lütt-
mann: „Wir freuen uns, dass sich die Kolleginnen und Kollegen bereits über Jahre engagieren, und leisten gerne ebenfalls unseren Beitrag dazu.“
mw
„Bildung ist einer der wichtigsten Grundsteine, um Armut zu bekämpfen. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben dazu beigetragen, dass die Kinder in Indien eine Chance auf eine bessere Zukunft haben.“
L U D W I G S A N D K ä M P E R , GMHütte-Betriebsratsvorsitzender
Freuen sich über zweimal 8.888,88 Euro (von links nach rechts): Bernhard Lüttmann (Personalleiter GMH Holding), Rainer Witt (Personalabrechnung GMHütte), Stephan Stolze (Leiter Spendenreferat terre des hommes) und Ludwig Sandkämper (Betriebsrats-vorsitzender GMHütte). Foto: vl
rund ums PersonalGmh Gruppe · Die Personalleiter der GMH Gruppe trafen sich in Georgsmarienhütte bei der BGG Berufsbildungsgesellschaft Georgsma-rienhütte. Harald Schartau begrüßte die Personalverantwortlichen aus den Unternehmen und diskutierte mit ihnen über aktuelle Personalthe-men. Seit über 10 Jahren kommen die Personaler jeweils im Mai und No-vember eines Jahres zusammen, um sich über wichtige personelle Fragen auszutauschen und den persönlichen Kontakt zu pflegen. Der Austausch über aktuelle Themen zu Gesetzesänderungen und Rechtsprechung bei befristeten Arbeitsverhältnissen oder Zeitarbeit interessierte die Teilneh-mer dabei ebenso wie der Bericht von Personalleiterkollege Robert Bie-nert über große Veränderungsprozesse beim Bochumer Verein Verkehrs-technik. Die Tagungsthemen Aktuelles aus der Gruppe, Aus- und Wei-terbildung, Nachwuchskräfteprogramm und Gesundheitsmanagement gehören mittlerweile zum Pflichtprogramm des Treffens, das übrigens im Mai dieses Jahres bei Windhoff in Rheine stattfindet.
Bernhard Lüttmann
Deutsch-polnischer AustauschSchmiedewerke Gröditz · In Freiberg fand die 9. Auflage des deutsch-polnischen metallurgischen Seminars statt, eine Veranstaltung der TU Bergakademie Freiberg und der Akademie für Bergbau und Hüt-tenwesen Krakau (AGH). Dabei haben erneut zahlreiche Studenten der hüttenmännischen Fakultäten beider Hochschulen ihre Forschungs-ergebnisse präsentiert. Das Seminar findet seit 2005 abwechselnd in Polen und Freiberg statt und ist inzwischen ein Highlight im akademi-schen Jahr. Es bietet neben Fachvorträgen und dem wissenschaftlichen Austausch vielfältige Möglichkeiten, mit Fachkollegen des anderen Lan-des ins Gespräch zu kommen. Im Rahmen des Seminars besuchten neun Teilnehmer der AGH die Schmiedewerke in Gröditz. Mit dabei war auch Bernd Lychatz, der für das Institut für Eisen- und Stahltechnologie (IEST) der TU Bergakademie Freiberg die Beziehungen zum polnischen Part-ner koordiniert. Als die Gäste fachkundig von Stefan Lachmann durch das Unternehmen geführt wurden, erlebten sie aufschlussreiche Stun-den. Anschließend stellte Stefan Lachmann während eines gemeinsamen Mittagessens die beruflichen Möglichkeiten vor, die sowohl die Schmie-de- und Elektrostahlwerke Gröditz als auch die GMH Gruppe zu bieten haben.
jp
Skifahren beflügelte KreativitätStahl Judenburg · Wenn Privates auch Geschäftlichem zugutekommt.
österreicher und Steirer lernen das Skifahren gleich nach dem
Laufen – und noch vor dem Rad-fahren. Um es nicht zu verlernen, sollte man diese wunderschöne Sportart aber regelmäßig betreiben.
Dies ist einer der Gründe, wa-rum sich seit vielen Jahren Ge-schäftsführung und Führungskräf-te der Stahl Judenburg und der VTK Krieglach Anfang Januar für ein paar Tage privat zum Skifahren
treffen. Als bevorzugte Region hat sich das Ennstal in der Steiermark (etwa 100 Straßenkilometer von Judenburg entfernt) herauskristal-lisiert. Die Skigebiete Reiteralm – Hochwurzen – Schladming/Planai und Hauser Kaibling sind mitein-ander verbunden und durch Welt-cuprennen und zwei alpine Ski-weltmeisterschaften sehr bekannt. Quartier bezieht man schon seit Jahren in einem gemütlichen Gast-
hof am Fuße der Reiteralm. Die Liftstation Reiteralm/Hochwurzen ist von dort zu Fuß gut erreichbar. Natürlich stehen das Skifahren, die zurückgelegten Höhen- und Pisten-meter im Vordergrund. Keiner will bei den wunderbaren Abfahrten zurückbleiben. So gesehen ist der sportliche Wert hoch einzuschät-zen – umso mehr, als die Schnee-lage nicht optimal, die Piste durch Kunstschnee und Regen ziemlich eisig und die Kondition von ent-scheidender Bedeutung war.
Dennoch waren natürlich Be-ruf und Geschäft allgegenwär-tig. Ob bei kurzer Mittagsrast auf den Hütten, beim Après-Ski in der Schirmbar, beim Abendessen oder danach: In entspannter Atmosphä-re konnte man Themen und Pro-bleme diskutieren, die im berufli-chen Alltag oft zu kurz kommen. So wurde auch diesmal der eine oder andere Lösungsansatz gefun-den oder bestehende Unklarheiten ausgeräumt.
Die drei Tage endeten zwar mit etwas Muskelkater – aber ohne Sturz und Verletzungen. Für den nächsten Januar sind bereits wie-der die Zimmer reserviert.
Ewald Thaller
PronoVA BKK
Wenn Pflege dem Pflegenden schadetproGERO: Ein Hilfsangebot für alle Angehörigen, die sich zu Hause um Demenzkranke kümmern.
Demenz wird oft auch als Leiden der Angehörigen bezeichnet. Denn sie müssen hautnah miterleben, wie die eigenen Eltern, der Ehepartner
oder andere nahe Verwandte durch eine Demenzerkrankung immer mehr zum Schatten ihrer selbst werden. Dies hat oft auch schwerwiegende Fol-gen für ihr eigenes Leben und ihre eigene Gesundheit.
Denn der Blick in die Praxis zeigt: Diese Angehörigen sind mit der fort-schreitenden Erkrankung meist hoffnungslos überfordert, nicht zuletzt, weil eine Betreuung rund um die Uhr notwendig ist. proGERO ist ein spe-zielles Angebot der pronova BKK für diese Angehörigen. proGERO will sie in ihrer Rolle als Pflegende stärken.
Deshalb bietet das Programm Schulung und Unterstützung. Kernziel ist die telefonische Hilfestellung für die Angehörigen, bei Bedarf auch ein Hausbesuch zwecks Pflegeberatung. Die Betreuung läuft meist über zwölf Monate.
Die Zusammenarbeit der pronova BKK mit der Pflegekasse ermöglicht eine ganzheitliche Hilfestellung bei Fragen und Schwierigkeiten rund um die häusliche Betreuung. Die pronova BKK berät Sie gerne unter der Tele-fonnummer 0621.53391-4919.
Britta Jansen
Ein bisschen Spaß muss sein – umso mehr, wenn so ganz nebenbei auch die Arbeit nicht zu kurz kommt (von links nach rechts): Ewald Thaller, Günther Jauk, Joachim Seifter, Thomas Krenn, Gerhard Diewald und Klaus Seybold. Foto: privat
Die Personalleiter/-innen der GMH Gruppe in Georgsmarienhütte Werksfoto

glück auf · 1/2014 ......... 30
menschen & kontakte
hoffen auf PolitikSuchtprävention in der Schule (SpidS): Erfolgreiches Projekt sucht öffentliche Mittel.
Das Projekt „SpidS“ (Suchtpräven-tion in der Schule) gibt Schüle-
rinnen und Schülern der siebten bis neunten Klassen das Rüstzeug an die Hand, sich wirkungsvoll und selbst-bewusst gegen Drogen, Alkohol, Ess- oder auch Computersucht zur Wehr zu setzen. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Seit seiner Gründung 2002 haben etwa 8.000 Jugendliche aus allgemeinbildenden Schulen in Osnabrück und im Landkreis an Projekttagen teilgenommen. Die Stiftung hat das Projekt seit 2008 mit insgesamt 25.000 Euro gefördert. Sie versteht ihr Engagement allerdings – ähnlich wie der Mitsponsor „Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung“ – als
Anschubfinanzierung. Jürgen Griese, Vorsitzender des För-derkreises Drogenhilfe Osna-brück, sieht nun die sozialpoli-tischen Akteure in der Pflicht.
mw
regionale TalentschmiedeDie Herbstakademie ist nur an den Besten interessiert: Gymnasiasten präsentierten im Kreishaus Osnabrück ihre Forschungsarbeiten.
zum zwölften Mal fand die Herbstakademie an der Uni Os-
nabrück statt. Sie will leistungsstarke Schülerinnen und Schüler fördern – nicht zuletzt aus Eigennutz. Denn viele Unternehmen in der Region sind auf hoch qualifizierte Nach-wuchskräfte angewiesen, wie Ulrike Behrens vom Niedersächsischen Kul-tusministerium in ihrem Grußwort betonte.
120 Schülerinnen und Schüler nahmen in diesem Jahr teil. Sie wur-den in insgesamt zwölf Kursen an das wissenschaftliche Arbeiten her-angeführt. Dabei konnten sie tiefer und detaillierter in die Materie ein-tauchen, als dies in der Oberschule üblich ist.
Ein Beispiel dafür ist der Technik-kurs zum Thema „Stirling-Motor“. Dort hatten fünf Oberschüler die Aufgabe, dessen Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie Zukunfts-chancen zu erläutern. Zudem kons-truierten und bauten sie ein Modell des Motors – eine filigrane Arbeit, die viel Fantasie und Improvisations-vermögen erforderte. Beleg dafür sind die verwendeten Baumateriali-en, wozu unter anderem eine Plas-tikflasche, der Deckel einer Konser-vendose und ein Einweghandschuh gehörten.
Was bei den Kursen letzten Endes erarbeitet wird, blieb kein Betriebsgeheimnis: Zum Abschluss der Herbstakademie wurden die Ergebnisse im Kreishaus Osnabrück präsentiert.
Die festen Partner der Herbst-akademie sind die Landkreis-Gym-
nasien Bersenbrück und Oesede, das Gymnasium „In der Wüste“ und das Ratsgymnasium aus der Stadt Osna-brück. Neben diesen Kernschulen werden zwei bis vier weitere Schulen eingeladen. Ausrichter sind die Uni-versität und Hochschule Osnabrück sowie deren gemeinsame Zentrale Studienberatung (ZSB). Stadt und Landkreis Osnabrück richten die Prä-sentationstage aus.
Ein Großteil des Budgets wird von der Stiftung beigesteuert – von 2011
bis 2013 mit jährlich jeweils 3.500 Euro, von 2014 bis 2016 mit jährlich jeweils 4.000 Euro.
Auch der aktuelle Antrag werde „wohlwollend“ behandelt, sagte Hermann Cordes, Vorsitzender der Stiftung. Gleichwohl unterstrich er, dass man nicht dauerhaft für die Finanzierung aufkommen werde. Alle Beteiligten seien deshalb aufge-rufen, nach Fördergeldern Ausschau zu halten.
bmz
Starke Schüler Die vier Fortbildungstage haben sich für die 25 Lehrerinnen und Lehrer gelohnt. Sie wissen jetzt besser, wie man mit Stress im Klassenraum umgeht, rechtzeitig Störungen in der Gruppe erkennt und verhindert, Defizite und Fähig-keiten der Schüler erkennt und stär-kende Impulse setzt. Hintergrund ist „Chancen ausloten – Übergänge meistern“, ein einjähriges Pilotpro-jekt der Oase-Stiftung. Mit ihrem Wissen sollen die Erzieher für eine befruchtende Lernatmosphäre in der Klasse sorgen, damit ihre Schü-ler bessere schulische Leistungen bringen und leichter den Wechsel in die Berufswelt schaffen. Im Fokus stehen Jugendliche mit Bindungs-störungen, schlechten Schulleis-tungen, unzureichender Ausbil-dungsreife, mangelndem Selbst-wertgefühl oder auch schwachem Durchhaltevermögen. Sie sollen zu starken Schülern werden, indem sie den Klassenraum als einen Ort er-leben, wo fruchtbare – weil funk-tionierende – soziale Beziehungen herrschen und der Umgang mitei-nander stimmt, nicht zuletzt zwi-schen Schüler und Lehrer. Nach der Fortbildung gingen Lehrer und Schüler auf dreitägige Klassenfahrt. Hier begann bereits die Arbeit der Erzieher. Die Stiftung fördert das Projekt seit 2007 mit bislang insge-samt 58.000 Euro.
pkm
Tierisch gut Deutsch lernenStiftung unterstützt Sprachförderprojekt.
Deutsch lernen – ob lesen oder schreiben – ist nicht immer ein-
fach, gerade für Grundschulkinder mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Schichten. Das Pro-jekt „Deutsch lernen im Zoo“ macht sich die Anziehungskraft exotischer Tiere zunutze. Elefanten, Löwen & Co sind für Kinder so spannend, dass sie sich leichter damit tun, neue Begriffe zu lernen.
Bislang konnten 1.200 Kinder aus fünf Schulen kostenlos von der Sprachförderung im Zoo profitieren. Es sind Grundschüler der Franz-Hecker-Schule, der Rosenplatzschu-le, der Stüveschule, der Heiligen-Weg-Schule und der Grundschule Eversburg. Sie können bis zu zwei-mal kostenlos im Jahr in den Zoo Osnabrück kommen und mithilfe der Zoobewohner neue Begriffe lernen. Zoopädagogen führen die Kinder durch den Zoo und erklären ihnen die Welt der Tiere.
Dabei wird Wert auf neue Begrif-fe und Sprechen gelegt: Was isst der Affe zum Frühstück? Wie unterschei-det sich der Tiger vom Löwen? Und wie heißt das Haar am Kopf des Löwenkaters? Spielerisch lernen die Teilnehmer neue Begriffe und Wis-senswertes über Tiere. So werden selbst stille Kinder zum Sprechen animiert.
Um das Gelernte weiter zu fes-tigen, behandeln die Lehrerinnen und Lehrer die Zoobesuche auch im Unterricht. Eine Klasse der Grund-schule Eversburg legte beispielswei-se einen Schwerpunkt auf Elefanten. Nach dem Besuch bei den Dick-häutern startete in der Schule die „Elefantenwerkstatt“.
Die Schüler konnten sich unter-schiedliche Aufgaben je nach Leis-tungsniveau aussuchen: Ob lesen, schreiben, basteln oder präsentieren – die Kinder lösten mit Eifer ihre Schularbeiten. Auch ein Mädchen mit Behinderung kam in den Zoo und löste Aufgaben aus der „Elefan-tenwerkstatt“ mithilfe ihrer Betreue-rin. Das ist gelebte Inklusion.
„Deutsch lernen im Zoo“ begeis-tert alle Beteiligten. Während die Schüler voller Elan ihre Erlebnisse in der Schule umsetzen und noch Monate später aufgeregt von ihrem Zoobesuch berichten, sind die Lehrer begeistert über die motivie-renden Impulse und die Wortschatz-erweiterung der Kinder.
Das Projekt zeigt, wie wichtig es ist, zwischendurch den Klassen-raum zu verlassen, um besser und mit mehr Spaß lernen zu können. Die Stiftung unterstützt das Projekt bereits seit 2009 mit bislang insge-samt 33.000 Euro.
bmz
Auch der Giraffen-Nachwuchs sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Fotos: vl
Um die Herbstakademie alljährlich auf die Beine zu stellen, arbeiten mehrere Partner in der Osnabrücker Region zusammen (hintere Reihe von links nach rechts): Reinhardt Fulge (Organisationsteam), Prof. Alexander Schmehmann (Hochschule Osnabrück), Hermann Cordes (Stiftung) und Landrat Michael Lübbersmann. Vorne von links nach rechts: Gisela Danz (Zentrale Studienberatung), Heike Siebert (Stiftung) und Ulrike Behrens (Kultusministerium des Landes Niedersachsen). Foto: Uwe Lewandowski
SpidS muss zukünftig neue Förderer suchen (von rechts nach links): Jürgen Griese (Vorstand Förderkreis Drogenhil-fe Osnabrück), Hermann Cordes (Vor-stand Stiftung Stahlwerk Georgsmarien-hütte), Christa Fip (Schirmherrin des Projekts), Michael Prior (Geschäftsfüh-rer der Friedel & Gisela-Bohnenkamp-Stiftung) und Herbert Staben (Vorstand Förderkreis Drogenhilfe Osnabrück).
Foto: vl

glück auf · 1/2014 ......... 31
menschen & kontakte
Werksfoto
Weiterbildungsfahrt. Kurz vor Jahresende kam sie trotz schwieriger Wirtschafts-lage und Terminproblemen doch noch zustande: die Wei-
terbildungsfahrt der Arbeitssicherheits-, Umwelt- und Energiebeauftragten des Stahlwerkes Bous. 18 Teilnehmer begannen ihre Weiterbildung bei der MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG in Saarlouis, die unter anderem Berufskleidung, Schutzkleidung und Arbeitsschutzartikel herstellt. Dort besichtigte man die Produktions-linie, bevor man sich mit den Verantwortlichen über Normen und Verordnungen für Arbeitskleidung austauschte. Dabei konnten die Kollegen nicht zuletzt den Unterschied zwischen Waschen und Reinigen kennenlernen. Zweite Station war die Dillinger Hütte, wo man sich mit der Abteilung Arbeitssicherheit austauschte. Nachdem Jürgen Weisgerber (Arbeitssicherheit) das Unternehmen kurz vorgestellt hatte, konnten sich die Gäste bei einer ausführ-lichen Besichtigung einen Überblick über die Größe der Dillinger Hütte verschaffen. Danach ging es zurück nach Bous, wo der Tag mit einem gemütlichen Beisammensein ausklang. Das Foto zeigt die Kollegen mit der Geschäfts-führung der MEWA.
Armin Hans
BETriEBSJuBiLäEn Geschäftsführungen und Betriebsräte gratulieren den Jubilaren und sagen Dank für die langjährige Betriebstreue. glück auf wünscht alles Gute für die Zukunft, beste Gesundheit und viel Erfolg.
STAhL
Mannstaedt GmbH25 Jahre: Miguel Fernandez-Calero (Walzwerk), Klaus Fuchs (Walzwerk), Jakob Hoch (Walzwerk), Rudolf Janowczyk (Weiterverarbeitung), Andreas Mundorf (Walzwerk), Hein-rich Schoppa (Walzwerk), Seref Sucuoglu (Logistikzentrum), Cemal-letin Turhan (Walzwerk) und Marian Wojick (Weiterverarbeitung)35 Jahre: Viktor Wenzel (Weiterverarbeitung)45 Jahre: Karl-Heinz Stroeder (Zerspanungszentrum)
Stahlwerk Bous GmbH25 Jahre: Thomas Barthen (Stahl-werk) und Marian Hrobok (Stahlwerk)Stahl Judenburg GmbH25 Jahre: Harald Erdkönig (Kolben-stangenfertigung), Gerhard Fruh-mann (Blankstahlbetrieb), Johann Krobath (Walzwerk) und Bernhard Wolfger (Kolbenstangenfertigung)
SChmiEDE
Energietechnik Essen GmbH35 Jahre: Manfred Reisdorf (Qualitätsstelle)
Gröditzer Vertriebsgesell-schaft mbH Willich10 Jahre: Detlef Schwerdt (Vertrieb)
Gröditzer Kurbelwelle Wildau GmbH 10 Jahre: Simone Senst (Geschäfts-führung)35 Jahre: Hannelore Schläger (Werkzeugwirtschaft) und Hartmut Gall (Fertigung) Schmiedewerke Gröditz GmbH10 Jahre: Bärbel Schöne (Kompetenzzentrum)20 Jahre: Steffen Gerlach (Werkserhaltung) 40 Jahre: Wilfried Arndt (Einkauf/Magazin) und Gunter Hommola (Schmiede/Vergüterei)
Wildauer Schmiedewerke GmbH & Co. KG 10 Jahre: Christian Dinter (Produktionsleitung)
BAhn
Bahntechnik Brand-Erbisdorf GmbH 10 Jahre: Simone Anders (Vertrieb)
Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH25 Jahre: Thomas Ruppert (Warmformgebung)
Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH, Werk Ilsenburg 25 Jahre: Andreas Brenz (Fertigung), Ingo Müller (Fertigung), Denis Pittel (Fertigung), Jörg Schulze (Werkerhal-tung) und Wera Stempel (Fertigung)35 Jahre: Henning Bock (Fertigung) und Johannes Parlesak (Werkerhal-tung)
MWL Brasil Ltda.10 Jahre: Ailton Jose da Silva (Schmiede), Edmar Ramos da Cruz (Engineering), Elton das Neves (Wär-mebehandlung), Francisco Vieira Neto (Maschinelle Bearbeitung),
Glauber Luiz B. Moura (Radsatz-Montage), Joao Paulo de Freitas Sin-faes (Maschinelle Bearbeitung CNC), Marcos Antonio Assis Leite (Wärme-behandlung) und Valdecir Aparecido Nogueira (Schmiede)
GuSS
Walter Hundhausen GmbH25 Jahre: Musa Akyüz (Kernma-cherei), Vehbi Avci (Trennband), Alfred Busch (Instandhaltung), Bilal Calik (Kernmacherei), Jürgen Dud-ziak (Endfertigung), Ahmet Durmus (Endfertigung), Aziz Eser (Kernma-cherei), Nuri Eser (Kernmacherei), Rafet Hamurci (Schmelzbetrieb), Wolfgang Hill (Formerei), Salim Kay-narca (Trennband), Marc Redlingshö-fer (Schmelzbetrieb), Wilfried Schei-bel (Glüherei), Waldemar Schwitalla (Endfertigung), Ekrem Sevindi (Pro-duktionsplanung), Cumali Sinankili (Trennband), Ramazan Tan (Forme-rei) und Ergün Topal (Formerei)35 Jahre: Francesco Tatulli (Kern-macherei) und Paolo Valenti (For-merei)
Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH25 Jahre: Rolf Ehlert (Instandhal-tung G 1 mech.), Florian Fenzel (Fer-tigungskontrolle), Reinhold Hartel (Formerei Kokillen + Zubehör), Sta-
nislaw Macioszek (ATZ/Ruhe- phase) und Thaddäus Przybylka (ATZ/Ruhephase)35 Jahre: Christian Koziol (Nachputzerei)
Friedrich Wilhelms-Hütte Stahlguss GmbH35 Jahre: Günter Brosig (Brennen/Trennen/Abschleifen)
Harz Guss Zorge GmbH40 Jahre: Karl-Heinz Schulze (Werksdienst)
MWK Schwäbisch Gmünd GmbH25 Jahre: Dursun Akbulut (Werks-verkehr), Ersin Akbulut (Endprüfung), Aslan Aksoy (Schmelzerei), Georg Bock (Qualitätssicherung), Wolfgang Wilm (Qualitätssicherung) und Hilal Yüksel (Endprüfung)
MWK Renningen GmbH15 Jahre: Johan Häring (Messtechnik)20 Jahre: Kiriakos Tsakis (Putzerei)
Service
GSG GmbH25 Jahre: Martin Balsam (Eisenbahn)35 Jahre: Ibrahim Tanovic (IH-Team Reserveteilwirtschaft)
PErSonALiA// 1. Quartal 2014
Des rätsels Lösung. Auch im letzten Jahr gab es bei der
GMHütte ein Weihnachtsrätsel zum Thema Energie. Dabei ging es um den Energieverbrauch des Werkes in den letzten Jahren (Strom, Erdgas, Druckluft und Wasser) und die erzielten Einsparungen. So hätte man 2013 zum Beispiel mit dem Erdgasbedarf von Ofen 63 durchschnittlich 12.185 Einfamilienhäuser beheizen und mit der verbrauchten Trinkwassermenge 1.480.000 Badewannen füllen können. Mehr als 250 Mitarbeiter/-innen haben mitgerätselt. Zu gewinnen gab es einen Einkaufskorb. Das Foto zeigt die Gewinnerin Heike Schönemann aus der VKA (links) mit der Energie-beauftragten Claudia Riesenbeck bei der Preisübergabe. Weitere Gewinner waren Alexander Ruppel und Arthur Scherzinger (beide Stahlwerk) sowie Thorsten Biewald und Jürgen Niemann (Walzwerk).
Reimund Laermann
Eine Frage des VertrauensDie Vertrauensleute der GMHütte trafen sich Ende letzten Jahres zu einem A1-Seminar in Bad Essen. In angenehmer Atmosphäre erarbeiteten sie die grundlegenden Aspekte ihrer Arbeit – in Gruppenarbeit und ge-meinsam mit den Dozenten Achim Bigus und Michael Schuhl. Die Teil-nehmer nutzten die Gelegenheit, sich auch außerhalb der Seminarzeiten untereinander auszutauschen. Bei einer Sammelaktion wurden 100 Euro für die Stiftung „Hilfe für Petra und andere“ gesammelt. In diesem Jahr soll das Seminar erneut stattfinden. Übrigens: Zu einem der Seminare der IG Metall kann sich jede Vertrauensperson oder jede/r IG-Metall-Aktive anmelden.
Tobias Westermann
Tolles Jahr, tolles Festharz Guss · Familientag als Dankeschön
Für Harz Guss Zorge war 2013 das bisher erfolgreichste Ge-
schäftsjahr der Unternehmensge-schichte. Grund genug, die Beleg-schaft Ende letzten Jahres erneut zu einem Familientag einzuladen – und eine ideale Gelegenheit für Geschäftsführer Carsten Weißel-berg, ihr für ein außerordentlich großes Engagement zu danken.
Die Feier stand ganz unter dem Zeichen des fröhlichen Miteinan-ders. Der Schwerpunkt lag jahres-zeitlich bedingt auf einem festlich geschmückten Weihnachtsmarkt. Zahlreiche Aussteller und Kunst-handwerker aus der Umgebung sorgten mit ihren regionalen Pro-dukten für vorweihnachtliches Flair – bei einem allerdings eher vorfrühlingshaften sonnigen Wet-ter. Die Palette reichte vom Räu-cherfisch und Käse über Honig und Marmelade bis hin zu kunstvollen Schwibbögen und Handstrickarbei-ten.
Die Kleinen freuten sich über eine Bastel- und Schminkecke und eine Hüpfburg. Beim Kerzen-
ziehen konnten sie ihr handwerk-liches Geschick beweisen. Auch ein Weihnachtsmann durfte nicht fehlen, der (natürlich nur an artige Kinder) kleine Geschenke verteilte.
Grafenquelle, Dönerimbiss, Hähnchenbraterei und Kantinen-belegschaft sorgten für Essen und Trinken. Schützenhilfe erhielten sie von der Suppenkanone der Frei-willigen Feuerwehr Ellrich mit def-tigen Suppen einer ortsansässigen Fleischerei. Zum Nachtisch wink-ten Kaminstriezel und Waffeln.
Für eine stimmungsvolle musi-kalische Untermalung sorgte erneut DJ Uwe Proschinski, ein Kollege aus der Putzerei. Und zum Abschluss erhielten die Mitarbeiter die inzwischen obligatorische Weihnachtspute.
Der Familientag war gratis. Wer wollte, konnte für einen guten Zweck spenden, was viele gerne taten. So kamen knapp 700 Euro zusammen – eine Summe, die zu gleichen Teilen an umliegende Kindergärten verteilt wurde.
mh
GmhüTTE
BouS
Foto: Reimund Laermann

glück auf · 1/2014 ......... 32
dies & das
Ein-druck
Not-signal
ein-farbig
Feuer-stelle
Leben,Existenz
Hetz-jagdmitHunden
ElementantikerTempel
Neben-flussderDonau
Abkoch-brühe
Zupf-instru-ment
flei-schigeSüd-frucht
SchliffimBeneh-men
emp-finden
Körper-stellung
Ränke-spiel
sichirren
Feier,Party
Berg-weide
runderGriff
Ziffern-kennung(engl.Abk.)
Kose-name fürden Groß-vater
gen-mani-puliertesWesen
präzise
Schlüs-sel einerGeheim-schrift
Direkt-verbin-dung(EDV)
FlussdurchMünchen
Handy-Norm(Abk.)
Halb-leiter-produkt
Grotten-molch
Ansturmauf etwasBegehrtes(engl.)
Insel-euro-päer
ver-ehrtesVorbild
eineGeliebtedes Zeus
Ost-euro-päerin
falls
latei-nisch:Götter
eiligeFort-bewe-gung
früh.türk.Titel
fest ver-bunden,anhäng-lich
glück auf · Rät sel
zuLETzT noT iErT
EEG-reform. Zeitpunkt und Thema „Stahl in der Energiewende“ waren optimal gewählt: Kurz bevor die EEG-Reform im Bundeskabinett beschlossen wird, trafen sich zum Berliner Stahldialog am 19. März rund 330 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie interessierten sich vor allem für die Auswirkungen der Energiewende auf die Stahl-industrie. Veranstaltet hatte den Abend die Wirtschaftsvereinigung Stahl. Einigkeit bestand darüber, dass die kürzlich veröffentlichten EU-Leitlinien zur Energie- und Klimapolitik kein Anlass zur Entwarnung seien, da sie für Elektrostahlwerke bis zu einer Verzehnfachung der Kosten führen könnten. Wirtschaftsminister Gabriel hat sie als „nicht akzeptabel“ kritisiert.
mw
Eine Frage des GeschmacksReizende süß-sauer-salzig-herbe Linsenkomposition für die Zungenpapillen.
Die ayurvedische Küche will süß, sauer, bitter, salzig, herb und scharf jeweils in einem Gericht vereinen. Das folgende Gericht schafft zwar nicht alle sechs – aber zumindest vier von sechs. Welche?
Das müssen Sie schon selbst probieren!
zutaten: 1 Bund Lauchzwiebeln300 g rote LinsenHeißes Wasser (doppelte Volumen-menge der Linsen)1/2 Granatapfel1 Espressotasse (max. 30 ml) Grenadine-SirupOlivenöl1 TL gekörnte Brühe
1 Bund RucolaFalafelmischungBalsamico-Creme
Für die Joghurtsauce:400 g JoghurtSaft von einer halben ZitroneSchnittlauch (nach Belieben)Minze (nach Belieben)Salz, Pfeffer, Vollrohrzucker1 EL Olivenöl
zubereitung:
• Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden, in Olivenöl andünsten. Linsen dazugeben und kurz mitdünsten. Mit heißem Wasser ablöschen und 1 TL gekörnte Brühe hinzugeben. 12 bis 15 Minuten garen.
• Kerne aus dem halbierten Granatapfel herauslösen (ohne weiße Haut!). Nach der Hälfte der Garzeit – nach 6 bis 7,5 Minuten – zu den Linsen hinzufügen.
• Rucola waschen. • Falafel-Bällchen nach Packungsanweisung braten oder
frittieren.• Für Joghurtsauce Schnittlauch und Minze kleinschnei-
den. Den Joghurt mit Kräutern, Salz, Pfeffer, Prise
Zucker, Zitronensaft und Olivenöl glatt rühren und abschmecken.
• Wenn die Linsen gar sind, Topf vom Herd nehmen. Die Linsen ggf. mit Salz und Pfeffer nachwürzen.
• Nach und nach Grenadine-Sirup unterrühren. Immer wieder kosten, bis das Linsengemüse eine leichte angenehme Süße hat. Vorsicht: Wenn Sie zu viel Sirup unterrühren, haben Sie keine Chance mehr, es rück-gängig zu machen, um das Gericht zu retten!
• Anrichten: Salatblätter mit Stiel nach innen im Kreis legen, Linsengemüse hinzufügen, Falafel-Bällchen danebenlegen und mit Joghurtsauce beträufeln. Wer will, kann etwas Balsamico-Creme hinzufügen.
glückauf wünscht Ihnen guten Appetit.
Foto: Thomas Hesselmann-Höfling
Teamsport mit dem Fan-ShopGmh-Fan-Shop erfüllt (fast) alle Wünsche.
Der Fan-Shop der GMH Gruppe hilft, wo immer er kann. Schließlich ist unser Motto: Gemeinsam – miteinander – füreinander.•Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Betriebssportgruppe, die ein gemeinsa-
mes Outfit braucht? Ob sie nun ausschließlich Betriebssport treibt oder an öffentli-chen Rad-, Lauf- oder Fitness-Veranstaltungen teilnimmt: Wir sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestens dastehen und Ihr Unternehmen visuell optimal repräsentieren – mit einer Sportbekleidung im Corporate-Design-Look. Wir bieten Ihnen ein funktionales und hochwertiges Teamoutfit, inklusive Beflockung oder Bestickung. Bedenken Sie: Eine optimale Ausstattung erhöht die Chancen für einen erfolgreichen Wettkampf. Das beispielhaft abgebildete Teamsportpaket erhal-ten Sie im Fan-Shop.
•Suchen Sie für Ihr Unternehmen einen Artikel, der im Fan-Shop fehlt? Kein Problem: Wir beschaffen Ihnen gerne Ihren Wunschartikel. Oder wir suchen für Sie nach einer Alternative – schnell, flexibel und individuell.
•Wollen Sie Artikel aus dem Fan-Shop Ihren Mitarbeiter/-innen im Unternehmen zeigen? Wir stellen Ihnen gerne Muster für Ihre Fan-Shop-Vitrinen zur Verfügung. Auf Wunsch senden wir Ihnen auch unseren aktuellen Fan-Shop-Flyer, als Druck-PDF oder im Origi-nal. Anfrage genügt: [email protected].
Kirsten Schmidt
nur das Beste für unseren nachwuchs !
Ab sofort erhalten Sie im Fan-Shop: dekorative Babystrampler in weicher Baumwoll-Qualität, wahlwei-se in rot-weiß-gestreift oder blau-weiß-gestreift, beflockt mit „GMH Gruppe“. In den Größen 3–6, 6–12 oder 12–18 Monate.