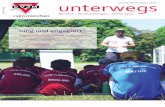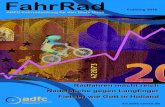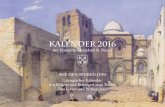glueckauf-1-2016
description
Transcript of glueckauf-1-2016

glück auf Die Zei tung für Mit ar bei ter, Kun den und Freun de der GMH Gruppe
1/2016
Schmiede macht RiesenwelleSchmiedewerke Gröditz · Schmiede beherrscht das TR-Schmieden von Großkurbelwellen inzwischen aus dem Effeff. Kunden kommen in der Hauptsache aus dem Schiffsmotorenbau.
D ie Erprobungsphase war lang und gründ-lich – nicht zuletzt, weil viele techni-
sche, organisatorische und betriebslogisti-sche Probleme zu klären waren. Jetzt gehört die Herstellung von TR-Großkurbelwellen zum festen Lieferprogramm der Schmiede-werke Gröditz (SWG).
Dabei beeindrucken vor allem Ausmaße und Gewicht der Werkstücke. So hat man beispielsweise während der Erprobungspha-se in mehreren Kampagnen neunhübige Kurbelwellen mit einem Rohgewicht von je 35 Tonnen und sechshübige Kurbelwellen mit einem Rohgewicht von 24 Tonnen ge-fertigt (sie alle wurden anschließend von der Gröditzer Kurbelwelle Wildau einbaufertig weiterbearbeitet).
Der lange Weg in die TR-Großkurbelwel-len-Fertigung war für die Gröditzer aller-dings mit einigen Schwierigkeiten, Denkauf-gaben und Hindernissen gepflastert – und erforderte jede Menge Geduld:
Bereits 2009 schmiedeten die SWG-Schmiedeexperten die ersten Prototypen, nachdem man eine TR-Vorrichtung an ihre 60-MN-Presse angepasst hatte. 2013 erprob-te man dann die ersten größeren Werkstü-cke – bis zu 18 m lange Spindeln mit einem maximalen Hüllkreis von 1.100 mm (Erläute-rung „Hüllkreis“ siehe Seite 8).
In dieser Phase bereitete den Gröditzern vor allem das folgende Problem Kopfzerbre-chen: Die Komplett-Erwärmung solch großer Spindeln war nicht möglich. Deshalb wur-den gemeinsam mit einem Ofenbauer drei transportable Klappöfen entworfen, gebaut und Ende 2013 in Betrieb genommen.
Diese Öfen ermöglichen den Schmiede-werken, die Kurbelwellen beim Schmieden gezielt partiell zu erwärmen. Die restliche Welle bleibt dabei kalt und dadurch sta-bil. Die Mobilität der Öfen stellt sicher, dass sie nicht im Weg stehen und den „normalen Schmiedebetrieb“ nicht behindern.
Die SWG-Schmiedemannschaft hat sich während der Entwicklungsphase extrem en-gagiert. Das beweisen auch die vielen Ver-besserungsvorschläge, die bisher zum Thema TR-Schmieden eingegangen sind. Und ob-wohl die Kollegen mittlerweile sehr gut in die Materie eingearbeitet sind, beschäftigen sie sich immer noch intensiv mit einer Opti-mierung des Verfahrens.
Gelegenheit dazu gibt es reichlich: Bei-spielsweise steht zurzeit die Fertigung eines neuen Wellentyps auf dem Programm – ein Auftrag, der neue Herausforderungen mit sich bringt. Denn für die Neukonstruktion des Rohlings müssen auch die dazugehöri-gen Werkzeuge neu konstruiert und herge-stellt werden.
Ralf Schreiber
R Wie funktioniert das TR-Verfahren? Siehe dazu Seite 8
Stahl global. Europäische Stahlherstel-ler haben es schwer. Auch noch so innova-tive Methoden zur kostengünstigen Pro-duktion können die Wettbewerbsvorteile chinesischer Stahlwerke nicht wettmachen: unter anderem deutlich niedrigere Löhne und weitaus weniger Umweltauflagen.
R siehe Seite 6 und 7
Arbeiten mit Sicherheit. Das Stahl-werk der GMHütte konnte eine ausge-zeichnete Arbeitssicherheits-Bilanz 2015 ziehen. Denn über das ganze Jahr hinweg war im Walzwerk kein einziger Unfall mit Ausfalltagen zu beklagen.
R siehe Seite 8
Der Azubi-Award und seine Preisträger ist eines der Themen, über die in den aktu-ellen AzubiPages 1/2016 informiert wird.
R siehe Buch 3
Gigantische Ausmaße: Die Großkurbelwelle wird Stück für Stück erwärmt und geschmiedet. Großes Foto: jb, kleines Foto: MUBVideo
Spezial-Radsätze für SpurwechselDie BTK-Route ist eine neue Eisenbahnstre-cke, die von der aserbaidschanischen Haupt-stadt Baku über die georgischen Städte Tiflis und Achalkalaki und zur türkischen Stadt Kars führt. Für einen nahtlosen Übergang von Breit- auf Normalspur an der türkischen Grenze sollen Radsätze aus dem BVV-Werk Ilsenburg sorgen.
R siehe Seite 4

glück auf · 1/2016 ............ 2
GMH GRUPPE
eD itoR iAl
AuS Dem inhAltRRo/RRD · Papierflutbremse: Befundung und Dokumentation eingehender Schrottlieferungen werden zukünftig komplett online abgewickelt.
auf Sei te 9
Gmhütte · Positive Entwicklung: Walzwerk des Stahlwerkes hatte im Vorjahr keinen einzigen Arbeitsunfall mit Ausfalltagen.
auf Sei te 8Kolumne · Gesundheit: Schon aus persönlichen Gründen sollte man auch im Betrieb auf Sicherheit und Gesundheit achten.
auf Sei te 10
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wenn es um die Zukunft geht, ist man oft auf Vermutungen ange-wiesen. Nur selten kann man sich 100-prozentig sicher sein, dass eintritt, was man erwartet – und dass man das Richtige tut, damit das eintritt, was man gerne hätte. Also was tun? Der Philosoph René Descartes empfiehlt, wo man das Rechte nicht mit voller Gewissheit erkennen kann, unbeirrt und mit ganzer Kraft dem Wahrscheinlichs-ten zu folgen. Mit anderen Worten: Was man nach reiflicher Über-legung für gut befunden hat, sollte man auch konsequent durchziehen. Diese Einstellung eröffnet die größte Chance, dass die erhoffte Zukunft auch tatsächlich eintritt.
Ihr glückauf-Redaktionsteam
Stan
d 04
.201
5
STANDORTE DER GMH GRUPPE
Produktionsstandorte
Repräsentanzen (GMH Holding)
Hamburg
WildauIlsenburg
Georgsmarienhütte
BousHomburg
Krieglach
Judenburg
Osnabrück
ÖSTERREICH
Brand-Erbisdorf
FRANKREICH
LUXEM- BURG
Bochum
Gevelsberg
Troisdorf
HagenMülheimWitten Schwerte
Dortmund
Essen
Böbingen/Rems
NIEDERLANDE
BELGIEN
POLEN
TSCHECHISCHE REPUBLIK
DEUTSCHLAND
SCHWEIZ
Nürnberg
Gröditz
Produktionsstandorte / Repräsentanzen
Caçapava
China
Russland
Sydney
Indianapolis
KocaeliJapan
Zorge Herzberg
Burg
Schwäbisch Gmünd
Produktionsstandorte
Repräsentanzen (GMH Holding)
Caçapava
China
Russland
Sydney
Indianapolis
KocaeliJapan
ete · Im Schaufenster: Kappenringe sind enormen Belastungen ausgesetzt. Sie betätigen sich quasi als „Fliehkraft-bremser“ in Turbo-Generatoren.
auf Sei te 5
BVV · Strategie Leise Schiene: Auf dem Aktionsforum begutachtete Bun-desminister Dobrindt interessiert ein mit Radkappen-Absorber gedämpftes BVV-Güterwagenrad.
auf Sei te 8
Foto
: © p
anth
erm
edia
/alp
hasp
irit
e-ofen-Betreiber im netzwerk Gmh Gruppe · Stahlunternehmen haben Vereinbarung über das „Energieeffizienz-Netzwerk Elektrostahl“ unterzeichnet. Drei Unternehmen aus der GMH Gruppe gehören ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern.
Bei der Jahrestagung STAHL 2015 in Düsseldorf unterzeich-
neten Vertreter von elf Unterneh-men die Gründungsvereinbarung für ein Energieeffizienz-Netzwerk der Elektrostahl-Produzenten in Deutschland. Darunter waren auch drei Unternehmen der GMH Grup-pe: die Georgsmarienhütte GmbH, die Schmiedewerke Gröditz GmbH und die Stahlwerk Bous GmbH. Ziel des Netzwerkes ist es, durch einen umfassenden Erfahrungsaus-tausch Möglichkeiten zu diskutie-ren, wie man in den Unternehmen die Energieeffizienz steigern kann.
Träger und Moderator des Netz-werks ist das Stahlinstitut VDEh. Dessen Vorsitzender Hans Jürgen Kerkhoff, der gleichzeitig Präsi-dent der Wirtschaftsvereinigung Stahl ist, betont die Relevanz der Netzwerk-Aktivitäten: „Das Thema
Energieeffizienz beschäftigt alle Stahlunternehmen, insbesondere vor dem Hintergrund immer weiter steigender Energiekosten. Mit dem Energieeffizienz-Netzwerk Elektro-stahl gibt es die Möglichkeit, sich zielgerichtet entlang der Herstel-lungsroute über Effizienzmaßnah-men auszutauschen.“
Die Ausrichtung des Netzwerks ist einzigartig. Denn innerhalb des
Netzwerkes sind ausschließlich Unternehmen der Elektrolicht-bogenofen-Route vertreten. Diese bewusste Eingrenzung ermöglicht, punktgenau Erfahrungen mitein-ander auszutauschen.
Das Energieeffizienz-Netzwerk Elektrostahl geht auf eine Verein-barung der Bundesregierung mit verschiedenen Branchen- und Fachverbänden zurück. Diese Ver-
einbarung hat die Zukunft im Blick und sieht die Gründung von 500 neuen Energieeffizienz-Netzwer-ken bis Ende 2020 vor.
Dementsprechend haben Unter-nehmen der Branche bereits eben-falls Gründungen und Teilnahmen an Netzwerken angekündigt.
jb
Die GründungsmitgliederDie Vereinbarung über das „Energieeffizienz-Netzwerk Elektrostahl“ haben unterzeichnet: ArcelorMittal Hamburg GmbH, Benteler Steel/Tube GmbH, BGH-Edelstahl GmbH, Deutsche Edelstahlwerke GmbH, ESF Elbe-Stahl-werke Feralpi GmbH, Georgsmarienhütte GmbH, Lech-Stahlwerke GmbH, RIVA Stahl GmbH, Schmiedewerke Gröditz GmbH, Stahlwerk Bous GmbH und Stahlwerk Thüringen GmbH.
Weitere Informationen zu Netzwerkaktivitäten und „Effizienz und Stahl“ unter www.effizienz-mit-stahl.de.
glückauf: Was verspricht sich Ihr Unternehmen vom Energieeffizienz-Netzwerk Elektrostahl?
„Die Schmiedewerke Gröditz versprechen sich innerhalb des Netzwerkes neben einem intensiven Erfahrungs- auch einen regen Ideenaustausch, wie die Energieeffizienz im Unternehmen weiter gesteigert werden kann – und damit auch die Energiekosten gesenkt werden können.“
N I c o K N o R R ( SWG-Energiemanager)
mannstaedt · Supplier Award: Die Troisdorfer sind die einzigen Lieferanten, die weltweit alle Standorte der Unicarriers-Gruppe beliefern.
auf Sei te 10
Zentrale Frage: Wie kann man am E-Ofen Energie sparen? Werksfoto
RepariertIAG MAGNUM: Gebrochene Oberwalze repariert. Nach dem Schweißen zeigte die über 19 m lange Walze eine Abweichung von lediglich 1,5 mm!
>>> auf Seite 14
optimiertHGZ: Neue Strahlanlage entlastet Mitarbeiter. Gießerei erzielt hohes Produktivitäts- und Ergonomie-Plus in Vorputzerei.
>>> auf Seite 15
SaniertSWG: Kranbahnsanierung vor-gezogen. Mitarbeiter wollten kein weiteres Jahr Behinderungen in der Werkshalle hinnehmen.
>>> auf Seite 15
installiertSchmiedag: Vielseitigere und fle-xiblere Software installiert. Syste-
matische Vorbereitung ermöglichte den reibungslosen Übergang beim CAD-Wechsel.
>>> auf Seite 17
motiviertGMHütte: Das IdeeM des Stahlwer-kes rechnet auch in diesem Jahr wieder mit reger Beteiligung und vielen guten Ideen aus der enga-gierten Belegschaft.
>>> auf Seite 17
Routiniert GMHütte: Erfahrung pur und viele Tipps. Guntram Haase arbeitet seit 45 Jahren im Werk und ist zugleich seit 30 Jahren als Sicherheitsbeauf-tragter tätig.
>>> auf Seite 19
Kontrolliert RRO: Schrottis unterstützen Kampfmittelräumdienst bei Blind-gängersuche im Stichkanal. Bislang wurde nur eine Panzerfaust ent-deckt und entschärft.
>>> auf Seite 21
KuRznewS

glück auf · 1/2016 ............ 3
GMH Gruppe
3. Health & Safety Day Am Donners-tag, den 28. April 2016, findet auf der ganzen Welt der „World Day for Safety and Health at Work“ statt – also der Jah-restag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Initiiert wurde er 2014 von der Welt-Stahl-Vereinigung (World Steel Association). Man wollte damit auf die fünf weltweit am häufigsten auftretenden Unfallursachen hinweisen, damit Unternehmen entsprechende Gegen-maßnahmen treffen können: Unfälle durch bewegliche Maschinenteile, Stürze aus hoher Höhe, herabfallende Gegenstände, giftige Gase und sich bewegende Krane bzw. Lasten an Kranen. Unternehmen nutzen den Health & Safety Day natürlich ebenfalls dazu, auf andere Unfallursachen aufmerksam zu machen oder auch diver-se Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen durchzu-führen.
Gesund und sicher arbeitenGut für die Mitarbeiter. Gut für das Unternehmen.
unser Ziel ist der unfallfreie Betrieb. Einen hohen Stellenwert hat auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Im Einklang
mit dem „Health & Safety Day“ der Welt-Stahl-Vereinigung werden wir als Gruppe ein klares Bekenntnis abgeben, dass si-cheres und gesundes Arbeiten Teil unserer Unternehmenskultur ist.
Um dies zu verdeutlichen, wird am 28. April an allen Stand-orten ein Arbeitssicherheits- und Gesundheitstag stattfinden. Alle Mitarbeiter sind zur aktiven Teilnahme aufgerufen. Hohe Standards der Arbeitssicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sind Top-Themen im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensführung.
Sicherheit geht vor „tonnen kloppen“
„Nichts ist wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit unse-rer Mitarbeiter“, so lautet das oberste Prinzip der Welt-Stahl-Vereinigung. Diesem Leitwert fühlen wir uns verpflichtet, nicht nur in sonnigen Zeiten. Ich füge hinzu: Arbeitssicherheit geht auch vor „Tonnen kloppen“, da gibt es gar kein Vertun. oder anders gesagt: Weniger krankheits- und unfallbedingte Fehlzeiten sind ein Beitrag zu mehr Sicherheit des Arbeitsplat-zes durch größeren wirtschaftlichen Erfolg. Gut für die Mit-arbeiter, gut für das Unternehmen.
Mehr Arbeitssicherheit und höhere Produktivität sind kein Gegensatz, sondern bedingen einander. Prävention von Ver-letzungen und Krankheiten verschafft uns einen Wettbewerbs-vorteil. Es geht um unser grundsätzliches Verständnis, wie wir Geld verdienen wollen. Klar: so ertragsstark wie möglich, weil davon nicht zuletzt unsere Investitionsfähigkeit abhängt – aber nicht auf Kosten der Mitarbeiter.
Wir wollen als Gruppe wahrgenommen werden, die es sich auf die Fahne geschrieben hat, Gesundheit und Leistungsver-mögen ihrer Mitarbeiter zu erhalten und zu fördern.
Etwa 560 Millionen Fehltage fallen jährlich in Deutschland an. Nach Berechnungen des Bundesamtes für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin werden dadurch Produktionsausfälle von 59 Milliarden Euro verursacht. Grund genug, sich der harten ökonomischen Aufgabe zu stellen, Krankheit und Unfälle prä-ventiv anzugehen.
Gesunde und produktive Arbeitsbedingungen
Richtig ist: Unsere Betriebe sind keine Wellness-oasen. Hier pumpt der Herzmuskel der deutschen Industrie. Und wir können stolz sein, in Zeiten der Globalisierung am Standort Deutschland wettbewerbsfähige Arbeitsplätze mit Leiden-schaft, Hirn und Hand zu sichern.
Hitze, Staub und Lärm lassen sich minimieren, aber kom-plett weg kriegen wir sie nicht. Auch die Schichtarbeit können wir nicht aus der Welt schaffen. Umso wichtiger ist es, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass unsere Mitarbeiter gesund und produktiv das gesetzliche Rentenalter erreichen können.
Im vergangenen Jahr haben sich in unserer Gruppe mehr als 300 meldepflichtige Unfälle ereignet – von den nicht-melde-pflichtigen oder Beinahe-Unfällen ganz zu schweigen. Das sind 300 Unfälle zu viel. „Keine Arbeitsunfälle!“ – das darf nicht die Ausnahme bleiben, sondern muss zur Regel werden. Die Philo-sophie, die dahinter steckt, lautet: „Jeder Unfall ist vermeid-bar.“ Das ist unsere Richtschnur.
Die höchsten Unfallzahlen melden die Gießereien – ein Sek-tor, der von schwerer, personalintensiver und handwerklicher Arbeit geprägt ist. In der Stahlerzeugung finden wir Unter-nehmen, bei denen die Sicherheit der Arbeitsplätze bereits in die DNA übergegangen ist. Bei anderen ist noch viel Luft nach oben. Die guten und erfolgreichen Beispiele in der Gruppe werden Ansporn sein, den Abstand zu verringern.
null-unfall-Strategien verankern
Die Anzahl der Arbeitsunfälle ist auch ein Gradmesser für die Qualität der Arbeitsabläufe. Anzahl und Art der Arbeitsunfälle stehen in direktem Zusammenhang mit der organisation der Produktion und dem Arbeitsverhalten. Arbeitsunfälle sind ein Symptom für Probleme in der Produktion. Eine Null-Unfall-Strategie kann logischerweise kontinuierliche Verbesserungs-prozesse ergänzen.
Im vergangenen Jahr hat die Holding die Entwicklungen in der Arbeitssicherheit stärker in den Blickpunkt genommen. Die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sind geklärt. Unser Ziel ist, Null-Unfall-Strategien an allen Standorten dauerhaft zu verankern:
Harz Guss Zorge ist schon lange am Ball. Am Standort Gröditz wurde ein Projekt aufgelegt, das neue Impulse zur Verbesserung des Unfallgeschehens setzen soll. Der Steuer-kreis „Gesundheitsmanagement“ wurde um die Kompetenz „Arbeitsschutz“ erweitert. Unabhängig davon tagt der bewähr-te Arbeitskreis „Arbeitssicherheit“ weiterhin zweimal im Jahr.
Wir wollen die beste Praxis in der Gruppe identifizieren und Möglichkeiten eröffnen, sich intensiver über Ursachen bestimmter Entwicklungen und Problemlösungen auszutau-schen. So bündeln wir Fachkompetenzen und bringen Projekte voran, die unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern.
zur nachahmung empfohlen
Auch im Gesundheitsmanagement ist die Weitergabe von guten Beispielen inzwischen eingespielt. Nachahmung emp-fohlen. Jahreszeitlich geprägte Quartalsaktionen begleiten den Prozess. Noch sind wir in der Phase, „gute Vorsätze“ in die Tat umzusetzen.
Einmal jährlich werden die Gesundheits-Awards der GMH Gruppe vergeben: Der „Rote Apfel“ für dauerhaft wirksame Aktionen und die „Grüne Birne“ für besonders einfallsreiche Maßnahmen. Die Apfel- und Birnen-Trophäe für die beiden Preise werden übrigens in unserer Friedrich Wilhelms-Hütte gegossen.
Seminare zum Thema Gesundheit sind feste Bestand-teile des Weiterbildungsprogramms der BGG. Beispiele sind „Gesund mit Wechselschicht“, „Gesunder Rücken“ oder auch „Positiver Umgang mit Stress“.
Stress ist ein Stichwort, mit dem wir uns intensiver auch im Rahmen der Gefährdungsbeurteilungen befassen müssen. Im Geschäftsbereich Rohstoff Recycling wurden psychische Belastungen und Methoden, wie man sie vermeiden kann, frühzeitig aufgegriffen. Studien zufolge sind 50–60 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage durch arbeitsbedingten Stress und psychosoziale Risiken bedingt.
Psychische Erkrankungen führen inzwischen die Statistik der Erwerbsminderungsrenten an. Nach Angaben der Ren-tenversicherung sind es mehr als 40 Prozent. Der Abstand zu körperlichen Ursachen wächst. Was früher hinter unspezi-fischen Beschwerden verborgen wurde, wird heutzutage offen benannt. Abgesehen vom Leidensdruck der Betroffenen müs-sen wir auch den Auswirkungen auf Produktivität und Innova-tionsfähigkeit mehr Aufmerksamkeit schenken.
Vom Start weg (selbst-)verantwortlich
Im Idealfall beginnt die Wachsamkeit für Fragen der Arbeits-sicherheit und der gesunden Lebensweise natürlich bereits in der Ausbildung. Die Zeichen der Zeit haben auch die Schmie-dewerke Gröditz erkannt: Sie nehmen vom Start weg die Jugendlichen in die (Selbst-)Verantwortung. Für diese Maßnah-me werden sie mit dem Roten Apfel 2015 ausgezeichnet.
In der GMHütte ist ein Ersthelferkurs im ersten Ausbildungs-jahr Pflicht. Im zweiten Modul stehen die Themen Ernährung, Bewegung und Fitnesscheck auf dem Plan. Im dritten Modul werden die Auswirkungen der Schichtarbeit, Ergonomie, Ent-spannung und ein Aktivprogramm einbezogen. Kein Wunder, dass die Hütte in der champions League spielt.
Die Gestaltung des „Health & Safety Day“ ist frei von Vor-gaben und wird sich auch an den betriebsspezifischen Erkennt-nissen zu Unfall- und Krankheitsschwerpunkten orientieren. Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und Integrationsämter sind unsere Partner bei der Vorbereitung des Tages und in der täglichen Arbeit. Die Bandbreite der Gesundheitsaktionen reicht von der Augendiagnostik über Rückenschulungen bis hin zur Venendruckmessung. Der Tag soll uns auch Erkenntnis-se liefern, welche Prioritäten zukünftig gesetzt werden müssen.
Es wird eine Vielzahl von Mitmachaktionen und praktischen Übungen geben: Brandschutzübungen, Fahrverhaltenstraining, Absturzsimulationen und anderes mehr. Dabei wird Wert auf anschauliche und interaktive Maßnahmen gelegt, die auch den Teamgeist stärken.
Vom Wollen zum Können kommen wir im Arbeits- und Gesundheitsschutz nur, wenn es klar zugewiesene Verantwort-lichkeiten, Bewertungen der Risiken, Ziele, Planung, Regelmä-ßigkeit, Prozesse und Verbindlichkeit gibt.
Über das Bohren dicker Bretter
Die Integration von Gesundheitsaspekten, Sicherheit und Ergo-nomie fängt bereits bei der Konzeption neuer Arbeitsplätze an. Es geht weiter mit regelmäßigen Betriebsbegehungen der Geschäftsführung, Null-Toleranz gegenüber Regelverstößen, angemessener Sicherheitsausrüstung und Konsequenzen aus Unfallanalysen.
Sichere Arbeitsplätze zu gestalten, Verhaltensänderungen dauerhaft zu bewirken, gefährliche Routinen gar nicht erst auf-kommen zu lassen: Das ist immer wieder das beharrliche Boh-ren dicker Bretter.
So anerkennenswert das Engagement unserer Sicher-heitsfachleute ist: Unmittelbare Verantwortung tragen die Geschäftsführungen vor ort, und sie sind die Treiber des Geschehens. Das Engagement für Arbeitssicherheit muss für jede Führungskraft und für jeden Mitarbeiter selbstverständlich sein. Auch die Betriebsräte sind bei allen Projekten gefragt. Sie haben den Finger am Puls der Beschäftigten und sind wichtige Multiplikatoren.
machen Sie mit!
Nicht zuletzt die Mitwirkung unserer Eigentümerfamilie wird dem Tag noch mehr Gewicht und Schwung verleihen. Aber auch die Geschäftsführung der Holding wird sich an ausge-suchten Standorten ein Bild von den Aktivitäten machen. Die-ser Tag soll auch ein Umdenken in den Köpfen bewirken. Der Kopf ist ja bekanntlich rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Sicheres und gesundes Arbeiten ist ein Grund-pfeiler unseres Werteverständnisses – das ist die Botschaft.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es ist nie zu spät, achtsamer mit seiner Gesundheit umzugehen, das Risikobe-
wusstsein zu schärfen, sich gesünder zu ernähren, sich mehr zu bewegen, schlechte Gewohnheiten abzulegen.
Lassen Sie sich am „Health & Safety Day“ inspirieren! Machen Sie mit! Bleiben Sie gesund!
Ihr
LEITARTIKEL
Harald Schartau Werksfoto

glück auf · 1/2016 ............ 4
GMH Gruppe
Von 1.520 auf 1.435 mmUnd so funktioniert ein automati-scher Spurwechsel von Breit- auf Normalspur in einer Spurwechsel-Anlage: Die Waggons laufen über eine Zwangsführung (von Breit- auf Normalspur-Breite). Dabei werden die axialen Verriegelungen der Räder auf der Radwelle gelöst und die Räder auf die neue Spur-breite verschoben. Eine integrierte Druckfeder sorgt dafür, dass die Räder dann in der neuen Position verriegelt werden.
Spurwechsel im Sauseschritt BVV werk ilsenburg · Schnellerer Grenzverkehr zwischen Georgien und der Türkei: Spurwechsel-Radsatz vom BVV-Werk Ilsenburg ermöglicht reibungslosen Wechsel von Breit- auf Normalspur – und umgekehrt.
D ie Bahnverwaltungen von Georgien und Aserbaidschan
wollen auf der Bahnstrecke zwi-schen Achalkalaki (Georgien) und Kars (Türkei) ein neues Kapitel Bahngeschichte schreiben: Zukünf-tig sollen Personenzüge ohne zeit-raubenden Radsatzwechsel die tür-kische Grenze passieren können. Von dort aus geht es dann in Rich-tung Istanbul, Ankara oder andere Städte der Türkei weiter.
Hintergrund: In Georgien und Aserbaidschan ist die sogenannte Breitspur (1.520 mm), in der Tür-kei die sogenannte Normalspur (1.435 mm) die Norm. Das bedeu-tete bislang: Man musste in Achal-kalaki bei jeder Grenzüberquerung die Drehgestelle mit den Radsätzen austauschen – eine zeitraubende, technisch aufwendige und kos-tenintensive Prozedur. Sie bean-spruchte große Lagerkapazitäten für Drehgestelle mit den Radsätzen und band auch Kapital für die Be-treiber der Bahnen.
Seit die drei Länder im Jahre 2007 Vereinbarungen zum Stre-ckenneubau unterschrieben haben, denkt man auch über einen auto-matischen Radspurwechsel nach. Dementsprechend hat man jetzt mit der Schweizer Firma Stadler Busnang AG einen Vertrag zur Flot-ten-Neuausrüstung abgeschlossen. Dabei geht es um Personen- und Schlafwaggons, die auf den geplan-ten bzw. bereits ausgebauten Lang-strecken anlaufen sollen. Die neu-en Waggons sollen nicht nur die betagten Modelle aus Unionszeiten ablösen. Sie sollen auch modernen Komfort bieten und merklich die Reisezeit verkürzen.
Die Eisenbahn-gesellschaft von Aser-baidschan hat für 120 Mio. Schweizer Franken die ersten drei Züge mit jeweils zehn Wagen be-stellt. Sie sollen bis spätestens 2018 in Dienst gestellt werden. Bestückt werden sie mit DBAG/RAFIL Typ V aus Ilsenburg, einem patentrecht-lich geschützten reinen Spurwech-selradsatz für Güterwagen. Für die Waggons hat der BVV den Radsatz nochmals modernisiert. Er ist nun mit leisen Wellenbremsscheiben statt mit lauten Klotzbremsen aus-gestattet.
Um die neue Technik zu demonstrieren, trafen sich An-fang 2016 alle beteiligten Partner des Zugherstellers und der Bahn-verwaltungen aus Georgien und Aserbaidschan im BVV-Werk Ilsen-burg. Dort demonstrierte man ein-drucksvoll die Wirkungsweise des Radsatzes im Drehgestell auf seiner Spurwechsel-Anlage.
Auch wenn das Wetter sich nicht von der sonnigen Seite zeig-te: Die Technik hielt ihr Verspre-chen. Mittlerweile sind bereits 44 dieser Radsätze für den ersten Zug ausgeliefert.
em
Günter Köhler erläutert an den Baugruppen die Wirkungsweise der patentierten mecha-nischen Verstellung der Räder.
Foto: Matthias Schwartze
Partner des Zugherstellers und der Bahnverwaltungen aus Georgien und Aserbaidschan beobachten die Wirkungsweise des Radsatzes im Drehgestell auf der Spurwechsel-Anlage in Ilsenburg. Foto: Hagen Döbelt
Das Schienennetz im Überblick
Derzeitige Strecke
Geplante Zusatzstrecke
Georgien
Aserbaidschan
türkei
Kars
Achalkalaki Tiflis
AgstafaGenze
Rustawi
Iran
Armenien

glück auf · 1/2016 ............ 5
GMH Gruppe
SchAufenSteR
„Buckle up!“energietechnik essen · Kappenringe halten 3.600 Umdrehungen pro Minute unter Kontrolle.
Buckle up!“ – übersetzt: „Sicher-heitsgurt anlegen!“ Genau diese
Funktion übernehmen Kappenringe – und werden so zum am höchsten beanspruchten Bauteil eines Turbo-generators.
Elektrische Energie wird heute fast ausschließlich mit rotierenden Stromerzeugern erzeugt, sogenann-ten Generatoren. Der weitaus größ-te Teil des in Generatoren erzeugten Stromes stammt aus Turbogenera-toren. Sie laufen in der Regel mit 3.000/3.600 Umdrehungen pro Minute (entspricht 50/60 Umdre-hungen in der Sekunde).
Das rotierende magnetische Feld wird durch Wicklungen mit wech-selnder Polarität erzeugt, die durch Gleichstrom erregt werden. Die Wicklungen treten aus den Längs-nuten des Rotors an den Ballen-enden aus und bilden dort den Wicklungskopf, der gegen die Flieh-kraft gesichert werden muss.
Die Kappenringe werden in den meisten Fällen fliegend auf die Ballenenden der Läuferkörper aufgeschrumpft und mit einer Art Bajonettverschluss gegen Dreh- und Axialbewegungen gesichert. An der dem Ballen abgewandten Seite ist in vielen Fällen ein Stützring in den Kappenring eingeschrumpft, der die in Längsrichtung wirkenden Kräfte der Wicklungsköpfe aufnimmt.
Die Entwicklung immer größerer Leistungseinheiten führt zu einer
wachsenden Beanspruchung der Kappenringe. Es werden daher höchste Anforderungen an diese Ringe und damit auch an deren Fertigungstechnik gestellt. Der Werkstoff, aus dem Kappenringe hergestellt werden, muss daher eine Reihe von Forderungen erfül-len bzw. bestimmte Eigenschaften mit sich bringen:• Hohe Streckgrenze• Ausreichende Kalt- und Warm-
formungseigenschaften
• Eine nicht zu geringe Wärme-ausdehnung
• Nichtmagnetisierbarkeit • Korrosionsbeständigkeit.
Die Energietechnik Essen hat einen entsprechenden Werkstoff entwickelt: den stickstofflegierten Stahl P900 (Werkstoffnummer/DIN-code: 1.3816, ASTM A 289, class c). Er gilt als aktueller Mate-rialstandard für diese Anwendung.
Jörg Schulze
EinsatzTurbogeneratoren (von 10 t bis zu über 200 t Gewicht)
Herstellverfahren• Bis zu 6.000 t Presskraft des
Einzelaggregates „Aufweite-presse“
• Über 200 Einzel-Aufweite-schritte vom Schmiederohling bis zum fertigen Kappenring
• Kalt-Aufweitung bei Raum-temperatur
Maße & Gewichte• Durchmesser bis 2.200 mm• Gewicht bis etwa 4,3 t
Material• Hochlegierter, stickstoff-
haltiger Stahl P900 • „State of the Art“ • Entwickelt von der Ener-
gietechnik Essen GmbH
zum themA : KVP
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess in der Division Stahl
Breite masse einbindenP rozesse und Strukturen kontinuierlich zu
verbessern und zu optimieren, gehört in den Mitgliedsunternehmen der GMH Gruppe zum Alltagsgeschäft. Demnach ist die Ein-führung eines gruppenweiten KVP, das von der Holding 2015 initiiert wurde und seitdem von ihr begleitet wird, keine neue Erfindung. Schließlich verlangt sogar die Qualitätsma-nagement-Norm DIN EN ISo 9001, dieses Werkzeug anzuwenden.
Dennoch stellt diese Einführung die KVP-Beauftragten vor neue und ungeahnte Heraus-forderungen. Denn bis vor Kurzem reichte es noch aus, kontinuierlich besser zu werden und die Wirksamkeit getroffener Maßnahmen zu überprüfen. Welchen Weg man dabei ging, lag in der Verantwortung der Projektleiter oder KVP-Beauftragten.
Neu ist die Anforderung, das Verbesse-rungspotenzial in definierten Kennzahlen und als geldwerten Vorteil genau auszuweisen – und dieses der GMH-Holding monatlich zu berichten. Damit steigen die Anforderungen, wenn man ein KVP-Projekt durchführt und dokumentiert. Deshalb werden die KVP-Beauf-tragten entsprechend geschult.
Das detailgenaue Nachhalten der Kenn-zahlen führte übrigens zu aufschlussreichen Erkenntnissen: Auch kleine und unscheinbare Ideen und Projekte können erhebliche Einspar-potenziale in sich bergen. Sogar psychologi-sche Faktoren spielen eine Rolle: So wirkt ein eingesparter Betrag in Euro, den man schwarz auf weiß vor sich sieht, als Ansporn, kontinu-
ierlich nach weiteren Verbesserungsmöglich-keiten zu suchen.
Will man das volle Potenzial der organisier-ten kontinuierlichen Verbesserung ausschöp-fen, muss man eine möglichst breite Masse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesen Prozess einbinden, und zwar auf allen Führungsebenen. Grundlage für eine kontinu-ierliche Verbesserung ist dabei der PDcA-Zy-klus, dessen praktische Umsetzung allerdings nicht so leicht ist.
Der folglich nächste Schritt ist eine inten-sive Schulung und Motivation der führenden Mitarbeiter, sich des Themas intensiv anzuneh-men. Im Stahlwerk Bous wurde dies mit einem umfangreich angelegten KVP-Kickoff-Meeting in die Wege geleitet. Dies kann jedoch nur der Anfang der Motivation und Schulung gewesen sein, wenn der Kontinuierliche Verbesserungs-prozess in dieser Form nachhaltig sein soll.
Dr. Lutz Dekker
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess in der Division Bahntechnik/Guss
zDf-Analyse einbeziehenDer Kontinuierliche Verbesserungsprozess
ist bei Walter Hundhausen eine bereits lange gelebte Unternehmenspraxis. Ansonsten hätte das Unternehmen keine chance, am Markt zu agieren und zu bestehen. Allerdings wurden die Maßnahmen in der Vergangenheit nie unter der Flagge des „KVP“ umgesetzt. In Schwerte liefen sie unter den Bezeichnungen „optimierung“ oder „Prozessverbesserung“.
Projekte wie die Taktzeitoptimierung in der Formerei hat ein Team realisiert, das aus
Stör-Ereignissen diverse Maßnahmen abge-leitet und umgesetzt hat – Maßnahmen, die zu einer Stabilisierung und Beschleunigung des Prozesses führten.
Im Schmelzbetrieb wurden ebenfalls zahlreiche Prozesse optimiert, um Qualität, Energieeinsatz und Ausbringen ständig zu verbessern – was zudem die Betriebskosten verringerte. Beispielhaft genannt seien hier das prozessnahe Labor, die Verbesserung der Fahrwege für Flüssigeisen transportierende 16-t-Stapler und die Dauermessung der Eisentemperatur in der Vergießeinrichtung.
Unter KVP soll nun die bei Walter Hundhau-sen gelebte Kultur des ständigen optimie-rens und Verbesserns fortentwickelt werden. Dazu gehört auch, das kritische Hinterfragen bereits optimierter Prozesse und alltäglicher Vorgänge zu systematisieren. Nur so können die Prozesse dauerhaft perfektioniert und die Kosten gesenkt werden.
Die Betrachtung und Bewertung dieser Vorgänge erfolgt wie bereits in der Vergan-genheit anhand von Kennzahlen. Dabei kann man nur mit einer ZDF-Analyse (gemeint sind damit Zahlen, Daten und Fakten) den tatsächlichen Erfolg der umgesetzten Maß-nahmen erfassen bzw. nachweisen. Diese Analyse erhöht die chance, falsche Schluss-folgerungen größtenteils auszuschließen.
Kai Kmieciak
PDcA-zyklus: Prozesse auf Verbes-serungspotenziale prüfen, bewerten und Änderungen detailliert planen (Plan), umsetzen – meist im kleinen Maßstab oder als Versuch (Do) –, die Wirksam-keit der Maßnahmen prüfen (check), bei Erfolg breit umsetzen und als Standard festschreiben (Act). Danach beginnt der Zyklus wieder von vorn. Foto: © panthermedia.net/gustavofrazao
Sicherheitsgewährleistung• Absolute Rissfreiheit• Keine Einschlüsse• Nachweis der Festigkeiten und gleichzeitig
Elastizität

glück auf · 1/2016 ............ 6
GMH Gruppe
ohne einheitliche Regelnkein vernünftiger wettbewerbChinesischer Stahl zu Dumpingpreisen flutet Europa: Wie soll die deutsche Stahlindustrie im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig und „grün“ bleiben? Entwicklung auf dem globalen Stahlmarkt wirft Grundsatzfragen auf.
D eutsche und europäische Stahlhersteller stehen der-zeit mächtig unter Druck. Auch noch so innovative
Lösungen für eine kostengünstige-re Produktion können die Wettbe-werbsvorteile chinesischer Stahl-werke nicht wettmachen. Denn im Land der Mitte sind zumindest in Teilen die Umweltstandards erheb-lich niedriger als in Deutschland – was dort eine entsprechend kosten-günstige Produktion ermöglicht.
An den deutschen Umweltstan-dards hingegen ist nicht zu rütteln. Da stellt sich die Frage, wie man konkurrenzfähig und „grün“ blei-
ben kann, ohne wirtschaftlich in Schieflage zu geraten und wie man die globalen Un-gleichheiten einebnen könn-te. Die „grüne Komponen-te“ spielt in der Tat in der deutschen Stahlindustrie mehr denn je eine Schlüs-selrolle. Das mag auf den
ersten Blick überraschen. Schließ-lich hat die Stahlproduktion, was Energieverbrauch und Auswir-kungen auf das Klima betrifft, ein schlechtes Image. Denn die pri-märe Stahlerzeugung aus Eisenerz – und dies steht ohne Frage fest – ist ressourcen-intensiv und klima-belastend und hinterlässt einen beachtlichen ökologischen Foot-print.
Auf den zweiten ist solch eine Einschätzung nicht zu halten. Es stimmt schon: Die Rohstahlgewin-
nung aus Eisenerz als Vormaterial (Primärroute) erzeugt einen vier-fach höheren CO2-Ausstoß (Abb. 1) als die Stahlwiedergewinnung im
Recyclingverfahren aus Schrott. Richtig ist aber auch, dass
Stahl ohne Qualitätsverlus-te recycelt und zu neuen
Produkten verarbeitet wird. Dass Stahl- und Eisenschrott der
Werkstoff ist, der am meisten recy-celt wird. Und das alleine dadurch, dass Stahlprodukte am Ende ihrer Nutzung immer wieder im Recyc-lingprozess enden, jährlich mehr als eine Milliarde Tonnen Primär-rohstoffe eingespart werden.
Die Stahlerzeugung aus Schrott, wie sie in den Stahlwerken der GMH Gruppe praktiziert wird, ist solch ein Beispiel effektiven Roh-stoffrecyclings. Und so kursiert Stahl in einem kontinuierlichen Kreislauf aus Produktion, Verwen-dung, Aufbereitung und Wieder-verwertung (Abb. 2). Ökologisch gesehen kann Stahl deshalb perma-nent punkten. Im Klartext: Quelle: Stahl-Zentrum, Düsseldorf, 2009
Stahl wird nicht verbraucht, Stahl wird benutzt.
Die EU muss bestehende Spielräume voll ausschöpfen.
IM FOKUS: GlObAleR StAHlMARKt
2
Que
lle: W
V S
tahl
Kurze Lebensdauer
Mittlere Lebensdauer
Lange Lebensdauer
Wertstoffkreislauf
Kohle
Koks
Hochofen
Konverter
Anteil: 68 % 31,2 mio. t 32 % 14,6 mio. t
1800 kg/t RSt
360 kg/t RSt
Schrott 15,1 Mio. t
DRI 0,5 Mio. t
Heißwind 02
02
Roheisen (28,2 Mio. t)
Schrott (5,6 Mio. t)
Öl, Gas oder Kohle
Pellets
Elektrolicht- bogenofen
Sinter
Stückerz Feinerz
Eisenerz
Spezifische co2-emission:
Rohstahl
Abb. 1
Abb. 2
2
Que
lle: W
V S
tahl
Kurze Lebensdauer
Mittlere Lebensdauer
Lange Lebensdauer
Wertstoffkreislauf

glück auf · 1/2016 ............ 7
GMH Gruppe
• Mit jedem neuen Lebenszyklus sinken Emissionen und Energie-verbrauch – wodurch sich der ökologische Fußabdruck step by step verkleinert (Abb. 3). Bezo-gen auf seinen gesamten Lebens-zyklus schneidet Stahl deutlich besser ab als andere Werkstoffe. Durch dieses Multi-Recycling las-sen sich bereits bei sechs Recyc-lingzyklen aus einer Tonne Stahl mehr als vier Tonnen Stahlpro-dukte herstellen.
• Das Recyceln verbraucht nur ein Drittel der Energie, die für die Stahlerzeugung aus Erz und Koh-le aufgewendet werden muss. Eine Studie der Boston Consul-ting Group und des Stahlinstituts VDEh errechnet, dass durch den Einsatz von Stahl in hochinno-vativen Verfahren am Ende sechs Mal so viel CO2 eingespart wird, wie zu seiner Herstellung freige-setzt wurde (Abb. 4).
• Allein seit 1990 hat die deutsche Stahlindustrie die CO2-Emissio-nen um fast ein Fünftel gesenkt. Das ist beachtlich. Damit sind die europäischen Stahlhersteller Vorreiter in der Welt. Sie setzten global die höchsten Umweltstan-dards (Abb. 5).Bleibt die weit geöffnete Sche-
re zwischen den Klimapionieren und den Klimanachzüglern, sprich zwischen europäischen Stahlpro-duzenten und der Konkurrenz aus China oder auch den USA. Diese Schere ist umweltpolitisch kon-traproduktiv und wirtschaftlich schädlich – was sich ganz einfach nachvollziehen lässt.
Die Stahlindustrie ist internatio-nal, konkurriert miteinander auf globaler Ebene. Ungleicher Um-
gang mit Umweltstandards führt zu ungleichen Produktionsbe-dingungen, ungleichen Kostenbe-
lastungen – und folglich zu Wett-bewerbsverzerrung. Die Folgen für die deutsche bzw. europäische Stahlwirtschaft:
Erstens werden die hohen deut-schen Standards konterkariert, in-dem Industrieproduktion in Län-der abwandert, in denen weniger hohe Umweltauflagen gelten.
Zweitens fluten die chinesischen Unternehmen den deutschen wie
europäischen Markt mit Stahl zu Dumpingpreisen, da sie als über-wiegend staatliche Unternehmen keine kostendeckenden Preise an-bieten müssen. Sie laden ihre Über-kapazitäten auf dem EU-Markt ab (Abb. 6).
Und drittens kommen dadurch 4,2 Mio. Tonnen CO2 als ökologi-scher Rucksack mehr nach Europa, als wenn dieselbe Menge hier pro-duziert worden wäre.
Doch wir haben nur diese eine Welt. China ist noch keine Markt-wirtschaft. Nur unter gleichen Wettbewerbsbedingungen kann man sich zukünftig auf Augenhö-he begegnen. Nur unter gleichen Wettbewerbsbedingungen kann man die technische Messlatte im-mer höher legen. Kurz: Ohne ein-heitliche Regeln wird es keinen fai-ren Wettbewerb geben.
Wie dringend solch ein Aus-gleich wäre, zeigt ein Blick auf die dramatischen Entwicklungen auf den Stahlmärkten. Das inter-nationale Wettbewerbsumfeld ist in einem Umfang verzerrt, wie es die Stahlindustrie bislang noch nicht erlebt hat. Selbst die so wett-bewerbsfähige Stahlindustrie in Deutschland stößt an ihre Gren-zen.
Das lässt sich auch eindeutig mit Zahlen belegen: Die globalen Stahlexporte, so Hans Jürgen Kerk-hoff (Präsident der Wirtschaftsver-einigung Stahl), sind im vergange-nen Jahr auf ein Rekordlevel von 355 Millionen Tonnen gestiegen. Dabei kam nahezu jede dritte Ton-ne aus China. Während China sei-ne Stahlexporte in den letzten drei Jahren auf 111 Millionen Tonnen verdoppelt hat, hat der Rest der
Stahlwelt seine Exporte um 20 Mil-lionen Tonnen gedrosselt. Zudem bieten die Chinesen ihr Material zum großen Teil zu Dumpingprei-sen an.
Der europäi-sche Stahlmarkt ist ein offener Stahlmarkt – und deshalb besonders bedroht. Dies be-legen die gestie-genen Importe 2015. Die Expor-te dagegen sind deutlich zurückge-gangenen als Fol-ge von Verdrän-gungseffekten auf den internationa-len Märkten. Bei-des zusammen er-gibt einen alarmierenden Befund: Die EU musste wie kein anderes Land eine drastische Verschlechte-rung im Stahl-Außenhandelssaldo hinnehmen: minus 9 Millionen Tonnen. In der gleichen Zeit konn-te China ein Plus von 20 Millionen Tonnen verbuchen.
Was aber macht die EU so ver-letzlich? Die Ursache, so Kerkhoff, sei unter anderem die „Regel des geringsten Zolls“ (lesser duty ru-
le). Sie führe häufig dazu, dass die Schutzzölle in der EU niedriger sind als in anderen Ländern – und die Dumping-Marge nicht ausglei-
chen können. Doch wer
schreibt solch eine nachteilhafte Re-gel den Europäern eigentlich vor? Weder die Welt-handelsorganisa-tion noch andere Institutionen. Von anderen Indust-rienationen wird sie ebenfalls nicht praktiziert. Die EU sollte sie schnellst-möglich wieder abschaffen und ihre bestehenden
Spielräume voll ausschöpft. Dies gilt auch für Verfahrenszeiten. Sie müssten auf ähnliche Zeiträume verkürzt werden wie in den Ver-einigten Staaten.
Die Dumping-Marge lässt sich übrigens auch ökologisch definie-ren: Eine Tonne Stahl wird in Chi-na durchschnittlich mit rund 40 Prozent mehr CO2-Emissionen pro-duziert als in Europa.
ikw
5
CO2-EMISSIONEN DER SECHS GRÖSSTEN EMITTENTEN (1990 BIS 2014 IN MIO. T)
VoRAuSSichtlich weRDen 2015
7 mio. twAlzStAhl AuS chinA in Die eu imPoRtieRt
DAmit Kommen AlS öKoloGiScheR RucKSAcK
4,2 mio. t co2mehR in Die eu, AlS wenn DieSelBe menGe DoRt PRoDuzieRt woRDen wäRe
co2 – emiSSionenBei PRoDuKt DieSeR menGe
in der eu28
9,7 mio. tin china
13,9 mio. t
2,1 mio.DAS entSPRicht JähRlich Dem co2-AuSStoSS Von RunD
mittelKlASSe- PKw
3
Multi-Recycling-Ansatz (MRA)
MRA6 Lebenszyklen
EO-Route
740999
1.724
MRAKonverterEO-Stahlwerk
KoksofenWarmwalzenWarmwalzstraßen
SinterKWGutschriften
HOAbwasserTotal
HO-RouteQue
lle: A
bbild
ung
8: D
arst
ellu
ng d
er T
reib
haus
gase
mis
-si
onen
(GW
P10
0-C
ML2
001)
GWP 100 years [kg CO2-Äqv.]
Que
lle: P
rof.
Fink
bein
er T
U B
erlin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0
500
1500
2000
kg CO²-Äqv.
Selbst bei konservativer Rechnung mit nur 6 Lebenszyklen
Reales Treibhausgaspotential
< 1 t CO2-Äq. / t Stahl
1000
4
Innovative Stähle sparen sechsmal soviel CO2 ein, wie ihre Produktion verursacht
29,5 %
14,2 %
9,2 %
5,0 %
2,1 %
11,2 %
1,9 %
1,0 %
8,4 %
0,9 %
0,7 %
0,1 %
0,03 %
1,0 %
0,4 %
0,1 %
Gewichtsreduktion LKW
Effiziente E-Motoren
Effizientere Trafos
Weitere regen. Energien
Kraft-Wärme-Kopplung
Windkraftwerke
Effizienz foss. Kraftwerke
Gewichtsreduktion PKW
Que
lle: B
CG
, Sta
hl-Z
entr
um
Emissionen~12 Mio. t
Einsparpotenzial~74 Mio. t
Mit jedem neuen Stahl-Lebenszyklus sinken Emissionen und Energieverbrauch.
Abb. 3
Abb. 4
Abb. 5
Abb. 6
Stahl und emissionshandel.
Die EU hat eine drastische Verschärfung des Emissionsrechtehandels vor-geschlagen. Diese Reformpläne bedrohen die deutsche Stahlindustrie in ihrer Existenz, denn sie bedeuten eine Mehrbelastung von rund einer Mil-liarde Euro jährlich. Was mit der Reform des Emissionshandels noch auf die Stahlindustrie zukommt, zeigt das neue Video der Wirtschaftsvereini-gung Stahl. Im Video wird auch ein Vorschlag gemacht, wie man Effizienz belohnen und die Wettbewerbsfähigkeit erhalten könnte. Zu sehen auf YouTube unter: www.youtube.com/watch?v=LunoMXjYizc
Die große Schere zwischen Klimapionieren und Klimanachzüglern ist umweltpolitisch kontraproduktiv und wirtschaftlich schädlich.

glück auf · 1/2016 ............ 8
GMH Gruppe
wellenkunde Schmiedewerke Gröditz · TR-Schmieden
Beim TR-Verfahren können unter einer Vorrichtung, die
unter einer Schmiedepresse ein-gebaut ist, Kurbelwellen herge-stellt werden. Dabei wird aus einer Spindel jeder Hub der Kurbelwelle einzeln stauchgepresst. Der Vorteil gegenüber dem Freiformschmie-den besteht darin, dass die Schmie-dung der Hübe im Faserfluss ge-schieht, das bedeutet im Endeffekt: Die Wellen können höher belastet werden. Weiterhin ist der darauf-
folgende Bearbeitungsaufwand deutlich verringert (die minimale Schnittzugabe beträgt z. B. für den Typ 18V46 gerade einmal 36 mm). Die TR-Methode zum Schmieden von Kurbelwellen wurde von Prof. Dr. Tadeusz Rut erfunden und im Institut für Plastische Formgebung in Posen (Polen) entwickelt. Die Buchstaben TR stehen für die Ini-tialen des Erfinders.
Ralf Schreiber
Re iSet iPPS
380 statt 777-300 Neue Flugzeuge zwischen Düsseldorf und Dubai
emirates · Dubai–Düsseldorf mit Airbus A380: Mitte letzten Jahres landete erstmals ein Airbus A380 regulär am Flughafen Düsseldorf. Seither führt Emirates einen ihrer beiden täglichen Flüge zwischen der Basis in Dubai und der NRW-Haupt-stadt mit dem A380 durch. Ab dem 1. Juli wird auch der zweite Flug von der Boeing 777-300 auf den A380 umgestellt. Das Streckennetz von Emi-rates umfasst 150 Destinationen in 80 Ländern auf sechs Kontinenten.
eurowings · Streckenangebot ab Düsseldorf: Eurowings verbindet ab Ende März den Flughafen Düsseldorf mit dem East Midlands Airport in der Nähe von Nottingham. Die Strecke soll täglich außer samstags bedient werden.
lufthansa · Betreuung Eurowings-Langstreckenflotte: Die Langstre-ckenflotte der Eurowings wird nun von der Lufthansa Technik direkt an der Heimatbasis am Flughafen Köln/Bonn betreut. Eine entsprechende Vereinbarung gilt ab sofort für bis zu sieben Flugzeuge des Typs Airbus A330-200 der Airline. Eurowings ist derzeit mit zwei Langstreckenjets vom Typ Airbus A330 unterwegs; zudem wird eine Maschine der Tuifly über Eurowings vermarktet. Im April und Mai sollen zwei Airbus-Langstrecken-jets hinzukommen.
Diana Peter Foto: Senator Reisen
null unfälle mit Ausfalltagen Gmhütte · Bilanz 2015: Die Sensibilisierung der Mitarbeiter hat sich ausgezahlt. Arbeitssicherheit kann im Walzwerk großen Erfolg verbuchen.
i nteRV iew
Das Walzwerk der GMHütte kann in Sachen Arbeitssicherheit auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zu-rückblicken: Die Mannschaft hat keinen einzigen unfallbedingten Ausfalltag zu verzeichnen. Und auch die Zahl sonstiger Unfall- ereignisse ist sehr gering. glückauf sprach mit Dirk Möller (leiter Produktion Walzwerk) und Nor-bert Kölker (leiter Arbeitssicher-heit) über die erfolge.
glückauf: Keine Unfälle mit Ausfall-tagen im Walzwerk und insgesamt nur vier Unfallereignisse – wie ist die-ser Erfolg zu erklären?Dirk möller: Wir haben im Walz-werk in den letzten Jahren immer wieder Dinge angepasst, die uns aufgefallen waren: Gefährliche Be-reiche wurden eingezäunt und mit Schließsystemen versehen, Anzei-getafeln zeigen heute deutlich an, ob Anlagen laufen oder stehen, Ka-meras überwachen schwer zugäng-liche Maschinenbereiche, die Hal-lenbeleuchtung wurde optimiert, Stolperstellen beseitigt. Auch die Außenbereiche wurden angepasst und die Lager optimiert.norbert Kölker: Darüber hinaus haben die Kollegen von Walzwerk und Walzenwerkstatt die Sensibili-sierung für Arbeitssicherheit wei-ter vorangebracht. Neue Arbeits-sicherheitsbeauftrage haben sich
gemeldet. Zudem wurden immer alle Maßnahmen zusammen mit den jeweiligen Mitarbeitern vor Ort entwickelt. Und nicht zuletzt ist es auch dem persönlichen Enga-gement von Dirk Möller zu verdan-ken, dass die Zahlen so gut sind!
Was war wohl die wichtigste Maß-nahme?möller: Das Wichtigste ist und bleibt das miteinander Reden: Nur wenn jeder sagen kann und sagen möchte, wo er Gefahren sieht, nur wenn im gemeinsamen Gespräch potenzielle Unfälle besprochen oder aber auch wirkliche Ereignis-se reflektiert werden, dann wird Arbeitssicherheit auch gelebt. Hier-für hat das Walzwerk nicht nur einen eigenen Schulungsraum mit-ten in der Halle. Das Team nutzt auch kurze Gespräche auf den Leit-ständen dafür. Und natürlich ist darüber hinaus der Dialog mit den Instandhaltern und den Kollegen von der Arbeitssicherheit wichtig.
Gab es ein besonderes Arbeitssicher-heitsprojekt?Kölker: Vor vier Jahren hatten wir ein Projekt mit dem Ergonomie-labor der Hochschule Osnabrück im Walzwerk. Dabei wurden die Arbeitsplätze unter ergonomischen Aspekten besonders unter die Lu-pe genommen. Das war wirklich interessant und hat einen neuen Blickwinkel gegeben. Einige Plät-ze konnten wir entsprechend an-
passen – was auch die Kollegen zu schätzen wissen.
Was haben Sie sich im Walzwerk denn für 2016 vorgenommen?möller: Besser geht es ja kaum noch, das sagt eigentlich schon die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber natürlich wollen wir auch in diesem Jahr alles daran setzen, das erreichte Niveau zu halten. Des-halb setzen wir weiterhin alle Maß-nahmen – insbesondere die Sensi-bilisierung der Mitarbeiter – fort. Und wir werden mit den Kollegin-nen und Kollegen auch in Zukunft einen wachen Blick auf mögliche Sicherheitsverbesserungen im Be-trieb haben.
Wie sieht es denn für die gesamte GMHütte aus?Kölker: Auch die Gesamt-Bilanz der GMHütte ist sehr zufriedenstel-lend: Hatten wir 2014 noch 45 Un-fallereignisse mit insgesamt 1.077 Ausfalltagen, waren es im vergan-genen Jahr 50 Ereignisse mit ledig-lich 312 Ausfalltagen – also „nur“ fünf Unfälle mehr, aber zwei Drit-tel weniger Ausfall. Insgesamt gab es neun meldepflichtige Unfälle, also genauso viel wie 2014. Was al-lerdings auffällt: Die Zahl der We-geunfälle ist von zwei auf sieben deutlich gestiegen. Hier spielt die Witterung eine große Rolle. Hier ist also noch Luft nach oben.
Vielen Dank für das Gespräch.
BochumeR VeRein
Quelle: Ministerium
minister Dobrindt. Bundesminister Alexander Dobrindt präsentierte am 9. März auf einem Aktionsforum seine „Strategie Leise Schiene“. Dabei sollen
mit rund einer Milliarde Euro Innovationen in Schienen, Züge und Bahnstrecken gefördert werden, mit dem Ziel, den Schienenlärm bis 2020 zu halbieren. Eingeladen dazu hatte er ins Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur/Verkehrsministerium. Auf einer Begleitausstellung bot sich den Unternehmen der Bahnindustrie die Gelegenheit, Komponenten für einen besseren Lärmschutz im Bahnverkehr auszustellen. Die Bochumer Verein Verkehrstechnik (BVV) nutzte die chance, ein mit einem Radkappen-Absorber gedämpftes Güterwagenrad zu prä-sentieren. Diese aktuelle Entwicklung der Radspezialisten aus Bochum soll das Laufgeräusch von Güterwagen noch mal deutlich unter den Pegel senken, den „Flüsterbremsen“ erreichen können. Auch Alexander Dobrindt (links), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, konnte sich bei Martin Fehndrich (BVV) ausführlich über die Funktionsweise des Radkappen-Absorbers informieren.
Grundlage: Pressemitteilung BVMI
Jeder Hub der Kurbelwelle wird einzeln stauchgepresst. Werksfoto
HüllkreisAuch bei komplexen Wellen will man mit minimalem Materialeinsatz auskommen:
Dabei hilft die Geometriedatenbestim-mung des Hüllkreises, den Rohling nicht umfangreicher zu fertigen als
nötig: Beim Hüllkreis liegen extreme Messpunkte auf bzw. innerhalb eines
kleinstmöglichen Kreises.max. Zielform
Hüllkreis

glück auf · 1/2016 ............ 9
GMH Gruppe
Audit stellt Ausbildung auf äußerst harte ProbeGmhütte · Positives Beispiel für die Industrie: IHK Osnabrück nimmt Ausbildung unter die Lupe – und zeichnet Stahlwerk mit einem Siegel als TOP-Ausbildungsbetrieb aus.
Analysieren, hinterfragen, ver-bessern: Mit diesen Aspekten
hat sich die GMHütte in den ver-gangenen Monaten besonders in-tensiv befasst. Schließlich ging es darum, die hervorragende Qualität ihrer Ausbildung unter Beweis zu stellen.
Die Anstrengungen haben sich gelohnt. Denn das Stahlwerk nahm mit Erfolg am neuen Zertifizie-rungsverfahren zur betrieblichen Ausbildungsqualität teil, durchge-führt von der Industrie- und Han-delskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim. Belohnt wurde es dafür mit dem erstmals verliehenen IHK-Siegel „IHK-TOP-Ausbildungsbetrieb“. Die GMHütte erhielt das Zertifikat aus den Hän-den des IHK-Präsidenten Martin Schlichter und des Bundestagsab-geordneten Rainer Spiering.
Schlichter erklärte anlässlich der Verleihung: „Mit dieser Aus-zeichnung wollen wir Betriebe he-rausstellen, die mit vorbildlicher Qualität ausbilden und ein über-zeugendes Konzept der Fachkräfte-gewinnung und Personalentwick-lung haben.“ Mit der Zertifizierung wolle man die Besten unter den Ausbildungsbetrieben aufspüren, um „ein Zeichen zu setzen für gu-te Ausbildung“, so Schlichter wei-
ter: „Wir wollen die Unternehmen unterstützen, damit sie mit ihrer exzellenten Ausbildungsqualität motivierte junge Leute für eine ‚Karriere mit Lehre‘ gewinnen.“
Das neue IHK-Zertifizierungs-verfahren ist mehrstufig konzi-piert. Dabei wird die betriebliche Ausbildung des Unternehmens gleich dreifach kritisch unter die Lupe genommen: mit einer um-fangreichen Befragung per Frage-bogen, mit einer Analyse durch IHK-Ausbildungsberater und mit einem Audit.
Der Audit-Prozess stellt die be-triebliche Ausbildungsqualität auf den Prüfstand und hilft, sie syste-matisch zu verbessern. Im Fokus stehen dabei die methodische Um-setzung und die Vermittlung der Ausbildungsinhalte.
„Angesichts der zunehmenden Schwierigkeit von Betrieben, Aus-zubildende zu finden, muss die At-traktivität der dualen Ausbildung verbessert werden“, ergänzte Rai-ner Spiering. Dazu leiste das IHK-Siegel einen wichtigen Beitrag. Es sei nicht nur Orientierungshilfe für Eltern und Schulabgänger, sondern zugleich auch ein Weiterbildungs-programm für Ausbilder. Spiering weiter: „Das Qualitätssiegel der IHK stellt eine Anerkennung für den ausgezeichneten Betrieb dar, sollte aber auch Ansporn für ande-re Unternehmen sein, diesem posi-tiven Beispiel zu folgen.“
Ausbildungsleiter Christian Bloom freute sich über die Aus-zeichnung: „Zum einen ist sie Be-stätigung dafür, dass wir in Sachen Ausbildung auf dem richtigen Weg sind und sogar zu den Besten ge-hören. Zum anderen ist die Zerti-fizierung auch Ansporn, immer besser zu bleiben, um auch in Zu-kunft eine Top-Ausbildung bieten zu können.“
mw
PDfs dämmen Papierflut einRohstoff Recycling · Eben noch auf der Lkw-Waage – jetzt schon komplett online abgerechnet.
i nteRV iew
Rohstoff Recycling Osnabrück und Rohstoff Recycling Dort-mund wollen empfang, befun-dung und Dokumentation ein-gehender Schrott-lieferungen zukünftig komplett online abwi-ckeln. Nach der digitalen befun-dung per Smartphone-App (siehe glückauf 2/2015) stand der letzte Schritt an: die Digitalisierung des papierlosen Wiegekarten-Work-flows. Dirk Strothmann (It-lei-ter) erläutert das neue System:
glückauf: Wie haben Sie bisher ein-gehende Schrottlieferungen bearbeitet?Dirk Strothmann: Mit sehr viel Papier. An der Waage wurden die Wiegekarten ausgedruckt – für die Lieferanten, die Spediteure und die interne Abrechnung. Hinzu kamen die Kopien der Lieferpapiere und die Lkw-Unterweisungsbestätigun-gen.
Also jede Menge Papierkram.Strothmann: Die Papierflut war bei über 100 Lkw pro Tag in der Tat rie-sig. Danach gingen die Papiere an die Kolleginnen und Kollegen aus der Abrechnung. Waren auf den Wiegekarten Qualitätsminderun-gen notiert, wurden sie vom zu-ständigen Schrotteinkäufer geprüft und zur Abrechnung freigegeben.
Die Wiegekarten sind dann ma-nuell den Verträgen zusortiert, ab-gelegt und als Papierversion archi-viert worden. Diese Prozedur kos-tete natürlich jede Menge Zeit, jede Menge Stellplatz im Archiv und jede Menge Papierordner.
Und wie läuft es jetzt auf den Schrott-plätzen von RRO und RRD?Strothmann: Wir geben an den Lkw-Waagen die Wiegekarten nur noch für Lieferanten bzw. Spedi-teure aus. Die Wiegekarten-Aus-drucke für RRO/RRD werden direkt als PDF-Datei abgelegt. Die Papiere, die vom Lieferanten oder Spedi-teur kommen, werden direkt an der Waage eingescannt, ebenfalls als
PDF-Datei abgespeichert und auto-matisch dem Wiegevorgang zuge-ordnet. Danach werden beide PDF-Dateien zusammengeführt und in einem revisionssicheren Archiv im PDF/A-Format abgelegt. Kurze Zeit später sind sie dann in unserem SAP verfügbar.
Und was passiert mit den Notizen zu Qualitätsminderungen, die gegebe-nenfalls auf der Wiegekarte eingetra-gen wurden?Strothmann: Die Schrotteinkäufer werden in Realtime über Qualitäts-mängel per Mail bei der Anliefe-rung informiert. Bei Bedarf können sie die Dokumente sofort einsehen und darauf reagieren.
Hat die Digitalisierung weitere Vor-teile?Strothmann: Die Abrechnungs-abteilung in Georgsmarienhütte muss nicht mehr auf den Boten warten, der bislang die Wiege-karten erst am nächsten Tag zu-gestellt hat. Die Kolleginnen und Kollegen können jetzt Ein- und Ausgänge zeitnah bearbeiten. Und wenn Lieferanten oder Spe-diteure Unterlagen benötigen, können sie mit wenigen Klicks per E-Mail übermittelt werden. Und das Beste ist: Beim soge-nannten „Buchen“ der Wiegekar-ten im SAP durch die Abrechnung wird nun sofort die komplette Wie-
gekarte im SAP dargestellt – in al-len Ausfertigungen und mit allen vorhandenen Scans. Somit entfällt das zeitintensive Sortieren, Suchen und Ablegen der Wiegekarten.
Und was passiert mit den bislang archivierten Wiegekarten?Strothmann: Das Gesetz schreibt vor, Wiegekarten mindestens sie-ben Jahre aufzubewahren. Deshalb können wir das Papier-Archiv nur allmählich und Stück für Stück auf-lösen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Nach der Übergabe der Urkunde „IHK-TOP-Ausbildungsbetrieb“ (von links nach rechts): IHK-Präsident Martin Schlichter, Christian Bloom (Ausbildungsleiter), Ferenc Albrecht (Personalleiter GMHütte) und MdB Rainer Spiering.
Foto: IHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim
SAP-Abrechnungsmaske mit archiviertem und eingebettetem PDFFoto: Dirk Strothmann
Foto: © panthermedia.net/PicsFive
Dirk Strothmann Werksfoto

glück auf · 1/2016 .......... 10
GMH Gruppe
G A S T K O L U M N E : RoBeRt hARt inG
Eine Frage der EhreEigenverantwortung: Weshalb Sie Sicherheit und Gesundheit persönlich nehmen sollten.
e igenverantwortung“ hört sich etwas „hölzern“ an. Und wenn ich genauer darüber nachdenke, glaube ich
sogar, dass man nur dann Verantwortung für sich selbst übernehmen kann, wenn es um eine Sache geht, die einen unmittelbar persönlich betrifft. Die eigene Be-troffenheit lässt einen besonders deutlich spüren, was Verantwortung ist – logisch, weil man die Folgen seiner Entscheidung direkt zu spüren bekommt.
Aber dieses Verantwortungsgefühl greift auch im erweiterten Rahmen: an Ihrer Arbeitsstelle.
Sie werden sich jetzt fragen, was Ihre Eigenverantwortung für Ihre Sicherheit und Gesundheit mit Ihrem chef zu tun hat? Jede Menge. Stellen Sie sich vor, Sie wären der chef des ganzen Ladens und hätten 12.000 Mitarbeiter. Und die würden immer wieder unverant-wortlich mit Gegenständen, Einrich-tungen und Werkzeugen umgehen oder sich gar leichtsinnig verhalten und dabei verletzen. Was wäre dann?
Sie hätten pro Monat riesige Ver-luste und könnten Aufträge nicht mehr abwickeln. Nicht nur, dass Sie das, was sie zu liefern versprochen haben, nicht mehr einhal-ten könnten. Sie müssten auch die Schäden im eigenen Haus ausbügeln. Unterm Strich: Sie hätten finanzielle Verluste, weil Sie nicht liefern können, und zusätzliche Kosten, weil Sie interne Schäden beseitigen müssten. Über kurz oder lang müssten Sie Leute ent-lassen, um verbleibende Arbeitsplätze zu schützen.
Rollenwechsel: Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Führungsposition. Solche Leute setzen sich Ziele, sind ambitioniert und tragen einen höheren Eigenanteil zur Arbeit bei, weil sie länger im Büro bleiben, oft zu Hause arbeiten und rund um die Uhr für das Unternehmen tätig sind. Diese Leute verdienen in der Regel etwas mehr Geld. Als „wesentlicher Kostenfaktor“ sind sie deshalb
auch die Ersten, die gehen müssen. In unse-rem Rollenbeispiel wären das Sie (oder Ihr
Kollege oder Ihr Abteilungsleiter). Aber selbst wenn Sie verschont blieben: Es würde sich vieles ver-
ändern – die Wertschätzung Ihrer Leistung, der eingespiel-
te Arbeitsprozess, die sozia-len Beziehungen zwischen den Kollegen. Zudem würde die Arbeitsleis-tung Ihres Teams leiden. Sie selbst müssten mehr arbeiten und sich zusätz-
lich um ganz andere Dinge kümmern.
Auch privat und zu Hause würde sich vieles verändern. Sie wären länger auf der Arbeit und massiv verunsichert, weil plötzlich Ihr Arbeitsplatz bedroht ist – ohne dass Sie sich hätten etwas zuschul-den kommen lassen. Dieses Szenario ließe sich noch weiter ausmalen. Ich will nur sagen, dass in diesen Dingen der Grad der Eigenverantwortung mit dem sozialen Status einhergeht.
Für die eigene Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sollte Eigenverantwortung ebenfalls eine wichtige Rolle spie-len. Sie wollen doch auch Respekt und Anerkennung. Was diese Faktoren miteinander zu tun haben? Es ist ein Frage der Ehre: Wer mit sich selbst würdevoll umgeht und Ansprüche an sich selbst stellt, wird mit Eigenverantwortung kein Problem haben und von anderen Respekt und Anerkennung erfahren. Andererseits: Menschen, die von sich selbst wenig halten und keine Ansprüche an sich stellen, werden diese Einstellung auch ausstrahlen – und weder Respekt noch Anerkennung erwarten können.
Menschen brauchen soziale Sicherheit. Das bedeutet in der Arbeitswelt: Sie müssen Kontrolle in Vertrauen umwandeln können, das heißt „blind“ darauf vertrauen können, dass der Kollege in Ihrem Sinne handelt, ohne dass man ihn kontrolliert.
Doch welche Rolle will man selbst in dieser Vertrauen-gegen-Kontrolle-Kette spielen? Je mehr Eigenverantwortung man bereit zu praktizieren ist, desto mehr fördert man seine Vertrauenswürdigkeit gegenüber den Kollegen. So gesehen ist Eigenverantwortung Ausgangspunkt und Antriebsfeder für gegenseitiges Vertrauen.
Achten Sie auf sich und Ihre Gesundheit, denn Ihre Kollegen brauchen Sie! Und achten Sie auf Ihre Kollegen, denn deren Gesundheit und Sicherheit braucht Sie!
Ihr
Projekte kommen der Praxis zuguteGmh Gruppe · 5. Nachwuchskräfteprogramm: Qualifizierung endet mit offizieller Präsentation.
28 junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den
Unternehmen der GMH Gruppe haben in den letzten zwei Jahren an der fünften Runde des Nach-wuchskräfte-Programms (NWK) der GMH Gruppe teilgenommen und es er folgreich abgeschlos-sen. Am 11. März präsentierten sie ihre Pro jekt-Ergebnisse vor der Geschäfts führung der Holding, Ge-schäftsführern der Gruppe sowie den Paten ihrer Projekte. Eine in-teressante Diskussion folgte. Die Projektthemen sind zum Teil schon in die Linie überführt und werden dort weiter bearbeitet.
Zielgruppe des NWK-Pro-gramms sind junge Nachwuchs-kräfte der GMH Gruppe mit Hoch-schulabschluss und qualifizierte Mitarbeiter mit einer Berufs- und
Zusatzausbildung. Sie werden im Rah men einer zweijährigen Quali-fikation auf zukünftige Fach- und Führungsaufgaben vorbereitet. Entsprechend werden dabei über-fachliche Kompetenzen vermittelt.
Ein festes Dozententeam be-gleitet die Nachwuchskräfte. Sie absolvieren verschiedene Semi-nare und Mo dule, bei denen auch die ganze Gruppe immer wieder zusammen kommt. Ein wesent-licher Schwer punkt sind die ein-jährigen Projekt arbeiten. Dabei müssen die Nachwuchskräfte in in-terdisziplinär zusammenge setzten Projektgruppen ein bestimmtes Thema bearbeiten und zum Ab-schluss vor der Ge schäftsführung der Holding prä sentieren.
Kirsten Wengeler
einzigartig als lieferantmannstaedt · Supplier Award 2015 der Unicarriers-Gruppe
D ie 2013 gegründete Unicarriers-Gruppe ging aus den ehemali-
gen Gabelstapler-Herstellern Nis-san, TCM (Toyo Carrier Manufac-turing Co., Ltd.) und Atlet hervor. Ihre Fertigungsstandorte liegen in Japan, China, den USA, Spanien und Schweden.
Mannstaedt ist der einzige Lie-ferant der Unicarriers-Gruppe, der weltweit jeden Standort des Unter-nehmens beliefert. Für die Standor-te in den USA, Spanien und Schwe-den sind die Troisdorfer sogar der alleinige Lieferant für Hubschie-nen. Für den Standort in Schweden werden beispielsweise komplett einbaufertig bearbeitete Profile her-gestellt – das heißt, fixmaßgesägt, gefräst, gebohrt, zu Sets konfektio-niert und just in time angeliefert.
Bei der letzten Supplier Confe-rence von Unicarriers in Pamplona (Spanien) waren ausgesuchte Liefe-ranten eingeladen, darunter auch Mannstaedt. Im Rahmen dieser Konferenz wurde das Unterneh-men zum Lieferanten des Jahres 2015 gekürt.
Überreicht hat den Supplier Award der japanische Präsident der Unicarriers-Gruppe Akira Shiki, der extra aus dem Headquarter des Unternehmens in Kawasaki (Japan) angereist war.
Guido Glees
Unicarriers-Präsident Akira Shiki (rechts) – er war extra aus Japan angereist – gra-tuliert Vertriebsleiter Guido Glees zum Supplier Award. Werksfoto
Auf einen Blick: Die Projektthemen des 5. NWK-Programms• Entwicklung einer standardisierten Vorgehensweise zur Ermittlung
der Kundenzufriedenheit und Nutzung der Ergebnisse• Entwicklung eines Qualifikationsprofils für die Gruppenunternehmen• Lösungsansätze für alternsgerechte Arbeitsbedingungen in der schwe-
ren Adjustage bei der Mannstaedt GmbH• Stahlindustrie im Netz• Hohlbohren von Wellen in Eigenfertigung• Identifikation von Einkaufssynergien zwischen GMH Unternehmen

glück auf · 1/2016 .......... 11
GMH Gruppe
Stahl im DesignÜber Jahrhunderte waren Hölzer unterschiedlichster Art das Material der Wahl im Möbelbau: edle Hölzer für erlesene, oft mit Intarsien gearbei-tete Stücke, Allerweltshölzer für einfache Gebrauchsmöbel. Es dauerte lange, bis im Laufe der Industrialisierung auch Stahl im Möbelbau Fuß fassen konnte. Stahlrohr wurde ab 1890 bereits für Krankenhausmöbel verwendet. Einzug ins Wohnzimmer hielt Stahl erst mit dem clubsessel „Wassily B3“ von Designer und Architekt Marcel Breuer (1902–1981). Der B3 wurde Anfang der 1920er Jahre in Serie produziert und läutete eine ästhetische Wende ein. Berühmte Stahlmöbel aus der Design-Geschichte sind vor allem Stahlrohrmöbel aus der Bauhaus-Zeit wie der Thonet-Frei-schwinger S32 oder auch der Beistelltisch „Adjustable Table“ von Eileen Gray (1878–1976). Stahl (meist als Stahlrohr oder Stahlblech verwendet) ist weiterhin ein gefragtes Design-Material – seiner technischen Eigen-schaften, seiner Robustheit und nicht zuletzt seiner Ausstrahlung wegen. Denn Stahl steht auch für Modernität und coolness.
Was ist gutes Design?Was ist für Florian Vogel „gutes Design“? Klare und übersichtliche For-men. Verschnörkeltes oder Produkte, die keine klare Linie im Aussehen und in der Bedienung haben, mag er nicht. Moderne Autos zum Beispiel, die alle möglichen Bedienknöpfe, Drehrädchen und Hebelchen für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten haben, findet er für die Bedie-ner zu verwirrend. Beispiele für klare, schnörkellose Formen findet man natürlich bei den Apple-Produkten, die maßgeblich von dem britischen Designer Jonathan Ive gestaltet wurden. Aber auch viele Produkte der deutschen Firma Braun weisen diese Klarheit auf. Über viele Jahre war Dieter Rams der chefdesigner bei Braun.
designimwerk„mach mal!“ Der Designer Florian Vogel – alias Victor Foxtrot – gestaltet Möbel, Leuchten, Wohnaccessoires. Wir trafen ihn zu einem Gespräch in seiner Hamburger Werkstatt.
„warum heißt Ihr Label VIC-TOR FOXTROT furniture
& lightning? Sie heißen doch Flo-rian Vogel?“ –„Vogel ist nicht gera-de ein seltener Nachname, nichts Besonderes. Ich wollte einen et-was ausgefalleneren für meine Fir-ma. Meine Frau schenkte mir mal Manschettenknöpfe mit meinen Initialen, aber im Flaggenalphabet abgebildet. Da steht Victor für das V und Foxtrot für das F. Das gefiel mir auf Anhieb.“ Seit 2012 existiert nun seine Firma unter diesem Na-men, mit Sitz in Hamburg.
Alles hat irgendwie seinen Aus-löser, seinen Ursprung. Was war der Auslöser für Florian Vogel, sich mit Design zu beschäftigen, Design zu seinem Beruf zu machen?
Bei nicht wenigen Menschen spielt die Kindheit eine wesent-liche Rolle für den Verlauf des je-weiligen Lebensweges. So auch bei ihm. In seinem Elternhaus gab es – wie damals oft üblich – ein Tele-fon-Tischchen, das im Flur seinen Platz hatte. Dieses Tischchen hat-te eine geräumige Schublade. Und diese Schublade war immer voll-gepackt mit zahlreichen Ausgaben der Zeitschrift „Schöner Wohnen“.
Seine design-affine Mutter las diese Zeitschrift regelmäßig. Schon
als kleiner Junge begeisterte sich auch der Sohn dafür. Darin im-mer wieder zu blättern, sich die wunderbaren Fotos der Designer-Häuser, -Wohnungen, -Möbel an-zuschauen, das war für ihn das Größte. Und heute, viele Jahre spä-ter, erscheinen Artikel in „Schöner Wohnen“ über ihn. Er kann es im-mer noch nicht recht glauben.
Neben dieser Leidenschaft für „Schöne Dinge“ hatte er auch von Kind an Interesse an handwerkli-chen Beschäftigungen. Sein erstes Objekt gestaltete und baute er mit 15 Jahren: eine Lampe aus ei-nem Baustellenbrett, die für seine Freundin bestimmt war.
Nach seinem Abitur arbeitete er für ein Jahr in einer Hambur-ger Möbelschlosserei. Nach die-ser „handwerklichen Grundaus-bildung“ begann er sein Studium „Produktgestaltung“ an der Hoch-schule für Design in Dresden.
Das fünfte Semester war sein Praktikumssemester. Es sollte weg-weisend für seine Zukunft als Desi-gner werden: „Ich hatte das Glück, dieses Semester bei Ingo Maurer in München verbringen zu dürfen.“
Ingo Maurer ist ein internatio-nal anerkannter Leuchten-Desi-gner. Während dieses Praktikums realisierte Florian Vogel im Desi-gnerteam von Ingo Maurer erste Projekte. Die drei Semester bis zum
Examen seien für seine Tätigkei-ten, die er danach ausführte, fast egal gewesen. Im Bereich Design seien Abschlüsse nicht das Aus-schlaggebende. Das Wichtigste sei das, was man mit seinen Fähigkei-ten realisiert.
Nach Abschluss des Studiums kehrte er 2004 zu seinem „Ziehva-
ter“ Ingo Maurer nach München zurück. Dort blieb er dann acht Jahre. In dieser Zeit hat Florian Vo-gel – sei es im Team, sei es allein – spannende Projekte realisiert: „Sie begannen oft mit handgezeichne-ten Skizzen von Ingo Maurer. Die waren meist extrem klein zu Papier gebracht, man konnte kaum Details erken-nen. Und dann sag-te Ingo Maurer: „Mach mal!“ –
und er machte. Zum Beispiel war er 2007 federführend bei der Realisierung des Lichtobjekts „Abgefahren“ für das Foyer der Rockhal, einer Konzerthalle in Esch-Belval (Luxemburg). Von der Skizze über die Ideen-findung bis hin zum ferti-
gen Objekt vergingen vier Monate. Objekt war ein ausgedienter Citroen SM (der legendäre Citroen DS mit Maserati-Motor), der mit viel Aufwand zu einem Lichtobjekt umgestaltet
wurde. Es hing schließlich vom Hallendach herunter und vermit-telte durch die Installation den Be-suchern den Eindruck, als würde es explodieren.
Wenn es um die Entscheidung „Serien- oder Sonderleuchten“ geht, bevorzugt Florian Vogel Sonderleuchten, da für sie ein be-stimmtes Budget bereitsteht. Bei Serienfertigungen bestünde auf dem Weg von der Idee über den Prototyp bis zur Fertigung meist ein gewisser Kostendruck, der wäh-rend der Realisierung immer mit-schwinge.
Das zweite „Mach mal!“ war zu Beginn seiner Zeit mit VICTOR FOXTROT in Hamburg. Er bekam von einer Hamburger Kanzlei den Auftrag, den neuen Konferenz-raum und teilweise die Büros zu gestalten. Aus diesem Auftrag ent-stand die von ihm gestaltete Mes-sing-Leuchte „NR5 LE“.
Designte Objekte sollten beim Betrachter und Benutzer Emotio-
nen erzeugen. Darum ist Florian Vogel
davon überzeugt, dass es bei
Möbeln nicht
nur den Internet-Handel, sondern
auch den klassischen Handel weiter geben
wird. Designte Produkte muss man real wahrneh-
men, anfassen, spüren. Der Online-Handel ermöglicht alle diese emotionalen und
haptischen Erfahrungen nicht.Florian Vogel hat noch vie-
le Ideen im Kopf, die er in Zu-kunft umsetzen möchte. „Es hat ja irgendwie schon alles einmal gegeben. Trotzdem habe ich so viele Ideen im Kopf für Objek-te, die es dann eben doch noch nicht gab.“
Da möchte man ihm einfach zurufen: „Mach mal!“
mk
Links: Eines von vielen POI-Objekten des Designers Florian Vogel – zum Beispiel fürs Aufbewahren von Schreib-Utensilien. POI steht dabei für „Point of Interest“.
DeR DeS iGneR
Florian VogelSein nächstes öffentliches Projekt ist die Ausstattung des Hamburger Hauptzollamtes für ein Event der Firma „Red Bull“ im Juni dieses Jahres.23.12.1978 geboren in Hamburg09/99-11/99 Praktikum bei „Möbel in Stahl“ (Möbelschlosserei)12/99-07/2000 Anstellung bei „Möbel in Stahl“. Lernt alles rund um das Metallhandwerk.09/2000-2004 Studium der Produktgestaltung an der HTW Dresden (Dipl.-Designer)09/2002-03/2003 Praktikum bei Ingo Maurer, München2004-05/2012 Mitglied des Designteams bei Ingo Maurer, München. Arbeit an diversen Serienleuchten, u. a. Alizz cooper, metall cooper, comic Explosion, Knot, Man o Man (www.ingo-maurer.com/de/produkte). Außer-dem diverse Projekte, u. a. Abge-fahren, Atomium, Gudde Vol (www.ingo-maurer.com/de/projekte)Mai 2012 Rückkehr nach Ham-burg und Gründung des Labels VIcToR FoXTRoT. Anfänglich hauptsächlich Projektarbeit und Realisierung der Einrichtung für die Kanzlei Reuther/Rieche05/2014 Der erste Katalog der Kollektion bestehend aus SAME SAME, LESS MESS, NR5 limited edition messing, LEAF IT, ZIG ZAG
www.victorfoxtrot.de
Oben: Beistelltisch „Bright Eyed“ Rechts: Leselampe Nr. 5
Fotos: Markus Tollhopf
Foto: mk

glück auf · 1/2016 .......... 12
„Ich heiße Pierre Tamdjokwen und komme aus Kamerun“Je m‘appelle Pierre Tamdjokwen et je viens du Cameroun
wann sind Sie nach Deutschland gekommen?Vor zehn Monaten.
welche Ausbildung haben Sie durchlaufen?2013 habe ich mit 17 Jahren in Kamerun mein französisches Abitur gemacht. Im oktober beginne ich in Bochum ein Inge-nieur-Studium (Rohstoff-Ingenieurwesen).
was mögen Sie an Deutschland?Die Höflichkeit der Menschen, die Technolo-gien, die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Verkäufer in den Geschäften. Wenn man mit einem Produkt Probleme hat, kümmern sie sich respektvoll darum. Nicht so in Kamerun.
was mögen Sie an ihrem heimatland?Dort ist alles irgendwie entspannter und ruhiger. Viele Menschen sind einfach lustig und fröhlich (die Verkäufer ausgenommen!). Familie und gemeinsames Essen sind sehr wichtig.
was mögen Sie an Deutschland gar nicht?Eine gewisse Distanziertheit. Deutsche nehmen viele Dinge sehr ernst. Ich musste schon öfter mal sagen: „Das war Spaß!“ Ansonsten ist alles okay.
was mögen Sie an ihrem heimatland gar nicht?Verkäufer! online-Einkaufen geht in Kame-run gar nicht. Simpler Grund: Straßennamen fehlen.
was ist typisch deutsch?Höflichkeit, Pünktlichkeit. Deutsche sagen Bescheid, wenn sie sich verspäten. In Afrika kann man darauf lange warten. Dort tragen nur wenige eine Armbanduhr. Unter Freun-den gibt es keine Zeit. Alles geht langsam vonstatten. Im Beruf hält man sich allerdings an Uhrzeiten.
was würden Sie in der Ausländerpolitik ändern, wenn Sie „König von Deutschland“ wären?
Bessere Integration für Studierende. Damit meine ich nicht Geld, sondern dass Auslän-der, die in Deutschland studieren möchten, mehr Informationen und gute Ratschläge bekommen. Alleine sind die bürokratischen Hürden nicht zu bewältigen.
was ist wichtig für ein friedliches zusammenleben unterschiedlicher nationaler mentalitäten?
Das möchte ich mit dem Rat meiner Mutter beantworten, den sie mir kurz vor meiner Abreise nach Deutschland gab: „Vergiss Gott nicht! Gehe in die Kirche.“
ihr lebensmotto?Entspannt bleiben. Zeit ist nicht nur Geld.
Quand êtes-vous arrivé à l‘Allemagne?Il y a de cela dix mois.
Quelle formation avez-vous?J’ai eu mon Baccalauréat en 2013 à l âge de 17 ans. Je vais m’inscrire à la filière Rohstoff-Inge-nieurwesen à Bochum en octobre 2016.
Qu‘est-ce que vous aimez en Allemagne?La politesse des gens, la technologie, la convi-vialité et la serviabilité des vendeurs dans les magasins. Ils prêtent attention à leur clientèle et s’occupent d’eux jusqu’au moindre détail avec respect et courtoisie. Ce qui n’est pas le cas chez nous au Cameroun.
Qu‘est-ce que vous aimez à votre pays?Au Cameroun, tout est calme, tranquille et détendu. Beaucoup de gens sont juste drôle et gai (sauf certains vendeurs !). La famille et les repas en communs là-bas sont très importants !!!
Qu‘est que vous n’aimez pas du tout en All-emagne?
Un certain recul. Les allemands prennent beau-coup de choses au sérieux. J’ai déjà été obliger plusieurs fois de dire : “C‘était une blague!” En outre tout est ok.
Qu‘est que vous n’aimez pas du tout à votre Pays?
Les vendeurs! L‘achat en ligne ne fonctionne pas
du tout là-bas. Tout simplement parce que les rues ne sont pas dénommées.
Qu’est ce qui est typiquement allemand ?Le respect, la ponctualité. Ils signalent quand ils arrivent en retard. On peut attendre longtemps en Afrique. Peu de personnes font attention à l’heure bien qu‘ils portent des montres. Entre amis on ne considère pas le temps !! Tout se passe lentement !!!! Cependant, au travail on tient compte de l’heure.
Que voulez-vous changer dans la politique étrangère, si vous seriez «roi de l‘Allemagne » ?
Une meilleure intégration pour les étudiants. À travers cela, je ne pense pas seulement à la rémunération mais au fait que les étudiants qui veulent se former en Allemagne puissent rece-voir des orientations, des conseils et informati-ons utiles. Les barrières bureaucratiques ne sont pas les seules difficultés à surmonter.
Ce qui est important pour la coexistence paci-fique des différentes mentalités nationales?
La tolérance, la politesse, et toujours répondre avec un grand sourire !!!!
Votre devise?Etre toujours détendu. Le temps n’est pas seule-ment de l‘argent !
Pierre Tamdjokwen est âgé de 20 ans. Il est de nationalité camerounaise. Il termine actuellement un stage d’imprégnation à l’entreprise RRD. Sa sœur vit en Allemagne depuis sept ans et prépare un master en Informatique. Il vit chez elle à Dortmund. Pierre est protestant et voudrait apprendre bientôt la guitare.
Pierre Tamdjokwen (20) aus Kamerun hat bei der Rohstoff Recycling Dortmund ein Praktikum absolviert (wofür er dem Unternehmen sehr dankbar ist). Er lebt bei seiner Schwester in Dortmund, die seit sieben Jahren in Deutschland lebt und gerade ihren Master in Informatik macht. Pierre möchte gerne Gitarre lernen.
In den Kochtopf geschaut
Streetfood, Yams und Kochbananen w ie in jedem Land wird auch in Kamerun das ge-
gessen, was die Natur zu bieten hat. Und da die Natur viel zu bieten hat, ist auch die Küche Kameruns sehr facettenreich.
Zu den Grundnahrungsmitteln zählen Mais, Koch-bananen, Maniok, Yams (Wurzelgemüse) sowie Süß-kartoffeln. Apropos Banane: In Kamerun gibt es etli-che verschiedene Bananensorten. Kochbananen wer-den als Sättigungsbeilage gereicht – und spielen, ähn-lich wie bei uns Kartoffeln, bei vielen Rezepten und Gerichten eine wichtige Rolle.
Kamerun bietet auch viele Fleischsorten, darunter Ziege, Lamm, Rind und Schwein. Wer es etwas exo-tischer haben will, kommt aber ebenfalls auf seine Kosten – mit Fleischsorten wie Affe, Antilope, Gorilla, Schlange (gehört zum alltäglichen Speiseplan), Sta-chelschwein, Schuppentier, Riesenhamsterratte oder sogar Hund und Katze. Als Spezialität gilt unter ande-rem Affengulasch.
Die Menschen in der Küstenregion profitieren von der Artenvielfalt des Atlantischen Ozeans. Zu den ein-heimischen Spezialitäten zählen dort vor allem Ge-richte aus frischem Fisch, Hummer, Garnelen und an-deren Meeresfrüchten.
Was man an jeder Straßenecke findet, sind Brochettes: gegrillte Fleischspieße mit einer Mischung aus Ziegen-, Rind- und Geflügelfleisch. Aber nicht nur Gegrilltes gehört zum Streetfood. In der Stadt findet man auch jede Menge fahrende Obsthändler, die frische Früchte oder auch geschälte Möhren und frische Kokosnuss-Ecken anbieten.
Erwähnenswert sind auch die Eier-Baguette-Verkäu-fer. Auf frisches Brot geschnippelte Eier werden ver-edelt mit Mayonnaise, Piment (ziemlich scharfes Söß-chen) oder Sardinensoße. Soll echt lecker schmecken.
In den Restaurants isst man übrigens häufig mit den Händen – woran man sich als Europäer erstaun-lich schnell gewöhnen kann. Als Nationalgericht gilt Ndolé (eine Art Eintopf). Hauptzutat ist das gleichna-mige Blattgemüse (Bitterspinat). Es wird ähnlich wie Spinat zubereitet und hat – nomen est omen – einen leicht bitteren Geschmack. Weitere übliche Zutaten sind frische, gemahlene Erdnüsse, Knoblauch, Zwie-beln, Ingwer, Fleisch und getrocknete Garnelen. Es sind jedoch viele Variationen möglich. Beilage sind oft frittierte Kochbananen oder Yams.
pkm
imPReSSum
Den ken Sie da ran: Ih re Le ser brie fe, Ar ti kel, An re gun gen und Kri tik für die nächs te Aus ga be müs sen recht zei tig bei Ih ren An sprech part nern vor lie gen. Letz-ter mög li cher Ter min ist der:
4.5.2016He raus ge ber:Ge orgs ma ri en hüt te Hol ding GmbHNeue Hüt ten stra ße 149124 Ge orgs ma ri en hüt tewww.gmh-gruppe.de
V.i.S.d.P.:Iris-Kath rin Wil ckens
Re dak ti ons team:Julia Bachmann (jb), Monika Hansen (mha), Markus Hoffmann (mh), Matthias Krych (mk), Dr. Ulrike Libal (li),
Ve ra Loo se (vl), Eberhard Mehle (em), Sarah-Fee Kim (sfk), Dirk Strothmann (ds), Iris-Kath rin Wil ckens (ikw), Marcus Wolf (mw), Dr. Be a te-Ma ria Zim mer-mann (bmz)
Pro duk ti on und Gra fik:elemente designagentur, www.elemente-designagentur.ms
Text be ar bei tung:Pe ter Karl Mül ler (pkm)
Lektorat:Dorothea Raspe, Münster
Her stel lung:STEIN BA cHER DRUcK GmbH, os na brück; auf 100% Re cy cling pa pierDie glückauf erscheint viermal im Jahr.
AnDeRe länDeR , AnDeRe S i tten
offenherzig und freundlichob Europa, Asien, Amerika, Australien oder Afrika: Wer für sein Unter-nehmen im Ausland unterwegs ist, sollte die Sitten und Gebräuche im Geschäftsleben seines Gastgebers kennen. Hier Beispiele aus Kamerun: • Die Menschen in Kamerun sind offenherzig und freundlich.• Zur Begrüßung, zum Essen und beim Berühren von objekten nie die
linke Hand zu benutzen. Sie gilt als unrein (weil für sanitäre Belange verwendet). Falls Sie gerade etwas in Ihrer rechten Hand halten, reichen Sie einfach Ihr Handgelenk zur Begrüßung.
• Sie wollen Fotos von einer Person machen? Fragen Sie unbedingt vor-her um Erlaubnis.
• Hotelpersonal bekommt normalerweise etwas Trinkgeld. Bedienungs-geld ist aber meistens in der Rechnung enthalten.
• Die Beine nicht an den Knien, sondern nur an den Fußgelenken über-kreuzen (einer höherrangigen Person gegenüber überhaupt nicht kreu-zen). Wichtig: Niemals mit Fußsohlen auf eine andere Person zeigen.
Pierre Tamdjokwen aus Kamerun Foto: mk
KAMERUNER IMPRESSIONEN
Werden überall angeboten: Brochettes. Foto: © panthermedia.net/Directphoto
Kochbanane frittiert
Foto: © panthermedia.net/Joerg. Mikus

glück auf Berichte aus den unternehmen1/2016
glück auf · 1/2016 .......... 13
iAG mAGnum: RiesenwalzeÜber 19 Meter lang war die gebrochene oberwalze einer Dreiwalzen-Biegemaschine, die zur Reparatur anstand.
>>> auf Seite 14
SwG: KranbahnsanierungEigentlich wollte man die Sanierung der Kranbahn erst im nächsten Jahr abschließen. >>> auf Seite 15
SwG/GwB: euRoGuSS 2016Auf der Fachmesse für Druckguss-Erzeugnisse blickten die Fachbesucher optimistisch in die Zukunft.
>>> auf Seite 16
Bochumer Verein: PraxislösungenSchüler der Technischen Beruflichen Schule haben Vorschläge entwickelt, wie man die Produktion optimiert. >>> auf Seite 16
Schmiedag: DatentransferDie Mitarbeiter aus der Konstruktion arbeiten nach langer Vor-bereitungszeit mit einer neuen Software. >>> auf Seite 17
Gmh Systems: SAm 4Die GMH-Software-Experten bieten GMH-Unternehmen ein Modul an, das die Datenvernetzung erleichtert. >>> auf Seite 18
Gmhütte: ArbeitssicherheitNach 30 Jahren als Sicherheitsbeauftragter weiß Guntram Haase genau, worauf es bei Sicherheitsfragen ankommt.
>>> auf Seite 19
Villa Stahmer: Retrospektive Nikolaus Schuck, ehemaliger Geschäftsführer der GMHütte, hat auch als Künstler Spuren hinterlassen.
>>> auf Seite 20
RRo: Kampfmittelräumdienst Ein Teil des Stichkanals wird mithilfe des Schrottunterneh-mens nach Überbleibseln aus dem 2. Weltkrieg untersucht.
>>> auf Seite 21
Foto: Laura Genne
entlastung. Das Hantieren mit Gusstei-
len zählt immer noch zu den körperlich anstrengends-ten Tätigkeiten in einer Gießerei – und zu den unpro-duktivsten dazu. Stattdessen könnte man die Kraft produktiver einsetzen. Die neue Strahlanlage von Harz Guss Zorge macht die Konzentration auf das Wesentli-che möglich. Lesen Sie mehr darüber …
auf Seite 15

produktion & innovation
glück auf · 1/2016 .......... 14
Alles andere als Stückwerk iAG mAGnum · Spektakuläre Reparatur: Gebrochene Oberwalze einer Dreiwalzen-Biegemaschine repariert. Nach dem Schweißen zeigte die über 19 m lange Walze eine Abweichung von nur 1,5 mm.
i nteRV iew
Die europipe GmbH aus Mül-heim an der Ruhr fertigt auf vier modernen Straßen spiral- und längsnahtgeschweißte Rohre mit Durchmessern von 609 mm bis 1.524 mm. Während des betriebs war die Oberwalze einer Dreiwal-zen-biegemaschine gebrochen, die IAG MAGNUM reparieren sollte. Keine leichte Aufgabe. Über die Details berichtet IAGM-Mitarbeiter Andreas Vogele (Gruppenleiter Schweißaufsicht) im glückauf-Interview.
glückauf: Defektes Ende abtrennen, neues Stück anschweißen und an-schließend auf Einbaumaß bearbei-ten: Das hört sich nach einem Routi-nejob an, Herr Vogele.Andreas Vogele: War es aber ganz und gar nicht. Die Schwierigkeiten lagen in der speziellen Beschaf-fenheit der Oberwalze, das heißt ihrer Länge, ihrer Form und ihres Werkstoffs. Sie war nämlich über 19 Meter lang und hatte einen ma-ximalen Durchmesser von einem halben Meter.
Was heißt „maximal“?Vogele: Dass die Form der Walze nicht zylindrisch, sondern ballig, also bombiert war.
Also, die Walze war in der Mitte am dicksten und hat sich zu beiden Enden hin verjüngt.Vogele: Genau. Diese Bombierung zusammen mit dem Schlankheits-grad – also dem Verhältnis von Durchmesser zu Länge – war für die Drehbearbeitung eine echte Herausforderung. Hinzu kam der Werkstoff, ein hochgekohlter Ver-gütungsstahl aus Vollmaterial, der nicht einfach zu schweißen ist.
Und das Gewicht von 30 Tonnen?Vogele: War unproblematisch.
Wie sind Sie den Auftrag angegangen?Vogele: Vorab gab es mehrere Ge-spräche mit dem Kunden über die Besonderheiten des Auftrags. Auf Grundlage dieser Besprechungen, interner Abstimmungen und einer exakten Maßaufnahme am Bauteil haben wir detaillierte Konstruk-tionszeichnungen erstellt, für die Europipe dann grünes Licht gab. Erst dann konnten wir das 6 Meter lange und über 13 Tonnen schwere Reparaturstück bei den Schmiede-werken Gröditz in Auftrag geben.
Und wie ging es weiter?Vogele: Zunächst wurde das de-fekte Walzenstück an der Band-säge abgetrennt. Danach haben wir auf das verbliebene Stück der Oberwalze spezielle Lagerringe aufgeschrumpft. Sie hatten einen individuellen Innen- und einen gleichen Außendurchmesser. Die-se Ringe sollten dabei helfen, die Walze später auf der Drehmaschine auszurichten. Sie waren aber auch für unsere Schweißabteilung ideal,
um Oberwalze und Reparaturstück auf fünf Rollenlagern aufzubauen, auszurichten und während des Schweißens das Ergebnis zu kont-rollieren.
Wussten Sie von Anfang an, wie und womit geschweißt werden musste?Vogele: Nein, die Material-Zeugnis-se ließen es leider nicht zu, zwei-felsfrei die exakte Werkstoff-Zu-sammensetzung zu ermitteln.
Aber ohne die genaue chemische Ana-lyse des Grundwerkstoffs kann man weder die passende Schweißtechno-logie noch den passenden Schweißzu-satzwerkstoff bestimmen. Vogele: Deshalb musste unsere Qualitätsstelle zunächst die exak-te chemische Zusammensetzung mittels Spektralanalyse ermitteln. Erst danach wussten wir, dass wir die Schweißarbeiten bei mindes-tens 300 Grad Celsius Vorwärmung durchführen mussten. Dazu be-nutzten wir Induktionsschläuche,
die auf eigens hergestellten Ring-körben gewickelt waren. Diese Ringkörbe waren wichtig, da die Oberwalze drehbar sein musste. Als Erstes haben wir den Kernbe-reich von Hand mit Elektrode ge-schweißt, bis ein Durchmesser er-reicht wurde, ab dem man dann rotierend unterpulverschweißen konnte.
Mit welchem Ergebnis?Vogele: Mit einem höchst bemer-kenswerten Ergebnis. Denn die Maßkontrolle hat über die gesamte Länge von 19 Metern hinweg eine Abweichung von lediglich 1,5 Mil-limetern ergeben!
Womit ging es dann weiter?Vogele: Direkt danach aus der Schweißwärme heraus mit dem mehrstündigen Spannungsarmglü-hen. Wir verwendeten dafür nach schnellem Umbau die bereits ins-tallierten Induktoren auf den Ring-körben.
Ohne vorher die Schweißnähte geprüft zu haben?Vogele: Wir mussten ja die Walze permanent warm halten. Deshalb konnten wir die Schweißnaht erst nach dem Schweißen und Glühen prüfen. Bei der Ultraschallprüfung waren alle Beteiligten entspre-chend angespannt, als unter Auf-sicht des Kunden die Naht auf der Drehmaschine erstmals überdreht wurde. Nachdem die komplette Naht zu 100 Prozent geprüft war, gingen die Daumen des Prüfers und des Kunden hoch – und wir waren natürlich sehr erleichtert. Denn jetzt hatten wir die Gewiss-heit: Unsere bisherige Arbeit war erfolgreich.
Aber damit war der Auftrag noch nicht abgewickelt.Vogele: Nein. Jetzt begann erst die eigentliche Drehbearbeitung auf der Bank 052. Die oben erwähnten Lagerringe waren dabei der ent-scheidende Erfolgsfaktor für die exakte Ausrichtung. Die ballige Form der Walze wurde von unse-ren CNC-Programmierern perfekt nachgebildet. Nun mussten sich unsere Dreher ganz besonderes auf den Übergang zwischen Altteil und Neuteil konzentrieren. Mit dem Er-gebnis war der Kunde voll zufrie-den. Danach konnte das Rollieren der beiden Lagerstellen an den En-den der Walze erfolgen.
Was passiert dabei?Vogele: Beim Rollieren wird die Oberfläche spanlos geglättet und verfestigt und dadurch der Tragan-teil stark erhöht.
Wie haben Sie es geschafft, die fast 20 Meter lange Oberwalze auf Endmaß abzulängen, zwei Nuten zu fräsen und ein Gewinde zu schneiden?Vogele: Wir mussten gleich zwei Bohrwerke belegen. Die abschlie-ßende Endabnahme mit Maßkon-trolle haben wir gemeinsam mit Europipe absolviert. Dabei wurde deutlich: Die anfangs investierte Zeit für die umfangreiche Auftrags-planung hat sich am Ende mehr als ausgezahlt.
Vielen Dank für das Gespräch.
30 Tonnen um die eigene Achse zu bewegen, ist keine leichte Aufgabe: die Oberwalze bei der Drehbearbeitung. Fotos: Andreas Vogele
Während des Unterpulverschweißens
Andreas Vogele Werksfoto

glück auf · 1/2016 .......... 15
PRODUKTION & INNOVATION
Gewichtewuchten war einmalharz Guss zorge · Neue Strahlanlage entlastet die Mitarbeiter: Gießerei erzielt ein deutliches Produktivitäts- und Ergonomie-Plus in der Vorputzerei.
V iele Jahre leisteten die zwei Schleuderrad-Strahlanlagen in
der Gießerei der Harz Guss Zorge (HGZ) treue Dienste. Die eine kam von der Badischen Maschinenfabrik Durlach (BMD), die andere von der Wheelabrator Group. Der Lauf der Zeit führte dazu, dass beide nicht mehr die erforderlichen Leistun-gen bringen konnten – vor allem in puncto Arbeitsergonomie und Effizienz. Zudem waren sie alters-bedingt sehr stör- und wartungs-anfällig, was mehr und mehr teure Reparaturen nach sich zog.
„Es war an der Zeit, sich Gedan-ken über einen leistungsfähigen Ersatz zu machen“, so Mario Zim-mer, Abteilungsleiter Putzerei von
Harz Guss Zorge. Drei Jahre dau-erten Planung und Projektierung. Dann wurde eine neue Umlauf-Hängebahn-Strahlanlage der Firma RUMP anstelle der beiden Alt-An-lagen installiert.
Bei der Anlage handelt es sich um eine neu entwickelte Sonder-anlage von RUMP. Bestimmend für die Entwicklung war dabei ein an-spruchsvolles HGZ-Lastenheft, das spezifische Leistungsanforderun-gen vorgegeben hatte.
Das Ergebnis repräsentiert das derzeitige Optimum an verfügba-rer Technik auf dem Markt. So wer-den die Werkstücke innerhalb der Strahlanlage von 16 Turbostrah-lern gereinigt. Durch die besonde-
re Anordnung der Turbostrahler ist es möglich, den Ausstrahlwinkel des Strahlmittels exakt einzustel-len. Somit wird ein Hot-Spot mit gleichmäßiger Strahlmittelvertei-lung erzeugt, und es können bis zu 300 kg/min Strahlmittel pro Strah-ler durchgesetzt werden, was eine enorme Leistungsfähigkeit der Ma-schine bewirkt.
Eine erste Zwischenbilanz be-weist: Die neue Anlage hat die Arbeitsabläufe in der Vorputzerei enorm optimiert. Die Produktivität und die Kapazitäten sind erheblich gestiegen, und die Ergonomie wur-de ebenfalls deutlich verbessert.
Mario Zimmer ist begeistert: „Die Strahlzeit bzw. Taktzeit der Werkstücke kann im Vergleich zu den beiden zuvor genutzten Strahlanlagen mit in Summe elf Schleuderrädern (8 + 3) um bis zu 50 Prozent reduziert werden – eine bemerkenswerte Steigerung der Maschinenproduktivität!“
Bei dem KVP-Projekt „Putzerei“ hat man auch die Arbeitsbedingun-gen der Mitarbeiter durch die ergo-nomische Gestaltung der Arbeits-plätze deutlich verbessert: Für das Entfernen von Speiserresten und Grat wurde ein Förderband instal-liert. Es ermöglicht das Arbeiten in rückengerechter, optimaler Arbeits-höhe. Dies verringert die körperli-che Belastung der Mitarbeiter bzw. entlastet den Mitarbeiter bei seiner Tätigkeit.
Die Zeiten, in denen Gussteile mühsam mit Hebehilfen aus Kisten gehoben werden mussten, sind da-mit vorbei.
mh und Laura Genne
Kran kann vorzeitig sichere Bahnen ziehen Schmiedewerke Gröditz · Kranbahnsanierung vorgezogen: Schmiede hatte keine Lust, noch ein weiteres Jahr Behinderungen hinzunehmen.
w ieder einmal hieß es für die Instandhaltung der Schmie-
dewerke Gröditz (SWG) und zahl-reiche Fremdfirmen: Großreparatur. Diesmal kümmerten sie sich vor al-lem um die Sanierung der Kranbahn im Gießschiff des Elektrostahlwer-kes. Es war der letzte und zugleich umfangreichste Bauabschnitt, um die Gießschiff-Kranbahn fit für die Zukunft zu machen.
Ursprünglich hatte man das Großprojekt in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Es sollte während dreier Betriebsstillstände innerhalb von drei Jahren umgesetzt werden. Da-bei ging es darum, den effizienten Betrieb dreier Krane dauerhaft und uneingeschränkt sicherzustellen: von zwei Altgießkranen und einem neuen Gießkran (Anfang 2015 in Betrieb gegangen). Dafür mussten unter anderem Stützen und Brems-portale verstärkt und alle 16 Kran-bahnträger Stück für Stück ausge-tauscht werden.
Bis Anfang 2017 – so der ur-sprüngliche Plan – wollte man al-le Arbeiten abschließen. Doch bis dahin hätte man bei großen Lasten
zwischen den Gießkranen einen Mindestabstand von 15 m einhal-ten müssen – was die Abläufe im Gießbetrieb massiv erschwerte. Diese Behinderungen wollte man nicht noch ein weiteres Jahr hin-nehmen. Also legte man die letzten beiden Bauabschnitte zusammen, um sie während eines etwas verlän-gerten Stahlwerksstillstands zum Jahreswechsel 2015/16 abzuschlie-ßen.
Das bedeutete: Instandhaltung und Fremdfirmen mussten in 18 Tagen zwölf Kranbahnträger aus-wechseln und vier Bremsportale verstärken. Am 2. Januar war Dead-line. Projektleiter war SWG-Mitar-beiter Silvio Kopsch, maßgeblich beteiligte Fremdfirmen die Plauen Stahl Technologie GmbH, die IMO Leipzig GmbH, die Menke Gerüst-bau GmbH und das BIB Bolduan Ingenieurbüro (Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator).
Um den Termin halten zu kön-nen, begann man bereits 14 Tage vor dem eigentlichen Stillstand bei laufendem Stahlwerksbetrieb mit umfangreichen Vorbereitungen. Dazu gehörte auch der Wechsel von zwei Trägern am Hallenende.
Während der gesamten Um-bau- und Instandhaltungsarbeiten mussten sich Stahlwerk, Instand-haltung, Fremdfirmen sowie der Si-cherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator nicht nur technisch und terminlich abstimmen. Auch arbeitssicherheitstechnische Belan-ge erforderten eine kontinuierliche Verständigung.
Am Ende stand der Erfolg: Alle Aufgaben wurden erledigt, alle Ter-mine eingehalten. Dies gilt auch für andere Arbeiten und Repara-turen, die man im Stillstandzeit-raum durchführen wollte. Ob im oder am Rande des Baufeldes der Großmaßnahme: Auch sie konnten termingerecht und vor allem sicher abgeschlossen werden. Seit dem 2. Januar ist die Gießschiff-Kranbahn im Elektrostahlwerk wieder unein-geschränkt nutzbar.
Dirk Raschke Gut vorbereitet: Bereits Mitte Dezember letzten Jahres lagen die neuen Träger bereit. Foto: BIB Bolduan Ingenieurbüro
Aufrechtes Arbeiten: Mitarbeiter am Förderband entfernen Speiserreste und Grate und hängen die Gussteile auf Drehgestänge. Foto: Laura Genne
TechnikDie Umlauf-Hängebahn-Strahlanlage dient zum automatischen Strahlen von Gusswerkstücken aus den Werkstoffen GG und GGG im chargenbetrieb. Von Sand-, Zunder- und Rostpartikeln gereinigt werden die Gussteile mithilfe eines kugelförmigen Stahlguss-Strahlmittels, das über Turbostrahler verblasen wird. Beschickt wird die Anlage über eine Hängebahn – ein Umlauf-oval, das als „Power & Free“-Fördersystem ausgeführt ist. Die zu strahlenden Werkstücke werden auf ein Drehgestänge oder einen Lasthaken gehängt, automatisch in die Strahlkammer befördert und dort gereinigt. Anschließend wird der Strahlmittelstrom „gesäubert“: von magnetischen Bestandteilen per Magnetabscheidern und von Sand per Windsichtung. Zurück bleibt das Strahlmittel, das zwecks Wiederverwendung zwischengelagert wird.
UmbauWegen der großen Abmessungen der RUMP-Anlage standen zunächst größere Umbauten an: Der alte Hallenkomplex der Vorputzerei, in dem zuvor Gussteile vor ihrer Bearbeitung zwischenlagerten, wurde abgerissen, um Platz für eine neue Halle für die RUMP-Anlage zu schaffen. Zunächst wurde das Areal großräumig tief ausgebaggert und die neu angelegte Grube gegen Eintreten von Grundwasser mit Spundwänden gesichert. Anschließend errichtete man eine Halle nach neuestem Standard mit einer 4 m tiefen Kellergrube.
in einem einzigen Arbeitsgang Stahl Judenburg · Neues Bearbeitungszentrum
zu den Geschäftsfeldern der Stahl Judenburg gehört auch
die Bearbeitung von einbaufertigen Komponenten. Deshalb wird alles dafür getan, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben und die Wertschöpfungskette zu erwei-tern. Jüngster Beleg ist ein neues CNC-Bearbeitungszentrum.
Hintergrund: Zuvor hatte man unter anderem mit einer Anlage gearbeitet, die nicht mehr den mo-dernen Anforderungen in der Kom-ponentenfertigung entsprach. Des-halb wurde in ein neues Bearbei-tungszentrum investiert.
Wichtig war vor allem die Auto-matisierung. Entschieden hat man sich für ein CNC-Bearbeitungs-zentrum von EMCO sowie ein Be- und Entlademagazin von HAGE Sondermaschinenbau. Ende Januar 2016 wurde das Bearbeitungszent-rum angeliefert und montiert.
Ab sofort wird das gesamte Pro-dukt in einem Arbeitsgang gefertigt (und nicht mehr in mehreren auf-einanderfolgenden Arbeitsschrit-ten) – was der Qualität, der Produk-tionssicherheit und der Gesamt-leistung zugute kommt.
Franz Klingsbigl

partner & märkte
glück auf · 1/2016 .......... 16
Branche blickt optimistisch in die zukunftSwG/GwB · EUROGUSS 2016: Mehr Besucher, mehr Aussteller, mehr Fläche und mehr Zufriedenheit.
m it einem neuen Be-sucherrekord ende-
te Mitte Januar in Nürn-berg die EUROGUSS. Zur Fachmesse für Druckguss kamen 12.032 Fachbe-sucher (2014: 11.187 Be-sucher) aus dem In- und Ausland, um sich über Technik, Prozesse und Produkte zu informieren. Gelegenheit dazu boten ihnen 580 Aussteller (2014 waren es 470 Aussteller).
Wie bereits in den Vorjahren präsentierten sich auch die Schmie-dewerke Gröditz und die Gröditzer Werkzeugstahl Burg auf einem Ge-meinschaftsstand. Dort standen Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiter der technischen Kundenberatung und Handelsvertreter beider Unter-nehmen den Fachbesuchern Rede und Antwort. Wie meist auf einer Messe drehten sich die Gespräche um die Auslastung bei den Kun-den, ihre Bedarfe und neue Werk-stoffentwicklungen. Gesprächs-stoff bot auch eine Federbeinstütze aus XPM ESU-Stahl (hochglanz-poliert), die als Exponat auf dem Messestand zu sehen war. Am Ende zeigten sich die Gesprächspartner hoch zufrieden mit dem Informa-tionsaustausch.
Die Fachbesucher der EURO-GUSS kamen laut Messegesell-schaft vor allem aus der Automo-bilindustriebranche, dem Formen-bau sowie innovativen Industrie-
zweigen wie der Energie- oder Medizintechnik. Die Top-10-Be-sucherländer sind: Deutschland, Italien, Tschechische Republik, Ös-terreich, Polen, Türkei, Slowenien, Frankreich, Schweiz und Spanien.
„Die diesjährige EUROGUSS war ein gelungener Auftakt für ein gutes Druckgussjahr 2016. Die aus-stellenden Druckgießereien sind in großer Mehrheit mit dem Mes-severlauf zufrieden. Ein ganz gro-ßes Plus dieser Veranstaltung ist,
dass die quantitativ und qualitativ richtigen Ziel-gruppen nach Nürnberg
kommen“, so Gerd Röders, Vorsit-zender des Verbandes Deutscher Druckgießereien (VDD).
Und Timo Würz, Generalsekre-tär der European Foundry Equip-ment Suppliers Association, zog ebenfalls eine positive Messe-bilanz: „Die Stände unserer Mit-gliedsunternehmen waren bestens besucht. Die Maschinenhersteller sind mehr als zufrieden mit ihrer diesjährigen Messebeteiligung. Das ist ein positives Vorzeichen, die gu-
ten Ergebnisse aus 2015 auch 2016 zu halten.“
Auch Heike Slotta von der Messegesellschaft freu-te sich über den Verlauf: „Die Stimmung in den Messehallen war richtig gut. Die in diesem Jahr neu belegte Halle sechs wurde von Ausstellern wie
Besuchern auf Anhieb angenom-men. Es hat sich einmal mehr ge-zeigt: Nürnberg ist die Heimat der Druckguss-Branche.“
Die nächste EUROGUSS ist erst wieder in zwei Jahren. Bis dahin werden die Schmiedewerke Grö-ditz und die Gröditzer Werkzeug-
stahl Burg natürlich die Marktent-wicklung weiter aufmerksam beob-achten – und dann über Teilnahme und Ausrichtung entscheiden. Da aber die gesamte Branche derzeit optimistisch in die Zukunft blickt, gehen beide Unternehmen bis da-hin ebenfalls von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung aus.
Bernd Romeikat und Ina Klix
„Wir werden dabei sein!“Die NürnbergMesse veranstaltet nicht nur die EURoGUSS in Nürnberg. Sie versteht sich auch als Wegbereiter für deutsche und europäische Druckgießereien, die ins Asiengeschäft einsteigen oder ihre Geschäftsver-bindungen vertiefen möchten. Dies ist möglich vom 12. bis 14. Juli auf der cHINA DIEcASTING in Schanghai. Die SWG wird dort ebenfalls vertreten sein. Zudem ist die NürnbergMesse Group in Indien aktiv: Vom 1. bis 3. Dezember beteiligt sich die indische Tochtergesellschaft der NürnbergMesse zum zweiten Mal an der ALUcAST in Bangalore.
hand in hand mit der wirtschaftBochumer Verein · Studierende erarbeiten Praxislösungen für Unternehmen aus der Region. Der Bochumer Verein war gleich vierfach Projektpartner bei dem diesjährigen Projekt der TBS1 in Bochum.
D ie Weiterbildung zum „Staat-lich geprüften Techniker“ an
der TBS1 in Bochum (Technische Berufliche Schule 1) ist rundum praxisorientiert. Schon die Aus-bildungsform steht für Flexibilität. Denn sie kann in zwei Jahren Voll-zeitform, in vier Jahren Abendform oder auch in vier Jahren Schicht-form absolviert werden. So können auch Interessenten, die bereits bzw. noch im Job stehen, die Weiterbil-dung meistern.
Praxisbezug zählt auch noch in weiterer Hinsicht: Unter an-derem erwartet die Studierenden zwischen dem 4. und 5. Semester eine besonderer „Praxistest“: Sie müssen für ein Unternehmen kon-krete Verbesserungen entwickeln – beispielsweise einen Arbeitspro-zess optimieren, die Ergonomie an einem Arbeitsplatz verbessern, mit einer Neukonstruktion die Produk-tion vereinfachen oder auch die Rüstzeiten reduzieren.
Ihr Projekt suchen sich die Stu-dierenden in der Regel in lokal
oder regional ansässigen Industrie- und Handwerksunternehmen. Um ein Unternehmen als Partner zu gewinnen, müssen sie dessen Ge-schäftsführung aber erst mal von ihrer Idee überzeugen. Danach ha-ben sie ein Jahr lang Zeit, eine pra-xistaugliche Lösung zu erarbeiten.
Präsentiert wurden die diesjäh-rigen Ergebnisse bei einer Schau
Ende Januar im Technologiezen-trum der TBS1. Die insgesamt 34 kreativen Projektteams standen dort morgens und abends an ihrem Messestand, um die Fragen von In-teressenten zu beantworten. Dabei reichte die Themenpalette von der Energierückgewinnung an einer Trinkwasserdruckregelanlage der Stadtwerke Bochum bis hin zum
Bau einer mobilen Pedelec-Ladesta-tion für sechs Fahrräder.
Unter den Studierenden waren auch vier Projektteams, die die Bo-chumer Verein Verkehrstechnik als Partner hatten gewinnen können, vertreten. Dort in den Werkshallen fanden sie auch ihre Themen bzw. Probleme, die sie bearbeiten woll-ten. Entsprechend interessant wa-ren die Lösungsvorschläge, die sie entwickelt hatten:
Domenic Richmann (BVV), Da-vid Schönrath (BVV) und Chris-toph Montforts (alle Thyssen Krupp Steel AG) befassten sich mit der „Planung und Entwick-lung eines Manipulator-Armes zur Rüstzeitoptimierung an einer Räderwalzmaschine“; Daniel Har-nisch und Marcel Thiemann mit der „Planung und Konstruktion eines Kipptisches für Nacharbeiten an einer 80-MN-Schmiedepresse“; Maximilian Baumann (BVV), Ma-nuel Jung (Wilo) und Alexander Raspopov (DMT) mit der „Opti-mierung des Ausstoßers an einer
80-MN-Schmiedepresse“; und Mirco Hütter (BVV), Jens Krüger (Siegfried Boecker GmbH) und Tim Haubert (Thyssen Krupp Steel AG) mit der „Entwicklung und Konst-ruktion einer automatisierten Rei-nigungsanlage für Vollräder“.
Bleibt abzuwarten, ob die Lö-sungen bei der BVV auch umge-setzt werden. Die Chancen schei-nen dafür gut zu stehen. TBS1-Projektleiter Bernd Krohn weiß den praktischen Wert der Projekte einzuschätzen: „Die hier ausge-stellten Arbeiten verschwinden später nicht in irgendeiner Schub-lade oder irgendwelchen Archiven. Sie werden in den Betrieben auch umgesetzt.“ Und so könnte das an-strengende Jahr so manche Tür ins bzw. im Berufsleben öffnen.
Domenic Richmann
Praktische EinblickeMirco Hütter, Jens Krüger und Tim Haubert präsentieren ihr Projekt auf einer eigenen Internetseite: „Entwicklung und Konstruktion einer automatisierten Reinigungs-
anlage für Vollräder“: http://fhhost.de/bvv/projektvorstellung/
95 % … der Aussteller konnten ihre wichtigsten Zielgruppen während der EURoGUSS 2016 erreichen.
98 % … der Aussteller waren mit dem Angebot der EURoGUSS 2016 zufrieden.
Gut besuchter SWG/GWB-Messestand Foto: Walter Grimm
Ebenfalls mit dabei: Daniel Harnisch (links) und Marcel Thiemann. Werksfoto
94 % … der Aussteller waren mit dem Gesamterfolg ihrer Beteiligung zufrieden.
Ausstellungsstück der Schmiedewerke Gröditz: Federbeinstütze aus XPM ESU-Stahl (hochglanzpoliert).
Foto: NürnbergMesse

qualität & qualifikation
Aus erfahrung gutGmhütte · Preiswürdige Verbesserungsvorschläge: IdeeM rechnet auch für dieses Jahr wieder mit reger Beteiligung und vielen Ideen aus der Belegschaft.
Bei der GMHütte hat das Betrieb-liche Vorschlagswesen eine
langjährige Tradition. Denn das Stahlwerk setzt auf den Ideenreich-tum und die Kreativität seiner Mit-arbeiterinnen und Mitarbeiter.
Jeder kann über das IdeeM (soft-waregestütztes Ideenmanagement) mit seinen Verbesserungsvorschlä-gen dazu beitragen, die Konkur-renzfähigkeit seines Unterneh-mens zu steigern und dessen tech-nischen Vorsprung zu sichern. Sei-ne Vorschläge zahlen sich für ihn gleich doppelt aus: direkt durch die Gewinnprämie, indirekt durch den wirtschaftlichen Erfolg der GMHütte.
2015 haben 267 Mitarbeiterin-nen und Mitarbeiter (19 Prozent der Belegschaft) 591 Verbesse-rungsvorschläge eingereicht. Ins-gesamt wurden im Vorjahr sogar 771 Vorschläge abschließend be-wertet, weil noch offene Vorschlä-ge von 2014 mit dabei waren.
383 Vorschläge (49,7 Prozent) wurden positiv bewertet. Daraus ergab sich für das Unternehmen ein wirtschaftlicher Vorteil von 649.200 Euro. Alle prämierten Verbesserungsvorschläge erhalten
nicht nur eine Prämie, die sich nach dem Einsparpotenzial der Idee für das Unternehmen richtet. Sie nehmen auch in der letzten Be-triebsversammlung des Jahres an einer Verlosung teil, bei der es at-traktive Preise zu gewinnen gibt.
2015 war beispielsweise der Hauptgewinn ein Opel KARL Edi-tion 1.0 l. Die Glücksfee zog Hen-drik Ossege aus dem Stahlwerk. Er hatte einen Verbesserungsvor-schlag für eine Verdreh-Sicherung am neuen Pfannenschieber ge-macht.
Auch 2016 haben alle Mit-arbeiterinnen und Mitarbei-ter wieder die Gelegenheit,
ihre beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen mit ins
Spiel zu bringen – indem sie Verbesserungsvorschläge einrei-chen. Ob Kosteneinsparungen, effizientere Arbeitsabläufe, Ener-gieeinsparung oder verbesserte Unfallverhütung: Der Ideenviel-falt sind keine Grenzen gesetzt.
Ralf Kübeck
Foto: Karin Kriebel
caterpillar-Bronze-Award. Seit vielen
Jahren liefert die Schmiedag einbaufertig montierte Baugruppen an cater-pillar, den weltweit größten Hersteller von Baumaschinen mit Hauptsitz in Peoria, Illinois (USA). Nach einem abschließenden Bewertungsaudit hat caterpillar der Schmiedag im Dezember 2015 den Bronze-Award für Liefe-ranten verliehen. Gewürdigt wurde dadurch neben der großen Liefertreue die gute Qualität der gelieferten Komponenten und des Qualitätsmanage-ment-Systems. Mit der Auszeichnung endete ein zwei Jahre andauerndes erfolgreiches Projekt zwischen den beiden Unternehmen. Dass der Award für die Schmiedag besonders wichtig für die zukünftige Geschäftsent-wicklung ist, zeigt eine Ankündigung von caterpillar: Das Unternehmen will die Anzahl seiner Lieferanten reduzieren, um sich nur noch auf wenige Entwicklungslieferanten zu konzentrieren. Umso mehr freuen sich der Leiter der Mechanischen Fertigung Michael Wolf (links) und der Leiter des Qualitätswesens Andreas Studinski über die Auszeichnung. Vor ihnen liegt der „Bezugspunkt“ für den Award: die einbaufertig montierten Laufrollen.
Andreas Studinski
State of the ArtSchmiedag/hagen · Vielseitigere und flexiblere Software: Systematische Vorbereitung ermöglichte den reibungslosen Übergang beim CAD-Wechsel.
i nteRV iew
Seit 1988 setzt die Schmiedag in Hagen alle Gesenk- und Werk-zeugkonstruktionen und deren Zeichnungen mithilfe moder-ner CAD-Programme um. Doch die Ansprüche, die Kunden und deren Konstrukteure an Design und Produktentwicklung stellen, sind vielfältig und anspruchs-voll – und nehmen ständig zu, wie Schmiedag-Mitarbeiter Klaus Pfeiffer, leiter des technischen büros, weiß. Um diesen Anfor-derungen gerecht zu werden, ist man jetzt auf eine neue Software umgestiegen. Klaus Pfeiffer erläutert die näheren Umstände:
glückauf: Wie groß, Herr Pfeiffer, ist bei Ihnen die CAD-Abteilung über-haupt?Klaus Pfeiffer: Je nach Arbeitsum-fang sind bis zu fünf Arbeitsplätze besetzt.
Und was wird dort erarbeitet? Pfeiffer: Umfangreiche 2-D- und 3-D-Konstruktionen für Kunden und den eigenen Fertigungsbe-reich, aber auch komplexe Geo-metriekörper für die eigenen FEM-Berechnungen von Schmie-desimulationen. Also ob einfaches Betriebsmittel – beispielsweise eine Blechschablone – oder komplexe Vorrichtungen für die hauseigene 5-Achs-Fertigung: Alles wird bei uns via CAD umgesetzt.
Mit welchem System bislang?Pfeiffer: Mit dem Pro/Engineer
Wildfire 4.0 aus dem Softwarehaus PTC Parametric Technology.
Diese Software war ja jahrelang er-folgreich bei Ihnen im Einsatz. Jetzt sind Sie auf eine neue umgestiegen?Pfeiffer: Auf Creo 3.0, eine Soft-ware, die über verschiedene Modu-le erweiterbar ist. Die kommt aller-dings ebenfalls aus dem Hause PTC Parametric Technology.
Was macht die neue Software besser als die alte?Pfeiffer: Ihre 2-D- und 3-D-CAD-Funktionen sind vielseitiger und flexibler. Sie ermöglichen uns, unsere Produkte schneller als bis-her zu entwickeln. Eine weitere Stär-ke ist die höhere Automatisierung von immer wiederkehrenden Auf-gaben – wie beispielsweise das Ablei-ten von technischen Zeichnungen.
… also das Verwenden technischer Details beziehungsweise deren Zeich-nungen, die immer wieder benötigt werden.Pfeiffer: Genau. Dadurch können wir Fehler vermeiden, die sonst sehr viel Zeit und damit Geld kos-ten würden. Mit der neuen Soft-ware können unsere Konstrukteure
zudem bessere Analysen durch-führen und Animationen erstellen. Und sie erhöht unsere Produktivi-tät bei einer ganzen Reihe weiterer Aufgaben in der Konstruktion.
Jetzt kann man eine Konstruktions-software nicht so einfach wechseln und loslegen.Pfeiffer: Richtig. Leider geht das nicht so einfach wie zum Beispiel
ein Wechsel von einem Betriebssys-tem wie Microsoft Windows 7 zu Windows 8.
Weshalb eigentlich nicht?Pfeiffer: Das liegt unter anderem am PDM, dem sogenannten Pro-duktdaten-Managementsystem. Dort sind alle gespeicherten 3-D-Daten und CAD-Zeichnungen ab-gelegt. Dieses System verwaltet nicht nur alle Aktivitäten an Daten und Zeichnungen, es unterstützt zugleich auch wichtige Abläufe wie das Inhalts-, Änderungs- und Frei-gabemanagement von Informatio-nen.
Das sind also Informationen, die man möglichst nicht verlieren sollte.Pfeiffer: Das wäre katastrophal, so-zusagen der Worst Case. Deshalb muss ein „Daten-Umzug“ in ein neues System immer gut vorberei-tet werden.
Wie groß war der Datenumfang?Pfeiffer: Mehrere Terrabyte.
Und wie lief der „Umzug“?Pfeiffer: So schnell ging das alles nicht über die Bühne. Zunächst hatten wir erst mal über drei Mona-te Vorbereitung, um beispielsweise neue Server einzurichten. Ohne die hätten wir die neue Datenflut gar nicht bewältigen können. Danach konnten die ersten Rechner mit der ebenfalls neuen Konstruktionssoft-ware PTC Creo Parametric 3.0 in den Testbetrieb gehen.
Waren denn auch die Mitarbeiter auf die neue Software gut vorbereitet?Pfeiffer: Nach nur vier Wochen wurden alle Mitarbeiter in drei Schulungsböcken auf die neue Software vorbereitet. Parallel zum Tagesgeschäft erfolgte dann der „Daten-Umzug“. Erst als dies alles abgeschlossen war, konnten wir be-ginnen, mit PTC Creo Parametric 3.0 zu arbeiten.
Vielen Dank für das Gespräch.
SchmieDAG
Arbeiten mit der neuen Software Creo 3.0. (von links): Mathias Hellwig, Bodo Rahner und Frank Kobuszewski. Foto: Karin Kriebel
glück auf · 1/2016 .......... 17
Hauptgewinn: Der stolze Gewinner des Opel KARL Edition 1.0 l Hendrik Ossege (links) bei der Übergabe des Wagens zusammen mit IdeeM-Koordinator Ralf Kübeck. Foto: vl

glück auf · 1/2016 .......... 18
Qualität & Qualifikation
Q-newS +++ Q -newS +++ Q -newS
ideenmanagement. Auch das Ideenma-nagement (IDM) von
Mannstaedt setzte im Jahr 2015 auf „Qualität“. Die Verbesserungsvor-schläge reichten von der Vermeidung von oberflächenschäden an Profilen über organisatorische Änderungen zur Einhaltung von Arbeitsgängen bis hin zu Sichtverbesserungen beim Nachschleifen von Walzen. Im Rahmen einer Sonder-Aktion zum Jahr der Qualität wurden für Ideen zur Quali-tätsverbesserung zusätzlich attraktive Sonderpreise ausgelobt. Unter den Einreichern aller durchgeführten Ideen mit Qualitätsaspekt wurden einige Sachpreise verlost und den Gewinnern Ende Januar 2016 in einer kleinen Feierstunde im Beisein von Dieter Wilden (Geschäftsführung) und Michail Tsapanidis (Betriebsrat) überreicht.
Bernd Krist
Richtung industrie 4.0Gmh Systems · Auf dem Weg zu Industrie 4.0 (Internet der Dinge): Neues Release GMH.mes mit Modul SAM 4 ermöglicht GMH-Unternehmen die horizontale Vernetzung von Produktionsprozessen.
D ie Unternehmen der GMH Gruppe nutzen schon an vie-
len Stellen Technologien für die Digitalisierung (SAP, MES, Senso-rik, Steuerungen, OPC-UA oder auch Systeme für das Streamen von Daten). Die in der Unternehmens-gruppe eingesetzten produktions-nahen Systeme für die Visualisie-rung von Messdaten und „Con-dition Monitoring“ ermöglichen eine Überwachung und Steuerung (durch Berechnung mit Algorith-men). So wird die Steuerung von diversen Produktionsprozessen unterstützt.
Es gehört zu den anstehenden Aufgaben in der GMH Gruppe, die-se unterschiedlichen Systeme „in-telligent“ und vor allem auch „si-cher“ miteinander zu verknüpfen.
Derzeit sehen einige Beobachter die „horizontale Vernetzung“ in bestimmten Bereichen noch sehr kritisch. Die Fragen, die zu klären sind, beziehen sich auf Aspekte wie Datenhoheit, lokale oder dezentra-le Datenspeicherung von Prozess-daten in einer Cloud, Hochverfüg-barkeit, Geschwindigkeit und Echt-
zeitverarbeitung. Doch fertige Lö-sungen, die alle Wünsche abbilden, gibt es aktuell nicht – und wird es
auch zukünftig nicht geben. Denn Industrie 4.0 wird sich immer wei-ter entwickeln und damit auch nie abgeschlossen sein. Quintessenz für die GMH Systems: Es ist sinn-voll, heutige Lösungen und Syste-me zu nutzen, um durch eine si-chere Vernetzung miteinander jede zukünftige Funktionalität oder An-forderung abbilden zu können.
GMH.mes kann mit dem neuen Release 3.0 diese Aufgaben erfül-len. Ihr neues Modul SAM 4 (Nach-folger von MDE-OPC) ist auch da-für ausgelegt, die bestehenden Lö-
sungen für das Streamen von Daten einfach „anzuzapfen“ und zu verwer-ten (diese Daten werden bereits heute aus Anlagen, Steuerungen und Sensoren generiert). Und es ermöglicht, Lösungen der großen Marktführer wie SAP-ERP oder Mi-crosoft in die Prozesskette nach Be-darf sicher einzubinden.
Ralph Brausen undDaniel Kotte
Scouts auf energietripGmhütte · Schulung soll Energie-Bewusstsein der Jugendlichen schärfen.
Wenn etwas im Überfluss verfüg-bar zu sein scheint, wird es ger-ne „großzügig“ verwendet. Dies gilt erst recht, wenn man nicht dafür zahlen muss. Ob Druckluft, Wärme, Strom und Wasser: Gera-de auch in Unternehmen ist ein behutsamer Umgang mit energie nicht durchweg verbreitet. ener-gie-Scouts sollen bewusstsein dafür entwickeln, was energie wert ist – und dass aus der „groß-zügigen“ Verwendung keine Verschwendung wird. elias Wes- termeyer, tobias liedmann und timo Runde – Auszubildende „elektroniker Automatisierung“ der GMHütte – haben jetzt an einer Weiterbildung teilgenom-men. Hier ihr erfahrungsbericht:
Zum ersten Mal überhaupt hatte die Stadt Georgsmarienhütte eine Energie-Scout-Weiterbildung orga-nisiert. Sie fand an sieben Terminen zwischen dem 17. September 2015 und dem 24. Februar 2016 statt. Insgesamt hatten sich 17 Auszu-bildende aus verschiedenen Berufs-gruppen angemeldet. Vom Bade-meister über technische Berufe (zum Beispiel wir als Elektroniker) bis hin zum Bürokaufmann war ein buntes Spektrum an Azubis vertreten.
Sie kamen aus Unternehmen, die alle ihren Standort im Umkreis von Georgsmarienhütte haben: die Städtereinigung Holtmeyer GmbH & Co. KG, die Friedrich Freund GmbH Kartonagenfabrik, die Eber-hard Schweer GmbH & Co. KG, die
Stadtwerke Georgsmarienhütte, die Wiemann Haustechnik GmbH, die AGW Elektro Große-Wördemann GmbH & Co. KG und natürlich die GMHütte.
Unser erstes Treffen war im Rat-haus Georgsmarienhütte. Hier er-hielten wir Einblicke in den Pro-jektablauf und in die Grundlagen der Energietechnik. Weiter ging es mit einer Werksbesichtigung bei den Stadtwerken Georgsmarien-hütte. Dabei wurden uns die Was-seraufbereitung der Kläranlage und die Biogasanlage erklärt; dort wird Gas mit Biomüll erzeugt.
An der Hochschule in Osna-brück erfuhren wir alles über das Thema Motoren, ihre Funktions-weise und ihren Stromverbrauch. Die darauffolgenden drei Termi-ne fanden bei der GMHütte statt. Dabei lernten wir die Wärmerück-gewinnung über das Abgaskühl-system des Elektro-Ofens kennen. Durch diesen Prozess wird Dampf erzeugt, der sowohl für verschiede-ne Produktionsvorgänge verwen-det als auch ins Heizungsnetz ge-speist wird. Des Weiteren fand ein Stationslauf in der Ausbildungs-werkstatt statt, bei dem es um die Einsparung von Druckluft, Wärme, Strom und Wasser ging.
Bei unserem letzten Treffen ging es um die Planung unseres Ab-schlussprojektes. Dabei sollte jede
Firma eine Energiesparmaßnahme im Betrieb verwirklichen. Für unser Projekt haben wir uns die Hallen-beleuchtung der Ausbildungswerk-statt vorgenommen.
Unser Plan war, die alten Leucht-stoffröhren gegen neue LED-Panels auszutauschen. Sie sollten nicht nur Energie sparen, sondern auch für eine bessere Ausleuchtung der
Werkstatt sorgen. Auf der Grund-lage von Angeboten für die neue Beleuchtung haben wir die Kosten und Amortisationszeit berechnet.
Beim Abschusstreffen im Rat-haus haben alle Firmen ihr Projekt vorgestellt. Im Anschluss erhielten alle Auszubildenden ein IHK-Zerti-fikat und die besten drei Projekte wurden prämiert.
Wandel der Automatisierungspyramide
horizontale integration
fertigung/Produktionsprozess
SAP-eRP
GMH.mes
Level 2 - Systeme
SPS
Ein- und Ausgangssignale
echtzeit-kritisch
Vernetzte Automatisierung
SAM 4 GMH.mesSteuerungs-anschlussmodul
SAM 4 Das Modul SAM 4 ist seit Januar 2016 das logische Nachfolge-modul des ehemaligen MDE-oPc. oPc-Server sind seit Jahren Industrie-Standard, wenn es um den Austausch von Prozess- oder Betriebsdaten zwischen Steuerun-gen oder Level-1-Systemen zum MES oder anderen Subsystemen geht. Wenn es künftig um die sichere „horizontale Vernetzung“ von Systemen geht – z. B. um eine Digitalisierung Industrie 4.0 – können oPc-Server alleine diese Anforderungen nicht abde-cken. Deshalb (zur sicheren Ver-bindung von Steuerungen oder Level-1-Systemen über MES und SAP) stellt die GMH Systems nun SAM 4 zur Verfügung. So werden einfache Anbindungen möglich, z. B. für vorbeugende Instandhal-tung, Qualitätsdaten-Erfassung, Lösungen für die Steuerungen von Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen, Robotik oder Aufgaben des Ener-giemanagements.
IoTIoT steht für Internet of Things (meint dasselbe wie Industrie 4.0). Zwischen realer und virtueller
Welt gibt es oft „Informations-lücken“, will sagen: Die Dinge in der realen Welt haben einen bestimmten Zustand (z. B. „Luft
ist kalt“, „Patrone ist voll“), der im Internet unbekannt ist. Ziel des IoT ist es, dass viele reale Dinge ihren aktuellen Zustand (Eigen-schaften, Nutzung, Alterung ...) an das Netz weitergeben können, um diese Daten mit anderen Daten zu verknüpfen und zu verwerten (z. B. für Früherkennung von Wartung oder Austausch etc.).
„Wir sind gar nicht so weit davon entfernt, auch in unserem Produktionsumfeld den sogenannten ‚Husten‘ eines Anlagenteils zu ermitteln. Damit meinen wir die frühzeitige Generierung einer Warnmeldung, zum Beispiel in der SAP-Instandhaltung, damit sie den Ausfall einer Anlage vorab als Maßnahme einplanen kann – also ‚echte‘ praktizierbare Predictive Maintanance.“
R A L P H B R A U S E N
Die Energie-Scouts mit ihrem IHK-Zertifikat Foto: Jens Hübschmann
GMHSystems
4.indu
stri
e

glück auf · 1/2016 .......... 19
Qualität & Qualifikation
Get connectedSchmiedewerke Gröditz · Nahezu 2.500 Studierende auf Karrieremesse ORTE in Freiberg
unter dem Motto „Get connec-ted – Vom Netzwerk zum Job“
präsentierte sich die 17. Karriere-messe ORTE der TU Bergakademie Freiberg Mitte Januar rund 2.500 Besucherinnen und Besuchern. Überwiegend Studentinnen und Studenten nutzten von 10 bis 16 Uhr in der Sporthalle Ulrich-Rü-lein-von-Calw die Chance, ihr be-rufliches Netzwerk zu erweitern.
Sie konnten sich bei über 70 Ausstellern über Praktika, Ab-schlussarbeiten und Berufsein-stiegsmöglichkeiten informieren. Die vielen Info-Gespräche an den Ständen zeigten:
Die Messe ist eine wichtige Platt-form für zukünftige Nachwuchs-kräfte, potenzielle Arbeitgeber ken-nenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen.
Auch die Schmiedewerke Grö-ditz (SWG) präsentierten sich wie schon in den Vorjahren den ORTE-Besuchern. Zu dem vierköpfigen SWG-Messeteam gehörten Diana Hennig (Personalreferentin), Falk Snatkin (Produktionsingenieur), Steffen Krahl (Produktingenieur Auftragszentrum) und Julia Bach-mann (Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation).
Sie informierten Interessenten über Möglichkeiten für Prakti-ka und Praxissemester sowie über Themen für Bachelor-, Master-, Diplom- und Studienarbeiten in Gröditz. Dabei gelang es ihnen, die Schmiedewerke als attraktiven Arbeitgeber vorzustellen und an-gehende Ingenieure für einen Ein-stieg in Gröditz zu begeistern.
jb
Das erfolgreiche SWG-Messeteam (von links): Falk Snatkin, Julia Bachmann, Diana Hennig und Steffen Krahl. Foto: Dorina Becker (Career Center TU Bergakademie Freiberg)
Argumente zählen – und nicht BlablaGmhütte · Erfahrung pur und viele Tipps: Guntram Haase hat 45 Jahre Werkserfahrung und ist seit 30 Jahren als Sicherheitsbeauftragter aktiv.
i nteRV iew
Carsten Große-börding (Fach-kraft für Arbeitssicherheit) und Vera loose (Arbeitssicherheit) sprachen mit dem Kollegen Gun-tram Haase über seine Zeit als Si-cherheitsbeauftragter.
glückauf: Wo sind Sie beschäftigt, Herr Haase?Guntram haase: Ich arbeite bei der GSG Georgsmarienhütte Service GmbH im Bereich TWW – also im Steuerungsteam Walzwerk. Nach 37 Jahren Schichtarbeit wurde mir aus gesundheitlichen Gründen ein Arbeitsplatz auf der Frühschicht in der Materialbeförderung angebo-ten. Ich fahre jetzt einen E-Karren, mit dem ich für die Umformung – will sagen für Walzwerk und Final-betrieb – außergewöhnliche Fuh-ren erledige.
Versorgungsfahrten?haase: Genau. Ich besorge bei-spielsweise Öl, transportiere Moto-ren oder Teile, fahre zum Magazin
et cetera. Zu der Arbeit gehören aber auch leichte Lagertätigkeiten. Das mache ich jetzt seit eineinhalb Jahren.
Und was haben Sie früher gemacht?haase: 1971 habe ich mit der Aus-bildung zum Maschinenschlosser angefangen. Danach war ich etwa zehn Jahre als Schlosser am Hoch-
ofen/Sinteranlage und dann etwa zwölf Jahre als Kranschlosser auf dem gesamten Werksgelände. Seit 1993 hatte ich eine Stelle in der GSG-Umformung. Ich habe mitt-lerweile 45 Jahre Werkserfahrung auf dem Buckel.
Das heißt, Sie feiern in diesem Jahr Ihr 45-jähriges Betriebsjubiläum?haase: Genau. Ich habe die wech-selvolle Geschichte der Hütte also am eigenen Leib miterlebt und in dieser Zeit praktisch schon überall gearbeitet.
Wie und wann wurden Sie Sicher-heitsbeauftragter?haase: Das war 1986. Damals wur-de ich angesprochen, ob ich die Aufgabe eines Sicherheitsbeauf-tragten übernehmen wolle. Ich ha-be zugestimmt und bin bis heute ein aktives ehrenamtliches Mit-glied in diesem Team.
Was hat sich in diesen 30 Jahren ver-ändert?haase: Also, ich habe im Laufe der Zeit diverse Lehrgänge besucht und
muss sagen: Die Dozenten sind in-zwischen viel geschulter als früher. Vor 30 Jahren ha-ben sie ihre Vorträ-ge oft einfach vor-gelesen, heute sind die Seminare sehr viel lebendiger.
Befolgen die Kollegen denn wohl Ihre Rat-schläge zur Vermei-dung von Unfällen?haase: Mein gro-ßes Plus ist mittlerweile die Er-fahrung. Ich habe schon Sachen erlebt, die können sich junge Kol-legen gar nicht vorstellen. Den-noch muss ich zugeben, dass mei-ne Warnungen nicht immer Gehör finden. Und es kostet oft sehr viel Überzeugungsarbeit, den Mit-arbeitern die Arbeitssicherheit zu vermitteln. Auf jeden Fall bin ich immer noch sehr aktiv und mache den Mund auf.
Haben Sie noch einen Rat an die jun-gen Sicherheitsbeauftragten? Worauf sollten sie achten?haase: Also wichtig ist, sich nicht einschüchtern zu lassen. Sicherheit geht immer vor. Mut zum Anspre-chen ist unabdingbar – auch wenn es der Meister persönlich ist. Natür-lich muss das auf kollegiale Art und Weise geschehen, nicht mit erho-benem Zeigefinger, sondern zum Beispiel beim Frühstück. Und Argu-mente sind wichtig, nicht nur Bla-bla. Die meisten neuen Sicherheits-beauftragten sind zu ängstlich und kommunizieren nicht. Sprechen ist das A und O.
Wenn Sie noch einmal Sicherheits-beauftragter würden, was würden Sie
anders machen?haase: Ich war schon immer selbstbewusst. Da gäbe es keine großen Ve rä n de r u n -gen. Ich war stets voller Ideen und ha-be Vorschläge gemacht, Ver-
anstaltungen zu organisieren oder andere Werke zu besuchen.
Wie sehen Sie die aktuelle Situation in der Arbeitssicherheit?haase: Die vierteljährlichen SB-Infos sind gut. Es gibt Vorträge, Informationen, Wortmeldungen. Außerdem beteiligen wir uns am G+S-Tag. Das Amt des Sicherheits-beauftragten muss interessant sein, ab und zu eine Fahrt, ein Essen. Die Sicherheitsbeauftragten müssen für ihre ehrenamtliche zusätzliche Tä-tigkeit einen Anreiz haben, denn sie werden von den Vorgesetzten bestimmt.
Was gibt es über Guntram Haase pri-vat zu berichten? Wie verbringen Sie beispielsweise Ihre Freizeit?haase: Ich bin leidenschaftlicher Harley-Fahrer und seit 37 Jahren im Motorrad-Club. Außerdem liebe ich Camping-Urlaub an der Ostsee. Im Jubiläumsbuch zur 160-Jahr-Feier soll ich einer der 160 Köpfe sein.
Vielen Dank für das Gespräch.
Guntram Haase in seinem E-KarrenFoto: vl
„Wichtig ist, sich nicht einschüchtern zu lassen. Sicherheit geht vor. Mut zum Ansprechen ist unabdingbar – selbst wenn es der Meister ist.“
nachwuchs dank werbungGmhütte · Werkfeuerwehr: Jahresbilanz, Beförderungen und Ehrungen
Bei ihrer Mitgliederversamm-lung zog die Werkfeuerwehr
der GMHütte eine positive Bilanz. Insgesamt sei es ein ruhiges Feuer-wehrjahr gewesen, berichtete der Leiter der Werkfeuerwehr Thomas Schmücker den anwesenden Mit-gliedern und Gästen. „Gleichwohl möchte ich aber betonen, dass jeder Brand, der nicht ausbricht, auch dafür ein Zeichen ist, wie gut die Werkfeuerwehr arbeitet“, so Schmücker weiter.
Brandschauen und die Ausbil-dung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang von Feuer-löschern hätten mit dazu beigetra-gen, dass aus Kleinbränden keine Großbrände entstehen. Besonders freute sich der Leiter der Werk-feuerwehr aber über den „Nachwuchs“: Habe er in der letzten Haupt-versammlung noch von Schwierigkei-ten bei der Mit-g l i e d e r w e r b u n g berichten müssen, sei es nun durch intensive Werbung gelungen, die Zahl der Mitglieder wie-
der auf 60 Kameradinnen und Ka-meraden anzuheben.
Thomas Schmücker hob auch die gute Zusammenarbeit mit den umliegenden Feuerwehren hervor: Die gemeinsamen Übungen, aber auch Einsätze zeigten ein optima-les Teamwork – was auch der an-wesende Stadtbrandmeister Gerd Glane bestätigten konnte.
Arbeitsdirektor Felix Osterhei-der hob die Bedeutung der Werk-feuerwehr für die GMHütte und die Region hervor: „Die Werkfeuer-wehr ist ein integraler Bestandteil der Hütte, auf den wir stolz sein können. Mit den Einsätzen auch außerhalb des Werksgeländes zei-gen wir zudem, dass wir in dieser Stadt und dieser Region zu Hause
sind und uns hier engagieren.“ Den Kameradinnen und Kamera-den dankte Osterheider für ihren unermüdlichen Einsatz. Dem schloss sich auch der stellvertre-tende Betriebsratsvorsitzende Udo Börger an.
Um die Werkfeuerwehr auch weiterhin einsatzbereit zu halten, treffen sich die Mitglieder nicht nur wöchentlich zu ihren Dienst-abenden, sondern nehmen zusätz-lich an zahlreichen Schulungen und Weiterbildungen teil. Und so konnte Thomas Schmücker meh-rere Beförderungen und Ehrungen aussprechen.
mw
Stellten sich nach Beförderung und Aus-zeichnung dem Fotografen (von links nach rechts): Thomas Schmücker, Man-fred Mittelberg, Wolfgang Schröder,
Gaby Nast, Benjamin Boßmeyer, André Friedrich, Johannes Hegener
und Thorsten Kornau.Foto: mw
Ehrungen und BeförderungenErnannt wurden Benjamin Boßmeyer und Wolfgang Schröder zu neben-beruflichen Feuerwehrmännern. Befördert wurden André Friedrich zum nebenberuflichen Werk-Löschmeister und Gaby Nast zur nebenberuflichen 1. Werkfeuerwehrfrau. Darüber hinaus erhielt der 1. Werk-Hauptfeuerwehr-mann Manfred Mittelberg die Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft in der Werkfeuerwehr Georgsmarienhütte. Werkhauptbrandmeister Johannes Hegener wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Werkfeuerwehr geehrt.
KuRz not ieRt
weiterbildung · Auch im zweiten Quartal 2016 unterbreitet die Berufsbildungsgesellschaft Georgsmarienhütte wieder zahl-reiche attraktive Weiterbildungs-angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Blick in das
aktuelle Programm lohnt sich. Download unter www.bgg-gmh.de.

menschen & kontakte
glück auf · 1/2016 .......... 20
Allzeit bereitStahlwerk Bous · Hauptversammlung rückte positive Bilanz und den März 1906 in den Vordergrund: Werkfeuerwehr seit über 110 Jahren im Einsatz.
D ie gute Nachricht vorweg: Die Werkfeuerwehr vom
Stahlwerk Bous musste im letz-ten Jahr zu keinem Groß- oder Mittelbrand ausrücken. 19 Alar-mierungen erwiesen sich zudem als Fehlalarm. So verblieben ins-gesamt sechs tatsächliche Klein-brände und zwölf technische Hilfeleistungen, zu denen die Kameradinnen und Kameraden ausrücken mussten.
Bei den Feuerwehreinsätzen im Stahlwerksbetrieb und den Mietfirmen kamen auf dem ge-samten Werksgelände 82 Feuer-löscher zum Einsatz. Dabei wur-den 1.074 kg Löschpulver und 95 kg Co2-Löschgas verbraucht.
Diese Bilanz konnten Wehr-führer Rainer Wolf und sein Stellvertreter Thorsten Madler Anfang Februar bei der jährli-chen Hauptversammlung der Werkfeuerwehr ziehen. Der Ein-ladung gefolgt waren 26 Feuer-wehrmänner und eine Feuerwehr-frau (aktuell sind 30 aktive und 21 inaktive Feuerwehrleute in der Werkfeuerwehr tätig). Ebenfalls zu Gast waren Geschäftsführer
Franz-Josef Schu und die ehemali-gen Wehrführer Klaus Kalsing und Klaus Kuhn.
Rainer Wolf stellte darüber hin-aus den aktuellen Übungsplan für
2016 vor. Auf dem Programm stehen 36 Übungstermine und Schulungen im 14-Tages-Rhyth-mus, Atemschutz-Übungsstre-cke, die Jahreshauptübung sowie gemeinsame Übungen mit den Nachbarwehren Bous, Wadgas-sen, Ensdorf und Schwalbach. Einige Kameraden besuchen zudem Fachschulungen bei der Arbeitsgemeinschaft der Werk-feuerwehren des Saarlandes.
Doch eigentlich beherrschte ein Datum ganz anderer Art die Hauptversammlung: der März 1906. Dieses Jahr markiert näm-lich das Gründungsdatum der Werkfeuerwehr. Das bedeutet: Seit 110 Jahren engagieren sich nun schon Feuerwehrleute für das Unternehmen. Sie stellen dabei ihre eigenen Interessen zurück, opfern ihre Freizeit, er-weitern regelmäßig ihr Fachwis-sen und halten sich bei Übun-gen fit – all das, um im kame-
radschaftlichen Miteinander im Notfall dem Stahlwerk und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Seite zu stehen.
Armin Hans
Werksfoto
Bescherung. „Hellhörig sind wir geworden, als wir im Spätsommer in der Presse lasen, dass alle
Flüchtlinge aus der Turnhalle am Stadtpark im Keller-Basar eingekleidet wurden“, sagt Achim Rottsieper, Geschäftsführer von Walter Hundhausen. „Wir wollten helfen!“ Darum der Anruf bei der Diakonie Schwerte. Dort erfuhr man, dass momentan genügend Kleidung vorhanden sei, aber Per-sonal aufgestockt werden müsse. Schnell stand der Entschluss fest: eine Spendensammlung in der Belegschaft. Und so kam eine stolze Summe zusammen, die das Unternehmen großzügig aufrundete. Jetzt konnte man einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro an die Diakonie übergeben. Genutzt wird er zur Deckung der Mehrkosten im Keller-Basar. „Das ist ja schon so ein bisschen wie Weihnachten“, freute sich Heike Burghardt, die bei der Diakonie die sozialen Dienste koordiniert. „Und es geht dabei ja nicht allein um die finanzielle Hilfe“, ergänzt Diakonie-Geschäftsführer Ulrich Groth. „Die Erfahrung zu machen, dass viele beteiligt und solida-risch sind, ist so unendlich wichtig und schafft Rückhalt und Motivation.“ Bei der Diakonie wird man nun durchaus gestärkt die neuen Herausforde-rungen angehen. Und die werden nicht lange auf sich warten lassen. Das Foto zeigt Achim Rottsieper (Mitte) mit Heike Burghardt und Ulrich Groth.
li
wAlteR hunDhAuSen
Die Kunst seines lebensVilla Stahmer · Retrospektive: Die Bilderwelten des Nikolaus Schuck
D ie Villa Stahmer in Georgs-marienhütte zeigt derzeit eine
Retrospektive der eindruckvollsten Bilder des 2014 verstorbenen Ma-lers Nikolaus Schuck (1993–2000 Kaufmännischer Geschäftsführer der GMHütte). An der Ausstel-lungseröffnung Ende Februar nah-men neben zahlreichen Kunstinte-ressierten auch ehemalige Kollegen teil. Für sie alle war zu spüren, wie sehr er mit dem kulturellen Leben in Georgsmarienhütte und dem Stahlwerk verbunden war.
Nachdem Bürgermeister Ans-gar Pohlmann die Gäste begrüßt hatte, entführte Felix Osterheider (Arbeitsdirektor der GMHütte) die
Besucher mit einer leidenschaftli-chen und erfrischenden Rede in die Kunstwelt von Nikolaus Schuck. Dabei verweilte er abwechselnd in den drei Ausstellungsräumen. Dort erläuterte er nicht nur die Bilder, sondern schilderte auch die eine oder andere Anekdote aus vielen gemeinsam verbrachten Stunden – Gelegenheit für Carla Schuck, ebenfalls Interessantes und Amü-santes aus dem Leben ihres verstor-benen Mannes einzuflechten.
Nikolaus Schuck hatte seine Kar-riere in der Stahlindustrie unmit-telbar nach Abschluss des Volks-wirtschaftsstudiums begonnen. 1984 – im Jahr der Fusion der Fir-
men Krupp und Klöckner – wurde er aus dem Ruhrgebiet nach Osna-brück versetzt.
Das Malen war für ihn lange Zeit nur ein Ausgleich zum Beruf. Die Arbeit als Geschäftsführer bei der GMHütte ließ ihm damals we-der Zeit noch Muße, sich mit dem Malen zu beschäftigen. Ab dem Jahr 2000 sollte sich das ändern. Denn damals schied er aus der Geschäfts-führung aus und widmete sich von da an wieder intensiv seiner Mallei-denschaft: Er frischte seine Kennt-nisse in Kursen an Kunstakademien wieder auf. Bald darauf folgten zahl-reiche Ausstellungen im Raum Os-nabrück und im Ruhrgebiet.
Seine bevorzugten Motive wa-ren Häuser und Landschaften. Er fand sie zumeist in der Toskana, in Umbrien, auf Mallorca oder in anderen südeuropäischen Ländern. Dort faszinierte ihn die Intensität des Lichts und der Farben. Wie-der zu Hause angekommen, rief er den abgespeicherten Entwurf eines oder mehrerer Bilder – den Aufbau, die Komposition, die Farben – aus dem Kopf ab und realisierte sie in seinem Osnabrücker Atelier als Ge-mälde.
Die meisten malte er mit Acryl-farben. Aber auch andere Mate-rialien wie Sand, Kies, Pappe, Tex-tilien oder sogar Zunder (da kam die jahrzehntelange Tätigkeit in der Stahlindustrie wieder zum Vor-schein!) fanden ihren Platz in sei-nen Werken.
Wenn ihm früher ein Bild als nicht gelungen erschien, weißte er es kurzerhand wieder und begann, es neu zu malen. Später ließ er häu-
fig Passagen des „Urbildes“ durch-scheinen – was den Bildern eine zusätzliche Mal- und Sinn-Ebene verschaffte.
Neben seiner Leidenschaft für die Landschaftsmalerei gab es noch eine andere Maltechnik, die Niko-laus Schuck ebenfalls eindrucksvoll beherrschte: Er zeichnete, wenn die Stimmung dafür da war, für sein Leben gern Karikaturen. Eini-ge Freunde und ehemalige Kolle-gen haben sich schon damals über die Abbildung der eigenen Person köstlich amüsiert.
Aber das künstlerische Schaffen in seinem Atelier war ihm dann doch nicht genug: 2005 wurde Nikolaus Schuck 1. Vorsitzender der Kunst- und Kulturstiftung, ein Jahr später auch Vorsitzender der Kunstschule Paletti.
Die „Retrospektive“ über ihn wird in der Villa Stahmer noch bis zum 3. April 2016 gezeigt.
mk
Am 14. April 1907 erschien die Satzung der frei-willigen Werkfeuerwehr der damaligen Mannes-mannröhren-Werke Bous.
Vom Abstrakten im Konkreten: Im Detail bzw. Ausschnitt eröffnet sich eine völlig andere Formen- und Farbenwelt als in der Gesamtschau. Felix Osterheider entführte die Gäste mit einem leidenschaftlichen und erfrischenden Vortrag in die Kunstwelt des Nikolaus Schuck. Fotos: mk

glück auf · 1/2016 .......... 21
menschen & kontakte
Spendenaktion. Zweimal – bei der Betriebsver-sammlung Anfang Dezember
2015 und im Januar 2016 – kam es zum Spendenaufruf. Und die Mitar-beiterinnen und Mitarbeiter der Schmiedewerke Gröditz haben sich nicht lumpen lassen. Letzten Endes hatten sie 853 Euro zugunsten des Deutschen Kinderschutzbundes oV Riesa e. V. gespendet. Anfang Februar überreichten Uwe Jahn (rechts) und Doreen Hausmann (Mitte) vom Betriebsrat der Schmiedewerke den symbolischen Scheck an Barbara Plach vom Riesaer Kinderschutzbund. Die Spende soll unter anderem zwei Gröditzer Kindergartenkindern aus sozial schwachen Familien zu-gutekommen. Mit dem Geld soll ein Jahr lang ihr Eigenanteil an der Essensversorgung gedeckt werden.
jb
explosive SpurensucheRRo · Schrottis unterstützen Kampfmittelräumdienst bei Blindgängersuche.
Vor über 70 Jahren ging der 2. Weltkrieg zu Ende – und im-
mer noch sind seine Spuren nicht völlig beseitigt. So auch im Hafen Osnabrück, der mit dem Mittel-landkanal durch den 14,5 km lan-gen sogenannten Stichkanal ver-bunden ist. Ein Teil dieser rund 3,5 m tiefen Wasserstraße wird von einem Kampfmittelräumdienst derzeit auf Blindgänger unter-sucht – mithilfe der Rohstoff Re-cycling Osnabrück, deren Schrott-lagerplatz an der Rheinstraße am
Ende des Stichkanals liegt. Denn mit dem RRO-Portalkran wurde das Sondierschiff auf den Kanal ge-hievt und wieder herausgehoben.
Von den seit Januar untersuch-ten Verdachtspunkten hat sich glücklicherweise – zumindest bis-lang – nur einer als gefährlich er-wiesen: Eine Panzerfaust aus Wehr-machtsbeständen wurde entdeckt und gesprengt. Werden tatsächlich Blindgänger gefunden, müssen die Anlieger evakuiert werden. Zudem wird der Schiffsverkehr eingestellt.
Schon lange ist das Thema Aus-bau bzw. Vertiefung des Stichkanals in der öffentlichen Diskussion und in Osnabrück ein finanzielles Poli-tikum – verschärft dadurch, dass bei einem Ausbau nicht nur der Stichkanal, sondern auch die Ka-nal-Schleuse vor dem Mittelland-kanal vergrößert werden müsste. Optimisten werten die Suche nach Kampfmitteln allerdings als Zei-chen dafür, dass es mit dem Ausbau vorangehen wird.
ds
SchmieDeweRKe GRöDitz
Foto: Armin Hans
Doktorarbeit. Die mündliche Prüfung am Institut für Metallurgie der TU clausthal wird Lutz
Dekker gut in Erinnerung bleiben. Nicht nur, weil es dabei um den Erwerb des Doktorgrads der Ingenieurswissenschaften ging. Mit Monika Muth, Sabrina Muth, Jörg Treib und Armin Hans waren auch vier Kollegen mit-gereist, die ihn dabei moralisch unterstützen wollten. Sie nahmen an der Verteidigung der Doktorarbeit teil und hatten zudem die Gelegenheit, sich vor ort ein Bild von der Fakultät für Natur- und Materialwissenschaft zu machen. Nachdem verkündet worden war, dass Lutz Dekker die Prüfung bestanden hatte, ging es auf große Fahrt: Kollegen des Instituts fuhren den frischgebackenen Doktor nach alter Tradition in einer Gondel (siehe Foto) durch die Innenstadt von clausthal. Auf dem Kronplatz musste er dann ebenfalls nach altem Brauch eine Rede halten. Thema der Promotion war übrigens die „Anwendung neuer Methoden in der Legierungsentwick-lung am Beispiel eines warmfesten Gusseisens mit Kugelgraphit. Erkennt-nisse zur Wirkung des Legierungselementes Molybdän.“
Armin Hans
StAhlweRK BouS
eine produktive mischung aus tradition und moderneBrand-erbisdorf · Erster Kommunaltag 2016 des Landkreises Mittelsachsen führt Politiker zu einem Leistungsträger und wichtigen Arbeitgeber der Region.
w ieder einmal standen die Bahntechniker in Brand-Erbis-
dorf im öffentlichen Fokus. Grund des Interesses war der erste Kom-munaltag 2016 des Landkreises Mittelsachsen, der nach Brand-Er-bisdorf kam. Auf dem Programm der Politiker stand auch ein Ab-stecher ins Industriegebiet Ost, zu einem der industriellen Leistungs-träger und wichtigen Arbeitgeber im Einzugsgebiet: der Bahntechnik Brand-Erbisdorf.
Das Unternehmen konnte eine 17-köpfige Delegation der Kom-munalpolitiker begrüßen, darunter Landrat Matthias Damm und Ober-bürgermeister Martin Antonow. Dokumentiert wurde der Besuch von einem Fernsehteam von KA-NAL 9 Erzgebirge.
Die Gäste lauschten aufmerksam den Ausführungen von Werkleiter Uwe Heise, als er sie durch die Fer-tigung führte. Der Rundgang zeig-te deutlich, dass „Tradition“ und „Moderne“ Hand in Hand gehen müssen, um hochwertige Produk-te für den Schienenfahrzeugbau zu fertigen.
Natürlich werden wie zum Bei-spiel in der Feinschmiede rechner-gestützte Fertigungssysteme einge-setzt. Aber beim Freiformschmie-den von schweren Treibradsatzwel-len, Walzen und Scheiben spielt immer noch die Geschicklichkeit der Mitarbeiter eine entscheiden-
de Rolle. Werkleiter Uwe Heise er-läuterte zudem die Bedeutung des Unternehmens für den Geschäfts-bereich Bahntechnik in der GMH
Gruppe. Für die Gäste besonders interessant waren seine Hinweise auf zahlreiche Lieferbeziehungen zu Unternehmen im In- und Aus-land – und zur Wirtschaftskraft der Bahntechnik Brand-Erbisdorf: Mit ihren 95 Mitarbeitern und Auszu-bildenden konnte man 2015 im-merhin einen Umsatz von 42 Mio. Euro erzielen und über 26.000 t Stahl unterschiedlichster Legierun-gen verarbeiten.
Eine Leistung, auf die man stolz sein kann – zumal, wenn die Arbeit des Unternehmens auch im regio-nalen Fernsehen KANAL 9 Erzge-birge gewürdigt wird.
em
hätten Sie’s gewusst?
KommunaltagBeim Kommunaltag geht es vor allem um Fragen der weiteren Ent-wicklung und die Erwartungen der Bürger. Unter anderem können sie sich an dem Tag in einer öffentli-chen Sprechstunde mit Anliegen aller Art an die Politiker wenden.
Beim Werksrundgang (von links nach rechts): Werkleiter Uwe Heise erläutert Landrat Matthias Damm (Mitte) und Oberbürgermeister Martin Antonow die Besonderheiten des Schmiedens unter den Dampfhämmern. Foto: KANAL 9
Unter Wasser so gut wie keine Sicht: Die Taucher müssen sich bei der Suche auf ihren Tastsinn verlassen. Foto: Swaantje Hehmann

glück auf · 1/2016 .......... 22
menschen & kontakte
Die Neue osnabrücker Zeitung (NoZ) berichtet in ihrer Serie „Kulturstiftungen in osnabrück“ über die Stiftungslandschaft in ihrer Region. Wir drucken den Beitrag der Journalistin
Johanna Lügermann, die für ihre Recherchen Hermann cordes, den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, interviewt hatte, mit freundlicher Genehmigung der NoZ in voller Länge ab.
Foto: Gemeinde Hagen a.T.W.
familienzertifikat. Hagen am Teutoburger Wald ist als „familiengerechte Kommune“ zertifiziert. Übergeben wurde das Zertifikat auf einer Ratssitzung
des Hagener Gemeinderates. Begleitet hatte den Zertifizierungsprozess der „Verein familiengerechte Kommune e. V.“ aus Bochum, eine Initiative, die unter anderem aus der Bertelsmann Stiftung hervorging. Finanziell unter-stützt wurde das Audit unter anderem von der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte mit 5.000 Euro. Bereits im Sommer 2014 hatten Mitglieder des Gemeinderates – fachkundig beraten von der Vereinsvorsitzenden Kerstin Schmidt – die Familiensituation in Hagen unter die Lupe genommen. Danach wurden Zielvereinbarungen und Maßnahmen erarbeitet, wie man Hagen a. T. W. in den nächsten Jahren noch familienfreundlicher machen könn-te. Dabei befasste man sich mit Aspekten wie Familie und Arbeitsfeld, Bildung und Erziehung, Wohnumfeld und Lebensqualität oder auch Senioren und Generationen. So hat man sich unter anderem darauf geeinigt, ein politi-sches Leitbild zu beschließen, einen runden Tisch mit allen Vereins- und Verbandsvorständen zu initiieren, einen online-Spielplatzführer zu veröffentlichen sowie Aufenthalts- und Begegnungsorte zu schaffen. Die Zertifizierung gilt bis zum oktober 2018. Jetzt muss Hagen in Sachen Familiengerechtigkeit seine Hausaufgaben machen und die erarbeiteten Zielvereinbarungen und Maßnahmen umsetzen. Das Foto zeigt Bürgermeister Peter Gausmann mit Kindergartenkindern.
Heike Siebert
Blick über den zaunBildung zu fördern ist ein zentrales Anliegen der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte
GEoRGSMARIENHÜTTE. 60 Projek-te hat die Stiftung Stahlwerk Georgs-marienhütte nach eigenen Angaben bereits unterstützt. Das Stiftungsver-mögen ist in den vergangenen zehn Jahren stark gewachsen, doch die Jury stößt bei der Vergabe von För-dermitteln auch an Grenzen.
Schon bevor die Stiftung Stahl-werk gegründet wurde, habe die Georgsmarienhütte GmbH gemein-nützige Initiativen unterstützt, sagt der Stiftungsvorsitzende Hermann cordes: „Es wurde schon immer über den Zaun geschaut und ver-sucht, im Umfeld etwas zu tun.“
Zum 150-jährigen Bestehen des Unternehmens 2006 ist auf Initiative von Gesellschafter Jürgen Großmann dann die Stiftung Stahlwerk gegrün-det worden. Ihren Sitz hat sie auf dem Unternehmensgelände, die Ent-scheidungen werden jedoch unab-hängig getroffen, betont cordes. Damals stellte das Unternehmen eine Million Euro Kapital und weitere 150.000 Euro für das erste Jahr zur Verfügung. „Doch wir haben schnell erkannt, dass man damit nicht die Welt aus den Angeln heben kann“, sagt cordes.
Seitdem ist das Stiftungsvermö-gen um ein Vielfaches gewachsen. Es beläuft sich nach Angaben des
Vorsitzenden mittlerweile auf 14 Mil-lionen Euro. Dazu haben das Unter-nehmen, aber auch private Förderer beigetragen. 460 Projekte seien mit insgesamt 17 Millionen Euro unter-stützt worden. In manchen Fällen reichten 2000 Euro, während andere Projekte mehrere Hunderttausend bekamen. Gefördert wurden über-wiegend regionale Projekte, aber beispielsweise auch eine internatio-nale Schule in Essen und das Spren-gel Museum Hannover.
Das oberste Ziel bei der Vergabe der Fördermittel sei Nachhaltigkeit. „Wir sehen uns als Anschieber. Im besten Fall entsteht eine dauerhafte Einrichtung, die von der Stadt oder dem Land übernommen wird“, sagt cordes. So im Fall des Familienheb-ammenprojekts: Die Zusatzausbil-dung für Hebammen habe das Land Niedersachsen übernommen. Aus dem Pilotprojekt „Gesunde Stun-de“ ist ein Verein entstanden, der das Ziel verfolgt, Kindern Spaß an gesunder Ernährung und Bewegung zu vermitteln.
In der Satzung der Stiftung heißt es, das Geld steht für wissenschaft-liche, mildtätige und kulturelle Zwe-cke zur Verfügung. Der Vorstand hat die Bildung in den Fokus gestellt. Kinder und Jugendliche aus einem
sozial schwachen Umfeld sollen pro-fitieren und junge Talente gefördert werden. Ein großer Teil des Geldes wird für Stipendien ausgegeben.
Derzeit erhalten laut cordes 38 Stipendiaten jährlich 120.000 Euro. Zu den kulturellen Projekten, die unterstützt wurden, gehören zum Beispiel die interkulturelle Sprach-werkstatt der Lutherkirchengemein-de in Georgsmarienhütte, der Bau
eines Regiehauses an der Waldbühne oesede und das Yeah-Festival.
Über die Vergabe der Fördermit-tel entscheidet der ehrenamtliche Vorstand, dem außer Hermann cor-des auch der ehemalige osnabrü-cker oberbürgermeister Hans-Jürgen Fip und der frühere oberkreisdirek-tor Heinz-Eberhard Holl angehören. Viele Anträge müssen abgelehnt werden, weil sie nicht den Richt-
linien der Stiftung entsprechen.Es gebe aber auch förderwürdige Pro-jekte, die letztlich kein Geld erhal-ten. Doch wenn die Mittel erschöpft sind, enden damit nicht die Mög-lichkeiten der Stiftung. Es komme oft zu Kooperationen zwischen regionalen Stiftungen, sagt cordes: „Das Netzwerk, das wir hier haben, ist wahrscheinlich einzigartig.“
Foto: vl
emmas Alphabet. Dass die Willkommenskultur in osnabrück gelebt wird,
zeigt sich an vielen Beispielen. Eines ist das Buch „Emmas Alphabet“ von Lioba Meyer. Die ehemalige Bürgermeisterin hat es gestaltet, um Flücht-lingskindern die Sprache in Deutschland vertraut zu machen. Das Buch soll die Kleinen im Alter zwischen drei und fünf Jahren anregen, mit Bildern und Versen Buchstaben zu lernen. „Das unterhaltsam geschriebene Buch richtet sich mit den kindgerechten Texten und vielen Illustrationen an Kinder und ist zum Vorlesen gut geeignet“, schreibt oberbürgermeister
Wolfgang Griesert in einem Grußwort. Die Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte hat dieses Projekt mit 3.000 Euro unterstützt. Heike Siebert und Hans-Jürgen Fip von der Stiftung übergaben nun 15 Bücher an Birgit Jöring und Sara Kirsten von der Drei-Religionen-Grundschule in osna-brück. Die ebenfalls bei der Übergabe anwesende Lesepatin wird das Buch in Zukunft bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit mit Flüchtlingskindern in der Schule einsetzen.
mw
Hermann Cordes, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte Foto: David Ebener

glück auf · 1/2016 .......... 23
menschen & kontakte
BetRieBSJuBiläen Geschäftsführungen und Betriebsräte gratulieren den Jubilaren und sagen Dank für die langjährige Betriebstreue. glück auf wünscht alles Gute für die Zukunft, beste Gesundheit und viel Erfolg.
StAhleRzeuGunG RohStoff RecYclinG
Georgsmarienhütte GmbH25 Jahre: Ibrahim Akman (Walz-werk), Necati Alarslan (Walzwerk), Ali Arslan (Finalbetrieb), Emin Aslantas (Finalbetrieb/Wärmebehandlung), Tuncay cemtosun (Finalbetrieb), Johann Ederle (Finalbetrieb), Holger Funke (Stahlwerk), Karsten Golinske (Walzwerk), Peter Granzow (Finalbe-trieb), Uwe Igelbrink (Finalbetrieb), Andreas Kersten (Finalbetrieb), Bernhard Klare (Walzwerk), Norbert Kölker (Arbeitssicherheit), Siegmund Pander (Finalbetrieb/Wärmebehand-lung), Holger Preiss (Stahlwerk), Sergej Reglin (Stahlwerk), Wilhelm Rimer (Stahlwerk), Nail Sahin (Stahl-werk), Thomas Schnier (PSPT/Metallografie/Werkstoffprüfung), Sedat Selvi (Finalbetrieb), Thorsten Steinbach (Stahlwerk/Baubetrieb), carsten Wörmann (Finalbetrieb) und Thorsten Wöhrmann (Logistik)35 Jahre: Helmut Baier (Finalbe-trieb), Wolfgang Grewin (Walzwerk), Hans-Peter Hübner (Werkssicher-heit), Thomas Nobbe (Finalbetrieb), Wolfgang Thörner (Logistik), Jürgen Trimborn (Stahlwerk) und Hans-Jürgen
Tripke (Finalbetrieb/Wärmebehand-lung)
Mannstaedt GmbH25 Jahre: Andrea Vonde (Instand-haltung)35 Jahre: Guido Glees (Vertrieb), Juan Munoz-Forte (Instandhaltung) und Jürgen Neumann (Zerspanungs-zentrum)
Stahlwerk Bous GmbH35 Jahre: Nedim Acun (Stahl-werk), Michael Becker (Stahlwerk), Hans Werner Brose (Stahlwerk), Helmut Dinger (Arbeitssicherheit/Werksdienste) und Dietmar Kammer (Arbeitssicherheit/Werksdienste)
GSG GmbH25 Jahre: Murat Erdem (Eisenbahn) und Ronald Tolk (Neubau/Planung)35 Jahre: christian Meyer (Eisen-bahn)
StAhlVeRARBeitunG
Stahl Judenburg GmbH25 Jahre: Jürgen Macher (Ferti-gungswerkstatt)
GMH Blankstahl GmbH25 Jahre: Ludger Tieke und Lutz Wacker
SchmieDetechniK
Energietechnik Essen GmbH35 Jahre: Ralph Lanz (Datenverarbeitung)
Gröditzer Kurbelwelle Wildau GmbH10 Jahre: Thomas Breßler (Arbeits-vorbereitung) und Heide Kalle (controlling)
Gröditzer Werkzeugstahl Burg GmbH10 Jahre: christin Hagen (Verwaltung)
Schmiedag GmbH (Homburg)35 Jahre: Marita Rudig (Sachbe-arbeiterin Personalabteilung)
Schmiedewerke Gröditz GmbH10 Jahre: Uwe Brückner (Mechani-sche Werkstatt), Thomas Hickhardt (Mechanische Werkstatt), Stefan Hollmann (Mechanische Werkstatt), Michael Kirschner (Werkssteuerung), Mario Körner (Mechanische Werk-statt), Heiko Leutritz (Ringwalzwerk), Sven Michel (Mechanische Werk-statt), Rene Nerlich (Mechanische Werkstatt), Detlef Raethel (Schmie-de), Andreas Reiche (Ringwalzwerk), Thomas Schüppel (Schmiede) und Andreas Seifert (Mechanische Werk-statt)
20 Jahre: Birgit Salega (Auftrags-zentrum) und Harald Stiegel (Werks-steuerung)40 Jahre: Harald Graf (Vertrieb)
Wildauer Schmiedewerke GmbH & Co. KG10 Jahre: christian Domke (Adjus-tage), carsten Flögel (controlling), Karin Hornung (Vertrieb Innen-dienst), Peter Kasper (Hammerstre-cken), Denny Mindach (Hammer-strecken) und Lothar Nowottnick (Werkzeugbau)
BAhntechniK
Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH, Werk Bochum35 Jahre: Bernd Drgas (Mechani-sche Bearbeitung), Henryk Glinka (Mechanische Bearbeitung), Muk-sun Gürbüz (Warmformgebung), Klaus Hupperts (Warmformgebung/Mechanische Werkstatt), Werner Lucke (Mechanische Bearbeitung), Alfred Sacha (Warmformgebung/Mechanische Werkstatt) und Kathleen Vowe (Vertriebsinnen-dienst) Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH, Werk Ilsenburg35 Jahre: Jens-Uwe Keischke (Mechanische Bearbeitung) 40 Jahre: Heidrun Belger (Mechani-sche Bearbeitung)
Bahntechnik Brand-Erbisdorf GmbH15 Jahre: Andre Kleen (Fertigung) und Hubert Peukert (Fertigung)20 Jahre: Michael Buchwald (Fertigung), Andreas Martin (End-kontrolle) und Jens Reißmann (End-kontrolle)
GuSS
Harz Guss Zorge GmbH25 Jahre: Lothar Westphal (Prozess-entwicklung)
Pleissner Guss GmbH25 Jahre: Frank Rothenberg (Arbeitsvorbereitung)
Walter Hundhausen GmbH25 Jahre: Andreas Kaliwoda (Trenn-band) und Jan Libner (Modellbau)35 Jahre: Hueseyin Kaplan (Kern-macherei) und Mahmut Kavraz (For-merei)
lenKunGStechniK
MVO GmbH10 Jahre: Frank Bidlingmaier 25 Jahre: Jakob Schott und Konstantinos Karanikas
PeRSonAliA// 1. Quartal 2016
PRonoVA BKK
Vorsorge zahlt sich doppelt ausBonuspunkte noch einfacher sammeln
Das Bonusprogramm der pronova BKK setzt sinnvolle Anreize für
eine gesunde Lebensweise. Dabei wird ein Verhalten belohnt, das einen positiven Effekt auf die Gesundheit hat. Neben Geld- und Sachprämien kann man 2016 auch eine Gesund-heitsprämie gewinnen.
Ein vollständiger Impfschutz oder die Krebsfrüherkennung – nur zwei Beispiele, für die es im Bonus-heft 2016 einen Stempel gibt. Die dadurch erzielten Punkte können in eine Prämie umgewandelt oder gesammelt und ins nächste Jahr übertragen werden. Ab 3.000 Punk-ten gibt es Geldprämien, dabei ent-sprechen 1.000 Punkte jeweils zehn Euro. Für 3.000 Punkte gibt’s also insgesamt 30 Euro.
Wer sich lieber für eine Gesundheitsprämie entscheidet und per Rech-nung etwa die Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder die Zahlung einer pro-fessionellen Zahnreinigung nachweist, erhält von der pronova BKK noch mal zehn Euro: Für 3.000 Punkte gibt es dementsprechend dann sogar 40 Euro. Für Familien ist das Bonus-System zusätzlich attraktiv. Denn die Punkte aller teilnehmenden Familienmitglieder können zusammengelegt werden – wodurch man schneller zu einer Prämie kommt. Und Kinder und Jugendliche machen mit einem eigenen Bonusheft mit. Sie punkten etwa durch Sport oder Vorsorgeuntersuchungen.
Versicherte, die sich zum ersten Mal beim Bonusprogramm der pro-nova BKK anmelden, bekommen 500 Punkte als Startbonus geschenkt. Man hat die Möglichkeit, sein persönliches Bonusheft telefonisch unter 0621.53391-4945 anzufordern. Weitere Informationen sind online unter www.pronovabkk.de/bonusprogramm erhältlich.
Annemike Gößmann
Werksfoto
Jubilare und Rentner. Bei einer Feierstunde mit Gänsebraten im Landhotel Kun-zental in Zorge kam es zur Ehrung und Verabschiedung
zahlreicher Kollegen. Zum einen dankten die Harz Guss Zorge und die HGZ-Gießerei 16 Kollegen für ihre 25-jähri-ge und drei Kollegen für ihre 40-jährige, zuverlässige und treue Mitarbeit, zum andern verabschiedeten sie 15 Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand, und zwar claus Fichtner (Vertrieb), Karl-Heinz Schulze (Werks-dienst), Lothar Wächter (Modellbau), Norbert Schalipp (Schmelzbetrieb), Karl-Heinz Werner (Formanlage), Fried-rich-Karl Schelberg (Lost Foam), Dietmar Langer und Siegfried Müller (beide Arbeitsvorbereitung), Jürgen Arm-brecht, Ben-Jamil Attia, Rolf Günzel und Wolfgang Lemmer (Kernmacherei), Dieter Bönisch, Manfred Helwig und Hans-Jürgen Marquardt (Putzerei). carsten Weißelberg (Technischer Geschäftsführer) und Andre Schulz (Betriebs-ratsvorsitzender) moderierten die Veranstaltung und nahmen auch die Ehrungen und Verabschiedungen vor. Das Foto zeigt alle „Neu-Rentner“ und Jubilare zusammen mit dem technischen Geschäftsführer, dem Betriebsratsvor-sitzenden und den jeweiligen Abteilungsleitern.
Julia Henkelmann
Klimawandel. Jürgen Beck arbeitet im Rechnungswe-sen des Stahlwerks Bous – und konnte
dem bislang milden Winter etwas ganz Besonderes abgewinnen: „Auf mei-nem Balkon habe ich immer noch Tomaten, die im Sommer als kleine Pflan-ze in einen Topf gesetzt wurden. Die letzten – unter Plastikfolie gehaltenen – Tomaten habe ich am 8. Januar geerntet. Und der Strauch trägt immer noch.“ Das Foto beweist: Jürgen Beck hat seinen Gemüsevorrat noch lange nicht abgeerntet. Es sind immer noch mehrere grüne bzw. hellrote Toma-ten an dem Strauch.
mw Foto: privat
hARz GuSS zoRGe
BouS

glück auf · 1/2016 .......... 24
DIES & DAS
altge-dienterSoldat
Härte,Stabi-lität
asiati-schesBuckel-rind
Opfer-stein,-tisch
Binde-wort
Wasser-sport-gerät
ungelenk
europ.Träger-rakete
österr.Univer-sitäts-stadt
Ein-kaufs-beutel
Kerzen-rohstoff
sofort,gleichwenn
amerik.Raub-katze
Raserei
längsterStromAfrikas
alba-nischeWährung
einIndo-germane
ersteMesse e.kath.Priesters
in eige-ner Per-son, per-sönlich
kleineAbstell-kammer
Atem-organderFische
Abk.:seiner-zeit
Leicht-athlet
feineHaut-öffnung
Gelenkzw. Ober-u. Unter-schenkel
Kose-namefür dieKatze
franzö-sisch,englisch:Kunst
SpielimSport
großerLang-schwanz-papagei
Nudis-mus(Abk.)
einTrilli-onstelTeil
Qua-drille-figur
Hoch-schul-reife(Kw.)
besitz-anzei-gendesFürwort
Verwal-tungs-gremium
Erfinderder Tele-grafie† 1872
ge-wollteHand-lung
Un-mensch
Greif-vogel-fütterung
Haben Sie’s gewusst?GMHütte-Mitarbeiterin Vera Loose steht vor der größten Holzkirche Deutsch-lands in Clausthal-Zellerfeld. Unter den richtigen Einsendungen (vielen Dank für Ihre Teilnahme!) wurde als Gewin-ner Jürgen Beck vom Stahlwerk Bous (Rechungswesen) ausgelost. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)
Wir gratulieren!
ORIGINAL
Raten Sie mal !Vor welcher berühmten Touristenattraktion in der Türkei liest glückauf-Lektorin Doro-thea Raspe die glückauf? Es ist ein Name mit sechs Buchstaben. Beantworten Sie die folgenden Fragen und nehmen Sie für das Lösungswort jeweils den ersten Buchstaben Ihrer Antwort: Türkischstämmiger BVB-Mittelfeldspieler (Nachname)? Türkischstämmi-ger Bundesvorsitzender der Grünen (Nachname)? Türkisches mit Anis aromatisiertes Nationalgetränk? Türkischer Ministerpräsident (Nachname)? Türkische Espresso-Varian-te? Die Farbe „Lila“ auf Türkisch? Lösungswort:
glück auf unterwegs
FÄLSCHUNG
IHR GEWINN!
Fan-Shop-SommersetBeim Grillen darf bekanntlich ein Mann noch ein Mann sein. Und damit er dabei auch seinen Mann stehen kann, gibt es diesmal das Grillset mit Zange, Gabel und Wender aus dem GMH-Fan-Shop im Grillkoffer plus Grillschürze. Nur echt mit dem GMH-Logo.
Wir wünschen viel Erfolg!
Und wo bleibt Ihr Foto? Möchten Sie auch ein Bilderrätsel einreichen? Machen Sie einfach ein Foto mit der glückauf im Vordergrund. Im Hintergrund müssen genügend cha-rakteristische Details zu erkennen sein, um erraten zu kön-nen, wo bzw. in welcher Stadt das Foto geschossen wurde. Mailen Sie Ihr Foto einfach an [email protected].
Foto: Wolfgang Strasche
ZULETZT NOT IERT …
Was ist bei Ihnen passiert? Nein, nicht an Unfällen, sondern beim SafetyDay am 28. April. Welche Aktionen gab es in Ihrem Unter-nehmen? Was haben Sie Neues erfahren? Wie war die Resonanz? Was sagen die Kolleginnen und Kollegen? Senden Sie uns doch Ihre Berichte an [email protected] oder an Ihren Bereichskorresponden-ten. Und Sie wissen ja: Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Also sind auch Fotos herzlich willkommen.
Ihr glückauf-Redaktionsteam
5 -FEHLER -SUCHB ILD
Es ist gar nicht so leicht: Erkennen Sie die fünf Unterschiede zwischen Original und Fälschung. Was fehlt in der Fälschung? Das Original-Foto ist diesmal bei den Schmiedewerken Gröditz entstanden. Fotografiert und die Fehler eingebaut hat Felix Treppschuh von der Rohstoff Recycling Osnabrück. Und falls Sie nicht alle fünf Fälschungen erkennen sollten:
Die Lösung finden Sie auf www.glueckauf-online.de.
Frauenpower. Der Internationale Frauentag ist bei den Schmiedewerken Gröditz bereits seit vielen
Jahr(zehnt)en Teil der Unternehmenskultur. Und so haben sich auch in diesem Jahr Geschäftsführung und Betriebsrat bei allen Mitarbeiterinnen (insgesamt
sind es bei der SWG zusammen mit der Gröditzer Vertriebsgesellschaft fast 140) mit einem kleinen Präsent für ihren Einsatz, ihre Mitarbeit und ihre Motivation bedankt. Für sie gab es ein schickes Halstuch mit GMH-Logo aus dem GMH-Fan-Shop nebst einem gemeinsamen Dankesschreiben von Geschäftsführung und Betriebsrat. Und so waren Sabine Goldbach und Julia Bachmann vormittags auf dem Werksgelände unterwegs, um den Frauen das Präsent zu überreichen. Natürlich hat man auch die GVG-Mitarbeiterinnen aus Willich und die Mitarbeiterinnen in Mutterschutz-/Elternzeit nicht vergessen: Ihnen wurden Halstuch und
Anschreiben zugeschickt.jb
Foto: jb
Haben Sie’s gewusst?GMHütte-Mitarbeiterin Vera Loose steht vor der größten Holzkirche Deutsch-lands in Clausthal-Zellerfeld. Unter den -Lektorin Doro-
kann, gibt es diesmal das Grillset mit Zange, Gabel und Wender aus dem GMH-Fan-Shop im Grillkoffer plus Grillschürze. Nur echt mit dem GMH-Logo.
Wir wünschen viel Erfolg!
Foto: privat
Werksfoto
glückglückaufauf · auf · auf Rät sel Rät sel Lösung unter www.glueckauf-online.de