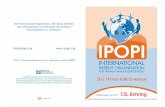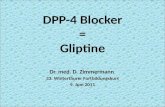H2-Blocker und Antazida bei gastrointestinalen Erkrankungen. Erfolgreiche Therapie von Ulcusleiden?
-
Upload
juergen-stein -
Category
Documents
-
view
267 -
download
4
Transcript of H2-Blocker und Antazida bei gastrointestinalen Erkrankungen. Erfolgreiche Therapie von Ulcusleiden?

Erfolgreiche Therapie von Ulcusleiden?
H2-Blocker und Antazida bei gastrointestinalenErkrankungenJÜRGEN STEIN | WOLFGANG RÖSCH
Ulcustherapeutika, die noch in den 1970er Jahren alsMeilenstein betrachtet wurden – wie das Carbenoxo-
lon-Natrium, bei dem erstmals eine Beschleunigung der Ulcusheilung dokumentiert werden konnte – sind vollstän-dig von der Bildfläche verschwunden, nicht zuletzt wegender mineralokortikoiden Nebenwirkungen. Andere, wie dieMuscarinrezeptor-Antagonisten (Pirenzepin), sind mit demSchlagwort der medikamentösen Vagolyse groß geworden,aber ebenso wie die proximal selektive Vagotomie (sie tanz-te nur ein Jahrzehnt) wieder verlassen worden [Rösch2005].
Die in den 1980er Jahren gewonnene Erkenntnis, dassdas Ulcusleiden bei der überwiegenden Mehrzahl der Pa-
Kaum ein gastroenterologisches Krankheitsbild hat in denvergangenen 30 Jahren einen derartigen Wandel hinsichtlichder medikamentösen Therapie erfahren wie das Ulcusleiden.
tienten eine durch Helicobacter pylori hervorgerufeneInfektionskrankheit darstellt oder dass zumindest die Rezi-divneigung des peptischen Ulcus durch eine H.-pylori-Gas-tritis gesteuert wird, hat zu einem Umdenken in der The-rapie dieses chronischen Leidens geführt, das plötzlich heil-bar geworden ist, wenn die Sanierung der Infektion durcheine Kombination von Antibiotika mit einer antisekretori-schen Therapie gelingt [Rösch 2005].
Ulcustherapeutika werden jedoch nicht nur beim klas-sischen Ulcusleiden, sondern auch bei der Dyspepsie, derRefluxkrankheit der Speiseröhre sowie in der Therapie undProphylaxe der ASS-/NSAR-Gastropathie eingesetzt.
H2-Rezeptor-AntagonistenErst als Sir James Black 1972 die Existenz von H1- und H2-Rezeptoren im menschlichen Organismus nachweisenkonnte, war der Weg zur Entwicklung wirksamer Ul-custherapeutika vorgezeichnet. Mit Cimetidin, das 1977 aufden Markt kam, wurde die bislang stationär durchgeführte
DOI:10.1002/pauz.200600203
38 | Pharm. Unserer Zeit | 1/2007 (36) © 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Grad A Grad B
Grade A: Schleimhautläsion < 5 mm Länge Grade B: Schleimhautläsion > 5mm
Gemäß der Los-Angeles-Klassifikation wird die Refluxösophagitis folgendermaßen eingeteilt [Lundell 1999]:

G A S T R O I N T E S T I N A L E E R K R A N K U N G E N | K L I N I K
Ulcustherapie zu einem ambulanten Gewerbe. Stan-dardtherapie wurde jedoch die Behandlung mit der Nach-folgesubstanz Ranitidin, das eine zehnmal größere Affinitätzum H2-Rezeptor aufwies, keine Affinität zum An-drogenrezeptor bot und in therapeutischen Dosen keinenhemmenden Einfluss auf das Arzneimittel-abbauende Cyto-chrom-P450-System der Leber zeigte. Weitere in den fol-genden Jahren angebotene H2-Rezeptor-Antagonisten wieFamotidin, Nizatidin oder Roxatidin konnten an den Erfolgvon Ranitidin nicht anknüpfen (Tab. 1).
Ranitidin beherrschte für ein Jahrzehnt auch wissen-schaftlich die Therapie säureassoziierter Erkrankungen, vonder Ulcuskrankheit über die Refluxkrankheit bis zur Dys-pepsie, der ASS-/NSAR-Gastropathie und dem Zollinger-El-lison-Syndrom.
UlcusleidenNicht nur für die Akuttherapie, sondern auch zur Rezidiv-prophylaxe erwiesen sich die H2-Rezeptor-Antagonisten alstherapeutische Revolution. So konnte in der 1990 in derBundesrepublik durchgeführten RUDER-Studie (Ranitidinbeim Ulcus duodeni. Epidemiologie und Rezidiv-Verhütung)an mehr als 1.900 Patienten gezeigt werden, dass durch ei-ne medikamentöse Langzeitbehandlung mit 150 mg Rani-tidin die Rezidivrate des Zwölffingerdarmgeschwürs um80 %, nämlich auf 13 % im ersten Jahr und auf 9,7 % im zwei-ten Jahr, gesenkt werden konnte [Armstrong et al. 1994].
H2-Rezeptor-Antagonisten waren bis zur Einführung derProtonenpumpenblocker (PPI) der Goldstandard in der The-rapie peptischer Ulcera. Die Heilungsraten liegen jedochnach zwei Wochen im Durchschnitt um 20 bis 30 %, nachvier Wochen Therapie etwa 10 bis 20 % niedriger als unterder Gabe von PPI [Poynard et al. 1995, Eriksson et al. 1995].Ranitidin (300 mg täglich) und Famotidin (40 mg täglich)erreichen im Vergleich zu Cimetidin (800 mg täglich) eine
schnellere Ulcusheilung [Hartmann und Fölsch 1988; Ro-drigo et al. 1989], die Heilungsrate nach acht Wochen un-terscheidet sich jedoch nicht.
Die Entdeckung eines noch wirksameren Therapie-prinzips, nämlich der Protonenpumpenblockade sowie dieWiederentdeckung von Helicobacter pylori durch Warrenund Marshall führte zu einem Niedergang der H2-Rezeptor-Antagonisten nach dem Motto „das Bessere ist des GutenFeind“, so dass H2-Rezeptor-Antagonisten heute in derUlcustherapie praktisch nicht mehr eingesetzt werden.Auch Kombinationen von H2-Blockern mit Antibiotika inder Tripeltherapie zur H.-pylori-Eradikation sind verglei-chenden Schemata mit PPI eindeutig unterlegen.
Die Wirksamkeit des nur in der Schweiz zugelassenenRanitidin-Wismuth-Zitrates (Pylorid®) ist nur bei einer Kom-bination mit Clarithromycin und Metronidazol, nicht jedochmit Amoxicillin, einer PPI-basierten Eradikation diskretüberlegen [Gisbert et al. 2005].
© 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.pharmuz.de 1/2007 (35) | Pharm. Unserer Zeit | 39
Grad C Grad D
Grade C: Schleimhautläsion dehnt sich über > 2 Schleimhautfalten aus Grade D: Schleimhautläsion beträgt > 75 % des ösophagealen Bereiches
TA B . 1 D OS I E R U N G U N D PH A R M A KO K I N E T I K VO N H 2- B LO C K E R N
Cimetidin (z.B. 800 57 – 66 56 1,5 – 2Tagamet, Cimehexal, Azucimet)Ranitidin (z.B. Sostril, 300 50 30 2 – 3Zantic, Ranidura)Nizatidin (z.B. 300 60 65 1,5 – 2Gastrax, Nizax Lilly)Roxatidinacetat (Roxit) 150 49 4 – 6Famotidin (Ganur, 40 40-45 32 2,5 – 4Pepdul)
Substanz (Präparat) Tages- Bioverfüg- Renale HWZdosis barkeit Ausscheidung [h][mg] [%] [%]

H2-Rezeptor-Antagonisten in der Behandlung dergastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD)
Als dominierendes gastrointestinales Krankheitsbild des 21.Jahrhunderts gilt die Refluxkrankheit der Speiseröhre, de-ren Prävalenz sich in den letzten 30 Jahren verzehnfacht hat.Schätzungsweise 20 bis 30 % der erwachsenen Bevölkerungin den westlichen Industrienationen leiden unter Reflux-symptomen, 10 % haben täglich oder mehrmals wöchent-lich Sodbrennen. Ungefähr 10 % der Patienten mit Reflux-symptomen entwickeln eine Refluxösophagitis (Abb. 1), ei-ne so genannte Endoskopie-positive Refluxkrankheit. 10 %der Patienten mit makroskopisch endoskopisch nachweis-barer Refluxösophagitis entwickeln eine Zylinderzellmeta-plasie (Barrett-Ösophagus). Bei möglicherweise bis zu 10 %dieser Patienten geht die Metaplasie in ein Adenokarzinomdes Ösophagus über (10er-Regel).
Die Wirksamkeit von H2-Blockern in der Behandlungdes GERD korreliert invers mit dem Schweregrad der Öso-phagitis: 80 % bei Grad A, B gegenüber 30 bis 50 % bei GradC, D [Sabesin et al. 1991; Tygat et al. 1990]. Doch auch inden unteren Stadien konnte in zahlreichen prospektivenDoppelblindstudien die Überlegenheit einer Therapie mitProtonenpumpenblockern, insbesondere in den ersten Wo-chen, gezeigt werden. In einer Meta-Analyse wurden 43 Ori-ginalarbeiten mit insgesamt 7.635 Patienten und endosko-pisch dokumentierter erosiver oder ulceröser Refluxöso-phagitis überprüft. Unter der Therapie mit Protonen-pumpenblockern im Vergleich zu H2-Blockern war nichtnur die prozentuale vollständige Abheilung innerhalb vonzwölf Wochen höher, sondern auch die Geschwindigkeitder Abheilung doppelt so hoch.
Protonenpumpenhemmer sind daher im Sinne einerStep-down-Therapie auch hier Medikamente der erstenWahl in allen Stadien der Refluxösophagitis und nicht mehrnur der H2-Blocker refraktären Refluxösophagitis vorbe-halten [Dent 1999].
Als unwirksam gilt mittlerweile auch die Mitte der1990er praktizierte Kombination mit PPIs in Form einerabendlichen Einnahme von H2-Blockern unter der Vor-stellung, die von einigen Patienten beschriebenen nächt-
lichen Refluxbeschwerden zu mildern [Wolfe und Sachs2000; Katz und Tutuian 2001; Cross und Justice 2002; Panet al. 2004].
H2-Rezeptor-Antagonisten zur Prophylaxe NSAR-induzierten Ulcera
Etwa 10 % aller Patienten, die nichtsteroidale Antirheuma-tika (NSAR) einnehmen, leiden unter gastroduodenalen Ul-cera; hiervon entwickeln wiederum bis zu 10 % im weite-ren Verlauf eine intestinale Blutungskomplikation [Graham1993, Langman 1994]. Die Inzidenz von Magen- oder Duo-denalulcera unter NSAR-Einnahme reicht bis zu 5 % undkann mit Blutungen und Perforationen einhergehen [Steenet al. 2001; Wolfe et al. 1999].
Sowohl in der Therapie als auch in der Prophylaxe vonNSAR-induzierten Ulcera bei Risikopatienten erweisen sichPPIs am effektivsten. Dass keiner der derzeit verfügbarenH2-Rezeptor-Antagonisten in der Lage ist, NSAR-induzierteMagendarmulcera effektiv zu verhindern, wurde durch zahl-reiche Studien wiederholt gezeigt. Lediglich Hochdosis-Famotidin (2 × 40 mg) scheint eine Ausnahme zu machen[Taha 1996].
H2-Rezeptor-Antagonisten zur Stress-Ulcusprophylaxe
Aufgrund der in den letzten Jahren deutlich rückläufigenPrävalenz von Stressläsionen bei kritisch kranken Patientenund einer auch deutlich geringeren Rate von klinisch be-deutsamen Blutungen ist eine generelle medikamentöseStress-Ulcusprophylaxe nicht mehr zu befürworten. Nebender Minimierung von Risikofaktoren – hier insbesondere ei-ne Optimierung von Analgosedierung (Sedationstiefe) undmaschineller Beatmung (PEEP, Tidalvolumina) gilt eine früh-zeitig einsetzende enterale Ernährung (Verbesserung derMukosadurchblutung über Freisetzung von Ghrelin) alswirksame prophylaktische Maßnahme [Stein 2006].
Eine Indikation zur Stress-Ulcusprophylaxe ist nach demgegenwärtigen Stand der Literatur [Stein 2006; Stollman2006] bei Patienten mit den Risikofaktoren Beatmung (> 2 Tage), Schädel-Hirn-Traumata, großflächigen Verbren-nungen, hypotonen Kreislaufsituationen (z.B. im Rahmen ei-ner Sepsis) und Koagulopathien in jedem Fall gegeben. Siesollte dann mit H2-Blockern (Ranitidin, Famotidin) oderSulcrafat (s.u.) durchgeführt werden, deren Wirksamkeit inzahlreichen prospektiv-randomisierten Studien und Meta-Analysen belegt ist [Stein 2006; Stollman 2006]. Aufgrundeiner besseren Wirksamkeit bei geringerer Neben-wirkungsrate (negative chrono- und inotrope kardiale Wir-kungen) sollte eine kontinuierliche Infusion von H2-Blockern einer mehrmals täglichen Bolusapplikation vor-gezogen werden [Duerksen 2003].
H2-Rezeptor-Antagonisten in der Therapie der funktionellen Dyspepsie
Nach allgemeiner Übereinkunft werden unter dem BegriffDyspepsie Beschwerden zusammengefasst, die auf den obe-
40 | Pharm. Unserer Zeit | 1/2007 (36) www.pharmuz.de © 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
TA B . 2 A N TA Z I DA
Gavison Alginsäure, Aluminiumhydroxid
Gelusil Aluminium-Magnesium-Silikathydrat
Maalox, Maaloxan, Progastrit Aluminiumhydroxid, Magnesiumhydroxid
Phosphalugel Kolloidales Aluminiumphosphat
Renni Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
Riopan Aluminium-Magnesium-hydroxid-sulfathydrat (= Magaldrat)
Solugastril Aluminiumoxid, Calciumcarbonat
Talcid Aluminium-Magnesiumhydroxid-carbonathydrat (Hydrotalcit)
Trigastril Aluminiumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat
Präparat (Handelsname) Substanz(en)

G A S T R O I N T E S T I N A L E E R K R A N K U N G E N | K L I N I K
ren Magen-Darm-Trakt bezogen werden, ohne dass hierfüreine organische Ursache im Rahmen der diagnostischen Ab-klärung nachweisbar ist. Der Begriff Dyspepsie wird un-abhängig von der zugrunde liegenden Ursache der Symp-tomatik zur Beschreibung eines auf den Oberbauch be-zogenen Symptomkomplexes verwendet. DyspeptischeBeschwerden umfassen entsprechend nicht nur Schmer-zen, sondern auch frühzeitiges Sättigungsgefühl oder Völ-legefühl, Übelkeit oder andere unangenehme auf den Ober-bauch bezogene Sensationen [Holtmann 2005].
H2-Rezeptor-Antagonisten zeigten in den 17 vorliegen-den kontrollierten Studien recht unterschiedliche Wirk-samkeiten, wobei allerdings kritisch anzumerken bleibt,dass in den meisten Studien kein explizierter Ausschlussvon Patienten mit GERD vorgenommen wurde [Bytzer undTalley 2001]. In sechs Studien zeigte sich eine Überlegen-heit der H2-Rezeptor-Antagonisten gegenüber Placebo.
Seit Sommer 2000 sind die H2-Rezeptor-Antagonistenaus der Rezeptpflicht entlassen und als OTC-Präparate freiverfügbar (Ranitidin: Zantic 75®; Famotidin: Pepcid®). DieIndikation wurde dabei vom Bundesinstitut für Arzneimit-tel und Medizinprodukte (BfArM) auf die Indikation Sod-brennen eingeschränkt, um nicht Symptome eines Magen-neoplasmas durch diese Selbstmedikation zu kaschieren.
AntazidaDie Säureneutralisation stellt ein bereits in der Antike prak-tiziertes Therapieprinzip bei dyspeptischen Beschwerdendar, das auch heute noch im Vorfeld der ärztlichen Dia-gnostik weite Verbreitung findet. Freiverkäufliche Antazidaauf Natriumbicarbonat-, Calciumcarbonat-, Aluminiumhy-droxid- oder Magnesiumhydroxid-Basis (Tab. 2) werden im-mer dann eingenommen, wenn der Betroffene glaubt, sei-ne Magensäure mache ihm zu schaffen. Dabei ist es weni-ger die Säure im Magen als die Säure am falschen Ort,nämlich in Speiseröhre oder Duodenum, die Symptome aus-zulösen vermag. Dabei wird neben der Säureneutralisationauch die Pepsinaktivierung, die Adsorption von Gallensäu-ren und die Freisetzung von Prostaglandinen therapeutischgenutzt.
Nachdem gezeigt werden konnte [Petersen et al. 1977],dass durch hohe Dosen eines Aluminiumhydroxid-haltigenAntazidums (über 1000 mval Neutralisationskapazität) dasUlcus duodeni beschleunigt zur Abheilung gebracht werdenkann, sind zahlreiche weitere Therapiestudien publiziertworden, die ähnliche Ergebnisse auch beim Ulcus ventriculimit wesentlich niedrigeren Dosen (z.B. 120 mval Neutrali-sationskapazität) erzielten. Einnahmekomfort und Wech-selwirkungen mit anderen Medikamenten (Tab. 3) habendieses Therapiekonzept jedoch mit Aufkommen der H2-Blocker, auch in Kombination mit diesem Wirkprinzip, nichtweiter verfolgen lassen.
Nachdem in kontrollierten Studien auch gezeigt wer-den konnte, dass Antazida bei der funktionellen Dyspepsienicht wirksamer sind als Placebo, spielt diese Substanzklassezumindest in der gastroenterologischen Fachpraxis keine
Rolle mehr. Auch zur Therapie und Prophylaxe von NSAR-Läsionen liegen keine schlüssigen Therapiestudien vor oderes gibt heute bessere beziehungsweise wirksamere Alter-nativen.
Als obsolet gilt heute ebenso die sehr arbeitsintensive Gabe von Antazida (1- bis 2-stündige Einnahme von 30 bis60 mL) in der Stressulcusprophylaxe [Stein 2006]. Nebeneiner nicht zu akzeptierenden Belastung des Organismusmit 20 bis 80 g Aluminium bzw. Magnesium und der Volu-menbelastung des Magens (erhöhtes Reflux- und Pneu-monierisiko) erwiesen sich Interaktionen mit einer Vielzahlvon Medikamenten als problematisch [Stollmann und Metz2006; Duerksen 2003].
Lediglich bei episodischem Sodbrennen spielen Antazi-da – wohl auch aus Kostengründen – noch eine gewisse Rol-le, um rasche Beschwerdefreiheit, wenn auch nur vorüber-gehend, zu gewährleisten. Eine Wirkungsverlängerung wirddabei in Kombination mit einem OTC-H2-Blocker, zum Bei-spiel Pepcid dual®, erreicht.
SulcralfatDas basische Aluminium-Saccharose-Sulfat Sucralfat (Sucral-fat-ratiopharm®, Sucralphil®, Ulcogant®) bildet auf der Ul-cusoberfläche Komplexverbindungen mit basischen Pro-teinen und verhindert dadurch den Angriff aggressiver Fak-toren wie Salzsäure, Pepsin und Galle. Ferner verstärkenSucralfat bzw. freigesetzte Aluminiumionen die Prosta-glandinsynthese, was mit einer beschleunigten Ulcus-Ab-heilungsrate einhergehen sollte.
Sulcralfat wird heute nur noch gelegentlich in Suspen-sionsform (4 × 1 g) bei der alkalischen Refluxösophagitis,zum Beispiel nach Gastrektomie, eingesetzt, eventuell inKombination mit einem Prokinetikum. Die Ergebnisse sinddabei genauso wenig überzeugend wie bei der Gabe vonAluminiumhydroxid, Colestyramin oder nicht-toxischenGallensäuren.
Sucralfat kann und sollte beim kritisch Kranken zurStress-Ulcusprophylaxe eingesetzt werden (6 × 1 g über Ma-gensonde). Als Vorteil von Sulcralfat gilt hier seine bakte-riostatische Wirkung, was die in mehreren Studien nach-
© 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.pharmuz.de 1/2007 (36) | Pharm. Unserer Zeit | 41
TA B . 3 W EC H S E LW I R KU N G E N VO N A N TA Z I DA U N D A N D E R E N
M E D I K A M E N T E N
Adsorption IsoniazidTetracycline
Resorption erhöht SulfonamideAntikoagulanzien?
erniedrigt TetracyclineDigitalisChlorpromazinPentobarbitalCarbenoxolon
Renale Ausscheidung erhöht Salizylatevermindert Chinidin
Amphetamin
Wirkungen Betroffene Medikamente

gewiesene im Vergleich zu H2-Blockern niedrigere Pneu-monierate erklärt [Stein 2006]. Steht die Hyperazidität imVordergrund wie z.B. bei Schädel-Hirn-Traumata und Sepsissollte dagegen H2-Blockern der Vorzug gegeben werden.
Zitierte Literatur[1] Armstrong, D., Arnold, R., Classen, M., Fischer, M., Goebell, H.,
Schepp, W., Blum, A.L.: RUDER – a prospective, two-year, multicen-ter study of risk factors for duodenal ulcer relapse during mainten-ance therapy with ranitidine. RUDER Study Group. Dig Dis Sci 39(1994), 1425-1433.
[2] Classen, M.: Ranitidin. Dokumentation eines Erfolges. Verlag fürMedizin. Dr. Ewald Fischer Heidelberg (1992).
[3] Cook, D.J., Reeve, B.K., Guyatt, G.H., Heyland, D.K., et al.: Stress ulcer prophylaxis in critically ill patients: Resolving discordant meta-analyses. JAMA 275 (1996), 308-314.
[4] Cross, L.B., Justice, L.N.: Combination drug therapy for gastroeso-phageal reflux disease. Ann Pharmacother 36 (2002), 912-916.
[5] Dent, J., Yeomans, N.D., Mackinnon, M., et al: Omeprazole v raniti-dine for prevention of relapse in reflux oesophagitis. A controlleddouble blind trial of their efficacy and safety. Gut 35 (1994), 590-598.
[6] Eriksson, S., Langstrom, G., Rikner, L., Carlsson, R., Naesdal, J.:Omeprazole and H2-receptor antagonists in the acute treatment ofduodenal ulcer, gastric ulcer and reflux oesophagitis: a meta-analy-sis. Eur J Gastroenterol Hepatol 7 (1995), 467-475.
[7] Gisbert, J.P., Leticia Gonzalez, L., Xavier Calvet, X.: Systematic Re-view and Meta-analysis: Proton Pump Inhibitor vs. Ranitidine Bis-muth Citrate Plus Two Antibiotics in Helicobacter pylori Eradication.Helicobacter 10 (2005), 157-171.
[8] Graham, D.Y., White, R.H., Moreland, L.W., Schubert, T.T., Katz, R.,Jaszewski, R., Tindall, E., Triadafilopoulos, G., Stromatt, S.C., Teoh,L.S.: Duodenal and gastric ulcer prevention with misoprostol in ar-thritis patients taking NSAIDs. Misoprostol Study Group. Ann InternMed 119 (1993), 257-262.
[9] Hartmann, H., Fölsch, U.R.: Famotidine versus cimetidine in the treatment of acute duodenal ulcer. Double-blind, randomized clini-cal trial comparing nocturnal administration of 40 mg famotidine to800 mg cimetidine. Digestion 39 (1988), 156-161.
[10] Katz, P.O., Tutuian, R.: Histamine receptor antagonists, protonpump inhibitors and their combination in the treatment of gastro-oesophageal reflux disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol 15(2001), 371-384.
[11] Langman, M.J., Weil, J., Wainwright, P., Lawson, D.H., Rawlins, M.D.,Logan, R.F., Murphy, M., Vessey, M.P., Colin-Jones, D.G.: Risks ofbleeding peptic ulcer associated with individual non-steroidal anti-inflammatory drugs. Lancet 343 (1994), 1075-1078.
[12] Lundell, L.R., Dent, J., Bennett, J., et al.: Endoscopic assessment ofesophagitis: clinical and functional correlates and further validationof Los Angeles classification. Gut 45 (1999), 172-180.
[13] Moayyedi, P., Soo, S., Deeks, J., Forman, D., Harris, A., Innes, M., Delaney, B.: Systematic review: antacids, H2-receptor antagonists,prokinetics, bismuth and sucralfate therapy for non-ulcer dyspep-sia. Aliment Pharmacol Ther 17 (2003), 1215–1227.
[14] Moayyedi, P., Talley, N.J.: Gastro-oesophageal reflux disease. Lancet367 (2006), 2086–2100.
[15] Pan, T., Wang, Y., Guo, Z., Wang, Q.: Additional bedtime H2-recep-tor antagonist for the control of nocturnal gastric acid breakt-hrough. Cochrane Database Syst Rev 18 (2004), CD004275.
[16] Peterson, W., Sturdevant, R.A.L., Frankl, H.D., et al.: Healing of duo-denal ulcer with an antacid regimen. N Engl J Med 297 (1977), 341-346.
[17] Poynard, T., Lemaire, M., Agostini, H.: Meta-analysis of randomizedclinical trials comparing lansoprazole with ranitidine or famotidinein the treatment of acute duodenal ulcer. Eur J Gastroenterol Hepatol 7 (1995), 661-665.
[18] Rösch, W.: Ulkustherapeutika. In: Therapie gastroenterologischerKrankheiten (W.F. Caspary, J. Mössner, J. Stein, Hrsg.), Springer-Ver-lag, Berlin, Heidelberg, New York, 2005, 605-611.
[19] Rodrigo, L., Viver, J., Conchillo, F., Barrio, E., Forne, M., Zozaya, J.M.,Alvarez, A., Dieguez, P., Munoz, M., Panes, J.: A multicenter, rando-mized, double-blind study comparing famotidine with cimetidine inthe treatment of active duodenal ulcer disease. Digestion 42(1989), 86-92.
[20] Sabesin, S.M., Berlin, R.G., Humphries, T.J., Bradstreet, D.C., Wal-ton-Bowen, K.L., Zaidi, S.: Famotidine relieves symptoms of ga-stroesophageal reflux disease and heals erosions and ulcerations.Results of a multicenter, placebo-controlled, dose-ranging study.USA Merck Gastroesophageal Reflux Disease Study Group. Arch Intern Med 151 (1991), 2394-2400.
[21] Scarpignato, C., Pelosini, I., Mario, F.D.: Acid Suppression Therapy:Where do we go from here? Dig Dis 24 (2006), 11-46
[22[ Steen, K.S., Lems, W.F., Aertsen, J., et al.: Incidence of clinically manifest ulcers and their complications in patients with rheumatoidarthritis. Ann Rheum Dis 60 (2001), 443-447.
[23] Stein, J.: Stressulkusprophylaxe – Wann, womit und wie viel. Inten-siv- und Notfallmedizin (2006) im Druck.
[24] Tytgat, G.N., Nicolai, J.J., Reman, F.C.: Efficacy of different doses ofcimetidine in the treatment of reflux esophagitis. A review of threelarge, double-blind, controlled trials. Gastroenterology 99 (1990),629-634.
[25] Vaskil, N., Guda, N., Partington, S.: The effect of over-the-counterranitidine 75 mg on night-time heartburn in patients with erosiveoesophagitis on daily proton pump inhibitor maintenance therapy.Aliment Pharmacol Ther 23 (2006), 649-653.
[26] Wolfe, M.M., Lichtenstein, D., Sing, G.: Gastrointestinal toxicity ofnonsteroidal antiinflammatory drugs. N Engl J Med 340 (1999)1888-99.
[27] Wolfe, M.M., Sachs, G.: Acid suppression: optimizing therapy for gastroduodenal ulcer healing, gastroesophageal reflux disease, andstress-related erosive syndrome. Gastroenterology 118 (Suppl 1)(2000), S9-31.
Die Autoren:Prof. Dr. Dr. Jürgen Stein; 1978-1989 Studium derErnährungswissenschaft (Ökotrophologie), Biophy-sik und Medizin an der Universität des SaarlandesSaarbrücken und der Justus-Liebig-Universität,Gießen; 1983 Diplomprüfung in Ökotrophologie;1989 Staatsexamen in Medizin an der JLU Gießen;1989-1990 Arzt i. P. und 1990-1996 Wiss. Ass. imZentrum Innere Medizin der UniversitätsklinikFrankfurt, Med. Klinik II; 1990 Promotion zum Dr.oec. troph.; 1991 Promotion zum Dr. med. an derJustus-Liebig-Universität Gießen; 1996 Anerkennungzum Facharzt für Innere Medizin; 1996 Habilitationfür das Fach Innere Medizin an der JWG-UniversitätFrankfurt 1997 Erwerb der Fachgebietsqualifikationinternistische Intensivmedizin; 1998 C2-Hochschul-dozentur für Innere Medizin; C3-Professur für InnereMedizin (Schwerpunkt Gastroenterologie, Ernäh-rungs- und Präventivmedizin) an der UniversitätFrankfurt; 2002 Geschäftführender Oberarzt desZentrums Innere Medizin; Seit 2002 Sekretär derRhein-Main AG für Gastroenterologie; 2003 Erwerbder Zusatzqualifikation Gastroenterologie
42 | Pharm. Unserer Zeit | 1/2007 (36) www.pharmuz.de © 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

G A S T R O I N T E S T I N A L E E R K R A N K U N G E N | K L I N I K
Prof. Dr. med. Wolfgang Rösch (geb. 1940), Medi-zinstudium in Erlangen, Berlin, Wien und München;1965 Staatsexamen und Promotion in Erlangen;1965-1967 Medizinalassistentenzeit in Flensburgund Passaic, USA; 1967-1968 wissenschaftlicher Assistent am Pathologischen Institut der UniversitätErlangen-Nürnberg; 1968-1981 Medizinische Uni-versitätsklinik Erlangen-Nürnberg; 1974 Facharztfür Innere Medizin, Zusatzbezeichnung Gastroente-rologie; 1975 Habilitation für das Fach Innere Medi-zin; 1978 Leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik der Universität Erlangen-Nürnberg; 1981 C3-Professur für Innere Medizin; 1981–2005 Chefarztder Medizinischen Klinik am Krankenhaus Nord-west, Frankfurt/Main; 2005 Präsident der Mittel-deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie.
Anschrift:Prof. Dr. Dr. Jürgen SteinMedizinische Klinik I- ZAFESJ. W. Goethe-Universität FrankfurtTheodor-Stern-Kai 760590 Frankfurt/[email protected]
© 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.pharmuz.de 1/2007 (36) | Pharm. Unserer Zeit | 43
INTERESSANTE INTERNETADRESSEN ZU DEN THEMEN „ANTAZIDA“ UND „MAGENERKRANKUNGEN“ |http://www.gastroenterologe.de/ und http://www.gastroenterologe.de/patient/erkrankungen/speiseroehre/reflux.html Informationen für Arzt und Patienten zu verschiedenen Themen
http://www.ernaehrung.de/tipps/MD_Erkrankungen/md11.htmHomepage des Deutschen Ernährungsberatungs- und -informationsnetzes (DEBInet) mit Tipps für Magen-Darm-Erkrankungen
http://www.magenspezial.deHomepage der Redaktion MAGEN SPEZIAL des Instituts für Medizin und Gesundheitspflege
http://www.gesundheit-aktuell.de/Refluxkrankheit_der_Speiseroehre.651.0.htmlOnline-Gesundheitsratgeber zum Thema GERD
http://www.sodbrennen-welt.deInternetseite der „Sodbrennen-Welt“
http://www.sodbrennen-aktuell.deInformationsseite der Firma SCHWARZ PHARMA
http://www.magen.hexal.deInformationsseite der Firma HEXAL zum Thema Magen & Darm
http://www.astrazeneca.deHomepage der Firma AstraZeneca mit interessanter Patientenfortbildung zum Thema Sodbrennen
http://www.altanapharma.deHomepage der ALTANA Pharma Deutschland mit Informationen zu den Themen „Sodbrennen“ und „Refluxkrankheit“
http://www.talcid.deInformationsseite der Firma BAYER mit Tipps zum Thema Ernährung und Magenbeschwerden