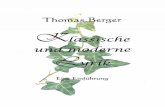Klassisch oder „Pflege-Bahr“?
Transcript of Klassisch oder „Pflege-Bahr“?

recht | steuern | wirtschaft 111EUROROEURO§§
§§
§
§22
DFZ 1 · 2014
Private Pflegezusatzversicherung
Klassisch oder „Pflege-Bahr“?Die private Krankenversicherung spricht von regem Zuspruch: Nach der Lesart des Verbandes der privaten Krankenversicherung (PKV) ist die zum 1. Januar 2013 neu eingeführte staatlich (steuer-lich) geförderte Pflegezusatzversicherung ein „durchschlagender Erfolg“. Bis Mitte November 2013 hatten bereits mehr als 270.000 Personen eine private Pflegezusatzversicherung, den „Pflege-Bahr“, bei einem Unternehmen der PKV abgeschlossen. Aktuell kämen etwa 1900 Anträge jeden Tag hinzu, sodass die 24 PKV-Versicherungsgesellschaften, die solche Tarife bislang anbieten, damit ausgelastet seien, Versicherte beim Abschluss und Aufbau einer privaten Pflegezusatzversicherung zu beraten.
Aus den Vertragsabschlüssen geht hervor, dass insbesondere die jüngere Generation im Alter zwischen 25 und 35 Jahren steuer-lich geförderte Policen abgeschlossen hat. Diese Altersgruppe macht fast 40 Prozent aller Anträge beziehungsweise Vertragsab-schlüsse aus, so der PKV-Verband. Bei Versicherten, die 50 Jahre und älter sind, sind es 56 Prozent. Auch Angehörige der freien Berufe und der Selbstständigen, darunter viele Ärzte, Zahnärzte und andere Heilberufe, werden vom Angebot der geförderten Zusatzversicherung angelockt.
„Praktizierte Generationensolidarität“Nach der Interpretation des PKV-Verbandes ist die steuerlich geförderte und kapitalgedeckte Pflegezusatzversicherung eine „praktizierte Generationensolidarität“, die dazu beiträgt, dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen und bestehen-de Versicherungslücken bei der gesetzlichen Versicherung zu schließen. Diese ist seit Einführung Anfang 1995 lediglich eine Teilkaskoversicherung, die ergänzende Versicherungen ermög-lichen soll. Noch längst ist nicht das vom Fiskus zur Förderung von „Pflege-Bahr“-Policen zur Verfügung gestellte Steuervolu-men abgerufen und ausgeschöpft worden.
Verbraucherschützer und Versicherungsmakler raten, vor Abschluss eines geförderten Pflegeversicherungsvertrags sowohl die Leistungen als auch die Finanzierung und die Rentabilität solcher Policen zu prüfen. Alternative Absicherungsmöglichkei-ten, etwa über eine „normale“ kapitalgedeckte Zusatzversiche-rung, müssen ebenso gecheckt werden, um die Vor- und Nach-teile gegenüber der geförderten Versicherung abzuwägen. Die beiden Versicherungsalternativen unterscheiden sich in wesent-lichen Punkten.
Es gibt private Pflegetagegeldversicherungen, die das finanziel-le Risiko in allen Pflegestufen absichern. Sie werden für 45-jäh-rige Neukunden ab 55 Euro Monatsprämie und für 55-Jährige ab 85 Euro Monatsprämie offeriert und sind für Höherverdie-nende mit einem Alter von mehr als 40 Jahren nach Einschät-zungen von Verbraucherschützern und Finanztestern empfeh-lenswert. Finanztester der Stiftung Warentest kritisieren, dass die steuerlich geförderten Policen relativ niedrige Leistungen vorsehen, die die Finanzierungslücke bei Weitem nicht schlie-ßen und zumeist keine Möglichkeit bieten, die Geldleistungen durch höhere Beiträge zu steigern. Die Leistungen in den Pfle-gestufen I und II sowie bei Demenz seien oftmals schlechter als in den ungeförderten Tarifen. Zudem müssten die Versicherten im Pflegefall weiterzahlen.
Versicherbarer PersonenkreisEinen „Pflege-Bahr“ kann jeder abschließen, der 18 Jahre und älter ist und noch keine Pflegeleistungen bezieht. Es werden bei der staatlich geförderten Variante keine Gesundheitsatteste gefordert. Für den Versicherer besteht Kontrahierungszwang, also eine Aufnahmepflicht durch die Versicherung. Die Anbieter müssen sich von ihren üblichen Aufnahme- und Kalkulations-prinzipien verabschieden. Weil sie jeden erwachsenen Interes-senten versichern müssen, dürfen weder Risikozuschläge noch Leistungsausschlüsse vereinbart werden. Die Höhe der Prämien
© is
tock
/ th
inks
tock
phot
os.c
om

recht | steuern | wirtschaft 23
DFZ 1 · 2014
ist allein altersabhängig. Allerdings muss der Neuversicherte eine mindestens fünfjährige Wartezeit abwarten, um Leistungen zu beziehen. Ist der Risikofall bereits eingetreten, besteht kein Leis-tungsanspruch – nach der Devise: Ein brennendes Haus kann man nicht mehr gegen Feuerschaden versichern! Während der Wartezeit haben die Versicherten zwar Prämie zu zahlen, aber keinen Anspruch auf Leistungen. Experten gehen davon aus, dass steuerlich geförderte Policen vor allem für jene interes-sant sind, die aufgrund von Vorerkrankungen keine oder kei-ne bezahlbaren „normalen“ PKV-Pflegepolicen erhalten oder bezahlen können.
Bei der bereits seit Langem eingeführten „klassischen“ Zusatz-versicherung zur Abdeckung des Pflegerisikos gibt es keine Altersgrenzen für die Aufnahme. Dagegen ist ein Gesundheits-attest bei der Antragstellung weiterhin verpflichtend. Erforder-lich ist keine Gesundheitsuntersuchung bei einem Arzt, son-dern lediglich eine wahrheitsgemäße Erklärung des Antragstel-lers beziehungsweise ein ärztliches Testat. Werden falsche Anga-ben gemacht und Vorerkrankungen verschwiegen, erlischt der Leistungsanspruch im Risikofall.
Versicherungsleistungen, VersicherungsumfangDamit ein „Pflege-Bahr“-Vertrag förderungsfähig ist, müssen Zahlungen für die Pflegestufen 0 bis III vereinbart werden. In Pflegestufe III muss die Versicherungssumme mindestens 600 Euro je Monat betragen. Die geförderte Versicherung kann bereits bei einem monatlichen Eigenbetrag in Höhe von zehn Euro abgeschlossen werden; dazu legt der Staat fünf Euro drauf. Damit kann eine monatliche Leistung von fast 2000 Euro in Pfle-gestufe III abgesichert werden – also mehr als das Dreifache der gesetzlichen definierten Mindestleistung in Höhe von 600 Euro. In den Policen sind als Auszahlungsminimum zehn Prozent der Versicherungssumme in Stufe 0 wegen eingeschränkter All-tagskompetenz, 20 Prozent in Stufe I und 30 Prozent in Stufe II vorgesehen. Allerdings können die Versicherer höhere Prozent-sätze anbieten.
Den Zuschuss muss man nicht selbst beantragen – das über-nimmt die Versicherung im Auftrag des Versicherten. Die Ver-sicherung bestätigt der zentralen Zulagenstelle, dass der Ver-trag die gesetzlichen Auflagen erfüllt und somit förderungsfä-hig ist. Übermittelt werden außerdem die personenbezogenen Vertragsdaten und Informationen darüber, welche Beiträge der Versicherte gezahlt hat und zahlen wird. Wenn die Bedingun-gen erfüllt sind, wird der Förderbetrag direkt an die Versiche-rung überwiesen. Der Versicherte muss seine Versicherung auch darüber informieren, wenn er nicht mehr pflegepflichtversichert ist. Das kann beispielsweise bei einem Umzug ins Ausland sein. Denn mit dem Ende der Pflichtversicherung erlischt auch der Anspruch auf den Zuschuss, und die Versicherung muss den Zulagenantrag zurücknehmen.
In der klassischen Pflege-Tagegeldversicherung sind in der Regel Leistungen für die Stufen I bis III versicherbar. Die Ein-beziehung der neu geschaffenen Stufe 0 ist möglich, aber eher die Ausnahme. Eine Mindestversicherungssumme gibt es nicht, der Leistungsumfang des Vertrags kann den Wünschen und persönlichen Bedürfnissen angepasst und vereinbart werden.
Bei der geförderten Pflegezusatzversicherung muss die bei-tragspflichtige Wartezeit von fünf Jahren beachtet werden, die lediglich bei Pflegebedürftigkeit nach einem Unfall entfällt. Die Wartezeit bei klassischen Pflegetage-Policen beträgt dagegen
Pflege-PolicenCheckliste einer ausreichenden Zusatzversicherung
Verbraucherschützer ebenso wie der Bund der Versicher-ten haben in Merkblättern Kriterien für eine „gute“ priva-te Pflegzusatzversicherung umrissen. Im Versicherungsfall sollte eine Pflegezusatz-Policen folgende Kriterien erfüllen:
» Der private Zusatzversicherer sollte in allen drei Pflege-stufen im Risikofall zahlen.
» Die Versicherung sollte sowohl die häusliche als auch die stationäre Pflege finanziell abdecken. Wenn Ange-hörige oder Freunde pflegen, sollten die Leistungen dafür nicht niedriger sein.
» Bei Kostensteigerungen in der Pflege sollten die Zusatz-leistungen ohne Gesundheitsprüfung und ohne Risiko-zuschläge nachträglich zu erhöhen sein.
» Die Leistungen der Versicherung sollten dann einset-zen, wenn die Pflegeversicherung die Pflegebedürftig-keit anerkannt hat.
» Die private Versicherung sollte die Pflegestufe der gesetzlichen und privaten Pflegepflichtversicherung übernehmen.
» Die Versicherung sollte auf das ordentliche Kündi-gungsrecht innerhalb der ersten drei Versicherungs-jahre verzichten.
» Die Versicherung sollte nicht auf eine Karenzzeit und/oder eine dreijährige Wartezeit bis zur ersten Leistungs-pflicht bestehen. Beides wäre ungünstig, wenn die Ver-sicherten im Pflegefall erst nach diesen Fristen Leistun-gen aus der Versicherung erhielten.
» Die Versicherung sollte auch bei der neu eingeführten Pflegestufe 0 beziehungsweise bei dem Risikotatbe-stand Demenz leisten.
» Ab Eintritt des Pflegefalls sollte kein laufender Beitrag mehr entrichtet werden müssen.
» Die Versicherung sollte bei stationärer Pflege in allen Pflegestufen 100 Prozent des vereinbarten Tagegelds zahlen.
» Atteste über die Pflegebedürftigkeit sollten nicht in regelmäßigen Abständen verlangt werden. Ausnah-men: Wegfall oder Minderung der Pflegebedürftigkeit.
» Informationen und Ratschläge: Die regional organi-sierten Verbraucherzentralen beraten zu Versiche-rungsverträgen; ein halbstündiges Beratungsgespräch kostet 40 Euro. Kontakt zu den Verbraucherzentralen: http://www.vz-nrw.de; Telefon: 900/189 79 67
» Bund der Versicherten: Informationen über ein Merk-blatt zur privaten Zusatzpflegeversicherung, bestell-bar unter Telefon: 0 41 93/9 42 22 oder im Internet unter http://www.bundderversicherten.de
nur drei Jahre. In der Praxis bieten manche Versicherer Verträ-ge ohne Wartezeit an. Bei unfallbedingter Pflegebedürftigkeit entfällt bei klassischen Policen diese ohnehin.
Dr. Harald Clade, freier Journalist