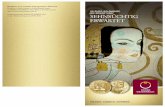Praxisberichte (I) – Erfassung und Beschreibung germanistischer Internetquellen
praxisberichte-kasachstan-unternehmerische-erwartung-roedl-partner
-
Upload
taissiya-sutormina -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of praxisberichte-kasachstan-unternehmerische-erwartung-roedl-partner
260
Der rechtliche Rahmen und die Rechtssicherheit in
Kasachstan sind relativ gut entwickelt, wobei es auch
erhebliche Schwachstellen gibt. Deutsche Unternehmen
unterhalten mit ca. 200 Repräsentanzen und Filialen sowie
mit 400 in Kasachstan ansässigen Tochtergesellschaften Handelsbeziehungen mit kasachischen
Partnern. Weitere 1.500 Unternehmen agieren auf dem kasachischen Markt von Deutschland
und/oder von Russland aus. Im Jahr 2016 sind vermehrte Investitionen aus China zu erwarten.
Bei einem Besuch von dem kasachischen Präsidenten Nasarbajew in Peking im September 2015
wurden milliardenschwere Projekte unterzeichnet.
Ähnlich wie in Russland kann die erste Kontaktaufnahme mit einem kasachischen Geschäftspart-
ner mit Kommunikationsschwierigkeiten verbunden und durch kulturelle Differenzen geprägt
sein. Für die Begründung einer erfolgreichen Handelsbeziehung ist der enge persönliche Kontakt
zu den kasachischen Geschäftspartnern maßgeblich.
Entscheidend für einen erfolgreichen Start-up auf dem kasachischen Markt sind eine gründliche
Vorbereitung und die Kenntnis der kasachischen Geschäftsgestaltung. Statt ein viel Erfolg ver-
sprechendes Geschäft unter Verwendung von Standard-Verträgen abzuwickeln und einen fach-
kundigen Berater erst dann einzuschalten, wenn es bereits zu einem Rechtsstreit gekommen ist,
empfiehlt es sich, sich zunächst Klarheit über die Bonität und Zuverlässigkeit des kasachischen
Vertragspartners, insbesondere bei neuen Geschäftsbeziehungen, zu verschaffen. Bereits hier-
durch kann der größte Teil der Schwierigkeiten, der in grenzüberschreitenden Lieferbeziehungen
mit kasachischen Partnern in der Praxis nicht selten festgestellt werden kann, vermieden werden.
Wer hier beide Augen verschließt, handelt grob fahrlässig. Bemerkenswerterweise gilt hier nach
wie vor der Grundsatz von Lenin: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“.
Erhebliche Risiken ergeben sich insbesondere bei der Vertragsgestaltung. Das fehlende Vertrauen
der Bevölkerung in das Gerichtswesen und in die Unabhängigkeit der Justiz haben einen Grund.
Der hohe Grad der Korruption, die nach wie vor unzureichende Ausbildung von Richtern sowie
die ineffiziente Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen sind die Ursachen für das Misstrauen.
Ein gut beratenes deutsches Unternehmen sollte sich gegen einen möglichen Zahlungsausfall
bereits dadurch schützen, dass nur nach dem Prinzip der Vorauskasse agiert wird.
Bei einer Unternehmensgründung in Kasachstan ist neben der richtigen Unternehmensform ins-
besondere auch die Auswahl des lokalen Geschäftsführers sorgfältig vorzunehmen. Vor dem
Hintergrund, dass die Beschränkungen der Vertretungsmacht des Geschäftsführers nur im In-
nenverhältnis gelten und die Gesellschaft die Beweislast dafür trägt, dass ihr Vertragspartner
zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses von den Beschränkungen im Außenverhältnis wusste,
gilt es ausreichende Kontrollmechanismen in der Satzung zu verankern. Bei Vertragsschlüssen
KASACHSTAN
261
sollte deshalb stets ein aktueller Nachweis einer Vertretungsberechtigung, respektive der Be-
schluss über die Bestellung des Geschäftsführers vorgelegt werden, dem solche weiterführenden
Informationen entnommen werden können.
Rödl & Partner ist in Kasachstan mit dem Standort in Almaty vertreten. Mit einem Team von
kasachischen und deutschen Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern unterstüt-
zen wir unsere Mandanten seit 2009 in allen Fragen von Investitionen in einem der wichtigsten
Zukunftsmärkte zwischen Europa und Asien – in deutscher Sprache und aus einer Hand.
262
Steuern
Sachverhalt:
Ein in Deutschland ansässiges Unternehmen lieferte eine Anlage nach Kasachstan. Es fand eine
vertragliche Preisaufteilung zwischen den Lieferanteilen und den lokalen Leistungsanteilen (Su-
pervision, Beratung und Service) statt. Im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen
in Kasachstan wurde entsprechend dem kasachischen Steuerrecht eine steuerliche Betriebsstät-
te angemeldet. Die Abrechnung der lokalen Dienstleistungen sollte erst nach Beendigung des
Projekts erfolgen. Das Unternehmen vertrat die Ansicht, dass die Abgabe von Steuererklärun-
gen nicht notwendig sei, da ohnehin nur „Nullsteuererklärungen“ abgegeben werden müssten.
Sämtliche Kosten, die im Rahmen des Gesamtprojekts auf die Erbringung lokaler Dienstleistungen
entfielen, sollten erst nach Abschluss der Arbeiten durch Abgabe einer Gesamtsteuererklärung
im kasachischen Inland gewinnmindernd geltend gemacht werden. Während eines Zeitraumes
von mehr als zwei Jahren wurden im Ergebnis weder Quartals- noch Jahressteuererklärungen für
die Betriebsstätte abgegeben. Die Abgabefrist für diese Zeiträume war längst verstrichen, als sich
das Unternehmen an Rödl & Partner wandte.
Was kann man jetzt tun?
Nach der steuerlichen Prüfung des Sachverhalts wurde dem Unternehmen mitgeteilt, dass
der Abzug von Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungsaufwendungen auch für die
Betriebsstätte einer nicht ansässigen juristischen Person möglich ist, um den in Kasachstan er-
zielten Gewinn zu minimieren. Es wurde zudem mitgeteilt, dass auch diejenigen Aufwendun-
gen, die in den vergangenen zwei Jahren der Betriebsstätte entstanden sind, im Rahmen der
Abgabe einer Körperschaftsteuererklärung noch als Betriebsausgabe geltend gemacht werden
können und mithin nicht verloren sind. Trotz der gegebenen grundsätzlichen Möglichkeit der
Verringerung der steuerlichen Bemessungsgrundlage entstand die Situation, dass aufgrund
der Nichtabgabe einer (Null-)Steuererklärung Säumniszuschläge und Ordnungsgelder gezahlt
werden mussten.
263
Was hätte man von Beginn an anders machen sollen?
Die Frage des Abzugs von Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungsaufwendungen hät-
te unmittelbar nach der Registrierung der Betriebsstätte des Unternehmens als nicht ansässige
juristische Person zwingend mit fachkundigen Beratern erörtert werden müssen. Das Unterneh-
men wäre in so einem Fall dahingehend beraten worden, dass die nach dem kasachischen Recht
anzuerkennenden Aufwendungen durch zwei Methoden, nämlich die proportionale Aufteilung
und die unmittelbare Zuordnung von Aufwendungen zu Abzugszwecken, ermittelt werden kön-
nen. Das Unternehmen hätte nicht nur die Möglichkeit gehabt, von Beginn an Buchhaltungs-
unterlagen an die Anforderungen der handelsrechtlichen Rechnungslegung in Kasachstan an-
zupassen, sondern auch die Zahlung von Säumniszuschlägen und Ordnungsgeldern vermieden.
Steuern
Sachverhalt:
Ein in Deutschland ansässiges Unternehmen (Verleiher) überließ seine Arbeitnehmer an ein ande-
res deutsches Unternehmen mit einer Niederlassung in Kasachstan (Entleiher) auf der Grundlage
eines Rahmenarbeitnehmerüberlassungsvertrages. Ob durch die Arbeitnehmerüberlassung das
in Kasachstan nicht ansässige Unternehmen eine steuerliche Betriebsstätte begründen könnte
und deshalb in Kasachstan seine Erlöse besteuern müsste, ist von keiner Seite geprüft worden.
Die Arbeitnehmer sind von Deutschland aus an den kasachischen Endkunden weiterverliehen
worden.
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden deutschen Unternehmen funktionierte bis zu dem
Zeitpunkt, als der kasachische Endkunde die Behauptung aufgestellt hat, der Verleiher habe
in Kasachstan durch die Arbeitnehmerüberlassung eine steuerliche Betriebsstätte begründet.
Das dem Verleiher zustehende Entgelt für die Arbeitnehmerüberlassung unterliege der Quel-
lenbesteuerung in Höhe von 20 Prozent durch den in Kasachstan ansässigen Entleiher, so der
kasachische Endkunde. Dies gelte auch für die Vergangenheit, wobei den Entleiher die subsidiäre
Haftung treffe, falls dieser nicht die Quellensteuer einbehalte und an den kasachischen Fiskus
abführe. Aus Angst zu haften, hat der Entleiher in der Folgezeit den Verleiher für die Arbeitneh-
merüberlassung nicht vergütet und die Quellensteuer (teilweise) auf eigene Kosten abgeführt.
Was kann man jetzt tun?
Nach der steuerlichen Prüfung des Sachverhalts wurde festgestellt, dass weder nach dem kasa-
chischen Recht noch nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik
264
Deutschland und der Republik Kasachstan im konkreten Fall der Verleiher in Kasachstan eine
steuerliche Betriebsstätte begründet hat. Die Informationen des kasachischen Endkunden waren
schlicht nicht zutreffend. Der Entleiher war nicht verpflichtet, die Quellensteuer vor der Aus-
zahlung des Entgelts an den Verleiher einzubehalten. Die entstandenen Irritationen konnten im
Rahmen einer gemeinsamen Telefonkonferenz ausgeräumt werden.
Der Entleiher hat die Erstattung der von ihm ohne Rechtsgrund in lokaler Währung gezahlten
Quellensteuer beantragt. Die Steuererstattung ist ein langwieriger Prozess, der in Kasachstan
Monate dauert und auch zum Anlass für eine steuerliche Prüfung genommen werden kann. Zu-
dem ergibt sich aufgrund der Dauer des Erstattungsverfahrens das Risiko der zwischenzeitlichen
Abwertung des kasachischen Tenge, der zu erheblichen Abschreibungen, teilweise bis zu 25
Prozent, führen könnte.
Was hätte man von Beginn an anders machen sollen?
Die Frage der Entstehung einer steuerlichen Betriebsstätte ist stets bei einem Engagement im
Ausland zu stellen. Im vorliegenden Fall hätte man diese Frage, welchem Staat die Besteuerung
der Einkünfte aus der Arbeitnehmerüberlassung zusteht, noch vor Abschluss entsprechender
Vereinbarungen klären müssen.
Nach der Prüfung der Rechtslage wäre dem Verleiher mitgeteilt worden, welche Fallkonstel-
lationen bei einer gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung zur Begründung einer steuerlichen
Betriebsstätte für den Verleiher sowohl nach dem internationalen als auch nach dem lokalen
Steuerrecht führen. In einem solchen Fall hätten der Entleiher Äußerungen des kasachischen
Unternehmens nicht zur Zahlung an den kasachischen Fiskus veranlasst.
Recht
Sachverhalt:
Eine Rechtsanwaltskanzlei beriet ein Mineralölunternehmen, das Schmierstoff an ein kasachi-
sches Unternehmen lieferte. Dem lag ein Handelsvertrag zugrunde, in dem die Rechtsanwalts-
kanzlei für den Fall von Rechtsstreitigkeiten die Zuständigkeit des Gerichts in Köln festlegte. Nach
langwierigen Verhandlungen mit dem kasachischen Vertragspartner wandte sich die Rechtsan-
waltskanzlei an das Team von Rödl & Partner in Almaty. Es wurde festgestellt, dass die kasachi-
sche GmbH zwischenzeitlich die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt hatte.
265
Was kann man jetzt tun?
Zwischen Kasachstan und Deutschland existiert kein Abkommen über die gegenseitige Aner-
kennung und Vollstreckung gerichtlicher Urteile. Die Folgen einer solchen Gerichtsstandverein-
barung sind die, dass ein deutsches Gerichtsurteil in Kasachstan nicht vollstreckbar ist und der
Schuldner im Falle einer gerichtlichen Geltendmachung in Kasachstan mit einer an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit die Einrede der Unzuständigkeit erhoben hätte. Die Vereinbarung
eines kasachischen Gerichtsstandes wäre die bessere Wahl.
Was hätte man von Beginn an anders machen sollen?
Es empfiehlt sich stets, die Möglichkeit zu erwägen, eine Schiedsgerichtsklausel in den Vertrag
aufzunehmen. Kasachstan ist dem New Yorker Übereinkommen von 1958 „über die Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche“ im Jahr 1996 beigetreten. Sowohl Ka-
sachstan als auch die Bundesrepublik Deutschland haben dieses Übereinkommen ratifiziert. Im
vorliegenden Fall hätte beispielsweise der kasachische internationale Schiedsgerichtshof mit Sitz
in Almaty als zuständiges Gericht benannt werden können. Dann bestünde die Möglichkeit,
den Ablauf und die Gestaltung eines Gerichtsverfahrens selbst zu bestimmen. Zudem hätte die
Möglichkeit genutzt werden können, sich über die Solvenz des kasachischen Unternehmens als
Schuldner zu erkundigen. Es besteht insofern die Möglichkeit, prüfen zu lassen, ob gegen ein
kasachisches Unternehmen Gerichtsverfahren anhängig sind und ob dieses Unternehmen in den
letzten Quartalen im Vergleich zu den Vorjahren überhaupt Steuern gezahlt hat. Beides sind
wichtige Indikatoren einer drohenden Zahlungsunfähigkeit.
Recht/Verwaltung
Sachverhalt:
Ein erfolgreiches deutsches Unternehmen vereinbarte unter Zwischenschaltung einer kasachi-
schen GmbH mit dem Ministerium die Lieferung eines Gerätes zum Druck von Pässen. Die Lie-
ferung dieses Gerätes über die kasachische GmbH an die Behörde selbst war aus der Sicht des
deutschen Unternehmens wirtschaftlich sinnvoll, weil kasachische Unternehmen bei öffentlichen
Ausschreibungen nach der kasachischen Gesetzgebung gegenüber ausländischen Unternehmen
bevorzugt behandelt werden.
An die Vereinbarung eines Bürgschaftsvertrages mit der Behörde ist zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung des Kaufvertrages mit der kasachischen GmbH nicht gedacht worden. Der Geschäfts-
führer der kasachischen GmbH sicherte – nachdem eine sechsstellige Restkaufpreisforderung
266
über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr nicht ausgeglichen wurde – zu, innerhalb eines
Monats einen Schuldübernahmevertrag zu unterzeichnen und für die Verbindlichkeit der GmbH
aufzukommen. Nach Ablauf der Monatsfrist wurde festgestellt, dass bei dem kasachischen Part-
ner ein Geschäftsführer- und Gesellschafterwechsel stattfand und sich die kasachische GmbH
nunmehr in der Liquidation befand.
Was kann man jetzt tun?
Mangels eines Bürgschaftsvertrages sowie des verspäteten Herantretens an den (ehemaligen)
Geschäftsführer ist eine Erfüllung der Verbindlichkeit durch die kasachische GmbH als einzige
Schuldnerin aussichtslos. Aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen dem deutschen Unter-
nehmen und der kasachischen Behörde bleibt nunmehr zu hoffen, dass diese Forderung durch
die Behörde übernommen wird.
Was hätte man von Beginn an anders machen sollen?
Auf der vertraglichen Ebene bestand nach dem kasachischen Recht die Möglichkeit, für das zwi-
schengeschaltete Unternehmen zu bürgen. Die Gestaltung des Bürgschaftsvertrages zwischen
den deutschen Unternehmen und der kasachischen Behörde als Endabnehmer hätte zur Wah-
rung der Interessen aller Beteiligten zwingend vorgenommen werden müssen. Die Experten von
Rödl & Partner raten deshalb dazu, entweder nach dem Prinzip der Vorauskasse zu agieren oder
sich bei internationalen Sicherungsgeschäften professionellen Rat zu holen.