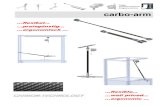Sandra Oppikofer, Elena Mayorova Lebensqualität im hohen ... · cept for the health care. Existing...
Transcript of Sandra Oppikofer, Elena Mayorova Lebensqualität im hohen ... · cept for the health care. Existing...
Sandra Oppikofer, Elena Mayorova
Lebensqualität im hohen Alter – theoretischeAnsätze, Messmethoden und empirischeBefunde
Quality of life in very old age – theoretical models, measures and empiricalfindings
This article aims to give an overview of theoretical models, measures and empirical fin-dings on the quality of life in very old age. A good quality of life (QOL) is today seen as akey individual objective. Accordingly, most psychosocial interventions are directed at en-hancing the quality of life of old and very old people – quality of life has become a key con-cept for the health care. Existing concepts of quality of life however differ widely and arebased on different conditions and assumptions. Nevertheless there is broad agreementthat quality of life is a multidimensional, holistic construct, which should be discussed inan interdisciplinary manner and from many perspectives. Currently, three main generalapproaches to measuring QOL can be distinguished: (1) the “objective” approach that in-fers QOL of an individual from the outside (oQOL), e.g. living conditions via measurementof health impairments; (2) the “subjective” approach which measures an individual’ssubjective interpretation of his or her overall life situation and QOL (sQOL); and (3) the“functional” approach which combines the subjective and objective approach of QOL bylinking the subjective representations of objectively measurable resources to their func-tional value for pursuing individually meaningful activities and goals (fQOL). With the newglobal WHO Strategy and Action plan for healthy ageing (2015), individualised functionalstabilization of quality of life in old age comes into focus.
Keywordsquality of life, life satisfaction, well-being, old age, instruments of measurement, theore-tical model
Ziel dieses Artikels ist es, einen Überblick zu schaffen über theoretische Ansätze, Mess-methoden sowie empirische Befunden der Lebensqualität im hohen Alter. Eine gute Le-bensqualität wird heute als eines der zentralen individuellen Ziele angesehen. Entspre-chend zielen eine Vielzahl an psychosozialen Interventionen darauf ab, die Lebensqua-lität älterer und hochaltriger Menschen zu verbessern – Lebensqualität ist so zu einemSchlüsselkonzept für die Gesundheitsversorgung geworden. Bestehende Lebensquali-tätsmodelle unterscheiden sich jedoch wesentlich voneinander und basieren auf inhalt-lich sehr verschiedenen Voraussetzungen und Grundannahmen. Einig ist man sich indes
Schwerpunkt
101
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
eingereicht 06.11.2015akzeptiert 26.02.2016
102
Schwerpunkt
darüber, dass Lebensqualität ein multidimensionales, ganzheitliches Konstrukt dar-stellt, welches interdisziplinär und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werdenmuss. Heute können drei grundsätzliche Lebensqualitätsansätze ausgemacht werden:(1) Äussere oder objektive Lebensqualität (oQOL), d. h. äussere Lebensbedingungen,welche anhand objektiver Gesundheitsfaktoren erfasst werden, (2) subjektive Lebens-qualität (sQOL), d. h. die subjektive Interpretation der eigenen Lebenssituation und -qua-lität und (3) funktionale Lebensqualität (fQOL), die eine Kombination aus objektivem undsubjektivem Ansatz darstellt. Mit dem neuen globalen Strategie- und Aktionsplan derWHO zum gesunden Altern (2015) rückt die individualisierte funktionale Stabilisierungvon Lebensqualität im Alter in den Fokus.
SchlüsselwörterLebensqualität, Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden, hohes Alter, Messinstrumente,theoretische Modelle
1. Lebensqualität im Alter – theoretische Ansätze
Auf Europäischer Ebene werden heute eine Vielzahl an psychosozialen Interventioneninitiiert, die darauf abzielen, die Lebensqualität älterer und hochaltriger Menschen zuverbessern – Lebensqualität ist so zu einem Schlüsselkonzept für die Gesundheitsver-sorgung geworden – dies besonders im Zusammenhang mit chronischen Erkrankun-gen wie beispielsweise einer Demenzerkrankung (Brod, Stewart & Sands 1999; Law-ton 1991). Was jedoch ist unter Lebensqualität im Alter zu verstehen? Wie äussert siesich und auf welche Art und Weise können individuell bedeutsame Lebenssituationenerfasst, bewertet und zugänglich gemacht werden, um Massnahmen zur Förderungderselben abzuleiten? Im Folgenden wird Alter zunächst undifferenziert zu verschiede-nen Aspekten der Lebensqualitätsforschung in Beziehung gesetzt.
1.1 Lebensqualitätskonzepte im Alter
Mit erhöhter Langlebigkeit und sinkenden Mortalitätsraten zeigt sich eine deutlicheErhöhung des Anteils älterer Menschen in Europa. So soll gemäss europäischer Statis-tik der Anteil an 65jährigen Europäer von derzeit 17,4% im Jahre 2058 auf 27% anstei-gen (Eurostat. 2012). Diese Veränderung der Altersstruktur ist eine der bedeutsamstengesellschaftspolitischen Herausforderung unserer Zeit. Nebst sozialökonomischenFragestellungen – insbesondere bezüglich der stetig steigenden Krankheitskosten –bringt es diese Fragestellung mit sich, wie ein gesundes Altern gefördert und ältereMenschen dabei unterstützt werden können, ihre Selbständigkeit bis ins hohe Alter zuwahren respektive ihre Lebensqualität zu stabilisieren (WHO 2015a, 2015b). Eine gu-te Lebensqualität wird in unserer heutigen Gesellschaft als eines der zentralen indivi-duellen Ziele angesehen (Garratt, Schmidt, Mackintosh, Fitzpatrick 2002).
Obwohl bisher eine Vielzahl von Lebensqualitäts-Konzeptualisierungen formuliertwurden, so zeichnen sich diese meist dadurch aus, eher beschreibend statt definierendzu sein. Momentan scheitern Versuche, Lebensqualität allgemeingültig zu umschrei-
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
ben und zu definieren, meist auch daran, dass diese nicht nur individuell, sondern auchvom Lebensalter und den damit verbundenen Umständen (beispielsweise Lebensstan-dard oder soziales Netz) geprägt ist. Es ist deshalb nicht sinnvoll, von einer spezifischenLebensqualität im Alter zu sprechen (Oppikofer 2013). Ebenfalls spielt die subjektiveKomponente bei der Beurteilung eine grosse Rolle.
Die meisten Forschungsbestrebungen sind darauf ausgerichtet, Lebensqualität imAlter zu messen; dies bedingt eine klare Definition des zugrunde liegenden Lebensqua-litätsverständnisses. Obwohl in der Zwischenzeit eine Reihe von Instrumenten zurMessung der Lebensqualität entwickelt worden sind (für eine Übersicht: Ettema,Dröes, de Lange, Mellenbergh, Ribbe 2005; Demenzspezifische Übersicht: Oppikofer2008), existiert bis heute keine – weder auf internationaler noch auf nationaler Ebene –allgemeingültige Definition von Lebensqualität respektive ein Einverständnis damit,wie Lebensqualität gemessen werden soll (Walker, Lowenstein 2009; Walker, Mollen-kopf 2007).
Bestehende Lebensqualitätsmodelle unterscheiden sich wesentlich voneinanderund basieren teils auf inhaltlich sehr verschiedenen Grundlagen (Boggatz 2015). Einigist man sich darüber, dass Lebensqualität ein multidimensionales, ganzheitliches Kon-strukt darstellt, welches gebührt, interdisziplinär und aus verschiedenen Perspektivenuntersucht zu werden (Walker, Mollenkopf 2007). So werden etwa nach Zapf (1979)unter Lebensqualität gute Lebensbedingungen verstanden, die mit einem positivensubjektiven Wohlbefinden einhergehen. Lebensbedingungen sind dabei „beobachtbareLebensverhältnisse, die von Aussenstehenden als wissenschaftlichen und/oder moralischenStandard bewertet werden“ (Zapf 1984: 19). Beispiele dafür sind das Einkommen, dermaterielle Status, die medizinische Versorgung, der Familienstand oder etwa die An-zahl sozialer Kontakte.
Lebensqualität setzt sich in diesem Verständnis durch die Konstellation einzelnen,individuell bedeutsamen Lebensumständen und deren subjektiver Bewertung sowieeinem guten subjektiven Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit zusammen. Die sub-jektive Wahrnehmung der eigenen Lebensbedingungen wird durch Werteorientierun-gen, sprich der eigenen Auffassungen vom Guten und Wünschenswerten, bestimmt.Aus diesen subjektiven Werten ergeben sich Ansprüche und Erwartungen (Habich,Noll 2002: 453). Die starke Abhängigkeit dieser Definition von der subjektiven Kom-ponente ist immer wieder kritisch hinterfragt worden. Eine stärkere Gewichtung funk-tionaler Kriterien ist deshalb Bestandteil neuerer Ansätze zur Erfassung von Lebens-qualität.
Erikson (1993) geht in seinem Modell der Lebensqualität von vier Dimensionenaus: Verfügbare Ressourcen, bestehende Umwelt, Kontrolle durch Person sowie Orien-tierung an Werten. Der Ausgangspunkt bildet dabei die Ressourcen einer Person. Die-se Ressourcen können einerseits materiell sein (beispielsweise Einkommen oderWohnniveau) und andererseits immateriell (physische Gesundheit, Ausbildung, Resi-lienz u. a. m.). Erikson versteht unter den Ressourcen die Mittel, um ein Ziel zu errei-chen (beispielsweise den Erhalt der Selbständigkeit). Beeinflusst wird die Nutzung die-
Schwerpunkt
103
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
104
Schwerpunkt
ser Ressourcen durch bestehende Umweltbedingungen, welche förderlicher aber aucherschwerender Natur sein können. Mit der Dimension „Kontrolle durch Person“möchte Erikson ausdrücken, dass eine Person sich ihre Ziele selber definiert – entspre-chend ihrer Orientierung an Werten – und auch nach Wegen sucht, diese – mittels derihr zur Verfügung stehenden Ressourcen respektive der bestehenden Lebensbedingun-gen – zu verwirklichen.
Die Konzeptualisierung der Lebensqualität besonders geprägt hat der AmerikanerM.P. Lawton. Aus seinen empirischen Arbeiten zur Lebensqualität bei Menschen miteiner Demenzerkrankung hat er ein vierdimensionales Modell abgeleitet. Er beschriebdie Lebensqualität als: „the multidimensional evaluation, by both intrapersonal and soci-al-normative criteria, of the person-environment system of an individual in time past, cur-rent and anticipated“ (Lawton 1991: 6). Lebensqualität konstituiert sich hier in einemKontinuum objektiver (objektive Umwelt und Verhaltenskompetenzen) und subjekti-ver Dimensionen (wahrgenommene Lebensqualität, psychologisches Wohlbefinden).Lawton argumentiert, dass sowohl objektive als auch subjektive Dimensionen wichtigfür die Lebensqualität seien. Sein Konzept ist durch einen sozial-normativen Zugang inden objektiven Dimensionen (soziale und räumliche Umwelt, Verhaltenskompeten-zen) und einem individuellen in den subjektiven Dimensionen (emotionale Befind-lichkeit und subjektive Bewertung der verschiedenen Lebensbedingungen) gekenn-zeichnet (Lawton, Winter, Kleban et al. 1999). Kritisiert wurde an diesem Ansatz, dassLawton Voraussetzungen mit Konsequenzen vermische. Ausserdem erfordert diesesModell eine differenzierte Analyse des eigenen Verhaltens und Erlebens.
Bowling (2004) unterscheidet zwischen einer Makro- (sozial, objektiv) und einerMikrodefinition (individuell, subjektiv) von Lebensqualität und leitet daraus acht ver-schiedene Ansätze der Lebensqualität ab: a) objektive und soziale Indikatoren, b) Zu-friedenheit mit menschlichen Bedürfnissen, c) subjektive soziale Indikatoren (z. B. derLebenszufriedenheit), d) soziales Kapital in Form personeller Ressourcen, e) ökologi-sche und nachbarschaftliche Ressourcen, f ) Gesundheit und Funktionsfähigkeit, g)psychologische Faktorenmodelle (z. B. Autonomie), h) hermeneutische Ansätze(Schwerpunkt auf individueller Werte, Wahrnehmung und Interpretation).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Lebensqualität ein dynamisches,facettenreiches und komplexes Konzept darstellt, welches durch die Interaktion objek-tiver, subjektiver, makro, mikro, positiven und negativen Einflüssen geformt wird(Mollenkopf, Walker 2007).
Unabhängig von der Verschiedenartigkeit der bestehenden Modelle, können heutedrei grundsätzliche Lebensqualitätsansätze ausgemacht werden: (1) Äussere oder ob-jektive Lebensqualität (oQOL), d. h. äussere Lebensbedingungen, welche anhand ob-jektiver Gesundheitsfaktoren erfasst werden (beispielsweise Gesundheitsbeeinträchti-gungen), (2) subjektive Lebensqualität (sQOL), d. h. die subjektive Interpretation dereigenen Lebenssituation und -qualität (beispielsweise die Lebenszufriedenheit) und(3) funktionale Lebensqualität (fQOL), welcher eine Kombination des objektiven undsubjektiven Ansatzes darstellt. Der von Martin et al. (2012) relativ neu formulierte
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
funktionale Lebensqualitätsansatz verbindet subjektive Repräsentationen von objektivmessbaren Ressourcen bezüglich ihres funktionalen Wertes, um individuell bedeutsa-me Ziele und Aktivitäten zu verfolgen. Der Ansatz geht davon aus, dass Personen im je-weiligen Lebenskontext über spezifische Eigenschaften, Fähigkeiten und Ressourcenverfügen und bei einer optimalen Zusammensetzung derselben in der Lage sein kön-nen, eine stabile Lebensqualität herzustellen (beispielsweise Mobilität, die der Ausü-bung individuell bedeutsamer Freizeitaktivitäten dient). Lebensqualität ist in diesemVerständnis weniger von der objektiven Verfügbarkeit von materiellen und immate-riellen Dingen abhängig, sondern vom Grad, mit dem ein vom Einzelnen erwünschterZustand an körperlichem, psychischem und sozialem Befinden auch tatsächlich er-reicht werden kann (Martin, Schneider, Eicher, Moor 2012). Der funktionalen Le-bensqualität liegen vier Dimensionen zu Grunde: funktionale Repräsentationen vonspezifischen Ressourcen, zielgerichtete Aktivitäten sowie Ziele und Relationen zwi-schen diesen Komponenten.
Eine in der Praxis bewährte weitere Perspektive besteht in einer kurzfristigen gegen-über einer langfristigen Betrachtung von Lebensqualitätsaspekten wie beispielsweisedem Wohlbefinden. So wird zum Beispiel von aktuellem Wohlbefinden (d. h. von dermomentanen Befindlichkeit einer Person) in Abgrenzung zum sogenannten habituel-len Wohlbefinden gesprochen (Becker 1991). Damit sich ein gutes langfristiges, sprichhabituelles Wohlbefinden einstellen kann, müssen jedoch grundlegende Rahmenbe-dingungen wie etwa Sicherheit und Geborgenheit erfüllt sein.
1.2 Lebenszufriedenheit versus Lebensqualität
Das Konzept der Lebenszufriedenheit wird oft im gleichen Zug wie die Lebensqualitätgenannt. Die Lebensqualitätsforschung hat sich zwar parallel, jedoch ziemlich unab-hängig vom Konzept der Lebenszufriedenheit entwickelt (Schumacher et al. 2003).Laut der kognitiven Alternstheorie von Thomae (1996) gilt die Lebenszufriedenheitals Kongruenz zwischen Werten und Zielen einerseits und gegebener Situation ande-rerseits. Die subjektive Deutung der Situation als Grundlage für Möglichkeiten undGrenzen individuellen Handelns spielt hier eine grosse Rolle. Zu beiden Konzeptenexistieren indes unterschiedliche Messverfahren (z. B. der Fragebogen zur Lebenszu-friedenheit, FLZ, vgl. Schumacher, Klaiberg, Brähler 2003), deren Anwendung jedochin einem sehr ähnlichen Outcome-Mass resultieren. Der Fragebogen zur Lebenszufrie-denheit umfasst in heutiger Form zehn Bereiche: Gesundheit, Arbeit und Beruf, finan-zielle Lage, Freizeit und Hobby, Ehe und Partnerschaft, Beziehung zu den Kindern, ei-gene Person, Sexualität, Freunde, Bekannte, Verwandte und Wohnung. Vergleichtman den Fragebogen zur Lebenszufriedenheit mit den fünf Dimensionen des Europe-an Quality of Life Questionnaire (EQ-5D; Graf, Claes, Greiner et al. 1998), so fällt auf,dass diese beiden Messintrumente sich sehr ähneln (EQ-5D: Beweglichkeit/Mobilität,für sich selber sorgen, allgemeine Tätigkeiten, Schmerzen/körperliche Beschwerden,Angst/Niedergeschlagenheit). Unsere Vorstellungen über die Lebensqualität habensich jedoch gegenüber den Anfängen der Lebensqualitätsforschung stark verändert.
Schwerpunkt
105
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
106
Schwerpunkt
Bestimmten früher Normen – meist durch medizinische Experten festgelegt – was Le-bensqualität ist, so hat sich heute ein Verständnis von Lebensqualität als individuellesPhänomen durchgesetzt (Netuveli, Blane 2008). Aus diesem Grund finden sich injüngster Zeit in der Literatur mehrere Versuche zur Integration dieser beiden eng ver-wandten Forschungstraditionen.
1.3 Das Wohlbefinden
Ein wesentlicher Teil der Lebensqualität im Alter wird durch das individuell wahrge-nommene Wohlbefinden bestimmt (z. B. Mollenkopf, Walker 2007: 247). Dabei ge-hen verschiedene Ansätze davon aus, dass Wohlbefinden aus einer gefühlsmässigen so-wie einer bewertende Komponente besteht (vgl. Sölva, Baumann, Lettner 1995). Die-ner et al. (1999) schlagen in ihrer Theorie des Subjektiven Wohlbefindens vor, dass sichWohlbefinden aus zwei Bestandteilen zusammensetzt. Einerseits sprechen sie von eineremotionalen oder affektiven und andererseits von einer kognitiv-evaluativen Kompo-nente. Die Erstere wird weiter in einen positiven Affekt, einen negativer Affekt als auchGlück unterteilen. Bereiche der kognitiv-evaluativen Komponente beinhalten eine all-gemeine sowie eine bereichsspezifische Lebenszufriedenheit (vgl. Schumacher, Klai-berg, Brähler 2003: 4).
Wie bereits unter der Kategorisierung der Lebensqualitätskonzepte erwähnt,schlägt Becker (1991) die Unterscheidung zwischen aktuellem und habituellem Wohl-befinden vor. Aktuelles Wohlbefinden wird als Oberbegriff zur Charakterisierung desvorübergehenden, momentanen Erlebens einer Person erachtet, der positiv gefärbteGefühle, Stimmungen und körperliche Empfindungen umfasst. Demgegenüber wirdhabituelles Wohlbefinden als relativ stabile Eigenschaft angesehen. Diese stabile Ei-genschaft des Wohlbefindens ist ein wesentlicher Bestandteil und heutiger For-schungsgegenstand der Lebensqualität.
Zu personenzentrierten Ansätzen zum Wohlbefinden werden motivationstheoreti-sche, kognitivistische, persönlichkeitspsychologische und integrierende Zugänge ge-zählt (Perring-Chiello 1997). Die Theorie der seelischen Gesundheit (Becker 1991)weist zwei varianzstarke Konstrukte auf, die sich gut replizieren lassen: seelische Ge-sundheit und Verhaltenskontrolle. Diese setzen sich aus folgenden Indikatoren zusam-men: (1) Sinnerfülltheit, Selbstvergessenheit, Beschwerdefreiheit, Expansivität, Auto-nomie, Selbstwertgefühl und (2) Verhaltenskontrolle und Liebesfähigkeit. Die SkalenSelbstwertgefühl, Liebesfähigkeit, Expansivität und Autonomie korrelieren mit habi-tuellem Wohlbefinden. Die Förderung dieser Lebensbereiche mittels spezifischen, individuell bedeutsamen gerontologischen Interventionen können einen positivenEinfluss auf die Lebensqualität im Alter ausüben. So akzentuiert beispielsweise dasKonstrukt „Liebesfähigkeit“ mittels tierunterstützten Interventionen die Wiederher-stellung und Stabilisierung des physischen und psychischen Zustands der Betroffenen(Kamioka et al. 2014).
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
2. Messung der Lebensqualität im Alter
Um Lebensqualität messbar zu machen, ist eine präzise Definition des ihr zugrunde lie-genden Modells notwendig; erst dann lässt sich die Lebensqualität eines Individuumsin Bezug auf dieses Modell zuverlässig feststellen und auch modifizieren. Die WHO-QOL Gruppe (The WHOQOL Group 1997) hat in ihrem Bestreben, Lebensqualitätfür internationale Forschung einheitlich messbar zu machen, folgende Definition for-muliert: „Quality of life is defined as an individual’s perception of their position in life inthe context of the culture and value system in which they live and in relation to their goals,expectations and standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complexway by the person’s physical health, psychological state, level of independence, social rela-tionships and their relationship to salient features of their environment“. Lebensqualitätwird hier als subjektive Wahrnehmung der eigenen Position im Leben in Bezug auf denkulturellen Kontext und Wertesysteme, in welchen ein Individuum lebt, verstandensowie seine Beziehung zu persönlichen Zielen, Erwartungen, Standarten und Interes-sen. Dieses breite Konzept beinhaltet physische Gesundheit, psychische Verfassung,Unabhängigkeitsgrad, soziale Beziehungen, persönliche Vorstellungen und ihr jeweili-ges Verhältnis zu salienten Merkmalen vorhandener Umwelten (beispielsweise Selbst-einschätzungen wie Lebensqualität). Allerdings leistet dieses metadisziplinäre Kon-strukt wenig Klärung, wenn es darum geht, Lebensqualität konkret zu operationalisie-ren und messbar zu machen, da es nicht trennscharf bezüglich ähnlicher Konstruktewie beispielsweise dem Wohlbefinden ist (Ring, Höfer, McGee, Hickey, O’Boyle2007).
2.1 Subjektive Einschätzung der Lebensqualität
Individuelle subjektive Einschätzung wird als Diskrepanz zwischen einer individuellwahrgenommenen heutigen Situation und einer subjektiv angenommenen idealenoder optimalen Lebenssituation des Individuums verstanden. Beispiele für solche Messinstrumente sind SWLS (Satisfaction with Life Scale; Diener et al. 1985), SEI-QoL-DW (Schedule of Evaluation of Individual Quality of Life – Direct Weighting;Hickey et al. 1996), EUROHIS (Schmidt, Mühlan, & Power 2006) und CASP-19(Blane, Higgs, Hyde, & Wiggins 2004). Zu den subjektiven Parametern gehören hiersolche Aspekte wie physische Gesundheit, Umwelt, soziale Beziehungen, Autonomieund Spiritualität. Lebensqualität bei CASP-19 wird in Bezug auf die subjektive Zufrie-denheit der menschlichen Bedürfnisse in vier Lebensbereichen, nämlich Kontrolle,Autonomie, Selbstverwirklichung und Vergnügen definiert.
Messinstrumente, welche die subjektive Einschätzung der Lebensqualität mit einerMessung objektiver Ressourcen kombiniert, sind beispielsweise der World Health Or-ganisation Quality of Life Questionnaire for older persons (WHOQOL-OLD, Poweret al. 2005) oder das Assessment of Quality of Life (AQoL, Hawthorne et al. 1999).
Schwerpunkt
107
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
108
Schwerpunkt
2.2 Objektive Einschätzung der Lebensqualität
Der Vorteil der Einschätzung von Lebensqualität anhand objektiver Indikatoren wiebeispielsweise der objektiv beobachtbare Gesundheitszustand durch Fremdeinschät-zung liegt in der höheren Reliabilität. Dies erlaubt die Anwendung dieser Messinstru-mente auch bei Patienten mit kognitiven Störungen wie beispielsweise bei einer Demenzerkrankung. Der grösste Nachteil dieser Methode liegt jedoch darin, dass in-terindividuelle Unterschiede in der subjektiven Bedeutsamkeit von Lebensqualitätsas-pekten nicht berücksichtigt werden können und damit subjektive und objektive Indi-katoren meist über eine geringe Korrelation verfügen. Beispiele für solche Messinstru-mente sind der SF-36 (Bullinger, Kirchberger 1998) oder der EQ-5D (Kind, Brooks,Rabin 2005).
2.3 Funktionale Einschätzung der Lebensqualität
Die Einschätzung der funktionalen Lebensqualität erfolgt durch die Integration mul-tipler subjektiver Repräsentationen von Ressourcen (Martin et al. 2012). Messinstru-mente, welche das Modell in seiner Ganzheit abbilden, existieren zurzeit noch nicht,ihre Entwicklung in den kommenden vier Jahren wird derzeit von der WHO in ihrem„Global Strategy and Action Plan“ zum gesunden Altern gefordert. Diese Forderungbasiert auf dem von der WHO in ihrem „World Report on Ageing and Health“ (WHO2015a) veröffentlichten Konzept des „Healthy Ageing“: „Healthy Ageing (…) the pro-cess of developing and maintaining the functional ability that enables well-being in olderage.“ Eine individuelle Funktionsfähigkeit konstituiert sich in diesem Verständnis ineinem dynamischen Zusammenspiel zwischen der biologischen und physiologischenAusstattung einer Person, ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, Krankheiten, subjekti-ven Bewertung, Persönlichkeitseigenschaften, Umweltbedingungen und ihren Akti-vitäten im täglichen Leben. Weiter schreibt die WHO in ihrem Bericht: „FunctionalAbility comprises the health-related attributes that enable people to be and to do what theyhave reason to value.“ Gelingt es also Personen, mittels ihrer zur Verfügung stehendenFunktionsfähigkeit, das, was sie in ihrem Leben anstreben und wertschätzen, zu errei-chen (beispielsweise eine gute Lebensqualität in Form hoher Autonomie und Mobi-lität), so ist ihnen die Stabilisierung ihrer funktionalen Lebensqualität im Sinne des„Healthy Ageing“-Ansatzes gelungen.
3. Empirische Befunde der Lebensqualität im hohen Alter
Oftmals schätzen Hochbetagte ihre Lebenssituation als deutlich besser ein als es fürAussenstehende nachvollziehbar ist, weil sie im starken Kontrast zu objektiv beobacht-baren Beeinträchtigungen stehen (auch als Wohlbefindensparadoxon bekannt; Stau-dinger 2000). So hat etwa die 2013 in Deutschland durchgeführte Generali Altersstu-die bei 4.197 Personen im Alter von 65 bis 85 Jahren gezeigt (Köcher, Bruttel 2013),dass die befragten älteren Menschen ihr Leben mehrheitlich als sehr abwechslungsreichempfanden, sich durchschnittlich zehn Jahre jünger fühlten als ihr biologisches Alter
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
war, sowie über grösstenteils stabile soziale Netzwerke verfügten – und dies unabhängigvom Alter. Der Gesundheitszustand scheint hier das Gefühl der Einsamkeit zu beein-flussen und weniger das Alter per se.
Unabhängig davon zeichnet sich im hohen Alter ein Trend ab, dass weniger schwereBeeinträchtigungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens auftreten als dies früherder Fall war (Christensen, Doblhammer, Rau et al. 2009). Werden Menschen jedochpflegebedürftig, so ist dieser Zustand gezeichnet von einem Höchstmass an physischer,psychischer und sozialer Vulnerabilität und Abhängigkeit, welche den Betroffenen dieWeiterführung eines selbständigen Lebens erschwert respektive früher oder später ver-unmöglicht.
Das Deutsche Alterssurvey (Motel-Klingebiel, Wurm, Tesch-Römer 2010) hat einehohe Multimorbidität der über 76-Jährigen aufgezeigt (80% mit zwei oder mehr Er-krankungen). Dies begleitet von einer hohen Heterogenität bei der Einschätzung dessubjektiven gegenüber dem objektiven Gesundheitszustands. Die Studie zeigt ausser-dem auf, dass eingeschränkte Gesundheit erst dann zu einer Minderung der subjekti-ven Lebensqualität führt, wenn durch die damit verbundenen Einschränkungen dasselbständige Führen des eigenen Lebens und damit die eigene Automie gefährdet wird(Kuhlmey, von Renteln-Kruse 2011).
Die Heidelberger Hundertjährigenstudie (Rott, Jopp 2012), zeigt im Einklang mitden zuvor dargestellten Befunden, dass Hundertjährige im Allgemeinen tatsächlich ge-brechlich und pflegebedürftig sind, sie andererseits jedoch auch über ein eindrucksvol-les Mass an Glücksempfinden und positiver Bewertung des eigenen Lebens verfügen –und dies trotz vielfältiger objektiver Einschränkungen, wie beispielsweise verminderteSelbständigkeit. Rott & Jopp zeigen auf, dass die Einstellung zum eigenen Leben denHochaltrigen ermöglicht, trotz nachteiliger objektiver Umstände, ihrem Leben Sinnzu geben und damit Qualität zu verleihen
4. Kritische Betrachtung und Ausblick
Lebensqualität und Autonomieverlust
Wodurch unterscheidet sich nun die Lebensqualität im Alter von einer Lebensqualitätim hohen Alter? Im hohen Alter werden die funktionalen Einschränkungen sowohlvon den Betroffenen als auch den Behandelnden anders gewichtet. Instrumente zur Be-stimmung von Lebensqualität sind deshalb immer in Gefahr, instrumentalisiert zuwerden zur Bestimmung von lebenswerten oder nicht lebenswerten Lebens. Dies be-deutet, dass bei zunehmendem Nachlassen eigener Urteilsfähigkeit und Ausdrucksver-mögen das Bedürfnis nach objektiv feststellbaren Kriterien der Lebensqualität zuneh-men wird. Insbesondere bei Entscheidungen am Lebensende sind im Rahmen von Patientenverfügungen häufig von Aussenstehenden Entscheidungen bezüglich Lebens-beendigung zu treffen, die sich mehr oder weniger an früher geäusserten Einschätzun-gen bezüglich der Lebensqualität orientieren können (Wilkening, Ohnsorge 2007).
Schwerpunkt
109
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
110
Schwerpunkt
Individualisierte Interventionen zur Stabilisierung der Lebensqualität
Die Respektierung autonomer Zielvorstellungen – auch im hohen Alter – steht imZentrum bedeutsamer Interventionen. Das Ziel vieler Interventionen im Alter ist dieStabilisierung der Lebensqualität im Kontext schneller altersbedingter Veränderun-gen. Im zuvor beschriebenen Modell der funktionalen Lebensqualität (fQOL) sind in-dividuelle Zielbestimmung selbst bei fortschreitenden, kognitiven Einbussen immernoch möglich. Der Unterschied zu nicht so stark beeinträchtigten Menschen liegtmöglicherweise lediglich in der Reduktion der wahrgenommenen Optionen. Diesewenigen können jedoch durchaus noch konsequent zielgerichtet und bewusst verfolgt,allenfalls jedoch nicht mehr explizit verbalisiert werden.
Zielen bisher die meisten gängigen Untersuchungen in der Forschung darauf ab, dasGleiche bei einer bestimmten Zielgruppe zu verbessern (z. B. kognitive Fähigkeiten)und dies mittels varianzanalytischen Verfahren nachzuweisen, so weisen diese oft sehrkleine Effekte im Durchschnitt der untersuchten Population auf. Der von Martin(2015) vorgeschlagene Paradigmawechsel fragt demgegenüber nach, was auf der Basiswissenschaftlicher Erkenntnisse die Lebensqualität einer einzelnen Person im Gesam-ten verbessert. Das Ziel dieses Forschungsansatzes ist zu verstehen, was eine Person tunmuss, um ihre jetzige Lebensqualität zu stabilisieren (Scholz, König, Eicher, Martin2015). Dies im Sinne individuell bedeutsamer Interventionen (Martin, Moor 2012).
Methoden zum evidenzbasierten Nachweis der Wirksamkeit individualisierterInterventionen stellen jedoch hohe Anforderungen an die Methodenkompetenz. Sieerfordern den Vergleich von theoretischen Modellen mit individuell relevanten empi-rischen Daten. Gleichzeitig sind sie jedoch auch diejenigen Modelle, welche eine syste-matische, quantitative, individualisierte und alltagsbezogene Lebensqualitätsfor-schung versprechen (Martin 2015; Martin, Jäncke, Röcke 2012b).
LiteraturBecker, P. (1991): Wohlbefinden. Theoretische Grundlagen. In A. Abele & P. Becker (Hrsg.). Wohlbefin-
den. Theorie – Empirie – Diagnostik. (S. 42). Weinheim: JuventaBlane, D.; Higgs, P.; Hyde, M. & Wiggins, R.D. (2004): Life course influences on quality of life in early
old age. Social Science & Medicine, 58(11), 2171-2179. doi:10.1016/j. socscimed.2003.08.028Boggatz T. (2015): Quality of life in old age - a concept analysis. The Journal Older People Nursing.
ISSN: 1748-3743, 1-15, doi: 10.1111/opn.12089Boker, S.M. (2013): Selection, Optimization, Compensation, and Equilibrium Dynamics. The Journal
of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 26(1), 61-73Bowling, A. (2004): A Taxonomy and Overview of Quality of Life. In: J. Brown, A. Bowling, & T. Flynn
(eds.), Models of Quality of Life: A Taxonomy and Systematic Review of the Literature. Sheffield:University of Sheffield, FORUM Project
Brandstätter V. & Schüler, J. (2013): Action crisis and cost-benefit thinking: A cognitive analysis of a go-al-disengagement phase. Journal Of Experimental Social Psychology, 49(3), 543-553
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Für hilfreiche Kommentare danken wir ganz besonders Prof. Dr. Karin Wilkening, Prof. Martin Meyer undHeather Edwards.
Brod, M.; Stewart, A. L.; Sands, L. & Walton, P. (1999): Conceptualization and measurement of qualityof life in dementia: The dementia quality of life instrument (DQoL). The Gerontologist, 39 (1), 25-36
Brown, J.; Bowling, A. & Flynn, T. N. (2004): Models of quality of life. A taxonomy and systematic re-view of the literature. Report commissioned by European Forum on Population AgeingResearch/Quality of Life, University of Sheffield (Prof. Alan Walker)
Bullinger, M. & Kirchberger, I. (1998): SF-36. Fragebogen zum Gesundheitszustand. Handanweisung.Göttingen: Hogrefe
Christensen, K.; Doblhammer, G.; Rau, R. & Vaupel, J. W. (2009): Ageing populations: the challengesahead. Lancet, 374(9696), 1196-208
Diener, E. D.; Emmons, R. A.; Larsen, R. J. & Griffin, S. (1985): The satisfaction with life scale. Journalof personality assessment, 49(1), 71-75.
Diener, E.; Suh, E.; Lucas, R. E. & Smith, H. L. (1999): Subjective well-being: Three decades of progress.Psychological Bulletin, 125 (2), 276-302.
Diener, E. (2005): Culture and subjective well-being. In S. Kitayama & D. Cohen (Eds.), Handbook ofcultural psychology. New York: Guilford.
Erikson, R. (1993): Descriptions of Inequality: The Swedish Approach to Welfare Research. In: M.C.Nussbaum & A. Sen (eds.), The Quality of Life (pp. 67-83). Oxford: Clarendon
Eschen, A.; Zehnder, F. & Martin, M. (2013): Cognitive Health Counseling 40+. A New IndividualizedCognitive Intervention. Zeitschrift Für Gesundheitspsychologie, 21(1), 24-33
Ettema, T. P.; Dröes, R.-M.; de Lange, J.; Mellenbergh, G. J. & Ribbe, M. W. (2005): A review of qualityof life instruments used in dementia. Quality of Life Research, 14, 675-686
Eurostat. (2012): Active ageing and solidarity between generations: A statistical portrait of the EuropeanUnion 2012. Luxembourg: European Union Publications
Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2002): Life-management strategies of selection, optimization, and com-pensation: Measurement by self-report and construct validity. Journal of Personality and SocialPsychology, 82, 642–662
Garratt, A.; Schmidt, L.; Mackintosh, A. & Fitzpatrick, R. (2002): Quality of life measurements: Biblio-graphic study of patient assessed health outcome mesures. British Medical Journal, 324, 1417-1421
German Ageing Survey (SUF DEAS) 2008: DZA The German Centre of GerontologyGraf, J. M., Claes, C., Greiner, W., & Uber, A. (1998): Die deutsche Version des EuroQol-Fragebogens.
Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften, Journal of public health, 6 (1), 3-20Habich, R., & Noll, H.-H. (2002): Teil II: Objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden
im vereinten Deutschland. In: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Datenreport 2002. Zahlen und Fak-ten über die Bundesrepublik Deutschland, Bonn
Hawthorne, G.; Richardson, J. & Osborne, R. (1999): The Assessment of Quality of Life (AQoL) instru-ment: a psychometric measure of health-related quality of life. Quality of Life Research, 8(3), 209-224
Hennessey, R. & Mangold, R. (2009): Mit Lebensqualität gegen die Wirtschaftskrise. Wirtschaftspoliti-sche Blätter, 2, 269-285
Hickey, A. M.; Bury, G.; O’Boyle, C. A.; Bradley, F.; D O’Kelly, F. & Shannon, W. (1996): A new shortform individual quality of life measure (SEIQoL-DW): application in a cohort of individuals withHIV/AIDS. Bmj, 313(7048), 29-33
Huber, M.; Knottnerus, J. A.; Green, L. H.; Henriëtte van Der, J.; Alejandro, R.; Kromhout, D.; Leo-nard, B.; Lorig, K.; Loureiro, M. I.; Meer Jos, W. M.; van der Schnabel, P.; Smith, R.; Weel, Ch. van &Smid, H. (2011): How should we define health? British Medical Journal Publishing Group, 26, 343(7817)
Kamioka, H.; Okada, S.; Tsutani, K.; Park, H.; Okuizumi, H.; Handa, S. & Mutoh, Y. (2014): Effective-ness of animal-assisted therapy: A systematic review of randomized controlled trials. ComplementaryTherapies in Medicine, 22, 371-390
Schwerpunkt
111
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
112
Schwerpunkt
Kim, G.R.; Netuvel, G.; Blane, D.; Peasey, A.; Malyutina, S.; Simonova, G. & Pikhart, H. (2015):Psychometric properties and confirmatory factor analysis of the CASP-19, a measure of quality of lifein early old age: the HAPIEE study. Aging & Mental Health, 19(7), 595-609,http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2014.938605
Kind, P.; Brooks, R. & Rabin, R. (2005): EQ-5D concepts and methods: a developmental history. Dord-recht: Springer.
Köcher, R. & Bruttel, O. (2013): „Generali Altersstudie 2013 – Wie ältere Menschen leben, denken undsich engagieren“, Fischer Taschenbuch Verlag, ISBN 978-3-596-18935-9
Kruse, A. (2003): Lebensqualität im Alter. Befunde und Interventionsansätze. Zeitschrift für Gerontolo-gie und Geriatrie. 36(6), 419-420
Kuhlmey, A. & von Renteln-Kruse, W. (2011): Die Forschungsverbünde „Gesundheit im Alter“: Aktuel-le Ergebnisse zu Multimorbidität im Alter aus interdisziplinärer Perspektive.?The research associa-tions „Health in old age“: current results on multimorbidity in old age from an interdisciplinary per-spective. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 44(2), 7-8
Lawton, M.P. (1991): A multidimensional view of quality of life in frail elders. In Birren J., Lubben, J.,Rowe, J., Setchman, D. (eds) The Concept and Measurement of Quality of Life in the Frail Elderly.San Diego: Academic, 3-27
Lawton, M.P.; Winter, L.; Kleban, M.H. & Ruckdeschel, K. (1999): Affect and quality of life. Objectiveand subjective. Aging Health, 11, 169-198
Martin, M.; Schneider, R.; Eicher, S. & Moor, C. (2012a): The Functional Quality of Life (fQOL)-mo-del: A new basis for quality of life-enhancing interventions in old age. The Journal of Gerontopsycho-logy and Geriatric Psychiatry, 25(1), 33-40
Martin, M.; Jäncke, L. & Röcke, Ch. (2012b): Functional Approaches to Lifespan Development. TowardAging Research as the Science of Stabilization. GeroPsych, 25(4), 185-188
Martin, M. & Moor, C. (2012): How psychology as a discipline can profit from focusing psychological re-search on the individual. European Psychologist, 1, 31-32
Martin, M. (2015): Von der Symptombezogenen zur personenzentrierten Gesundheitsforschung (Inter-view mit Beat Leuenberger). Curaviva, 2(15), 36-39
Mollenkopf, H. & Walker, A. (2007): Quality of life in old age. Synthesis and future perspectives. In:Mollenkopf, H. & A. Walker (eds.), Quality of life in old age (pp. 235-248). Dordrecht: Springer
Motel-Klingebiel, A.; Wurm, S. & Tesch-Römer, C. (Hrsg.) (2010): Altern im Wandel. Befunde desDeutschen Alterssurveys (DEAS). Stuttgart: Kohlhammer
Netuveli, G. & Blane, D. (2008): Quality of life in older ages. British Medical Bulletin, 85, 113-126Oppikofer, S. (2008): Lebensqualität bei Demenz. Zürcher Schriften zur Gerontologie. Zürich: Zentrum
für GerontologieOppikofer, S. (2013): Das Konzept Lebensqualität. Pflegen: palliativ, 18, 4-7Perrig-Chiello, P. (1997): Wohlbefinden im Alter. Körperliche, psychische und soziale Determinanten
und Ressourcen. (S. 21). Juventa VerlagPower, M.; Quinn, K. & Schmidt, S. (2005): Development of the WHOQOL-old module. Quality of Li-
fe Research, 14(10), 2197-2214Ring, L.; Höfer, S.; McGee, H.; Hickey, A. & O’Boyle, C. A. (2007): Individual quality of life: Can it be
accounted for by psychological or subjective well-being? Social Indicators Research, 82, 443-461Rott, C. & Jopp, D. S. (2012): Das Leben der Hochaltrigen. Wohlbefinden trotz körperlicher Einschrän-
kungen. Bundesgesundheitsblatt, 55, 474–480Schmidt, S.; Mühlan, H. & Power, M. (2006): The EUROHIS-QOL 8-item index: psychometric results
of a cross-cultural field study. The European Journal of Public Health, 16(4), 420-428Scholz, U.; König, C.; Eicher, S. & Martin, M. (2015): Stabilisation of health as the centre point of a he-
alth psychology of ageing. Psychology & Health, 30(6), 732-749Schumacher, J.; Klaiberg, A. & Brähler, E. (2003): Diagnostik von Lebensqualität und Wohlbefinden. In
J. Schumacher, A. Klaiberg, E. Brähler, Diagnostische Verfahren zu Lebensqualität und Wohlbefin-den. (S. 9-23). Göttingen: Hogrefe
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Sölva, M.; Baumann, U. & Lettner, K. (1995): Wohlbefinden: Definitionen, Operationalisierungen, em-pirische Befunde. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 3, 292-309
Staudinger, U. M. (2000): Many reasons speak against it, yet many people feel good: The paradox of sub-jective well-being. Psychologische Rundschau, 51, 185–197
The WHOQOL Group. (1995). The World Health Organization Quality of Life assessment (WHO-QOL). Position paper from the World Health Organization. Social Science and Medicine, 41, 1403–1409
The WHOQOL Group. (1997): The World Health Organization Quality of Life assessment (WHO-QOL). Measuring Quality of Life. Programm on Mental Health. 1-3
Thomae, H. (1996): Das Individuum und seine Welt: Eine Persönlichkeitstheorie (3. Aufl.). Göttingen:Hogrefe
The WHO (2015a): World Report on Ageing and Health. Geneva: World Health Organization.http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf, accessed 4 Decem-ber 2015
The WHO (2015b): Draft global strategy and plan of action on ageing and health. Geneva: World HealthOrganization. http://who.int/ageing/ageing-global-strategy-revised-draft-for-who-eb.pdf?ua=1 No-vember 2015
Walker, A. & Mollenkopf, H. (2007): International and Multidisciplinary Perspectives on Quality of Lifein Old Age. In: H. Mollenkopf & A. Walker (eds.), Quality of Life in Old Age (pp. 3-13). Dordrecht:Springer
Walker, A. & Lowenstein, A. (2009): European perspectives on quality of life in old age. European Jour-nal of Ageing, 6 (2), 61-66
Wilkening, K. & Ohnsorge, K. (2007): Gestaltungsmöglichkeiten am Lebensende. In Robert-Bosch-Stiftung (Hrsg.), Gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz, Bd. 7: Ethik und Recht (S. 57-83).Bern: Huber
Zapf, W. (1979): Lebensbedingungen und wahrgenommene Lebensqualität. In: Matthes, Joachim (Ed.);Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) (Ed.): Sozialer Wandel in Westeuropa: Verhandlungendes 19. Deutschen Soziologentages in Berlin, S. 767-790. Frankfurt am Main: Campus
Zapf, W. (1984): Individuelle Wohlfahrt: Lebensbedingungen und wahrgenommene Lebensqualität. In:W. Glatzer & W. Zapf (Hrsg.), Lebensqualität in der Bundesrepublik (S. 13-26). Frankfurt a.M./NewYork
Dr. phil., Betr. oec. Sandra OppikoferUniversität Zürich, Universitärer Forschungsschwerpunkt „Dynamik Gesunden Alterns“Zentrum für Gerontologie, Pestalozzistrasse 24, 8032 Zürich, Schweiz;[email protected]
Dipl.-phil. Elena MayorovaUniversität Zürich, Zentrum für Gerontologie, Zürich, Schweiz
Schwerpunkt
113
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
114
Schwerpunkt
Martin Nikolaus Dichter, Martina Schmidhuber
Das Konzept Lebensqualität von Menschen mitDemenz verstehen – Zwei Ansätze zur theoreti-schen Auseinandersetzung
The concept of quality of life of people with dementia – Two approaches for atheoretical discussion
Background: Quality of life is a major and frequently applied outcome in trials for people with de-mentia. Quality of life as an outcome reflects the meaning of the dementia syndrome for a personas a whole and its subjective perception for that person. There is no generally accepted and empiri-cally based definition of Qol for people with dementia.
Objective: Description of two methodological approaches and their results (1) Meta-synthesis ofstatements related to quality of life of people with dementia and (2) literature analysis of experien-ce reports from family caregivers of people with dementia, and book authors. Both approaches willsupport the theoretical discussion on the construct of dementia-specific quality of life.
Method: The meta-synthesis was based on a systematic literature search, a data extraction andquality appraisal of the included qualitative studies. The result sections of the included studies we-re open coded. After that the codes were arranged according to their content and summarized. Allmethodological steps were conducted by two independent researchers.
The literature analysis was based on a convenience sample of experience reports by relatives anddescriptions by book authors. For quality purposes, the actual experiences of book authors and re-latives with people with Alzheimer’s disease were ascertained. Each description of enjoyment andgood experiences was identified as evidence for the quality of life of people with dementia.
Results: Based on the first results of the meta-synthesis, 14 influencing factors for the quality of li-fe of people with dementia were identified: family, social contact and relationships, self-determi-nation and freedom, living environment, positive emotions, negative emotions, privacy, security,self-esteem, health, spirituality, care relationship, pleasant activities and future prospects. Thesefactors underpin the significance of psycho-social factors for the quality of life of people with de-mentia.
The literature study describes the psychosocial well-being within the identified factors related toquality of life. Moreover, the literature study demonstrates noticeable differences between theself-report of quality of life and the proxy-report by relatives.
Conclusion: Both methodological approaches give a consecutive contribution to the theoreticaldiscussion for dementia-specific quality of life. The clarification of this construct is important forthe development and evaluation of nursing interventions for people with dementia and dementia-specific quality of life instruments.
KeywordsDementia, quality of life, meta-synthesis, narration
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
eingereicht 15.12.2015akzeptiert 27.02.2016
Problemdarstellung: Lebensqualität ist ein zentraler und sehr häufig genutzter Endpunktin Interventionsstudien mit Menschen mit Demenz. Das Ergebniskriterium Lebensqua-lität reflektiert hierbei die Bedeutung der Demenz für den Menschen insgesamt und seinsubjektives Erleben. Bisher liegt jedoch keine allgemeingültige und empirisch überprüfteDefinition der Lebensqualität von Menschen mit Demenz vor.
Ziel der Studie: Darstellung des methodischen Vorgehens und der ersten Ergebnisse ei-ner (1) Metasynthese von lebensqualitätsbezogenen Selbstäußerungen von Menschenmit Demenz und einer (2) Literaturanalyse von Erfahrungsberichten von Angehörigen vonMenschen mit Demenz und Buchautoren. Anhand beider Ansätze soll ein Beitrag zur the-oretischen Auseinandersetzung mit dem Konstrukt demenzspezifische Lebensqualitätgegeben werden.
Methodik: Die Metasynthese von lebensqualitätsbezogenen Selbstäußerungen vonMenschen mit Demenz beruht auf einer systematischen Literaturrecherche, einer Daten-extraktion und einer Qualitätsbewertung der eingeschlossenen qualitativen Studien.Hieran anschließend wurden die Ergebniskapitel der eingeschlossenen Studien offen ko-diert und die so ermittelten Kodes wurden inhaltlich geordnet und zusammengefasst. Al-le methodischen Schritte wurden von zwei Wissenschaftlern getrennt und unabhängigdurchgeführt.
Die Narrationsanalyse basiert auf einer Gelegenheitsstichprobe von Erfahrungsberich-ten von Angehörigen und Beschreibungen von Buchautoren. Die Qualität der Literaturwurde gesichert, indem geprüft wurde, inwieweit die Autoren tatsächlich Erfahrung mitMenschen mit Alzheimer-Demenz haben. Zur Datenanalyse wurden Textpassagen, dieeine Form von Genuss und schönem Erleben beschreiben identifiziert und als Evidenz fürdie Lebensqualität gewertet.
Ergebnisse: Anhand der ersten Ergebnisse der Metasynthese konnten 14 die Lebens-qualität von Menschen mit Demenz beeinflussende Faktoren identifiziert werden (Fami-lie, soziale Kontakte und Beziehungen, Selbstbestimmung und Freiheit, Wohnumfeld,positive Emotionen, negative Emotionen, Privatheit, Sicherheit, Selbstwertgefühl, physi-sche und mentale Gesundheit, Glaube, Pflegebeziehung und Freude an Aktivitäten, Zu-kunftsaussichten). Diese Faktoren unterstreichen die Bedeutung von psycho-sozialenFaktoren für die Lebensqualität von Menschen mit Demenz.
Die Narrationsanalyse liefert eine Deskription des beschriebenen psychosozialen Wohl-befindens innerhalb der identifizierten lebensqualitätsrelevanten Faktoren. Danebenzeigen sich deutliche Unterschiede zwischen der selbstberichteten Lebensqualität undderen Fremdbericht durch Angehörige.
Schlussfolgerungen: Die beiden methodischen Ansätze liefern sich ergänzende Beiträgezur theoretischen Klärung von demenzspezifischer Lebensqualität. Die Klärung des Kon-strukts ist wichtig für die Entwicklung und Evaluation von pflegerischen Interventionenfür Menschen mit Demenz und demenzspezifischen Lebensqualitätsinstrumenten.
SchlüsselwörterDemenz, Lebensqualität, Metasynthese, Narrationen
Schwerpunkt
115
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
116
Schwerpunkt
1.Einleitung1
Die Lebensqualität ist ein wichtiger und sehr häufig genutzter Endpunkt in Studienzur Wirksamkeit pharmakologischer und nicht-pharmakologischer Interventionenfür Menschen mit Demenz (Rabins & Black 2007). Hierbei reflektiert das KonstruktLebensqualität als Ergebniskriterium die Bedeutung der Demenz für den Menscheninsgesamt und sein subjektives Erleben (Dichter et al. 2014). Problematisch ist jedoch,dass bisher keine allgemeingültige und empirisch überprüfte Definition der Lebens-qualität von Menschen mit Demenz existiert.
Die Weltgesundheitsorganisation definiert Lebensqualität als „subjektive Wahrneh-mung eines Menschen über seine Stellung im Leben in Relation zur Kultur und den Wertsys-temen, in denen er lebt und in Bezug auf seine Ziele, Erwartungen, Standards und Anlie-gen“ (WHO 1995). Ausgehend und zusätzlich zu dieser sehr breiten, die subjektivenErfahrungen und Einflüsse betonenden Definition wurden unterschiedliche theoreti-sche Ansätze zur Definition von Lebensqualität von Menschen mit Demenz entwickelt(Ettema et al. 2005, Jonker et al. 2004, Lawton 1994, Scholzel-Dorenbos et al. 2010).Diese Ansätze unterscheiden sich stark hinsichtlich ihres Detaillierungsgrades sowieder Bedeutung von objektiven (z. B. funktionelle und kognitive Fähigkeiten) und sub-jektiven Faktoren (z. B. wahrgenommenes Wohlbefinden) für die Lebensqualität vonMenschen mit Demenz. So berücksichtigt das Modell von Lawton (1994) zwar grund-sätzlich sowohl subjektive als auch objektive Faktoren. Die Operationalisierung desModells in Form von Instrumenten (z. B. die Quality of Life of Alzheimer’s DiseaseScale (Logsdon et al. 1999)) mündete jedoch häufig in eine Betonung von eher von au-ßen beobachtbaren gesundheitsbezogenen Kriterien. Demgegenüber fokussieren neu-ere theoretische Ansätze auf die psychosozialen Dimensionen der Lebensqualität (Ette-ma et al. 2005, Jonker et al. 2004, Scholzel-Dorenbos et al. 2010), was sich auch in demjüngeren demenzspezifischen Instrument QUALIDEM (Ettema et al. 2007) anhandeiner deutlichen Betonung psychosozialen Faktoren der Lebensqualität widerspiegelt.
Trotz dieser Entwicklungen gibt es bisher keine allgemeingültige Definition der Le-bensqualität mit Demenz. Kleinster gemeinsamer Nenner der theoretischen Ansätzeist die Feststellung, dass die Lebensqualität von Menschen mit Demenz multidimen-sional und subjektiv geprägt ist.
Basierend auf dieser noch unzureichenden theoretischen Fundierung wurden 19demenzspezifische Lebensqualitätsinstrumente entwickelt. Diese unterscheiden sichjedoch stark hinsichtlich ihrer inhaltlichen Operationalisierung der Lebensqualität,dem Demenzschweregrad in dem ihr Einsatz empfohlen wird, ihrer Perspektive(Selbst-, Fremdeinschätzung, Beobachtung) und dem damit verbundenen zeitlichenAufwand (Bowling et al. 2015, Dichter et al. 2015). Unabhängig von dem jeweiligenInstrument gilt die Selbsteinschätzung der Lebensqualität als Goldstandard für die Le-bensqualitätsmessung (Brod et al. 1999, Rabins & Black 2007).
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
1 Der Beitrag ist eine kontrastierende Zusammenfassung und Diskussion von zwei unabhängig voneinander ent-standenen wissenschaftlichen Arbeiten. Eine ausführlichere Beschreibung des methodischen Vorgehens und derErgebnisse findet sich in dem Buch: Kovács, L.; Kipke, R.; Lutz, R. (Eds.). (2016): Lebensqualität in derMedizin. Wiesbaden: Springer VS
Aufgrund der hohen Bedeutung des Konstrukts Lebensqualität in der Demenzfor-schung, der noch unzureichenden theoretischen Fundierung des Konzepts, derHeterogenität der vorliegenden Erfassungsinstrumente und der Bedeutung der Sub-jektivität für das Konstrukt ist der stärkere Einbezug der Perspektive der Menschen mitDemenz ein wichtiger Schritt in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Kon-strukt (Brod et al. 1999, Trigg et al. 2007).
Im fortgeschrittenen Stadium der Demenzerkrankung kann der Zugang zur Le-bensqualität von Menschen mit Demenz allerdings nicht nur über Selbstäußerungenvon den Erkrankten erfolgen, sondern auch über Narrationen von Dritten, wie denpflegenden Angehörigen oder Buchautoren, die sich mit der Innenperspektive vonMenschen mit Demenz befassen. Denn Demenz lässt sich als „literarische Krankheit“(Vedder 2012) bezeichnen, weil der Verlust von Sprach-, Erinnerungs- und Erzählfä-higkeit sprachlich-narrativ beschrieben werden kann (Vedder 2012). Erfahrungsbe-richte über Menschen mit Demenz sind Narrationen, die Probleme und Widersprüch-lichkeiten der Erkrankung sprachlich aufarbeiten und „die einen Umgang mit den ab-nehmenden Fähigkeiten eines Demenzkranken lebbar machen“ (Gräßel & Niefanger2012). Über den narrativen Zugang zur Erkrankung kann gezeigt werden, was Lebens-qualität bei Demenz sein könnte.
Hiervon ausgehend hat dieser Beitrag das Ziel, über die Darstellung von zwei unter-schiedlichen Ansätzen einen Beitrag zur theoretischen Auseinandersetzung mit demKonstrukt Lebensqualität von Menschen mit Demenz zu geben. Hierbei werden das(1) methodische Vorgehen und erste Ergebnisse einer Metasynthese zu Selbstäußerun-gen von Menschen mit Demenz und deren Lebensqualität sowie eine (2) Literaturana-lyse von Erfahrungsberichten von Angehörigen von Menschen mit Demenz und Buch-autoren kontrastierend vorgestellt.
2. Methodisches Vorgehen
Nachfolgend wird das methodische Vorgehen der beiden wissenschaftlichen Arbeitenvergleichend beschrieben. Beide Literaturarbeiten sind unabhängig voneinander ent-standen. Sie basieren auf jeweils unterschiedlichen Zielgruppen, Stichproben undAnalyseverfahren.
Metasynthese von Selbstäußerungen von Menschen mit Demenz
Grundlage für die Metasynthese von Selbstäußerungen von Menschen mit Demenz wardie folgende Fragestellung: Welche Faktoren werden von Menschen mit Demenz als re-levant für ihre Lebensqualität beschrieben? Die Datenanalyse im Rahmen der Metasyn-these basiert insgesamt auf den Prinzipien dem Kodierparadigma der Grounded Theo-ry. Ziel war es, somit ein theoretisches Modell von die Lebensqualität von Menschen mitDemenz beeinflussenden Faktoren zu entwickeln (Hannes & Lockwood 2011). ImRahmen dieses Artikels werden jedoch ausschließlich die Ergebnisse des ersten metho-dischen Schrittes (induktives offenes Kodieren) berichtet und genutzt.
Schwerpunkt
117
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
118
Schwerpunkt
Narrationen zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz
Für die Analyse der Narrationen war die Frage nach der Lebensqualität bei Demenz ausSicht von pflegenden Angehörigen und Buchautoren anleitend. Welche Aspekte wer-den in Erfahrungsberichten von Angehörigen und in Büchern mit Lebensqualität inVerbindung gebracht? Am meisten Einblick in die Biographie von Menschen mit De-menz haben pflegende Angehörige. Sie sind es, die den Betroffenen meist gut kennen,seine Gewohnheiten, seine Vorlieben und an ihm auch die Veränderungen durch dieErkrankung miterleben. Den Autoren gelingt es aufgrund des persönlichen Nahever-hältnisses meist sehr gut, die verschiedenen Gesichter der Erkrankung eindrücklichdarzustellen.
Aber auch Bücher, die aufgrund ihres „eigenen Erkenntniszugangs zur Wirklich-keit“ (Wetzstein 2012: 190) das Thema sensibel behandeln, geben Einblick in den Ver-lauf der Erkrankung, das Leben der von Demenz Betroffenen vor und nach der Erkran-kung und berücksichtigen auch die Perspektive der Angehörigen. Beschreibungen inBuchform reflektieren das Leben und Erleben der Erkrankten und ihr Umfeld, wie es inkaum einem anderen Kontext möglich ist. Das regt zum Nach- und Umdenken an undgibt Aufschluss darüber, was Lebensqualität bei Demenz ausmachen kann.
2.1 Literaturrecherche
Metasynthese von Selbstäußerungen von Menschen mit Demenz
Die Literaturrecherche erfolgte in zwei methodischen Schritten. In einem erstenSchritt wurde im Juni 2014 in den Datenbanken Medline [Pubmed], CINAHL [EBS-CO], PsychINFO [EBSCO] und Embase [EBSCO] systematisch recherchiert. Die Be-griffe Demenz und Lebensqualität sowie deren Synonyme wurden mit einer validiertensensitiven Suchstrategie für qualitative Studien der McMaster University (Health In-formation Research Unit 2011) logisch kombiniert. In einem zweiten Schritt erfolgteein forward und backward citation tracking der bis dahin eingeschlossenen Studien inden Metadatenbanken Google Scholar, Web of Science und Scopus.
Für die Metasynthese wurden ausschließlich qualitative Studien, deren Ziel dieIdentifizierung oder Beschreibung von die Lebensqualität von Menschen mit Demenzbeeinflussenden Faktoren war, herangezogen. Die Studien mussten in deutscher oderenglischer Sprache vorliegen. Ausgeschlossen wurden Studien, die diese Kriteriennicht erfüllten oder in deren Rahmen die Datensammlung ausschließlich anhand prä-definierter Lebensqualitätsdimensionen erfolgte.
Narrationen zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz
Die Erfahrungsberichte und Bücher wurden per Internet (Amazon Buchkatalog) mitdem Stichwort „Demenz“ recherchiert und mittels Gelegenheitsstichprobe ausge-wählt. Beim Großteil der Literatur zum Thema handelt es sich um Ratgeber, persönli-che Erfahrungsberichte und Bücher kommen unter dem Stichwort sehr vereinzelt vor.Auch Filme zu Demenz sind Formen von Narrationen, die allerdings aufgrund der Fo-
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
kussierung auf Literatur hier nicht einbezogen wurden.2 Es handelt sich um aktuelle Li-teratur der vergangenen Jahre, die auch in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeitgefunden hat. Englischsprachige Literatur wurde aus Praktikabilitätsgründen ausge-schlossen. Textpassagen, die darauf verweisen, dass es eine Form von Genuss und schö-nem Erleben gibt, wurden als narrative Evidenz für Lebensqualität gewertet. Lebens-qualität bei Demenz ist in diesem Sinne als momentanes Wohlbefinden zu verstehen.
2.2 Datenextraktion und Qualitätsbewertung
Metasynthese von Selbstäußerungen von Menschen mit Demenz
Die Charakteristika der eingeschlossenen Studien wurden anhand des Qualitative As-sessment Review Instruments extrahiert. Eine Qualitätsbewertung erfolgte mit Hilfedes Critical Appraisal Skills Programm (Critical Appraisal Skills Programme (CASP)2006). Hierbei wurde angelehnt an Feder et al. (Feder et al. 2006) ein Punktwert zwi-schen 11 und 24 Punkten zur Zusammenfassung der methodischen Güte ermittelt.Ein höherer Punktwert entspricht hierbei einer höheren methodischen Güte. Unab-hängig von dieser Qualitätsbewertung wurden alle eingeschlossenen Studien im Rah-men der Datenanalyse berücksichtigt. Ursächlich hierfür war zum einen die geringeAnzahl an identifizierten qualitativen Studien sowie die uneinheitliche Bewertung derRelevanz der methodischen Güte von Primärstudien in der methodischen Literatur zuMetasynthesen. Die methodischen Schritte Literaturrecherche, Datenextraktion undQualitätsbewertung wurden von zwei unabhängigen Wissenschaftlern durchgeführt.
Narrationen zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz
Um die Qualität der Literatur zu sichern, wurde eruiert, inwieweit die Autoren tatsäch-lich Erfahrung mit Menschen mit Alzheimer-Demenz haben. Bei Erfahrungsberichtenvon pflegenden Angehörigen ist dies aufgrund des Naheverhältnisses offensichtlich.Bei den Buchautoren handelt es sich meist auch um Personen, die entweder beruflichoder privat in Kontakt mit Menschen mit Demenz stehen. Es wurden in diesem Sinnequalitativ hochwertige Narrationen ausgewählt, die für die vorliegende Untersuchungauf eine Anzahl von fünf beschränkt bleiben.
2.3 Datenanalyse
Metasynthese von Selbstäußerungen von Menschen mit Demenz
Die Synthese der Selbstäußerungen erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurden dieErgebniskapitel der eingeschlossenen qualitativen Studien offen kodiert. Das heißtausgehend von der Fragestellung wurde das Datenmaterial adhoc entwickelten Kodie-rungen zugeordnet. Je nach kodierter Textsequenz (z. B. ein Satz) wurde auch mehr alsein Kode vergeben, wenn in der Textsequenz mehrere inhaltliche Aussagen enthalten
Schwerpunkt
119
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
2 Zu Filmen bei Demenz vgl.: Schweda, M. & Frebel, L. (2015): Wie ist es, dement zu sein? EpistemologischeProbleme und filmästhetische Lösungsperspektiven in der Demenzethik, in: Ethik in der Medizin 1 (2015) 27,47-57.
120
Schwerpunkt
waren. Die ermittelten Kodes wurden inhaltlich geordnet und zu Kategorien (Dimen-sionen der Lebensqualität) zusammengefasst. Das offene Kodieren wurde ebenfalls vonzwei Wissenschaftlern getrennt und unabhängig durchgeführt, anschließend wurdendie Kodierungen verglichen und aufeinander abgestimmt.
Narrationen zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz
Textpassagen, die darauf verweisen, dass es eine Form von Genuss und schönem Erle-ben gibt, wurden als narrative Evidenz für Lebensqualität gewertet. Lebensqualität beiDemenz ist in diesem Sinne als momentanes Wohlbefinden zu verstehen. Beim Aus-werten der Literatur wurden jene Textstellen als relevant herausgearbeitet, die auf dasoben erwähnte momentane Wohlbefinden verweisen. Es handelt sich um Textstellen,die zeigen, dass Menschen mit Demenz keine „lebenden Toten“ sind (Vedder 2012),sondern Lebensqualität anders verstanden werden muss als bei gesunden Menschen(Kumlehn 2014).
2. Ergebnisse
3.1 Metasynthese von Selbstäußerungen von Menschen mit Demenz
Im Rahmen der systematischen Literaturrecherche wurden zunächst die Abstracts von3213 Veröffentlichungen gesichtet (Datenbankrecherche und anschließendes Cita-
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Ergebnisse der Da-tenbanksuche:
3673
Ausschluss: Duplikate: 134
Ausgeschlossen:517
Step 1
Eingeschlossen fürMetasynthese:
2
6 ausgeschlossen ge-mäß der Ausschluss-
kriterien:2 Studienteilnehmerwaren nicht MmD2 Hauptziel der Stu-die war nicht die Be-schreibung vonSelbstäußerungenvon MmD zu ihrer
LQ2 keine qualitativen
Studien
Eingeschlossen fürMetasynthese:
7
Volltextscreening:8
43 ausgeschlossengemäß der Aus-schlusskriterien:
3 Studienteilnehmerwaren nicht MmD22 Hauptziel derStudie war nicht dieBeschreibung vonSelbstäußerungenvon MmD zu ihrer
LQ18 keine qualitati-
ven Studien
Volltextscreening:50
Titel- & Abstract-screening:525
Ausgeschlossen:2638
Titel- & Abstract-screening:2688
Ergebnisse des forward & backwardcitation tracking:
659
Ausschluss Duplikate: 1035
Step 2
Einschluss
Volltextscreening
Screening
Identifikation
Einschluss
Volltextscreening
Screening
Identifikation
Abb.: 1: Flussdiagramm der Literaturrecherche zu Selbstäußerungen von Menschen mit Demenz
Schwerpunkt
121
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Referenz/Land
Ziel Studienteilnehmer/Wohnumfeld
Datenerhebung Daten-analyse
Ergebnisse/LQ-Dimensionen
CASP-Wert
(Byrne-Davis etal. 2006)Ver-einigtes König-reich
Exploration von LQ-Di-mensionen von MmD/Entwicklung eines Mo-dells zur LQ-Entschei-dungen von MmD
Gelegenheitsstichproben =50 zu Hause lebenderMmD/ Ausschluss: Perso-nen mit starken Schluckbe-schwerden, funktionellenEinschränkungen & zu ho-hen Belastungen durchmögliche Studienteilnahme
FokusgruppenInterviewsDauer: 30 – 60Min.
Inhaltsana-lyse kombi-niert mitAnalyse an-gelehnt anGrounded Theory
Soziale Interaktion,wahrgenommenes Wohl-befinden, Spiritualität,Freiheit, finanzielle Un-abhängigkeit, Gesundheit
18
(Cahill &Diaz-Pon-ce 2011)Irland
Exploration der subjektivenSichtweisen von MmD bzgl.ihrer LQ in Pflegeheimen /Exploration von Unterschie-den in der Einschätzung vonLQ von MmD mit unter-schiedlichen kognitiven Fä-higkeiten
Gelegenheitsstichproben =61 MmD in Pflegeheimenlebend / Ausschluss: fehlen-de kognitive Einschrän-kung, deutlich einge-schränkte Kommunika-tionsfähigkeit
Einzel-interviewsDauer: 20 – 30Min.
Themati-sche Analyse
Sozialer Kontakt, Zuge-hörigkeitsgefühl, Akti-vitäten, Affekt
19
(Dröes etal. 2006)Nieder-lande
Exploration der Selbst- &Fremdeinschätzung derLQ von MmD sowieÜbereinstimmungen bei-der Perspektiven mit exis-tierenden LQ-Modellen& LQ-Instrumenten
Gelegenheitsstichproben =143 MmD zu Hause oderim Pflegeheim lebend /Keine Ausschlusskriterienberichtet
65 Einzelinter-views und Grup-pendiskussionenmit insg. 78MmD / Dauer:10 – 15 Min.(Einzel), 30 – 60Min (Gruppe)
Analyse an-gelehnt anGroundedTheory
Affekt, Selbstbild, Zugehö-rigkeitsgefühl, Sozialer Kon-takt, Freude an Aktivitäten,physische & psychische Ge-sundheit, finanzielle Sicher-heit, Sicherheit & Privatheit,Unabhängigkeit, Selbstwert-gefühl, Spiritualität
15
(Gallrach2006)Deutsch-land
Exploration von LQ-Di-mensionen aus der Per-spektive von MmD &pflegenden Angehörigen
Gelegenheitsstichproben =32 MmD zu Hause lebendKeine Ausschlusskriterienberichtet
EinzelinterviewsDauer: 10 Mindurchschnittlich
Inhalts-analyse
Soziale Beziehungen, Le-bensumfeld, Glaube, Part-nerschaft, Freizeit, finan-zielle Situation, Gesundheit
11
(Jonas-Simpson2005) Kanada
Beschreibung der Bedeu-tung von LQ sowie damitverbundenen Hoffnungen& Mustern
Gelegenheitsstichproben =17 MmD in PflegeheimenlebendKeine Ausschlusskriterienberichtet
12 Einzel-interviews & 1Gruppeninter-view mit Hilfevon Musik undKunsttherapieDauer: 15 – 60Min.
Datenana-lyse nachParse et al.1996
Zufriedenheit, Bedeutungvon Beziehungen, Lebens-einstellung, Würde, Lebenmit Verlusten, Unabhängig-keit, Einschränkungen inder Kommunikation, Auf-rechterhaltung des bisheri-gen Lebens
15
(Matano2000)USA
Exploration & Verstehender LQ von MmD aus derEigenperspektive /Exploration von mit derLQ von MmD verbunde-nen Faktoren
Gelegenheitsstichproben =23 MmD zu Hause und inPflegeheimen lebend / Ein-schluss: MMSE ≥ 18, Perso-nen die an englischsprachi-gen Interviews teilnehmenkonnten
2 – 5 Einzel-interviews proTeilnehmerDauer: 20 – 90Min.
QualitativeDatenanalysenach Miles &Huberman1994 undKnafl & Web-ster 1988
Kontrolle haben, Sicher-heit, Einschränkungenund Verluste im Leben
19
(Moyle etal. 2011)Australien
Exploration von Faktoren dieLQ von MmD in der Lang-zeitpflege beeinflussen / Ex-ploration inwieweit Faktorender LQ die wahrgenommeneWertschätzung beeinflussen
Gelegenheitsstichproben =32 MmD in Pflegeheimenlebend / Einschluss: ≥ 65Jahre, Demenzdiagnose, Fä-higkeit zur Interviewteil-nahme
Einzel-interviewsDauer: nichtberichtet
Computer-unterstütztethematischeAnalyse
Familie, soziale Kontak-te/Personen, Dinge
15
(Rizzo-Parse1996)USA
Exploration der Bedeu-tung der LQ von MmD
Gelegenheitsstichproben =25 MmD zu Hause lebendKeine Ausschlusskriterienberichtet
Einzel-interviewsDauer: 15 – 30Min
Daten-analysenach Rizzo-Parse et al.1996
Vertrauen – Schwierig-keiten, Freiheit – Res-triktionen, Sicherheit –Unsicherheit, Zusam-men - Alleinsein
14
(Smith etal. 2005)Vereinig-tes König-reich
Exploration von Determi-nanten der LQ von MmDUntersuchung von Unter-schieden zwischen der LQSelbst- & Fremdeinschät-zungen von MmD
Gelegenheitsstichproben =19 MmD zu Hause lebend /Keine Ausschlusskriterienberichtet
Einzel-interviewsDauer: 30 – 60Min.
Inhalts-analyse
Tgl. Aktivitäten, Ge-sundheit & Wohlbefin-den, kognitive Funktio-nen, soziale Beziehun-gen, Selbstverständnis
16
Tab. 1: Charakteristika der eingeschlossenen Primärstudien
LQ = Lebensqualität, MmD = Menschen mit Demenz, MMSE = Mini Mental Status Examination
122
Schwerpunkt Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Faktor Kurzbeschreibung Beispielhafte Originalzitate
Familie die Rolle und Bedeutung des Men-schen mit Demenz in der FamilieKontakt und Aktivitäten mit FamilienangehörigenVerlust von Angehörigen
Things have changed a lot (...) but I do have family (...) they're the only onesI have to go to, and yet, they get me mad at times. (Rizzo-Parse 1996)Probably if I didn't have my family, I would be in a real problem. (Rizzo-Parse 1996)
Soziale Kontakte undBeziehungen
Kontakte, Austausch und Beziehun-gen zu Freunden, Nachbarn, MitbewohnernWichtigkeit von bedeutsamen GesprächenVerlust von Beziehungen zu Freunden
(…) meaningful conversations. These helped them to recall previous memo-ries, and helped link them to the community, as well as to remind them oftheir existence in the world outside of the care setting. (Moyle et al. 2011)Lack of friends or relations, loneliness, all these things take away the qualityof life. (Byrne-Davis et al. 2006)
Selbstbestim-mung und Freiheit
Möglichkeit, eigenständig Entschei-dungen zu treffen und diese auch um-zusetzenFinanzielle Möglichkeiten/Unabhängigkeit
Some participants described the importance of being free and others wishedto be free-to move around, to walk, to be outdoors, to say what you want.They identified living with opportunities amid the restrictions that comewith the routines and safety measures of institutional life. One participantexclaimed that he went to war to free Canada and now he is locked up in Ca-nada. (Jonas-Simpson 2005)I know, there's [sic!] some things I could do better around the house, but Idon't like it anymore. Who needs housework? (…). (Rizzo-Parse 1996)
Wohnumfeld Sich zu Hause fühlenPositive/negative Erinnerungen anehemaliges WohnumfeldWohnen in der Gemeinschaft
I’m quite happy as long as I’m in my own home. (Byrne-Davis, et al., 2006)I was wondering if I would, but I'm satisfied (…). It's better than being alo-ne, like I was at home, in my own house. I was alone, and it wasn't good. Icouldn't drive anymore, and I'd have to ask my neighbors all the time.(Rizzo-Parse 1996)He always wants the TV on and wouldn’t change the channel. I just let himgo there is no point in fighting. (Cahill & Diaz-Ponce 2011)
Positive Emotionen
z. B. Dankbarkeit, Erinnerungen, dieglücklich machen, Zufriedenheit
Since sometimes if you’re happy and that’s more or less all you really want.(Byrne-Davis et al. 2006)Another participant said, ‘There’s nothing important. I'm just living fromday-to-day and I'm quite happy, I seem to have good health, I have a good ap-petite , nice friends and that, so I'm quite satisfied and nothing else. (Jonas-Simpson 2005)
Negative Emotionen
z. B. Angst, Traurigkeit, Einsamkeit,Resignation, Gefühl von Verlust
got totally disoriented there and I got so and got very scared because I keptwalking and I couldn’t see how I could get back to civilisation.” (Smith et al.2005)I'm afraid to ask this question; I'm afraid of the answer. How long this earlystage last? You don't have to be exact but (…). (Matano 2000)Sometimes I wish I was dead cause there’s nothing in life for me at all. (Cahill& Diaz-Ponce 2011)
Privatheit Verlust oder Aufrechterhaltung vonIntimitätMöglichkeit zum Rückzug im Wohn-umfeld
Having a private single room and being able to enjoy some privacy helpedmany residents to feel at home. (Dröes et al. 2006)
Sicherheit Gefühl von KontrolleUnsicherheit aufgrund von fehlen-dem Wissen, z. B. über die eigene medizinische Diagnose
(...) one of the main reasons that I do so well is that I know I have my familybehind me ... I think that's important that you know that they're there (...)then that makes you take a bit of the depression off yourself (...) that's theway I feel (...) as I say I got we (...) we two boys and a girl feel as though I gotsome backing on their back you know (...) and everybody in my family hasbeen 100% supportive (...) so what else can I ask for (...). I know that if any-thing should happen that I would be frightened or something, that all I wo-uld have to do is just call (...). I would hope (...) anybody else that has the sa-me illness has that kind of feeling toward their family. That they know thatthey are going to get their strong support. (Matano 2000)
tion Tracking). Nach Anwendung der definierten Ein- und Ausschlusskriterien konn-ten neun Studien für die Metasynthese berücksichtigt werden (Abbildung 1) (Dichter etal. 2016). Eine differenzerte Beschreibung der Studiencharakteristika zeigt Tabelle 1.
Basierend auf dem offenen Kodieren der Ergebniskapitel dieser neun Studien konnten14 Dimensionen demenzspezifischer Lebensqualität identifiziert werden, die nachfol-gend in Tabelle 2 mit Originalzitaten vorgestellt werden.
Schwerpunkt
123
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Tab. 2: Zusammenfassung der von 14 die Lebensqualität von Menschen mit Demenz beeinflussenden Faktoren (nach dem offenen Kodieren)
Faktor Kurzbeschreibung Beispielhafte Originalzitate
Selbstwert-gefühl
Sich wertgeschätzt durch andere füh-lenPositives Selbstwertgefühl durch denErhalt von Fähigkeiten
What would change my quality of life is] just that I enjoy myself a little more.(Rizzo-Parse 1996)We don’t look after our old people like we should. (Byrne-Davis et al. 2006)
Physische undmentale Gesundheit
Wahrgenommene Gedächtnis-funktionVorhandensein von SchmerzenEinschränkungen in der Kommunikation
(…) but it seems to get less and less all the time and it’s my fault because I’mthe one who has a bad memory. (Smith et al. 2005)I’ve had a good life. I’ve been lucky enough to have good health. (2) There’sone thing – your health. You need that more than anything, really. I am get-ting older and taking tablets but if anyone asked me for a walk I could.(Byrne-Davis et al. 2006)
Glaube (religiös)
Religiöser Glaube als Stütze beimUmgang mit VerlustenGlaube der Stärke und Dankbarkeitvermittelt
I am a Christian. That is very important to me. I believe it. Beyond that, I do-n’t think there is much. (Byrne-Davis et al. 2006)When I wake up I say, 'Thank you God, I'm still here.' You have to ... you ha-ve to be grateful for the many things you have in life. (Matano 2000)
Pflege-beziehung
Den gewünschten Respekt vom Pfle-gepersonal zu erhaltenPositive Kommunikation zwischenMenschen mit Demenz und PflegendenRestriktionen
So the girl in the office this morning said ‘I’ll fix that up during the day’. But Istill haven’t got it and I’m terrified of losing it. She said ‘it’ll turn up. But ithasn’t turned up. I’m frightened somebody else will grab it and hide it. It’sjust little things in your life that don’t mean anything when you’re youngerbut little things mean a lot to me now. (Moyle et al. 2011)(Staff ) won’t let me out as I am not fit to walk. (Cahill & Diaz-Ponce 2011)
Freude an Aktivitäten
Möglichkeit zur Teilnahme an AktivitätenVerlust bisheriger Möglichkeiten fürAktivitäten/Beschäftigung
I love being outside, because I feel different, I feel free, course inside you gotto make the best of it. (Jonas-Simpson 2005)It’s a bit boring just sitting here, I’ll be sitting here now until tea time. (Moyleet al. 2011)
Zukunftsaus-sichten
Mutmaßungen darüber, was in derZukunft passiert
So far, [it's going] very nicely. For my future, I hope that everything goeswell. Let's hope that I continue to function properly. (Rizzo-Parse 1996)I very well know that I have Alzheimer's. And I'm afraid of the future (...) be-cause I've seen how people (...) begin to go down instead of remaining the sa-me (...) and that's very frightening. VERY frightening (Matano 2000)
3.2 Narrationen zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz
In die Analyse von Narrationen wurden insgesamt vier Monografien eingeschlossen(Tabelle 3).
Autor Titel Literaturform Hintergrund des Autors
LQ-Dimension
Genova, 2009 Mein Leben ohnegestern
Autorenbeschreibung Neurowissen-schaftlerin
Innenperspektive von Alice, der Frau mit Demenz: Siefühlt sich trotz des Erinnerungsverlustes lebendig undglücklich, wenn sie im Meer schwimmt.
Geiger, 2011 Der alte König inseinem Exil
Autorenbeschrei-bung/Erfahrungsbericht
Pflegender Sohn Sohn macht sich bewusst, dass sich der Besuch beimVater auch für diesen zu lohnen scheint, wenn dieserihn klar ansieht und anlächelt.
Jens, 2009 Demenz. Ab-schied von mei-nem Vater
Erfahrungsbericht Sohn Unbehagen der Angehörigen angesichts der Krankheitmuss nicht notwendigerweise Unbehagen bei Menschmit Demenz bedeuten. Obwohl sich Jens‘ Vater wohlzu fühlen scheint, ist dem Sohn traurig zumute.
Zander-Schneider,2011
Sind Sie meineTochter? Lebenmit meiner alz-heimerkrankenMutte
Erfahrungsbericht Pflegende Tochter
Aktivitäten im Alltag (wie z.B. Kartoffel schälen), er-höhen sichtbar das Wohlbefinden der Mutter. Siesummt und lächelt.(Zander-Schneider 2011: 174)Bevorzugte Tätigkeiten aus früheren Zeiten, wie dasTanzen, lassen die Mutter trotz Erkrankung aufblühen.(Zander-Schneider 2011: 209f )Das Wahrnehmen von angenehmen, sinnlichen Ein-drücken, z.B. Sonne auf der Haut, zeigt sich bei derMutter manchmal nur in einem Lächeln.
Tab. 3: Charakteristika der eingeschlossenen Bücher
124
Schwerpunkt
In Lisa Genovas Buch „Mein Leben ohne gestern“ wird das Sich-gut-fühlen im Augen-blick der an Demenz erkrankten Frau aus der Innenperspektive beschrieben:
„Sie sah über das dunkle Wasser hinaus. Ihr Körper, kräftig und gesund, hielt sie Wasser tre-tend an der Oberfläche, kämpfte mit jedem Instinkt um ihr Leben. Na schön, sie konnte sichnicht erinnern, heute Abend mit John gegessen zu haben oder was er gesagt hatte, wohin ernoch wollte. Und es konnte gut sein, dass sie sich morgen früh nicht mehr an diese Nacht er-innern würde, aber in diesem Augenblick fühlte sie sich nicht verzweifelt. Sie fühlte sich le-bendig und glücklich.“ (Genova 2009)
Gabriela Zander-Schneider zeigt in ihrem Erfahrungsbericht über die Pflege ihrerMutter mit Demenz, dass kleine Aufgaben und Tätigkeiten, das Wohlbefinden der Per-son mit Demenz positiv beeinflussen können. So scheint sich die Mutter beim Schälenvon Kartoffeln gut und nützlich zu fühlen: „Im Hintergrund läuft das Radio, und Mut-ter summt die Melodie richtig mit. Sie ist gut gelaunt.“ (Zander-Schneider 2011). Aller-dings ist es für die Angehörigen wichtig, so Zander-Schneider selbstkritisch, sich im-mer wieder in Erinnerung zu rufen, dass man auch Menschen mit Demenz in gewissenStadien etwas zutrauen kann und sie nicht permanent wie kleine Kinder beaufsichtigenmuss (Zander-Schneider 2011).
Die Interpretation von Mimik und Gestik von Menschen mit Demenz ist eine be-sondere Herausforderung. Angehörige, die den Erkrankten und seine Lebensgeschich-te meistens gut kennen und ihn auch ohne Worte verstehen, können möglicherweiseam besten erahnen, was er meint und wie er sich fühlt. So kann dies beispielsweise beiKindern von Menschen mit Demenz der Fall sein, wie Arno Geiger aus seiner Erfah-rung berichtet. Geiger ist sich manchmal unsicher, ob es sich für den vergesslichen, ab-wesend scheinenden Vater überhaupt lohnt, wenn er ihn besucht. Wenn aber „die Au-gen klar blicken und er mich anlächelt, was ja zum Glück sehr oft geschieht, dann weiß ich,dass sich auch für ihn mein Besuch gelohnt hat. Oft ist es, als wisse er nichts und verstehe al-les“ (Geiger 2011).
Ähnlich wie Geiger beobachtet auch Tilman Jens seinen Vater Walter Jens, den einstgroßen Rhetoriker und belesenen Mann, und erlebt, wie dieser ein aus seiner Sicht im-mer kindlicheres Verhalten an den Tag legt. Sein Vater hat lesen und schreiben verlernt,beschäftigt sich, anstatt mit Büchern, am liebsten mit Tieren am Bauernhof und freutsich über Orangenlimonade und Kuchen (Jens 2009). Sein Sohn, Tilman Jens,schreibt: „Ich möchte weinen. Er aber fühlt sich wohl“ (Jens 2009).
Einerseits sind Brüche in der Lebensgeschichte wie bei Walter Jens im Zuge der Er-krankung keine Seltenheit, andererseits kann das, was vor der Demenz Wohlbefindenausgelöst hat, dies auch weiterhin bewirken. So erlebt es Zander-Schneider, als sie mitihrem Bruder ihre Mutter während eines Konzerts in dem Heim besucht, in das sie ihreMutter schweren Herzens gebracht haben. Sie sehen, wie ihre Mutter ausgelassen zurMusik tanzt und offenbar ganz in ihrem Element ist. Die Geschwister denken an dieZeit zurück, in der ihre Mutter bei einem Fest im Elternhaus genauso getanzt hat (Zan-der-Schneider 2011). Vor allem jene Tätigkeiten, die Menschen nahezu ritualisiert
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
ausführten, wie beten oder singen, können aufgrund der Wiederholung Vertrauen undSicherheit im Leben bei Demenz schaffen und somit Wohlbefinden hervorrufen.
Selbst im schweren Stadium, in dem die verbalen Fähigkeiten nicht mehr vorhan-den sind, lässt sich noch Lebensqualität erkennen. So hat Zander-Schneider oftmals denEindruck, dass ihre Mutter den Frühlingsbeginn und das Singen der ersten Vögle garnicht mehr wahrnimmt. „Doch manchmal, wenn man sie in ihrem Rollstuhl in die Sonneschiebt, glaube ich ein Lächeln auf ihrem Gesicht zu erkennen“ (Zander-Schneider 2011).
3. Diskussion
Anhand der Metasynthese von Selbstäußerungen von Menschen mit Demenz wirddeutlich, dass vor allem psycho-soziale Faktoren einen Einfluss auf die Lebensqualitätvon Menschen mit Demenz haben. Demgegenüber werden in den Erfahrungsberich-ten von Angehörigen und Autorenbeschreibungen eher objektive Faktoren z. B. ge-sundheitsbezogene Faktoren und Wohnumfeld berichtet, deren Bedeutung für dasWohlbefinden scheint jedoch von der individuellen Interpretation der Menschen mitDemenz abzuhängen (z. B. wahrgenommene Gedächtnisfunktion, sich zu Hause füh-len). Das heißt, anhand der Metasynthese konnten 14 die Lebensqualität beeinflussen-de Faktoren identifiziert werden (Familie, soziale Kontakte und Beziehungen, Selbst-bestimmung und Freiheit, Wohnumfeld, positive Emotionen, negative Emotionen,Privatheit, Sicherheit, Selbstwertgefühl, physische und mentale Gesundheit, Glaube,Pflegebeziehung und Freude an Aktivitäten, Zukunftsaussichten). Und die Analyse derNarrationen liefert eine Deskription des beschriebenen psychosozialen Wohlbefindensinnerhalb der identifizierten Faktoren.
Der Unterschied zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung der Lebensqualitätwird anhand der Angehörigennarrationen deutlich (Krug 2014). So ist es für Angehö-rige in den untersuchten Büchern nicht unbedingt naheliegend, dass für Menschen mitDemenz scheinbare Kleinigkeiten, wie Aktivitäten in der Küche, beten oder essen, rele-vant für deren Lebensqualität sein können. Das mag daran liegen, dass für gesundeMenschen Selbstbestimmung in der eigenen Lebensführung als ein hohes Gut angese-hen wird und Selbstbestimmung in dieser Form bei Menschen mit Demenz im Verlaufder Erkrankung nicht mehr möglich ist (Schmidhuber 2013). Deshalb wird häufig da-von ausgegangen, dass ein Leben mit Demenz, in welchem der Grad der Selbstbestim-mung stetig abnimmt, keine Qualität mehr haben kann. Dass dies nicht zutreffend ist,zeigen die beiden vorgestellten Ansätze deutlich auf.
Die Ergebnisse liefern somit auch einen Beitrag für die Sensibilisierung von z. B.Angehörigen von Menschen mit Demenz und auch professionell Pflegenden. Sie kön-nen erlebte Situationen in der Literatur wiedererkennen und sich motiviert fühlen,sich mit der Biographie einer jeweiligen Person mit Demenz auseinanderzusetzen, umzu erfahren, was für diese Person in ihrem Leben wichtig war bzw. auch heute nochwichtig sein könnte und somit relevant für seine Lebensqualität ist.
Schwerpunkt
125
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
126
Schwerpunkt
Die vorgestellten Ergebnisse unterstützen auch die theoretische Diskussion zur Le-bensqualität von Menschen mit Demenz, in deren Entwicklung die Relevanz vonpsychosozialen Faktoren für die Lebensqualität von Menschen mit Demenz zugenom-men hat (Dichter et al. 2016). Diese stärkere Betonung psycho-sozialer Faktoren solltesich auch in der Entwicklung neuer oder Weiterentwicklung bestehender Instrumentezur Erfassung der Lebensqualität wiederspiegeln. Hier wurde bisher bei der Entwick-lung und testtheoretischen Evaluation von Instrumenten eher gesundheits- und krank-heitsbezogene Dimensionen prominent berücksichtigt ((Bowling et al. 2015, Perales etal. 2013). Vor dem Hintergrund der hier vorgestellten Ergebnisse ist dies nicht längerhaltbar. Speziell für die Überprüfung der Inhalts- und Konstruktvalidität von Lebens-qualitätsinstrumenten bieten die ermittelten Faktoren einen hilfreichen Rahmen. Fer-ner bieten die dargestellten beeinflussenden Faktoren der Lebensqualität von Men-schen mit Demenz Hinweise für die inhaltliche Entwicklung von einzelnen Kompo-nenten für pflegerische Interventionen zum Erhalt und der Förderung derLebensqualität von Menschen mit Demenz.
4.1 Methodische Limitationen
Metasynthese von Selbstäußerungen von Menschen mit Demenz
Die hier vorgestellten Ergebnisse stellen die ersten Ergebnisse einer Metasynthese zuSelbstäußerungen zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz dar. Im weiterenVerlauf der Datenanalyse werden die ermittelten Faktoren weiter zusammengefasst, dieBeziehungen zwischen den Faktoren werden herausgearbeitet und ihre Bedeutungwird vor dem Hintergrund der jeweiligen Primärstudien reflektiert (z. B. methodischeQualität der eingeschlossenen Studien (Dichter et al. 2013)). Dies wird zu einer Re-duktion der Faktoren und ggf. auch zu deren Umbenennung führen (die finalen Ergeb-nisse werden im Jahr 2016 vorliegen). Unabhängig hiervon erscheinen die Ergebnissebereits in der vorliegenden Form als relevant für die theoretische Diskussion zum Kon-strukt Lebensqualität von Menschen mit Demenz. Neben der noch nicht abgeschlosse-nen Analyse unterliegt die Metasynthese weiteren methodischen Limitationen. Sokonnten, basierend auf dem methodischen Vorgehen der eingeschlossenen Primärstu-dien, für die vorliegende Arbeit nur Selbstäußerungen von Menschen mit einer leich-ten bis mittelschweren Demenz ausgewertet werden. Studien in deren Rahmen anhandvon Beobachtungen eine Annäherung an die Perspektive von Menschen mit einer sehrschweren Demenz versucht wurde, konnten anhand der vorliegenden Literaturrecher-che nicht identifiziert werden. Die Ergebnisse der Metasynthese werden jedoch durchdie Narrationsanalyse ergänzt. So werden im Rahmen der eingeschlossenen Erfah-rungsberichte und Bücher Situationen beschrieben, in denen Menschen im fortge-schrittenen Stadium der Demenz ihr Wohlbefinden ausdrücken.
Narrationen zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz
Der Zugang zu Menschen mit Demenz und ihrer Lebensqualität kann über Literaturzugänglich gemacht werden. Dennoch ergibt sich speziell bei dieser Erkrankung in der
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
literarischen Darstellung eine besondere Herausforderung: Es besteht die Schwierig-keit, sich in die Perspektive des Kranken hineinzubegeben. Der Autor, der üblicher-weise keine Demenz hat, kann nur erahnen, welche Folgen eine Demenz hat. Men-schen mit Demenz selbst können jedoch aufgrund des Nachlassens verbaler Fähigkei-ten und Verwirrtheitszuständen ab einem gewissen Zeitpunkt der Erkrankung nichtmehr von ihrem Erleben berichten. Deswegen ist sowohl die Ich-Perspektive in einerErzählung als auch eine Außenperspektive keine einfache literarische Aufgabe (Vedder2012) und limitiert auf eine gewisse Art und Weise die Aussagekraft, weil sie stets mitInterpretation verbunden ist. Daneben muss darauf hingewiesen werden, dass für dieberichtete Untersuchung eine pragmatische Auswahl von Literatur erfolgte. Diese Ge-legenheitsstichprobe kann und soll nicht den Anspruch von generalisierbaren Aussa-gen zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz aus der Perspektive von Angehöri-gen oder Autoren erheben. Ferner wurden ausnahmslos deutschsprachige Bücher undBücher zu Menschen mit einer Alzheimer Demenz in die narrative Analyse einbezogen,somit können sich die Ergebnisse auch nur auf den deutschen Sprachraum und dieseForm der Demenz beziehen.
LiteraturBowling, A./ Rowe, G./ Adams, S./ Sands, P./ Samsi, K./ Crane, M./ .Manthorpe, J. (2015): Quality of li-
fe in dementia: a systematically conducted narrative review of dementia-specific measurement scales.In: Aging Ment Health, 19(1), 13-31. doi: 10.1080/13607863.2014.915923
Brod, M./ Stewart, A. L./ Sands, L. (1999): Conceptualization and measurement of quality of life in de-mentia. In: J Mental Health Aging, 5, 7-20.
Byrne-Davis, L. M. T./ Bennett, P. D./ Wilcock, G. K. (2006): How are quality of life ratings made? To-ward a model of quality of life in people with dementia. In: Quality of Life Research, 15(5), 855-865.
Cahill, S./ Diaz-Ponce, A. M. (2011): 'I hate having nobody here. I'd like to know where they all are': Canqualitative research detect differences in quality of life among nursing home residents with differentlevels of cognitive impairment? In: Aging Ment Health, 15(5), 562-572. doi:10.1080/13607863.2010.551342
Critical Appraisal Skills Programme (CASP) (2006): 10 questions to help you make sense of qualitativeresearch. http://www.sph.nhs.uk/sph-files/casp-appraisal-tools/Qualitative-Appraisal-Tool.pdf
Dichter, M./ Halek, M./ Dortman, O./ Meyer, G./ Bartholomeyczik, S. (2013): Measuring the quality oflife of people with dementia in nursing homes in Germany - the Study Protocol for the Qol-Dem Pro-ject [Die Erfassung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz in stationären Altenpflegeeinrich-tungen in Deutschland - Studienprotokoll des Qol-Dem Projektes]. In: GMS Psychosoc Med,10:Doc07, DOI: 10.3205/psm000097
Dichter, M./ Palm, R./ Halek, M./ Bartholomeyczik, S./ Meyer, G. (2016): Die Lebensqualität von Men-schen mit Demenz. Eine Metasynthese basierend auf den Selbstäußerungen von Menschen mit De-menz. In: Kovács, L./ Kipke, R./ Lutz R. (Hrsg.), Lebensqualität in der Medizin. Wiesbaden: SpringerVS, 287-302
Dichter, M./ Schwab, C./ Meyer, G./ Bartholomeyczik, S./ Dortmann, O./ Halek, M. (2014): Measuringthe quality of life in mild to very severe dementia: Testing the inter-rater and intra-rater reliability ofthe German version of the QUALIDEM. In: Int Psychogeriatr, 26(5), 825-836
Dichter, M./ Schwab, C. G./ Meyer, G./ Bartholomeyczik, S./ Halek, M. (2015): Linguistic validationand reliability properties are weak investigated of most dementia-specific quality of life measure-ments-a systematic review. In: J Clin Epidemiol. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.08.002
Schwerpunkt
127
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
128
Schwerpunkt
Dröes, R.-M./ Boelens-Van Der Knoop, E. C. C./ Bos, J./ Meihuizen, L./ Ettema, T. P./ Gerritsen, D. L./Schölzel-Dorenbos, C. J. M. (2006): Quality of life in dementia in perspective. An explorative studyof variations in opinions among people with dementia and their professional caregivers, and in litera-ture. In: Dementia, 5(4), 533-558. doi: 10.1177/1471301206069929
Ettema, T. P./ Droes, R. M./ de Lange, J./ Mellenbergh, G. J./ Ribbe, M. W. (2007): QUALIDEM: deve-lopment and evaluation of a dementia specific quality of life instrument. Scalability, reliability andinternal structure. In: Int J Geriatr Psychiatry, 22(6), 549-556. doi: 10.1002/gps.1713
Ettema, T. P./ Droes, R. M./ de Lange, J./ Ooms, M. E./ Mellenbergh, G. J./ Ribbe, M. W. (2005): Theconcept of quality of life in dementia in the different stages of the disease. In: Int Psychogeriatr, 17(3),353-370
Feder, G. S./ Hutson, M./ Ramsay, J./ & Taket, A. R. (2006): Women exposed to intimate partner violen-ce: expectations and experiences when they encounter health care professionals: a meta-analysis ofqualitative studies. In: Arch Intern Med, 166(1), 22-37. doi: 10.1001/archinte.166.1.22
Gallrach, F. (2006). Lebensqualität von Demenz – Patienten und ihren Caregivern. Eine methodischeund begriffliche Studie. (Master), Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Geiger, A. (2011): Der alte König in seinem Exil. München: dtvGenova, L. (2009). Mein Leben ohne Gestern. Köln: Bastei LübbeGräßel, E./ Niefanger, D. (2012): Angehörige erzählen. Vom Umgang mit Demenz: Einige sozialmedizi-
nische und narratologische Beobachtungen. In: Freiburg, R./ Kretzschmar, D. (Hrsg.): Alter(n) in Li-teratur und Kultur der Gegenwart. Würzburg: Königshausen und Neumann, 99-116
Hannes, K./ Lockwood, C. (2011): Pragmatism as the philosophical foundation for the Joanna Briggsmeta-aggregative approach to qualitative evidence synthesis. In: Journal of Advanced Nursing, 67(7),1632-1642
Health Information Research Unit. (2011): Search Filters for MEDLINE in Ovid Syntax and the Pub-Med translation. McMaster University http://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_MEDLINE_Strategies.aspx#Qualitative. [Stand 29.06.2012]
Jens, T. (2009): Demenz. Abschied von meinem Vater. Gütersloh: Goldmann VerlagJonas-Simpson, C. (2005): Giving voice to expressions of quality of life for persons with dementia
through story, music and art. In: Alzheimer's Care Quarterly, 6(1), 52-61Jonker, C./ Gerritsen, D. L./ Bosboom, P. R./ Van der Steen, J. T. (2004): A model for quality of life mea-
sures in patients with dementia: Lawton's next step. In: Dement Geriatr Cogn Disord, 18(2), 159-164. doi: 10.1159/000079196 DEM2004018002159 [pii]
Kovács, L./ Kipke, R./ Lutz R. (Hrsg.), Lebensqualität in der Medizin. Wiesbaden: Springer VSKrug, H. (2014): Lebensqualität und Selbstbestimmung bei neurodegenerativen Erkrankungen. Diskussion
anhand ausgewählter Krankheitsbilder. In: Coors, M./ Kumlehn, M. (Hrsg.): Lebensqualität im Alter.Gerontologische und ethische Perspektiven auf Alter und Demenz. Stuttgart: Kohlhammer, 115-126
Kumlehn, M. (2014). Lebensqualität imaginieren. Deutungen der Demenz in Literatur und Religion alsAnregung von Perspektivenwechseln in der Begleitung und Pflege. In: Coors, M./ Kumlehn, M.(Hrsg.): Lebensqualität im Alter. Gerontologische und ethische Perspektiven auf Alter und Demenz.Stuutgart: Kohlhammer, 165-182
Lawton, M. P. (1994): Quality of life in Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord, 8 Suppl 3, 138-150Logsdon, R. G./ Gibbons, L. E./ McCurry, S. M./ Teri, L. (1999): Quality of life in Alzheimer's Disease:
Patient and caregiver reports. In: J Ment Health Aging, 5(1), 21-32. Matano, T. (2000): Quality of Life of persons with alzheimer's disease. (PhD), University of Illinois at
Chicago, Chicago. Moyle, W., Venturto, L., Griffiths, S., Grimbeek, P., McAllister, M., Oxlade, D., & Murfield, J. (2011):
Factors influencing quality of life for people with dementia: a qualitative perspective. In: Aging MentHealth, 15(8), 970-977. doi: 10.1080/13607863.2011.583620
Perales, J./ Cosco, T. D./ Stephan, B. C./ Haro, J. M./ Brayne, C. (2013): Health-related quality-of-lifeinstruments for Alzheimer's disease and mixed dementia. In: Int Psychogeriatrics, 25(5), 691-706.doi: S1041610212002293 [pii] 10.1017/S1041610212002293 [doi]
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Rabins, P. V./ Black, B. S. (2007): Measuring quality of life in dementia: purposes, goals, challenges andprogress. In: Int Psychogeriatr, 19(3), 401-407. doi: S1041610207004863 [pii]10.1017/S1041610207004863
Rizzo-Parse, R. (1996): Quality of life for persons living with Alzheimer's disease: the human becomingperspective. In: Nurs Sci Q, 9(3), 126-133
Schmidhuber, M. (2013): Der Stellenwert von Autonomie für ein gutes Leben Demenzbetroffener. In:Salzburger Beiträge zur Sozialethik 5
Scholzel-Dorenbos, C. J./ Meeuwsen, E. J./ Olde Rikkert, M. G. (2010): Integrating unmet needs intodementia health-related quality of life research and care: Introduction of the Hierarchy Model ofNeeds in Dementia. In: Aging Ment Health, 14(1), 113-119. doi: 919231180 [pii]10.1080/13607860903046495
Schweda, M. & Frebel, L. (2015): Wie ist es, dement zu sein? Epistemologische Probleme und filmästhe-tische Lösungsperspektiven in der Demenzethik. In: Ethik in der Medizin 1 (2015) 27, 47-57
Smith, S. C./ Murray, J./ Banerjee, S./ Foley, B./ Cook, J. C./ Lamping, D. L., Mann, A. (2005): Whatconstitutes health-related quality of life in dementia? Development of a conceptual framework for peo-ple with dementia and their carers. In: Int J Geriatr Psychiatry, 20(9), 889-895. doi: 10.1002/gps.1374
Trigg, R./ Jones, R. W./ Skevington, S. M. (2007): Can people with mild to moderate dementia provide re-liable answers about their quality of life? In: Age Ageing, 36(6), 663-669. doi: 10.1093/ageing/afm077
Vedder, U. (2012): Erzählen vom Zerfall. Demenz und Alzheimer in der Gegenwartsliteratur. In: Zeit-schrift für Germanistik, XXII(2), 274-289
WHO. (1995). The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paperfrom the World Health Organization. In: Soc Sci Med, 41(10), 1403-1409. doi:027795369500112K [pii]
Zander-Schneider, G. (2011). Sind Sie meine Tochter? Leben mit meiner alzheimerkranken Mutter.Reinbek bei Hamburg: Rororo
Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Martin Nikolaus Dichter1, 2, * (MScN, RN)Dr. Martina Schmidhuber3, *
1 Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Standort Witten2 Department für Pflegewissenschaft, Fakultät für Gesundheit, Private Universität
Witten/Herdecke, Witten3 Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg* Der Beitrag der beiden Autoren an diesem Artikel ist gleichwertig, die Namen sind alphabe-
tisch gereiht.
Korrespondenzadresse Martin Nikolaus Dichter, MScN, RNDeutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), WittenStockumer Straße 12, 58453 Witten, [email protected]
Schwerpunkt
129
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Entwicklung des Manuskriptkonzepts: MND, MSManuskripterstellung: MND, MS
130
Schwerpunkt
Kathrin I. Fischer, Gregor Liegl, Matthias Rose, Sandra Nolte
Moderne testtheoretische Ansätze zur Messunggesundheitsbezogener Lebensqualität – Entwicklung und Anwendung computer-adaptiver Tests
The measurement of health-related quality of life using modern test theorymethods – development and application of computer adaptive tests
The inclusion of the patient perspective is an important aspect in patient-oriented healthcare and complements medical diagnostics and clinical findings. Through the assess-ment of health-related quality of life physical, psychological, and social dimensions of pa-tients are revealed. Various generic as well as disease-specific instruments to measurehealth-related quality of life have been developed over the past decades. However, inpractice some methodological challenges remain that can be addressed by use of moderntest theory methods. In the past, comprehensive and complex questionnaires were requi-red to precisely measure self-reported outcomes. In contrast, the development of compu-ter-adaptive tests (CATs) offers the unique opportunity to administer only those items thatare most informative to assess subjective well-being. Thus, it is possible to use shorterquestionnaires while retaining reliability. This paper outlines and discusses the develop-ment and application of computer-adaptive tests in clinical outcomes assessment.
KeywordsHealth-related quality of life, psychometrics, evaluation, patient-reported outcomes, mo-dern test theory, item response theory, computer-adaptive testing
Die Einbindung der Patientenperspektive ist, neben klassischen medizinischen und pfle-gerischen Daten, ein wichtiger Bestandteil der patientenorientierten Gesundheitsversor-gung. Die Messung gesundheitsbezogener Lebensqualität umfasst sowohl physische,psychische, als auch soziale Dimensionen. Verschiedene generische wie auch krank-heitsspezifische Instrumente zur Messung unterschiedlicher Konstrukte der gesund-heitsbezogenen Lebensqualität wurden in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Allerdingszeigen sich in der praktischen Anwendung einige methodische Herausforderungen, de-nen durch die Ansätze der modernen Testtheorie begegnet werden kann. Zur präzisenMessung von selbstberichteten Endpunkten war in der Vergangenheit häufig ein umfang-reicher und komplexer Fragebogen notwendig. Durch die Entwicklung computer-adapti-ver Testverfahren (CAT) besteht die Möglichkeit, gezielt Items zu administrieren, die fürden individuellen Patienten den größtmöglichen Informationsgehalt aufweisen. Somitkönnen kürzere Fragebögen bei gleichzeitigem Erhalt der Reliabilität angewendet wer-den. In diesem Beitrag werden die Entwicklung und Anwendung computer-adaptiver Testmittels moderner testtheoretischer Verfahren skizziert und diskutiert.
Schlüsselwörtergesundheitsbezogene Lebensqualität, Psychometrie, Evaluation, patientenrelevante End-punkte, moderne Testtheorie, Item-Response Theorie, computer-adaptive Testverfahren
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
eingereicht 02.10.2015akzeptiert 09.12.2015
1. Hintergrund
Über die letzten beiden Jahrzehnte hat das Konstrukt der Lebensqualität sowohl in derGesundheitsversorgung, als auch in der gesundheitspolitischen sowie gesundheitsöko-nomischen Diskussion in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabeiwird Lebensqualität als multidimensionales Konstrukt gesehen. Eine weitverbreiteteDefinition ist die der World Health Organization und umfasst die Dimensionen desphysischen und psychischen und sozialen Wohlbefindens, die Beziehung zur Umwelt,das Maß an Unabhängigkeit sowie Spiritualität / Religion (Saxena et al. 1997). Auf-grund der Verbreitung im gesundheitswissenschaftlichen Kontext kommt diese Defi-nition im gegenwärtigen Artikel zur Anwendung.
Auf Ebene der Patienten1 dient die Erhebung der Lebensqualität als wichtige Ergän-zung zu den traditionellen Patientendaten und klinischen Messwerten. In der patien-tenzentrierten Versorgung, wie von verschiedenen Akteuren der Gesundheitsversor-gung gefordert, kann durch die selbstberichtete Lebensqualität auf strukturierte undstandardisierte Weise die Patientenperspektive in die Behandlung eingebunden wer-den. Besonders bei Menschen mit chronischen Erkrankungen wird die Selbsteinschät-zung von Patienten, oder auch Patienten-Selbstbericht, als Faktor zur Entscheidungwie auch zur Evaluation von Behandlungsstrategien, hinzugezogen. Zudem könnendurch die Erhebung verschiedener Dimensionen, die der Lebensqualität subsumiertwerden, mögliche Risikofaktoren wie auch notwendige Ressourcen identifiziert wer-den (Radoschewski 2000; Osoba 2007).
Der gesundheitspolitische und gesundheitsökonomische Stellenwert der Erhebungvon patientenberichteten Endpunkten zeigt sich in Deutschland am Beispiel der Ver-fahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (2014). Neben Mortalität undMorbidität stellt die Lebensqualität den dritten Endpunkt zur Beurteilung von Maß-nahmen dar. Im Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (Prä-ventionsgesetz - PrävG 2015) wird die Steigerung der Lebensqualität ebenfalls als Ziel-setzung genannt. Auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, spielt die Erhe-bung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei der Entscheidung über dieKostenerstattung von Medikamenten innerhalb des Gesundheitssystems eine wichtigeRolle. So wird die Erfassung von gesundheitsbezogener Lebensqualität als Endpunkt inKosteneffektivitätsanalysen vorgeschrieben (Pharmaceutical Benefits Board 2007).
Verschiedene Lebensqualitätsinstrumente wurden seit den 1980er Jahren entwi-ckelt (Bullinger 2014). Primäres Ziel dieser Fragebögen ist eine valide und reliableMessung des Patienten-Selbstberichts, um diesen verlässlich z. B. für Screenings, zurlangfristigen Beobachtung von Krankheitsverläufen oder zur Evaluation von Behand-lungsmaßnahmen nutzen zu können. Wichtig hierbei ist jedoch eine standardisierteErfassung, um die Vergleichbarkeit von Patienten-Selbstberichten sowohl zwischeneinzelnen Patienten und Patientengruppen als auch im longitudinalen Verlauf zu ge-währleisten. In der klinischen Praxis oder beim Einsatz im Rahmen von Studien wer-
Schwerpunkt
131
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird hier nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind immerbeide Geschlechter gemeint.
132
Schwerpunkt
den bei der Anwendung dieser Instrumente allerdings regelmäßig Schwierigkeiten be-schrieben (Greenhalgh et al. 1999; Varni et al. 2005; Valderas et al. 2008). So werdenneben meist langen Fragebögen, die eine Belastung für die befragten Personen darstel-len, auch die häufig händische Auswertung und Interpretation der Ergebnisse als Her-ausforderungen beschrieben (Rose et al. 2009b; Kroenke et al. 2015). Zudem ist dieVergleichbarkeit unterschiedlicher Instrumente kaum gegeben (Rose et al. 2013).
Ein innovativer Ansatz zur Überwindung von Barrieren und Herausforderungen inder Anwendung von Instrumenten zur Messung von Lebensqualität stellen computer-adaptive Tests (CATs) dar (Cella et al. 2000; Rose et al. 2012). Der vorliegende Beitrag hatzum Ziel, einen Einblick in die methodische Entwicklung und Anwendung von compu-ter-adaptiven Tests in der Lebensqualitätsforschung zu geben und beinhaltet eine kurzeEinführung in moderne testtheoretische Methoden, welche die Basis von CATs bilden.
2. Konzeptionelle Ansätze in der Lebensqualitätsmessung
In der Literatur werden verschiedene Ansätze zur Erfassung von Lebensqualität be-schrieben, die sich auf der Ebene des Konstrukts unterscheiden (Rose 2009a; Nolte etal. 2013). Die globale Lebensqualität umfasst die allgemeine Lebensqualität in ihrerGesamtheit und wird für gewöhnlich mittels einer einzigen Frage gemessen, deren Ant-wort auf einer Skala (z.B. von 0 bis 100) abgebildet wird (Rose 2009a). Die gesund-heitsbezogene Lebensqualität bezieht sich inhaltlich auf verschiedene Aspekte des all-gemeinen Gesundheitszustands. Mittels Fragen, die verschiedenen Dimensionen desKonstrukts zugeordnet werden, kann so die Lebensqualität in Bezug auf den Gesund-heitszustand dargestellt werden (Rose 2009a). In Abgrenzung dazu liegt der Fokus beider Messung der erkrankungsbezogenen Lebensqualität auf krankheitsspezifischenSymptomen (Osoba 2007). Somit lässt sich die Belastung durch eine bestimmte Er-krankung in Bezug auf die Lebensqualität operationalisieren. Der Vollständigkeit hal-ber sind hier noch die sogenannten Utility-Messungen anzuführen, bei denen metho-disch versucht wird, Präferenzen bezüglich verschiedener Gesundheitssituationen zubestimmen, welche dadurch in der Gesundheitsökonomie verstärkt ihren Einsatz fin-den (Drummond et al. 2005; Osoba 2007; Kohlmann 2014). Neben der Unterschei-dung verschiedener Instrumente auf Konstruktebene, wie oben beschrieben, wird inder Lebensqualitätsforschung zudem die Selbsteinschätzung von der Fremdeinschät-zung durch Dritte unterschieden, die gemeinhin als Proxybefragung bezeichnet wer-den (Sneeuw et al. 2002; McPhail et al. 2008).
Unabhängig vom konzeptionellen Ansatz zur Messung der Lebensqualität lassensich unterschiedliche Methoden zur Messung von Lebensqualität identifizieren, wobeiwir uns auf das Konstrukt der gesundheitsbezogenen Lebensqualität konzentrieren. Imnachfolgenden Kapitel wird ein moderner Messansatz vorgestellt, die computer-adap-tive Testung (CAT). Dabei wird das Prinzip von CATs beispielhaft anhand der Mes-sung von Mobilität, einer Subdimension von physischem Wohlbefinden, dargestellt.Da der vorliegende Beitrag zum Ziel hat, einen Einblick in das methodische Vorgehen
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
zur Entwicklung von CATs zu geben, werden nachfolgend zunächst die Grundzüge dermodernen Testtheorie erläutert. Für weitere Informationen möchten wir an dieser Stel-le auf vertiefende Literatur zu modernen, testtheoretischen Verfahren sowie CATs ver-weisen (Embretson et al. 2000; DeMars 2010; van der Linden et al. 2000).
3. Moderne Psychometrie und computer-adaptive Tests
Die verschiedenen Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (wie z. B.physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden) sind als latente Merkmale defi-niert, die nicht direkt messbar sind. Um eine standardisierte Messung vornehmen zukönnen und somit vergleichbare Messergebnisse des jeweiligen theoretischen Kon-strukts zu erhalten, wird das latente Merkmal durch manifeste, also direkt messbare,Variablen ermittelt (Embretson et al. 2000; Jonkisz et al. 2012). Diese manifesten Vari-ablen entsprechen dabei Items (Fragen oder Aussagen), die von der zu befragenden Per-son beantwortet werden. Basierend auf diesen Antworten wird auf die individuelleMerkmalsausprägung einer Person geschlossen (Embretson et al. 2000).
Die Besonderheit des übergeordneten Konstrukts der gesundheitsbezogenen Le-bensqualität liegt in der eingangs beschriebenen Multidimensionalität (Bullinger2014), bestehend u. a. aus physischem, psychischem und sozialem Wohlbefinden. Umdie Konstruktvalidität eines Lebensqualitätsinstruments zur Erfassung des latentenMerkmals beurteilen zu können, ist eine genaue Definition des zu messenden Kon-strukts notwendig. Dabei ist es wichtig, dass auch die einzelnen Dimensionen, die demübergeordneten Konstrukt Lebensqualität subsumiert werden, genau definiert und so-mit voneinander abgrenzbar sind. Dies bedeutet, dass ein Instrument zur Messung vonLebensqualität entsprechend der einzelnen zu messenden Dimensionen in einzelne uni-dimensionale Instrumente unterteilt wird. Die individuelle Merkmalsausprägung, ent-sprechend der einzelnen Dimension, wird dabei mittels Items ermittelt. Die Multidimen-sionalität ergibt sich durch das Zusammenfügen der einzelnen Dimensionen, die in ihrerGesamtheit das Konstrukt der gesundheitsbezogenen Lebensqualität repräsentieren.
Viele Instrumente zur Messung gesundheitsbezogener Lebensqualität wurden aufBasis der klassischen Testtheorie konstruiert (Reeve et al. 2007; Rose et al. 2013). Beider Entwicklung dieser Instrumente ist eine Herausforderung, die richtige Balancezwischen Testlänge und der angestrebten Messpräzision zu finden. Ziel ist, ein Instru-ment zu entwickeln, welches zum einen durch die Anzahl der Fragen die Befragtennicht überfordert, und zum anderen das zu messen beabsichtigte Konstrukt präzise ab-bildet. Um die Belastung durch die Befragung beim Patienten zu begrenzen, wird in derklassischen Testtheorie die Anzahl der Items eines Fragebogens begrenzt. Dabei müs-sen zum Teil Boden- und Deckeneffekte in Kauf genommen werden, da durch die festeAnzahl der Items das gesamte Kontinuum einer Merkmalsausprägung in der Regelnicht hinreichend abgebildet werden kann. Dieser Limitation von Instrumenten derklassischen Testtheorie kann mit der Anwendung moderner messtheoretischer Verfah-ren Abhilfe geschaffen werden (Rose et al. 2013).
Schwerpunkt
133
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
134
Schwerpunkt
3.1 Moderne Testtheorie
Auf Basis der modernen Testtheorie lassen sich computer-adaptive Tests programmie-ren, welche nachfolgend dargestellt werden. Hierbei wird in den Grundzügen die Item-Response Theorie (IRT), im Deutschen häufig als probabilistische oder auch moderneTesttheorie bezeichnet, vorgestellt (Embretson et al. 2000).
Der IRT liegt die Annahme zugrunde, dass für jede vorstellbare Merkmalsausprä-gung eine Wahrscheinlichkeit bestimmt werden kann, welche Antwort von einer Per-son mit dieser Merkmalsausprägung auf ein Item gegeben wird. Ist die Wahrscheinlich-keitsbeziehung zwischen Antwort und Merkmalsausprägung auf Basis großer Stich-proben bestimmt, kann umgekehrt im Einzelfall von einer bestimmten Antwort einereinzelnen Person auf deren Merkmalsausprägung geschlossen werden. Ein Sportler, derkörperlich fit ist, wird demnach auf eine Frage, ob er in der Lage ist, 500 Meter zu ge-hen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit antworten, dass dies ohne Problememöglich ist. Im Gegensatz dazu wird ein bettlägeriger Patient auf dieselbe Frage mitsehr hoher Wahrscheinlichkeit angeben, dass dies nicht möglich ist. Dementsprechendlässt sich, basierend auf der gegebenen Antwort, ein sogenannter Theta-Wert schätzen,der die individuelle Merkmalsausprägung eines Befragten ausdrückt (Embretson et al.2000; Rose et al. 2013). Je mehr Items beantwortet werden, desto näher kommt dieseSchätzung an die „wahre“ Merkmalsausprägung einer Person heran und die Messpräzi-sion steigt. Aus technischer Sicht bedeutet dies, dass der Standardfehler („Standard Er-ror“) mit zunehmender Anzahl von Items kleiner wird.
Für die Lebensqualitätsforschung eröffnet die IRT neue Möglichkeiten in der Test-entwicklung und Messung. So können nicht nur kürzere Instrumente mit gleichzeitigverbesserter Messgenauigkeit entwickelt, sondern durch flexible (adaptive) Anpassungder Items an die jeweilige getestete Person auch Boden- und Deckeneffekte reduziertwerden. Dies bedeutet, dass selbst bei extremen Merkmalsausprägungen eine präziseSchätzung des Theta-Wertes möglich ist (Bjorner et al. 2007).
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Merkmalsausprägung (Theta-Wert)bei einem bestimmten Antwortverhalten vorliegt, wird in der IRT durch die Schätzungvon individuellen Itemparametern bestimmt. Es werden dabei verschiedene IRT-ba-sierte Ansätze zur Schätzung der Merkmalsausprägung unterschieden, die die mathe-matische Beziehung zwischen Item und Merkmalsausprägung beschreiben. In der Le-bensqualitätsforschung werden häufig sogenannte „2-PL Modelle“ eingesetzt. „2-PL“steht dabei für „zwei Parameter“, d. h. dass jedes Item nach dem Parameter „Schwierig-keit“ und nach dem Parameter „Diskriminierung“ charakterisiert wird (Embretson etal. 2000; Devine et al. 2014; Fliege et al. 2005; Walter et al. 2008). Die Schwierigkeit(„Item Difficulty“) beschreibt hierbei, wie die einzelnen Antwortkategorien einesItems hinsichtlich der Merkmalsausprägung der Dimension angeordnet sind. Die Dis-kriminierung („Item Discrimination“) eines Items hingegen zeigt, wie gut die auf einItem gegebene Antwort zwischen unterschiedlichen Merkmalseigenschaften unter-scheidet. Eine Item-Charakteristik Kurve („Item Characteristic Curve“) bietet dabeidie Möglichkeit, die Eigenschaften der einzelnen Items zu visualisieren. Die Y-Achse
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
zeigt dabei die Wahrscheinlichkeit an, und reicht von 0 bis 1. Auf der X-Achse wird derTheta-Wert, also die Merkmalsausprägung der Befragten, dargestellt und kann, zu-mindest theoretisch, Werte von -∞ bis +∞ annehmen. Durch die Position („Location“)der Kurve auf der X-Achse lässt sich somit die Schwierigkeit eines Items, in Referenz zuder zuvor bestimmten Stichprobe, feststellen. Items, bei denen nur bei einer hohenMerkmalsausprägung eine hohe Wahrscheinlichkeit vorliegt, das Item „positiv“ zu be-antworten, werden als „schwere“ Items bezeichnet. Sie befinden sich eher rechts inner-halb des Koordinatensystems. Übertragen auf die Subdimension Mobilität befindetsich demnach die Item-Charakteristik Kurve für das Item „Sind Sie in der Lage, einenMarathon zu laufen?“ in Referenz zur Gesamtbevölkerung sehr weit rechts auf der X-Achse, da bei einer angenommenen Normalverteilung innerhalb der Bevölkerung nurwenige Personen, die körperlich sehr fit sind, diese Frage „positiv“ beantworten wer-den. Die Diskriminierung eines Items zeigt sich in der Steigung („Slope“) der Kurve. Jesteiler eine Kurve, desto besser kann durch das Item zwischen Befragten mit unter-schiedlichen Merkmalsausprägungen unterschieden werden. In anderen Worten: jesteiler eine Kurve, desto informativer ist das Item (Embretson et al. 2000).
Die Item-Charakteristik Kurve wird abschließend an einem konkreten Beispiel er-läutert. In der Lebensqualitätsforschung werden häufig ordinal skalierte (polytome)Items verwendet. Dementsprechend wird für jede Antwortkategorie eine individuelleItem-Charakteristik Kurve berechnet. Bei polytomen Items wird dabei von „Characte-ristic Category Curves“ gesprochen (Embretson et al. 2000). Abbildung 1 zeigt bei-spielhaft die Characteristic Category Curve für das polytome Item „Bereitet es IhnenSchwierigkeiten, 1 km zu gehen?“ Das hier dargestellte Model entspricht dem 2-Para-meter Modell, in dem sowohl die Steigung als auch die Position entlang der X-Achse alsParameter ermittelt werden. Ausgehend von der Annahme, dass das Modell in Referenzzur Normalbevölkerung geschätzt wurde, handelt es sich im vorliegenden Beispiel, inBezug auf die Schwierigkeit des Items, um ein durchschnittliches bis eher leichtes Item.Das heißt, dass Personen mit einer normalen körperlichen Funktionsfähigkeit mit ei-ner sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Antwort „wenig“ oder „überhaupt nicht“ an-kreuzen. Dies erkennt man an der Position der beiden Antwortkurven (siehe Abbil-dung 1). Ausgehend von einer Normalverteilung entspricht der Theta-Wert von 0 (+/-1 Standardabweichung) dem durchschnittlichen Maß an körperlicher Funktionsfähig-keit bzw. Mobilität. Die Schnittpunkte der Kurven (siehe Kreise in Abbildung 1) wer-den bei der IRT als Schwellenwerte bezeichnet. Sie lassen Rückschlüsse auf die Spann-weite des Theta-Werts zu. Wird das Beispiel Item mit „wenig“ beantwortet, wird derTheta-Wert bei ca. -0,2 bei einer Spannweite von -1,1 bis 0,8 liegen.
3.2 Entwicklung und Ablauf von computer-adaptiven Tests
Wie zuvor beschrieben, können die Modelle der modernen Testtheorie dazu dienen,computer-adaptive Tests zu konstruieren. Diese neue Generation an Lebensqualitäts-instrumenten vereint mehrere Vorteile gegenüber den häufig in der Praxis eingesetztenPapierfragebögen (Rose et al. 2013; Kohlmann 2014). Neben der computer-assistier-
Schwerpunkt
135
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
136
Schwerpunkt
ten Datenerfassung, die eine langwierige Dateneingabe und die Gefahr von Übertra-gungsfehlern minimiert, kann durch CATs die Anzahl der Testfragen reduziert und so-mit der Beantwortungsaufwand verringert werden. Trotz der Reduktion der Testfragenkönnen CATs zuverlässige Testergebnisse ermitteln, die mindestens genauso, zum Teilauch präziser, als statische Messinstrumente sind (Bjorner et al. 2007; Reeve et al.2007; Rose et al. 2013).
Das Prinzip von CATs basiert darauf, dass nur Items administriert werden, die zurBestimmung eines möglichst präzisen Theta-Werts benötigt werden. In anderen Wor-ten: es werden nur Items administriert, die einen Informationsgewinn erwarten lassen(Rose et al. 2012). Um das multidimensionale Konstrukt der gesundheitsbezogenenLebensqualität zu ermitteln, werden Theta-Werte auf Ebene der subsumierten Dimen-sionen ermittelt. Am Beispiel der WHO Definition bedeutet dies, dass einzelne Theta-Werte z. B. für das physische, psychische und soziale Wohlbefinden bestimmt werden.Dazu werden für die einzelnen Dimensionen sogenannte Itembanken entwickelt, umdie Merkmalsausprägung zu bestimmen.
Itembanken beinhalten eine Vielzahl von Items zu einer bestimmten Dimension.Dabei werden alle Items der Itembank auf einer gemeinsamen Metrik kalibriert. Ur-sprünglich kommt diese Art von Itembanken (oder Item Pools) aus dem Bereich derBildungsforschung (Thissen et al. 2007). Hier werden Itembanken genutzt, um ver-gleichbare Testergebnisse – trotz unterschiedlicher Testfragen – zu erhalten und dabeiein einheitliches Schwierigkeitslevel von Prüfungen sicherzustellen. Durch die Beur-teilung der einzelnen Items einer Itembank hinsichtlich ihrer Schwierigkeit können
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Abb. 1: Item-Charakteristik Kurve
rsehßigmä
g g
ignewthic ntpuahrebü
niotlaup
Mr dethicrpstn etre W Weateh T:P( e B initekhlicinehcsrha W a:)
etrewnlleewhSc -2,2 -
e 0no vateh Tin E.gg.nugguärpsualsmakre M.tre W Weateh Tn deu zgg zuze
1,1 0,8
Mnehlictitnhcshcr duri deeb dathicrpstn
popznereffee Rr de ingg innugguärpsualsmakre M
θTheta Wert entspricht der Merkmalsausprägung. Ein Theta von 0 entspricht dabei der durchschnittlichen Merkmalsausprägung in der Referenzpopulation.P(θ): Wahrscheinlichkeit in Bezug zu dem Theta Wert.
sehrmäßig wenig
überhaupt nicht
Schwellenwerte
Item: Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten 1 km zu gehen?
Fragen mit gleichem Schwierigkeitsgrad identifiziert werden. Im Gegensatz dazu istdas Ziel der Lebensqualitätsforschung, durch die Items ein breites Spektrum einerMerkmalsausprägung abzubilden und demnach Items in die Itembank aufzunehmen,die möglichst unterschiedliche Grade der Merkmalsausprägung abfragen.
Die Kalibrierung der Items auf einer gemeinsamen Skala erfolgt, indem diese aufBasis ihrer Parameter miteinander in Beziehung gesetzt werden und dadurch in eineRangfolge gebracht werden. Durch diese Zusammenführung auf eine gemeinsameMetrik ist eine problemlose Erweiterung der Itembank möglich. Die für die Kalibrie-rung aller Items benötigte Kalibrierungsstichprobe ist dabei genau zu definieren. Beikrankheitsspezifischen Konstrukten kann es sich beispielsweise anbieten, nicht die Ge-samtbevölkerung als Referenzpopulation zu nehmen, sondern eine Subpopulation,welche die entsprechende Krankheit aufweist. Unabhängig von der definierten Refe-renzstichprobe ist es in jedem Fall notwendig, dass diese Kalibrierungsstichprobe diegesamte Spanne der Merkmalsausprägung abbildet, sodass jede Antwortkategorie hin-reichend repräsentiert wird (Bjorner et al. 2007; Thissen et al. 2007).
Bei der Kalibrierung aller Items auf einer gemeinsamen Skala kann, wie in Abbil-dung 1 dargestellt, der Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1, unterAnnahme einer Normalverteilung, als Beurteilungsmaßstab gesetzt werden. Allerdingswird gerade in der Lebensqualitätsforschung davon abgewichen, da negative Werte inder Merkmalsausprägung zu Missverständnissen in der Interpretation führen können.Wenn beispielsweise eine Person eine Merkmalsausprägung von Theta=-0.5 aufweist,könnte dieser Wert intuitiv nachteilig für den Untersuchten interpretiert werden, ob-wohl dieser bei einer halben Standardabweichung vom Mittelwert völlig im Durch-schnittsbereich der Referenzpopulation liegt. Eine Alternative ist die Transformationder Testwerte auf eine T-Skala mit einem Mittelwert von 50 mit 10 als Standardabwei-chung (Thissen et al. 2007). Diese Skalentransformation wurde sowohl bei CATs imdeutschsprachigen Raum (Fliege et al. 2005; Walter et al. 2008) wie auch von der U.S.-amerikanischen Patient-Reported Outcomes Measurement Information System(PROMIS) Initiative (Cella et al. 2010) adaptiert.
Zur Erstellung von Itembanken für die einzelnen Dimensionen eines Instrumentszur Messung von Lebensqualität wird meist eine systematische Vorgehensweise ge-wählt. Nach der genauen Definition der jeweiligen Dimension wird im nächstenSchritt eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt, um passende Items für dieItembank zu identifizieren. Diese Items werden anschließend begutachtet und hin-sichtlich ihrer Parameter bewertet, um so eine vorläufige Liste an Items zusammenzu-stellen, welche in einem größeren Rahmen getestet werden (Petersen et al. 2011; Peter-sen et al. 2013; Gamper et al. 2014). Mitunter kann es zudem notwendig sein, neueItems zu entwickeln, um sicherzustellen, dass auch extreme Merkmalsausprägungenabgebildet werden können. Ein wichtiges Kriterium in der IRT ist die Eindimensiona-lität der in der Itembank zusammengeführten Items, um die jeweilige Dimension vali-de bestimmen zu können (Bode et al. 2003; Bjorner et al. 2007). Das bedeutet, dass an-hand faktoranalytischer Methoden überprüft werden sollte, ob alle Items dasselbe
Schwerpunkt
137
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
138
Schwerpunkt
Konstrukt messen. Bei der Zusammenstellung der Items für die finale Itembank wer-den nach Berechnung der Item-Parameter, Items mit geringem Differenzierungspo-tential, geringem Informationsgehalt sowie mehrdimensionale Items aus dem Poolentfernt. Allerdings ist neben den statistischen Kriterien, nach denen die psychometri-sche Güte der Items beurteilt wird, auch eine Beurteilung hinsichtlich des Inhalts sinn-voll, bevor ein Item in die entsprechende Itembank ein- bzw. aus ihr ausgeschlossenwird (Bode et al. 2003; Haley et al. 2009). Um Decken- und Bodeneffekte zu minimie-ren, sollten die Items einer Itembank zudem einen möglichst breiten Bereich hinsicht-lich des Schwierigkeitsgrades aufweisen (Bode et al. 2003; Haley et al. 2009). Wie inAbbildung 2 schematisch an einer Itembank zur Mobilität dargestellt, werden unter-schiedliche Fragen, die ein breites Fähigkeitsspektrum abdecken, in der Itembank auf-genommen. Wie unterhalb der T-Metrik zu sehen ist, ist das Item „das Bett verlassen,um sich auf einen Stuhl zu setzen“ am unteren Ende und das Item „einen Marathon lau-fen“ am oberen Ende der Merkmalsausprägung dargestellt. Dies bedeutet, dass einerPerson, die angibt einen Marathon laufen zu können, ein hoher Theta-Wert zugeord-net wird, wohingegen einer Person, die nicht in der Lage ist, das Bett zu verlassen, umsich auf einen Stuhl zu setzen, ein sehr niedriger Theta-Wert zugewiesen wird. In Abbil-dung 2 ist zusätzlich oberhalb der T-Metrik die Referenzpopulation dargestellt, welchezur Beurteilung individueller Fähigkeitsausprägungen herangezogen werden kann.Die in der Darstellung grau unterlegte Person hat einen T-Wert von ungefähr 34. Dem-zufolge befindet sich diese Person hinsichtlich ihrer der Mobilität mehr als 1,5 Stan-dardabweichungen unterhalb des zuvor definierten Mittelwerts von 50.
Auf Basis von Itembanken können CATs entwickelt werden, deren Prinzip nachfol-gend am Beispiel der Subdimension Mobilität verdeutlicht wird. Wie in Abbildung 3dargestellt, wird zunächst das Item „Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, eine kurze Stre-cke außer Haus zu gehen?“ administriert. Dieses Item hat vier Antwortmöglichkeitenvon „sehr“ bis „überhaupt nicht“. Jeder Teilnehmer beginnt mit der gleichen Frage,
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Abb.2: Schematische Darstellung einer Itembank
!
!"
!"
!!
!
!!
! " ""
""!
""
!!"
!!
!" "
! ""!"
!!"
!
!"!!!
!
!
!"
""
F 20
"30 40 50 60 70 T- ikrteM
ehlicreprö ketu grhSeitekighäffäsniotktnuF
"
F
F
F
F
F F F
F F
F
F
F F
F F F
F
F F F F
F F F
F
F
F F F F
F F
F F F F
F F
F
F
F
F
F F
F
F
F F
m
m
k3nredanw
r 3 k10 nennre
Fü 0 3r tenunMinereiazps engeh
nn
Eine onhatarr Mneffeaul
Eine nezkurzgangreiazpS
nehacm
Im sauHnheegrrgheum
mg
005engeh
znereffeeRoniatluopP
""!" "
"
""!
"
"!
"
"
"!
""
"
"
Ein
"
aarpetithrSc
engeh
""
"
""
!"!
?"
"!"
etknärhcsegin ek raStitekighäffäsniotknu Fehlicrreprök
n
"
EinezatsbaanepperT
hoch engeh
as
"
D ttBe nesaslrev , um chsi f au ennei
uhlSt zu ensetz .
!!"
"!
"
!!
! !""
F
F
F F
F
Stark eingeschränkte kör-perliche Funktionsfähigkeit
Sehr gute körperlicheFunktionsfähigkeit
Das Bett verlassen,um sich auf einenStuhl zu setzen.
Ein paarSchrittegehen
Im Haus um-hergehen
Einen Treppen-absatz hoch gehen
500 mgehen
Einen kurzenSpaziergang machen
Für 30 Minutenspazieren gehen
3 kmwandern
10 kmrennen
Einen Marathonlaufen
T-Metrik
Referenz Population
dem sogenannten Startitem. In der Regel wird ein Startitem aus der Itembank danachausgewählt, einen möglichst breiten Bereich der Merkmalsausprägung abzudecken(Ware et al. 2000). Das heißt, das Startitem sollte in der Lage sein, eine erste Differen-zierung zwischen schlechter, mittlerer und guter körperlicher Funktionsfähigkeit bzw.Mobilität vorzunehmen. Je nach Antwort wird ein vorläufiger Theta-Wert für die Di-mension geschätzt. Der bereits erwähnte Standardfehler gibt zudem Auskunft über diePräzision des Theta-Werts. Anhand des ersten Theta-Werts wird das nächste Item aus-gewählt, welches den höchsten Informationsgehalt für den vorläufigen Theta-Wertaufweist. Diese Auswahl ist möglich, da, wie oben beschrieben, alle Items einer Item-bank auf einer gemeinsamen Metrik kalibriert werden. Somit sind alle Items in Rela-tion zueinander auf einer Skala, die von schlechter bis sehr guter Mobilität reicht, ange-ordnet. Ein Befragter, der hier bereits angibt, dass eine kurze Strecke außer Haus zu ge-hen sehr hohe Schwierigkeiten bereitet, wird nicht gefragt werden, ob ein 10 km Laufmöglich ist, sondern eher, ob er stehen kann. Für eine Person wiederum, die eine hohekörperliche Funktionsfähigkeit aufweist und somit mit einer hohen Wahrscheinlich-keit die Antwort „überhaupt nicht“ ankreuzen wird, wird das nächstfolgende Itemschwieriger sein. So könnte bei diesem Befragten die zweite Frage lauten „Bereitet es Ih-nen Schwierigkeiten, 30 Minuten spazieren zu gehen?“.
Die Anzahl der Fragen werden bei einem CAT durch sogenannte Stopping Rules, al-so Regeln zur Beendigung des Tests, bestimmt. Das bedeutet, dass somit nicht nur dieItems an sich, sondern auch die Anzahl der administrierten Items zwischen den Befrag-ten variieren kann. Es werden in der Literatur zwei Arten von Stopping Rules beschrie-ben, die häufig miteinander kombiniert werden (Ware et al. 2000). Zum einen kanndie maximale Anzahl der Fragen von Beginn an determiniert werden. Dabei wird an-hand von Simulationen getestet, wie viele Items im Durchschnitt benötigt werden, umeinen Testwert mit einer hohen Präzision zu ermitteln. Zum anderen kann die Präzi-
Schwerpunkt
139
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Startitem Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten für 30 Minuten spazieren zu gehen?
Vorläufiger -Wert und SD
2. Item Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten 1km zu rennen?
3. Item Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten 3km zu wandern?
Neu-Schätzung des -Wert und SD,
Überprüfung ob Stoppingrule erfüllt ist, ggf. Beendigung des CATs.
-Wert: Merkmalsausprägung im Bezug auf körperliche Funktionsfähigkeit SD: Standardabweichung
mäßig sehr wenig überhaupt nicht
mäßig sehr wenig überhaupt nicht
Abb. 3: Exemplarische Darstellung eines CATs
Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten für 30 Minuten spazieren zu gehen?
sehr
Vorläufiger θ-Wertund SD
2. Item
Neu-Schätzung desθ-Wert und SD,Überprüfung obStopping Rule erfülltist, ggf. Beendigungdes CATs.
3. Item
Startitem
Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten 3km zu wandern?
θ-Wert: Merkmalsausprägung im Bezug auf körperliche FunktionsfähigkeitSD: Standardabweichung
mäßig wenigüberhauptnicht
überhauptnicht
wenigmäßigsehr
Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten 1km zu rennen?
140
Schwerpunkt
sion, welche durch die Standardfehler dargestellt wird, als Stopping Rule definiert wer-den. Das heißt, dass der CAT beendet wird, wenn der Standardfehler des ermitteltenTheta-Werts einen zuvor festgelegten Schwellenwert unterschreitet. Durch die Kom-bination dieser beiden Stopping Rules wird der CAT so kurz wie nötig, aber so präzisewie möglich gehalten (Cook et al. 2007; Thissen et al. 2007).
4. Praktische Anwendung und Herausforderungen im klinischen Setting
Das Potential der Messung gesundheitsbezogener Lebensqualität für die Bereiche derGesundheitsökonomie, der Gesundheitspolitik wie auch für die klinische Praxis istderzeit noch nicht ausgeschöpft (Bullinger 2014). Sowohl in klinischen Studien, alsauch in der klinischen Praxis werden das Zielkriterium Lebensqualität und demzufolgeauch der Einsatz von Instrumenten zu ihrer Messung nicht flächendeckend eingesetzt(Rose et al. 2012; Bullinger 2014). Demensprechend schwierig gestaltet sich auch dieIntegration der Lebensqualität als Beurteilungsmaßstab in gesundheitspolitischen undgesundheitsökonomischen Diskussionen, da aufgrund der Datenlage nur schwer evi-denzbasierte Entscheidungen getroffen werden können (Bullinger 2014).
International zeigt sich hingegen, dass der Einsatz von Instrumenten zur Messungder gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowohl im klinischen Alltag, als auch auf ge-sundheitspolitischer und gesundheitsökonomischer Ebene in den letzten Jahren deut-lich zugenommen hat und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung beiträgt. InSchweden beispielweise wird im Rahmen von Qualitätsregistern die gesundheitsbezo-gene Lebensqualität bei Patienten mit Arthrose erhoben. Diese Daten werden aller-dings zur Evaluation von Behandlungsmethoden und nicht in der direkten Patienten-versorgung herangezogen (Ovretveit et al. 2013). Smith et al. (2014) beschreiben dieMessung von patientenbezogenen Endpunkten mittels computer-assistierender Syste-me in der klinischen Praxis in den USA. Die routinemäßige Erhebung von psychi-schem Wohlbefinden und Stress bei onkologischen Patienten wurde sowohl zumScreening, als auch in der direkten Patientenversorgung genutzt. Die Anwendung ei-nes elektronischen Systems hat dabei die Datenerhebung gegenüber dem Einsatz vonFragebögen im Papierformat verbessert wie auch den Arbeitsablauf in der Klinik opti-miert.
Obwohl die Form der Datenerhebung, z. B. von Patienten-Selbstberichten mittelsCATs, wie oben dargestellt, Vorteile und Potenziale im gesundheitswissenschaftlichenKontext bietet, kommen CATs in diesem Kontext nur vereinzelt zum Einsatz. So kom-men in den obengenannten internationalen Beispielen keine CATs zur Anwendung,sondern lediglich elektronische Datenerhebungssysteme, welche auf der klassischenTesttheorie beruhen. Die komplexe Entwicklung von computer-adaptiven Tests, diefundierte Kenntnisse in der modernen Testtheorie, aber auch Erfahrung im Bereich derInformationstechnologie und der elektronischen Datenverarbeitung voraussetzt, istals möglicher Grund hierfür zu sehen. Neben der Entwicklung von Itembanken, der
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Schätzung der Itemparameter und der Programmierung des CATs, müssen in der klini-schen Praxis zusätzlich Fragen hinsichtlich des technischen Supports, des Trainings derMitarbeiter, der Unterstützung der Patienten beim Ausfüllen, die Einbindung in dasKrankenhausinformationssystem wie auch Aspekte des Datenschutzes geklärt werden(Chang 2007; Rose et al. 2009b).
Dennoch lassen sich Beispiele für den Einsatz von CATs in der Gesundheitsversor-gung finden. An der Charité - Universitätsmedizin Berlin werden bereits seit über zehnJahren CATs erfolgreich eingesetzt. So werden der A-, der D- und der S- CAT (Fliege etal. 2005; Rose et al. 2009b; Devine et al. 2014) in der Medizinischen Klinik mitSchwerpunkt Psychosomatik zur Messung von Angst, Depression bzw. Stress in der kli-nischen Praxis verwendet. Auch in nationalen Studien, wie der BELLA-Studie (2015),welche ein Modul der vom Robert Koch-Institut durchgeführten Studie zur Gesund-heit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) ist, wird in der aktuellenDatenerhebung unter anderem der Kids-CAT (Devine et al. 2015) zur Erhebung dergesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt.
5. Fazit und Schlussfolgerung
Computer-adaptive Tests bieten eine effiziente und präzise Methode zur Messung ge-sundheitsbezogener Lebensqualität. Der Vorteil von CATs gegenüber Instrumenten,die auf Methoden der klassischen Testtheorie basieren, liegt in der Minimierung desBeantwortungsaufwandes bei gleichzeitig hoher Reliabilität und Validität der Tester-gebnisse. Beim Einsatz von CATs erhält jeder Befragte einen Fragebogen, der sich – ba-sierend auf den gegeben Antworten – individuell anpasst. Die Befragten werden somitnicht mit der Beantwortung von Fragen belastet, die keine Relevanz für sie haben bzw.keine neuen Informationen liefern. Demnach beantwortet jeder Befragte ein unter-schiedliches Set an Fragen. Durch die Kalibrierung aller Fragen auf einer gemeinsamenMetrik, können sogenannte Theta-Werte ermittelt werden. Auf Basis dieser Werte las-sen sich, trotz der unterschiedlichen Fragen-Sets, Testwerte unterschiedlicher Perso-nen miteinander vergleichen. Ein weiterer Vorteil von CATs ist die computer-basierteAdministration der Befragung, die eine sofortige Verfügbarkeit der Daten sowieelektronische Auswertung der Testergebnisse ermöglicht. Die computer-adaptive Tes-tung stellt somit, neben der traditionellen Papier-Bleistift-Methode und der compu-ter-unterstützten Befragung, eine weitere Methode zur Datenerhebung dar, die unterBerücksichtigung des Kontexts, in dem die Datenerhebung stattfindet, zukünftig mit-diskutiert werden sollte.
Den oben aufgeführten Vorteilen von CATs in der praktischen Anwendung stehenjedoch Herausforderungen in der Entwicklung gegenüber, die bereits im vorangegan-genen Kapitel andiskutiert wurden. Die Entwicklung von CATs ist aufwendiger als dieEntwicklung von Messinstrumenten, die auf der klassischen Testtheorie basieren undsetzt fundierte Kenntnisse sowohl im Bereich der Psychometrie als auch Fachkennt-
Schwerpunkt
141
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
142
Schwerpunkt
nisse zur Programmierung eines solchen Instruments voraus. Allerdings stehen ver-schiedene Softwarelösungen zur Verfügung, die die Entwicklung von CATs unterstüt-zen.
Es verbleibt, dass die computer-adaptive Testung eine reliable und effiziente Mes-sung gesundheitsbezogener Lebensqualität darstellt, deren Potential im gesundheits-wissenschaftlichen Kontext noch lange nicht ausgeschöpft ist.
LiteraturBELLA-Studie (2015): BELLA-Studie - Was wird gemessen? URL: http://www.bella-study.org/die-stu-
die/was-wird-gemessen/. [Stand: 02.12.2015]Bjorner, J. B., Chang, C. H., Thissen, D., Reeve, B. B. (2007): Developing tailored instruments: item
banking and computerized adaptive assessment. In: Qual Life Res, 16 Suppl 1, 95-108Bode, R. K., Lai, J. S., Cella, D., Heinemann, A. W. (2003): Issues in the development of an item bank.
In: Arch Phys Med Rehabil, 84 (4 Suppl 2), S52-60Bullinger, M. (2014): [The concept of quality of life in medicine: its history and current relevance]. In: Z
Evid Fortbild Qual Gesundhwes, 108 (2-3), 97-103Cella, D., Chang, C. H. (2000): A discussion of item response theory and its applications in health status
assessment. In: Med Care, 38 (9 Suppl), II66-72Cella, D., Riley, W., Stone, A., Rothrock, N., Reeve, B., Yount, S., Amtmann, D., Bode, R., Buysse, D.,
Choi, S., Cook, K., Devellis, R., DeWalt, D., Fries, J. F., Gershon, R., Hahn, E. A., Lai, J. S., Pilkonis,P., Revicki, D., Rose, M., Weinfurt, K., Hays, R. (2010): The Patient-Reported Outcomes Measure-ment Information System (PROMIS) developed and tested its first wave of adult self-reported healthoutcome item banks: 2005-2008. In: J Clin Epidemiol, 63 (11), 1179-94
Chang, C. H. (2007): Patient-reported outcomes measurement and management with innovative metho-dologies and technologies. In: Qual Life Res, 16 Suppl 1, 157-66
Cook, K. F., Teal, C. R., Bjorner, J. B., Cella, D., Chang, C. H., Crane, P. K., Gibbons, L. E., Hays, R. D.,McHorney, C. A., Ocepek-Welikson, K., Raczek, A. E., Teresi, J. A., Reeve, B. B. (2007): IRT healthoutcomes data analysis project: an overview and summary. In: Qual Life Res, 16 Suppl 1, 121-32
DeMars, C (2010): Item Response Theory. New York: Oxford Uiversity Press IncDevine, J., Fliege, H., Kocalevent, R., Mierke, A., Klapp, B. F., Rose, M. (2014): Evaluation of Compu-
terized Adaptive Tests (CATs) for longitudinal monitoring of depression, anxiety, and stress reactions.In: Journal of affective disorders, doi:10.1016/j.jad.2014.10.063
Devine, J., Otto, C., Rose, M., Barthel, D., Fischer, F., Mulhan, H., Nolte, S., Schmidt, S., Ottova-Jor-dan, V., Ravens-Sieberer, U. (2015): A new computerized adaptive test advancing the measurement ofhealth-related quality of life (HRQoL) in children: the Kids-CAT. In: Qual Life Res, 24 (4), 871-84
Drummond, M.F., Sculpher, M.J., Torrance, G.W, O´Brien, B.J., Stoddart, G.L. (2005):Methods forthe Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford: Oxford University Press
Embretson, S. E. R., Steven P. (2000): Item Response Theory For Psychologists. London: Lawrence Erl-baum Associates
Fliege, H., Becker, J., Walter, O. B., Bjorner, J. B., Klapp, B. F. , Rose, M. (2005): Development of a com-puter-adaptive test for depression (D-CAT). In: Qual Life Res, 14 (10), 2277-91
Gamper, E. M., Groenvold, M., Petersen, M. A., Young, T., Costantini, A., Aaronson, N., Giesinger, J.M., Meraner, V., Kemmler, G., Holzner, B. (2014): The EORTC emotional functioning computer-ized adaptive test: phases I-III of a cross-cultural item bank development. In: Psychooncology, 23 (4),397-403
Gemeinsamer Bundesaussschuss. (2014): Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses.URL: https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1002/VerO_2014-12-18_iK2015-04-16.pdf.[Stand: 02.12.2015]
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Greenhalgh, J., Meadows, K. (1999): The effectiveness of the use of patient-based measures of health inroutine practice in improving the process and outcomes of patient care: a literature review. In: J EvalClin Pract, 5 (4), 401-16
Haley, S. M., Ni, P., Jette, A. M., Tao, W., Moed, R., Meyers, D., Ludlow, L. H. (2009): Replenishing acomputerized adaptive test of patient-reported daily activity functioning. In: Qual Life Res, 18 (4),461-71
Jonkisz, E., Moosbrugger, H., Brandt, H. (2012): Planung und Entwicklung von Tests und Fragebogen.In: Mossbrugger, H. and Kelava, A.(Hrsg.): Testtheorie und Fragebogenkonsturktion. Berlin: Sprin-ger-Verlag, 27-74
Kohlmann, T. (2014): [Measuring quality of life: as simple as possible and as detailed as necessary]. In: ZEvid Fortbild Qual Gesundhwes, 108 (2-3), 104-10
Kroenke, K., Monahan, P. O., Kean, J. (2015): Pragmatic characteristics of patient-reported outcomemeasures are important for use in clinical practice. In: J Clin Epidemiol, 68, 1085-92
McPhail, S., Beller, E., Haines, T. (2008): Two perspectives of proxy reporting of health-related quality oflife using the Euroqol-5D, an investigation of agreement. In: Med Care, 46 (11), 1140-8
Nolte, S., Rose, M. (2013): [The assessment of health-related quality of life in adults]. In: Gesundheits-wesen, 75 (3), 166-74
Osoba, D. (2007): Translating the science of patient-reported outcomes assessment into clinical practice.In: JNCI Monographs, 2007 (37), 5-11
Ovretveit, J., Keller, C., Hvitfeldt Forsberg, H., Essén, A., Lindblad, S., Brommels, M. (2013): Continu-ous innovation: developing and using clinical database with new technology for patient-centered care- the case of the Swedish quality register for arthritis. In: Int J Qual Health C, 25 (2), 118-124
Petersen, M. A., Groenvold, M., Aaronson, N. K., Chie, W. C., Conroy, T., Costantini, A., Fayers, P.,Helbostad, J., Holzner, B., Kaasa, S., Singer, S., Velikova, G., Young, T. (2011): Development of com-puterized adaptive testing (CAT) for the EORTC QLQ-C30 physical functioning dimension. In:Qual Life Res, 20 (4), 479-90
Petersen, M. A., Giesinger, J. M., Holzner, B., Arraras, J. I., Conroy, T., Gamper, E. M., King, M. T., Ver-donck-de Leeuw, I. M., Young, T., Groenvold, M. (2013): Psychometric evaluation of the EORTCcomputerized adaptive test (CAT) fatigue item pool. In: Qual Life Res, 22 (9), 2443-54
Pharmaceutical Benefits Board. (2007): The Swedish Pharmaceutical Reimbursement System. URL:http://www.tlv.se/Upload/English/ENG-swe-pharma-reimbursement-system.pdf. [Stand:02.12.2015]
Präventionsgesetz – PrävG (2015): Gesetz zu Stärkung der Gesundheitsförderung und der Präventionvom 17. Juli 2015. In: Bundesgesetzblatt Jg 2015, Teil I, Nr. 31
Radoschewski, M. (2000): Gesundheitsbezogene Lebensqualität – Konzepte und Maße. In: Bundesge-sundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 43 (3), 165-189
Reeve, B., Hays, R., Chang, C. H., Perfetto, E. M. (2007): Applying item response theory to enhance he-alth outcomes assessment. In: Qual Life Res, 16 Suppl 1, 1-3
Rose, M. (2009a): Lebensqualität bei chronischen Erkrankungen. In: Janssen, P. L., Joraschky, P. andTress, W.(Hrsg.): Leitfaden Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag, 227-234
Rose, M., Bezjak, A. (2009b): Logistics of collecting patient-reported outcomes (PROs) in clinical practi-ce: an overview and practical examples. In: Qual Life Res, 18 (1), 125-36
Rose, M., Bjorner, J. B., Fischer, F., Anatchkova, M., Gandek, B., Klapp, B. F., Ware, J. E. (2012): Com-puterized adaptive testing—ready for ambulatory monitoring? In: Psychosom Med, 74 (4), 338-48
Rose, M., Wahl, I., Lowe, B. (2013): [Computer adaptive tests in medicine]. In: Psychother PsychosomMed Psychol, 63 (1), 48-54
Saxena, S., Orley, J. on behalf of the WHOQOL Group (1997). Quality of life assessment: The WorldHeealth Organization perspective. In:Eur Psychiatry, 12, 263s-266s
Smith, S. K., Rowe, K., Abernethy, A. P. (2014): Use of an electronic patient-reported outcome measure-ment system to improve distress management in oncology. In: Palliat Support Care, 12 (1), 69-73
Schwerpunkt
143
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
144
Schwerpunkt
Sneeuw, K. C., Sprangers, M. A., Aaronson, N. K. (2002): The role of health care providers and signifi-cant others in evaluating the quality of life of patients with chronic disease. In: J Clin Epidemiol, 55(11), 1130-43
Thissen, D., Reeve, B. B., Bjorner, J. B., Chang, C. H. (2007): Methodological issues for building itembanks and computerized adaptive scales. In: Qual Life Res, 16 Suppl 1, 109-19
Valderas, J. M., Kotzeva, A., Espallargues, M., Guyatt, G., Ferrans, C. E., Halyard, M. Y., Revicki, D. A.,Symonds, T., Parada, A., Alonso, J. (2008): The impact of measuring patient-reported outcomes inclinical practice: a systematic review of the literature. In: Qual Life Res, 17 (2), 179-93
Van der Linden, W.J., Glas, C.A. (2000): Computerized Adaptive Testing: Theory and Practice. Dord-recht: Kluwer Academic Publishers
Varni, J. W., Burwinkle, T. M., Lane, M. M. (2005): Health-related quality of life measurement in pedia-tric clinical practice: An appraisal and precept for future research and application. In: Health Qual Li-fe Outcomes, 3, 34
Walter, O. B., Holling, H. (2008): Transitioning from fixed-length questionnaires to computer-adaptiveversions. In: Zeitschrift für Psychologie, 216 (1), 22-8
Ware, J. E., Jr., Bjorner, J. B., Kosinski, M. (2000): Practical implications of item response theory andcomputerized adaptive testing: a brief summary of ongoing studies of widely used headache impactscales. In: Med Care, 38 (9 Suppl), II73-82
Kathrin I. Fischer1 (M.Sc.med, B.A. Pflegewissenschaft, RN)Gregor Liegl1 (Mag.rer.nat.)Prof. Dr.med. Matthias Rose1,2
Dr. Sandra Nolte1,3
1 Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Centrum für Innere Medizin undDermatologie, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany
2 Department of Quantitative Health Sciences, University of Massachusetts Medical School,Worcester, MA 01605, USA
3 Public Health Innovation, Population Health Strategic Research Centre, School of Healthand Social Development, Deakin University, Melbourne, VIC 3125, Australien
Korrespondenzadresse:Dr. Sandra NolteMedizinische Klinik mit Schwerpunkt PsychosomatikCentrum für Innere Medizin und DermatologieCharité - Universitätsmedizin Berlin, Charitéplatz 1, 10117 Berlin, [email protected]
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Karina Becker
Loyale Beschäftigte – ein Auslaufmodell? Zum Wandel von Beschäftigtenorientierungen in der stationärenPflege unter marktzentrierten Arbeitsbedingungen
Loyal employees an obsolete model? The changes of employees’ orienta-tions in the care-sector on condition of market-centered work
In the care sector it can be observed that the implementation of market-centered controlmechanisms and tools are accompanied by intensification of working conditions, whichoften leads to job dissatisfaction among employees. The article analyses the employ-ees’ way of dealing with these influences. For this it can be referred to the work of AlbertO. Hirschman (1970), where it is argued that actors react in different ways to dissatisfac-tion. On the basis of large-scale qualitative empirical material it will be examined how theresponse patterns on dissatisfaction presented by Hirschman – exit, voice and loyalty –can be shown in care service. It will be shown – that if market logic predominates – this isat the expense of employees’ loyalty.
KeywordsCare Work, Economization, Job Satisfaction, Emotional Work, Employee Retention
Im Pflegesektor lässt sich seit einiger Zeit beobachten, dass mit der Einführung markt-zentrierter Steuerungsmechanismen und Instrumente auch eine Verschärfung der Ar-beitsbedingungen einhergeht, die bei den Beschäftigten vielfach zur Arbeitsunzufrieden-heit führt. Der Beitrag analysiert die Umgangsweisen der Pflegekräfte mit diesen Einflüs-sen. Dafür wird auf das Werk von Albert O. Hirschman (1970) zurückgegriffen, in demdargelegt wurde, dass Akteure in unterschiedlicher Weise auf Unzufriedenheit reagieren.Anhand umfangreichen qualitativen empirischen Materials wird untersucht, inwieferndie von Hirschman dargelegten Reaktionsweisen auf Unzufriedenheit – Exit (Abwande-rung), Voice (Widerspruch) und Loyalty (Loyalität) – in der Pflege zu beobachten sind. Eswird gezeigt, dass – wenn die Marktlogik überhandnimmt – dies zu Lasten der Loyalitätder Beschäftigten geht.
SchlüsselwörterPflegearbeit, Ökonomisierung, Arbeitszufriedenheit, Emotionsarbeit, Mitarbeiterbin-dung
145
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
eingereicht 30.03.2015akzeptiert 29.05.2015
Beiträge
146
Beiträge
1. Einführung und forschungsleitende Fragen
„Man kann nicht jemanden im Dreischichtsystem, zwölf Tage am Stück, davon fünf Näch-te, arbeiten lassen und dann geht der mit eineinhalb Scheinen nach Hause – schon gar nichtin der Intensivpflege, wo man auch häufig Arztarbeiten macht. Das geht einfach nicht. Dasist menschenunwürdig, das macht einen fertig.“ (A_PK06_2010)
Diese und viele ähnliche Äußerungen examinierter Pflegekräfte spiegeln den Unmutüber die eigenen Arbeitsbedingungen wider, die repräsentativ für die Situation vielerPflegekräfte sind. Die Debatte um diese Entwicklung wird vor allem mit dem Verweisauf den demografischen Wandel geführt, der auch zukünftig zu einem steigenden Be-darf von Pflegekräften führen wird. Die ohnehin schon existierende Kluft zwischenAngebot und Nachfrage nach Pflegekräften wird durch die unattraktiven Arbeitsbe-dingungen in diesem Sektor vergrößert. Für die Personalverantwortlichen in der sta-tionären Pflege ist die Mitarbeiterzufriedenheit daher eine zentrale Einflussgröße fürdie Abwanderungsneigung von Beschäftigten; vielfach avancierte die Zufriedenheits-variable zu einer „weichen“ Kennziffer des Personalcontrollings (Matiaske et al. 2001).Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die Personalfluktuation nicht nur Fol-gekosten für die Neubesetzung von Stellen, sondern auch den Verlust von Erfahrungs-wissen nach sich zieht.
Während sich die Mitarbeitergebundenheit in erster Linie aus ökonomischen, ver-traglichen und anderen funktionalen Anreizen speist, die sich oft als Wechselbarrierenerweisen, können Unternehmen in ihren Personalbindungsstrategien in der Regelauch auf emotionale Faktoren zurückgreifen, die sich aus intrinsischen Motivstruktu-ren herleiten. Die Pflegearbeit ist dafür ein typisches Beispiel: Wie u. a. die Studien vonBuxel (2011) oder auch Reich (2012) zeigen, zeichnen sich Pflegekräfte generell durcheine hohe Verbundenheit mit ihrer Profession und daher auch durch eine hohe Leis-tungsbereitschaft aus, die in der Regel eng mit berufsethischen Ansprüchen an die eige-ne Arbeit verknüpft ist.
Ausgangspunkt des Beitrags ist die Beobachtung, dass diese Orientierung aktuelldurch eine zunehmende Ausrichtung der medizinischen Versorgung an Marktprinzi-pien erschwert wird. In Repräsentativerhebungen wird deutlich, dass dies bei den be-troffenen Pflegekräften zu einer hohen Unzufriedenheit führt (vgl. z.B. DGB-IndexGute Arbeit 20111 und DBFK 20092)
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
1 In dieser Befragung, die auf Angaben von insgesamt (branchenübergreifend) 6.083 Beschäftigten beruht, gebenknapp 47% der Pflegekräfte an, dass sie den Eindruck haben, in den letzten Jahren immer mehr in der gleicherZeit schaffen zu müssen; für 71% der PflegerInnen führt diese Situation zu Belastungen. Hinzu kommt ein wahr-genommener Zeitdruck, der zur Folge hat, dass sie Abstriche bei der Arbeit machen müssen – bei 18,9% kommtdies sehr häufig vor, bei 19,8% oft.
2 Auch in der Meinungsumfrage des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe von 2009 geben 63,2% der 3048Befragten an, dass die Pflegequalität in den letzten 12 Monaten abgenommen hat. Außerdem sind 80,5% derUmfrageteilnehmer der Ansicht, die Personalausstattung im Arbeitsbereich und in der Schicht seien nicht ange-messen. 46,8% würden ihre eigenen Angehörigen oder nahe Verwandte nicht im eigenen Pflegebereich versorgenlassen (DBFK 2009: 9f.).
In einer früheren Studie (Becker 2014) wurde gezeigt, dass die Unzufriedenheit derPflegekräfte aus einer Spannung zwischen berufsethischen Vorstellungen und neuenrestriktiveren Arbeitsbedingungen resultiert, die Folge einer Neuausrichtung des Ge-sundheitswesens an marktzentrierten Steuerungsinstrumenten und -prinzipien ist.
In diesem Beitrag soll nun gefragt werden, wie Pflegekräfte mit dieser Unzufrieden-heit umgehen. Dafür wird auf das Werk von Albert O. Hirschman (1970) zurückgegrif-fen. Denn während die Arbeitszufriedenheitsforschung ihren Fokus vor allem daraufrichtet, die Entstehung von Arbeits(un)zufriedenheit zu erklären, bietet Hirsch man ei-ne fruchtbare Heuristik, um den Umgang mit Unzufriedenheit analytisch zu fassen.
Im Zentrum seiner Überlegungen steht zunächst die Beziehung von KundInnenoder von Mitgliedern zu einer Organisation, die Leistungseinbußen verzeichnet unddaher Unzufriedenheit bei diesen nach sich zieht. Der Umgang mit Unzufriedenheitartikuliert sich Hirschman zufolge in Markt und Politik auf unterschiedliche Weise:Während der Funktionslogik des Marktes in der Regel ein Wechsel (Exit) des Anbietersoder der Organisation entspricht, setzt die Politik-Variante eher darauf Unzufrieden-heit zu verbalisieren (Voice), um dadurch eine Verbesserung der Situation zu erreichen.Exit entspringt demnach einer eher ökonomischen Orientierung von Beschäftigten.
Bezieht man diese idealtypischen Varianten auf Reaktionsweisen von Beschäftigtenin Folge sich verschlechternder Arbeitsbedingungen, lassen sie sich wie folgt unter-scheiden: Entweder es wird versucht, die Bedingungen bspw. durch partizipatorischeInterventionen zu verändern oder aber Beschäftigte wenden sich von der Organisationab und verlassen diese, wenn sich eine Alternative bietet. Neben diesen beiden Mög-lichkeiten kommt bei Hirschman der Kategorie Loyalität eine entscheidende Bedeu-tung zu. Loyalität definiert Hirschman als selbst oder fremdproduzierte Treue einesMitglieds zu seiner Organisation. Sie ist zentral für die Frage, welche Option Exit oderVoice Beschäftigte wählen oder wie Hirschman es formuliert: „(…) loyalty holds exit atbay and activates voice“ (Hirschman 1970: 78). Loyalität kann demnach dafür sorgen,dass die Mitglieder einer Organisation die Voice-Option bei bestehender Unzufrieden-heit wählen, obwohl ihnen die Exit-Option ebenso offen steht.
Auch im Fall der Pflegearbeit wird angenommen, dass Loyalität eine entscheidendeBedeutung dafür hat, wie die Beschäftigten mit ihrer Unzufriedenheit umgehen. Ihrhoher beruflicher Selbstanspruch lässt sich vor allem als Loyalität gegenüber ihrem Ar-beitsgegenstand beschreiben. Denn Loyalität kann sich nicht nur auf das Unterneh-men/den Arbeitgeber richten, sondern auch auf die Profession oder eben auf den Ar-beitsgegenstand, in personenbezogenen Dienstleistungsberufen können das KundIn-nen, KlientInnen oder PatientInnen sein (Blankertz et al. 1997; Hagedoorn et al.1999).
Dabei ist die Loyalität von Beschäftigten keineswegs stabil, sondern kann sich bei-spielsweise durch sich wandelnde Arbeitsbedingungen verändern; je nachdem wie in-dividuell vorteilhaft, persönlich relevant und wie umfangreich dieser Wandel ausfällt(Fedor et al. 2006). Analog dazu korrelieren Faktoren wie Stress (Nissly et al.2005) ne-
Beiträge
147
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
148
Beiträge
gativ mit Loyalität. Weiterhin wurde gezeigt, dass eine positive Einstellung gegenüberder Arbeit wahrscheinlicher ist, wenn die personalen Orientierungen mit den Wertender Organisation übereinstimmen (Edwards et al. 2009).
Bezieht man diesen Befund auf den vorliegenden Untersuchungsgegenstand, lässtsich vermuten, dass Prozesse der Marktzentrierung, wenn sie die Arbeitsinhalte undVorgaben so verändern, dass sie mit denen der Beschäftigen nicht (mehr) übereinstim-men, einen Einfluss auf den Umgang mit Unzufriedenheit im beruflichen Kontext –mithin auch auf die Loyalität der Beschäftigten haben. Mit Hirschman ist also zu fra-gen, welche handlungswirksamen Reaktionsweisen sich bei den Pflegekräften unterden veränderten organisationalen Rahmenbedingungen beobachten lassen. Lässt sichbeispielsweise der in anderen Studien aufgezeigte Zusammenhang von steigendemStress und einem Anstieg von Exit, sowie einer Abnahme von Voice und Loyalität auchfür die Beschäftigten in der Pflege aufzeigen? Welche Rolle spielen dabei Aspekte wieBerufsethos, aber auch die Arbeitsmarktchancen der Beschäftigten? Folgt man der Li-teratur entsteht Loyalität vor allem vor dem Hintergrund hoher Autonomie und gerin-ger Rollenkonflikte (Naus et al. 2007) – arbeitsbezogene Merkmale, die unter markt-zentrierten Arbeitsbedingungen jedoch eher abnehmen.
Untersucht wird zudem, in welcher Weise das Krankenhausmanagement Einflussauf die Loyalität der Beschäftigten nimmt. Eine Reihe von Studien zeigen, dass Be-schäftigte mit einem ausgeprägten Berufsethos weniger über direkte, vom Manage-ment vorgegebene Koordinationsformen gesteuert werden; vielmehr lösen die Be-schäftigten das Problem der Transformation von Arbeitskraft in konkrete Arbeit3 weit-gehend selbst (Moldaschl et al. 2002), indem sie den Anspruch gute Arbeit zu leisten,an sich selbst stellen.
Da die Abwanderungsneigung in hohem Maß von den Arbeitsmarktchancen undden daraus erwachsenen Alternativen strukturiert wird (Hausknecht et al. 2008), bie-tet sich die Pflegearbeit als eine Branche, in der Beschäftigte auf einem Angebots(-ar-beits)markt agieren, für die Hirschmanschen Kategorien geradezu an: Der hohenNachfrage nach PflegerInnen steht kein ausreichendes Angebot gegenüber; der Ar-beitsmarkt ist vielerorts in diesem Bereich nahezu leergefegt (Heidemann 2012: 20f.;Kolodziej 2011: 4). Die daraus erwachsene strukturelle Verhandlungsmacht könntendie Pflegekräfte theoretisch dazu nutzen, bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln –durch individuelle Ansätze, die auf eine Maximierung der eigenen Vermarktungsbe-dingungen zielen, aber auch durch kollektives Handeln. In der Vergangenheit ließensich kollektive Aktionen wie Streiks und Betten sperren jedoch kaum beobachten (Bar-tholomeyczik et al. 2008). Welche Reaktionsweisen sich bei den hier untersuchtenPflegekräften stattdessen beobachten lassen, wird empirisch untersucht.
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
3 Es besteht darin, dass das Management aufgrund der Unspezifiziertheit des Arbeitsvertrags einen nur begrenztplanbaren Zugang zur Arbeitsleistung der Beschäftigten hat. Die Kontrolle kann daher niemals vollständig sein.Dieser in der Soziologie unter dem „Transformationsproblem“ des Managements firmierende Ansatz bildet denAusgangspunkt der Labour Process-Debatte (Braverman 1985; Burawoy 1979), in der die Möglichkeiten zurLösung dieses Problems diskutiert werden.
2. Empirische Basis und methodisches Vorgehen
Um den aufgeworfenen Forschungsfragen nachzugehen, wird eine explorative Heran-gehensweise gewählt. Die empirische Untersuchung folgte einer Verknüpfung aus de-duktivem und induktivem Vorgehen: Ausgehend von Theorien zum Zusammenhangvon Arbeits(un)zufriedenheit und daran anschließender Umgangsweisen sowie Befun-den zur Berufsorientierung von Pflegekräften sollten zunächst getroffene Annahmen –gemäß dem Prinzip der „Offenheit“ (Flick 2002) – durch Schilderungen aus dem Be-rufsalltag sowie berufsbiografische Entscheidungen der Betroffenen, ergänzt, weiter-entwickelt oder widerlegt werden können. Anhand der im Interviewleitfaden genann-ten Themen wurden zunächst die vollständig transkribierten Interviews mit MaxQDAkodiert. In einem zweiten Schritt wurde das gesamte Textmaterial durch Subkategorienerweitert bzw. verfeinert (Mayring 2008). Diese Vorgehensweise orientiert sich an denAussagen der InterviewpartnerInnen, weshalb Ergebnisse zum Einfluss marktzentrier-ter Arbeitsbedingungen auf Beschäftigtenorientierungen bereits durch die Gesprächs-partnerInnen gefiltert werden. Die Schilderungen der Interviewten wurden im Ge-spräch stets an die rahmengebenden Bedingungen ihrer Tätigkeiten rückgebunden.Andere Einflussgrößen und Variablen (z. B. private Konstellationen und Einflussfak-toren) wurden mit in die Interpretation der Befunde und der theoretischen Ableitun-gen einbezogen.
Die empirische Basis bilden fünf Fallstudien, zu denen die Autorin im Zeitraum2009-2014 umfangreiches Datenmaterial erhoben hat. Die Auswahl der Krankenhäu-ser orientierte sich am Kriterium des maximalen Kontrasts: Es wurden Einrichtungenmit unterschiedlichen Trägerschaften untersucht. Die Analyse der zu Fallstudien ver-dichteten untersuchten Einrichtungen basiert auf teilstandardisierten Interviews, indenen es in erster Linie um die Arbeitsbedingungen und deren Rückwirkungen auf dieGesundheit der Beschäftigten ging. Besprochen wurden auch Berufsbiografien und dieprofessionelle Orientierung der GesprächpartnerInnen. Die Interviews wurden mitBeschäftigten verschiedener Hierarchiestufen und mit unterschiedlichen Tätigkeits-feldern geführt, um möglichst viele Perspektiven und Interessenlagen einzubeziehen;darunter befanden sich Vertreter des Managements, Teamleiter, Pflegeleitungen, Be-triebs- und Personalräte und Sicherheitsfachkräfte (siehe Tabelle).4 Zusätzlich wurdenExpertInneninterviews mit überbetrieblichen Akteuren, wie Gewerkschaften, Vertre-tern von Berufsgenossenschaften und Branchenverbänden herangezogen. Dass sowohldie Arbeitsbedingungen als auch die Beschäftigtenorientierungen in der ambulantendenen in der stationären Pflege ähnlich sind, zeigte eine Studie zu den neueren Ent-wicklungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz in ambulanten PflegeeinrichtungenThüringens, an der die Autorin beteiligt war.5
Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über das Sample; aufgeführt werdennur die im Beitrag angeführten Unternehmen und zitierten Interviews.
Beiträge
149
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
4 Die Entscheidung darüber, aus dem breiten empirischen Fundus vor allem das qualitative Material zu nutzen, istder Fragestellung geschuldet.
5 Vgl. die ausführlichen Befunde der quantitativen und qualitativen Erhebung zu den Arbeitsbedingungen in derambulanten Pflege in Becker und Engel (2011).
150
Beiträge
3. Pflegearbeit im Spannungsfeld von „traditionellen“ berufs-ethischen Orientierungen und „neuen“ Marktanforderungen
Dass der Einzug ökonomischer Prinzipien in gesellschaftliche Bereiche, die sich vor-mals in erster Linie an außerökonomischen Maximen orientierten, an kaum einemThema so deutlich wird, wie dem Gesundheitswesen, ist wahrscheinlich kaum um-stritten. Zurückzuführen ist diese gesundheitspolitische Neuausrichtung der medizi-nischen Versorgung an Marktprinzipien auf eine Reihe gesetzgeberischer Änderungen,die dem Globalziel einer Kostendämpfung folgen. Einen wichtigen Impuls setzte dasseit 2003 in Deutschland zur Anwendung gekommene Abrechnungssystem nach dia-gnosebezogenen Fallgruppen (Diagnoses Related Groups – DRG), wonach Kranken-häuser mit den Krankenkassen nicht mehr nach der Liegedauer abrechnen, sondernnach der Art der Diagnose, die nach einer einheitlichen Pauschale vergütet wird. Die-ser Wechsel des Anreizsystems führt u. a. dazu, dass die Akteure im Gesundheitswesenihre medizinischen und pflegerischen Entscheidungen, Therapien und Empfehlungenauch anhand neuer ökonomischer Prämissen treffen müssen (Bauer 2007; Flecker et al.2014). Obgleich bereits vor seiner Einführung vielfach auf die dem Abrechnungssys-tem innewohnenden problematischen Anreize hingewiesen wurde, verteidigte es derGesetzgeber mit dem Verweis auf eine höhere Kostentransparenz und Effizienz, zu de-nen Krankenhäuser angehalten werden, wenn sie in einen Wettbewerb zueinander ge-setzt werden.6
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Institution InterviewpartnerIn Codierung*
A: Universitätskrankenhaus
Insg. wurden hier 15 Interviewsgeführt
Pflegeleiterin Stationsleiterin Personalrat Pflegekraft Pflegekraft Pflegekraft Pflegekraft Pflegekraft Pflegekraft
A_PL01_2012 A_SL01_2012 A_PR01_2011 A_PK02_2010 A_PK03_2011 A_PK04_2011 A_PK05_2011 A_PK06_2010 A_PK07_2012
B: Universitäts-krankenhaus
Insg. wurden hier 12 Pflege-kräfte interviewt
Personalrat Pflegekraft Pflegekraft Pflegekraft
B_PR01_2011 B_PK03_2012 B_PK04_2012 B_PK05_2012
C: Krankenhaus (mit explizitweltanschaulicher Ausrichtung)
Stationsleiterin Pflegekraft
C_SL01_2012 C_PK01_2013
D: Krankenhaus in kirchl. Trägerschaft
Personalleiterin Pflegekraft
D_PL01_2012 D_PK03_2013
Tab. 1: Übersicht über das Sample
*Die Codierung folgt der Logik: Nummer des Unternehmens, Funktionder InterviewpartnerIn, Nummer des Interviews, Jahr
6 Zur bounded rationality dieser Logik gehört, dass Krankenhäuser als konkurrierende Unternehmen ihre Effizienzzum einen dadurch steigern können, dass sie Mechanismen entwickeln, mit denen es ihnen gelingt, „unrentable
Eine der Folgen dieses Systems besteht in der Entfaltung einer selektiven Kommodi-fizierung, die in Krankenhäusern analog zu privatwirtschaftlichen Unternehmen spe-zifische abrechnungsfähige Vorgänge zu Wertschöpfungsbereichen machen und ande-re – wie ein Teil der Pflegearbeit – zu angelagerten Bereichen und damit Kostentreibernwerden. Diese Entwicklung konterkariert eine Praxis, die auf arbeitswissenschaftlicheErkenntnisse gestützt, sich im Sinne einer ganzheitlichen Pflege der PatientInnen-orientierung und Qualität verschreibt (Glaser 2006). Vollständige Pflegeaufgaben ha-ben sich jedoch nicht nur für die PatientInnen, sondern auch für die Pflegenden selbstals vorteilhaft erwiesen (Hacker 2005). Sie bieten einer Profession, bei der es darumgeht, der Besonderheit der Situation und ihres Gegenübers bei der Arbeit Rechnung zutragen, mehr tätigkeitsbezogene Ressourcen. Gleichwohl kamen bereits in den 1950erJahren mit der Einführung der sogenannten Funktionspflege tayloristische Organisa-tionsprinzipien zur Anwendung, von denen man sich eine höhere Effizienz versprach.Trotz einer in den 1970er Jahren aufflammenden Diskussion über Alternativen zurFunktionspflege wird diese seither als die in der Praxis dominierende Form der Arbeits-organisation bezeichnet (Rieder 1999). Mit den aktuellen Umbrüchen werden dieserelativ frühen Rationalisierungsformen durch Angebotsverknappungen (Rationie-rung) und Inwertsetzungen von Gesundheitsleistungen (Kommodifizierung) ergänzt.Im Zuge dessen droht Pflegearbeit in der Tendenz zu einer um ihre Kernbestandteilegekappten Dienstleistung zu verkommen. Dies zeigt sich u. a. daran, dass Pflegekräfteheute gehalten sind, ihr Handeln zunehmend an Prinzipien zeitökonomischer Ratio-nalisierung und damit in erster Linie auf standardisierte und entsprechend kalkulierba-re Pflegeleistungen zu beschränken (Becker 2014). In den überzeichnenden Worten ei-nes Personalrats einer Universitätsklinik: „Keine Krankenkasse zahlt dafür, dass den Pa-tienten die Hand gehalten wird“ (A_PR02_2011).
Dabei entscheiden sich viele Pflegekräfte bei ihrer Berufswahl bewusst für eine Ar-beit, bei der sie auch selbst emotional stark gefordert sind: Zum einen wird erwartet,dass sie die eigenen Emotionen dem Arbeitskontext entsprechend regulieren (Ekeloder Erschöpfung z. B. nicht zu zeigen); zum anderen müssen sie in der Lage sein, dieGefühle der PatientInnen zu beeinflussen (ihnen bspw. ihre Angst zu nehmen). Aussa-gen, wie: „Ich wusste schon ganz früh, eigentlich schon in der Schulzeit, dass ich Kranken-pflegerin werden will. Ich war schon immer gern für andere Menschen da, habe immer mitihnen mitgelitten“ (A_PK02_2010) sind geradezu typisch für die befragten PflegerIn-nen und spiegeln die Bereitschaft wider, sich auch emotional auf andere Menschen ein-zulassen. Die Regulation der eigenen Emotionen und der Gefühle Anderer kann unterrestriktiver werdenden Arbeitsbedingungen jedoch zu einer zusätzlichen Anforderungwerden, nämlich Emotionsarbeit zu leisten (Hochschild 2012; Strauss et al. 1982).Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die sozial erwarteten Emotionen der eigenen Be-findlichkeit nicht mehr entsprechen (z. B. souverän und ausgeruht zu wirken, aberüberfordert und erschöpft zu sein).
Beiträge
151
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
PatientInnen“, d. h. relativ schlecht bezahlte Diagnosegruppen nur begrenzt oder gar nicht aufzunehmen oderauch umgekehrt aus medizinischer Sicht nicht-notwendige Operationen und Therapien durchzuführen. DasSpektrum impliziter Rationierungspraktiken ist breit und mittlerweile empirisch gut dokumentiert (Bär 2011;Vogd 2006: 110).
152
Beiträge
3.1 Dominanz von Loyalität
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass auf Voice setzende Strategien der Interessenartiku-lation und -durchsetzung im Pflegebereich in den untersuchten Fällen eher die Aus-nahme sind. Dies lässt sich auf verschiedene Aspekte zurückführen, die zum einen inder Selbstwahrnehmung der Beschäftigten begründet liegen – PflegerInnen nehmensich in der Regel als arbeits- und mikropolitisch eher schwache, d. h. mit wenig Ver-handlungsmacht ausgestattete Akteursgruppe wahr. Die dafür angeführten Gründesind eher diffus; sie reichen von Verweisen auf die „hierarchischen Verhältnisse“(A_PK07_2012) in der stationären Pflege, die „dem Selbstbewusstsein der meisten Pfle-gekräfte nicht zuträglich sind“ (ebd.), über „mangelnde gesellschaftliche Wertschätzung“(A_PK06_2010). Zum anderen wird dies von ihnen auch auf den Arbeitsinhalt bzw.-gegenstand, die PatientInnen, zurückgeführt. Diese können im Unterschied zu ande-ren Dienstleistungsnehmern nicht ohne weiteres den Dienstleistungsgeber wechseln,sondern sind deren Schutz anvertraut. Die Tatsache, dass daraus zumindest für einenbestimmten Zeitraum auch eine gewisse Abhängigkeit der PatientIn von der Fürsorgeder PflegerInnen resultiert, schließt für viele beispielsweise aus, sich an kollektivenWiderstandsformen zu beteiligen; dazu eine Pflegerin: „Streiken? Dann müsste ich jameine Patienten allein lassen“ (A_PK03_2011). Obgleich es verschiedene Möglichkei-ten gäbe, die Versorgung der PatientInnen auch in Streikzeiten sicherzustellen, gebietetes ihre Interpretation berufsethischer Prinzipien, sich an diesen Aktionen nicht zu be-teiligen, da sie die ihr Anvertrauten damit im Stich lassen würde. Der Personalrat einesKrankenhauses – selbst jahrelang als Pfleger tätig – reflektiert dies in der Weise, dass erdavon spricht, dass sich die Beschäftigten in der „Geiselhaft der Patienten“(A_PR01_2011) befinden.
Um der Geiselhaft zu entkommen, kann es auch sein, dass die dem Berufsethos zu-grundeliegenden eigenen Ansprüche modifiziert oder auch teilweise preisgegeben wer-den müssen. Eine Interviewpartnerin schildert diesen – wie sie es nennt – Lernprozess,wie folgt: „Lange hätte ich diese Arbeit, in dieser Intensität, mit Aufopferung, Überstundenund immer noch mehr, nicht mehr machen können. Irgendwann habe ich kapiert, das istauch nur ein Job, auch wenn es da um Menschen geht.“ (B_PK04_2012)
Während in dem eben angeführten Beispielen das Krankenhausmanagement auf ei-ne Emotionalisierung von Erwerbsarbeit durch die Beschäftigten selbst setzen kann,gibt es auch Fälle in denen die Loyalität der PflegerInnen genutzt wird, um diese zurMehrarbeit zu motivieren. Dabei greifen die Akteure auf emotionalisierende Anrufun-gen zurück, die bei den untersuchten PflegerInnen als Selbstdisziplinierung ihre Wir-kung entfalten. Ein Beispiel dafür ist die Rhetorik einer Stationsleiterin, die eine Pfle-gekraft nach Schichtende mit der Frage konfrontiert: „Wer wechselt den Verband beiFrau M., wenn du jetzt Feierabend machst?“ (D_SL01_2012). Erfolgreich ist diese Stra-tegie vor allem dann, wenn sie bei den Pflegekräften zu selbstgesteuertem Arbeitshan-deln im Sinne ‚des Managements‘ (der hier angeführten Stationsleiterin) führt. Wer-den die eigenen Interessen (z. B. der pünktliche Feierabend) von den Beschäftigtengrundsätzlich hinten angestellt, muss die konkrete Arbeitsleistung von den Vorgesetz-ten kaum noch koordiniert und kontrolliert werden.
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Dies gilt zum Teil auch für die Anforderung Emotionsarbeit zu leisten. Viele Pflege-kräfte sprechen davon, dass sie gar nicht mehr auseinanderhalten können, ob ihre gezeigten Gefühle, die tatsächlichen sind oder aber jene, die sie zeigen sollen. Die erfor-derlichen Kompetenzen einer Pflegekraft mit einem funktionierenden Emotionsma-nagement, also mit möglichst viel Empathie, Einfühlungsvermögen und Kommunika-tionsfähigkeit am Arbeitsplatz aufzutreten, werden indes sowohl von den Beschäftigtenselbst als auch vom Pflegemanagement, als zur „Berufung“ (B_PK03_2012) einer Pflege-kraft gehörend erklärt, die „als Voraussetzung“ (ebd.) in diesen Beruf eingebracht wer-den müssen. Emotionsarbeit erfolgt meist ungeplant, häufig unbewusst, und wird da-her oftmals auch nicht als Teil der Professionsarbeit wahrgenommen. Dies bezieht sichauch auf den Umgang mit den Emotionen, die bei der Arbeit entstehen und für derenVerarbeitung und Bewältigung die Beschäftigten selbst Sorge tragen müssen.7 Voraus-setzung dafür sind Beschäftigte, bei denen auf ethisch-normative Aspekte betrieblicherIntegration und Steuerung gesetzt werden kann. Deutlich wird dies auch beim soge-nannten „Holen aus dem Frei“, bei dem aufgrund zu knapper Personaldecken die Pfle-gerInnen in ihrer Freizeit (teilweise auch im Urlaub) angerufen werden, um außerhalbder im Dienstplan festgelegten Arbeitszeit eine Schicht zu übernehmen. Da diese Pra-xis in der Regel gegen das geltende Arbeitszeitgesetz verstößt und es eine diesbezüglicheDienstverpflichtung nicht gibt, bemühen die verantwortlichen Führungskräfte hiernicht selten das Argument, „man muss doch dafür sorgen, dass es den Patienten gut geht“(D_PL01_2012). Loyalität wird hier durch eine Emotionalisierungsstrategie genutzt,die sich insbesondere bei jenen Pflegekräften beobachten lässt, die sich ihrer Tätigkeitim Sinne der „Pflege als Berufung“ (Voges 2002) verschrieben haben8.
Dies ist insofern eine neue Perspektive als die Bedeutung von Gefühlen bei der Er-werbsarbeit im sozialwissenschaftlichen Diskurs seit Arlie Hochschilds (2012) weg-weisender Studie vor allem am Zur-Schau-Stellen erwünschter Gefühle als Bedingungfür den Erfolg einer Dienstleistung festgemacht wurde. Für die Funktionalisierung vonEmotionen werden Beschäftigte als Subjekte (und nicht nur in ihrer eher eindimensio-nalen Rolle als Leistungsträger) adressiert, die sich möglichst ganzheitlich in die be-triebliche Leistungserstellung einbringen und ihre Arbeitsleistung selbst kontrollierensollen. Personale Attribute, moralische Haltungen und Emotionen avancieren im Zugedessen von einem Störfaktor zu einer Ressource (Moldaschl et al. 2002). Die Effizienzder Selbstkontrolle9 ist vor allem dann hoch, wenn Beschäftigte ihre persönlichen Zieleund Vorstellungen von bzw. bei der Arbeit mit denen der Organisation als weitgehendübereinstimmend wahrnehmen. Aus diesem Grund werden von der Geschäftsführungeines Krankenhauses, dass sich dem Leitbild der Ganzheitlichkeit in der Pflege ver-
Beiträge
153
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
7 Zur Externalisierung von frühzeitigem, betrieblich erzeugtem Gesundheitsverschleiß vgl. Becker et al. (2007).8 Am Bild der KrankenpflegerIn als „uneigennützigem Helfer“ gibt es auch starke Kritik. So weist etwaSchmidtbauer (1983) darauf hin, dass die Abhängigkeit der PatientInnen auch dazu verwandt wird, sich überderen Bedürfnisse hinwegzusetzen und ihnen Anerkennung und Zuneigung abverlangt wird. Grahmann undGutwetter (1996) resümieren, dass der Helfermythos auch dazu dient, die Verantwortung für unwürdigeArbeitsbedingungen abzuwehren.
9 Die Nutzung individuellen Potenzials ist auch Gegenstand des in der Arbeitssoziologie prominent geführtenSubjektivierungsdiskurses (Lohr et al. 2009; Kratzer 2003; Moldaschl et al. 2002), der zumeist von einer gene-rellen Ablösung alter Formen personaler Kontrolle durch neue Modi objektivierter Kontrolle ausgeht.
154
Beiträge
schreibt und damit auch am Markt platziert, obligatorisch Schulungen für die Füh-rungskräfte angeboten, in denen diese Prinzipien vermittelt werden.
Die dabei entstehenden Widersprüche, zwischen Kostenreduktion auf der einenund Pflegequalität auf der anderen Seite, versucht das Management dadurch aufzulö-sen, dass es auf technische Rationalisierungsmaßnahmen setzt. Erklärtes Ziel der Per-sonalleiterin dieses Krankenhauses ist es, „so wieder mehr Luft zu schaffen, damit diePflegekräfte auch wieder pflegen können“ (C_SL01_2012). Dass sich dies in der täg-lichen Praxis jedoch in erster Linie als eine Imagekampagne gegenüber den PatientIn-nen erweist, zeigt sich vor allem daran, dass bei dem Pflegepersonal in den letzten Jah-ren in diesem Krankenhaus viele Stellen gestrichen wurden. Deutlich wird dies auchdadurch, dass die Rationalisierungsfolgen der neuen Rahmenbedingungen organisa-tionsintern allenfalls Gegenstand informellen Austauschs sind: Dass die Interaktionzwischen medizinischem Personal und PatientInnen im rationalisierten Krankenhauszunehmend Züge einer marktförmigen Beziehung trägt10, wird weder vom Kranken-hausmanagement an die Belegschaft als Ziel formuliert, noch ist dieser Wandel Teil ei-nes Krankenhausmarketings, das in Werbebroschüren und Ähnlichem seinen Nieder-schlag findet. Vielmehr wird es den Beschäftigten überlassen, mit diesem Spannungs-feld umzugehen.
Im Fall einer gut qualifizierten Pflegerin, die zudem über viele Erfahrungen in derambulanten und stationären Arbeit verfügt, resultiert aus der Nicht-Passung von An-spruch und Wirklichkeit Unzufriedenheit, aus der sie Konsequenzen zieht. Sie be-schreibt, dass sie im Laufe verschiedener beruflicher Anstellungen immer nach demPrinzip gehandelt habe, dass der Anspruch an die Versorgungsqualität ihres jeweiligenArbeitgebers mit ihrem eigenen in Einklang stand: „Wenn ich selbst mit meiner Arbeitnicht zufrieden war, weil ich keine Zeit für die Patienten hatte und mein Chef mir diesenFreiraum nicht gegeben hat, dann war für mich irgendwann ein Punkt erreicht, an dem ichdas nicht mehr mitmachen wollte und das hieß, dass ich mir etwas anderes gesucht habe.Auch wenn ich dafür weniger verdient habe.“ (D_PK03_2013) Während emotionalisie-rende Anrufungen vielfach dazu führen, dass das Missverhältnis zwischen guter Pflege-arbeit und institutionellen Restriktionen von den PflegerInnen abgepuffert wird (Be-cker 2014), wirkt Loyalität in diesem Beispiel im Sinne einer Selbstverpflichtung aufdie eigenen Standards bei der Pflegearbeit – nicht jedoch als Loyalität gegenüber derOrganisation/des Arbeitgebers: Wenn diese Standards trotz Widerspruch der Inter-viewpartnerin (im Hirschmanschen Sinne Voice) unterschritten werden, quittiert siediese Unstimmigkeit mit einem Exit gegenüber der Organisation. Die Ablehnung pro-blematischer Arbeitsbedingungen, mit denen sich die Pflegerin auch nicht im Tauschgegen eine bessere materielle Vergütung abfinden will, setzt jedoch voraus, dass manauf alternative Arbeitgeber oder auch Beschäftigungen zurückgreifen kann.
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
10 Auf die Spitze getrieben wird diese Entwicklung durch die Ersetzung des Arzt-Patienten-Verhältnisses durchmedizinische Expertensysteme mit Hilfe von Ansätzen der „Künstlichen Intelligenz“. Die über die Marktlogikgesetzte Rationalisierungsstrategie besteht darin, das Beratungsgespräch zumindest in Teilbereichen durch denMensch-Maschine-Dialog zu ersetzen (Irrgang 1995).
3.2 Erosion von Loyalität gegenüber dem Unternehmen
Eigensinnige Praktiken lassen sich auch bei organisationsexternen Beschäftigten beob-achten; dazu gehören neben den Pflegekräften, die auf Basis von Selbständigkeit arbei-ten, auch Pflegekräfte in Leiharbeit. Für das Krankenhausmanagement ergibt sich dar-aus ein Dilemma: Personalpolitische Rationalisierungsstrategien und Arbeitskräfte-knappheit haben zur Folge, dass die PatientInnenversorgung vielerorts nur noch durchzusätzliches Personal aufrechterhalten werden kann. Allerdings haben es diese Beschäf-tigten auch verstanden, sich die auf einem solchen Angebotsmarkt bietenden Freiheits-grade zunutze zu machen: Neben der bereits diskutierten Reduktion von Tätigkeitengelingt es ihnen vielfach auch, eine bessere materielle Vergütung auszuhandeln und zu-dem eine höhere Autonomie und Flexibilität über ihre Arbeitszeit11 zu erlangen. DiePraxis zeigt, dass damit auch die Bereitschaft der Gesamtbelegschaft, widersprüchlicheAnforderungen hinzunehmen bzw. diese selbst zu einer Lösung zu führen, sinkt. Aussa-gen, wie: „Die Leasingkräfte lachen über uns, die machen bestimmt keine Überstunden.Daran sollte ich mir ein Beispiel nehmen“ (A_PK04_2011) deuten an, dass die bevorzug-te Behandlung der Leiharbeitskräfte eine entdisziplinierende Wirkung auf die Stamm-beschäftigten entfalten kann. Das Hineintragen der Marktlogik in die Organisationführt demnach dazu, dass Strategien der Emotionskontrolle, die auf eine Internalisie-rung übermäßiger Leistungsbereitschaft setzen, konterkariert werden. Schließlichwird den Stammbeschäftigten durch ihre Zusammenarbeit mit Organisationsexternendirekt vor Augen geführt, dass ihre Qualifikation am Markt so stark nachgefragt wird,dass Krankenhäuser und ambulante Pflegeeinrichtungen dafür mehr zu zahlen bereitund auch im Stande hierzu sind.
Für einige der InterviewpartnerInnen ist der Rückzug aus der Organisationsmit-gliedschaft auch die Konsequenz aus jahrelanger belastender Emotionsarbeit als Voll-zeitkraft, die bei ihnen zu einem inneren Rückzug führten. Mit ihrer Selbst-Kommodi-fizierung widersetzen sie sich daher nicht nur der Emotionalisierungsstrategie desKrankenhausmanagements, vielmehr schaffen sie sich damit auch eine Gesundheits-ressource, mit der sie die spezifischen Belastungen von Emotionsarbeit besser verarbei-ten können. Eine zusätzlich zu ihrer Anstellung als Stammkraft als selbständige Hono-rarkraft Arbeitende drückt dies wie folgt aus: „Der zusätzliche Verdienst ist nicht nur ausfinanziellen Gründen für mich wichtig. Irgendwie habe ich so auch das Gefühl, gefragt zusein und das fühlt sich gut an“ (A_PK04_2011). In den Interviews werden verschiedeneStrategien des Managements benannt, mit den Reaktionsweisen der Beschäftigten um-zugehen: Zum einen wird versucht, die individuelle Situationswahrnehmung und-interpretation der Beschäftigten im Rahmen der Emotionalisierung adaptiv zu beein-flussen. Exemplarisch dafür ist die folgende Schilderung einer Pflegekraft: „Ich habemal bei einer Dienstbesprechung als es um feste Teams ging, weil das mit den Halbtagskräf-ten und Leiharbeitskräften immer schwieriger zu bewerkstelligen ist, gesagt, dass ich meinArbeitszuhause brauche, also fester Kollegenkreis usw. Das wird jetzt ständig als gutes Bei-
Beiträge
155
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
11 In den untersuchten Krankenhäusern orientierte sich die Schichteinteilung zunächst an den Präferenzen derLeiharbeiter. Für drei interviewte Honorarärzte war die Wiedererlangung der Zeithoheit das treibende Motivvon einer Festanstellung im Krankenhaus in die Selbständigkeit zu wechseln.
156
Beiträge
spiel angeführt, so sollen am besten alle ticken.“ (A_PK03_2011). Dazu gehört auch Pfle-gekräfte als nicht primär ökonomisch orientierte Akteure zu adressieren: „Klar wirdvon uns erwartet, dass wir nicht auf die Uhr und das Geld schauen. Pflegearbeit ist schließ-lich eine Berufung.“ (A_PK06_2010). Zum anderen werden Strategien entwickelt, diedarauf zielen, die dem Interesse des Krankenhausmanagements widerlaufende Befrei-ungsfunktion des Marktes aus der Organisation wieder heraus zu drängen. Dies ge-schieht beispielsweise dadurch, dass die Nachfrager von qualifizierten Arbeitskräften(die Krankenhäuser) in einer Region die gemeinsame Strategie absprechen, möglichstalle als Leiharbeitskräfte angestellten Beschäftigten aufzukaufen, um sie als Stammbe-schäftigte in ihrer Einrichtung zu beschäftigen. Auf diese Weise soll der Wettbewerbum die umworbenen Arbeitskräfte eingedämmt werden. Die Interviewten des Univer-sitätskrankenhauses B berichten, dass im Zuge dieses Vorgehens auch Ablösegeld andie Verleiher (die Leiharbeitsfirmen) der Pflegekräfte gezahlt wird.
3.3 Exit-Varianten
Im Folgenden sollen verschiedene Umgangsformen vonBeschäftigten beschrieben und in der Abbildung 1 visuali-siert werden, die bei Unzufriedenheit unter dem Einflussder Marktlogik zu beobachten sind und sich im Rahmender Exit-Option ausdifferenzieren lassen.
1) Innerer Exit: Indem die bereits angeführte Pflegekraft (D_PK03_2013) ihre Ar-beitgeber wechselt, weil sie die Arbeitsbedingungen als unvereinbar mit ihren Vorstel-lungen guter Pflegearbeit erlebt, will sie einer Reaktion vorbeugen, die sich als innererExit bezeichnen lässt. Das konsequente Festhalten an den eigenen Prinzipien guterPflege trotz restriktiver werdenden Rahmenbedingungen lässt sich als Präventionsstra-tegie interpretieren. Damit kann Symptomen wie Abgestumpftheit und Zynismusgegenüber den PatientInnen (Zapf 2002) begegnet werden, die vielfach aus einer dau-erhaften Unzufriedenheit resultieren.
2) Temporärer Exit: In anderen Fällen versuchen die Pflegekräfte die zusätzlichen Be-lastungen von Emotionsarbeit dadurch zu kompensieren, dass sie sich eine Auszeitnehmen oder ihre Arbeitszeit reduzieren, denn nur so „kann man dem Arbeitsdruck hierstandhalten. Es geht hier immerhin um die Versorgung von Patienten. Da hat man ja aucheine hohe Verantwortung“ (B_PK05_2012). Entscheidend dabei ist, dass die Kosten be-lastender Arbeitsbedingungen vor allem von den betroffenen Beschäftigten getragenwerden müssen. Denn die Bereitstellung gesundheitsförderlicher Ressourcen oderauch Hilfe bei der Entwicklung von Bewältigungsstrategien (Mediation, Gesprächs-kreise etc.) sind in vielen Organisationen der Kostenreduktion zum Opfer gefallen.Um dennoch eine möglichst hohe Versorgungsqualität der PatientInnen aufrecht er-halten zu können, entziehen sich die PflegerInnen temporär der Verwertungslogik der
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
ExitVarianten
Innerer Exit
Temporärer Exit
Klassischer Exit
Partieller Exit
Abb. 1: Exit-Varianten vonBeschäftigten (eigeneDarstellung)
zunehmend marktzentrierten Organisation und nehmen durch die Reduktion ihrerArbeitsstunden eine Verminderung ihres ohnehin schon geringen Einkommens inKauf.
3) Klassischer Exit: In allen untersuchten Einrichtungen wurde von Beispielen berich-tet, für die die temporäre Exit-Variante keine Option darstellte (etwa bei Alleinverdie-nenden) und die daher auf einen klassischen Exit in Form eines Wechsels der Arbeits-stätte zurückgriffen, weil sie dort ein höheres Entgelt erwirtschaften konnten.
4) Partieller Exit: Eine weitere Exit-Form durchbricht diese Logik: Das Spannungs-verhältnis von Berufsethos zu Kommodifizierung wird in diesen Fällen über Strategiender Beschäftigten aufgefangen, die auf die Aushandlung eines höheren Entgelts zielen.Sie lassen sich vor allem bei jüngeren PflegerInnen beobachten, die bei der Bearbeitungproblematischer Arbeitsbedingungen und daraus resultierender Unzufriedenheit dieihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, die eigenen Vermarktungsbe-dingungen zu optimieren. Dazu bieten sie auf Basis von Teilselbstständigkeit ihre Ar-beitskraft zusätzlich zur regulären Beschäftigung als Angestellte des gleichen Kranken-hauses an. Mit dieser Selbst-Kommodifizierung erwirtschaften sie pro Schicht als selb-ständige Pflegekraft das Drei- bis Vierfache des Gehalts ihres normalen Arbeitstags alsKrankenhauspflegekraft. Das Marktrisiko für diese Unternehmer in eigener Sache istaufgrund der günstigen Arbeitsmarktlage und ihrer Festanstellung im Krankenhausbegrenzt. Der Anreiz ist indes groß, Abstriche bei den Pflegestandards durch eine deut-liche Verlängerung der Arbeitszeiten zu machen; schließlich werden diese aus Sicht derPflegerInnen durch die Marktzwänge ohnehin strukturell preisgegeben. Ein Pfleger,der neben seiner Vollzeitstelle noch auf Honorarbasis zusätzliche Schichten über-nimmt, schilderte sein Handeln wie folgt: „Wenn mal eine Schicht nicht so stressig warund ich denke, eine weitere ist noch drin, lass ich mich buchen. Das geht schon mal“(A_PK06_2010). Es ist kein Zufall, dass diese Strategie in dem untersuchten Fallunter-nehmen ausschließlich von jungen PflegerInnen und jenen im mittleren Alter (25 bis35 Jahre) gewählt wird, erfahren diese doch im Unterschied zu ihren älteren Kollegin-nen ihre berufliche Sozialisation bereits in einem Umfeld, das sowohl rhetorisch alsauch praktisch von Marktzwängen bestimmt wird. Dass dies auch Auswirkungen aufderen berufliche Orientierungen hat, ist evident. Anders als in den zuvor genanntenBeispielen kanalisieren sie ihre Unzufriedenheit über schlechte Arbeitsbedingungen,indem sie sich die Marktlogik zu Eigen machen. Damit stoßen sie auch im Kollegen-kreis auf Verständnis, die eine „gewisse Gelassenheit“ (A_PK07_2012) der jungen Pfle-gerInnen konstatieren, die sich positiv auf deren Belastungssituation und damit auchteilweise auf den Umgang mit den PatientInnen auswirkt. Das Zitat der Leiterin einerIntensivstation, der die Personalplanung obliegt, zeigt, dass sie die oben genannte Pra-xis nicht nur toleriert, sondern auch unterstützt: „Wenn ich jetzt jemanden fragen muss,ob er einspringt, weil jemand krank ist und ich weiß, dass der nebenbei selbstständig ist, sa-ge ich dem ‚Lass dich für morgen früh buchen‘. Das ist einfach attraktiver. Man bringt jaauch keinen mehr dazu, einzuspringen für einen feuchten Händedruck“ (A_SL_2012).Die Teilselbstständigkeit dieser Pflegekräfte stellt eine zumindest teilweise Um-Orien-tierung der Beschäftigten dar, die sich als partieller Exit vom traditionellen pflegeri-
Beiträge
157
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
158
Beiträge
schen Berufsethos deuten lässt. Auf Emotionalisierung setzende Strategien, die bei denälteren Pflegekräften unter Umständen auch zu einer De-Ökonomisierung führ(t)en(monetäre Aspekte spielen eher eine untergeordnete Rolle), laufen im Fall der als Selb-ständige arbeitenden Beschäftigten ins Leere. Sie bieten ihre Arbeitskraft aufgrund ih-rer Unzufriedenheit auf einem eigens geschaffenen Markt in genau jener Nische zurMiete an, in der sie ohnehin eingesetzt worden wären – mit dem Unterschied, dass auf-grund der günstigen Marktkonstellation die Entlohnungsbedingungen deutlich bessersind. Zugleich betonen diese Pflegekräfte, dass sie nicht komplett auf die Selbständig-keit setzen wollen, weil sie mit der Festanstellung im Krankenhaus Sicherheit verbin-den.
Die herausgearbeiteten Exit-Varianten lassen sich auch bei anderen Berufsgruppenbeobachten; die Pflegearbeit ist daher exemplarisch für andere Branchen. Es gilt jedochzu prüfen, inwieweit die arbeitsmarktspezifischen Rahmenbedingungen strukturelldenen der Pflegekräfte gleichen, ob Beschäftigte dieser Berufsgruppen beispielsweiseüberhaupt die Möglichkeit haben, auf temporäre oder partielle Exit-Formen zurück-zugreifen.
4. Fazit: Übermäßige Marktzentrierung zersetzt Loyalität von Beschäftigten
Lange Zeit ging man davon aus, dass personenbezogene Dienstleistungsarbeit imGegensatz zur industriellen Produktion oder auch der Verwaltung nur eingeschränktrationalisierbar ist, eine Rationalisierung von Humandienstleistungen zudem auch garnicht „angestrebt wird“ (Böhle 1999: 174). Dieser arbeitswissenschaftliche Ansatzwird mittlerweile von einer Ausrichtung überlagert, für die konstitutiv ist, dass diesachlichen Zwänge des Marktes, wie im sekundären Sektor, unmittelbar an die Be-schäftigten weitergegeben werden, denen es überlassen bleibt, die daraus entstehendenAnforderungen so zu bewältigen, dass die Dienstleistungsnehmer zufrieden sind. Ausden eigenen Ansprüchen an die Arbeit und den gewährten Spielräumen ergibt sich eineDifferenz, die bei den meisten der befragten Beschäftigten zu Unzufriedenheit über ih-re Arbeitsbedingungen führt. Dass sich die Arbeitsunzufriedenheit nicht ungebremstBahn bricht, hat bei den untersuchten Beschäftigten unterschiedliche Gründe: Sie istvor allem darauf zurückzuführen, dass Pflegekräfte ihr Berufsethos als unvereinbar mitdem Agieren als Marktakteure definieren. In der untersuchten betrieblichen Praxis las-sen sich auch Fälle finden, in denen dieses Selbstverständnis als betriebliche manageri-ale De-Ökonomisierungsstrategie genutzt wird, die darauf setzt, dass diese Akteure ih-re Handlungsweisen in erster Linie von ihrer Berufung zur/m PflegerIn ableiten. Daskann zum Beispiel heißen, die Versorgung anderer Menschen über monetäre Anreize(in Form eines höheren Entgelts) oder andere ökonomische Vorteilskalküle zu stellen.Die hohe Bedeutung der Arbeitsmarktchancen und des Berufsethos` wurde anhandder Kategorien – Exit, Voice, Loyalität – von Hirschman diskutiert. Neben dem klassi-schen Hirschmanschen Exit (Verlassen der Organisation) ließen sich auch Formen ei-
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
nes inneren, temporären oder auch partiellen Exits im empirischen Material ausma-chen. Ein Schwinden von Loyalität gegenüber den PatientInnen ließ sich in den unter-suchten Fällen nicht feststellen, allerdings ließen sich im empirischen Material Ten-denzen für eine Erosion der Loyalität gegenüber der Organisation/dem Arbeitgeberaufzeigen.
Der Befund eines Zusammenhangs von Loyalität und verschiedenen Varianten derSteuerung von Arbeitskraft in der Pflege scheint vor dem Hintergrund der hier darge-legten Analyse der Arbeitsbedingungen ein fruchtbarer Ansatz für weitere Studien zusein. Auch deshalb, weil das Ergebnis der Untersuchung, dass Personalverantwortlichenicht unbegrenzt und uneingeschränkt auf die Loyalität ihrer Beschäftigten setzenkönnen, womöglich auch für andere Berufsgruppen gilt – insbesondere jene mit gutenArbeitsmarktchancen. Diese Beschäftigten können ihrer Verpflichtung unter Umstän-den auch bei einem anderen Arbeitgeber zu für sie besseren Konditionen und ihren Be-rufsethos stärkenden Bedingungen nachkommen; davon zeugt auch die Abwanderungvon Pflegekräften ins Ausland. Weiterer Forschungsbedarf ergibt sich zudem aus dersich andeutenden Entwicklung, dass vor allem junge Pflegekräfte ihre beruflicheOrientierung an den sich ihnen bietenden Möglichkeiten marktzentrierter Rahmen-bedingungen anpassen.
LiteraturBär, S. (2011): Das Krankenhaus zwischen ökonomischer und medizinischer Vernunft. Wiesbaden, Hei-
delberg: VS Verlag für SozialwissenschaftenBartholomeyczik, S.; Donath, E.; Schmidt, S.; Rieger, M.; Berge, E. (2008): Arbeitsbedingungen im
Krankenhaus. DRGs und ihre Auswirkungen aus Sicht der Pflege. Dortmund: Bundesanstalt für Ar-beitsschutz und Arbeitsmedizin
Bauer, U. (2007): Gesundheit im ökonomisch-ethischen Spannungsfeld. In: Jahrbuch für Kritische Me-dizin und Gesundheitswissenschaften 44, 98-119
Becker, K. (2014): Von Florence Nightingale zu Adam Smith? Wenn PatientInnen zu KundInnen undGesundheitsdienstleistungen zu Waren werden. In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmens-ethik, 14(3), 33-52
Becker, K.; Engel, T. (2011): Ambulante Pflegearbeit unter Druck. Ergebnisse einer Beschäftigtenbefra-gung zu gesundheitsbelastenden und -förderlichen Arbeitsbedingungen in Thüringen. In: Jenaer Bei-träge zur Soziologie 22
Becker , K.; Brinkmann U.; Engel, T. (2007): Die Haut auf dem Markte: Betrieblicher Gesundheits-schutz im Marktkapitalismus. Prokla, 37(3), 383-401
Blankertz, L.; Robinson, S. (1997): Turnover Intentions of Community Mental Health Workers inPsychosocial Rehabilitation Services. In: Community Mental Health Journal 33(6), 517-529
Böhle, F. (1999): Nicht nur mehr Qualität, sondern auch höhere Effizienz – Subjektivierendes Arbeits-handeln in der Altenpflege. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Heft 3, 53. Jg., S. 174-181
Braverman, H. (1985): Die Arbeit im modernen Produktionsprozeß. Frankfurt a. M.: CampusBurawoy, M. (1979): Manufacturing consent. Changes in the labor process under monopoly capitalism.
Chicago, London: University of Chicago PressBuxel, H. (2011): Jobwahlverhalten, Motivation und Arbeitsplatzzufriedenheit von Pflegepersonal und
Auszubildenden in Pflegeberufen: Ergebnisse dreier empirischer Untersuchungen und Implikationenfür das Personalmanagement und -marketing von Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen.Münster
Beiträge
159
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
160
Beiträge
DBfK (2009): Wie sieht es im Pflegealltag wirklich aus? – Fakten zum Pflegekollaps Ausgewählte Ergeb-nisse der DBfK-Meinungsumfrage 2008/09, unter URL: http://www.dbfk.de/download/downlo-ad/Abschlussbericht-Wie-sieht-es-im-Pflegealltag-wirklich-aus___.pdf (Stand 2015-03-27)
Edwards, J.; Cable, D. (2009): The value of value congruence. In: Journal of Applied Psychology 94,654–677
Fedor, D.; Caldwell, S.; Herold, D. (2006): The effects of organizational changes on employee commit-ment: a multilevel investigation. In: Personell Psychology 59, 1–29
Flecker, J.; Schultheis, F.; Vogel, B. (Eds.) (2014): Im Dienste öffentlicher Güter: Metamorphosen derArbeit aus der Sicht der Beschäftigten. Berlin: Edition Sigma
Flick, U. (2002): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbeck bei Hamburg: Rowolth VerlagGlaser, J. (2006): Arbeitsteilung, Pflegeorganisation und ganzheitliche Arbeitsteilung, Pflegeorganisa-
tion und ganzheitliche Pflege – arbeitsorganisatorische Rahmenbedingungen für Interaktionsarbeitin der Pflege. In F. Böhle (Hrsg.), Arbeit in der Interaktion - Interaktion als Arbeit. Arbeitsorganisa-tion und Interaktionsarbeit in der Dienstleistung (1st ed., 43–57). Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-wissenschaften
Grahmann, R.; Gutwetter, A. (1996): Konflikte im Krankenhaus: ihre Ursachen und ihre Bewältigung impflegerischen und ärztlichen Bereich. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber.
Hacker, W. (2005): Arbeitspsychologie. Bern: HuberHagedoorn, M.; Van Yperen, Nico W.,; Van de Vliert, E.; Buunk, B. P. (1999): Employees’ reactions to
problematic events:a circumplex structure of five categories of responses, and the role of job satisfac-tion. In: Journal of Organizational Behavior 20, 309-321
Hausknecht, J. P.; Hiller , N.J.; Vance, R.J. (2008): Work-Unit Absenteeism: Effects of Satisfaction,Commitment, Labor Market Conditions, and Time. In: Academy of Management Journal 51(6),1223–1245
Heidemann, W. (2012): Zukünftiger Qualifikations- und Fachkräftebedarf – Handlungsfelder undHandlungsmöglichkeiten. Düsseldorf: Hans Böckler-Stiftung
Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty. Cambridge: Harvad University PressHochschild, A. R. (2012): The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling – Twentieth Anni-
versary Edition 3rd ed. Berkeley/Los Angeles/London: California PressIrrgang, B. (1995): Grundriss der medizinischen Ethik. München, Basel: Ernst Reinhardt VerlagKolodziej, D. (2011): Fachkräftemangel in Deutschland – Statistiken, Studien und Strategien. Wissen-
schaftliche Dienste, Deutscher Bundestag, Infobrief, Abschluss der Arbeit März 2012, BerlinKratzer, N. (2003): Arbeitskraft in Entgrenzung. Grenzenlose Anforderungen, erweiterte Spielräume,
begrenzte Ressourcen. Berlin: edition sigmaLohr, K.; Nickel, H.M. (2009): Subjektivierung von Arbeit – Riskante Chancen. In: K. Lohr, H.M. Ni-
ckel (eds.), Subjektivierung von Arbeit – Riskante Chancen, Münster: Westfälisches Dampfboot2005 (2. ed. 2008). S. 207-239
Matiaske, W.; Mellewigt, T. (2001): Arbeitszufriedenheit: Quo vadis? - eine Längsschnitt-Untersuchungzu Determinanten und zur Dynamik von Arbeitszufriedenheit. In: Die Betriebswirtschaft 1, 7-24
Mayring, P. (2008): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken - 10. neu ausgestattete Aufl.Weinheim/Basel: Beltz
Moldaschl, M. F.; Voß, G. (2002): Subjektivierung von Arbeit. München/Mering: Rainer Hampp VerlagNaus, Fons; van Iterson, Ad; Roe, R. (2007): Organizational cynicism: Extending the exit, voice, loyalty,
and neglect model of employees’ responses to adverse conditions in the workplace. In: Human Rela-tions 60(5), 683-718
Nissly, J. A.; Barak, M.; Levin, A. (2005): Stress, Social Support, and Workers’ Intentions to Leave TheirJobs in Public Child Welfare. In: Administration in Social Work 29(1), 79-100
Reich, A. (2012): With God On Our Side: Labor Struggle in a Catholic Hospital. Cornell: UniversityPress
Rieder, K. (1999): Zwischen Lohnarbeit und Liebesdienst. Weinheim: Juventa VerlagSchmidtbauer, W. (1983). Helfen als Beruf. Die Ware Nächstenliebe. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch
Verlag
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Strauss, A.; Fagerhaugh, S.; Suczek, B.; Wiener, C. (1982): Sentimental work in the technologized hospi-tal. Sociology of Health and Illness, 4(3), 254–278
Vogd, W. (2006): Die Organisation Krankenhaus im Wandel. Eine dokumentarische Evaluation ausSicht der ärztlichen Akteure. Bern: Huber
Voges, W. (2002): Pflege alter Menschen als Beruf: Soziologie eines Tätigkeitsfeldes. Wiesbaden: West-deutscher Verlag
Zapf, D. (2002): Emotion work and psychological well-being. In: Human Resource Management Review12(2), 237–268
Dr. Karina BeckerTechnische Universität Darmstadt, Landwehrstr. 48a/50, 64293 [email protected]
Beiträge
161
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
eingereicht 26.05.2015akzeptiert 30.07.2015
Miriam Kohnle
Innovative Ansätze zur Vereinbarkeit von Berufund AngehörigenpflegeEine Bestandsaufnahme klassischer und innovativer Maßnahmenin Unternehmen und Literatur
Innovative approaches to the reconciliation of work and family care. An over-view of classic and innovative activities in companies and literature
Working caregivers are under an enormous double burden: in most cases they care fortheir family members in need of care for reasons of love and belonging, although they of-ten have a full-time employment. If relatives only need support or the requirement of careneeded is rather low, then the reconciliation of work and care can turn out well. With in-creasing age of the members, however, also the need of care increases, and thus theburden on the working caregiver. The result can be a reduction of working time or the com-plete termination of work. Companies can keep working caregivers more likely in employ-ment if they offer suitable opportunities to reconcile work and family care. This paper gi-ves an overview of the needs of working caregivers and already existent and innovativesolutions in companies to combine work and family care.
Keywordscompatibility, care, family members, employment, working caregivers, profession, need
Pflegende erwerbstätige Angehörige stehen unter einer enormen Doppelbelastung: Siepflegen ihre Angehörigen in den meisten Fällen aus Gründen der Liebe und Zugehörig-keit, allerdings sind sie oft auch in nicht geringem Umfang berufstätig. Benötigen die An-
162
Beiträge
gehörigen nur Unterstützung oder ist der Pflegebedarf eher gering, kann die Vereinbar-keit von Beruf und Pflege gut gelingen. Mit steigendem Alter der Angehörigen steigt je-doch auch der Pflegebedarf und somit auch die Belastung für die pflegenden Erwerbstäti-gen. Die Folge ist die Reduktion der Arbeitszeit oder die komplette Berufsaufgabe. Unter-nehmen können pflegende Mitarbeitende eher in der Erwerbstätigkeit halten, wenn siegeeignete Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege anbieten.Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über die Bedürfnisse der pflegenden Mitarbei-tenden und bereits existente sowie innovative Lösungen der Unternehmen, um Beruf undAngehörigenpflege zu vereinbaren.1
SchlüsselwörterVereinbarkeit, Pflege, Angehörige, Erwerbstätigkeit, pflegende Angehörige, Beruf, Be-dürfnis
1. Hintergrund
Der demografische Wandel und der damit verbundene Fachkräftemangel führenmittel- und langfristig zu einem Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeitende, da die Al-tersgruppe der 30- bis 60-Jährigen langsam abnimmt (Keck 2011: 2). Gleichzeitig istdiese Altersgruppe räumlich flexibler – es besteht eine größere Distanz zum Rest der Fa-milie, da die beruflichen Anforderungen bezüglich der Flexibilität der Mitarbeitendengestiegen sind (Szydlik 2008: 15-16). Auf der anderen Seite wächst der Anteil an alten,hochaltrigen und hilfe- oder pflegebedürftigen Menschen stetig (Statistische Ämterdes Bundes und der Länder 2010: 29). So werden für das Jahr 2050 etwa 4,5 Mio. pfle-gebedürftige Menschen in Deutschland errechnet, das entspricht einem Anteil von5,6% an der deutschen Gesamtbevölkerung (Statistische Ämter des Bundes und derLänder 2010: 27-30: Variante „untere Grenze der mittleren Bevölkerungsentwick-lung“).
Die deutsche Bevölkerung sieht zunächst die Altersgruppe der 30- bis 60-Jährigenin der Pflicht, ihre hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen zu versorgen, dem ent-spricht auch der in § 43 Abs. 1 SGB XI normierte Grundsatz „ambulant vor stationär“(Wolf 2011: 212). Dass diesem Grundsatz Rechnung getragen wird, beweisen die Zah-len zur Versorgung von pflegebedürftigen Menschen: 70% der pflegebedürftigen Men-schen werden zuhause versorgt, davon 47% ausschließlich durch pflegende Angehöri-ge (Statistisches Bundesamt 2013: 5, 7). Dass dies zukünftig kein tragfähiges Modellzur Versorgung der pflegebedürftigen Angehörigen mehr sein wird, zeigt unter ande-rem die TK-Pflegestudie: Pflegende Angehörige fühlen sich durch die Pflege stark be-lastet und je jünger die Befragten, desto weniger Bereitschaft besteht zur Pflege und zueiner möglichen Reduktion der Arbeitszeit zugunsten der Pflegetätigkeit in der Familie(Techniker Krankenkasse 2014). Die pflegenden Angehörigen sind laut Schneeklothund Wahl (2005) zu 50% berufstätig, 25% davon reduzieren die Arbeitszeit trotz Auf-nahme der Pflegetätigkeit nicht (Schneekloth et al. 2005: 79).
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
1 Diese Arbeit wurde 2014 mit Ausblick auf das Pflegestärkungsgesetz I verfasst und berührt daher die aktuellengesetzlichen Regelungen ab 01.01.2015 nicht.
Da die Mitarbeitenden durch die Pflegetätigkeit vielfach belastet sind und unter ei-nem enormen Zeit- und Organisationsdruck stehen, geht damit oftmals eine Vermin-derung der Produktivität am Arbeitsplatz einher. Diese Produktivitätseinbußen kön-nen in Präsentismus und Absentismus münden. Dabei bezeichnet der Präsentismus dasVerhalten kranker oder belasteter Menschen, trotz Arbeitsunfähigkeit am Arbeitsplatzzu erscheinen. Absentismus hingegen bezeichnet das gegenteilige Verhalten, aus privatbedingten Gründen zuhause zu bleiben und nicht am Arbeitsplatz zu erscheinen (Fiss-ler et al. 2010: 411). Die Produktivitätseinbußen durch Absentismus und Präsen-tismus am Arbeitsplatz werden im Moment auf 14.154,20 Euro pro pflegender undpflegendem Mitarbeitenden im Jahr errechnet (Schneider et al. 2011: 1, 43), was be-deutet, dass pflegende Erwerbstätige Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf undAngehörigenpflege benötigen, um ihre Arbeit produktiv und konzentriert zu verrich-ten. Unternehmen profitieren von der Bereitstellung von Vereinbarkeitsmöglichkeitenin mehrfacher Weise: Sie sparen nicht nur große Summen pro Mitarbeitendem undJahr für Kosten durch eine mangelnde Vereinbarkeit und den damit verbundenen Pro-duktivitätsproblemen (Schneider et al. 2011: 1, 43), sondern sie erleben eine großeLoyalität und Motivation ihrer Mitarbeitenden und können daraus einen Wettbe-werbsvorteil ziehen (Riedmann et al. 2006: 11; Wolf 2011: 218). Die Vereinbarkeitvon Beruf und Angehörigenpflege ist bislang zwar Thema in deutschen Unternehmen,spielt jedoch seither eine untergeordnete Rolle (Kümmerling et al. 2012b: 86). Ein sichfür die Unternehmen erschwerend hinzukommender Faktor ergibt sich aus der Gene-rationenforschung. Eine Übersicht über die Charakteristika der derzeitig berufstätigenGenerationen der Babyboomer, X und Y liefert Tabelle 1.
Beiträge
163
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Zeitspanne Generationen Charakteristika
1956-1965 Babyboomer Hohes Sicherheitsbedürfnis, hohe Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber
1965-1980 X Eher bereit, Arbeitsplatz zu wechseln, Loyalität niedriger, variable Arbeits-zeit und -aufgaben am Arbeitsplatz erwünscht
1981-1995 Y Machtverhältnis liegt zugunsten Arbeitnehmender, Loyalität abhängigvon Selbstverwirklichung und Fördermöglichkeiten
(eigene Darstellung, Oertel 2014: 28-35, 39-43, 51; Klaffke 2014: 59, 64-66)
Tab. 1: Übersicht über die Generationen Babyboomer, X und Y
Die Loyalität der Arbeitnehmenden gegenüber dem Arbeitgeber sinkt stetig von derGeneration der Babyboomer bis hin zur Generation Y (Klaffke 2014: 66). Dies bedeu-tet, dass Arbeitgeber zukünftig in höherem Maße Maßnahmen zur Personalbindunganwenden müssen. Qualifizierte Arbeitnehmende der Generation Y befinden sich ineiner guten Verhandlungsposition – bedingt durch den Fachkräftemangel und den de-mografischen Wandel. Hierdurch wird das Machtverhältnis zwischen Arbeitgebernund Arbeitnehmenden in Richtung der letzteren verschoben (Klaffke 2014: 64-65).Generation X erwartet bereits flexiblere Arbeitszeiten von den Unternehmen und so-mit eine Anpassung an die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden. Die jetzige Genera-tion Y verfolgt diese Erwartung weiter: Sie strebt innerhalb des Erwerbslebens nachUnabhängigkeit und Individualität. Arbeit soll große Selbstentfaltungsspielräume bie-
164
Beiträge
ten (Bröckermann 2013: 18-19) und andere Lebensbereiche, z. B. Kindererziehungoder Angehörigenpflege nicht behindern, sondern vereinen (Bundesministerium fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend 2005: 334). Die im Moment hauptsächlich vonAngehörigenpflege betroffene erwerbstätige Generation sind die in der Zeitspanne von1956-1965 geborenen Babyboomer (Oertel 2014: 28). Zukünftig werden jedoch zu-nehmend die Generationen X und Y betroffen sein.
2. Ziel der Arbeit und Forschungsfragen
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Bedürfnisse pflegender Erwerbstätiger unddie von den Unternehmen bereitgestellten klassischen und in der Literatur benannteninnovativen Maßnahmen zu beschreiben. In einem weiteren Schritt ist analysiert, obdie angebotenen Maßnahmen die Bedürfnislage der pflegenden Berufstätigen abde-cken und inwieweit weitere Maßnahmen nötig sind, um die Vereinbarkeit von Er-werbstätigkeit und Angehörigenpflege zu verbessern.
Folgende Forschungsfragen werden im Verlauf der Arbeit behandelt und beantwortet:
- Welche Bedürfnisse bezüglich der Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbstätigkeithaben pflegende Erwerbstätige in ihrem Unternehmen?
- Welche klassischen und innovativen unternehmerischen Möglichkeiten zur Verein-barkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege existieren bereits, und in wel-chem Umfang werden sie genutzt?
- Werden die Bedürfnisse von pflegenden Erwerbstätigen durch die angebotenenVereinbarkeitslösungen befriedigt, und wo besteht potenzieller Handlungsbedarf?
Recherchiert wurde in den Bibliotheken der Hochschule Esslingen und des Fraunho-fer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart sowie in derWürttembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Außerdem wurden die DatenbankenCarelit, CINAHL, OECD iLibrary und Scopus verwendet. Als Internetrechercheortwurde Google Scholar genutzt. Genutzte Schlagworte zur Literatureingrenzung und-recherche waren „Vereinbarkeit Pflege Beruf“, „Pflege Angehörige“, „VereinbarkeitPflege Erwerbstätigkeit“, „working caregivers“, „Beruf“, „Erwerbstätigkeit“, „Bedürf-nis Vereinbarkeit“.
2.1 Methodik
Um die Forschungsfragen bearbeiten zu können, war es zunächst nötig, sich einenÜberblick über die Bedürfnislagen der pflegenden Berufstätigen zu verschaffen. In ei-nem weiteren Schritt wurden die bereits bestehenden Angebote zur Vereinbarkeit vonBeruf und Angehörigenpflege aus deutschen Unternehmen recherchiert sowie zu-kunftsträchtige Modelle aus der Literatur und Best Practice Beispielen aufgezeigt.Letztlich wurden zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage die Bedürfnisse der
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Arbeitnehmenden und die Angebote der Unternehmen analysiert und verglichen, umweiteren Handlungsbedarf im Bereich der Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf undAngehörigenpflege benennen zu können.
Um die Bedürfnisse von pflegenden Erwerbstätigen zu eruieren, wurden vor allemdie Studien EUROFAMCARE und carers@work betrachtet. EUROFAMCARE, eineStudie aus den Jahren 2004 und 2005, wurde in sechs europäischen Ländern durchge-führt und dient als Vergleichsstudie. Neben Deutschland nahmen auch Griechenland,Italien, Polen, Schweden und Großbritannien teil. Ziel der Studie war es, einen part-nerschaftlichen und integrativen Ansatz für pflegende Angehörige, professionelle Pfle-gedienstleister und die pflegebedürftigen Menschen selbst auf sozial- und gesundheits-politischer Ebene zu entwickeln (Kofahl 2005: 2-4).
Insgesamt wurden in den sechs teilnehmenden Ländern 5.923 pflegende Angehöri-ge persönlich und mit einem standardisierten Erhebungsbogen befragt, 12 Monatespäter wurde auf postalischem Weg oder per Vor-Ort-Besuchen eine Nachbefragungmit 3.362 Personen durchgeführt (Kofahl et al. 2005: 3). Im Durchschnitt waren dieBefragten in Deutschland 54 Jahre alt, davon 76% weiblich (Döhner et al. 2007: 9).Die gestellten Fragen sollten einen Einblick in verfügbare Unterstützungsangebote ge-ben; speziell wurde die Bekanntheit, Verfügbarkeit, Akzeptanz und der Nutzen erfragt(Kofahl 2005: 2-4). Auch wenn EUROFAMCARE das Augenmerk vornehmlich aufpflegende Angehörige legt, so können die Bedürfnisse derer doch im Speziellen aufpflegende Erwerbstätige größtenteils übertragen werden, da die Befragten teilweiseauch erwerbstätig waren. Weitere Bedürfnisse der Pflegenden und vor allen DingenMaßnahmen für Unternehmen liefert die von der VolkswagenStiftung finanzierte Stu-die carers@work. Der Studienzeitraum belief sich von Anfang des Jahres 2009 bis Endedes Jahres 2010, die Studie beschreibt die Situation von pflegenden Erwerbstätigen.Auch sie war als europäischer Vergleich der Länder Deutschland, Polen, Großbritan-nien und Italien aufgebaut und verfolgte eine „Untersuchung individueller sowie be-trieblicher Vereinbarungsstrategien mit dem Ziel beiderseitiger Konflikt- und damit Kos-tenminderung“ (Technische Universität Dortmund 2014). Dabei werden gleicherma-ßen die Betroffenen- sowie die Unternehmensperspektive im Rahmen desdemografischen Wandels beleuchtet (Technische Universität Dortmund 2014). Me-thodisch wurden nach einer Literaturanalyse Experteninterviews mit Unternehmens-vertretern geführt, pflegende Erwerbstätige wurden mittels eines Fragebogens zu ihrenVereinbarkeitsmöglichkeiten befragt (Technische Universität Dortmund 2014). In derLiteratur und den Studien carers@work und EUROFAMCARE finden sich sechs zen-trale Bedürfnisse pflegender Erwerbstätiger:
- Information und Unterstützung bei Behördengängen- Finanzielle Entlastung - Offene Kommunikation und Enttabuisierung- Akzeptanz und Verständnis- Flexibilität des Arbeitssettings- Verbindlichkeit
Beiträge
165
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
166
Beiträge
In der sich mit pflegenden Erwerbstätigen beschäftigenden Studie carers@workund in zahlreicher weiterer Literatur (siehe u. a. berufundfamilie gGmbH 2009, Boldund Deußen 2013, Eberhardt 2011, Kümmerling und Bäcker 2012) werden die unter-nehmerischen Maßnahmen und Möglichkeiten zur verbesserten Vereinbarkeit von Be-ruf und Angehörigenpflege in folgende Kategorien eingeteilt:
- Arbeitszeit, Arbeitsort, Arbeitsorganisation- Informations- und Kommunikationspolitik- Führungskompetenz- Personalentwicklung- Geldwerte Leistungen- Service für Pflegende (Kümmerling et al. 2012b: 39-47).
Eberhardt (2011) ergänzt die Kategorien außerdem um den Punkt „Technische Unter-stützung“, der Vereinbarkeitslösungen im Rahmen der AAL-Thematik anbietet. DerVollständigkeit halber wird diese Kategorie mit aufgenommen. Die Kategorien sollenim Folgenden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Konformität mit der aktuellenLiteratur beibehalten werden. Des Weiteren werden die Kategorien – abhängig ihresVerbreitungsgrades – den Kriterien „innovativ“ und „klassisch“ zugeordnet. Dabei be-zeichnet das Adjektiv „innovativ“ im Sinne dieser Arbeit „neuartige Produkte oder Ver-fahren, die sich gegenüber einem Vergleichszustand ‚merklich‘ […] unterscheiden“ (Haus-childt et al. 2011).
Im Folgenden werden neuartige Maßnahmen wie Best Practice Beispiele, das heißtbisher wenig verbreitete oder lediglich in der Literatur beschriebene, dem Kriteriuminnovativ zugeordnet werden; klassische Maßnahmen werden diejenigen sein, die be-reits ein Großteil der Unternehmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpfle-ge anbietet. Zur Unterscheidung, welche Maßnahmen zur Vereinbarkeit eher mehroder weniger verbreitet sind, wurde zum einen der Unternehmensmonitor Familien-freundlichkeit 2013 des BMFSFJ hinzugezogen. Hierfür wurden im Jahr 2012 1.556Unternehmen in Deutschland aus der Industrie- und Dienstleistungsbranche mit dreiBetriebsgrößenklassen befragt. Die Erhebungen fanden außerdem in den Jahren 2003,2006 und 2009 statt und gelten als repräsentativ. Es handelt sich nicht um eine Längs-schnittstudie mit denselben befragten Unternehmen, sondern es wurden zu jedem Be-fragungszeitraum unterschiedliche Unternehmen befragt und die Ergebnisse bundes-weit hochgerechnet (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend2013: 30). Die Befragung der Unternehmen bezieht sich auf vom BMFSFJ vorgegebe-ne Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege.
Neben dem Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2013 wurde außerdemdie nicht repräsentative Studie von Bold und Deußen (2013) zur Einordnung herange-zogen, da sie eine ähnliche Kategorisierung der Lösungsansätze verfolgt. Es wurdenUnternehmen und pflegende Arbeitnehmende mittels eines standardisierten Fragebo-gens befragt. Dabei sind die befragten Erwerbstätigen nicht in den befragten Unter-nehmen tätig. Bei den Unternehmen wurde Wert auf unterschiedliche Unternehmens-größen gelegt. Die Fragebögen wurden zur besseren Vergleichbarkeit identisch aufge-
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
baut; 26 Unternehmen und 21 pflegende Erwerbstätige haben ihn vollständig beant-wortet. Themen des Fragebogens waren die allgemeine Verantwortung für Thema derVereinbarkeit, die Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege im jeweiligen be-fragten Unternehmen, die Meinung zu gesetzlichen Rahmenbedingungen und staat-lichen Leistungen und die Unternehmensdaten und demografischen Merkmale derBefragten (Bold et al. 2013: 60-64, 76). Trotz der Tatsache, dass die Studie nicht reprä-sentativ ist, gibt sie doch wertvolle Anhaltspunkte darüber, was Unternehmen undpflegende Erwerbstätige für eine gelingende Vereinbarkeit für wichtig erachten undwelche Einstellungen zu der Thematik vorherrschen.
Neben den beiden Studien wurden außerdem Best Practice Beispiele der berufund-familie gGmbH (2009), der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände(2013) und des Bremer Verbundprojekts Beruf und Familie (2007) herangezogen. Diehier genannten Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege wur-den gesichtet, der beschriebenen Kategorisierung zugeordnet und als innovative Bei-spiele aufgeführt, da Best Practice Beispiele Orientierungshilfen für andere Unterneh-men darstellen und somit als Vorreiter für das beste Vorgehen in Bezug auf die Verein-barkeit von Beruf und Angehörigenpflege gelten (Gabler Wirtschaftslexikon „BestPractice“).
3. Ergebnisse
3.1 Bedürfnisse der pflegenden Erwerbstätigen
Bedürfnis nach Information und Unterstützung bei Behördengängen
Hilfreich und gewünscht sind vor allem zentrale Ansprechpartner und Anlaufstellen,die mitunter dafür sorgen, dass Pflege als unternehmerisches Handlungsfeld betriebenwird und somit das Tabu im Unternehmen bestenfalls gebrochen oder zumindest redu-ziert werden kann. Diese Ansprechpartner und Anlaufstellen können auch Hilfe zurSelbsthilfe bieten, indem sie beispielsweise Informationen über Dienstleistungen imregionalen Umfeld des Mitarbeitenden liefern, Selbsthilfegruppen vermitteln oder denKontakt zu anderen Betroffenen im Unternehmen herstellen (Bundesministerium fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend 2012: 16; Mooney et al. 2002: 33-37; Neal et al.2002: 10-11; Reuyß et al. 2012: 115-119; Wojszel et al. 2006: 48-49, 50). Das sind in-sofern persönliche Bedürfnisse der pflegenden Erwerbstätigen, da sie sich bei Eintritteines Pflegefalles in der Familie zumeist Informationen selbst erarbeiten müssen undsich aufgrund der Fülle der Informationen häufig allein gelassen und überfordert füh-len. Auch Hilfen im Umgang mit rechtlichen und finanziellen Fragen sowie Hilfenbeim Ausfüllen von Anträgen werden oftmals benötigt (Neal et al. 2002: 10-11).
Allgemein ist zu sagen, dass bei pflegenden Erwerbstätigen ein Bedürfnis nachUnterstützung bei der Kommunikation mit Behörden und Versicherungen vorliegt, d.h., ein Abbau der Bürokratie in den Unternehmen selbst wird gewünscht oder eine offi-zielle Anlaufstelle, die beim Ausfüllen unternehmensinterner und -externer Anträge
Beiträge
167
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
168
Beiträge
hilft und eine leichte Zugänglichkeit zu wichtigen Informationen garantiert (Döhneret al. 2007: 12; Döhner und Lüdecke 2011: 27; Mooney et al. 2002: 33-37; Schneideret al. 2006: 40-41; Wojszel et al. 2006, S. 48–49). Wichtig ist dabei für viele Pflegendeauch, dass sie sich nicht sofort als pflegende Erwerbstätige outen müssen, sondern sichzunächst unverbindlich informieren können (Döhner und Lüdecke 2011: 27; Küm-merling et al. 2012b: 83-85).
Bedürfnis nach finanzieller Entlastung
Ein weiteres persönliches Bedürfnis ist die finanzielle Entlastung der pflegenden Er-werbstätigen. Finanzielle Entlastungen aus dem Unternehmen heraus werden als for-male Anerkennung der Pflegetätigkeit bewertet. Außerdem schätzen pflegende Er-werbstätige zinslose Kreditunterstützung als Mittel zur sozialen Sicherung und Pla-nungssicherheit (Döhner und Lüdecke 2011: 27; Kümmerling et al. 2012b: 83-85;Schneider et al. 2006: 40-41).
Bedürfnis nach offener Kommunikation und Enttabuisierung im Unternehmen
Da die pflegenden Mitarbeitenden unter der Doppelbelastung von Beruf und Angehö-rigenpflege leiden und Pflege nach wie vor in Unternehmen eher tabuisiert wird, habenpflegende Erwerbstätige das soziale Bedürfnis nach einer innerhalb des Unternehmensoffenen Kommunikationskultur, die von Toleranz und Verständnis geprägt ist (Döh-ner und Lüdecke 2011: 27; Reuyß et al. 2012: 115-119). Findet diese offene Kommu-nikation nicht statt, können durch die Verschwiegenheit und die somit entstehendeStresssituation krank machende Faktoren entstehen. Es ist wichtig für die Betroffenen,ihre Gründe für die Inanspruchnahme von Vereinbarkeitslösungen rational und sach-lich darlegen zu können, ohne Mitleidssituationen zu erzeugen, sondern Akzeptanzund Normalität zu erfahren (Reuyß et al. 2012: 115-119).
Zu der offenen Kommunikationskultur und der Enttabuisierung können auch jeg-liche Bestrebungen des Unternehmens, das Thema in der Belegschaft zu verbreiten, ge-zählt werden. So ist es ein Bedürfnis, dass die Problematik und Vereinbarkeitslösungenbeispielsweise über das Intranet, das schwarze Brett oder über Mitarbeiterzeitungenpublik gemacht werden (Döhner und Lüdecke 2011: 27).
Bedürfnis nach Akzeptanz und Verständnis
Ein weiteres soziales Bedürfnis der pflegenden Erwerbstätigen ist außerdem die emo-tionale Unterstützung und Akzeptanz durch Freunde, Kollegen und vor allem durchFührungskräfte (Kümmerling et al. 2012b: 83-85; Mooney et al. 2002: 33-37; Neal etal. 2002: 10-11; Wojszel et al. 2006: 50) sowie die respektvolle Anerkennung ihrerDoppelbelastung und Leistungen (Wojszel et al. 2006: 50-51). Die Erfahrung vonemotionaler Unterstützung und Akzeptanz am Arbeitsplatz führt in den meisten Fäl-len dazu, dass sich die pflegenden Erwerbstätigen erleichtert und entlastet fühlen. Imbesten Falle verhalten sich Kolleginnen und Kollegen verständnisvoller und zeitlich fle-xibler, wenn sie von pflegenden Erwerbstätigen in ihre aktuelle Situation mit einbezo-gen werden (Keck 2012: 113).
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Bedürfnis nach Flexibilität des Arbeitssettings
Um ihre Doppelbelastung meistern zu können, ist es den pflegenden Mitarbeitendenein Bedürfnis, über geeignete Vereinbarkeitslösungen und somit über eine gesteigerteFlexibilität zu verfügen (Döhner und Lüdecke 2011: 27; Wojszel et al. 2006: 50). Dazugehören flexible Arbeitszeiten, aber auch außerplanmäßiges und flexibles Freinehmengehört zum Portfolio der Bedürfnisse, um plötzlich entstehenden Notfallsituationenentgegenstehen zu können. Ein weiterer Punkt ist die Möglichkeit zur Reduktion derArbeitszeit, die Möglichkeit der unbezahlten Freistellung, Heimarbeitsplätze, Notfall-regelungen und Karrierepausen, ohne dass diese zu einer Benachteiligung bei Beförde-rungen führt. Auch Langarbeitszeitkonten werden von pflegenden Erwerbstätigen ge-wünscht, um Karrierepausen vermeiden zu können (Döhner et al. 2007: 12; Döhnerund Lüdecke 2011: 27; Kümmerling et al. 2012b: 83-85; Mooney et al. 2002: 33-37;Neal et al. 2002: 10-11).
Bedürfnis nach Verbindlichkeit
Ein weiteres Bedürfnis sind verbindliche unternehmerische Regelungen, damit sichdie Mitarbeitenden im Ernstfall auf die Regelungen berufen können und Sicherheitund Nachhaltigkeit derer erleben (Döhner und Lüdecke 2011: 27; Kümmerling et al.2012b: 83-85; Schneider et al. 2006: 40-41). Die Verbindlichkeit scheint zunächst dasGegenteil von schnellen und unkomplizierten Lösungen darzustellen, die sich erge-ben, wenn man den Wunsch nach einem Bürokratieabbau in den Unternehmen ver-deutlicht. Allerdings steht Verbindlichkeit hierzu nicht im Gegensatz, sondern unter-streicht dieses Bedürfnis eher, da Ansprechpartner und Anlaufstellen in den Unterneh-men entscheidend zum Bürokratieabbau beitragen, wenn alle Informationengebündelt über einen Ansprechpartner mit allen Informationen laufen und nicht ver-schiedene Stellen im Unternehmen passieren müssen.
3.2 Angebotene Maßnahmen in Unternehmen und Literatur
Tabelle 2 zeigt auf, dass lediglich ein kleiner Teil der angebotenen Maßnahmen zur Ver-einbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege klassischerweise in den meisten Unter-nehmen verortet ist. Wie aus der Methodik und den verwendeten Studien hervorgeht,finden die innovativen Maßnahmen bis heute in deutschen Unternehmen kaum Ein-zug. Ob die klassischen Maßnahmen ausreichen werden, um die pflegenden Mitarbei-tenden auf Dauer im Beschäftigungsverhältnis zu halten, wird in den nächsten Kapi-teln genauer erörtert.
3.3 Befriedigung der Bedürfnislagen
Information und Unterstützung bei Behördengängen
Das Bedürfnis der pflegenden Erwerbstätigen nach unternehmensinternen Ansprech-partnern, Informationen und Unterstützung bei Behördengängen kann bislang nur inUnternehmen erfüllt werden, die eine familienfreundliche und bezüglich Vereinbar-
Beiträge
169
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
170
Beiträge
keitslösungen innovative Ausrichtung verfolgen. Es wird deutlich, dass Beratungs- undUnterstützungsleistungen zukünftig eine größere Rolle in den Unternehmen spielenmüssen, da Mitarbeitende zunächst mit der neuen Situation „Pflege und Erwerbstätig-keit“ zurechtkommen müssen, zum anderen zumeist einen Teil ihrer Arbeitszeit daraufverwenden, sich die Informationen zeitintensiv selbst zu beschaffen (berufundfamiliegGmbH 2009: 19-23).
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Klassisch Innovativ
Arbeitszeit,-ort,-organisation
TeilzeitIndividuell vereinbar-te ArbeitszeitenFlexible Tages- undWochenarbeitszeitenVertrauensarbeitszeitHeimarbeitsplätze
Langzeit- und JahresarbeitszeitkontenJobsharingSabbaticals
Informations-und Kommuni-kationspolitik
Interne BeratungAnfertigung von InformationsmappenFester Ansprechpartner im UnternehmenKontakt zu externen Beratungsstellen und Pflegestützpunkten
Service für Pflegende
Haushaltsnahe DienstleistungenCase ManagementKooperation mit externen PflegedienstleisternAnmietung betriebseigener TagespflegeplätzeFreiwilligen-Pool für BetreuungGesundheitsprogramme und Seminare, speziell zugeschnittenauf die Belastungen pflegender Angehöriger
Geldwerte Leistungen
Finanzielle Unterstützung für AngehörigenbetreuungVersicherungenGutscheineZuschüsse zu hauswirtschaftlichen LeistungenZuschüsse zu Wohnraumanpassungen
Führungs-kompetenz
Vorträge und TrainingsVerantwortung für Planung von Maßnahmen zur Vereinbar-keitSensibilisierung der BelegschaftRücksichtsvolles Verhalten und Kommunikation
Personalent-wicklung
WiedereinstellungsgarantieWiedereinstiegUrlaubsvertretungenFortbildungenKontakthalteprogramm
TechnischeUnterstützung
Vermittlung und Beratung zu assistiven TechnologienSicherstellung der Erreichbarkeit Zugriff auf elektronische Gesundheitsakten des/der Pflegebe-dürftigen durch Angehörige
Tab. 2: Klassische und innovative Maßnahmen in Unternehmen und Literatur(eigene Darstellung)
Finanzielle Entlastung
Es konnte herausgestellt werden, dass sich pflegende Mitarbeitende zum einen eineformale Anerkennung ihrer Pflegetätigkeit wünschen, zum anderen eine Planungssi-cherheit benötigen und diese Anliegen aus ihrer Sicht mit finanziellen Entlastungenbefriedigt werden können (Keck et al. 2013: 80). Allerdings wird auch das Bedürfnisnach finanzieller Entlastung lediglich in Unternehmen befriedigt, die für Angehöri-genpflege sensibilisiert sind – die letzten Jahre zeigen eine rückläufige Finanzierungvon Kosten, die aus der Angehörigenpflege entstehen, was der Vereinbarkeit von Berufund Pflege zuwiderläuft (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-gend 2013: 24-25; Reichert 2012: 326-328).
Offene Kommunikation und Enttabuisierung
Best Practice Beispiele wie angebotene Workshops oder Informationen zur Vereinbar-keit von Beruf und Angehörigenpflege über das Intranet oder in Mitarbeiterzeitschrif-ten (berufundfamilie gGmbH 2009: 19-23; DGB Bundesvorstand 2008: 14-15) zei-gen, dass auch Kommunikationsstrategien zur Enttabuisierung von Angehörigenpfle-ge noch nicht umfassend in Unternehmen etabliert sind und das Bedürfnis derpflegenden Mitarbeitenden nach einer offenen Kommunikationskultur somit nochnicht erfüllt werden kann. Dies führt im Ernstfall zu einer Isolierung und zu krankma-chenden Stressoren, weil die belastende Situation während Beruf und Pflege nicht of-fen kommuniziert werden kann (Reuyß et al. 2012: 115-119). Führungskräfte solltendahingehend geschult werden, hinter ihren pflegenden Mitarbeitenden zu stehen, adä-quate Vereinbarkeitslösungen entwickeln zu können und durch gezielte Kommunika-tion der Tabuisierung entgegen zu wirken.
Akzeptanz und Verständnis
Eine Kultur von Akzeptanz und Verständnis kann im Unternehmen entstehen, wennMaßnahmen zur Enttabuisierung angewandt und Führungskräfte ihre pflegendenMitarbeitenden entsprechend bei der Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflegeunterstützen. Allerdings wurde hierfür bereits gezeigt, dass diese Maßnahmen bislangnicht verfolgt werden. Somit zeigt sich auch für das Bedürfnis nach Akzeptanz und Ver-ständnis, dass Mitarbeitende oftmals mit ihrer Situation auf sich allein gestellt bleiben.
Flexibilität des Arbeitssettings
Es zeigt sich, dass die klassischen Möglichkeiten wichtige Elemente für eine gelingendeVereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege sind und in den Unternehmen breitvorhanden sind.
Für Angehörigenpflege sensibilisierte Unternehmen bieten ihren Mitarbeitendenaußerdem längere Freistellungen mit anteiligen Einkommenszahlungen und Wieder-einstellungsgarantien an und sorgen für eine unbürokratische und schnelle Abwick-lung der veränderten Arbeitsverträge (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-verbände 2013: 12-26; DGB Bundesvorstand 2008: 14-15). Außerdem wird daraufgeachtet, dass pflegende Erwerbstätige während der Arbeitszeit für ihre pflegebedürfti-gen Angehörigen erreichbar sind und zur privaten Organisation das Internet nutzen
Beiträge
171
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
172
Beiträge
können (berufundfamilie gGmbH 2009: 16-17; Neal et al. 2001: 9). Mit einer solchenZusammenstellung aus klassischen und innovativen Möglichkeiten gewährleisten sie,dass die pflegenden Erwerbstätigen Beruf und Angehörigenpflege – was die Flexibilitätbetrifft – tatsächlich zu vereinbaren wissen (Kohler et al. 2011: 162;Kümmerling et al.2012b: 87).
Verbindlichkeit
In den gesichteten Studien sowie den Best Practice Beispielen gibt es derzeit vor allemin den kleinen und mittelständischen Unternehmen geringe Ambitionen, Vereinbar-keitsregelungen einen verbindlichen Charakter zu geben. Gegenteiligerweise wird dieInformalität der Absprachen von befragten Unternehmen lobend erwähnt, da so leich-ter individuelle Absprachen getroffen werden könnten. Aber auch in größeren Unter-nehmen sind formelle Absprachen nicht populär (Kümmerling et al. 2012a: 318-320).Um den bereits vorhandenen und innovativen Vereinbarkeitslösungen einen gesicher-ten und stabilen Rahmen zu geben, wird in dieser Arbeit empfohlen, diese Regelungenformell – beispielsweise als Anlage zum Arbeitsvertrag – zu fundieren und somit das Be-dürfnis nach Verbindlichkeit zu erfüllen.
4. Diskussion
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sollen verdeutlichen, welche speziellen Bedürf-nisse pflegende Erwerbstätige haben, welche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Berufund Angehörigenpflege von Unternehmen in Deutschland bislang angeboten und inder Literatur beschrieben werden und ob die bislang angebotenen Maßnahmen die Be-dürfnisse der Mitarbeitenden mit Pflegeverantwortung decken. Somit kann die Arbeitin diesem Rahmen vor allem Unternehmen und deren Personalverantwortlichen alsOrientierungshilfe und Übersichtsarbeit über mögliche Vereinbarkeitslösungen undderen Effektivität dienen. Außerdem wird potenzieller Handlungsbedarf für Unter-nehmen aufgezeigt.
Auch wenn der Verbreitungsgrad einiger Vereinbarkeitslösungen in dieser Arbeit dar-gestellt werden konnte, so fehlen doch einige Daten – vor allem innovativer Lösungen –die hier letztlich über Best Practice Beispiele abgeleitet wurden. Dies könnte zu Verzer-rungen in Kapitel 3, der Bedürfnisdeckung, führen. Neben weiteren quantitativen undausgedehnteren Studien zum Verbreitungsgrad verschiedener Vereinbarkeitslösungenkönnten vertiefte Studien und Interviews mit pflegenden Mitarbeitenden wertvolleHinweise darauf geben, welche Vereinbarkeitslösungen neben der Arbeitszeitflexibilisie-rung besonders drängend sind und ob es für bestimmte Unternehmensbranchen Verein-barkeitspakete mit zusammengestellten Lösungen geben kann, die sich in der jeweiligenBranche hauptsächlich bewähren und vergleichsweise einfach bewerkstelligen lassen.Spannend könnte für pflegende Erwerbstätige und Unternehmen außerdem ein Blick inandere Länder sein, um zu erfahren, wie sich die Vereinbarkeit von Beruf und Angehöri-genpflege dort bewerkstelligen lässt und welche – auch außerunternehmerischen Unter-stützungsangebote – dort für Arbeitnehmende mit Pflegeverantwortung existieren.
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Der Großteil der in Deutschland angebotenen Maßnahmen zur Vereinbarkeit sindArbeitszeitflexibilisierungen, die jedoch eher von beruflich höher qualifizierten Mitar-beitenden in Anspruch genommen werden können (Reichert 2012: 331). Mitarbei-tende mit Pflegeverantwortung benötigen allerdings ein breiteres Spektrum an Verein-barkeitslösungen und formelle Regelungen, um sich auf die Lösungen berufen zu kön-nen und Sicherheit zu erfahren (Mooney et al. 2002: 38; Wolf 2011: 214-215; ZQPUnternehmensbefragungen 2011 und 2012 2013: 16-17). Somit kann gesagt werden,dass Unternehmen lediglich für das Bedürfnis „Arbeitszeiten“ tiefergehende Maßnah-men zur Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege bereitstellen. Die übrigen Be-dürfnisse der pflegenden Erwerbstätigen werden von einigen wenigen Unternehmen inDeutschland teilweise abgedeckt, wichtige Maßnahmen, wie z. B. finanzielle Unter-stützungen oder Langzeitarbeitszeitkonten, sind jedoch teilweise rückläufig, was amAusbau der flexiblen Arbeitszeiten und am erhöhten Verwaltungsaufwand für dieUnternehmen liegen kann (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-gend 2013: 24-25). Neben internen Beratungsleistungen sind vor allem für kleine undmittelständische Unternehmen in Deutschland Kooperationen mit externen Dienst-leistern und Pflegestützpunkten sinnig, um ihre Mitarbeitenden zu entlasten.
Nach Meinung der Autorin lässt sich abschließend sagen, dass es eines Portfolios anindividuellen und innovativen Lösungen bedarf, um Mitarbeitende mit Pflegeverant-wortung im Unternehmen halten zu können und Folgekosten durch z. B. Präsentismusund in letzter Konsequenz Personalrekrutierung zu vermeiden (Reichert 2012: 332;Schneider et al. 2011: 41), wobei die Findung passender Lösungen maßgeblich vonFührungskräften und deren Rolle bezüglich der Sensibilisierung des Teams der Mitar-beitenden abhängt (Kratzer et al. 2013: 194-195; Wolf 2011: 217-218). Pflegemana-gerinnen und Pflegemanager können hier aufgrund ihrer fachlich fundierten Ausbil-dung Hilfestellungen bei der Erfassung der spezifischen Bedürfnisse von pflegendenMitarbeitenden im Unternehmen und bei der Implementierung zugeschnittener Maß-nahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege anbieten.
Literaturberufundfamilie gGmbH (2009): für die praxis. Eltern Pflegen. So können Arbeitgeber Beschäftigte mit
zu pflegenden Angehörigen unterstützen - Vorteile einer familienbewussten Personalpolitik. 2. Aufl. Bold, S./Deußen, M. (2013): Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Mering, München: HamppBröckermann, Reiner (2013): Personalbindung: Hype oder Notwenidgkeit, Aktionismus oder Konzep-
tion? In: Bröckermann, R./Pepels, W. (Hrsg.): Das neue Personalmarketing - Employee RelationshipManagement als moderner Erfolgstreiber. Band 3: Handbuch Personalbindung. 2. Aufl. Berlin:BWV, Berliner Wiss.-Verl., 11-28
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005): Fünfter Bericht zur Lage der älte-ren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesell-schaft. Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen. Bericht der Sachverstän-digenkommission. Berlin
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2012): „Nachhaltige Familienzeitpolitikgestalten –Wege für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflegeaufgaben finden“. Berlin
Beiträge
173
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
174
Beiträge
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2013): Unternehmensmonitor Familien-freundlichkeit 2013. Berlin
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (2013): Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Praxisbeispiele aus der Wirtschaft. Berlin
DGB Bundesvorstand (2008): Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Ein Handlungsfeld für Betriebsräte.Berlin
Döhner, H./Kohler, S./Lüdecke, D. (2007): Pflege durch Angehörige – Ergebnisse und Schlussfolgerungenaus der europäischen Untersuchung EUROFAMCARE. In: informationsdienst altersfragen 3, 9-14
Döhner, Hanneli; Lüdecke, Daniel (2011): Bedarfe und Wünsche von pflegenden Angehörigen und de-ren Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen. Zu Hause bleiben im privaten Pflegehaushalt;56. Fachtagung des Wohlfahrtswerks für Baden-Württemberg. Wohlfahrtswerk Baden-Württem-berg. Stuttgart, 14.07.2011
Fissler, Ernst Rudolf; Krause, Regina (2010): Absentismus, Präsentismus und Produktivität. In: Badura,B./Walter, U./Hehlmann, T. (Hg.): Betriebliche Gesundheitspolitik. Der Weg zur gesunden Organi-sation. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 411-425
Hauschildt, J./Salomo, S. (2011): Innovationsmanagement. 5. überarbeitete, ergänzte und aktualisierteAuflage. München: Verlag Franz Vahlen GmbH
Keck, W. (2012): Die Vereinbarkeit von häuslicher Pflege und Beruf. Bern: H. HuberKeck, Wolfang; Klenner, Christina; Neukirch, Sabine; Saraceno, Chiara (2013): Caregiving and paid
work in Germany. In: Le Bihan, B./Martin, C./Knijn, T. (Hg.): Work and Care under Pressure. CareArrangements across Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press, 79-100
Keck, Wolfgang (2011): Pflege und Beruf. Ungleiche Chancen der Vereinbarkeit. In: WZBrief Arbeit,09/2011, 1-6
Klaffke, Martin (2014): Millenials und Generation Z - Charakteristika der nachrückenden Arbeitneh-mer-Generation. In: Klaffke, M. (Hg.): Generationen-Management. Konzepte, Instrumente, Good-Practice-Ansätze. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 57-82
Kofahl, Christopher (2005): EUROFAMCARE - Unterstützung und Entlastung für pflegende Angehöri-ge älterer Menschen. Eine europäische Vergleichsstudie. Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Kofahl, Christopher; Mestheneos, Elizabeth; Triantafillou, Judith (2005): “Services for Supporting Fami-ly Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage” - EUROFAMCARE. Zu-sammenfassende Übersicht der Ergebnisse aus der EUROFAMCARE-Sechs-Länder-Studie. Europäi-sche Union; Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Kohler, Susanne; Döhner, Hanneli (2011): Carers@Work. Carers between Work and Care. Conflict orChance? Results of Interviews with Working Carers. Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf,[2014-08-06]
Kratzer, Nick; Menz, Wolfgang; Pangert, Barbara (2013): Work-Life-Balance: Eine Bestandsaufnahme.In: Bornewasser; M./Zülch, G. (Hg.): Arbeitszeit - Zeitarbeit. Flexibilisierung der Arbeit als Antwortauf die Globalisierung. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 189-204
Kümmerling, A./Bäcker, G. (2012a): Berufstätigkeit und familiäre Pflege - Zur Praxis betrieblicher Ver-einbarkeitsregelungen. In: Pflege & Gesellschaft 4, 312-329
Kümmerling, Angelika; Bäcker, Gerhard (2012b): Carers@Work. Zwischen Beruf und Pflege. Betriebli-che Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflegeverpflichtung.Universität Duisburg Essen
Mooney, A./Statham, J./Simon, A. (2002): The pivot generation. Informal care and work after fifty. Bris-tol, UK: Policy Press
Neal, Margaret B.; Hammer, Leslie B. (2001): Supporting Employees with Child and Elder Care Needs.A work-family sourcebook for employers
Neal, Margaret B.; Wagner, Donna L. (2002): Working Caregivers: Issues, Challenges, And Opportuni-ties For The Aging Network. Issue Brief. Hg. v. National Family caregiver Support Program
Oertel, Jutta (2014): Baby Boomer und Generation X - Charakteristika der etablierten Arbeitnehmer-Generation. In: Klaffke, M. (Hg.): Generationen-Management. Konzepte, Instrumente, Good-Prac-tice-Ansätze. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 27-56
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Reichert, Monika (2012): Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege - eine Bestandsaufnahme. In:Bispinck, R./Bosch, G./Hofemann, K./Naegele, G. (Hg.): Sozialpolitik und Sozialstaat. Festschriftfür Gerhard Bäcker. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 323-333
Reuyß, S./Pfahl, S./Rinderspacher, J./Menke, K. (2012): Pflegesensible Arbeitszeiten. Perspektiven derVereinbarkeit von Beruf und Pflege. Berlin: Ed. Sigma
Riedmann, A./Bielenski, H./Szczurowska, T./Wagner, A. (2006): Working time and work-life balance inEuropean companies. Establishment survey on working time 2004-2005. Luxembourg: Office forOfficial Publications of the European Communities
Schneekloth, U./Wahl, H. (2005): Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung in privatenHaushalten (MuG III). Repräsentativbefunde und Vertiefungsstudien zu häuslichen Pflegearrange-ments, Demenz und professionellen Versorgungsangeboten. Integrierter Abschlussbericht im Auftragdes Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. München
Schneider, Helmut; Heinze, Jana; Hering, Daphne (2011): Betriebliche Folgekosten mangelnder Verein-barkeit von Beruf und Pflege. Hg. v. Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik. Berlin
Schneider, Norbert F.; Häuser, Julia C.; Ruppenthal, Silvia M.; Stengel, Stephan (2006): Familienpflegeund Erwerbstätigkeit. Eine explorative Studie zur betrieblichen Unterstützung von Beschäftigten mitpflegebedürftigen Familienangehörigen. Johannes Gutenberg Universität Mainz, Institut für Soziolo-gie. Mainz
Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2010): Demografischer Wandel in Deutschland. Auswir-kungen auf Krankenhausbehandlungen und Pflegebedürftige im Bund und in den Ländern. 2/2010.Wiesbaden
Statistisches Bundesamt (2013): Pflegestatistik 2011. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung.Deutschlandergebnisse. Wiesbaden
Szydlik, Marc (2008): Demographischer Wandel im Wohlfahrtsstaat: Perspektiven für Politik und For-schung. In: Zank, S. (Hg.): Generationen in Familie und Gesellschaft im demographischen Wandel.Europäische Perspektiven. Stuttgart: Kohlhammer, 13-22
Techniker Krankenkasse (2014): TK-Pflegestudie: Pflegende Angehörige treiben Pflichtgefühl und Fa-milienzusammenhalt an, doch der soziale Kitt bröckelt. http://www.tk.de/tk/pressemitteilungen/po-litik/658440?_printPDF_, [2015-07-30]
Technische Universität Dortmund (2014): Zwischen Beruf und Pflege: Konflikt oder Chance? - Projekt-informationen. http://www.carersatwork.tu-dortmund.de/info.php, [2014-08-20]
Wojszel, B./Döhner, H./Kohler, S./Lamura, G./Triantafillou, J./Krevers, B./Patel, J./Brown, J. (2006):“Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage andUsage” – EUROFAMCARE. WP 15: Research Action (REACT) Report
Wolf, Karsten (2011): Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. In: Hunke, G. (Hg.): Best Practice Modelle im55plus Marketing. Bewährte Konzepte für den Dialog mit Senioren. Wiesbaden: Gabler, 211-219
ZQP Unternehmensbefragungen 2011 und 2012 (2013): Auswertung der Unternehmensbefragung. In:Zentrum für Qualität in der Pflege (Hg.): Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Ermöglichen, Entlas-ten, Erhalten. Berlin, 13-22
Miriam Kohnle, B. A. Pflege/PflegemanagementLessingstraße 1, 73730 Esslingen a. N., [email protected]
Beiträge
175
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
176
Beiträge
Sven-Uwe Gau, Arndt Schlubach
Interdependenzanalyse der Behandlungs -leistung „Sturzprophylaxe in der Pflege“ unterBerücksichtigung patientenbezogener, pflege-fachlicher und ökonomischer Kriterien
Interdependence analysis on the treatment of “Fall prevention in nursing”considering patient related, nursing and economic criteria
Due to different factors influencing the emergence of falls it is hard to identify or verify de-cisive causal coherencies between intervention and the result. Between the conflictingpriorities of subject-specific, economic and ethical requirements multidimensional dataare needed to control the process of falls prevention. The control parameter to influenceoutcome are qualification of employees (healthcare organisations are organisations ofexperts), the choice of interventions (e.g. kind, amount, combination, costs of interven-tions) and the result for the patient. The analysis shows decisive hints on existing andnot applicable interdependences among examined variables. The evaluation of proces-ses via a triangulation of chosen variables seems to make it possible to control the provi-sion of services securer, of higher quality and more efficiently.
KeywordsExperts standards, fall, process control, quality of results, qualification, professional ex-perience, analysis
Aufgrund der multifaktoriell bedingten Entstehung von Stürzen, ist es nur schwer möglicheindeutig kausale Zusammenhänge zwischen Intervention und Ergebnis zu erkennenoder nachzuweisen. Im Spannungsfeld fachlicher, ökonomischer und ethischer Anforde-rungen, werden mehrdimensionale Daten zur Steuerung des Prozesses zur Sturzprophy-laxe benötigt. Die Steuerungsgrößen zur Beeinflussung des Outcomes sind die Mitarbei-terqualifikation (Gesundheitseinrichtungen sind Expertenorganisationen), die Auswahlder verwendeten Interventionen (z. B. Art, Anzahl, Kombination, Kosten der Interventio-nen) und das Ergebnis für den Patienten. Die durchgeführte Analyse liefert eindeutigeHinweise auf bestehende und nicht zutreffende Interdependenzen zwischen den unter-suchten Variablen. Die Bewertung der Prozesse über die Triangulation der gewählten Va-riablen scheint eine sicherere, qualitativ hochwertigere und effizientere Steuerung derLeistungserstellung möglich zu machen.
SchlüsselwörterExpertenstandard, Sturz, Prozesssteuerung, Ergebnisqualität, Qualifikation, Berufser-fahrung, Analyse
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
eingereicht 01.07.2015akzeptiert 01.02.2016
1. Einleitung
„Survival of the fittest“ – Dieses auf den Biologen Charles Darwin zurückzuführendeÜberlebensprinzip ist mit „Überleben des Passendsten“ und nicht wie fälschlicher-weise mit „Überleben des Stärksten“ zu übersetzen. Grundbedingung langfristigenÜberlebens ist also die Fähigkeit ständiger Anpassung an ein sich wandelndes Umfeld(Braun 2007: 15). Dieses Zitat beschreibt treffend die zentrale Anforderung an Leis-tungserbringer in der Gesundheitswirtschaft der heutigen Zeit: die Fähigkeit zur Ver-änderung. Die möglichen Ursachen für den stattfindenden Wandlungsprozess im Ge-sundheitswesen sind vielfältig. Von zentraler Bedeutung sind die vorherrschendenRahmenbedingungen, die seitens der Gesundheitspolitik vorgegeben werden. Stetigknapper werdende Ressourcen, stark beeinflusst durch den demografischen Wandel(Ulrich 2005:17), stehen einer Anspruchssteigerung auf der Seite der Patienten undBewohner als Nutzer oder der Kostenträger, mit dem Ziel der Effizienzverbesserung,der Qualitätssteigerung und/ oder -sicherung gegenüber. Ergänzt durch Kürzungender beitragsfinanzierten Leistungen und Erhöhung der Selbstbeteiligung der Patien-ten/Bewohner werden Kosten im Gesundheitssystem eingedämmt (Haubrock 2009:30). Der zunehmende Kosten- und Wettbewerbsdruck zwingt Unternehmen der Ge-sundheitsbranche zudem, ihre betrieblichen Ablauf- und Organisationsstrukturen neuzu gestalten. Es gilt den Wandel von Arbeitsteilung und Spezialisierung hin zu einerprozessorientierten Behandlung und Versorgung zu vollziehen. Immer mehr Patientensind in immer kürzerer Zeit zu versorgen (Isford, et al., 2014: 16f ). Neben der Ver-pflichtung zur Entwicklung der Qualität der Behandlung und Versorgung muss sicher-gestellt sein, dass diese auch dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisseentsprechen und somit in der fachlich gebotenen Qualität erbracht werden. Dieses istfür Anbieter von Gesundheitsleistungen in den Sozialgesetzbüchern differenziert be-schrieben und festgelegt. Das besondere Gewicht der daraus resultierenden Verpflich-tungen für die Leistungsersteller ergibt sich aus der Zusammenführung der gesetz-lichen Anforderungen mit dem vorliegenden wissenschaftlich fundierten Wissen überdie Wirksamkeit von Pflege- und Behandlungsmaßnahmen. Dieses Know How steht,vor allem im Bereich der Pflegeinterventionen, nur begrenzt zur Verfügung. Einen rele-vanten Einfluss auf dieses Spannungsfeld hat die haftungsrechtliche Perspektive. Beibegrenzt zur Verfügung stehender wissenschaftlicher Evidenz von Wirksamkeit derVersorgungsmaßnahmen und Behandlung wächst die Bedeutung der vertraglichenund gesetzlichen Verpflichtungen bei Haftungsansprüchen der Kostenträger und derLeistungsempfänger. Bezogen auf den Prozess der Sturzprophylaxe ergeben sich hierdeutliche Unsicherheiten. Im Tätigkeitsfeld der beruflich Pflegenden entsteht regel-mäßig ein Dilemma. Es müssen gesetzliche, ethische und wirtschaftliche Anforderun-gen erfüllt werden, die sich häufig gegenseitig beeinflussen und/oder beschränken (Jor-zig 2003: 381). Im aktuellen Bericht der Deutschen Agentur für Health TechnologyAssessment (DAHTA) zum Thema der Sturzprophylaxe wird zusammengefasst, dassbei gerichtlichen Entscheidungen oft Maßnahmen (z. B. Sensormatten) thematisiertwerden, für die in den vorliegenden Wirksamkeitsbewertungen keine Effektnachweisegeführt werden können (Balzer at al. 2012: 10). Basierend auf dem Problem der Ab-
Beiträge
177
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
178
Beiträge
grenzung des Sturzrisikos vom allgemeinen Lebensrisiko sowie der unsicheren Beweis-lage hinsichtlich der Sturzprophylaxe ergeben sich ebenfalls juristische Unsicherheiten(Balzer at al. 2012: 12). Die Besonderheit, dass Gesundheitsgüter in der Regel als per-sonenbezogene Dienstleistungen wahrgenommen werden, muss in diesem rechtlichenZusammenhang mit aufgeführt werden. Eine Leistung kann nur unter gleichzeitigerMitleistung des Nachfragers (Patienten/Bewohner/Angehöriger) erbracht werden(Berger/Stock 2008: 22). Der Patient ist ein integriertes Subsystem im Dienstleis-tungserstellungsprozess. Hierbei ist der Wille zum Gesundwerden für den Erfolg derVersorgungsleistung unverzichtbar (Eichhorn 2008: 82). Aus diesen skizzierten Span-nungsfeldern entsteht ein Milieu, welches als sehr vulnerabel zu beschreiben ist. Esexistiert ein haftungsrechtlich relevanter Vertrag, im Rahmen dessen hohe Anforde-rungen an das Ergebnis einer persönlich-interaktiven Dienstleistung gestellt sind.Hierbei ist das Ziel klar zu benennen. Im Falle der Sturzprävention ist dies die Vermei-dung von Stürzen. Wo das nicht möglich ist, soll eine Senkung der sturzbedingten Fol-geschäden erreicht werden (DNQP 2013: 23). Die Maßnahmen, die zur Zielerrei-chung benötigt werden, sind jedoch nicht evident auf Wirksamkeit untersucht. Somithängt die Auswahl an Maßnahmen von dem individuellen Fachwissen und den Fähig-keiten der Pflegefachperson ab. Der Empfänger der Behandlungsleistung ist durch sei-ne Mitarbeit entscheidend am Ergebnis beteiligt. Unter Umständen kann sich einemangelnde Bereitschaft oder Fähigkeit zur Kooperation negativ auf das Behandlungs-ergebnis auswirken. Die Gründe hierfür sind vielfältig und können oft nicht beein-flusst werden. Die Kostenträger der Behandlungsleistung verweisen im Schadensfallauf die Sorgfaltspflichten der Leistungserbringer und unterstellen häufig defizitäreLeistungen, um letztlich Schadensersatz zu fordern. Gigerenzer beschreibt das aus derAngst vor Klagen resultierende Verhalten der Experten als defensive Medizin. Dem-nach werden mitunter klinisch nicht gerechtfertigte, möglicherweise sogar schädlicheMaßnahmen für den Patienten angeordnet. In einer Studie von Studdert et al. (2005)berichten 93% der Befragten , dass sie manchmal oder oft defensiv handeln (Gigeren-zer 2013: 82). Hier kommt den an der Behandlung beteiligten Mitarbeitern in der Or-ganisation eine zentrale Rolle zu. Ihre Entscheidung hat Bedeutung für das Ergebniseinerseits, andererseits auch für den Einsatz der vom Management zur Verfügung ge-stellten Ressourcen. Der Prozessansatz impliziert, dass zwischen geplanten Interven-tionen, den dabei eingesetzten Ressourcen und dem Ergebnis ein Zusammenhang be-steht. Dies lässt darauf schließen, dass Möglichkeiten der gezielten Einflussnahme aufden Prozess existieren. Aktuelle Entwicklungen z. B. im Bereich der Abrechnungssyste-matik von Krankenhausleistungen stützen dies Annahme. So fordern Kunze et al.(2013), dass für eine weitere Transparenz zur Abrechnung von Leistungen mehr Infor-mationen benötigt werden, um Behandlungsmuster erkennen und schrittweise besserabbilden zu können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass trotz gleicher Diagnosen undIndikatoren für Schweregrade der Erkrankungen die individuellen Verläufe (ebensoauch der Leistungen, Anm. d. A.) sehr unterschiedlich sein können.
Die Expertenstandards des deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in derPflege (DNQP) bieten eine gute Basis für die Untersuchung der beschriebenen Annah-
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
men. Aufgrund der hohen Bedeutung für die Patienten/Bewohner, sowie einer gutenAbgrenzbarkeit und der erheblichen ökonomischen und forensischen Bedeutung derErgebnisse, wird der Prozess der Sturzprophylaxe in der Pflege zur Analyse gewählt. DieUntersuchung verfolgt im Wesentlichen das Ziel, den Prozess der Sturzprophylaxe inder Pflege auf eventuelle Zusammenhänge zwischen den Variablen pflegerische Kom-petenz/Qualifikation, Ressourceneinsatz und dem Ergebnis zu untersuchen. Konkretwird die Frage beantwortet, ob nachweisbare Interdependenzen zwischen den Qualifi-kationen der Pflegepersonen, den gewählten Interventionen zur Sturzprophylaxe, demdaraus entstandenen Ressourcenverbrauch und den Sturzfolgen bestehen.
2. Methodik und Datenbasis
Mittels einer multizentrischen, retrospektiven Längsschnittanalyse werden in vorhan-denen Patientendokumentationen pflegetherapeutische Leistungen zur Präventionvon Stürzen und sturzbedingter Folgeschäden, der daraus abzuleitende Ressourcenver-brauch, unterschiedliche Qualifikationscluster der planenden Pflegemitarbeiter sowieder Sturzfolgen für den Patienten/Bewohner analysiert. Die hohe Bedeutung desSturzgeschehens für Patienten/Bewohner sowie die gute Abgrenzbarkeit des Prozessesin Verbindung mit der erheblichen ökonomischen und forensischen Bedeutung sindweitere Gründe für die Auswahl. Der Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflegegilt in den untersuchten Einrichtungen als umgesetzt und die Dokumentation ent-spricht den Empfehlungen des Expertenstandards. Untersucht werden Sturzfälle auseinem psychiatrischen Krankenhaus und aus drei Einrichtungen der stationären Alten-hilfe. Die Gesamtheit der Merkmalsträger der Analyse sind alle Sturzereignisse der Jahre2006 bis 2010. Im genannten Zeitraum von fünf Jahren wurden in beiden Einrichtungeninsgesamt 2.302 Sturzereignisse dokumentiert. Aus diesem Clustersample (Bortz/Schus-ter 2010: 81) werden 700 Fälle randomisiert über das Statistikprogramm SPSS 15.0 aus-gewählt. Limitationen der durchgeführten Studie ergeben sich aus der Tatsache, dass aus-schließlich die geplanten Interventionen erhoben wurden. Des Weiteren ergab sich auf-grund der vorgefundenen Dokumentationsqualität eine Dropout rate von 22%.
Die Reduktion der je 350 Fälle/Einrichtung findet im Analyseprozess aufgrund vonAusschlusskriterien, wie nicht lesbarem Handzeichen, Nichtauffinden der Akte oderfehlender Dokumentation, statt. Es ergibt sich ein Datenumfang von insgesamt 545Fällen (242 Datensätzen stationäre Altenhilfe und 303 Datensätze Krankenhaus) aufder die vorliegende Analyse basiert. Die untersuchten Variablen werden mit dem In-strument der Korrelationsanalyse auf mögliche Interdependenzen hin untersucht. Beider Analyse wird je nach Skalenniveau der Korrelationskoeffizient nach Spearman-Rho bzw. nach Bravais-Pearson ermittelt. Um einen Informationsverlust zu vermei-den, wird jeweils das Verfahren gewählt, welches dem erreichten Skalenniveau ent-spricht (Bourier 2010: 207; Bortz/Schuster 2010: 156ff ). Die durchgeführte Analyseberuht auf der in den teilnehmenden Einrichtungen vorliegenden Leistungs- und Ver-laufsdokumentation in den Patienten-/Bewohnerakten. Maßgeblich hierbei ist dieAuswertung der nach dem stattgefundenen Sturzgeschehen erstellten Sturzprotokolle,
Beiträge
179
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
180
Beiträge
über die die Auswahl der Fälle erfolgt. Über die Recherche der Patienten-/Bewoh-nerakte werden die entsprechend geplanten Interventionen zur Prävention erhoben.Die erfassten Interventionen leiten sich vom Expertenstandard Sturzprophylaxe in derPflege ab. Im Expertenstandard sind Interventionen und Interventionsprogrammeempfohlen, die das Sturzrisiko senken sollen. Dazu zählen Einzelinterventionen, wiebeispielsweise Balancetraining, Gehilfen, Auswahl der Schuhe, aber auch die sog. Mo-difikation umgebungsbedingter Sturzgefahren. Hier werden beispielsweise das Entfer-nen von Stolperfallen, das Vorhandensein von Handläufen und die Anpassung der Be-leuchtung empfohlen (DNQP 2006: 80ff ). Zudem lassen sich die empfohlenen Prä-ventionsmaßnahmen in personenbedingte und umgebungsbedingte Interventionenunterteilen. Im Rahmen der Erhebung erfolgte eine Ergänzung um in der Praxis ange-wandte Maßnahmen (siehe Tabelle 1).
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Pflegeintervention Häufigkeit gesamt %
1 Assessment 543 97,14%
2 höhenverstellbares Bett 512 91,59%
3 ausreichende Beleuchtung 508 90,88%
4 Stolperquellen beseitigen 504 90,16%
5 Klingel in Reichweite (Funktion verstanden) 475 84,97%
6 Bett an die Wand 417 74,60%
7 Begleitung bei Körperpflege 403 72,09%
8 Geeignetes Schuhwerk 391 69,95%
9 geeignete Kleidung 384 68,69%
10 Zimmer in Begleitung verlassen 344 61,54%
11 Rollator/Gehstock bereitstellen 318 56,89%
12 Begleitung zum WC / Toilettengang /Toilettenstuhl 303 54,20%
13 Anleitung Gehstock/Rollator 301 53,85%
14 Beratung Sturzrisiko 230 41,14%
15 (Sichere) Lagerung im Bett 227 40,61%
16 Verlassen des Bettes in Begleitung 199 35,60%
17 Sitz-, Steh- u. Bewegungsübungen 188 33,63%
18 Begleitung beim Laufen 162 28,98%
19 Begleitete Spaziergänge 153 27,37%
20 Mobilisation in den Rollstuhl/Stuhl 158 28,26%
21 Bettgitter angeboten 147 26,30%
22 Angebote von Bettgittern von Patienten angenommen 134 24,10%
23 Einfuhrkontrolle 128 22,90%
24 Hüftprotektoren 77 13,77%
25 Sehhilfe anpassen, reinigen 69 12,34%
26 Gerichtliche Fixierung 66 11,81%
27 Kurzzeitige Anbringung von Bettgittern, Gefahr in Verzug 8 1,43%
eigene Darstellung
Tab. 1: Häufigkeitsverteilung der Pflegeinterventionen
Sowohl bei der Identifikation von Sturzrisiken und dem Erstellen der Interven-tionsplanung, als auch bei der Umsetzung der geplanten Interventionen findet ein di-rekter Kontakt zwischen den Pflegepersonen und dem Patienten/Bewohnern statt undes werden somit Ressourcen verbraucht. Die hauptsächlich verbrauchten Ressourcensind hierbei folglich Personalressourcen. Die Bedeutsamkeit der Personalkosten istdurch den Anteil von bis zu 75% der Gesamtkosten begründet (Schär 2009: 407). Eineexakte Leistungserfassung ist anhand der Pflegedokumentation nicht möglich. Es feh-len in den Untersuchten Pflegedokumentationen die Variablen „Frequenz der Leistungpro Tag“ und „Dauer der Leistung in Minuten“. Die Darstellung der durch die geplan-ten Interventionen verbrauchten Ressourcen erfolgt mit dem Instrument zur Leis-tungserfassung in der Pflege (LEP 3). Hierüber wird die Frequenz und Dauer der Inter-vention ergänzt, um den monetären Ressourcenverbrauch der erbrachten Pflegeleis-tung abbilden zu können (siehe Anhang). Die benötigten Minutenwerte undFrequenzen wurden aus einer Zufallsauswahl einer mit LEP 3 arbeitenden Klinik er-gänzt. Die Daten basieren auf 12.000 Krankenhausbehandlungsfällen. Die mitarbei-terbezogenen Daten werden nach Zustimmung der Einrichtungsleitung durch schrift-liche oder mündliche Befragung der vorgesetzten Führungskräfte und unter Hinzuzie-hung der Personalakte der Mitarbeiter ermittelt. Aus den Patienten-/Bewohneraktenist der jeweilige, zuletzt vor dem Sturz planende Pflegemitarbeiter ersichtlich. DieQualifikation der Mitarbeiter wird mit zwei Schwerpunkten definiert: a) dem Qualifi-kationsniveau mit den Kriterien der durchgeführten Aus-, Fort- und Weiterbildungenund b) der Berufserfahrung der Pflegepersonen auf dem entsprechenden Arbeitsbe-reich. Unternehmen im Gesundheitswesen sind gesetzlich dazu angehalten, die Ge-sundheitsleistung auf dem aktuellen Stand der Pflegewissenschaft zu erbringen. UnterBerücksichtigung der Kosten soll die Leistung des Personals auf einem marktfähigenQualitätsniveau gesichert werden (Schär 2009: 406). Das marktfähige Qualitätsniveaubedeutet in der vorliegenden Arbeit das Wissen um den Expertenstandard Sturzpro-phylaxe in der Pflege. Wissen entsteht, wenn Personen die Fähigkeiten besitzen, Infor-mationen zu vernetzen und diese sowohl interpretieren als auch integrieren können.Ferner muss das erworbene Wissen zu einer Erhöhung der Problemlösungsfähigkeitführen. Erlangt werden kann dies sowohl theoriegeleitet als auch durch praktische Er-fahrung. Erst durch die Ergänzung des Wissens um einen konkreten Anwendungs-oder Problembezug kann die Stufe des „Könnens“ erreicht werden (Falk 2007: 20). Fürdie Umsetzung des Expertenstandards Sturzprophylaxe in der Pflege muss die Pflege-fachkraft1 sich das Wissen zur Identifikation von erhöhten Sturzrisiken sowie das Wis-sen über geeignete Interventionen zur Reduzierung von Sturzfolgen oder Vermeidungvon Stürzen aneignen. Die Teilnahme an der Schulung zum Expertenstandard Sturz-prophylaxe in der Pflege wird somit als konkreter Anwendungsbezug gesehen, umKönnen zu erlangen. Das Qualifikationsniveau ergibt sich demnach durch die Erfül-lung von unterschiedlichen Anforderungen an die Mitarbeiter. Als Mindestanforde-rung wird die dreijährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger sowie
Beiträge
181
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
1 Der Begriff der Pflegefachkraft entspricht der Definition des Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege.Hierzu zählen Altenpfleger/innen, Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen und Gesundheits- und Kinder -krankenpfleger/innen sowie Hochschulabsolventen eines pflegebezogenen Studiengangs ( DNQP 2006: 24).
182
Beiträge
zum Altenpfleger angenommen. Darüber hinaus sind spezielle Fortbildungen zum Ex-pertenstandard erfasst, sowie deren Wiederholungen. Ferner werden Zusatzqualifika-tionen der Mitarbeiter berücksichtigt. Unter „Zusatzqualifikationen“ sind die berufs-qualifizierenden Weiterbildungen, wie Fachpflege Psychiatrie, Gerontopsychiatrie,Sucht etc., eingeschlossen. Ebenso sind Leitungsqualifikationen zu Stations-/Wohn-bereichsleitung etc. und z. B. Fortbildungen zur Praxisanleitung/ Mentoren aufge-nommen. Die unspezifischen Fortbildungen bildet die letzte erfasste Rubrik. Hier sindFortbildungen aufgeführt, die keinen direkten Bezug zum Expertenstandard Sturzpro-phylaxe haben, wie beispielsweise Schulungen zu Rechtsgrundlagen und Fixierungen,Kinästhetik und Basale Stimulation. Durch die unterschiedlichen Kombinationen derRubriken ergeben sich 12 Qualifikationscluster, in welche die Pflegefachkräfte einge-ordnet werden können.
Die Literatur gibt Hinweise darauf,dass die Qualifikation von Mitar-beitern neben dem Besuch von Fort-bildungen auch durch erlangte Be-rufsjahre und Erfahrungen in ver-schiedenen Situationen zunimmt.Neben dem Ausbau des theoriege-leiteten Wissens ist das Sammelnvon Erfahrungen die Grundlage derKompetenzentwicklung und fürhermeneutisches Fallverstehen. DieVerknüpfung von Theorie und Pra-xis ermöglicht den Pflegefachkräf-ten das Wissen und Verstehen kom-plexer Situationen (Benner et al2000: 45). Das angeeignete Wissenum ein Fachthema kann jedoch mit
der Zeit an Wertigkeit verlieren. Die Halbwertszeit des Wissens beschreibt den Wertdes Wissens, der sich im Laufe der Jahre um die Hälfte reduziert und oder verändert.Berufliches Fachwissen verändert sich in fünf Jahren um die Hälfte (Hungenberg/Wulf2006: 311f ). Auch das Fachwissen der Pflegefachkräfte, bezogen auf den Experten-standard Sturzprophylaxe in der Pflege, wird durch die Zeit beeinflusst. Aufgrund des-sen wird auch die Berufserfahrung der Pflegepersonen auf dem entsprechenden Ar-beitsbereich erhoben und in Cluster mit Fünfjahresschritten eingeordnet. Die Sturz-folgen werden dem Sturzprotokoll entnommen und ausgewertet. Die beschriebenenFolgen der Stürze für den Patienten/Bewohner wurden über die Auswertung der Pa-tienten-/Bewohnerakten nochmals überprüft und spezifiziert. Es sind insgesamt sie-ben Folgen ermittelt worden. Das Spektrum reicht von „keine körperlichen oder sach-lichen Sturzfolgen“ bis zu „Fraktur“ (siehe Tabelle 3).
Die Vorgehensweise, über die einzelnen Patienten/- Bewohnerakten die individuel-len geplanten Interventionen und Ressourcenverbräuche zu analysieren, entspricht
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Rang Fortbildungenspezifisch
Wieder-holung
Zusatzqua-lifikation
Fortbildungunspezifisch
1 1 1 1 12 1 1 1 03 1 1 0 14 1 1 0 05 1 0 1 16 1 0 1 07 1 0 0 18 1 0 0 09 0 0 1 110 0 0 1 0
11 0 0 0 1
12 0 0 0 0
eigene Darstellung
Tab. 2: Erhobene Qualifikationscluster
dem sogenannten bottom up-Ansatz, und es handelt sich um Primärdaten (Schöffski2008: 197f ). Tabelle 4 zeigt im Überblick alle Variablen und Subvariablen der Untersu-chung.
3. Ergebnisse
In einem Fünfjahreszeitraum (2006 bis 2010) wurden insgesamt 545 Patienten-/Bewoh-nerakten aus einem psychiatrischen Krankenhaus und aus drei Einrichtungen der statio-nären Altenhilfe ausgewertet. Tabelle 1 zeigt die geplanten Interventionen zur Sturzpro-phylaxe sortiert nach Häufigkeiten. Untersucht wurde weiterhin anhand des Prozessesder Sturzprophylaxe, ob mittels Korrelationsanalyse mögliche Interdependenzen zwi-schen i) den geplanten Interventionen, ii) den daraus abgeleiteten Ressourcenverbrauch,iii) des Qualifikationsniveaus der Experten und iiii) den Folgen für den Patienten/Be-wohner nachgewiesen werden können. Bei der Untersuchung der Mitarbeiterqualifika-tion und den geplanten Interventionen, kann ein Zusammenhang nachgewiesen werden.Die sehr schwache aber signifikante negative Korrelation (r=-0,09/Sig.=0,036) bei dengeplanten Interventionen und den personendingten Interventionen (r=-0,093/Sig.=0,030) gibt einen Hinweis darauf, dass mit zunehmender Qualifikation die Anzahlder geplanten Interventionen sinkt. Höher qualifizierte Pflegepersonen planen demnachtendenziell weniger Interventionen. Bei den umgebungsbedingten Interventionenwiederum kann kein Zusammenhang zwischen der Qualifikation und den geplanten Prä-ventionsmaßnahmen aufgezeigt werden. Der hohe Wert für die Signifikanz von 0,945(r=0,003) liefert einen sehr eindeutigen Hinweis, dass es tatsächlich keinen Zusammen-hang zwischen den Variablen gibt. Die Anpassung der Umgebung ist in den erhobenenEinrichtungen ein Ausstattungsmerkmal. Hier hat die Qualifikation keinen Einfluss. Da-neben kann unterstellt werden, dass auch Pflegehilfskräfte beispielsweise beim Erkennenvon Stolperfallen, diese auch beseitigen. Eine deutlich signifikante Interdependenz be-steht zwischen der Berufserfahrung in Jahren auf dem jeweiligen Arbeitsbereich und derAnzahl der Interventionen. Die Prüfung zeigt ein hochsignifikantes Ergebnis einer mitt-
Beiträge
183
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Sturzfolge Häufigkeit gesamt %
Keine 340 62,39%
Schürfwunde 72 13,21%
Prellmarke 61 11,19%
Schmerzen 58 10,64%
Platzwunde 50 9,17%
Dislokation v. Katheder,ZVK oder anderem
7 1,28%
Fraktur 6 1,10%
Beschädigung von Patienten-eigentum. Was? Brille
1 0,18%
Eigene Darstellung
Tab. 3: Darstellung der Sturzfolgen
184
Beiträge
leren negativen Korrelation, sowohl gesamt (r=-0,491/ Sig.=0,000) als auch nach perso-nenbedingten (r=-0,45/Sig.=0,000) und umgebungsbedingten(r=-0,413/Sig.=0,000)Interventionen unterteilt. Dies zeigt, dass mit steigender Berufserfahrung die Anzahl dergewählten Interventionen sinkt. Die Analyse des davon abgeleiteten Ressourcenverbrau-ches in verplanten Pflegeminuten bestätigt das Ergebnis (r=-0,47/Sig.=0,000). Die amArbeitsplatz berufserfahrenen Pflegepersonen verplanen somit weniger Interventionenund Ressourcen als die weniger Erfahrenen. Bedeutsam ist jedoch, dass die Sturzfolgen
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Variable Subvariable mit Merkmalswerten
Geplante Inter-ventionen
Personenbedingte Interventionen Umgebungsbedingte Interventionen
AssessmentBegleitung bei der Körperpflegefestes SchuhwerkZimmer in Begleitung verlassenRollator/Gehstock bereitstellenBegleitung zum WC/Toilettengang/ToilettenstuhlAnleitung Gehstock/Rollator(Sichere) Lagerung im BettBeratung SturzrisikoVerlassen des Bettes in BegleitungSitz-, Steh- u. BewegungsübungenBegleitung beim LaufenMobilisation in den Rollstuhl/StuhlBegleitete SpaziergängeAngebote von Bettgittern vom Patienten angenommenEinfuhrkontrolleHüftprotektorenSehhilfe anpassen, reinigen
höhenverstellbares Bettausreichend BeleuchtungStolperquellen beseitigenKlingel in Reichweite (Funktionverstanden)Bett an die Wand
Ressourcen-verbrauch
Summe verbrauchter Pflegeminuten für Interventionen (nach Übertragung in LEP3-Systematik)
Mitarbeiter-qualifikation
Aus-, Fort- und Weiterbildungsniveau (geclustert) Berufserfahrung auf der Station/dem Bereich (geclustert)
Fortbildung spezifischWiederholung der FortbildungZusatzqualifikationFortbildung unspezifisch
unter einem Jahr1,0 – 5,0 Jahre5,1 – 10,0 Jahre0,1 – 15,0 Jahre15,1 – 20,0 Jahreüber 20,0 Jahre
Sturzfolgen Keine körperlichen oder sachlichen FolgenEigentum defektDislokation von Katheder(n)SchmerzenPrellmarke/SchürfwundePlatzwundeFraktur
Tab. 4: Variablenset
eigene Darstellung
für den Patienten/Bewohner davon unberührt bleiben. In der Zusammenhangsanalysekann die Anzahl geplanter Interventionen keinen Zusammenhang mit den Sturzfolgenaufweisen (r=-0,023/Sig.=0,597). Auch nach Unterteilung in umgebungs- und personen-bedingten Interventionen liefert die Analyse keinen Hinweis auf einen Zusammenhang.Ferner lieferte die Korrelationsanalyse das Ergebnis, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeitkeinen Zusammenhang zwischen den Mitarbeitervariablen Qualifikation (r=-0,03/Sig.=0,484) und Berufserfahrung (r=-0,074/Sig.=0,086) und dem Schweregrad derSturzfolgen gibt. Dies liefert Hinweise darauf, dass der Schweregrad einer Sturzfolgenicht mit der Qualifikation und oder Berufserfahrung der Pflegeperson beeinflusst wer-den kann. Die nachfolgende Tabelle fasst die Gesamtergebnisse der Analyse zusammenund zeigt in welchen Fällen ein Zusammenhang wahrscheinlich ist und wo ein Zu-sammenhang statistisch nicht nachgewiesen werden konnte.
4. Diskussion
Anhand der durchgeführten Untersuchung konnte belegt werden, dass mittels der inden Einrichtungen vorliegenden Dokumentationen pflegetherapeutische Maßnah-men zur Sturzprävention ermittelt und ausgewertet werden konnten. Limitationen derUntersuchung ergaben sich aus der hohen Dropout Rate und der in der Pflegedoku-mentation nicht zuverlässig vorhandenen Angaben zu Frequenz und Dauer der jeweili-
Beiträge
185
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Korrelationsanalyse nach Spearman-Rho Untersuchungsgegenstand N r Sig.
Mitarbeiterqualifikation Interventionen 545 -0,09 0,036
umgebungsbedingte Interventionen 545 0,003 0,945
personenbedingte Interventionen 545 -0,093 0,030
Ressourcenverbrauch 545 -0,084 0,051
Berufserfahrung in Interventionen 545 -0,498(**) 0,000
Cluster Ressourcenverbrauch 545 -0,483(**) 0,000
Schweregrad Sturzfolgen 545 -0,071 0,097
Qualifikationscluster Schweregrad Sturzfolgen 545 -0,03 0,484
Berufserfahrung Schweregrad Sturzfolgen 545 -0,074 0,086
Umgebungsbedingte Interventionen Schweregrad Sturzfolgen 545 0,029 0,501
personenbedingte Interventionen Schweregrad Sturzfolgen 545 -0,03 0,480
Ressourcenverbrauch Schweregrad Sturzfolgen 545 -0,017 0,697
Korrelationsanalyse nach Pearson Untersuchungsgegenstand N r Sig.
Berufserfahrung Interventionen 545 -0,491(**) 0,000
umgebungsbedingte Interventionen 545 -0,413(**) 0,000
personenbedingte Interventionen 545 -0,45(**) 0,000
Ressourcenverbrauch 545 -0,47(**) 0,000
Interventionen Schweregrad Sturzfolgen 545 -0,023 0,597
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (zweiseitig) signifikant; * Die Korrelation ist auf dem 0,05Niveau signifikant (zweiseitig). Eigene DarstellungTab. 5: Ergebnisse der Korrelationsanalysen
186
Beiträge
gen Maßnahmen. Die Interdependenzanalyse konnte mit den vorhandenen Informa-tionen ebenfalls durchgeführt werden. Im Wesentlichen konnte nachgewiesen werden,dass mit steigender Berufserfahrung der Pflegefachpersonen die Anzahl der geplantenInterventionen und Ressourcen sinkt. Dieses bei gleichen Ergebnissen in den Sturzfol-gen wie die weniger berufserfahrenen Mitarbeiter. Diese planen demnach ökonomischeffizienter. Für die Autoren bildet dieses Ergebnis die Grundlage zu der Annahme, dassaus ökonomischer Sicht Teamkonstellationen von Vorteil sind, in der auf dem Arbeits-bereich erfahrene und weniger berufserfahrene Mitarbeiter zusammenarbeiten. DieGestaltung dieser ökonomischen Ressource nicht dem Zufall zu überlassen scheintsinnvoll. Einerseits bilden organisationale Strukturen, die einen Transfer von Wissenund Erfahrung zwischen den Mitarbeitern gezielt fördern, die Basis für eine möglicheEntwicklung. Anderseits können Maßnahmenplanungen, die von Pflegepersonen mitausreichend Erfahrungswissen durchgeführt werden, deutlich den Ressourcenver-brauch im Sinne der Ausgewogenheit strukturieren (siehe Abbildung 1).
Die statistischen Auswertungen belegen weiterhin, dass mit großer Wahrscheinlichkeitdie Annahme getroffen werden kann, dass ein schwach signifikanter Zusammenhangzwischen dem Qualifikationsniveau und den gewählten Interventionen besteht. Mitsteigender Qualifikation, sinkt die Anzahl der geplanten Interventionen in geringemAusmaß. Im Bezug zum Ressourcenverbrauch ist dieser Zusammenhang nicht nach-weisbar. Das im Rahmen dieser Untersuchung definierte Qualifikationsniveau (sieheAbbildung) der Mitarbeiter, zeigt nach der statistischen Auswertung keinen Einfluss aufdie Sturzfolgen für die Patienten. Die gefundenen Ergebnisse stützen die im HTA-Be-richt formulierten Empfehlungen zur Notwendigkeit robuster Forschungsergebnisseim Bereich der Prozess- und Strukturqualität um Aussagen z. B. zum Einfluss gezielterSchulungen von Mitarbeitern der Pflege machen zu können (Balzer et. al., 2012: 269f ).
Die vorgefundene, sehr heterogene Verteilung der Interventionen im Verhältnis zurQualifikation beruht aus Sicht der Verfasser auf der sehr unklaren Wirkungsweise der
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
- - - -
- - - - -
- -
--
&&
-&-
- - - - - -- -
- - - - - - - - -
8
65)#$4+-3')(3'$(#)(."2&1*#0+-##%/()"".*+,-#()"("'&%$##!"
65)#$4&3"7+-3')(#)(."2&1*#0+-##%/()"".*+,-#()"("'&%$##!"
("'&%$##!"*+,-#()"
+-)"9
'&
*
#+*+%:2(%&"0;(&"6
%$"#"!
0(%="."7*3(=%<
!"#"$%&(&
0(%=".#2(%#*#+>(1
("3')>2"2#*%*% 6*5>"&+-#)"7$+'%@7,%3'*%( &.&"6("'&%$##!"($$# 6#))(+(;>3&"?
Abb. 1: Ansatz zur Steuerung von Ressourcen
Ressourceneinsatz beeinflusst das Ergebnis nicht mehr positiv
Ressourceneinsatz beeinflusst das Ergebnis noch nicht positiv
Verhältnis von Ressourcenverbrauch zum Outcome ist relativ ausgeglichen
Ressourceneinsatz
Aufnahmebefund
Status B
Entlassungsbefund
Status A
Zeit
Statusverände-rung
eigene, erweiterte Darstellung in Anlehnung an Eichhorn 2008
einzelnen Interventionen. Am Beispiel der Leistung „Beratung Sturzrisiko“ wird er-sichtlich, dass diese in der Praxis nicht durchgehend angeboten wird. Auch hier liegtaktuell, (Quelle) kein eindeutiger Wirkungsnachweis vor. Dennoch bietet die Bera-tungsleistung die Möglichkeit, durch Information, Aufklärung zum Sturzrisiko etc. ei-ne deutlich stärkere Beteiligung des Patienten im Behandlungsprozess zu erzielen.Durch diese Sensibilisierung des Patienten besteht die Möglichkeit weitere z. B. perso-nalintensivere Interventionen bedarfsgerechter zu planen. Eine Anpassung des in Ab-bildung dargestellten Kontinuums zwischen Ressourceneinsatz und Ergebnis weiterauszugleichen.
Eine Besonderheit dieser Untersuchung entsteht aus dem Umstand, dass die in derPraxis tatsächlich geplanten Maßnahmen zur Sturzprävention im Rahmen der katam-nestischen Untersuchung erhoben wurden. Nach der durchgeführten Analyse derInterdependenzen kann festgestellt werden, dass zwischen den geplanten Interventio-nen, ausgewertet als Einzelmaßnahme oder als individuell zusammengestellte Maß-nahmenkombination, und den resultierenden Sturzfolgen mit an Sicherheit grenzen-der Wahrscheinlichkeit kein Zusammenhang besteht. Somit liefert die vorgenommeneUntersuchung den Hinweis, dass sich hier in der Versorgungspraxis spiegelt, was im ak-tuellen HTA-Bericht als Ergebnis der Literaturanalyse ermittelt wurde. Es ist unklarinwieweit medizinische oder pflegerische Interventionen die Möglichkeit bieten, einSturzrisiko oder ein Risiko sturzbedingter Verletzungen zu minimieren (Balzer et al,2012: 277f ).
5. Fazit und Ausblick
Die gezielte Einflussnahme innerhalb eines Prozesses, hier der Behandlungsprozess derSturzprophylaxe, setzt voraus, dass die Prozessvariablen bekannt sind. MedizinischeBehandlungsprozesse setzen beispielsweise eine Diagnosestellung voraus. Erst nach derDiagnosestellung kann der Prozess der Behandlung ausgelöst werden. Ein Einflussfak-tor für die Behandlung, wie auch die Diagnosestellung, kann die Qualifikation desLeistungsanbieters/-erbringers (Pflegeperson/Arzt) sein. Das Ergebnis steht wiederumin Abhängigkeit mit dem Leistungsanbieter/-erbringer und ebenso mit dem Leistungs-auslöser (Patient). Wirkungsweisen von Interventionen sind schwer nachzuweisen.Die Untersuchung zeigt, dass die Ressourcen zur Zielerreichung in einem Rahmen be-einflusst werden können, indem das Outcome gleichermaßen erreicht wird. Damitkommt, neben dem aktuellen Wissen über Wirkungsweisen der Interventionen zurSturzprophylaxe, der Berufserfahrung und der Qualifikation der Mitarbeiter in einemTeam eine wesentlichen Bedeutung zu. Die Einrichtung muss diese Leistungen gleich-bleibend oder verbessert unter Einbezug aller Führungskräfte und Mitarbeiter dauer-haft, effizient anbieten können. Es handelt sich folglich um die relative Wirtschaftlich-keit der Leistungserstellung. Zur Verteilung der Ressourcen werden demnach objekti-ve Bewertungskriterien benötigt. (Schär 2009: 144f ) Die benötigte Basis für die in derFolge zu treffenden Entscheidungen bilden dementsprechend differenzierte Informa-tionen über Leistungsprozesse, Ressourceneinsatz, zu erreichende Ergebnis- oder Ziel-
Beiträge
187
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
188
Beiträge
kriterien etc. Wobei es hier von entscheidender Bedeutung ist, die „richtigen“ Informa-tionen zu generieren. Das Ziel muss sein, das als „Paralyse-durch-Analyse“ – Syndrom“bekannte Phänomen zu vieler unspezifischer Informationen, zu verhindern (Braun2007: 32). Der Behandlungs-/Pflegeprozess konnte auf mögliche, relevante Datenanalysiert werden und auf Interdependenzen geprüft werden. Die Zusammenführungdieser Variablen könnte die Basis für eine ergebnisgestützte, im Sinne einer BalancedScorecard (BSC)2 ausgeglichenen Steuerung eben dieser zentralen Prozesse der Leis-tungserstellung sein. Wie in Abbildung 1 dargestellt, ist aus Sicht der Autoren das Er-gebnis dieses Steuerungsprozesses, die Leistung in dem Bereich eines relativen Gleich-gewichts zwischen Ressourceneinsatz und zu erzielendem Ergebnis zu erbringen.
Dabei kann der Ressourceneinsatz auch „noch nicht“, oder „nicht mehr“ das Ergeb-nis positiv beeinflussen. Ein Zusammenhang zwischen den gewählten Interventionund dem erzielten Ergebnis konnte nicht gefunden werden. Die durchgeführten Ana-lysen haben aber gezeigt, dass berufserfahrene Pflegefachpersonen im untersuchtenProzess der Sturzprävention das Verhältnis von Ressourcenverbrauch und Outcome sobeeinflussen, dass dieses als relativ ausgeglichen gelten kann; deutlich zu erkennen dar-an, dass zwar Anzahl und Gesamtminuten der gewählten Interventionen sinken, dasErgebnis „Sturzfolgen“ für den Patienten davon aber unbeeinflusst bleibt. Die Arbeitzeigt, dass mit der vorgenommenen Analyse die Prozesse und deren Ergebnisse transpa-rent dargestellt und Zusammenhänge identifiziert werden können. Anhand der vorge-stellten Ergebnisse wird jedoch auch deutlich, dass eine Vertiefung der Analyse sinnvollist. Eine Studie auf breiterer Datenbasis und Erweiterung des Variablensets soll Auf-schluss geben, in wieweit sich die erhobenen Datensätze zur Analyse und Darstellungeignen und inwieweit das gewählte katamnestische Verfahren für eine prospektiveSteuerung der Leistungserstellung Ansätze liefert. Die Klärung, ob konkrete Behand-lungs- und Versorgungsprozesse fortlaufend erhoben und dargestellt werden könnenund mögliche Steuerungsgrößen zur Beeinflussung der Behandlungs- und Versor-gungsprozesse identifiziert und beschrieben werden können, ist Ziel der Studie Nursesqualification impact on quality and resources in falls prevention (iNQUIRE).
LiteraturBalzer, K./Bremer, M./Schramm, S./Lühmann, D./Raspe, H. (2012): Sturzprophylaxe bei älteren Men-
schen in ihrer persönlichen Wohnumgebung. Schriftenreihe Health Technology Assessment (HTA)in der Bundesrepublik Deutschland. Hg. v. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation undInformation (DIMDI). Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Köln (Band, 116)
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
2 Die Perspektive, dass der Unternehmenserfolg nicht nur durch monetäre Kennzahlen gesteuert werden sollte,betont das Konzept der Balanced Scorecard (>ausgeglichener Berichtsbogen<): Es wird verlangt, dass es ein aus-gewogenes Verhältnis von kurz und langfristigen Zielen, monetären und nicht-monetären Kennzahlen, Spät- undFrühindikatoren sowie externen und internen Perspektiven gibt. […] Diese – eigentlich nicht neuen – Aspekteder Unternehmenssteuerung werden nun jedoch systematisch in ein erweitertes Kennzahlensystem integriert: Dieklassischen Erfolgskriterien wie Umsatz, Gewinn, und Produktivität werden durch weitere Indikatoren ergänzt,z. B.: Kundenzufriedenheit, Qualität der Leistungserstellung, Engagement der Mitarbeiter etc… (Schmalen2002: 184f )
Benner, P./Tanner, C. A./Chesla, C. A./Dreyfus, H. L. (2000): Pflegeexperten. Pflegekompetenz, klini-sches Wissen und alltägliche Ethik. Bern [u.a.]: Huber
Berger, H./Stock, C. (2008): Gesundheitsökonomie, in: Eichhorn, S. (Hrsg.): Krankenhaus-Manage-mentlehre. Theorie und Praxis eines integrierten Konzepts. 1. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer
Braun Reinersdorff, A. von (2007): Strategische Krankenhausführung. Vom Lean Management zum Balanced Hospital Management. 2. Aufl. Bern [u.a.]: Huber
Bourier, G. (2010): Beschreibende Statistik. Praxisorientierte Einführung mit Aufgaben und Lösungen.8. Aufl. Wiesbaden: Gabler
Bortz, J/Schuster, C (2010): Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. 7.Aufl. Berlin: SpringerDeutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (Hrsg) (2013): Expertenstandard Sturzpro-
phylaxe in der Pflege. Osnabrück: Dt. Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege; Fachhoch-schule Osnabrück
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege; Bundesministerium für Gesundheit (2006):Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege. Osnabrück: Dt. Netzwerk für Qualitätsentwicklungin der Pflege; Fachhochschule Osnabrück
Eichhorn, S. (2008): Krankenhausbetriebliche Grundlagen, in: Eichhorn, S. (Hrsg.): Krankenhaus-Ma-nagementlehre. Theorie und Praxis eines integrierten Konzepts. 1. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer
Gigerenzer, G. (2013): Risiko, 4. Aufl. München: Bertelsmann VerlagHaubrock, M. (2009): Vom Gesundheitssystem zur Gesundheitswirtschaft. In: Haubrock, M. / Schär, W.
(Hrsg): Betriebswirtschaft und Management in der Gesundheitswirtschaft. 5. Aufl. Bern: Huber.Isford, M./Klostermann, J./Gehlen, D./Siegling, B. (2014): Pflege-Thermometer 2014. Eine bundeswei-
te Befragung von leitenden Pflegekräften zur Pflege und Patientenversorgung von Menschen mit De-menz im Krankenhaus. Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (Hrsg.): Köln: DIP
Falk, S./Müller-Vorbrüggen, M. (2007): Personalentwicklung, Wissensmanagement und Lernende Or-ganisation in der Praxis. Zusammenhänge Synergien Gestaltungsempfehlungen. Mering: RainerHampp Verlag
Hungenberg, H./Wulf, T. (2006): Grundlagen der Unternehmensführung. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg,New York: Springer
Jorzig, A. (2003): Zur haftungsrechtlichen Problematik von Sturzfällen in Alten- und Pflegeheimen. In:Pflege & Recht PflR 2003 (10)
Kunze, H., Heinz, A., Schepker, R., Grupp, D. (2013): AufPEPPen reicht nicht. In: f&w führen undwirtschaften im Krankenhaus 1/2013, 58-61
Schär, W. (2009): Personalmanagement. In: Haubrock, M./Schär, W. (Hrsg.): Betriebswirtschaft undManagement in der Gesundheitswirtschaft. 5. Aufl. Bern: Huber
Schöffski, O. (Hrsg.) (2008): Gesundheitsökonomische Evaluationen. Mit 86 Abb. und 52 Tab. 3. Aufl.Berlin, Heidelberg: Springer
Schmalen, H. (2002): Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft. 12. Aufl. Stuttgart: Schäffer- Poeschel
Ulrich, R.E. (2005): Demografischer Wandel und Krankheitskosten in Deutschland. In: Badura, B. /Iseringhausen,O (Hrsg.): Wege aus der Krise der Versorgungssituation. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Verlag Hans Huber
Sven-Uwe Gau, B.A. PflegemanagementGottswaldstraße 11b, 77656 Waltersweier, [email protected]
Arndt Schlubach , B.A. Pflegemanagement, stud. M.A. Health AdministrationSt. Viter Str. 4; 59302 Oelde, [email protected] (Korrespondierender Autor)
Beiträge
189
Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Die Autoren erklären, dass sie während der letzten 3 Jahre keine wirtschaftlichen oder persönlichenVerbindungen zu Personen oder Organisationen hatten, deren Interesse vom Manuskript positiv oder negativbetroffen ist.
190
Beiträge Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 21. Jg. 2016 H.2
Anhang
Exemplarische Darstellung zur Ermittlung des Ressourcenverbrauchs/Sturz in Pflege-minuten.
Beispiel: Fall 37, Klinikbereich
Fall 37 weibl./Sturzda-tum: 06.08.2006
Fall aus Klinik
Erhebungen LEP 3.0. Systematik gemittelte Werte in Minuten
Int.-Nr. Beschreibung Ak-ten
LEP 3.0 Nr. Titel LEP 3.0 Ø Fre-quenz/Tag
Ø LEPMin.
ØMin/Tag
1 Assessment 3.6.2.1.1 Assessment-/Anam-nese erheben
1,015206655
13,93649981
14,14842735
2 höhenverstellbaresBett
3.1.3.1.1 Zimmer/Umgebunganpassen/einrichten
3 ausreichende Be-leuchtung
3.9.2.3.3 Zimmer/Umgebunganpassen/einrichten
4 Stolperquellen be-seitigen
3.9.2.3.3 Zimmer/Umgebunganpassen/einrichten
5 Klingel in Reich-weite (Funktionverstanden)
3.9.2.3.3 Zimmer/Umgebunganpassen/einrichten
6 Bett an die Wand 3.9.2.3.3 Zimmer/Umgebunganpassen/einrichten
1,78 6,77 12,04
8 festes Schuhwerk 3.2.2.1.1 Kleidung vor-/nach-bereiten
1,09 3,08 3,35
9 geeignete Klei-dung
3.2.2.4.1 An-/Auskleidetrai-ning durchfuhren
1,19 9,40 11,23
10 Zimmer in Beglei-tung verlassen
3.1.1.2.14 Wegstrecke be-gleiten
1,35 8,79 11,86
14 (Sichere) Lagerungim Bett
3.1.2.1. bis3.1.2.2.4
Diverse Lagerungen 1,37 5,32 7,28
Gesamt Minutenpro Tag
59,91