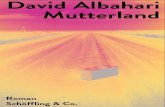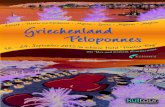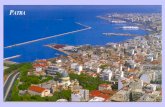TIME KAI DOXA (Ehrungen für hellenistische Herrscher im griechischen Mutterland und in Kleinasien...
Transcript of TIME KAI DOXA (Ehrungen für hellenistische Herrscher im griechischen Mutterland und in Kleinasien...
Das Material / В. Dubia et falsa
des Großen in der hoch- und späthellenistischen Monarchie (1989) 160 ff. Taf. 11, 13-17. Zur Diskussion über die neue Zuweisung der Münzen des Ariarathes V. an Ariarathes IX. überzeugend O. M0rkholm, NumAntCl 4, 1975, 109 ff.; s. ferner ders., SchwNumRu 57, 1978, 144 ff. Die Gegenmeinung wird von B. Simonetta, The Coins of the Cappadocian Kings (1977) 36 f. vertreten.
II. Peloponnes
1. Aigina
KNr.: *303 [E]
1. Attalos I. oder Attalos II. 2. 159-138 V. Chr. 3. Fest Attaleia, Temenos? 4. edd.: K. Pittakis, AEphem 1839, 291 ff. Nr. 343; CIG II Add. 2139 b; A. Rangabé, Antiquités helléniques II (1855) 688; E.L. Hicks, A Manual of Greek Historical Inscriptions (1882) 324 ff. Nr. 189; Michel, Recueil 340; IPergamon 169; IG IV 1,1; OGIS 329 (JLR, Bull. 1964, 172. 1973, 172)
Text: IG IV 1,1.
'AyaÛTji Τύχηι- δ6δ[όχΐ?]ο:ι [r]eî βουλβΐ και [τ]ώι δ[η]μωι· τοΟ δήμου ττάσιν μεν τοις άπεσταλμβνοις èirl τ[ή]ν [ττό]-\ιν ΤΓβττειύαρχηκότος те και, ίφ ' όσον ην δυνατόν, κατηκ[ο]-λουύηκότος ταΐς έκάστων αυτών βουλήσβσιν, καταχ-
5 ΰβντος 06 καΐ Κλέωνος των του βασιλέως ' Αττάλο[υ] φιλαδελφου σωματοφυ[Κ]άκων και μείναντος ετ[η ôe]-καεξ καΐ εν τούτοις άτΓ0δε[ιξι]ν πεποιημενου τ[7)]ς 7Γ[ραγ]-ματικής και της κατά τον βίον ευταξίας. Ισως δε καΐ δ[^ο;ίως] •ΐΐβοσενηνε·^μενου πάσιν μετά της -πάσης καύαρει[ότη]-
10 τος, ουύεν 'εφελκο[με]νον των ιδιωτικών οΰδ' άττ' ορϋής, [/(]ά[ί'] μετ' εξουσίας, iJéXioi'Tjoç ττράττειν, άλλα τα μεν πλείστα [ττει]-ρωμενου συλλύειν, τους δε μ[ή] συλλυομενους άναπεν·κον[τος] ετί τα καλώς καΐ δικαίως νενομούετημενα ήμΙν ύττο τώ[ν jSa]-σιλεων κατά τε τά €t[ç ]ομον κε[χ\ρηματισμενα π[ροσ]-
15 τάγματα καΐ τους νόμους, [δττως] καΐ τώι άσύενεστάτωι [προς] τον δυνατώτατον [καί] τώι δημοτικωτάτωι προς τον ευπο\βώ]-τατον ή ίση υπάρ[χ·ΐ] δι«;α]ω[δ]ο[σί]α, τών τε ά[π]ενενχύεισ[ών] έν τούτοις τοις [ετεσι] δικώί?' τά]ς μεν πλεί[σ]τας εις συλίλυ]-σιν άγηγοχώΐς, τάς δε επ' ο;]ΰ[τόί' ά]νενε^χΰείσας διεξα·γη[Ύθ]-
20 χώς ώστε καΐ [jaáX]a [το]υς τάς δίκας έχοντας εύδοκείν, τ[ήν] τε άλλην άναστ[ροφήν πε]ποιη[με]νος εύσχημόνως και ά[ξί]-ως του τε βασιλέως και τη[ς] πόλεως, κακού μεν είς το δι;ί'[α]-TÒV ούϋενΙ βουληύεΙς παραί[τι]ος Υινεσύαι, [άίγαΐ^οϋ δε κατ[ά το] δίκαιον καΐ κοινή καΐ [ί]δία[ι εκά]στωι, καϋηκολουάηκ[ώς]
25 η εχοντες οί βασιλείς [ή]μών [διαίτελοϋσιΐ' προς την 7Γ0[λιΐ'] προαιρεσει εύαπάντ[ητο]ς γινόμενος τοις τε κατά ττι[ν πό]-
426
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
//. Peloponnes /1. Aigina
λιν καΐ τοις ΐΓαραΎΐνο[μ€νο]ίς παρά του βασιλέως καΐ τω[ν] τοις %αβ€τηδ[ημονσι]· δι' à καΐ 7rX6wra/c[i]ç ό δημο[ς ή]-
[ξ]ίου roiiç βασιλείς μετά ιτρεσβείας, ως με^ιστον αϋτώ[ί'] 30 χαριουμενων τώι [δήμωι], kàv βπιχωρησωσιν μεν[€ΐν] αύτοί!/]
[έ]7Γΐ της ττόλεως- διά те δη ταντα και δια το βίς τα τον βασι-λέως τραύματα [καλώς] καΐ δικαίως άνβστράφϋαι, [ώσ7Γ]6[ρ και] [έ]ί' τοις άλλοις ·π[άσιν, μβτα] καλοκαΎαύίας καΐ δικαιοσ[υ]-[ί']τ;ς· δeδòχύ[aι τηι] βονληι καΐ τώι δ[ή]μωι ίταινίσαι Κλέω[ΐ'α]
35 [Στρ]ατο;γο[ιι] Ώ[ββΎ]α[μην]όν, [τον προσ]τά[την] της τολεως, και τ[ι]-μησαι χ[ρ]υσ[ώι] σ[τεφάνωι καί] βίκόνι χαλκηι άρβτης eveKev [και] [€ν]νοίας, ην Ιχ[ων δι]ατ6λ[6Ϊ καί eiç] τον βασιλέα Ευμβνη και τ[όν\ [jSaJaiXéa 'Άττ[αλο]ϊ' [(ρ]ιλάδ€[λ(ροϊ'] κοά την βασίλισ[σα]ν Στρατο[νί]-[κη]ν και "Α[τ]ταλο[ί' υΐόΐ'] /3α[σιλέω]ς Έ[ϋμ]€νου καΐ τό[ΐ'] δ[ημ]ον τ[όν Αΐ]-
40 [·γιν]ητών καΐ áva[yopeí>eiv ταύτα] ' Ατταλείων κα[ί] Ευμεν[εί]-ων καΐ Νικηφορίων ΐ?υ[μ6λικώι] à[yùvi κ]αΙ Αιονυσί[ω]ν τρ[α]γ(φ)δοΐς [και] την έπιμελειαν ε[κάστοτε €]ΐΐ'α[ι των 'εν άρ]χεΙ όντω[ν] στρατη^/ών. [eî]-ναι δε αυτόν καΐ ΐΓθλί[την και] έ[κγόΐΌυς α]ΰτοϋ και [έγγρ]άι/'ασι9αι φυλής κάί δήμου, ου αν [βούλη]ται, ΰπάρ[χε]ιν δε αΰ[τ]ώι καΐ σίτη-
45 [σ]ιν 'εν πρυτανείωι δια βίου. τον δέ Ύραμμα[τεα τ]ου δήμου ávaypá\¡/ai [ές σ]τήλην, ην σταϋήναι 'εν τώι Άτταλείωι, το δέ ^ενόμενον άϊ'άλ[ω]-[μα] e[tç] те την άναφραφήν καΐ την άνάϋεσιν [μ]ερίσαι τον ταμίαν, της [δέ] άναάεσεως την 'επιμελεια[ν] ττοιήσασϋΐαι] τους στρατηγούς, X-[ϊ'α] τούτων συντελουμένων [φ]ανερός ήι ό δήμος κατα^ίως τιμ[ή]-
50 [σ]ων κατά την εαυτου δύ[ϊ']αμ[ιΐ'] τους άξίως μεν του βασιλέως, [κα]λώς δέ καΐ δικαίως προσφερομενους εαυτώι. ανατεμ-φαι δέ [τό]-
[δε το \Ι/ή]φισμα τους στρατηγούς προς τον βασιλέα, ίνα μετά τής 'ε-κείν[ο]υ γνώμης συντελήται тсс 'εφηφισμενα.
55 Ή βουλή ό δήμος Κλέωνα Στρατάγου ΙΙερΎαμηνόν.
ϋ : Zum guten Glück. Mögen der Rat und das Volk beschließen. Das Volk hat allen, die in die Stadt gesandt wurden, gehorcht und ist, so weit es möglich war, ihren jeweiligen Wünschen gefolgt. (5) Als auch Kleon, einer der Leibwächter des Königs Attalos Philadelphos, eingesetzt wurde und sechzehn Jahre blieb, erbrachten wir auch in dieser Angelegenheit Beweise der politischen und der das Leben betreffen-den Ordnung. Auf angemessene und gerechte Weise brachte er alles mit aller Reinlichkeit zusammen, (10) und zog nichts aus den privaten Einkünften an sich, nicht einmal mit einer gerechten Erlaubnis wollte er (dies) tun, sondern versuchte das meiste zu schlichten. Diejenigen, die Streitigkeiten nicht schlichteten, schickte er nach den bei uns unter den Königen schön und gerecht angeordneten ... die verhandelten Befehle (15) und die Gesetze, damit die gleiche Rechtspflege zwischen den Schwachen und den Starken sowie zwischen den Angehörigen des Volkes und den Wohlhabenden besteht. Von den in diesen Jahren erfolgten Prozessen hat er die meisten geschlichtet, diejenigen, die bei ihm erfolgt waren, hat er geführt, (20) so daß auch diejenigen, die gestraft wurden, großes Wohlgefallen hatten. Sein restliches Benehmen war edel und dem König und der Staat gegenüber würdig, er wollte niemals Urheber von Bösem werden, aber von Gutem gemäß dem Gesetz für alle und für jeden einzelnen Bürger. Er
427
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
Das Material / В. Dubia et falsa
folgte der Gesinnung, (25) die die Könige der Stadt gegenüber hegen, wenn sie sich bei uns aufhalten, begegnete freundlich denjenigen, die in der Stadt wohnten, und denjenigen, die zum König um Hilfe kamen. Daher hat das Volk mehrmals die Könige durch Gesandte gebeten, da sie dem Volk einen großen Gefallen erwiesen hatten, (30) ob sie veranlassen würden, daß er in der Stadt bleibt. Denn er benahm sich in diesen Angelegenheiten sowie in denen des Königs schön und gerecht, wie auch in allen anderen, mit sittlicher Güte und Gerechtigkeit. So mögen der Rat und das Volk beschließen. Man soll Kleon, (35) den Sohn des Stratagos, aus Pergamon, den Beschützer der Stadt, loben und mit einem goldenen Kranz und einem bronzenen Standbild wegen seines vorbildlichen Chrakters und seines Wohlwollens, das er stets dem König Eumenes und König Attalos Philadelphos und der Königin Stratonike und Attalos, dem Sohn des Königs Eumenes und dem Volk der Aigineten gegenüber hegte, auszeichnen. (40) Dies soll am thymelischen Agon der Attaleia und Eumeneia und Nikephoreia und am tragischen Agon der Dionysien ausgerufen werden. Sorge dafür sollen die jeweils amtierenden Strategen tragen. Ferner sollen er und seine Nachkommen das Bürgerrecht erhalten und das Recht, sich in die Phyle und den Demos ein-zutragen, die ihm gutdünken, und er soll auch Speisung im Prytaneion (45) auf Lebenszeit erhalten. Der Schreiber des Volkes soll (diesen Beschluß) auf eine Stele schreiben, die im Attaleion aufgestellt werden soll. Der Schatzmeister soll den für die Eintragung und die Aufstellung nötigen Betrag zuteilen. Die Strategen sollen sich um die Aufstellung kümmern, damit, wenn diese Dinge vollbracht worden sind, (allen) offendkundig sei, daß das Volk die gebührenden Ehrungen nach eigener Möglichkeit (50) denjeni-gen verleiht, die dem König würdig sind, und schön und gerecht denjenigen, die sich nützlich zeigen. Die Strategen sollen diesen Beschluß dem König schicken, damit mit seinem Antrag die Beschlüsse vollstreckt werden. (55) Der Rat
Das Volk Kleon,
den Sohn des Stratagos, aus Pergamon.
K: Ehrendekret vom Volk und Rat der Aigineten für Kleon, den Strategen des Attalos, aus der Regie-rungszeit des Attalos II. Für seine Dienste als Kommandeur erhielt Kleon in Aigina einen Goldkranz, ein bronzenes Standbild, Bürgerrecht und Sitesis. Die Ausrufung sollte bei den Attaleia, Eumeneia (Z. 40-41), Nikephoreia und Dionysia stattfinden; vgl. F. Taeger, Charisma I (1957) 240; R.E. Allen, BSA 66, 1971, 4; zu den seit 183/82 v.Chr. in Pergamon gefeierten Nikephorien s. Hansen, Attalids 465 und hier KNr. 91 [Е]. In Anlehnung an das pergamenische Fest wurden die Nikephorien auch auf Aigina gefeiert. Die Feste Attaleia und Eumeneia werden von Allen, Attalid Kingdom 157 zu den Feiern gezählt, die in Griechenland seit 188 v.Chr. im Rahmen des attalidischen Herrscherkultes abgehalten wurden. Wie Hansen a.O. jedoch bemerkt, muß offen bleiben, ob das Fest Attaleia trotzdem nicht in Zusammenhang mit den um 200 v.Chr. erfolgten kultischen Ehrungen für Attalos I. auf Aigina (= KNr. 51 [E]) zu sehen ist; dafür W. Leschhorn, "Gründer der Stadt" (1984) 248. Fraglich ist ebenso, ob das in Zeile 46 erwähnte Attaleion (ein Temenos?) Attalos I. oder Attalos II. geweiht war; vgl. dazu KNr. *303 [А].
KNr.: *303 [A]
Mit dem inschriftlich belegten Attaleion wird ein Stempel in Zusammenhang gebracht, der den Abdruck AB (mit der Lesung Ά[ττάλου] Β[ασιλ€ως]) trägt; s. dazu G. Welter, AA 69, 1954, 45 f. Es handelt sich dabei um einen ungefirnißten Flachziegel mit aufgebogenen seitlichen Rändern in der Form der
428
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
и. Peloponnes / 2. Geraki
römischen Tegula. Ähnliche Stempel sind in Pergamon reich vertreten, s. dazu die Angaben Welters a.O. 45 Anm. 31. Ferner ders., Ägina (1938) 39 Abb. 36 und ΑΙΓΙΝΑ (1962) 30 Abb. 1 sowie RE II 2 (1896) 2156 s.v. Attaleion (Kern). Der Ziegel wurde in einem Gebäude hellenistischer Zeit am äußersten Westrand des Kolonnahügels gefunden. Dieses Gebäude bestand aus drei (oder vier) Gemächern, die sich um einen rechteckigen Hof gruppierten; in der Mitte des Hofes wurden ein Altar und an der Ostseite zwei Porosbasen gefunden. Durch den Stempel wurde das Gebäude mit dem inschriftlich belegten Attaleion identifiziert und als Sitz des pergamenischen Herrscherkultes auf Aigina gedeutet. Die Zuweisung des Attaleions an Attalos I. kann zwar nicht ausgeschlossen werden, doch muß der Vorschlag Welters hypo-thetisch bleiben; so auch R.E. Allen, BSA 66, 1971, 10 Anm. 55 und Schalles, Untersuchungen 106 Anm. 641.
2. Geraki
KNr.: *304 [E]
1. Antigonos III. Doson 2. ca. 221 V. Chr. 3. Standbild 4. edd.: H.W.J. Tillyard, BSA 11, 1904-1905, 111 f. Nr. 11; IG V 1, 1122; St. Dow/C.F. Edson, HarvStClPhil 48, 1937, 132 Nr. 8
Text: IG V 1, 1122. Βασιλέος 'Avnyóvov Σωτηρος.
Ü: Des Königs Antigonos Soter.
K: Zum historischen Hintergrund s. KNr. 60 [E]; zu Antigonos Doson vgl. auch Plb. 9,36,3. H.W.J. Tillyard, BSA 11, 1904-1905, 112: "It was by this mild policy of conciliation that Antigonus won the goodwill of the Laconians and so gained such honours as our inscription records." Aus Plb. 5,9,1 ff. schließt Tillyard, daß der Titel Soter dem Antigonos posthum verliehen wurde; daraus ergibt sich seiner Meinung nach ein Datum der Inschrift zwischen 221 und 219 v.Chr. Da in der Ehreninschrift kein Weihender genannt wird, kann eine private Weihung nicht ausgeschlossen werden.
KNr.: *304 [A]
Lage/Fundort: Gefunden auf der Akropolis von Geraki (antiker Name: Geronthrae).
Beschreibung: Kleines Fragment einer Statuenbasis; verstümmelt.
Maße: H: 0,16 m; B: 0,13 m.
Material: lokaler, bläulicher Marmor.
429
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
Das Material / В. Dubia et falsa
Lit.: H.J.W. TiUyard, BSA 11, 1904-1905, III f. Nr. 11.
K: Das antike Geronthrae wird von Paus. 3,22,1 ff. erwähnt; dort heißt es, daß sich auf der Akropolis ein Apollontempel befand. Bei dem geringen Umfang des Bruchstücks lassen sich keine Aussagen zum ursprünglichen Aussehen machen. Nach der Weiheformel kann es sich um ein privat gestiftetes Standbild handeln.
3. Olympia
KNr.: *305 [L]
1. Philipp IL, Alexander, Amyntas, Olympias, Eurydike 2. kurz nach 338 v. Chr. 3. goldelfenbeinerne Statuengruppe 4. Paus. 5,17,4; 5,20,9-10
Paus. 5,17,4: Μ^τβκομίσύη δέ αϋτόσβ καΙ ек τον καλουμένου Φίλιττχείου, χρυσού καί ταύτα καΐ ϊΚίφαντος, Εύρυδίκη те ή < ' Αρυδαίου ·γυνη και Όλυμιηάς ·η> Φιλίππου.
ϋ : Nach hier verbracht wurden auch aus dem sog. Philippeion, ebenfalls aus Gold und Elfenbein folgende Statuen, der Eurydike ... Philipps ... (Übersetzung E. Meyer)
Paus. 5,20,9-10: Έστι δε 'εντός της "Αλτεως το <τε> Μητρί^ιον καΐ οίκημα περιφερες ονομαζόμενον ΦιλιππεΙον επί κορυφή δε έστι τοΰ Φιλιππείου μήκων χάλκη σύνδεσμος ταις δοκοις. τοΰτο το οίκημα εστι μεν κατά την εξοδον την κατά το πρυτάνεων εν αριστερή, πεποίη-ται δε οπτής πλίνύου, κίονες δε περί αυτό εστήκασι. Φιλίττττψ δε εποιήϋη μετά το εν Χαιρωνείοί την 'Ελλάδα όλισϋεΐν. κείνται δε αντόύι Φίλιππος τε και 'Αλέξανδρος, συν δέ αΰτοις 'Αμύν-τας Ò Φιλίππου πατήρ· ερ^α δε 'εστι καί ταύτα Κεωχάρους 'ελεφαντος και χρυσού, καϋά καΐ της 'Ολυμπιάδος και Ευρυδίκης ε'ισΙν al εικόνες.
ϋ : Innerhalb der Altis liegen das Metroon und ein rundes Gebäude, das Philippeion heißt; auf der Spitze des Philippeions befindet sich ein bronzener Mohnkopf als Zusammenhalt für die Dachbalken. Dieses Gebäude liegt am Ausgang links vom Prytaneion, es ist aus gebrannten Ziegeln gebaut und wird von Säulen umstanden. Für (oder: von ?) Philipp wurde es errichtet (5) nach dem Zusammenbruch Griechen-lands bei Chaironeia. Dort stehen Philipp und Alexander, zusammen mit ihnen Amyntas, der Vater Philipps. Auch dies sind Werke des Leochares aus Elfenbein und Gold, ebenso wie die Statuen der Olympias und der Eurydike. (Übersetzung Schenkungen KNr. *329 [L])
K: Zur Datierung s. D. Kienast, Zeus und Ammon, in: Zu Alexander d. Gr., Festschrift G. Wirth zum 60. Geburtstag am 9.12.1986 (Hrsg. W. Will 1987) 322 und Schenkungen KNr. *329 [L]. Zum Bau s. Schenkungen KNr. *329 [A]; ferner A. Dinstl in: Götter, Heroen, Herrscher in Lykien (1990) 185; B. Hintzen-Bohlen, Herrscherrepräsentation im Hellenismus (1992) 26 ff.; dies., Jdl 105, 1990, 131 ff. Hintzen-Bohlen inteφretiert den Bau als Stiftung Philipps II. "für seinen Sieg sowie als Zeichen seiner panhellenischen Ambitionen"; s. dazu Schenkungen KNr. 329 [L] + [A] sowie die Diskussion bei E. Badian, Ancient Macedonian Studies in Honour of Ch. Edson (1981) 71; jüngst auch G. Roux, Structure and style of the Rotunda of Arsinoe, in: Samothrace 7 (1992) 192 ff. Abb. 127. Erneut wurde das Philippeion von W. Völker-Jannsen, Kunst und Gesellschaft an den Höfen Alexanders
430
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
//. Peloponnes / 3. Olympia
des Großen und seiner Nachfolger (1993) 128. 141 f. 2 als Baustiftung bezeichnet, die die Kultur-zugehörigkeit Philipps deutlich machen sollte.
KNr.: *305 [A]
4. Rundbasis im Philippeion.
Lage/Fundort: Die Basisblöcke wurden im Rundbau im Nordwesten der Altis gefiinden, wo sie noch heute zu sehen sind.
Beschreibung: Es handelt sich um eine freistehende, kreisbogenförmige Basis für die Aufstellung von mehreren Standbildern. Die Basis besteht aus einer zweistufigen Sockelschicht, einer Orthostaten- und einer Deckschicht.
Erhaltungszustand: Erhalten haben sich insgesamt acht Blöcke der Basis, vier von der Sockelschicht (die beiden Eckblöcke und zwei Mittelsteine) und vier von der Deckschicht mit Plintheneinlassungen; drei davon stammen aus dem Mittelteil, der eine Block stammt von dem einen Ende der Basis. Von der Or-thostatenzone ist kein einziger Block überliefert, doch läßt sich anhand der Dübellöcher an den erhaltenen Blöcken feststellen, daß den Basiskörper insgesamt vier innere und vier äußere Orthostaten bildeten. Da die erhaltenen Blöcke der Sockelschicht Dübellöcher auf ihrer Unterseite aufweisen, muß das Bathron auf einer Fundamentschicht gestanden haben, von der ebenfalls nichts überliefert ist. Das Profil der Sockel-schicht besteht von unten nach oben aus Torus mit Flechtband, aufwärtsgerichtetem lesbischem Kyma, Flammenpalmette und Perlstab, dasjenige der Deckschicht aus Perlstab, Eierstab und Flammenpalmette.
Maße: rekonstruierte H: 1,84 m; В (an den Außenkanten gemessen): ca. 4,50 m; T: 0,46 m; H des Sockels: 0,463 m; H der Deckschicht: 0,451 m.
Material: parischer Marmor.
Lit.: F. Adler in: Olympia II (1892) 132 f. Abb. 7 Taf. 82, 2-3. - К. Gebauer, AM 63/64, 1938/39, 70 ff. - H. Sclileif/ H. Zschietzschmaim, OF I (1944) 21 f. 51 f. Taf. 17. - G. Kleiner, Jdl 65/66, 1950/51, 212 Abb. 3. - E.B. Harrison, Hesperia 29, 1960 , 382 ff. - M. Wegner, Schmuckbasen des antiken Rom (1966) Taf. I b. - Jacob-Felsch, Statuenbasen 66 f. 68 Anm. 215 b 2; 70 f. 186 Kat. II 102. - A.H. Borbein, Jdl 88, 1973, 66 f. - V. v.Graeve, AA 1973, 244 ff. Abb. 1-14. - ders., AM 89, 1974, 239. - K. Fittschen, Katalog der antiken Skulpturen in Sclüoss Erbach, AF 3 (1977) 23 mit Anm. 14. - M. Andronikos, The Royal Graves at Vergina (1978) 40. - H.L. Schanz, Greek Sculptural Groups Archaic and Classical (1980) 18 ff. - J. Ganzert, Jdl 98, 1983, 154 f. Abb. 74; 163 Anm. 166. - B.S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture: The Problem of the Originals (1984) 56 f. - Schalles, Untersuchungen 130 f. 135 Anm. 776. - F. SeUer, Die griechische Tholos (1986) 98. 101 f. - B. SchmidtDounas, Egnatia 1, 1989, 106 f. - B. Hintzen-Bohlen, Jdl 105, 1990, 131 ff. Abb. 1. - Fr. Rumscheid, Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauomamentik des Hellenismus. Beiträge zur Erschließung hellenistischer und kaiserzeitlicher Skulptur imd Architektur (1994) 1 51. 66. 135 II. 92 Nr. 371 Taf. 197, 6-7. - Schenkungen KNr. *329 [E] + [А]. - D. Wannagat, Säule und Kontext (1995) 32 f.
K: Anhand der erhaltenen Blöcke läßt sich der Radius der Basis (innerer Kreisbogen: 1,735 m) genau feststellen und somit der Abstand der Basis von der Wand des Rundbaus ermitteln. Wie aus der Rekon-struktion von F. Seiler hervorgeht, nahm die Höhe der Basis Bezug auf die innere Wandgliederung des Philippeion, indem einerseits das Bathron der Höhe des Wandsockels entsprach, andererseits die auf dem Batrhon stehenden Statuen vor und zwischen den korinthischen Halbsäulen der Wandzone aufgereiht waren. Daraus läßt sich ableiten, daß die statuarische Gruppe zwar frei im Raum stand, jedoch eindeutig mit dem Bau zusammen konzipiert war. Laut Seiler a.O. 98 "stellt sich in dem Philippeion eine nahezu
431
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
Das Material / В. Dubia et falsa
perfekte Inszenierung der chryselephantinen Statuengruppe dar, die im Brennpunkt der gesamten Raumkonzeption stand." Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Rundbau und Statuenbasis geht aus der Verwendung des parischen Marmors vor, der bei der Tholos beim Stufenbelag der Krepis, dem Ringhal-lenpflaster, dem Wandfußglied und dem Dachrand vorkommt (Adler a.O. 130). Die Basis war wie eine gekrümmte Wand gestaltet, sie bestand aus drei Schichten und wies Profile auf, die beim Rundbau nicht vorkommen. Das lesbische Kymation stellt eine Mischung von Formelementen verschiedener Landschaften (kleinasiatisch, attisch und pelopoimesisch) dar, bei der das Mutterländische dominiert; s. dazu Ganzert a.O. Zur Ornamentabfolge s. Rumscheid a.O. 135. Von Miller a.O. 183 f. wurde die Basis des Philippeion aufgrund der Profile, die nur dort vorkommen, dem Leochares oder seiner Werkstatt zugeschrieben. Jedoch wird ebenda in Anm. 379 vermerkt: "On the other hand, an altar or a stele, perhaps connected with the Palace, was found at the Vergina Palace and has similar moul-dings, partly carved (...). The lower part is still preserved. This might suggest that it was not Leochares but a Macedonian who carved the statue base as well." Die Statuen der Olympias und der Eurydike wurden zu unbekannter Zeit und aus unbekannten Gründen in das Heraion verlegt, wo sie Pausanias sah (Paus. 5,17,4). Über die Anordnung der Statuen auf der Basis können nur Vermutungen angestellt werden; von den meisten Forschern wird angenommen, daß die Statue Alexanders d.Gr. die Mitte der Gruppe einnahm und von Amyntas und Eurydike auf der einen Seite, von Philipp und Olympias auf der anderen Seite gerahmt war (Zschietzschmann a.O. 51 f.; Borbein a.O. 66 Anm. 105; Schalles, Untersuchungen 131; Hintzen-Bohlen a.O. 131 f.; s. aber Seiler a.O. 98 Anm. 411). Borbein inteφretiert die Statuen als kostbare Weihgeschenke und den Bau als Schatzhaus. "Auch die kostbare Mischtechnik der Statuen könnte als Wiederaufiiahme einer alten Tradition verstanden werden" (Borbein a.O. 67 Anm. 107). Für die Statue Alexanders wurden Alexanderbildnisse herangezogen, die dem Typus Erbach-Athen-Berlin angehören; s. dazu Smith, HRP 15 Anm. 9; 155 f. Nr. 2; D. Kreikenbom, Griechische und römische Kolossalporträts bis zum späten 1. Jh. n. Chr., 27. Ergh. Jdl (1992) 13 ff.; s. ferner Schenkungen KNr. *329 [A] und hier KNr. *295 [А]. Zum Material der Statuengruppe s. Seiler a.O.
KNr.: *306 [E]
1. Nereis und Gelon 2. um 230 V. Chr. 3. Statuengruppe 4. edd.: K. Purgold, AZ 38, 1880, 63 Nr. 355; lOlympia 310; Syll. 148; Syll.^ 204 (Syll.^ 393; vgl. Pomtow zu Syll.^ 453); Schenkungen KNr. 61 [Е]. Olympia Inv. 743
Text: s. Schenkungen KNr. 61 [Е].
K: Von Dittenberger und Purgold wurde vermutet - und die Inschrift entsprechend ergänzt -, daß es sich bei dem länglichen Basisblock in Olympia um eine städtische Ehrung der Olympias und ihres Bruders und Gatten Alexandros II. handelt. Das vorliegende Monument wurde jedoch etwa 230 v.Chr. von Gelon und der Tochter des Pyrrhos II. in Olympia dem Zeus geweiht; eine ähnliche Gruppe ist für Delphi über-liefert; s. dazu Schenkungen KNr. 61 [E] + [A]. Unter Führung des Thrasybulos (vgl. P. Lévèque, Pyrrhos, BEFAR 185 [1957] 588) trat Elis auf die Seite des Pyrrhos über. Nach Paus. 6,14,9 stand in Olympia eine Ehrenstatue des Pyrrhos, die von Thrasybulos gestiftet war (vielleicht 273/72 v.Chr.); s. F. Eckstein, Pausanias Reisen in Griechenland IP (1987) 290 f. Anm. 46.
432
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
II. Peloponnes / 3. Olympia
KNr.: *306 [A]
Lage/Fundort: Gefunden in Olympia, verbaut in einer späteren Mauer "30 Schritt südlich von der sechsten der Zanesbasen". Die Basis befindet sich heute vor der Echohalle und südlich vom Schatzhaus VIII.
Beschreibung: Es handelt sich um einen länglichen Basisblock mit Ehreninschrift. Die Vorder- und die Rückseite zeigen einen ringsum laufenden Randbeschlag von 0,03 m Breite. Auf der Oberseite am linken Rand befinden sich zwei Dübellöcher, welche zur Verklammerung mit einem anstoßenden Block dienten; die linke Seite ist als Anstoßfläche bearbeitet. An der rechten hinteren Ecke der Oberfläche ist noch eine Standspur in Gestalt eines ovalen Loches vorhanden, wonach anzunehmen ist, daß auch rechts ein weiterer Block folgte.
Erhaltungszustand: Erhalten hat sich nur ein Block, dessen rechte Seite in späterer Zeit umgearbeitet wurde: Der Stein wurde umgedreht und als Oberblock einer Basis benutzt, dabei ging der Schluß der Inschrift verloren. Auf der ursprünglichen Rückseite sind die Reste einer Hebebosse noch zu erkennen. Vertiefungen zur Befestigung einer Statue, die die ursprüngliche Unterseite aufweist, gehören ebenfalls zur zweiten Verwendung des Blockes, ebenso die römische Profilierung der ursprünglichen linken Seite des Blockes mit kurzer Fortsetzung auf der Rückseite.
Maße: H: 0,295 m; B: 0,98 m; T: 0,93 m (hinten 0,88 m).
Material: grauer Kalkstein.
Lit.: К. Purgold, AZ 38, 1880, 63 Nr. 355. - lOlympia 310. - B. Hintzen-Bolüen, Herrscherrepräsentation im HeUenismus (1992) 117. 222 Nr. 26. - Schenkungen KNr. 61 [А].
K: Es handelt sich um ein langgestrecktes, aus drei oder mehreren Blöcken zusammegesetztes Bathron, auf dem eine statuarische Gruppe aufgestellt war; zu den mehrteiligen Statuenbasen s. Tuchelt, Frühe Denkmäler 51 ff. Zur Wiederverwendung von Statuenbasen s. Blanck, Wiederverwendung; Tuchelt a.O. 54 ff.
KNr.: *307 [E]
1. Sohn des Pyrrhos (Alexander IL?) 2. Mitte 3. Jh. V. Chr.? 3. Standbild 4. ed.: lOlympia 311. Olympia Inv. 1001
Βασ[ιλέα , βασιλέως] Ώ.υ{βρον υών, ].
Ü: König ..., Sohn des Königs Pyrrhos, ...
K: Siehe den Kommentar in KNr. *306 [Е]. Nach Material und Schriftcharakter gehört der Block nicht zu lOlympia 310; s. dazu lOlympia 311. Welcher Sohn des Pyrrhos in dem Denkmal verewigt wurde und aus welchem Anlaß, ist unbekannt.
433
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
Das Material / В. Dubia et falsa
KNr.: *307 [A]
Lage/Fundort: Gefunden am Pelopion; das Fragment befindet sich heute im Magazin des Olympia-Museums.
Beschreibung: Basisblocic mit Inschriftenresten.
Erhaltungszustand: Erhalten hat sich nur ein Fragment von der linken oberen Ecke mit einem Teil der Inschrift.
Maße: H: 0,14 m; B: 0,19 m; T: 0,06 m.
Material: gelber Kalkstein.
LH.: lOlympia 311.
K: Siehe den Kommentar in lOlympia 311; im Gegensatz zum grauen Kalkstein von der Basis KNr. *306 [E] haben wir hier gelben, weichen Kalkstein. Wegen des stark fi-agmentierten Zustandes des Bruchstückes läßt sich kein Urteil zum Typus der Basis gewinnen. Ebenso lassen die Anfangsbuchstaben der ersten Zeile nicht erkennen, ob der König im Nominativ oder im Akkusativ erscheint und ent-sprechend, ob es sich um eine Weihung oder eine Ehrung handelt.
KNr.: *308 [L]
1. Ptolemäer 2. 323-283 V. Chr. 3. Standbilder 4. Paus. 6,15,10; 6,16,9
Paus. 6,15,10: "Ощ óè τταρ6στηκασιν oí παίδες, τούτον μεν ΊΙτολεμαΙον τον Λάγου φασΙν είναι- τίαρα δε αυτόν ανδριάντες δύο ανδρός είσιν 'Ηλείου Κάπρου του Πυι?αγόροι;, πάλης τε είΚηφότος καΐ τταγκρατίου στεψανον επί ημέρας της αΰτης.
ϋ : Der, neben dem seine Söhne stehen, sei Ptolemaios, der Sohn des Lagos, sagt man; neben ihm stehen zwei Statuen des Eleers Kapros, des Sohnes des Pythagoras, der am selben Tag den Kranz im Ringkampf und Pankration erhielt. (Übersetzung E. Meyer)
Paus. 6,16,9: 'Εφεξής δε ΤΙτολεμαιός τε εστίν άναβεβηκως ΐππον καΐ παρ' αυτόν Ηλείος άΰλητής ΐίαιάνιος ό Ααματρίου πάλης τε 'εν Όλυμπίοί καΐ τάς δυο ϋυΰικάς άνηρημενος νι-κάς.
ϋ : Weiter folgen der Reihe nach: Ptolemaios zu Pferde, neben ihm der elische Athlet Paianios, Sohn des Damatrios, der als Ringer einmal in Olympia und zweimal in Delphi siegreich war. (Übersetzung E. Meyer)
434
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
II. Peloponnes / 3. Olympia
K: Von Pausanias werden Statuen der Ptolemäer ohne nähere Angaben aufgezählt, so läßt sich nicht feststellen, ob es sich um öffentlich oder privat gestiftete Denkmäler handelt. Paus. 6,15,10 spricht vom Standbild des Ptolemaios I., in 6,16,9 wird dagegen ein Ptolemäer zu Pferde genannt wird. Nach dem Kommentar des Periegeten könnten diese Statuen westlich des Tempels gestanden haben. Eine weitere Statue des Ptolemaios I., die Aristolaos aus Makedonien gestiftet hatte, wird von Pausanias 17,3 erwähnt: Πτολεμαίοι' ôè τον ΤΙτοΧεμαίου του Λάγου Άριστόλαος άνβϋηκβ Μακεδώ?* άνηρ. Ein Weihgeschenk des Ptolemaios I. Soter ist ebenfalls durch Pausanias (6,3,1) überliefert, vgl. dazu Schenkungen KNr. 57 [L]; zu weiteren Schenkungen der frühen Ptolemäer in Olympia s. Schenkungen KNr. 58 [E] + [A] und 59 [E] + [A].
KNr.: *309 [E]
1. Ptolemäer 2. 2. Jh. V. Chr. 3. Standbild 4. ed.: lOlympia 313. Inv. 714
[ ßaoLXea Πτολε]μαΐθί' [ , TÒV èavTOÎ! άδε]λ<ρόν.
Ü: ... König Ptolemaios ... seinen eigenen Bruder.
K: lOlympia 313: "Welcher Ptolemaier zu verstehen ist, bleibt ungewiß, nur deuten die Schriftzüge eher auf das zweite als auf das dritte Jahrhundert v. Chr. Deshalb und aus anderen Gründen ist in Z. 2 an die Ergänzung [Φιλάδε]λ(ίί5θί' nicht zu denken." Nach dem Wortlaut der zweiten Zeile ("seinen eigenen Bruder") wäre hier eine königliche Weihung am ehesten denkbar.
KNr.: *309 [A]
Lage/Fundort: Geftmden im Osten der Echohalle; heute im Magazin des Museums von Olympia.
Beschreibung: Kleines Fragment vom rechten Rand eines Basisblockes mit Ehreninschrift.
Erhaltungszustand: Auf der Oberseite befinden sich rechts Verklammerungsspuren für den anschließen-den Block.
Maße: H: 0,25 m; B: 0,18 m; T: 0,19 m.
Material: grauer Kalkstein, wie KNr. *306 [А].
Lit.: lOlympia 313.
K: Der verstümmelte Zustand des Fragments ermöglicht keine Aussagen zum Typus der Basis.
435
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
Das Material / В. Dubia et falsa
4. Korinthischer Bund
KNr.: *310 [E]
1. Antigonos I. Monophthalmos und Demetrios I. Poliorketes 2. 302 V. Chr.? 3. Agone?
4. edd.: L. Robert, Hellenica 2, 1946, 15 ff.; G. Daux, AEphem 1953-54, 245 ff.
Photo: Daux 251.
Text: Robert. Άδβίμαντος βασιλά Αημητρίωι xaípeív. Τό те φήφισμα δ 'εττβποίηντο οί 'Αμφικτίονβς π... ΣΓ., τΓβούβντβς μϊν kv Ίσύμίοις, βπίκυρώσαντβς δέ ev Αβλφοΐς, ά·π€σ[τ\α\κα καΰάτΓβρ ωΐου òeiv . δέ και τάς жара των φίλων έπιστολάς, ίνα -καρακολουϋης βκάστοις ON àvaypâxpavTaç
ΕΙΣ [ Ύ]€νόμβνον δοΎμα ΓΠΙ ...ΑΙΟΝ[... έΐΓ]6ποιήκ6ΐμεΐ' èv τώι Σ]....κ]ο;1 τα yeyovÒTa δημ....
5 [ 7Γ]αρά των Άμφίκτώ[νων] Π ΣΘΗ П..ca. 16 ONBOYA..ca. 9
Ü: Adeimantos grüßt König Demetrios. Den Beschluß, den die Amphiktyonen gefaßt haben ... der in Isthmia vorgelegt und in Delphi bestätigt wurde, habe ich geschickt, an wen es sich gehört ... und die Briefe bei den Freunden, damit du jeder ... folgen kannst ... der gefaßte Beschluß ...
K: Die Inschrift stammt aus Delphi; zur Datierung (162-150 oder 146-125 v.Chr.) s. L. Robert, Hellenica 2, 1946, 15 ff.; G. Daux, AEphem 1953-54, 245 ff. Die Ergänzung Roberts in Zeile 4 ev τώι σ[υν£δρίωι bildet den einzigen Anhaltspunkt für die Annahme, daß die Bundesversammlung die Eiiu-ich-tung von Agonen zu Ehren der ersten Antigoniden beschloß; vgl. aber die Lesung von Daux, die diese Annahme ausschließt. Skeptisch dazu auch Habicht, Gottmenschentum 78 f. Zu Geldspenden des Demetrios an Korinth s. Schenkungen KNr. 41 [L] -I- 42 [L]. Z. 4: TÒ yevóμevov δίτομα ccvaüelvai о κ[αί βπ]€ποιήκειμεν kv ΤΟΙΣ [-] Daux. Zu Korinth allgemein M. Sakellariou/N. Faraklas, Corinthia - Cleonae (1971) 107 ff.; J. Wiseman, ANRW II 7,1 (1979) 438 ff.
5. Methana
KNr.: *311 [E]
1. Ptolemaios VI. Philometor und Kleopatra 2. etwa 162 ν. Chr. 3. Kult? 4. edd.: CIG 1191; J. Letronne, Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte pendant la domination des Grecs et des Romains (1823) 463; F. Lenormant, RhMus 2, 1866, 395 Nr. 346; Syll. 232; P. Jamot, BCH 13, 1889, 190 Nr. 16; M.L. Strack, Die Dynastie der Ptolemäer (1897) 250 Nr. 92; IG IV 854.
Text: IG IV 854.
436
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
/ / . Peloponnes / 6. Sikyon
' Yirep βασιλβως ΐΙτόΚβμαίου καί [β]ασίλίσσης Κλεοπάτρας ύβών φίλομ[η]-τόρων /с[а]1 [τω]ν τ{ίκ]νω[ν] αυτών ΰεοίς to[îç] μεγάλοις [Τ]ι[μ]αΐος [τ]ών [φ\ΐΚίύν [κ]αΙ οΐ συνατο-[αταΧΚίντίς α[ύτ]ώι ταρ([φ\({ό]ρί{ΰ]σαι 'βξ Άλ[ε ] -
[ξ]ανδράας 'e[w]i
ϋ : Für den König Ptolemaios und die Königin Kleopatra, die Theoi Philometores, und ihre Kinder, (weihen) den Großen Göttern Timaios, einer der Freunde, und die mit ihm als Reserve geschicicten aus Alexandrien ...
K : Es handelt sich um eine Marmorstele mit Profilleiste, eine Privatweihung des Timaios, des Funktio-närs des Ptolemaios VI. Philometor. Nach der Weiheformel könnte die Stele zu einem Altar gehört haben; zu ähnlichen Marmorstelen mit der Formel νπβρ βασιλέως vgl. M.L. Strack, ArchPF 1, 1901, 200 ff.; H. Hommel, Chiron 6, 1976, 321 Anm. 5; H. Schaaf, Untersuchungen zu Gebäudestiftungen im Hellenismus (1992) 37 Anm. 236; vgl. ferner den umstrittenen Rundaltar aus Sestos mit ähnlicher Weiheformel: OGIS 88; P. Frisch, IvK 3, 117 ff. Nr. 44; S.G. Cole, Theoi Megaloi: The Cult of the Great Gods at Samothrace (1984) 65. 162 Nr. 46. Schon Η. Lolling, AM 6, 1881, 211 erkannte, daß solche Weihungen aus dem persönlichen Verhältnis der Stifter zur Dynastie der Ptolemäer erklärt werden müssen. Die Bezeichnung ύεών φιλομητόρων gehört in den Bereich des offiziellen dynastischen Kultes der Ptolemäer und impliziert somit keinen städtischen Kult des Ptolemaios VI. und der Kleopatra in Methana. Der Kopf des Ptolemaios VI. aus dem Meer bei Aigina (Athener Nationalmuseum, Inv. Aiy. 108) ist von J. Six, AM 12, 1887, 212 ff. Taf. 7-8 mit dieser Inschrift in Zusammenhang gebracht und als Weihung gedeutet worden; vgl. dazu F. Hiller v. Gaertringen, Thera I. (1899) 169; Kyrieleis, Ptolemäer 37. 59 ff. 174 F 1 Taf. 47,1-3; Smith, HRP 93. 170 Nr. 71 Taf. 46,2; P. Moreno, Scultura ellenistica II (1994) 701 Abb. 865; Schenkungen KNr. 386 [А].
6. Sikyon
K N r . : *312 [L]
1. Demetrios I. Poliorketes 2 . 303 v.Chr. 3. Kultstattie? 4. Plin. NH 34,67
Plin. NH 34,67: Huius porro discipulus fuit Tisicrates, et ipse Sicyonius, sed Lysippi sectae propior, ut vix discernantur complura signa, ceu senex Thebanus et Demetrius rex, Peucestes, Alexandri Magni servator, dignus tanta gloria.
Ü: Ein Schüler von ihm war ferner Teisikrates, ebenfalls aus Sikyon, welcher aber der Schule des Lysippos nähersteht, so daß man mehrere Werke kaum auseinanderhalten kann, wie z.B. einen thebani-schen Greis, den König Demetrios und Peukestes, den Retter Alexanders des Großen, der einer so großen Ehre würdig war. (Übersetzung R. König)
437
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
Das Material / В. Dubia et falsa
K: Zu den kultischen Auszeichnungen des Demetrios in Sikyon s. KNr. 79 [L], Für die Verbindung dieser Kultehren mit dem von Plinius überlieferten Standbild des Makedonenkönigs in Sikyon (so z.B. Habicht, Gottmenschentum 74 Anm. 1) gibt es keine Anhaltspunkte; s. ferner dazu KNr. *312 [А].
KNr.: *312 [A]
4. Bronzestatuette in Neapel
Lage/Fundort: Gefiinden in Herculaneum, heute in Neapel, Mus.Naz. Inv.Nr. 5026.
Beschreibung: Statuette einer mit Chlamys bekleideten, jugendlichen Gestalt mit Schnürrstiefeln im Typus des Pan. Die Figur ist auf die Seitenansicht konzipiert: Sie hat den rechten Fuß auf einen Felsblock gestellt und stützt den rechten Arm auf den Unterschenkel auf. Unterhalb der Haarbinde wachsen über der Stirnmitte ein Paar Bockshörner, die den Dargestellten dem Hirtengott Pan angleichen. Demnach wäre in der rechten Hand das Attribut Pans, das Lagobolon, zu ergänzen.
Erhaltungzustand: Die Figur ist bis auf den verloren gegangenen Gegenstand in der rechten Hand vollständig erhalten.
Maße: H: 0,33 m.
Material: Bronze.
Lit.: Α. Ruesch, Guida iUustrata del Museo Nazionale di Napoli (1980) Nr. 1606. - A.J.B. Wace, JHS 25. 1905, 87. - С. Watzin-ger, Expedition E. v.Sieglin III В (1927) 9 f. - Η. Thiersch, Pro Samothrake, SBWien 212,1,1930, 62 f. - RE V A (1934) 150 s.v. Teisikrates (Lippold). - Thieme-Becker XXXIII (1939) 217 s.v. Tisikrates (Bieber). - Ch. Picard, RA 6. Ser. 22, 1944, 5 ff. Abb. 1-2 (mit älterer Literatur). - ders., MonPiot 41, 1946, 78. 84. 90. - Ph.W. Lehmann, Statues on Coins (1946) 31 f. Taf. 6 Abb. 3-5 (mit älterer Literatur). -G. Lippold, Die griechische Plastik, HdArch III, 1 (1950) 295 Anm. 15 Taf. 105,1. - E. Will, Délos XXII (1955) 173 f. - W.-H. Schuchhardt, Die Epochen der griechischen Plastik (1959) 119 f. Abb. 94. - M. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age^ (1961) 50 f. Abb. 149. - Α. Rumpf, AM 78, 1963, 192 ff. Beil. 89, 3.4 (mit älterer Literatur). -Richter, Portraits III 256 Abb. 1743. - EAA VII (1966) 665 Abb. 784 s.v. Teisikrates (Moreno). - С. Wehrli, Antigonos et Démétrios (1968) 225 ff. Taf. 11. - J. Charbonneaux/R. Martin/F. ViUard, Das hellenistische Griechenland (1971) 248. 250 Abb. 286. -5. Adamo Muscettola in: Bronzes hellénistiques et romaines. Tradition et renouveau (Cahiers d'archéologie romande 17, 1979) 87. 90. - В. Viemeisel-Schlörb, Glyptothek München. Katalog der Skulpturen II. Klassische Skulpturen des 5. und 4. Jhs. v. Chr. (1979) 462 ff. - P. Zanker, Gymnasium 86, 1979, 355 f. Taf. I a. - Ph.W. Lehmann, GettyMusJ 8, 1980, 112 f. Abb. 13. 14. -E. Dontas, AntK 26, 1983, 124. - ders., ÖJh 54, 1983, 95 f. - C. Rolley, Die griechischen Bronzen (1984) 196 Abb. 175. -H.P. Laubscher, AM 100, 1985, 336 ff. Taf. 68,1; 69,1. - Himmelmann, Herrscher und Athlet 231 Nr. 17 mit Abb. - Smith, HRP 64. 154 Nr. 10. - B.S. Ridgway, Hellenistic Sculpture I. The Styles of ca. 331-200 B.C. (1990) 125 ff. - N. Himmehnann, Ideale Nacktheit in der griechischen Kimst, 26. Ergh. Jdl (1990) 81 Anm. 177. - N. Marquardt, Pan in der hellenistischen und kaiserzeith-chen Plastik (1995) 311 ff. Taf. 31,3.- D. Svenson, DarsteUungen hellenistischer Könige mit Götterattributen (1995) 48 ff. 216 Nr. 60 Taf. 22-23.
К: Für den alten Vorschlag, daß die Bronzestatuette mit der von Plinius überlieferten und von Teisikrates geschaffenen Statue des Königs in Sikyon identisch sei (vor allem Picard [1944] und Rumpf), wofür das lysippische Standmotiv der Statuette sowie der aufgestützte Poseidon auf Münzen des Demetrios Pol-iorketes sprechen würde (s. dazu E.T. Newell, The Coinages of Demetrius Poliorcetes [1978]) gibt es keine Anhaltspunkte; s. dazu Ridgway.
438
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
//. Peloponnes / 6. Sikyon
Es handelt sich um eine in republikanischer Zeit (50-40 v.Chr.) gearbeitete Statuette (s. dazu Laubscher a.O. 338 Anm. 25), die auf ein großplastisches Vorbild des späten 4. - frühen 3. Jhs.v.Chr. zurückgeht; damit vergleichbar sind die Bronzefragmente von der Athener Agora KNr. *296 [A], die in frühhelleni-stische Zeit datiert werden. Für den Dargestellten sind unterschiedliche Herrscher in Betracht gezogen worden; s. den Überblick bei Marquardt a.O. Die Deutung des Dargestellten als Demetrios Poliorketes beruht auf dem nicht überzeugenden Vergleich mit einer Marmorbüste aus der Pisonenvilla bei Hercula-neum (Laubscher a.O. 336 ff.; zu den Porträts der Pisonenvilla s. Smith, HRP 70 ff. Taf. 4-10), welche ihrerseits mit Hilfe von Münzbildnissen des Herrschers als Demetrios L benannt wird. Kürzlich wurde eine Zuweisung an Antigonos IL Gonatas vorgeschlagen (Himmelmann [1990] mit weiteren Angaben). Die Darstellungsweise spricht für einen Soldatenkönig, in dessen Selbstdarstellung der Gott Pan eine Rolle gespielt haben muß. Nachweislich ist dies, nach den Ergebnissen von Marquardt a.O. 309 ff., bei Antigonos IL Gonatas und Pyrrhos von Epirus der Fall. Der militärische Aspekt solcher Darstellungen läßt sich mit dem Funktionsbereich des Pan als Verbreiter "panischen" Schreckens und Schlachtenhelfers vereinbaren; s. dazu Laubscher und Marquardt. Jüngst wurde von Marquardt a.O. 314 f. ein neuer Benennungsvorschlag als Bildnis des Pyrrhos unterbreitet.
KNr.: *313 [E]
1. Philipp V. 2. 221-216 v. Chr. 3. Standbild 4. edd.: H. Earle, CIR 6, 1892, 133; IG IV 427; St. Dow/C.F. Edson, HarvStClPhil 48, 1937, 131 f. Nr. 7; SEG 11, 247; A.S. Arvanitopoullos, Prakt 1908, 147 f. Nr. 6; Marcadé, Signatures II 129 ff.
Photo: Marcadé 130.
Text: Marcadé.
Βασιλέα Φίλ < ι > ttttoj' βΥασιΚέως Αημητρίου -] θοινίας Ύβισικρά[τους ].
ϋ : Den König Philipp, den Sohn des Königs Demetrios... (weiht) Thoinias, der Sohn des Teisikrates, ...
K: Z. 1-2: [ό δάμος των Σικυωνίων άν€ΰηκ6] ßaoiXea Φίλ<ι>π·κον β[ασιλ€ος Ααματρίου Ma/ceóóra] Dow/Edson. Die Ergänzung Βασιλέα Φίλ < t > ttttoí' /ΐ[ασιλ6ος Ααματρίου ò δήμος. | θοινίας Ύβίσίκρά[τους βττοίησβ] wurde von Marcadé mit guten Gründen abgelehnt: Die Anbringung der Künst-lerinschrift direkt unter dem Namen des Königs ist für öffentliche Ehrenstatuen hellenistischer Zeit unüblich. Folglich läßt sich Thoinias als Dedikant der Statue auffassen, womit hier eine private Weihung vorliegt. Thoinias soll sich zeitweilig am Hof Philipps V. aufgehalten haben; s. dazu S. Le Bohec, L'entourage royale à la cour des Antigonides, in: Le système palatial en orient, en Grèce et à Rome, Actes du Colloque de Strasbourg 1985 (1987) 325; H. Müller, Chiron 19, 1989, 516 ff.; M. Sève, REG 104, 1991, 232 ff. Zu Philipp V. in Sikyon: Plb. 5,27,3; Plu.Arat. 46-47; s. ferner Walbank, Philipp V 60 f.; A. Griffith, Sikyon (1982) 83 f.
439
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM
Das Material / В. Dubia et falsa
KNr.: *313 [A]
Lage/Fundort: Gefunden im Dorf Vasilikó, verbaut in einem modernen Haus; heute im Museum von Sikyon.
Beschreibung: Es handelt sich um den Block einer Statuenbasis.
Erhaltunsgzustand: Erhalten ist die Bodenplatte mit einfach geschwungenem Profil und Inschrift auf der Vorderseite. Auf der Oberseite der Platte ist ein rechteckiges Zapfloch mit Gußkanal zu sehen.
Maße: H:0,29 m; B: 0,82 m; T: 0,51 m.
Material: weißer Marmor.
Lit.: Α.S. ArvanitopouUos, Prakt 1908, 147 f. Nr. 6. - Marcadé, Signatures II 129 ff. mit Abb.
K: Zum Künstler Thoinias, Sohn des Teisikrates, aus Sikyon, dessen Künstlerinschrift auf mehreren Statuenbasen überliefert ist, s. Marcadé, Signatures II 128 ff. Es handelt sich offensichtlich um eine zusammengesetzte Statuenbasis. Der Anbringungsort der Inschrift, welche die Statue als eine Privatwei-hung des Thionias präsentiert, ist für Statuenbasen, die von öffentlicher Seite errichtet wurden, unüblich.
7. Megara
KNr.: *314 [L]
1. Alexander d. Gr. 2. 333 - 331 V. Chr. 3. Bürgerrecht? 4. Plu. Mor. 826 С
"Ως φαμίν Άλβξάνδρφ τοΧιτείαν Μεγαρείς φηφίσασϋαι· του δ' εις γέλωτα ΰβμβνου την στΓουδην αυτών, eiireîv εκείνους on μόνφ ττρότερον την πολιτείαν ΉρακλεΙ και μετ' εκείνον αύτφ φηφίσαιντο· τον δε ύαυμάσαντα δεξασΰαι το τίμιον εν τφ στανίφ ηϋεμενον.
ϋ : Wie wir meinen, gewährten die Megarer in einer Abstimmung Alexander das Bürgerrecht; als dieser sich über ihren Eifer lustig machte, sagten sie, sie hätten bisher das Bürgerrecht nur Herakles verliehen und nun ihm (sc. Alexander); erstaunt nahm Alexander das Privileg an, weil es selten verliehen wurde.
K: Von Gauthier, Les cités grecques 44 wurde auf den anekdotenhaften Charakter dieser Plutarchnotiz aufmerksam gemacht; zur historischen Situation s. B.M. Kingsley, ZPE 66, 1986, 165 ff. Stewart, Faces of Power 118. 120. 209 ff. hat mit der Plutarchstelle den sog. Getty-Alexander (ebenda Farbtafel 2) in Verbindung gebracht, der somit als Teil einer Weihgeschenkgrappe zu denken wäre. Der Fundort des Kopfes (Megara?) ist jedoch unsicher.
440
Brought to you by | University of St Andrews ScotlandAuthenticated
Download Date | 12/9/14 12:41 AM