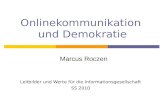Tsvasman2006 Informationsgesellschaft Artikel
Click here to load reader
-
Upload
leon-tsvasman -
Category
Technology
-
view
451 -
download
0
description
Transcript of Tsvasman2006 Informationsgesellschaft Artikel

134
von I.-Systemen für multimediale An-wendungen. Schwerpunkt sind audiovi-suelle Medien (u.a. Ton, Bild) und deren digitale Gewinnung, Übertragung und Wiedergabe (Kommunikationstechnolo-gie, ↑ Netzwerktechnik ). Medieni. ist im Wesentl. eine stark anwendungsorientier-te und inter-/multidisziplinäre Wiss., an der u.a. die Disziplinen I., Audio-/Video -↑ Technik, Gestaltung, Ergonomie und Management beteiligt sind. Kernaufgaben sind u.a. die Entwicklung und der Betrieb netzgestützter Informationssysteme („On-line-Medien“, z.B. im world wide web) und die Entwicklung von „Offl ine-Medien“, z.B. auf CD /DVD und sonstigen multime-diafähigen Informationsspeichern.
Günter Franke
>>Kommunikationstechnik; Infor ma ti ons-tech nologie; Medienkonzeption; Kommunika-tionspraxis; Interkulturelle Wirtschaftskom-munikation; Mediennetzwerke; Kybernetik; Kommunikative Kompetenz; Databasemar-keting; Customer Relationship Management.
Literatur: BLEICH H. (2005): Bosse der Fasern. Die In-frastruktur des Internet, in: c‘t 7/2005, S. 88-93. CO-MER, D. (2004): Computernetzwerke und Internets, München/London. GUMM, H.-P., SOMMER, M. (2004): Einführung in die Informatik, München. KAUFFELS, F.-J. (2003): Lokale Netze, 2 Bde., Bonn. KERSKEN, S. (2005): Handbuch für Fachinformatiker, Bonn. MEI-NEL, CH., SACK, H. (2004): WWW-Kommunikation, Internetworking, Web-Technologien, Berlin, Heidel-berg, New York. SCHNEIDER, U., WERNER, D. (2004): Taschenbuch der Informatik, Leipzig. STEINMETZ, R. (1999): Multimedia Technologie – Grundlagen, Kom-ponenten und Systeme, Berlin et al. VDI (1991): Tech-nikbewertung: Begriffe und Grundlagen (Richtlinie 3780), Düsseldorf. WERNER M. (2002): Information und Codierung, Braunschweig/Wiesbaden. WERNER M. (2003): Nachrichtentechnik, Braunschweig, Wies-baden. [Internetquellen] Webseiten der Gesellschaft für Informatik: http://www.gi-ev.de. Webseiten der IEEE: http://standards.ieee.org.
Informationsgesellschaft [information society]
Grundsätzlich handelt es sich bei dem Konzept der „I.“ um eine diagnostisch (be-stimmend) motivierte Idee, die den Kom-plex der aktuell als evident geltenden in-terdisziplinären wiss. Vorhersagen über die beobachtbaren Tendenzen erfasst, die sich auf der Basis der radikalen techno-logischen Innovationen (↑ Informations- und. Kommunikationstechnologie) ent-falten, sowie zunehmend alle Komplexe der Vergesellschaftung (Wirtschaft, Kul-tur, Politik sowie Alltag bzw. Lebenswei-se) betreffen: In den Leitmedien werden sie gerne mittels quantitativer Angaben wie differenzierte statistische Explikati-onen, z.B. zu den kontinuierlich steigen-den Zahlen der Internetnutzer etc. veran-schaulicht.
[Informationsgesellschaft als trans-disziplinäres Konzept] Die Bezeich-nung „I.“ setzte sich durch, obwohl sie nur auf die ökonom. bedeutende quanti-tative Zunahme der Informationen – ggf. ihrer Komplexität – hinweist, das gesamte Ausmaß des beobachtbaren gesellschaftl. Wandels jedoch nicht ausreichend reprä-sentiert. Noch weniger ausführlich sind parallel verwendete Bezeichnungen wie Wissens-, Erlebnis- oder Risikogesell-schaft, die lediglich Teiltendenzen der beobachtbaren Entwicklung ansprechen. Die Bezeichnung ↑ Mediengesellschaft wird – analog zu dem interaktionistisch geprägten Begriff Kommunikationsge-sellschaft – parallel oder in Verbindung mit „I.“ verwendet und betont die quali-tative Tendenz zur Autonomisierung ei-nes eigendynamischen/„eigensinnigen“ Mediensystems, welches zunehmend die gesamte Ges. durchdringt und, system-theoret.-konstruktivistisch betrachtet, die Wirklichkeitskonstruktion bestimmt.
Die Kernkategorie Information schließt für E. v. ↑ Glasersfeld „alle möglichen For-
Informatik/Informationsgesellschaft
LEXIKONSATZ.indd 134LEXIKONSATZ.indd 134 17.10.2006 08:19:4917.10.2006 08:19:49

135
men von Wissen ein, insbesondere Wis-sen, das zur Aus- oder Weiterführung von Handlungen oder Denkvorgängen nötig ist“ (s. auch ↑ Informationsübertragung und ↑ Wissen als Konstrukt ) und wird über den Begriff „Differenz“ mit Verweis auf Shands (1967) als ‚anything that makes a difference’ defi niert (s. auch ↑ Kommu-nikation und ↑ Informationstheorie). Der im diagnostisch-prognostischen Konzept der „I.“ thematisierte Wandel, der gesamt-gesellschaftl. Prozesse wie Medialisierung (s. ↑ Medialität), Virtualisierung , Kom-merzialisierung , Individualisierung und Erlebnisorientierung (s. ↑ Erlebnis) um-fasst, kann aus dem quantitativ verstan-denen Konzept der „Information“ kaum allein abgeleitet werden.
Zum Verständnis der mit dem Teil-begriff Gesellschaft gemeinten gesell-schaftl. Evolutionsphase kann die These von ↑ Luhmann (1975: 16) beitragen, dass die „Hauptphasen der gesellschaftlichen Evolution […] durch Veränderungen in den jeweils dominierenden Kommuni-kationsweisen“ gekennzeichnet sind und dass komplexere Gesellschaftssysteme erst durch neuartige Kommunikations-formen integriert und aufrechterhalten werden. Entscheidend ist bei Luhmann (1970, 1975) das Verständnis von Ge-sellschaft als ein umfassendes Sozial-system , das er als die Menge aller Kom-munikationen defi niert, die prinzipiell füreinander erreichbar sind. Im Hinblick auf die techn. ermöglichte Verbreitung bzw. Verfl echtung von Kommunikation geht er von einer Weltgesellschaft aus. (Vgl. Marcinkowski 2002). Eine transsoziologi-sche (im Sinne einer Integrationswissen-schaft) und ausgeprägt kritische Analyse der ↑ Öffentlichkeit als zentrale Kategorie einer bürgerlichen Ges. gibt außerdem ↑ Habermas (1962) in „Strukturwandel der Öffentlichkeit“, wo er frühbürgerli-che und spätkapitalistische Öffentlichkei-ten (kritische vs. manipulative Publizi-tät) am Beispiel der Medienentwicklung seit Mitte des 19. Jh. unterscheidet und den deutlichen Wandel im 20. Jh. durch Reichweite, Wirksamkeit, Finanzierungs-
art und Organisationsform der audiovisu-ellen Medien beobachtet. Im Zusammen-hang mit der Theorie des kommunikativen Handelns (Habermas 1981) genießt die Habermas’sche Forschung gegenwär-tig einen hohen Stellenwert für das Ver-ständnis des Zusammenwirkens von Ges. und Kommunikation.
Im aktuellen Diskurs zur I. „prüft“ das reduktionistische Paradigma, inwiefern die I. allein auf die Technologieentwicklung zurückgeführt werden kann. Parallel neigen immer mehr Forscher dazu, die Emergenz (Entstehung der neuen Qua-litäten − Strukturen o. Eigenschaften − eines Ganzen, die nicht allein aus ihren Bestandteilen ableitbar/erklärbar sind) im Bezug auf die I. anzuerkennen: Infol-ge der technologisch forcierten Optimie-rung der kommunikativen Netzwerke ,verändern sich auch die grundlegenden Relevanzstrukturen der soz. Wirklichkeit (s. auch ↑ Mediengesellschaft ), die das ge-genwärtige Konzept der „I.“ tendenziell transdisziplinär (gemeinsame Konzep-te von Wissenschaftlichkeit) und mindes-tens interdisziplinär (fachübergreifende Ansätze) anlegen, sowie prinzipiell holis-tisch (ganzheitlich) und inhaltlich wei-testgehend offen machen.
Im Folgenden wird die diagnostische Qualität des Ausgangsbegriffs (terminus a quo) durch den prognostisch motivier-ten Ausblick des Zielbegriffs (terminus ad quem) ergänzt, um das Konzept der I. sei-nem globalen Anspruch entsprechend zu positionieren.
[Historischer Defi nition sdiskurs]Obwohl selbst keine Prämisse von Wis-senschaftlichkeit, zählt die Diagnose- und Vorhersagekraft traditionell zu den Vorzü-gen wiss. Erkenntnis. Vor allem bestätigte Prognosen werden für den Beweis aufge-stellter Thesen instrumentalisiert; Vorher-sagen erscheinen deshalb methodologisch nützlich: Durch ihre Bestätigung – als In-diz für die Richtigkeit – gewinnen Theori-en an Geltung.
Aus diesem Grund wird der seit den 1960er Jahren vor allem in Japan und den USA bekannt gewordene diagnostisch
Informationsgesellschaft
LEXIKONSATZ.indd 135LEXIKONSATZ.indd 135 17.10.2006 08:19:4917.10.2006 08:19:49

136
fundierte Komplex der „Informationsge-sellschaft “ als ein wiss. tragbarer Begriff verwendet. Als „information economy“ etablierte sich dieses Konzept zuerst im wirtschaftlichen Kontext, später wurde er von der Politik (politics) anerkannt und zunehmend gesellschaftswiss. konzeptu-alisiert.
Analog zu der Idee der Industriege-sellschaft , die im 19. Jh. als historisch neuartige Gesellschaftsform entdeckt wurde (vgl. etwa Claude Henri de Saint Simon, Auguste Comte und Herbert Spencer), wird I. als ein gesellschaftl. Mo-dell konzeptualisiert, das sich innerhalb der Dienstleistungsgesellschaft entfaltet und die Industriegesellschaft ablöste.
[Klassische Ansätze von I.] Die ge-genwärtig tradierte Idee der I. stammt, historisch gesehen, aus mehreren the-oret. Konzepten seit den 60er Jahren des 20. Jh. Steinbicker (2001) verweist u.a. auf vier grundlegende Ansätze: (1) Das „Johoka Shakai “-Konzept von Tadao Umesao (verfasst 1963 in Japan) bezeichnet die „Industrialisierung des Geistes“ als eine universale Stufe in der Evolution der Menschheit. (2) Der Ent-wurf der „Wissensgesellschaft “ von F. Drucker, einleitend dargestellt in The Age of Discontinuity (1969), zählt ↑ Wissen und Information zu den basalen Ressourcender modernen Ges. (3) Das analytische Schema der „post-industriellen Ge-sellschaft“ beschreibt D. Bell systema-tisch in The Coming of Post-Industrial Society(1976) als tiefgreifenden Strukturwandel der Industriegesellschaft . Bell konzipiert die „post-industrielle Gesellschaft “als eine Dienstleistungs-, Wissens- und kommunale Ges. (4) Die Theorie der „In-formationellen Gesellschaft“ von M. Castells, beschrieben in einer Trilogie un-ter dem Gesamttitel The Information Age(Castells 1996, 97, 98), umfasst eine ein-schlägige Analyse des aufkommenden In-formationszeitalters. Die treibende Kraft des Wandels beschreibt der Autor als Zu-sammenwirken dreier unabhängiger Ent-wicklungen seit dem Ende der 60er Jahre: (a) die revolutionäre ↑ Informationstech-
nologie führt zum „Informationalis-mus “, der neuen materiellen Basis der Ges.; (b) Die Restrukturierung des öko-nom. Systems führt zum „globalen in-formationellen Kapitalismus“; (c) Eine „Kultur realer Virtualität“ kommt auf. (Vgl. Steinbicker 2001: 17-108).
[I. als sozial-ökonomisches Gesell-schaftsmodell] Analog zu den marxisti-schen Gesellschaftsmodellen bestimmen in den meisten im Diskurs etablierten Klassifi kationen primär die wirtschaftl. Faktoren (Produktionsverhältnisse) die Gesellschaftsform. So wird mit dem Be-griff „Industriegesellschaft “ der hist. Wandel von einer landwirtschaftl. zu ei-ner maschinellen Massenproduktion er-fasst. Das Konzept bezieht sich vor allem auf das marktorientierte Modell (Kapi-talismus); nach dem Zweiten Weltkrieg wurde jedoch zwischen kapitalistischen und sozialistischen Industriegesellschaf-ten unterschieden. Ab Ende des 20. Jh. wird zunehmend eine „post-industriel-le“ Dienstleistungsgesellschaft konzipiert, weil ihre Anzeichen − der Rückgang von industriespezifi schen Tätigkeiten die Zu-nahme an Dienstleistungen − gut beob-achtbar werden.
Der Begriff I. verweist somit primär auf ein Gesellschaftsmodell, das sich auf der Grundlage der Kommunikations- und In-formationstechnologien bzw. −infrastruk-turen entfaltet, welche eine offene, inter-aktive, verteilte, billige, leistungsfähige, kompatible, fehlertolerante, multimediale, benutzerfreundliche Informationstechnik (vgl. Capurro 1995) und speziell ↑ Netz-werktechnik ermöglichen und demzu-folge wirtschaftl., pol., soz. und kulturelle Prozesse auf eine revolutionäre Weise de-terminieren. Als Kernpunkte dieser Ent-wicklung gelten radikale Innovationen der Netzwerktechnik, die Konvergenz von ↑ Interaktionsmedien bzw. Telematik ,Datenverarbeitung, Informations-, Kom-munikations- und Medien-Technologien. Allein das Internet zieht umfassende öko-nom., pol. und soz. Auswirkungen nach sich. Die Folgen dieser radikalen Innova-tionen sind in den Markt- und Verwal-
Informationsgesellschaft
LEXIKONSATZ.indd 136LEXIKONSATZ.indd 136 17.10.2006 08:19:5017.10.2006 08:19:50

137
tungsstrukturen (governance) erkennbar. Sie wirken sich auf die Sicherheit (security)aus und offenbaren die Empfi ndlichkeit und Zerbrechlichkeit der I. (zumindest in ihrer aktuellen Phase).
Informationstechnologien revolutio-nierten in wenigen Jahren nahezu alle Lebensbereiche und Wirtschaftsbran-chen. Ohne sie ist inzwischen weder hochtechnologische Produktions- und Logistikoptimierung (R. Wagner 1996 er-wähnt die sog. just-in-time-Produktion als „fertigungssynchrone Beschaffung der Vorleistungen bei kleinstmöglicher Lager-haltung“ als Beispiel) noch Businesspro-zessoptimierungen (markführend sind u.a. Oracle, SAP und IBM) oder etwa On-line-Marketing (s. auch ↑ Dialogmarke-ting) denkbar. In den meisten Architektur- oder Maschinenbaubereichen ermöglicht „computergestützte Konstruktion“ mit-hilfe von CAD-Systemen (Computer Aided Design) bahnbrechende Lösungen. Fast in allen Branchen sind mittlerweise (Online-)Datenbanklösungen und Con-tent Management Systeme (CMS) im Einsatz, die informations- bzw. datenin-tensive Arbeitsabläufe effektiv stützen. Fortschrittliche Arbeits-, Lern- und Ver-waltungmodelle wie ↑ Telearbeit, E-Lear-ning oder E-Government sind ebenfalls neuen Informationstechnologien zu ver-danken. Und nicht zuletzt sind es ↑ In-teraktionsmedien (darunter telematische Anwendungen), die unser Alltag mittler-weile sichtbar verändert haben. Neben diesen und anderen – seit Ende des letzten Jh. in den sog. Industrieges. offensichtlich gewordenen (nicht nur wirtschafftlichen) – Vorzügen der Informationstechnologie wurden globale sozialökonom. Folgen evident.
Systematisch betrachtet sieht Kaase (1999) an der Schwelle des Jahrtausends neben der [i] wachsenden wirtschaftl. Bedeutung des Informationssektors, [ii] in der exponentiellen Zunahme der na-turwissenschaftlichen Erkenntnisse, [iii] dem raschen Anstieg verfügbarer In-formationen durch Datennetze, [iv] der
Entwicklung zu integrierten Multimedia -Universaldiensten, [v] der massenhaften Aneignung von Basisqualifi kationen zur Beschaffung, Nutzung und Aktualisie-rung von Informationen, und schließlich [vi] der Informatisierung aller Berufe und ihrer höheren Wissensintensität Faktoren gesellschaftlicher Veränderung.
Die fortschreitende Vernetzungskomp-lexität der Industrie und des Finanzsek-tors scheint Produktions- und Beschäf-tigungsverhältnisse weltweit radikal zu verändern und (geografi sch) zu verla-gern. Erheblich sind auch Forschung und ↑ Bildung betroffen: Revolutionäre Forschungsmethoden und −perspektiven werden realisierbar (z.B. Genom- und Proteom-Forschung), weil sie Verfahren entwickeln/optimieren (Gentechnik), die u.a. hoch profi table Wirtschaftszweige (z.B. Bio-, Nanotechnologie) versprechen. Beinahe alle Wirtschaftsbranchen (Ge-sundheits-, Energie-, Umweltbereiche) sind längerfristig an den „Hochtechnolo-gien“ interessiert. Auch Architektur/Städ-tebau wird sich revolutionieren, weil sich auch diese Branchen den neuen Lebens-, Arbeits- (↑ Telearbeit ) und somit auch den Wohnbedingungen anpassen werden (Arbeiten zu Hause). Die gesamte Ent-wicklung relativiert auch fundamentale soz.-philos. Paradigmen (Diskussion über die sog. Bioethik ). Andererseits erzwingt die Herausforderung, immer umfassende-re ökonom. Prozesse zu koordinieren, die Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Poli-tik, Kultur und Religion dazu, rechtzeitig die Weichen von der Nationalökonomie zur Weltwirtschaft zu stellen, um die „kritische“ Phase der Globalisierung soz.- und umweltpol. verträglich zu machen. (Vgl. Walterskirchen 2005: 257)
Das sozioökonom. Potential der I. ist so-mit vielgestaltig; seine Entfaltung hängt davon ab, inwieweit die transdisziplinär orientierten Wissenschaften (darunter die ↑ Kommunikationswissenschaft ) die mannigfaltigen Antriebskräfte der o.g. Prozesse erkennen und wie gut bzw. un-mittelbar Politik und Wirtschaft ihre sozi-
Informationsgesellschaft
LEXIKONSATZ.indd 137LEXIKONSATZ.indd 137 17.10.2006 08:19:5017.10.2006 08:19:50

138
oökonom. Regulationsmöglichkeiten ent-sprechend der gesicherten Erkenntnisse nutzen.
[↑ Öffentlichkeit und I.] Der vor al-lem soziol. bzw. pol. tradierte Begriff der Öffentlichkeit, der prinzipiell als Gesamt-heit der (an einem Ereignis direkt oder indirekt) teilnehmenden Personen ver-standen wird, verliert zunehmend sei-ne traditionelle Bedeutung einer Öffent-lichkeit (vgl. Fohrmann/Orzessek, Hrsg., 2002): Die vernetzungsbedingte Dissozi-ation (Aufspaltung) in mehrere multiple oder diffuse Medien- oder Teilöffentlichkeitenist insbesondere im neuen öffentl. Medi-um Internet beobachtbar, welches virtu-elle Räume schafft und unterhält. Auch im Singular verwendet, meint der Begriff Öffentlichkeit deshalb diese neuartige Plu-ralität.
Oft ablehnend-kritisch bis enthusias-tisch rezepiert ist die Entfaltung der I. in der o.g. Bedeutung weder in der öffentl. noch in der wiss. Diskussion kaum be-streitbar, denn die qualitativen Wandlun-gen werden in ihrer Nachhaltigkeit – ent-sprechend der aktuell als wiss. geltenden ↑ Methoden – empirisch nachweisbar: Sowohl qualitativ/quantitativ, soziol. oder systemtheoret. begründete Beobachtun-gen liefern mittlerweile eine gesicherte Grundlage für die Wissenschaftlichkeit des Begriffs der I. (Schink 2003). Dis-kutiert werden vor allem die sichtbaren Folgen der weltweit beobachtbaren öko-nom.-infrastrukturellen Tendenzen (Glo-balisierung), sowie ihre strategisch-pol. Regulationsmöglichkeiten (Investitionen, Gesetzgebung, Präventivmaßnahmen) z.B. in Bezug auf die Standort-, Sicher-heits-, Bildungs- oder Erziehungspolitik.
Neben den wirtschaftl. oder kultur-bezogenen Fragestellungen beschäftigen vor allem neue Sicherheitsprobleme die ↑ Öffentlichkeit, die in Verbindung mit I. auftreten: Ernsthaft diskutiert werden Problemkomplexe der Datensicherheit wie Schutz gegen Computerviren, Abwehr gegen das sog. Spamming oder Phishing.Als Motive für diese spezifi schen Tatbe-
stände gelten Spionage und Sabotage, die meistens von professionellen Hackern be-trieben werden.
Für viele Beobachter gelten globale Vernetzung, Medialisierung und Virtuali-sierung als infrastrukturelle Faktoren, die die aktuelle Form und das Ausmaß des fundamentalistisch motivierten Terroris-mus erst ermöglichen. So formieren sich islamistische Terrorgruppen zunehmend als dezentrierte, selbständig agierende Netzwerke , virtuell gekoppelt durch ge-meinsame Ideologieansätze. Auch die Medienwirksamkeit der Terrorakte spielt eine Rolle im modernen Terrorismus.Der Erfolg der aktuellen Strategien, der Terrorabwehr, Verkehrs- und Veranstal-tungssicherheit mit einschließt, basiert zunehmend auf dem Verständnis dieser Mechanismen. Präventionsmaßnahmen offenbaren neben den ethischen auch menschen- (Schutz der Privatsphäre) und medienrechtliche Fragen (↑ Medienrecht ).
Von der Seite der Unterhaltungs- und Softwareindustrie wird zunehmend das sog. Raubkopieren der kommerziellen In-formations- und Medienprodukte beklagt, was kontroverse Diskussionen hervor-bringt. Neben der Kriminalisierung und Verfolgung solcher Delikte werden funda-mentale Eigenschaften des intellektuellen Eigentums (z.B. prinzipiell unbegrenzte und nur mühsam begrenzbare Kopierbar-keit der Texte, Bilder, Dateien) diskutiert und somit nach neuen Modellen – wie Open-Source-Bewegungen im Softwarebe-reich etwa mit dem weltweit verbreiteten Betriebssystem Linux – gesucht.
Immer stärker rücken kriminelle De-likte in die öffentl. Diskussion, die für die aktuelle Phase der I. charakteristisch sind: Aus rechtlicher Sicht erfasst das Bundes-ministerium des Innern (BMI) unter dem Begriff „Internet-Kriminalität“ vor allem die Verbreitung von Kinderpornografi e, Volksverhetzung, extremistischer Pro-paganda , Kreditkartenbetrug, verbote-nem Glücksspiel (s. auch ↑ Spiel ) bis hin zu unlauterer Werbung, Urheberrechts-verletzungen und dem illegalen Verkauf
Informationsgesellschaft
LEXIKONSATZ.indd 138LEXIKONSATZ.indd 138 17.10.2006 08:19:5117.10.2006 08:19:51

139
von Waffen, Betäubungsmitteln und Me-dikamenten. Die sog. „Hackingdelikte“ werden als Angriffe verstanden, die sich gegen die Infrastruktur oder die Verfüg-barkeit von Dienstleistungen im Internet richten.
Trotz der oft kontroversen öffentl. Dis-kussion über den Regulationsbedarf der I. ist im internationalen soziol. Diskurs tendenziell eine ausgewogene Haltung gegenüber der Technologieentwicklung beobachtbar, die z.B. mit dem von Cas-tells 1996 als „Kranzberg’s fi rst law“ for-mulierten Lehrsatz erfasst werden kann: „technology is neither good nor bad“. Die-se prinzipielle Haltung resultiert aus der Komplexität der technogenen Prozesse, die aktuell weder eindeutig transdiszip-linär diagnostiziert noch prognostiziert werden können.
[Potential der I.] Das oben bereits eingehend skizzierte Konzept der I. er-weist sich zunehmend als (wiss.) brauch-bar, da es hilft, gesellschaftsübergreifende Zusammenhänge zu erklären, die auf der Grundlage einer Reihe von (postmodernen)Tendenzen existenziell bedeutend werden und die „psychische, kognitive, organisa-torische und technologische“ Eigenart der neuen Epoche formen (vgl. Walterskir-chen 2005: 255). Seit einigen Jahren gilt die I. als eingetreten, obschon nicht voll-ständig entfaltet (vgl. Schink 2003). Neue Tendenzen wie Informationsverdichtung, Medialisierung , Virtualisierung , Kom-merzialisierung , Individualisierung und Erlebnisorientierung lassen sich erkennen. Ihre Folge- oder Parallelentwicklungen wie eine Pluralisierung von Lebensstilen, die besonders in Jugendkulturen (artifi cial tribes, vgl. Farin 2001) beobachtbar wird, die zunehmende Risikoorientierung (Ex-tremsportarten, Börsenspekulationen) oder etwa der psychologische Narzissmus als Motivationsfaktor persönlicher Iden-titätsdynamik werden zu Forschungsge-genständen. Aus diesen Tendenzen wer-den neue Bezeichnungen wie „Zeitalter der Jugend“ oder „Risikogesellschaft“ ab-geleitet. (Vgl. Walterskirchen 2005).
Eine mutige Vision lieferte P. Teilhard de Chardin in den 1920er Jahren in sei-nem Aufsatz „Mensch im Kosmos“ (neu-ere Aufl . 1999), in dem er die aus der Vernetzung der Menschheit resultieren-de Verwandlung der Erde in eine Sozi-osphäre erläutert. Er beschreibt das Ziel unserer Evolution als das mit Hilfe der Technik erreichbare Zusammenwachsen der Einzelwesen zu einem denkenden Gemeinwesen, das er Noosphäre nennt; das Konzept wurde z.B. von Wernad-ski (1926) weiterentwickelt. ↑ McLuhan (1979) defi niert Noosphäre als „ein technisches Gehirn für die Welt“.
Auf internationalen Symposien und in zahlreichen Aufsatzsammlungen zur I. werden mittlerweile Visionen und Sze-narien diskutiert, die Potential (vor al-lem Chancen und Herausforderungen, aber auch Konfl ikte und Risiken) der I. im Hinblick auf die wirtschaftl., pol. und kulturelle Regulation, Gestaltung und Anpassung veranschaulichen. Die meis-ten von ihnen betreffen erkenntnisthe-oret., wirtschaftliche, kulturelle, soziale, pol. und didaktische Paradigmen und Prozesse sowie unterschiedl. Interessen-gruppen.
Ferner fördern Modernisierungspro-zesse des Informationszeitalters neuar-tige Konfl iktpotentiale der gesellschaftl. Macht eliten: Weil sich der Inhalt, die Reichweite, die Dauerhaftigkeit und die Repräsentation von Interessen ändern, führt der Verlust des Gleichgewichts zwi-schen institutionalisierten Interessenkon-fl ikten und einer durch Konsenseliten getragenen gesellschaftl. Stabilität zur Spannung zwischen „sektoralen“ (auch Teil- oder Funktionseliten genannt) und „gesamt-gesellschaftlichen“ (konsensuell bzw. allg. anerkannten) Eliten (vgl. Hitz-ler 2004).
Je nach Stellenwert, den man der In-formationsprozessen und der Kommuni-kation in der Ges. zuschreibt, lassen sich die meisten Ansätze (neben der optimis-tischen/pessimistischen Haltung zur I.) nach „Radikalität“ des Wandels systema-
Informationsgesellschaft
LEXIKONSATZ.indd 139LEXIKONSATZ.indd 139 17.10.2006 08:19:5117.10.2006 08:19:51

140
tisieren, den sie für möglich halten: Wenn die systemtheoret. Betrachtung nach ↑ Luhmann (1970, 1975) die Ges. im We-sentlichen als selbstregulierendes (autopoi-etisches) Kommunikationssystem versteht, kann die technogene Intensivierung des letzteren die Relevanzstrukturen der Ges. verwandeln oder die soz. Wirklichkeit (mit ihren intersubjektiven Konstrukten wie Zeit, s.↑ Konzeptuelle Zeitkonstrukti-on , Raum, Dinglichkeit bzw. Objektwelt, s.↑ Objektivität ) erneuern. Besonders in kybernetisch und kognitivistisch inspirierten Modellen, die (wahrnehmungsbezoge-nes) ↑ Wissen als „Konstruktion von In-varianten“ verstehen, „mit deren Hilfe der Organismus seine Erfahrungen assimilie-ren und organisieren kann“ (Richards/v. Glasersfeld 2000: 194), wird die Ges., die sich „aus den kommunikativen Interak-tionsweisen individueller kognitiver We-sen“ (Roth 2000: 284) aufbaut, ebenfalls als kognitives Konstrukt verstanden. Der radikal-konstruktivistische Diskurs nach J. Piaget, H. ↑ Maturana , E. v. ↑ Glasersfeld, S. J. ↑ Schmidt, G. Roth, P. Hejl liefert plausible Erklärungsmodelle dafür, wie Menschen ihre (soz.) Wirklichkeit(en) konstruieren.
Die Entfaltung des Potentials einer I. schöpft aus dem Zusammenwirken von Prinzipien der Selbstregulation (Ma-turana spricht von Autopoiese) − z.B. im Bezug auf die kognitiv-intersubjektiven Systeme − und der soz. Konstruktionder viablen („lebbaren“, „gangbaren“, vgl. v. Glasersfeld) Wirklichkeit. Beide sind ambivalent, also weder „positiv“ noch „negativ“ vorbestimmt. Die Chancen lie-gen in der Verwirklichungskraft des Men-schen, der seine Welt u.a. durch tätige Se-lektion von Differenzen (kommunikatives Handeln ) kreiert. Disziplinübergreifend verdeutlichen viele gegenwärtig disku-tierten Beobachtungen und Ansätze jene Chancen, die eine I. eröffnet, wenn bei-de Prinzipien berücksichtigt werden: So gründet bekanntlich die Selbstregulation des Marktes auf der natürlichen Knapp-heit von Ressourcen (Rohstoffe, Energie, Arbeit), die Information als Ressource
manifestiert diese Eigenschaft jedoch nicht (Meretz 2000). Es ist also dem soz. Entwurf des Menschen überlassen, ob er die Knappheit ggf. künstlich herstellen will oder ob er die Chance erkennt, einen anderen Antrieb der Selbstregulation für die Wertschöpfung zu nutzen (z.B. Me-chanismus der Selbstentfaltung , vgl. Meretz 2000).
In einem anderen Diskurs berichtet S. J. ↑ Schmidt (2000) von der Entfaltung einer besonderen Ressource einer ↑ Me-diengesellschaft , der ↑ Aufmerksamkeit ,die sogar Eigenschaften einer Währung besitzt (weil sie von ihrer Natur aus knapp ist) und sich parallel zu der Leitwährung Geld behauptet. Beobachtet man – in ei-ner weiteren Perspektive – die Selbstre-gulations-Muster der jugendlichen Erleb-niswelten , sog. Szenen (vgl. Farin, Hitzler), fi ndet man Modelle der Vergesellschaf-tung vor, in denen Aufmerksamkeit die soz. Dynamik bestimmt.
An diesen einzelnen Beispielen wird die zunehmende Verfl echtung von Wirt-schaft, Medien, Kultur und Politik sowie die Mannigfaltigkeit der in den recht-zeitig erkannten Synergien verborgenen Chancen evident, welche die angefange-ne Informationsära für viable Modelle, Entwürfe und Konzepte noch entfalten kann und welche Gefahren und Risiken sie birgt.
Leon Tsvasman
>>Informationstheorie; Informationsübertra-gung; Mediengesellschaft; Intersubjektivität; Medialität; Cyberspace; konzeptuelle Zeitkon-struktion; Erlebnis; Manipulation; Kommuni-kationspraxis; Interkulturelle Wirtschaftskom-munikation; Mediennetzwerke.
Literatur (Auswahl): CAPURRO, R. (1995): Leben im Informationszeitalter, Berlin. HABERMAS, J. (1962): Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt a. M. HABERMAS, J. (1981 u.ö.): Theorie des kommunikativen Handelns , Band 1: Handlungs-rationalität und gesellschaftliche Rationalisierung,
Informationsgesellschaft
LEXIKONSATZ.indd 140LEXIKONSATZ.indd 140 17.10.2006 08:19:5117.10.2006 08:19:51

141
Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt a. M. HITZLER, R., HORNBOSTEL, S., MOHR, C. (2004): Elitenmacht. Aus der Reihe: Soziologie der Politik Bd. 5, Wiesbaden. HITZLER, R., BUCHER, TH., NIEDERBACHER, A. (2005): Leben in Szenen. Formen jugendlicher Vergemeinschaftung heute, 2. Aufl ., Wiesbaden. HITZLER, R., PFADENHAUER, M. (Hrsg.) (2005): Gegenwärtige Zukünfte. Interpretative Beiträ-ge zur sozialwissenschaftlichen Diagnose und Progno-se, Wiesbaden. LUHMANN, N. (1970, 1975, 1981, 1987, 1990, 1995): Soziologische Aufklärung 1-6, Opladen. LUHMANN, N. (1975): Veränderungen im System ge-sellschaftlicher Kommunikation und die Massenmedi-en, in: Schatz, O. [Hrsg.]: Die elektronischen Revoluti-on. Wie gefährlich sind die Massenmedien, S.13-30, Zitat S.16, Graz. LUHMANN, N. (1984): Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a. M. MACKAY, D. M. (1969): Information, Mechanism and Meaning, Cambridge. MARCINKOWSKI, F. (2002): Massenmedien und die Integration der Gesellschaft aus Sicht der autopoietischen Systemtheorie: Steigern die Medien das Refl exionspotential sozialer Systeme?, in: Imhof, K., Jarren, O., Blum, R. (eds.): Integration und
Medien. Mediensymposium Luzern, Vol. 7, Wiesbaden, S. 110-121. MERETZ, S., SCHLEMM, A. (2000), Subjekti-vität, Selbstentfaltung und Selbstorganisation: http://www.kritische-informatik.de/selbst.htm. SHANDS, H. C. (1967): Novelty as Object: Precis for a General Psy-chological Theory, in: Archive for General Psychology, 17: 1-4. STEINBICKER, J. (2001): Zur Theorie der Infor-mationsgesellschaft. Ein Vergleich der Ansätze von Peter Drucker, Daniel Bell und Manuel Castells, Opla-den. TEILHARD DE CHARDIN, P. (1999): Der Mensch im Kosmos, München. WAGNER, R. (1996): Die Informa-tionsgesellschaft: Chancen für eine neue Lebensqua-lität am Beginn des dritten Jahrtausends, Münster, New York, München. WERNADSKI, V. I. [Vernadsky, V. I.], (1926) The Biosphere; engl. Übers. 1998. [Internet-quellen] Technologien der Informationsgesellschaft: http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene3/d2-2i.htm (Stand: 25.07.2006); Kritische Informatik: http://www.kriti-sche-informatik.de/selbst.htm (Stand: 25.07.2006).
Informationstechnologie [information technology, IT]
IT ist ein ugs. Begriff für Informati-onstechnik und deren ingenieurmäßige Anwendung. Der Begriff bedeutet im ei-gentlichen Sinn das (ingenieurmäßige) ↑ Wissen über die techn.-physik. Grund-lagen, Verfahren, Prozesse und Geräte der Informationstechnik.
I umfasst die Gewinnung, Verarbei-tung, Übertragung (↑ Kommunikations-technik ) und Wiedergabe von Daten und Informationen mit Hilfe (heute digitaler) techn. Geräte und Infrastruktur. Auf der Seite der Informationsgewinnung müs-sen geeignete Abtast-Aufnahmegeräte zur Verfügung stehen, z.B. Kameras ( Bild, Video ), Scanner (Grafi k, Bild), Mikrofon (Audio), deren physik. analoge (zeit-/wert-kontinuierliche) Signale durch geeig-nete Signalwandler in digitale Repräsenta-tionsform (Codierung ) überführt werden. Diese digitalen Daten können dann in digitalen Systemen (z.B. Computer) wei-terverarbeitet (gefi ltert, codiert, volumen-reduziert) und anschließend übertragen werden. Auf der Empfängerseite müssen diese Daten für menschl. Nutzer wieder in eine den Sinnesmodalitäten des Men-schen zugängliche Form überführt wer-den, unter Einsatz techn. Geräte wie z.B. Bildschirmwiedergabegeräten (Monitor), Drucker, Audiowiedergabesystem (Laut-sprecher). Dabei werden sie durch geeig-nete techn. (Digital-Analog)-Wandler wieder in analoge Signalform überführt.
Techn. gewonnene Informationen, die derart für die Wahrnehmung durch men-schl. Sinne bestimmt sind, werden ugs. als Digitale Medien bezeichnet. Für die versch. Sinnesmodalitäten des Menschen werden unterschiedl. und häufi g zusam-mengesetzte (multimediale) Informati-onsformate verwendet. Für die Übertra-gung derartiger Information werden bei begrenzter Bandbreite des Übertragungs-kanals häufi g Verfahren zur Reduktion der Datenrate (Datenvolumen pro Zeitein-
Informationstechnologie
LEXIKONSATZ.indd 141LEXIKONSATZ.indd 141 17.10.2006 08:19:5217.10.2006 08:19:52