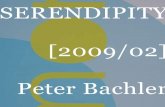Elektrotechnik 2009/02
-
Upload
daniel-gugger -
Category
Documents
-
view
266 -
download
5
description
Transcript of Elektrotechnik 2009/02

A Group Brand
Für höchste Qualitätsansprüche
Für aggressivste Umgebungen
Für extremste Belastungen
www.cablofil.ch
Mit dem Gitterkanal von Cablofilarbeiten Sie bis zu 30 % schneller
Evolution oder Revolution?
Elek
trote
chni
k 2/
2009
12 Kleinheizgeräte und Infrarotstrahler
16 Aus Unfällen lernen
40 IT: Schutz vor Angriffen
61 NIN-Know-how, Leserfragen, Teil 42
Heft 2 | Februar 2009WWW.ELEKTROTECHNIK.CH
ELEKTROTECHNIKAUTOMATION, TELEMATIKGEBÄUDETECHNIK

BACnet und das WAGO-I/O-SYSTEM
Flexibel. Kostengünstig. Bedarfsgerecht.� Modulare Hardware mit Standard I/O´s und Spezialklemmen (z.B. KNX, DALI,
EnOcean, MP-Bus, M-Bus, ...)
� Native BACnet-Funktionalität: Automatisches Anlegen von Objekten für Standard Ein- und Ausgänge
� Anlegen weiterer Objekte über Programmierumgebung WAGO-I/O-PRO CAA
� Tool zur Konfiguration der WAGO BACnet-Controller und Einbindung von BACnet-Fremdprodukten ins Netzwerk
� BACnet-Configurator steht zum freien Download im Internet zur Verfügung
WAGO CONTACT SARoute de l‘Industrie 191564 Domdidier� deutsch 026 676 75 86� français 026 676 75 87� italiano 026 676 75 88Fax 026 676 75 01E-Mail [email protected]
www.wago.com
2_BACnet_US2_bearb.indd 1 29.1.2009 14:08:00 Uhr

Edito
rial
Schwierige Zeiten?
Liebe Leserin, lieber Leser
Was kommt 2009 auf die Branche zu? Mit Sicherheit gibtes nur wenige Zeitgenossen, die sich diese Frage nicht stel-len. Noch ist das Elektrogewerbe nicht grossflächig betrof-fen, wenn auch der Arbeitsvorrat im einen oder anderen Be-trieb bereits schrumpft. Die täglichen Meldungen vermittelnden Eindruck einer breiten tiefer greifenden Abschwächung.Das Elektrogewerbe wird dabei nicht verschont bleiben.Ohne prophetische Ader lässt sich das Ausmass der Krisenicht voraussagen. Die Preise für umfangreiche Elektroins-tallationen bewegen sich seit einiger Zeit in Schwindel erre-gender Tiefe. Aus Furcht vor Auftragsmangel könnten nochweit unvernünftigere Gebote auf den Markt geworfen wer-den. Aufträge um jeden Preis zu ertrotzen, ist nicht sinnvoll.Unsaubere Arbeit mit daraus folgenden Reklamationen, Ga-rantiearbeiten und schliesslich fehlende Liquidität des Be-triebes können die Folge sein.
Verfehlt wäre es, den Kopf in den Sand zu stecken. Ge-fragt ist eine weitsichtige, vorsichtige Planung. Für verant-wortungsbewusste Führungskräfte ist ein Personalabbauenorm schmerzhaft. Fehlende Offenheit schafft ein Klimader Unsicherheit für alle Beteiligten. Offene, frühzeitige In-formation der Betroffenen und aktive Mithilfe bei einer all-fälligen Stellensuche sind das Gebot der Stunde. Vernünfti-ge Elektrounternehmer pflegen Kontakt mit Mitbewerbern.Ausmieten und Mieten von Personal als Win-Win-Situationbewährte sich schon früher, um kein Personal entlassen zumüssen. Auch mit Kurzarbeit kann es gelingen, die Mitar-beiter über die Krise weiter zu beschäftigen.
Die Kundenbetreuung und den innerbetrieblichen Be-reich gilt es zu überprüfen. Wie präsentieren wir uns amMarkt? Was lässt sich in unserem Betrieb verbessern?
Zwar wird sich das Gewitter oder der Sturm nichtdurch Massnahmen in der aufgezeigten Richtung ver-scheuchen lassen, doch werden Unternehmer und Mitar-beitende daraus gestärkt und für eine schwierige Zukunftbesser gerüstet hervorgehen.
Ernst [email protected]
Elektrotechnik 2/09 | 1
Was ist auf diesem Bild zu sehen ?
• Diebstahlgeschütztes Bild• Infrarotheizung als Spiegel• Dekoration in Hotel
Geben Sie Ihre Antwort ein auf der ET-Websitewww.elektrotechnik.ch und gewinnen Sie einesvon drei Fachbüchern aus dem ET-Fachbuchverlag.
Auflösung des Wettbewerbs in ET 1/09: «AutomatischesParkhaussystem» war die richtige Antwort. Je einenGutschein à 100 Franken für eine Bestellung bei ConradElectronic, haben gewonnen:• Herr Andreas Kilchenmann, Kirchdorf• Herr Florian Schneebeli, Winterthur• Herr Jakob Henzi, Pfäffikon
ET-Wettbewerb Februar 09

Otto Fischer AG | ElektrogrosshandelTelefon 044 276 76 76 | Fax 044 276 76 86 www.ottofischer.ch
Aargauerstrasse 2 | Postfach | 8010 Zürich
Gebäudeautomation jetzt im VirtualShop
GEBÄUDEAUTOMATION mit Comfort Systems.
Nutzen Sie unserenVirtualShop für Ihre
kompetente Lösung.Blättern Sie schwebend
durch die Artikel undstellen Sie mit Click & Drop
Ihre Bestellung einfach zusammen.
www.ottofischer.ch
Jetzt informieren:Informer maintenant:

Inha
ltsve
rzei
chni
s
Editorial1 Schwierige Zeiten ?
Aktuell4 Seminar für vorbeugende
Instandhaltung6 Zum Titelbild:
Mehr als ein Produkt, eineLösung mit System
6 Produkteanzeigen11 LED-Hintergrund-
Beleuchtung spart kosten
FachteilMonatsthema
12 Kleinheizgeräte undInfrarotstrahler
15 Spiegel an der Wandmit Kachelofeneffekt
Installations- & Gebäudetechnik16 Aus Unfällen lerne
Automation & Elektronik23 Wohnkomfort braucht Energie27 Die BACnet-Interoperabilitäts-
regeln (Teil 2 )
Licht & Leuchten31 Lichtsteuerung im Modul
Forschung & Umwelt32 Papa PAL
Elektroplanung & Beratung34 Fachbauleitung heute
Telematik und Multimedia40 Schutz vor Angriffen auf Homepage und PC44 Schulungen für die elektronische Sicherheit45 Sportsendungen – Rotronic mischt mit46 Glasfaser bis in die Stube48 Werkzeuge für die Glasfaserbearbeitung52 Telematik-News
Wirtschaft und Verbände Portrait54 KNX zum Standard verholfen
Management56 Kritikgespräche ohne Klimastörungen
Branchen-News59 20 Elektroinstallateure an der 6. SM in Horw60 Innovations- und Anerkennungspreis VeL 2009
Aus- und Weiterbildung61 NIN-Know-how 42
Service65 Geht uns die Energie aus?66 WAM – die Wissensplattform
am Morgen67 Veranstaltungen68 Stellenanzeiger71 Impressum71 Unsere Inserenten71 Im Text erwähnte Firmen72 Vorschau
Inhaltsverzeichnis
Elektrotechnik 2/09 | 3
Typische Anwendung von Infrarotstrahlern ineiner ungeheizten Umgebung.
Die zukunftsorientierte Lösung für den Wohnungs- oder Hausbau. Komplette Bedienung von Licht, Storen, Heizung sowie von Multiroom-Audio-, Video- und TV Anlagen. Besuchen Sie unseren kostenlosen Planungskurs im «in-house.ch» dem Erlebnispark für intelligentes Wohnen.
AMX Distributor: Arocom AG, Telefon: +41 61 377 87 97Weitere Infos unter: www.haussteuerung.ch
Einfachste Installation: Ein Netzwerkkabel genügt
Steuerung, Video-Gegensprechen und Power-over-Ethernet
Video- und Voice-over-IP
Gegensprechstation
Kostenloser
Planungskurs
07. APRIL ’09

4 | Elektrotechnik 2/09
Fo
cus
Unerwartete Ausfälle lassen sich dankeiner intelligenten und doch gleichzei-tig kostenfreundlichen Wartungsstrate-gie vermeiden. Moderne Messgerätewie Echteffektiv-Multimeter, industrie-taugliche Oszilloskope mit Feldbusana-lysenfunktionen und auch immer öfterWärmebildkameras und Netzqualitäts-analysatoren sind hierfür die idealenWerkzeuge. Doch erst die Verknüpfungdes notwendigen Fachwissens mit derSymptombeurteilung lassen die vorbeu-gende Instandhaltung zur Erfolgsge-schichte werden.
Kombination ist der Schlüssel zum Erfolg!Die Verbindung der Erkenntnisse inder Netzqualität mit weiteren Beurtei-lungsgrundlagen wie Wärmebilder,Isolations- und Leckstrommessungenund einem auf die Anlage ausgerichte-ten Kontroll- und Instandhaltungsplanmachen sich schnell bezahlt, längernutzbare Anlagen und weniger unplan-mässige Stillstände schonen das Budget.Fluke vermittelt den Teilnehmern diedazu notwendigen grundlegendenKenntnisse über Messmittel, Messwerteund deren Beurteilung. Das Seminarrichtet sich an Betriebselektriker und-Instandhalter, Elektro- und Elektro-nikfachleute in Service, Wartung undInstallation in Industrie und Handwerk,Netzqualitäts- und Wartungsverant-wortliche.
Inhaltsübersicht• Sicherheit beim Messen an Nieder-
spannungsanlagen• Grundlagen der Netzqualität
Fluke gilt mit ihrem umfassenden Programm an Messinstrumenten alsverlässlicher Partner im Bereich Installations- und Sicherheitstechnik, War-tung, aber auch Elektronik. In wirtschaftlich härteren Zeiten fällt dervorbeugenden Wartung noch mehr Gewicht zu, denn damit wird viel Geldgespart.
Seminar für vorbeu-gende Instandhaltung
Netzqualität und Thermografie als Schlüssel zum erfolgreichen Instandhaltungsmanagement
• Häufige Ursachen von Störungen inelektrischen Versorgungsnetzen
• Wahl des richtigen Messgeräts fürspezifische Anwendungen
• Einführung in die Grundlagen derThermografie
• Grundlagen der vorbeugendenInstandhaltung bzw. präventivenWartung
TeilnahmegebührFür das Seminar wird der Selbstkosten-preis von Fr. 250.– pro Person(exkl. MwSt.) durch den Veranstalterverrechnet. Im Preis inbegriffen sindSeminarunterlagen und eine Teilnah-mebestätigung, Kaffeepausen, Mittag-essen mit Getränk, eine Messfibel undThemen-DVDs.
Termine und Orte 200926. 2. Walenstadt mit Recom AG11. 3. Olten mit Recom AG25. 3. Nänikon mit Distrelec AG02. 4. Walenstadt mit Recom AG29. 4. Wallisellen mit Winterhalter- Fenner AG
Dauer jeweils von 9 bis 16 Uhr. Detailin-formationen und Anmeldungen sowieDaten zu weiteren Fachseminaren findetman unter: www.fluke.ch/seminare ■

Elektrotechnik 2/09 | 5
#
Marian Van der Elst,Leiter Energiewirtschaft International«Perfekte Vorbereitung als Basisfür maximale Leistung.»
Die Liberalisierung im Strommarkt setzt Impulse frei und eröffnet neue Chancen. Wir verstehen sie als
Aufforderung, uns dynamisch weiterzuentwickeln. Dazu sind wir auf engagierte Mitarbeitende an-
gewiesen wie beispielsweise Marian Van der Elst. Neue Projekte plant er perfekt – und trägt so zur
Unternehmensentwicklung bei.
Bei der BKW FMB Energie AG sorgen 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute dafür, dass bei mehr
als einer Million Menschen zuverlässig der Strom fliesst. Gehören Sie morgen dazu? Wir freuen uns,
wenn Sie mit uns die Zukunft angehen.
BKW FMB Energie AG, Human Ressource Management, Telefon 031 330 58 68,
[email protected], www.bkw-fmb.ch/jobs

6 | Elektrotechnik 2/09
Pr
oduk
tean
zeig
en
Seit mehr als 30 Jahren schon re-volutioniert Cablofil® das Kabel-management von Elektro- undKommunikationskabeln. Die Ka-belkanäle von Cablofil® sind einsicheres, wirtschaftliches unddauerhaftes System mit Vortei-
len und Leistungen, die amMarkt noch ihresgleichen su-chen. Erwähnenswerte Merk-male von Cablofil® sind nichtnur die geschweissten Stahl-drähte, sondern auch die abso-lute Konformität mit allen,auch den strengsten Sicher-heitskriterien sowie seine me-chanische Anpassungsfähigkeitund die schnelle Montage.
Tipp: Sehen Sie sich unterwww.cablofil.ch den Film an. Inweniger als 5 Minuten werdenauch Sie verstehen, warum Ca-blofil®-Systeme so begehrt sind.
Zum Titelbild: Mehr als ein Produkt, eineLösung mit System › www.cablofil.ch
A Gr oup Brand
Für höchste Qualitätsansprüche
Für aggressivste Umgebungen
Für extremste Belastungen
www.cablofil.ch
Mit dem Gitterkanal von Cablofilarbeiten Sie bis zu 30 % schneller
Evolution oder Revolution?
12 Kleinheizgeräte und Infrarotstrahler
16 Aus Unfällen lernen
40 IT: Schutz vor Angriffen
61 NIN-Know-how, Leserfragen, Teil 42
Heft 2 | Februar 2009WWW.ELEKTROTECHNIK.CH
ELEKTROTECHNIKAUTOMATION, TELEMATIKGEBÄUDETECHNIK
Legrand (Schweiz) AG5242 BirrTel. 056 464 67 67www.cablofil.ch
Die neuen 9-W-Decken-Ein-bauspots glänzen nicht nur mitstarkem Licht, sondern ebensodurch ihre saubere Verarbei-tung. Es gibt die Spots entwe-der mit festem oder schwenkba-rem Einbau. Beide Variantensind ausserdem mit verschiede-nen Abstrahlwinkeln erhältlich.Die LED-Chips stammen vomWeltführer Cree und glänzenmit mehr als 50 Lumen/Watt.Bei der Entwicklung wurdenicht nur auf eine hohe Licht-leistung Wert gelegt, sondern
ebenso auf naturgetreue Farb-wiedergabe. Der grosse Kühl-körper der Spots hält die Be-triebstemperatur tief. Das pas-sende Netzteil gehört zumLieferumfang. Das Gehäusebesteht aus lackiertem Alumi-nium.
Neue LED-Decken-Einbauspots
TRIGRESS Elektro AG6341 BaarTel. 041 560 60 00www.trigress.ch
Der neue RibbonStrip Ultravon Trigress Elektro setzt neueMassstäbe bezüglich Helligkeitund Flexibilität. Mit dem dop-pelseitigen Klebeband wird dieultraflexible Leiterplatte raschund ohne Werkzeug montiert.Neuartige, hocheffiziente 3-Chip-LEDs liefern einenLichtstrom von über 700 Lu-men pro Meter. Damit über-treffen sie die bisherigen Rib-bonStrips um das Mehrfache.Dieser Lichtstrom ist mehr alsausreichend für viele Beleuch-
tungsaufgaben. Die Länge be-trägt 3 m und kann auf alle 5 cmbeliebig gekürzt werden. Die180 ultrahellen LEDs mit120 °-Abstrahlwinkel bietenhelle und satte Farben, dieSpannung beträgt 12 VDC.Neben kalt- und warmweisssind auch die Farben Rot,Grün, Blau und Amber erhält-lich.
LED-Leuchtstreifen fürAllgemeinbeleuchtung
TRIGRESS Elektro AG6341 BaarTel. 041 560 60 00www.trigress.ch
Mit den Installationstestern vonFluke lassen sich elektrischeAnlagen einfach auf ihre kor-rekte Ausführung und Kom-patibilität zur SchweizerischenNorm NIV prüfen. Sowohl dieErgonomie,die Robustheit alsauch die Technik der Gerätesind einzigartig. Die Funk-tionen der bekannten Serie1650 sind erweitert worden.Das Gerät wiegt nur 1,2 kg undlässt sich über den gepolstertenTragriemen leicht tragen. DiePrüfung der Schleifenimpedanzerfolgt in wenigen Sekunden.Die Messdauer ist mit der Serie1650B halbiert und genauergeworden.
Verbesserter NIV-Tester Fluke 1650B
Distrelec8606 NänikonTel. 044 944 99 11www.distrelec.ch

Elektrotechnik 2/09 | 7
#
www.zublin.ch
M. Züblin AG Neue Winterthurerstrasse 30, 8304 Wallisellen, Telefon 044 878 22 22, Fax 044 878 22 33, www.zublin.ch
Rund oder quadratisch?Bewegungs- oderPräsenzmelder?
Rond ou quadratique?Détecteur de mouvementou de présence?
1 Swiss Garde 360 PlusPräsenz / PrésenceE-No 535 938 300
2 Swiss Garde 360 PlusE-No 535 949 800
3 Swiss Garde 360 PlusPräsenz RA / Présence RAE-No 535 938 304
4 Swiss Garde 360 Plus RAE-No 535 938 314
5 Swiss Garde 360Präsenz EB / Présence EBE-No 535 943 715
1
2
3
4
5

8 | Elektrotechnik 2/09
Pr
oduk
tean
zeig
en
Eaton stellt die neue Eaton 5130vor. Die Line-interaktivenUSV-Modelle aus der Power-ware-Familie schützen mitLeistungen von 1250 ... 3000 VAServer, Router, Switches,Work-stations, VoIP-Anwen-dungen, aber auch heikle Steu-erungen aus der Automation.Unerklärliche Störungen alsFolge von kurzen Stromausfäl-len gehören so der Vergangen-heit an. Auch bei Über- undUnterspannungen im Netz er-halten die Verbraucher einekorrekte Netzspannung. DieUSV verbindet hohe Flexibili-tät mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und ist so-wohl als Tower- als auch alsRackmount-Gerät einsetzbar.Durch ihr kompaktes Designmit nur zwei Höheneinheitenim Rack ist sie optimal für An-
lagen mit hoher Leistungsdich-te geeignet. Die Batterien las-sen sich wechseln, ohne dieUSV herunterzufahren (HotSwap).
Schutz für Server und Telekommuni-kationsanwendungen
ROTRONIC AG8303 BassersdorfTel. 044 838 11 66www.rotronic.ch
Die Hirschmann Automationand Control GmbH stellt einenneuen gemanagten Fast-/Giga-bit-Ethernet-Switch aus derMACH1000-Familie vor. Beidieser Ausführung befindensich mit Ausnahme eines Ser-vice-Ports sämtliche Anschlüsseauf der Geräterückseite. Die 24Fast-Ethernet-Ports, von denenbis zu vier PoE unterstützen,werden sowohl mit M12-An-schlüssen wie auch in beliebi-gen Zusammenstellungen fürandere Steckverbinder wie bei-spielsweise MTRJ, ST, SCoder RJ45 angeboten. Für die
Gigabit-Uplinks stehen wahl-weise zwei Combo-Ports(10/100/1000 BASE-TX) zurVerfügung, die mit SFP-Fiber-Modulen bestückt werdenkönnen (1000 BASE-FX-/SX/LX/LH). Damit bietet dieneue Ausführung erstmals einehohe Bandbreite in Kombinati-on mit der industrieerprobtenM12-Anschlusstechnik.
Fast-/Gigabit-Ethernet-Switch
Hirschmann Automationand Control GmbH8447 DachsenTel. 044 905 82 84
Wieland Electric erweitert sei-ne Produktpalette im BereichStromversorgungen um die ein-phasige Serie wipos P1. DieGeräte finden schwerpunkt-mässig im Maschinenbau sowiein der Prozesstechnik Anwen-dung. Die Serie umfasst ver-schiedene Module von 1,25 bis
20 A, die durch Weiteingangs-spannungsbereiche für denweltweiten Einsatz geeignetsind. Die robusten 24-VDC-Stromversorgungen arbeitenzwischen –25 ... 71 °C Umge-bungstemperatur. Die Schalt-netzteile bieten volle Ausgangs-leistung bis zu 60 °C, PFC-Technologie, Netzausfallüber-brückungszeit › 30 ms, einstell-bare Ausgangsspannung, aktiveÜberwachung mit Schaltaus-gang und LED-Diagnose zureinfachen Inbetriebnahme. DieNetzteile sind in Reihe schalt-bar, ab 5 A zur Leistungserhö-hung und Redundanz auch par-allel schaltbar.
Stromversorgungen ohneSchnickschnack
Omni Ray AG8600 DübendorfTel. 044 802 28 80www.omniray.ch
Epson bietet eine hervorragen-de Qualität durch die Integrati-on eigener innovativer Techno-logien (3LCD, erweitert durchein neues D7-Display, C²Fine,Deep Black und Cinema Filter)sowie echte HD-Projektion miteinem unglaublichen Kontrast-verhältnis von 75 000:1. DerEpson EH-TW5000 projiziertBilder in sensationeller Quali-tät. Das Heimkino wird ab so-fort mit anderen Augen wahr-genommen. Der EpsonEH-TW5000 ist mit zwei
HDMI-Eingängen (Version1.3) ausgestattet. So profitiertman gleichermassen vom HighDefinition Broadcasting undvon digitalen Multimedia-An-wendungen. Es lassen sichBlu-Ray-Filme und DVD wie-dergeben und die neueste HD-Spielkonsole oder HD-Set-Top-Box anschliessen.
Ultimative Kinoqualität der Zukunft
CECONET AG5506 MägenwilTel. 062 887 27 37www.ceconet.ch

Elektrotechnik 2/09 | 9
Prod
ukte
anze
igen
Der Schweizer USV-HerstellerNewave SA, ist mit dem Frost& Sullivan Award 2008 für her-ausragende Technologie imUSV-Markt ausgezeichnetworden. Der Preis ist eine An-erkennung für Newaves Erfolgein den letzten Jahren, die Tech-nologie von USV-Systemendurch konstante Innovationeneffizienter und kundenfreundli-cher zu machen. Der Frost &Sullivan «Excellence in Tech-nology Award» wird an Firmenvergeben, die wegweisend fürdie Entwicklung und Marktein-führung einer wichtigen Tech-nologie waren. Die wichtigsten
Innovationen, die Newave ein-geführt hat, gehören der drei-phasigen transformatorlosenUSV und die modulare USV.1994, zur Firmengründung vonNewave, war das Unternehmeneiner von nur zwei Herstellernin Europa, der dreiphasigetransformatorlose USV-Syste-me anbieten konnte. Mittler-weile werden die neuen Tech-niken auch von der weltweitenKonkurrenz verwendet.
Newave erhält «Excellencein Technology» Award
ServiceNet AG5432 NeuenhofTel. 056 416 01 01www.servicenet.ch
Ob Knöpfe oder Leuchtpatro-nen, Rahmen oder Platten, Ap-parate oder Steckdosen, dieKallysto Stock Box umfasst inkleinem Raum die wichtigstenKallysto-Artikel und Ersatztei-le. Als Profi weiss man, dass ef-fizienter Service zum Ge-schäftserfolg beiträgt. Kundenschätzen es über alles, wennkleine Installationen und Repa-raturen rasch erledigt werdendank der richtigen Apparateund Ersatzteile im Lager. Fürso ein Lager hat Hager die ide-ale Lösung entwickelt: KallystoStock Box. Dank diesem ulti-mativen kompakten Lager-system sind die wichtigstenErsatzteile und Kombinations-apparate für das Kallysto-Pro-gramm immer zur Hand. JedeSchublade ist mit Bild, Artikel-nummer, E-N° und EAN-Strichcode etikettiert.
Lösung für den Service-Profi
Hager Tehalit AG8153 Rümlang3063 [email protected]
Mit dem neuen Wago BAC-net-Controller 750-830 wird esmöglich, das am Markt bewähr-te Wago-I/O-System auch inBACnet/IP-Projekten einzu-setzen. Mit dem neuen freipro-grammierbaren Wago BAC-net/IP-Controller und den vie-len verfügbaren Standard- undSpezialklemmen des Wago-I/O-Systems lassen sich die un-
terschiedlichsten Aufgabenstel-lungen in der Gebäudeautoma-tion lösen. Einsatzgebiete sinddie typischen HLK-Anwen-dungen, aber auch Beleuch-tungs- und Jalousiesteuer-ungen. Vielfältige Schnitt-stellenmodule bieten direktenAnschluss an KNX/EIB, Da-li-Lichtsteuersysteme, EnOce-an-Funktechnik, tec. Bei derAnwendung des Controllers alsBACnet-Native-Server erkennter alle gesteckten digitalen undanalogen I /O-Module und er-stellt daraus automatisch BAC-net-Objekte.
Wago BACnet/IP-Controller 750-830
WAGO CONTACT SA1564 DomdidierTel. 026 676 75 86www.wago.com
Soeben ist die neueste Ausgabedes Dehn-Hauptkataloges «Ar-beitsschutz» erschienen. Auf256 Seiten hat Dehn + Söhnesein gesamtes Arbeitsschutzan-gebot zusammengefasst. DerKatalog beinhaltet ausser Si-
cherheitsgeräten zum Arbeitenan elektrischen Anlagen auchdas Deltec®-Programm zumArbeiten unter Spannung sowieSicherheitsgeräte für elektri-sche Bahnen. Unter den vielenNeuheiten sind vor allem eineKunststoffsteckkupplung alsEinheitskupplung für Schalt-stangen, Isolierstangen und Er-dungsstangen zu nennen. Neuist auch der AbstandsprüferASP für Freileitung und Frei-luftschaltanlage. Das Deltec®-Programm wurde erweitert umstörlichtbogengeprüfte Schutz-handschuhe.
Neuer Hauptkatalog «Arbeitsschutz»
elvatec ag8852 AltendorfTel. 055 451 06 46www.dehn.ch

10 | Elektrotechnik 2/09
Prod
ukte
anze
igen
Ihre Mitarbeiter sind zuverlässig,flexibel und gut geschult. Genauwie unsere.
Nutzen auch Sie das Fachwissen und das umfassende
Dienstleistungsangebot der VW Nutzfahrzeuge Service-
partner und profitieren Sie von:
• der Mobilitätsversicherung «Totalmobil!»
• der Anschlussgarantie «LifeTime»
• der ReifenGarantie
• Volkswagen Original Teile®
• Volkswagen Original Zubehör®
• und vielem mehr!
www.vw-nutzfahrzeuge.ch
KleineElektro-Heiz-konvektoren
Für Büros, Werk-stätten,Ferienwoh-nungen die idealeÜbergangs-undZu-satzheizung. 230 V500–2200 W. Von:
Warmluft-Heizgeräte
mobil oder festwirtschaftlich fürnicht dauernd be-legte Hallen, Saal-bauten, Lager. Ge-ringe Investition.Kein Unterhalt.230/400Vbis50kW.
Hz3
044/4611111ANSON8055 Zürich Friesenbergstr. 108 Fax 044/461 31 11
ANSON Infra-rot-Strahlerfür wohlige
Sofortwärmein Wintergärten,auf Terrassen, vorSchaufenstern, inBad / Dusche etc.230V. Fragen Sie:
1-8_neu_bearbeitet_2009.indd 2 5.12.2008 15:02:04 Uhr
Siemens Industry Automationand Drive Technologies präsen-tiert eine neue Hauptmotoren-reihe. Die Reihe 1PH8 ist fürden universellen Einsatz in ver-schiedensten Motion-Control-Anwendungen konzipiert. Aufder Basis eines flexiblen Baukas-tens sind die Motoren sowohl ineiner Asynchron- als auch in ei-ner kompakten Synchronvarian-te mit Fremdbelüftung als auchmit Wasserkühlung verfügbar.
Die Motoren sind als Hauptan-triebe mit Leistungen von 2,8...1340 kW erhältlich. Umfangrei-che Funktionserweiterungen wieunterschiedliche Lagerkonzepteerweitern das Anwendungsspek-trum.
Siemens Schweiz AG
Siemens Schweiz AGAutomation and Drives8047 ZürichTel. 0848 822 844www.siemens.ch
Hager führt ab sofort allstrom-sensitive FI-Schutzschalter desTyps B im Programm. BeiNiederspannungsanlagen inKombination mit elektronischenBetriebsmitteln wie Frequenz-umrichtern, USV-Anlagen,Schaltnetzteilen, Hochfrequenz-stromrichtern sowie bei medizi-
nischen Apparaten wie Röntgen-geräten und Computertomogra-phen treten glatte Gleichfehler-ströme oder Fehlerströme mitFrequenzen bis zu 1 MHz auf.In solchen Umgebungen ist eineffizienter Schutz mit dem Ein-satz von Fehlerstrom-Schutz-schaltern des Typs B gewähr-leistet. Die FI-Geräte Typ Berfassen alle Arten von Fehler-strömen: Sinusförmige und pul-sierende Ströme und reineGleichströme.
Fehlerstromschutzschalter Typ B,allstromsensitiv
Hager Tehalit AG8153 Rümlang3063 [email protected]
Soeben ist die neueste Ausgabe desDehn-Hauptkataloges «Blitz-schutz » erschienen. Auf 240 Sei-ten werden Neuheiten und be-währte Bauteile aus dem BereichÄusserer Blitzschutz vorgestellt.
Besonders hervorzuheben istDehnhold, eine neue Generati-on von Leitungs- und Stangen-haltern aus Niro-Material, de-ren geschlitzte Überleger einezeit- und kostensparende Mon-tage ohne das Herausdrehender Befestigungsschrauben er-möglichen. Weitere Neuheitensind unter anderem Bandrohr-schellen für den Blitzschutz-Potenzialausgleich in den Ex-Bereichen 1/21 und 2/22 sowieeine wasserdichte Wanddurchfüh-rung, und Klemmen für 50 -Hz-Kurzschlussströme.
Neuer Hauptkatalog «Blitzschutz»
elvatec ag8852 AltendorfTel. 055 451 06 46www.dehn.ch

Elektrotechnik 2/09 | 11
Hig
hlig
ht
Mit einfachen LED-Modulen bei der Montage und im Betrieb Kosten sparen
Viel bessere Ausleuchtung, wenigerStromkosten und deutlich längere Le-benserwartung zeichnen die Power-Grid-LED-Module von GE Lumi-nation aus. Es gibt aber noch anderegewichtige Argumente, die für eineLED-Hintergrundbeleuchtung spre-chen. Die Module lassen sich mit zweiSchrauben pro Modul in die Rückwandmontieren, fertig. Für grössere Flächenverbindet man die Module einfach. Siearbeiten mit 24 VDC und sind von da-her viel unkritischer als eine Beleuch-tung mit 230 VAC oder gar Hochspan-nung. Die robuste, umspritzteAusführung schliesst ein Zerbrechenbeim Transport und bei der Handha-bung aus. Vor allem Röhrenkonstrukti-onen, die mit Hochspannung arbeiten,sind sehr diffizil. Leuchtstofflampen ha-ben bei tieferen Temperaturen einenschlechten Wirkungsgrad, auf LEDstrifft dies nicht zu. Die Farbtemperaturder LEDs liegt bei 6500 K oder
Grosse Reklamefelder oder Schaukästen werden heute mit Leuchtstoff-röhren hinterleuchtet. Die Leuchtdichteverteilung ist dabei recht dürf-tig und die Lebensdauer der Röhren beträgt nur rund drei Jahre. Die neuenTetra PowerGrid von Trigress Elektro AG stossen hier in neue Dimen-sionen vor.
LED-Hintergrund-Be-leuchtung spart kosten
3200 K. Dank der grossen Zuverlässig-keit der PowerGrid-Module wird eineGarantie von 4 Jahren gewährt.
Einfachere AufbautenDie zum Patent angemeldete PowerGrid-Konstruktion zeichnet sich durch einfachzu koppelnde Module aus. Dank 24-V-Kleinspannung ist die Installation völligunkritisch. Der Montage- und Verkabe-lungsaufwand bei der Leuchtstoffröhren-technik ist deutlich grösser. Ein Kasten mitT8-Leuchtstofflampen bedingt eine Tiefevon rund 200 mm. Trotz dieser grossenBautiefe des Kastens ist die Leuchtdichte-verteilung an der Oberfläche dürftig undHelligkeitsunterschiede sind von blossemAuge wahrnehmbar. Bei einem Kasten mitPowerGrid-Modulen ist die Leuchtdichte-verteilung an der Oberfläche hervorra-gend, obwohl die Kastentiefe weniger als130 mm beträgt. Die geringere Kastentie-fe lässt ästhetisch schönere Aufbauten zu.
Tiefere EnergiekostenHintergrundbeleuch-tungen von Leuchtkäs-ten sind bis zu 12 h amTag in Betrieb. Bei ei-nem 12-h-Betrieb hal-ten Leuchtstofflampenrund drei Jahre, Power-Grid-LED-Modulehingegen 11 Jahre. Da-mit fallen deutlich we-niger Servicekosten an,je nach Aufwand desRöhrenwechsels wer-den hier erhebliche
Kosten gespart. Es kommt hinzu, dassdie LED-Beleuchtung bei gleicherLeuchtdichte an der Front einen bis zu64 % tieferen Stromverbrauch aufweist.Dabei sind die Stromkosten bei so lan-ger Betriebszeit kein zu vernachlässi-gender Kostenfaktor; sie sprechen klarfür die LED-Technik. Übrigens ist dieEntsorgung der LED-Module unkriti-scher als diejenige der Leuchtstoff-lampen. PowerGrid-Module enthaltenkeine Schwermetalle und auch derKunststoff lässt sich problemlos ver-brennen.
FazitPowerGrid-Module erlauben eine vieleinfachere Ausleuchtung von Flächen.Die Montage erfolgt schnell undunkompliziert, der Betrieb ist kosten-günstiger und die Ästhetik dank ausge-glichener Ausleuchtung und formschö-nerer Kästen viel besser. Und jederElektroinstallateur kann diese Moduleproblemlos handhaben. ■
TRIGRESS Elektro AG6341 BaarTel. 041 560 60 00www.trigress.ch
1 PowerGrid-Modul von GE Lumination.21 Module leuchten eine Fläche von 1,3 m2 aus.
2 Die Leuchtdichteverteilung ist selbst beideutlich kleinerer Kastentiefe viel besser alsbei Leuchtstofflampen.
1
T8-Leuchtstofflampen
Excelente Leuchtdichte-Verteilung
je 102 mmLichtabstrahlung der LEDs
PowerGrid-LED-Module
127
305
203
Leuchtdichte-Unterschied 35%
2

12 | Elektrotechnik 2/09
M
onat
sthe
ma
Obwohl im Winter auf einer Terrasse dieUmgebungsluft kalt ist, schätzen es viele,auf einem Liegestuhl ein Sonnenbad zu ge-niessen. Dabei wird die Person durch Infra-
Infrarotheizstrahler sind beliebt auf Terrassen in Wintersportorten,Badezimmern und zur gezielten Beheizung von Arbeitsplätzen in kaltenRäumen. Gleich verhält es sich mit Heizlüftern oder Konvektoren, diekurzfristig die Temperatur im Badezimmer erhöhen oder für Frostschutz inöffentlichen WC-Anlagen sorgen. Dieser Beitrag stellt Heizgeräte vorund beschäftigt sich auch mit der Frage, was heisst überhaupt heizen?
Kleinheizgeräte undInfrarotstrahler
Heizgeräte in Form von Infrarotstrahlern oder Heizlüftern z.B. für kalte Arbeitsplätze
rotstrahlen aufgewärmt. Die Sonne lässtsich natürlich auch durch Infrarotstrahlerersetzen. Dass dies ökologisch gesehen na-türlich etwas fraglich ist, braucht wohl nicht
speziell erwähnt zu werden. In Badezim-mern kommen oftmals elektrische Heizlüf-ter oder Badheizkörper zum Einsatz. Heiz-lüfter erlauben es ganz kurzfristig, dieRaumluft für ein paar Minuten auf höhereTemperatur zu bringen, damit nach derDusche oder während des Badens nicht nurdas Wasser angenehm warm ist, sondernauch die Luft. Der Badheizkörper (Bild 1)ist vor allem in der Überganszeit, wenndie Raumheizung noch nicht in Betriebist, eine geschätzte Möglichkeit, das Ba-dezimmer trotzdem warm zu haltenund erst noch warme Tücher bereitzu-stellen. In diesem Beitrag wollen wirdiese Geräte etwas genauer anschauen,denn das sind Geräte, die der Elektro-installateur aktiv verkaufen und auchinstallieren kann. Es ist deshalb sichervon Vorteil, wenn man als Fachmanndarüber auch etwas Bescheid weiss.
Physik der WärmeübertragungWärme lässt sich auf drei Arten über-tragen:• Infrarotstrahlung (sie braucht keinen
Träger, geht also auch durchs Vakuum)• Wärmekonvektion (sie braucht einen
flüssigen oder gasförmigen Träger wieLuft, Wasser, Öl)
• Wärmeleitung (Wärme breitet sich infesten Stoffen fort, z. B. durch Wand)
1
1 Badheizkörper – ein interessantes Zusatzgeschäft für den Elektroinstallateur.2 Typische Anwendung von Infrarotstrahlern in einer ungeheizten Umgebung.
2

Infrarotstrahlunggeht annähernd ohne Verluste durch Va-kuum und Luft. Damit ist der Vorteil derInfrarotstrahlung auch schon klar umris-sen. Infrarotstrahler heizen nicht die Um-gebungsluft auf, sondern die angestrahlteOberfläche (Bild 2). Die Infrarotstrahlenerzeugen eine Art Tiefenwärme, weildie Strahlen erst beim Auftreffen aufKörper und Gegenstände ihre wärmen-de Wirkung zeigen. Die Sonne strahltin unseren Breitengraden im Jahres-durchschnitt mit etwa 3 kWh/m2 proTag, in Nebelgebieten etwas weniger.Im Sommer fällt zur Mittagszeit an ei-nem sonnigen Tag Infrarotstrahlungvon über 1 kW/m2 Leistung an.
WärmekonvektionDarunter versteht man den Wärme-transport über bewegte Flüssigkeitenoder Gase, auch Wärmeströmunggenannt. Als Beispiel diene die Zent-ralheizung. Hier wird Wasser durcheine Pumpe in Bewegung gesetzt.Das kalte Wasser wird im Heizkesselaufgewärmt und über Rohre zu denHeizkörpern in den Zimmern trans-portiert. Die Heizkörper ihrerseitsgeben die Wärme teils durch Strah-lung, teils durch Konvektion an denRaum ab. Die am Heizkörper aufge-wärmte und aufsteigende Luft führtzur Durchmischung der Raumluftund damit zur Verteilung der Wär-me. Das Wärmetransportmediumkann auch Öl sein, wie z. B. in einemAutogetriebe. Heizlüfter saugen kalteRaumluft an, heizen diese auf undblasen die heisse Luft in den Raum.Gleiches tut der Föhn, auch er saugtkalte Raumluft an, heizt sie auf undbläst die Luft auf die nassen Haareund verdampft so forciert Wasser.Hier ist das WärmetransportmediumLuft.
WärmeleitungDarunter versteht man den Wärmefluss ineinem ruhenden Stoff. Hier geschieht derWärmetransport nicht über den Transportvon Teilchen. Die Fortpflanzungsge-schwindigkeit beträgt nur wenige Millime-ter pro Sekunde. Die Wärme fliesst stetsvom heisseren Teil zum kühleren. DieserVorgang dauert so lange an, bis ein Wär-meausgleich stattgefunden hat. Ein Massfür die Wärmeleitung in einem bestimm-ten Stoff ist die Wärmeleitfähigkeit. Dabeiist zu beobachten, dass gute elektrischeLeiter auch sehr gute Wärmeleiter sind.Die alte Gusskochplatte funktioniert aufdiese Weise. Die Kochplatte wird heissund überträgt ihre Wärme durch direkten
Kontakt via Wärmeleitung auf den Pfan-nenboden. Bei Glaskeramikplatten ge-schieht die Wärmeübertragung zurHauptsache über Infrarotstrahlung auf denPfannenboden.
Bei realen Systemen wirken meistensmehrere Übertragungsarten zusammen.Innerhalb von Festkörpern findet nurWärmeleitung statt, in Flüssigkeitenund Gasen Wärmeleitung, gekoppeltmit Wärmeströmung und Wärmestrah-lung.
Praktische InfrarotstrahlerMenschen empfinden Strahlungswärmeals die angenehmste Art von Wärme,sofern diese nicht schweisstreibendwirkt. Wird der Mensch von einer Inf-rarotquelle angestrahlt und hat dabeikeine kalten Füsse, so empfindet er kei-ne Einbusse an Wohlbefinden, selbstwenn die Umgebungstemperatur deut-lich unter 20 °C liegt. Elektrische Infra-rotstrahler kommen im Privatbereich inBadezimmern, Wintergärten, auf Ter-rassen und überhaupt an ungeheiztenStellen zum Einsatz. Im Industriebe-reich setzt man sie für Erwärmungs-oder Trocknungszwecke ein. In derTierhaltung halten Infrarotstrahlen Kü-cken, junge Schweine und andere Tierewarm. Typische Wärmelampen, die inStällen zum Einsatz kommen, sindnichts anderes als Glühlampen, derenWendel nur rotglühend gemacht wird.Dadurch wird ganz wenig Licht imsichtbaren Bereich emittiert, 99 % wer-den als Infrarotstrahlung abgegeben.Eine normale Glühlampe strahlt etwa96 % als unsichtbare Infrarotstrahlungaus. Auch in der Medizin werden Infra-rotstrahlen gezielt für die Wärmebe-strahlung von z. B. mit Rheuma befalle-nen Körperteilen eingesetzt. Infra-rotstrahlen beeinflussen eine Vielzahlvon Heilungsprozessen positiv. Neben-bei gesagt, es gibt auch Infrarotstrahler,die mit Gas betrieben werden. Damitlassen sich riesige Hallen von der De-cke her heizen. Der Vorteil liegt hierdarin, dass die Wärme am Boden, z. B.bei sitzenden Personen in einer Festhal-le, umgesetzt wird und nicht die ganzeHalle aufgeheizt werden muss.
Einen typischen Infrarotstrahler fürWand-, Decken- und Ständermontagezeigt Bild 3. Das Gehäuse besteht häu-fig aus lackiertem Alu-Zink-Blech undeinem hochglanzpolierten Reflektor ausAluminium. Dadurch ist maximale Kor-rosionsbeständigkeit gewährleistet. DieKunststoffteile sind aus wärme- undwetterfestem Thermoplast gefertigt. Innordischen Ländern wie Schweden und
Glasheizkörper
Entdecken Sie die angenehme Infrarotwärme dieser innovativen und hochwertigen Elektro-Glasheizkörper.
L In diversen Farben erhältlichL SelbstregulierendL ElegantL SparsamL Niedrige-, homogene
OberflächentemperaturL PflegeleichtL Auch als Handtuchtrockner
lieferbarL Komfortable RegelungL Gleichmässige Temperatur-
verteilung im RaumL Luft trocknet nicht aus
Erhä
ltlic
he F
arbe
nSystec Therm AGLetzistrasse 359015 St. Gallen
Telefon 071 274 00 50Telefax 071 274 00 60Mail [email protected] www.systectherm.ch

14 | Elektrotechnik 2/09
M
onat
sthe
ma
Norwegen ist es selbst in Sommermo-naten auf Terrassen recht frisch. VieleRestaurants haben deshalb Infrarot-strahler, damit sitzen die Leute auchgerne bei tiefen Temperaturen draus-sen. Dasselbe gilt bei uns in Winterkur-orten, dort werden Terrassen häufigebenfalls über Infrarotwärmestrahlergeheizt. In einigen Kantonen ist dasHeizen im Freien allerdings gesetzlicheingeschränkt.
Eine ganz besondere Form von Infra-rotstrahlern hat die Firma IHS InfrarotHeizsysteme GmbH, in der Schweizvertreten durch Wüest Infrarotheizung,Wittinsburg, im Programm. Sie bietenNiedertemperatur-Wand-Infrarotheiz-geräte an, die aussehen wie ein Bild(Bild 4). Infrarot-Rotglutstrahler arbei-ten bei Temperaturen um 900 °C, wo-hingegen IHS-Heizelemente nur etwa95 °C erreichen. Rotglutstrahler wer-den häufig im Freien eingesetzt, wokurzfristig starke Wärme erzeugt wird,um Personen zu erwärmen. Auch imBad oder im WC wird diese Techniknoch häufig eingesetzt, um schnellWärme zu erreichen. Die Idee einerlangwelligeren Flächenheizung folgtschon mehr dem Weg des Kachelofens– die «Raumhüllen» zu erwärmen, um ei-nen Wärmespeicher anzulegen, um damitdie Energie möglichst lange zu nutzen. Be-deutsam in diesem Zusammenhang istauch, dass Rotglut schädlich für die Netz-haut sein kann, wohingegen IHS-Wand-heizelemente in den physikalischen Be-reich der Dunkelstrahler fallen.
Heizlüfter, auch Schnellheizer genanntVerglichen mit anderen Heizsystemensind die Investitionen für Heizlüftersehr niedrig. Heizlüfter sind kompakt,haben ein geringes Gewicht und las-sen sich leicht an der Wand befestigen(Bild 5). Für ein Badezimmer, das beimDuschen schnell etwas aufgewärmtwerden soll, genügen in der Regel1,2 kW Leistung, viele Geräte verfügenjedoch über 2 kW. Heizlüfter sind vorallem auch für Räume sinnvoll, dienicht dauernd bewohnt sind. Die Gerä-te verfügen fast immer über einenThermostaten, sodass die Raumluft ge-regelt erwärmt wird. Im Badezimmerkann über den Timer für 10 Minutendie volle Heizleistung des Geräts akti-viert werden. Nach Ablauf der Zeit hältdas Gerät automatisch die mit demThermostaten am Gerät eingestellteRaumtemperatur auf einem Minimal-wert oder stellt ganz ab. Die Energie-einsparung ist so erheblich und derKomfort nur marginal eingeschränkt,denn das Gerät heizt einen Raum inkurzer Zeit auf, und dank des Lüfterswird die Raumluft gut durchmischt. Fürden Elektroinstallateur sind allerdingsBadheizkörper, auf denen auch die Ba-detücher getrocknet und schön warmgehalten werden, das bessere Geschäft.Qualitativ hochwertige Wandheizgerätezeichnen sich durch einen niedrigenGeräuschpegel aus. Ein leiser Lüfterhat in aller Regel auch eine hohe Le-benserwartung. Die Heizung selbst
wird bei billigsten Geräten über feineHeizdrähte realisiert, die über Glim-mer- oder Keramikstützen voneinanderisoliert sind. Diese Technik ist auch ty-pisch für Föhne. Fällt bei solchen Gerä-ten der Lüfter schlagartig aus, verglü-hen die Heizdrähte oftmals, weil derÜbertemperaturschutz zu träge re-agiert. Leistungsfähige frei stehendeGeräte, die in Rohbauten, Zelten undanderen Orten mit rauem, von Wasser-spritzern geprägtem Einsatz ihre Arbeitverrichten, verfügen über Heizelementeaus Panzerrohrstäben. Das Gehäuse istspritzwassergeschützt aufgebaut. DieseGeräte gibt es auch für Drehstroman-schluss und damit für Leistungen bisüber 10 kW. Industrie-Heizlüfter lassensich oftmals auch nur als Lüfter mit ab-geschalteter Heizung verwenden. Bild 6zeigt einen robusten Heizlüfter für denEinsatz im Gewerbe, auf Rohbauten,aber auch für den Bastelraum im Wohn-haus. Die Heizleistung von 230-V-Ge-räten reicht bis zu 2,5 kW. Solche Ge-räte sind in Ganzmetallgehäusenaufgebaut, verfügen über eine stufenloseThermostatsteuerung, über eine Frost-schutzfunktion, eine Kippsicherung undnatürlich über einen Überhitzungsschutz.
FazitElektroheizgeräte in Form von Infrarot-strahlern oder Heizlüftern sind das klassi-sche Segment des Elektroinstallateurs. Eswürde sich lohnen, wenn der Elektroins-tallateur jeden Besitzer eines neuen Einfa-milienhauses auf den wertvollen Einsatzeines Badheizkörpers im Badzimmer auf-merksam machen würde. Vor allem in derÜbergangszeit, wenn noch nicht generellgeheizt wird, schätzen es die Bewohner,wenn am Morgen, kaum aus dem warmenBett, sich wenigstens das Badzimmer kurz-fristig für ein paar Minuten schön warmaufheizen lässt. Dabei kann der Installateurein Gerät verkaufen und erst noch eineSteckdose installieren. (rk) ■
3
65
3 Infrarotstrahler für Wand-, Decken- und Ständermontage, beliebt an kalten Arbeitsplätzen.4 Infrarotheizung als Wandbild von redwell.
5 Kalahari Heizlüfter von Solis.6 Lüfter in Ganzmetallgehäuse, z. B. im Einsatz als Bautrockner.

Elektrotechnik 2/09 | 15
Hig
hlig
ht
Infrarotstrahlen existieren, seit esMenschen gibt. Die Sonne ist dabeider wichtigste Erzeuger, aber auchFeuer und Kachelofen wärmen überInfrarotstrahlen. Die unsichtbarenlangwelligeren Infrarotstrahlen sindnicht nur ungefährlich, sondern sogarlebensnotwendig.
Thema GesundheitEin wesentlicher Vorteil der Infrarot-heizung liegt darin, dass Luft nicht alsTransportmittel verwendet wird, da-durch gibt es keine Luftumwälzungund den damit verbundenen Staub-transport. Die Luft ist kühler und be-hält ihre relative Luftfeuchtigkeit, wasfür die Atmung wichtig ist. Infrarot-strahlen trocknen Materie, was dengiftigen Schimmelpilzen und den da-
Spiegel an der Wandmit Kachelofeneffekt
Eine Raumheizung, wie sie selbst Fachleute kaum kennen
mit verbundenen Geruchsemissionendie Grundlage entzieht. TrockeneWände isolieren und speichern Wär-me besser. Infrarotstrahlen sorgen füreine gleichmässige Temperierung desRaumes und verhindern Temperatur-unterschiede. Wo bei Konvektions-heizungen die warme Luft oben istund der Boden kalt, liegt bei Red-well-Infrarotheizungen ein angeneh-mes Temperaturempfinden vor, sogarbei kalten Füssen.
Minimste Installation, kleinsterPlatzbedarfEine Wärmestrahlen-Infrarotheizungbenötigt weder Rohre, Kamine nochTanklager. Wandtafeln, Spiegel, Bil-der oder auch Kugeln sind äusserteinfach zu montieren, benötigen ei-
nen Stromanschluss von 230 V und ei-nen dazwischen geschalteten Thermos-taten. Es können einzelne Räume oderganze Liegenschaften ohne grösserenAufwand beheizt werden. Das Infra-rot-Heizsystem lässt sich als Über-gangs-, Zusatz- oder als Hauptheizungeinsetzen. Unterhaltskosten und kost-spielige Servicearbeiten entfallen voll-ständig. Die Spitzentechnologie derRedwell-Produkte wird in einem ISO-zertifizierten Betrieb in Österreich her-gestellt, unter anderem mit USA-Zulas-sung.
Strom- und AnschaffungskostenDie Infrarotstrahlen erwärmen direktWände, Boden, Decke und alleGegenstände in einem Raum. DieWärme lagert sich in alle absorbieren-den Materialien ein und bildet einenWärmespeicher. Durch diesen Um-stand wird mit einem geringen Ener-gieaufwand geheizt. Dazu kommt,dass die gewünschte Behaglichkeitdurch zirka 3° C tiefere Raumtempe-ratur erreicht wird als dies bei einerKonvektionsheizung der Fall ist. DieRedwell-Infrarotheizung kann alsHaupt-, Übergangs- oder auch als Zu-satzheizung eingesetzt werden. Wich-tig ist eine seriöse Fachberatung. Bau-seits ist kein Heizraum und auch keinÖltank nötig. Die Installationskostensind sehr gering und es fallen keineWartungskosten oder Prüfungskostenan. Es kommt hinzu, dass die Geräteästhetisch einen äusserst vorteilhaftenEindruck machen. ■
VPL AG8280 KreuzlingenTel. 071 672 56 23www.redwell.ch
W-ä-h-r-e-n-d-e-i-n-e-K-o-n-v-e-k-t-i-o-n-s-h-e-i-z-u-n-g-(-K-o-n-v-e-k-t-o-r-e-n-,-R-a-d-i-a-t-o-r-e-n-,-H-e-i-z-l-ü-f-t-e-r-,-e-t-c-.)-d-i-e-L-u-f-t-e-r-w-ä-
Während eine Konvektionsheizung (Konvektoren, Radiatoren, Heizlüfter,etc.) die Luft erwärmen, werden bei einer Infrarotheizung feste Körpererwärmt – die Raumhülle, das Inventar und die Menschen selbst. Darausergeben sich erhebliche Vorteile.
Der Spiegel rechts an der Wand ist ein Infrarotstrahlermit einer Oberflächentemperatur wie ein Kachelofen.

16 | Elektrotechnik 2/09
In
stal
latio
ns- &
Geb
äude
tech
nik
Arbeitssicherheit durchsetzen und Mitarbeiter motivieren
Aus Unfällen lernen:Unfallstatistik 2007
Ein Deckenmonteur hatte den Auftrag,bei einem Umbau die neuen Decken-profile zu montieren, wozu er ein Roll-gerüst zu Hilfe nahm. Vorgängig wur-den die alten Deckenprofile entfernt.Dafür wurden gemäss Aussage desElektrikers die Elektrokabel ausser Be-trieb genommen, womit er meinte, dassder LS ausgeschaltet wurde. Beim
Um die seit Jahren stagnierende Zahl der Unfälle weiter zu senken, mussmit Nachdruck beim Menschen und beim Durchsetzen der Verhaltens-regeln durch Vorgesetzte angesetzt werden. Denn unsere technischenSchutzmassnahmen sind auf einem hohen Niveau, auch was diepersönlichen Schutzmittel und das Werkzeug betrifft. Das T des allen be-kannten TOP-Systems zur Festlegung von Massnahmen (Technik,Organisation, Person) ist in der Regel erfüllt. Der Artikel beschreibt zuerstmarkante Beispiele und gibt dann Antworten auf Fragen in den BereichenDurchsetzen, Motivieren und Verantwortung tragen.
Alfred Franz, Jost Keller, Marcel Schellenberg Montieren von Kreuzverbindungen derDeckenprofile erhielt der Deckenmon-teur dann einen Stromschlag. Er konntedie Profile erst loslassen, als er durchden Stromschlag vom Gerüst fiel undsich dabei erheblich verletzte (Bild 1).
Durch den Kontakt der Profile miteinem nicht isolierten und unter Span-nung stehenden Kabel der Elektroins-tallation stand die Deckenkonstruktionunter Spannung. Der Überstromunter-
brecher dieses Endstromkreises löstenicht aus. Ein Fehlerstromschutzschal-ter war nicht installiert. Das Rollgerüststand isoliert und berührte keine leiten-den Teile, die Erdpotenzial hatten.
Bei der Unfallabklärung konnte dergenaue Stromweg durch den Körper undder Pfad des Stromflusses gegen Erdenicht mehr ermittelt werden, da bereitsbauliche Veränderungen vorgenommenwurden. Offensichtlich hatte ein andererTeil des Deckenprofils Kontakt mitErde, sodass sich eine DurchströmungHand–Hand ergeben hat.
Immer wieder führen Kabelleichen zuUnfällen, wenn alte Kabel und Leitungenmit blanken, ungeschützten Enden unterSpannung stehen. Verunfallte sind dabeiwie der Deckenmonteur mehrheitlichLaien, die keine Schuld trifft. Obwohl dieVerantwortung für Kabelleichen beimElektrofachmann liegt, sollten deshalb inallen Berufsgattungen die Mitarbeiter aufdie Gefahr von blanken Leitungen auf-merksam gemacht werden. Beim gerings-ten Zweifel soll der Elektrofachmann bei-gezogen werden.
Die Verantwortung für Kabellei-chen liegt hingegen beim Elektro-fachmann. Nimmt dieser eine Leitungausser Betrieb, muss er sie nach den 5Sicherheitsregeln freischalten. Das Si-chern gegen Wiedereinschalten kannin vielen Fällen nicht gewährleistetwerden, ausser der LS wird zuverläs-sig beschriftet oder besser abgeschlos-sen. Zwingend ist in jedem Fall, dassdie blanken Leiterenden mit Klem-men isoliert werden. Wird eine Lei-tung bis auf Weiteres ausser Betriebgenommen, muss sie zudem am Spei-sepunkt getrennt und isoliert werden.Ungebrauchte Leitungen sollten ent-fernt werden.
Schutzmassnahmen nicht angewendetBei einem weiteren Unfall wurde imZuge von Sanierungsarbeiten der elekt-rischen Anlagen das bestehende
5-
1 2
1 Die Deckenprofile, an denen der Monteur auf dem Rollgerüstarbeitete, standen unter Spannung.
2 Der Elektromonteur berührte mit dem unisolierten Schrau-benzieher Polleiter und Gehäuse.

Elektrotechnik 2/09 | 17
Inst
alla
tions
- & G
ebäu
dete
chni
k
Nullungssystem TN-C auf Schutzer-dung TN-S umgerüstet. Für die ausge-führten Arbeiten ist keine Anmeldungan den zuständigen Netzbetreiber ein-gegangen. Der bestehende Hausan-schlusskasten verfügte nicht über eineeigene Erdungsklemme, die für denAnschluss des Hauptschutzleiters unddes Erdungsleiters in den neuen Haus-anschlusskästen vorhanden ist. Damitder Hauptschutzleiter beim Öffnen desNeutralleitertrenners trotzdem Erdpo-tenzial (Erder und Netz-PEN-Leiter)hat, wollte man den Hauptschutzleiterunter die gleiche Klemme wie derNetz-PEN-Leiter und die Erdverbin-dung zum Metallgehäuse anschliessen.Beim Unterklemmen des Hauptschutz-leiters rutschte der Monteur mit demunisolierten Schraubenzieher ab undverursachte einen Kurzschluss zwischendem Polleiter und dem Metallgehäuse.Der Kurzschluss verursachte einenFlammbogen, der erst durch das Ab-brennen der Leiter gelöscht wurde(Bild 2). Die netzseitigen 250-A-Siche-rungen wurden nicht ausgelöst(Stammkabelinstallation). Der Monteurerlitt Verbrennungen an den Armenund im Gesicht. Wie hätte die korrekteArbeitsvorbereitung aussehen müssen?
GefahrenermittlungErstens hätte ein möglicher Störlicht-bogen bei einem Kurzschluss als Ge-fahr berücksichtigt werden müssen.Bei Arbeiten an Hausanschlüssen istaufgrund der heutigen Trafoleistun-gen und der niedrigen Netzimpedan-zen durchwegs mit einem hohenKurzschlussstrom von mehr als1000 A zu rechnen. Zweitens könnendie Abschaltzeiten sehr unterschied-lich sein, und oft sind sie nicht be-kannt. Der dritte Faktor, die Distanzzwischen der Arbeitsstelle und demKörper der arbeitenden Person, wirdzwischen 30 und 50 cm liegen. Undwird in der Annäherungszone, d. h.innerhalb von 30 cm Distanz zu span-nungsführenden Teilen, gearbeitet,werden Schutzmassnahmen verlangt.
RisikoeinschätzungIn diesem Beispiel ist die Eintretens-wahrscheinlichkeit für beide Gefahrenmit gelegentlich und das Schadensaus-mass mit Wirkung auf die arbeitendenPersonen – im Falle eines Kurzschlus-ses – mit schwer einzustufen (Bild 3).Die voraussichtlichen Sachschäden sindreparabler Natur. Sie sind auch abzu-wägen, doch klar in zweiter Priorität.
Wahl der ArbeitsmethodeAufgrund der Gefahrenermittlung undder Risikoeinschätzung ist die Arbeits-methode nach EN 50110 respektive derESTI-Mitteilung 407.1199 zu wählen.Oft kommen alle 3 Arbeitsmethodeninfrage. Entsprechend müssen Restrisi-ko und Aufwand bei den einzelnen Me-thoden berücksichtigt werden. Die si-cherste Methode ist das Arbeiten anfreigeschalteten Anlagen, also Arbeits-methode 1. Dafür muss nach den 5 Si-cherheitsregeln vorgegangen werden.Die Arbeiten können darauf schnellund sicher ausgeführt werden. Die In-formation der Kunden und die zeitlicheWahl des Einsatzes sind mitentschei-dend für die Akzeptanz. Bei Arbeitenam Hausanschluss sollte die Wahl klarzugunsten des Ausschaltens fallen, d. h.das korrekte Freischalten des Hausan-schlusses.
Wenn man sich bewusst zur Arbeits-methode 2 entscheidet, also für das Ar-beiten in der Nähe von unter Spannungstehenden Teilen nach EN 50110-1, istsicherzustellen, dass geeignete Schutz-massnahmen angewendet werden. Hierhätte sich der Elektromonteur für diekomplette persönliche Körperschutz-ausrüstung sowie für Isolierwerkzeug
Wahrscheinlichkeit
Schaden-ausmass
häufig
unwahr-scheinlich
gelegentlich
praktischunmöglich
selten
kein
Sch
aden
schw
erer
Sch
aden
schw
erer
irrep
arab
ler
Sch
aden
leic
hter
irrep
arab
ler
Sch
aden
leic
hter
repa
rabl
erS
chad
en
Risiko-potenzial
gross
mittel
klein
x
3
3 Risikomatrix für den Hausanschluss.Nicht nur das Schadenmass, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden auftritt, mussberücksichtigt werden. Dazu eignet sich die Risikomatrix. Bei Unfällen mit Hausanschlüssen ist derSchaden oft gross, da die Kurzschlussströme hoch sind.
4 Niederspannungsverteilanlage mit der Sicherungsleiste, die ausgetauscht werden sollte.5 Die Anschlussfahnen der Sicherungsleiste erzeugten einen Kurzschluss zwischen den Polleitern.
Längssammel-schienen-Trennung
Kurzschluss zwischen denPolleitern mit den Anschluss-fahnen der Leiste 5
SicherungsleisteNH3
Längssammelschienen-Trennung 4

entscheiden müssen. Beides war im vor-liegenden Fall nicht vorhanden.
Arbeiten unter Spannung ohneSchutzausrüstungEine Elektroinstallationsfirma hatte denAuftrag, die Niederspannungsverteilan-lage in einer Trafostation umzubauen.Die Arbeit umfasste den Austausch ei-ner Sicherungsleiste NH3 gegen eineSicherungsleiste 2 x DIN 00 (Bild 4).Die Verteilung wird durch zwei parallelgeschaltete 630-kVA-Transformatorengespeist mit je einem Kurzschlussstromvon rund 20 kA. Die Verteilung ver-sorgt die umliegenden Gewerbe- undIndustrieanlagen mit Energie, daherwar eine Abschaltung schwierig, undman beschloss, den Austausch unterSpannung durchzuführen. Die Arbeitwurde durch zwei Elektromonteuredurchgeführt. Beim Lösen der Befesti-gungsschrauben und Anheben der Leis-te erfolgte ein 3-poliger Kurzschluss,der durch die Primärschutzeinrichtun-
gen erfasst und abgeschaltet wurde.Durch den entstandenen Lichtbogenerlitten beide Elektromonteure schwereVerbrennungen an Händen, Brust undGesicht. Sie trugen keine persönlichenKörperschutzausrüstungen. Die Vertei-lung wurde stark beschädigt.
Die NHS-Leiste war eine Längs-trennleiste für die Sammelschienen derPolleiter der beiden Transformatoren.Beim Anheben der NH-Leiste (Ele-ment) erzeugte die Anschlussfahne derSicherungsleiste einen Kurzschluss zwi-schen den Polleitern (Bild 5). Vor derDemontage war die Gefahr des Kurz-schlusses ohne Anlagenkenntnisse nichtoffensichtlich.
GefahrenermittlungZweifelsfrei ist der Kurzschlussstrom andieser Arbeitsstelle hoch. Der Störlicht-bogen kann ein grosses Ausmass anneh-men, und die Abschaltzeiten könnenkaum bestimmt werden – sicher nicht aufdie Schnelle. Der dritte Faktor, die Dis-
tanz zwischen der Arbeitsstelle und demKörper der arbeitenden Person, wird zwi-schen 30 und 50 cm liegen. Es wird alsoebenfalls in der Annäherungszone, d. h.innerhalb von 30 cm Distanz zu span-nungsführenden Teilen, gearbeitet, wasSchutzmassnahmen verlangt. Das Erken-nen der Gefahr setzt allerdings Erfahrungund Materialkenntnisse voraus.
RisikoeinschätzungIn diesem Beispiel ist die Eintretens-wahrscheinlichkeit für beide Gefahrenmit gelegentlich einzustufen und dasSchadensausmass mit Wirkung auf diearbeitenden Personen – im Falle einesKurzschlusses – mit schwer (Bild 6).
Wahl der ArbeitsmethodeDie Arbeitsmethode 1, das Arbeiten anfreigeschalteten Anlagen, wurde hiernicht in Betracht gezogen, weil dieEnergieverteilung komplexe Prozesseversorgte. Da es sich um Niederspan-nung handelte und spannungsführendeTeile planmässig nicht berührt werdensollten, fiel die Wahl auf Arbeitsmetho-de 2. Hier ist die komplette persönlicheKörperschutzausrüstung als Schutz-massnahme anzuwenden. Und zwar vonallen beteiligten Personen. Das Risikodes Sachschadens wurde akzeptiert –schlussendlich hat sich aber dadurchnach dem Ereignis eine unkontrollierteund längere Abschaltung ergeben.
Arbeiten im Fahrleitungsbereichvon BahnenEine Baugruppe hatte den Auftrag, ineinem Bahnhof an Gleis 1 und 3 dieFahrleitung zu regulieren. Das bedeu-tet, die Spurhaltermitnehmer richtig zumontieren, die Seilhänger abzuschnei-den und alte Klemmen von den Spur-haltern zu demontieren. Nach der Mit-tagspause nahm die Gruppe die Arbei-ten wieder auf. Um 12.35 Uhr verlang-te der Chefmonteur die Sperrung desganzen Bahnhofs beim Fernsteuerstell-werk. Nach der Bestätigung und dem
18 | Elektrotechnik 2/09
In
stal
latio
ns- &
Geb
äude
tech
nik Wahrscheinlichkeit
Schaden-ausmass
häufig
unwahr-scheinlich
gelegentlich
praktischunmöglich
selten
kein
Sch
aden
schw
erer
Sch
aden
schw
erer
irrep
arab
ler
Sch
aden
leic
hter
irrep
arab
ler
Sch
aden
leic
hter
repa
rabl
erS
chad
en
Risiko-potenzial
gross
mittel
klein
x
6
6 Risikomatrix beim Austausch der Sicherungsleiste.7 Integriertes Sicherheitssystem zur Reduktion von Unfällen.
1. Freischalten und allseitig trennen2. Gegen Wiedereinschalten sichern3. Auf Spannungslosigkeit prüfen4. Erden und kurzschliessen5. Gegen benachbarte, unter Spannung
stehende Teile schützen
(Art. 72 StV, Art. 22 NIV,Art. 6.2 EN 50110-1)
Die 5 Sicherheitsregeln
Gesamtverantwortung Eigeninitiative Kollektiv
Verantwortung fürSicherheitssystem im Betrieb
EigenverantwortungPersonal
Gesetze und Normen
Grundlage Kontrolle Akzeptanz Erfüllung Abmachungen Engagement
Anz
ahl U
nfäl
le
VerantwortungTeam
ManagementcommitmentÜberwachungVerbesserung NormenVorgaben, WeisungenArbeitsbedingungenDurchsetzungsvermögenMotivation, Anerkennung
TeamstrukturakzeptanzAusbildung, WeiterbildungTeamgeistGegenseitige WertschätzungGegenseitige UnterstützungVereinbarungenHilfe gegenseitigStolz als Kollektiv
FachwissenWeiterbildungEngagementGewohnheitenWeisungenVereinbarung einhaltenSelbstschutzStolz
Kommunikation
7

Elektrotechnik 2/09 | 19
Inst
alla
tions
- & G
ebäu
dete
chni
k
schriftlichen Festhalten auf der Check-liste verlangte er bei der Kreisleitstelle,die dazu zuständig ist, das Ausschaltendes Schalters 3 im Bahnhof. Dadurchwurde die Fahrleitung der Gleise 2 und3 ausgeschaltet; nicht aber diejenige derStrecke Richtung Norden (Strecken-trennung).
Mit dem Sperren des Bahnhofs sowiedem Ausschalten des Reparaturabschnittswurde die Arbeit in einer ca. 40-minüti-gen Zugspause in Angriff genommen. ImZugstraktor befand sich der Traktorfüh-rer, der auf Anweisung des Fahrleitungs-monteurs jeweils den Bauzug verschob.In der Hebebühne auf dem angehängtenWagen hielt sich der Fahrleitungsmon-teur auf. Als versierter Fachmann mitmehrjähriger Erfahrung führte er an derFahrleitung die vorgesehenen Arbeitendurch. Nach Bedarf gab er dem Traktor-führer den Auftrag, weiter vorzuziehen.Es lag in der Verantwortung des Fahrlei-tungsmonteurs, zu bestimmen, wie weitvorgezogen werden konnte, ohne in ei-nen Gefahren- oder nicht gesperrten Be-reich einzudringen.
Um 12.55 Uhr gab es im Bahnhof einenKurzschluss. Der Traktorführer, der sichzu diesem Zeitpunkt in der Führerkabinedes Schienentraktors befand, hörte einenKnall und sah, wie sein Arbeitskollege zu-sammenbrach. Sofort fuhr er aus dem Ge-fahrenbereich, kletterte auf die Hebebühneund liess diese hinunter. Anschliessendfuhr er zurück auf den Bahnhof, wo er dieRettungsmassnahmen einleitete. DerFahrleitungsmonteur erlitt schwerste Ver-brennungen.
Aufgrund der von der Kantonspolizeifestgehaltenen Spuren war der Verun-fallte offensichtlich im Bereich derStreckentrennung mit der unter Span-nung stehenden Fahrleitung in Kontaktgeraten. Er wurde durch einen Licht-bogen von der 15-kV-Leitung sowiedurch Gegenstände, die mit der Fahr-leitung in Kontakt gekommen waren,getroffen.
Die Streckentrennung umfasst mehre-re Meter Länge. Dabei wird die Stati-onsfahrleitung während einer längerenDistanz parallel zur Streckenfahrleitunggeführt und dann sachte davon weggelei-tet. Diese beiden Fahrleitungen berüh-ren sich nicht, es sind jedoch Induktions-ströme auf der ausgeschalteten Fahrlei-tung möglich. Ebenso könnte derStromabnehmer die beiden Fahrleitun-gen verbinden und so die ausgeschalteteFahrleitung unter Spannung setzen. Dieunter Spannung stehende Leitung ist zunah an der freigeschalteten.
Die Arbeitsstelle ist auf beiden Seiten
mit einer Erdungsstange zu erden undkurzzuschliessen. Erst nach dem Erdenist sichergestellt, dass der Stromkreisspannungslos ist. Im vorliegenden Fallwurde nur eine Erdungsstange stations-seitig angebracht. Die korrekt freige-schaltete Arbeitsstelle (Freileitung)befand sich in der Gefahrenzone vonbenachbarten, noch unter Spannungstehenden Teilen (zweite, über einigeMeter parallel geführte Leitung). DieseGefahr wurde nicht wahrgenommenoder ignoriert.
Unfälle können vermieden werdenBei der Risikoeinschätzung handelt essich nicht um eine genaue Wissen-schaft. Schadensausmass und Eintre-tenswahrscheinlichkeit sind von vielenEinflussfaktoren wie Erschrecken, Mü-digkeit oder plötzlich eintretenden Ver-änderungen von aussen abhängig. DieGefahren werden heute schon oft er-mittelt, wenn auch oft unbewusst undbei kleinen Arbeitseinsätzen nicht
schriftlich. Letzteres ist auch nicht im-mer gefordert, obschon es auch bei ein-facheren Arbeiten, beispielsweise auf ei-nen Notizblock skizziert, das Bewusst-sein des Ausführenden schärft.
Gehen wir vom Beispiel mit den Ka-belleichen aus: Diese weisen typischer-weise blanke Leiterenden auf, liegen ineinem metallenen Kabelkanal oder ra-gen aus der Wand und stehen unterSpannung. Solche Situationen stehenhäufig über Tage, Wochen oder Jahrean, ohne dass etwas passiert. Eine unbe-teiligte Person wird dann unverhofftelektrisiert: Hält sich eine Person mitder einen Hand am gut geerdeten Ka-belkanal und greift mit der anderen inden Kanal, ist der Unfall passiert. DieVerletzungen aufgrund der Elektrisie-rung und des Absturzes als Folgeereig-nis sind gravierend. Den Verunfalltentrifft indes keine Schuld, es liegt amElektrofachmann, der das Kabel nichtordnungsgemäss ausser Betrieb genom-men hat. Das Kabel hätte durch mehr
Die tödlichen Elektrounfälle im Jahr 2007
Personengruppe Wirksame Spannung
Einwirkung Kurzbeschrieb Ursache
Laien(Nicht-Berufsunfall)
NS Durchströmung Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte das Heizventil eines Heizradiators einen Defekt, sodass infolge des auslaufenden (tropfenden) Wassers der am Boden
verlegte Teppich feucht bis nass war (gut leitender Standort). Beim Umfassen der 2-poligen Anschlussschnur (mit einem Isolationsdefekt) einer Wandlampe, die an einer Steckdose T12 mit einem Stecker Typ 1 angeschlossen war, wurde das Opfer tödlich elektrisiert. Die vorgeschaltete Sicherung löste nicht aus.
• Mangel an Vorsichtsmass-nahmen
• Defekte Isolation (Versagen des Basis-schutzes und ungenü-gende Instandhaltung) des Anschlusskabels
• Leitender Standort gegen Erdpotenzial
• Fehlerstromschutzein-richtung nicht installiert (fehlender Zusatzschutz)
NS Durchströmung Das Opfer verwendete ein Elektrogerät der Schutzklasse II (sonder-isoliert) beim Baden in der Badewanne, wobei das Gerät ins Badewasser getaucht wurde. Das Opfer wurde tödlich elektrisiert. Der Strom-fl uss erfolgte vom Elektrogerät in das Wasser und über den metallischen Duschenschlauch (der im Badewasser eingetaucht war) und über die
Wasserleitung zum Erder. Die vorgeschaltete Sicherung (DI/6A) löste nicht aus, und das Gerät war noch in Betrieb, als man das Opfer tot auffand. Die elektrischen Installationen im Bad waren nach Nullung TN-C erstellt; es war kein Fehlerstromschutzschalter vorhanden.
• Verwendung von Elektro-gerät in der Badewanne
• Fehlerstromschutzein-richtung nicht installiert (fehlender Zusatzschutz)
NS Durchströmung Beim Baden rutschte der Haarföhn in die Badewanne. Das Opfer erlitt einen tödlichen Stromschlag. Der Haarföhn war noch in Betrieb, als man das Opfer auffand. Dieser heizte das Badewasser auf ca. 60 ºC auf. Die Elektroinstal-lationen im Bad waren zum Unfallzeitpunkt nach altem TN-C-System installiert und ohne Fehlerstromschutz-einrichtung. Lage eines Geräts in der Wanne: Der den Fehlerstrom begrenzende Widerstand setzt sich aus dem Ausbreitungswiderstand in der Umgebung des Geräts, dem Widerstand der Wassersäule und dem Ausbreitungswider-stand in der Umgebung der geerdeten Teile wie Abfl uss-ventil, Überlauf und gegebenenfalls eines eingetauchten Brauseschlauchs zusammen. Zur Stromaufnahme von Verbrauchern im Badewasser wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Das Eindringen von Wasser in elektrische Geräte führt zwar zu einem Anstieg des aufgenommenen Stroms, dieser bleibt aber im Allgemeinen zu klein, um eine vorgeschaltete Über-stromschutzeinrichtung zum Ansprechen zu bringen.
• Verwendung von Elektro-geräten im Handbereich der Badewanne
• Fehlerstromschutzein-richtung nicht installiert (fehlender Zusatzschutz)
Laien(Nicht-Berufsunfall)
Laien(Nicht-Berufsunfall)

Inst
alla
tions
- & G
ebäu
dete
chni
k
Aufmerksamkeit und etwas Nach-denken mit wenigen Handgriffen sicherstillgelegt werden können.
Bei einem weiteren Unfall berührteein Elektromonteur die spannungsfüh-renden Klemmen eines Trockentrans-formators, denn tragischerweise ging
er davon aus, dass dieser abgeschaltetsei. Zur Freischaltung wurde keinSchaltprogramm erstellt, die Verant-wortlichkeiten wurden nicht geregelt.Zudem klappte die Kommunikationnicht, denn die Zeit zwischen der Frei-schaltung und dem Arbeitseinsatz
betrug 16 Stunden. Vor Arbeitsbeginnfragte der verantwortliche Vorgesetztenicht nach, ob der Transformator aus-geschaltet sei. Tragisch ist, dass er demVerunfallten sagte, es sei freigeschal-tet, und sich dieser darauf verlassenhatte. Der laienhafte Arbeitsablauf un-ter der Verantwortung des Vorgesetz-ten führte zur Vollinvalidität seinesMitarbeiters.
SystematikUm die seit Jahren stagnierende Zahlder Unfälle weiter zu senken, mussmit Nachdruck beim Menschen undbeim Durchsetzen der Verhaltensre-geln durch Vorgesetzte angesetztwerden. Denn die technischenSchutzmassnahmen sind auf einemhohen Niveau, auch was die persönli-chen Schutzmittel und das Werkzeugbetrifft. Das T des TOP-Systems zurFestlegung von Massnahmen (Tech-nik, Organisation, Person) ist in derRegel erfüllt. Zu diesem Schlusskommt unter anderen ESB Net-works, die Staatsstelle zur Förderungder Arbeitssicherheit in Irland(Bild 7).
Um der Forderung nach wenigerUnfällen nachzukommen, ist eineSystematik einzuhalten (Tabelle 1).Die unter Grundvoraussetzungen er-wähnte Berufserfahrung hängt eng mitder zeitnahen Tätigkeit zusammen,d. h., die Erfahrung muss sich auf dieauszuführende Arbeit beziehen. Leichtvergessen geht beim Planen des Ar-beitseinsatzes das Festlegen des Arbeits-bereichs. Dabei ist die ergonomischeKomponente zu berücksichtigen. DerBewegungsradius mit Körperteilen oderGegenständen ist um ein Vielfachesgrösser als meist angenommen.
Gefahr bedeutet ein Zustand, ausdem ein Schaden entstehen kann, oh-ne die Anwesenheit eines Menschenzu berücksichtigen. Die Gefährdungist eine Gefahr unter Berücksichti-gung von anwesenden Menschen(Bild 8). Bei der Risikoeinschätzungfällt es uns leichter, das Schadensaus-mass zu beurteilen als die Eintretens-wahrscheinlichkeit, weil diese stark vonäusseren Einflüssen abhängig ist wieWetter oder plötzlich eintretenden Er-eignissen. Das Eintragen der Risikoein-schätzung in die Matrix lässt das Risikoerkennen (Bild 9). Das Risiko muss un-ter dem höchsten vertretbaren Risikoliegen. Durch gut durchdachte Schutz-vorkehrungen kann das Risiko gemin-dert werden, wodurch man die Grenzedes Restrisikos erreicht. Das vertretbare
20 | Elektrotechnik 2/09
Anzahl*) 1998 – 2007
in % aller Unfälle
Sicherheitswidrige Handlungen
ArbeitsbezogenSicherheitsregeln missachtet 627 64 %
Persönliche Schutzmittel 198 20 %
Schutzvorrichtungen 74 8 %
Werkzeug/Betriebsmittel 135 14 %
Personenbezogen
Akrobatische/risikobehaftete Arbeitsweise 197 20 %
Arbeitsanweisungen nicht befolgt, unbefugt unter Spannung gesetzt, widerrechtliche Installationstätigkeit 157 16 %
Erhöhter Zeitdruck 107 11 %
Sicherheitswidrige Zustände
Anlage und/oder Erzeugnis 384 39 %
Organisations-/umfeldbezogen
Arbeitsanweisung und Kontrolle 367 37 %
Arbeitsorteinfl üsse 60 6 %
Personenbezogen
Physische und psychische Verfassung des Arbeitsaus führenden 10 1 %
Kompetenz/Sachkunde 99 10 %
Total Elektroberufsunfälle 1998 – 2007 981
*) Sicherheitswidrige Handlungen bzw. Zustände
Restrisiko
mindestnotwendigeRisikominderung
angemessene Risikominderung
Risiko
hochniedrig
Sicherheit
Risiko ist nicht höherals höchstesvertretbares Risiko
Gefahr
Risiko ist höherals höchstes
vertretbares Risiko
höchstesvertretbares
Risiko
8
8 Vertretbares Risiko.

Risiko ist einerseits durch Gesetze, Verordnungen, Normen undandere Regeln der Technik definiert, andererseits aber auch durchgültige Wertvorstellungen der Gesellschaft. Bei Arbeiten im Teamsind die Risikogrenzen zu besprechen und für die anstehende Ar-beit festzulegen. Bei Uneinigkeiten entscheidet der Chef. Es istaber immer gut, wenn viele Beteiligte sich mit den Risiken befas-sen. Das fördert das Bewusstsein.
Schutzvorkehrungen sind die Gesamtheit der Schutzmass-nahmen. So ist beispielsweise das Abdecken von spannungs-führenden Teilen zu ergänzen mit dem Tragen von Handschu-hen oder der ganzen PSA. Hohe Anforderungen stellt das Be-wusstsein der Restrisiken. Es empfiehlt sich, im Team einander zuunterstützen und sich nach Arbeitsunterbrüchen die Situation er-neut in Erinnerung zu rufen.
Diese Ausführungen scheinen aufwendig und kompliziert.Da muss zwischen Arbeiten mit hohen oder kleinen Gefahrenund/oder von langer oder kurzer Dauer unterschieden wer-den. Bei kleinem Risikopotenzial wird der beschriebene Pro-zess ohne schriftliches Festhalten gemacht, während bei grös-serem Risikopotenzial die schriftliche Form auch bezüglichNachvollziehbarkeit bei Schäden oder Unfällen wichtig istund von der Starkstromverordnung eindeutig gefordert wird.
Durchsetzen heisst Verantwortung tragenWesentliche Pflichten im Arbeitsschutz richten sich an denUnternehmer, an die Vorgesetzten – auch in einem kleinenBetrieb. Unternehmer und Vorgesetzte können zwar Aufgabenauf Mitarbeiter übertragen, dies entbindet sie jedoch nichtvon ihrer grundsätzlichen Verantwortung. Arbeitsschutz bleibtimmer Chefsache. Das Verhalten des Chefs wirkt sich unmit-telbar auf jenes der Mitarbeiter aus. Arbeitsschutz muss zumselbstverständlichen Bestandteil der Organisation einer Arbeitwerden. Dabei ist es wichtig, unter Beteiligung der Mitarbei-ter die Arbeitsabläufe sicher und gesundheitsgerecht zu orga-nisieren. Es muss nicht nur festgelegt werden, wer im Betriebwofür zuständig ist, sondern beispielsweise auch, wie die Zu-sammenarbeit mit Partner- oder Fremdfirmen zu erfolgen hat.
Durchsetzen ist Knochenarbeit und geschieht auf zwei Ebe-nen: dem Kennen aller Elemente des eigenen Sicherheitssys-tems und dem konsequenten Durchsetzen in menschlicherund organisatorischer Hinsicht. Dies bedeutet:• die Führung, Organisation und Qualifikation der Mitarbeiter doku-
mentieren,• die Arbeitsbedingungen beurteilen,• die Mitarbeiter beteiligen, motivieren und unterweisen,• ein integrales Sicherheitssystem umsetzen,• aus Fehlern lernen.Durchsetzen heisst auch, einen Anfangseffort zu leisten undüber längere Zeit, beispielsweise über ein halbes Jahr, konse-quent zu kontrollieren, zu korrigieren und zu sanktionieren.Damit wird sich die Mehrheit der Mitarbeitenden automatischrichtig verhalten, es bildet sich eine Sicherheitskultur. Bei in-dividuellen Problemfällen ist zu sanktionieren, wenn notwen-dig bis hin zur Kündigung. Eine Kündigung hinterlässt – so-fern sie zu Recht erfolgt – bei den Mitarbeitern einen wegwei-senden Eindruck.
Bewährt haben sich die folgenden 4 Schritte: Zuerst werdendie Regeln und Systeme erklärt, begründet und gemeinsammit den Mitarbeitenden vereinbart. Dann werden die Sanktio-nen für den Fall der Übertretung bekannt gegeben. Die Ein-haltung wird regelmässig kontrolliert und konsequent zurück-gemeldet: sicheres Verhalten gelobt, bei Übertretung nachdem Grund gefragt. Bei nicht stichhaltigen Begründungen, al-so einer Ausrede, werden die Sanktionen umgesetzt.
Generalvertretung für die Schweiz:
Demelectric AG, Steinhaldenstrasse 26, 8954 GeroldswilTelefon 043 45544 00, Fax 043 455 44 11
e-Mail: [email protected]
e-Katalog: www.demelectric.chBezug über den Grossisten. Verlangen Sie unseren Katalog.
D03
alles halogenfreialles halogenfrei
Installations-technik für höchsteAnsprüche.
2_D_03_bearb.indd 1 4.6.2008 9:07:36 Uhr

22 | Elektrotechnik 2/09
In
stal
latio
ns- &
Geb
äude
tech
nik
MotivationDie Motivation der Mitarbeiter ist beson-ders wichtig, denn diese ist tief verwurzeltund zeigt eine immer wieder durchbre-chende Verhaltenstendenz. Es ist ein ei-gener Antrieb, dass ein selbst gestecktesoder vorgegebenes Ziel erreicht wird.Motivieren bedeutet dabei, Vorausset-zungen und Anreize zu schaffen, die dazuanregen, bestimmte Verhaltensweisen an-zunehmen. Dabei müssen die persönli-chen Bedürfnisse des einzelnen Mitarbei-tenden möglichst berücksichtigt werden,und das sicherheitsgerechte Verhaltenmuss mit Anerkennung, Statusgewinn,besserer Qualifikation oder Prämien be-lohnt werden.
Das Beeinflussen des Verhaltenswirkt vor allem dann, wenn gleichzeitigalle vertretbaren technischen und orga-nisatorischen Möglichkeiten ausge-schöpft werden. Denn Handlungsfehlerkönnen auch durch Motivation nichtganz vermieden werden. Das Durchset-zen des Sicherheitssystems und die Mo-tivation sind die besten Partner zur Re-duktion der Unfälle.
Angaben zu den AutorenAlfred Franz, dipl. El.-Ing. HTL, ist In-haber des Ingenieurbüros A. Franz in8610 Uster. Alfred Franz führt Beratun-gen und Projektleitungen für Elektroan-lagen, elektrische Energieversorgung so-wie Mess-, Steuer-, Regelungs- undEnergietechnikanwendungen durch.
Jost Keller, dipl. El.-Ing. HTL, ist Lei-ter «Sichere Elektrizität» (ESTI) undLeiter Weiterbildung (Electrosuisse).Jost Keller ist verantwortlich für das demESTI übertragene Suva-Mandat für diePrävention und die Abklärung von Un-fällen im Elektrobereich. Er ist fernerMitglied der Kommission für Sicherheitin Elektrizitätswerken des VerbandesSchweizerischer Elektrizitätsunterneh-men (VSE) und Mitglied des TK 64 so-wie des TC 64 Cenelec und IEC (TK64/TC 64: Electrical installation andprotection against electric shock).
Marcel Schellenberg arbeitet seit 2007bei Electrosuisse als Fachstellenleiter inder Weiterbildung. Vorher war er 10Jahre Projektleiter/Kontrolleur bei derH. Greuter AG in Zollikon. ■
Quelle: Gekürzte Fassung aus BulletinSEV/VSE 19/2008, Electrosuisse8320 Fehraltorf
Gru
ndvo
raus
setz
unge
n Fachwissen
+ Berufserfahrung+ zeitnahe berufliche Tätigkeit+ Weiterbildung des Kaders und der Mitarbeiter entsprechend
ihren Verantwortungsbereichen
Arb
eits
eins
atz
plan
en
1. Tätigkeit und Arbeitsbereich (örtlich) festlegen2. Gefahren und Gefährdungen identifizieren und auflisten3. Risikoeinschätzung vornehmen (Schadenausmass und Eintretenswahrschein lichkeit)4. Risikobewertung. Matrix ausfüllen entsprechend der Risikoeinschätzung5. Wahl der Arbeitsmethode gemäss EN 50110 unter Berücksichtigung der StV6. Schutzvorkehrungen aufbauen oder vorbereiten entsprechend
der gewählten Arbeitsmethode7. Restrisiko ermitteln, festhalten und während des Arbeitseinsatzes bewusst halten8. Mitarbeiter gemäss Fähigkeiten und Berechtigungen einsetzen
Arb
eite
n au
sfüh
ren Schutzvorkehrungen während des ganzen Arbeitseinsatzes aufrechterhalten und Rest-
risiko berücksichtigen und immer im Bewusstsein haben.
Nach Pausen Funktion der Schutzvorkehrungen kontrollieren und Restrisiken bewusst machen.
Keine UnfälleTabelle 1
Wahrscheinlichkeit
Schaden-ausmass
häufig
unwahr-scheinlich
gelegentlich
praktischunmöglich
selten
kein
Sch
aden
schw
erer
Sch
aden
schw
erer
irrep
arab
ler
Sch
aden
leic
hter
irrep
arab
ler
Sch
aden
leic
hter
repa
rabl
erS
chad
en
Risiko-potenzial
gross
mittel
klein
9
Tabelle 1 System zur Reduktion von Unfällen
9 Die Risikomatrix.

Elektrotechnik 2/09 | 23
Aut
omat
ion
& E
lekt
roni
k
Intelligentes Wohnen IW
Wohnkomfortbraucht Energie
Die Gebäudeautomation findet in derSchweiz zunehmend Eingang in den priva-ten Wohnbereich. Diese Tendenz läuft pa-
Beim Bundesamt für Energie erschien kürzlich der 86-seitige Schluss-bericht «Neueste Entwicklungen im Bereich Intelligentes Wohnen unddes damit verbundenen Stromverbrauchs». Die Autoren stellen fest, dassbei hohem Ausbaustandard bezüglich Vernetzung ein zusätzlicher Ver-brauch elektrischer Energie von 35% bis 55% auf der Basis eines typischenHaushaltstromverbrauchs entsteht. Bei einem einfachen Ausbau be-trägt der Strommehrverbrauch allerdings weniger als 3%. Im Bericht wer-den Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz angegeben.
Hans R. Ris rallel zur starken technischen Entwicklungvon Komponenten und Systemen. In denvergangenen Jahren wurden bereits ver-schiedene IW-Objekte (Bild 1) bezüglichdes Energieverbrauchs untersucht und
kürzlich durch weitere Untersuchungenund Messkampagnen ergänzt.
Im privaten Wohnbereich spricht manmeist nicht von «Gebäudeautomation»,sondern von «Intelligentem Wohnen» IW.Dadurch sind technische Lösungen möglich,die mehr Komfort, Flexibilität und Sicher-heit bieten und bei richtigem Einsatz auchdie Energieeffizienz erhöhen können.
Zusätzlicher Energieverbrauchnicht vernachlässigbarAlle untersuchten Objekte zeigen ge-mäss den Autoren, dass die Gebäudeau-tomation relevante Auswirkungen aufden Energiebezug hat bezüglich:• der zentralen Infrastruktur (Server)• einer allenfalls vorhandenen USV-
Anlage
1
1 Dreigeschossiges EFH «Savia», Baujahr 2005, 3 Personen mit hohem Ausbaustandard. Der jährliche Stromverbrauch steigt infolge intelligenter Vernetzung um 37%gegenüber einem gleichartigen EFH ohne Vernetzung.

24 | Elektrotechnik 2/09
A
utom
atio
n &
Ele
ktro
nik
• der Beleuchtungssteuerung (Dimmer,Aktoren z. B. für Jalousien)
• der zu wenig genutzten Möglichkei-ten der Steuerung zum Beispiel derHeiztemperatur bei Abwesenheit,Standby-Verbraucher abschalten usw.
Das Gebäude Netzwerk Institut GNI(Fachgruppe Intelligentes WohnenIW) definiert die Ausbaustandards undAbgrenzungen gemäss Bild 2. Die mög-lichen Ausbaustufen werden 4-stufigvorgeschlagen:• Grundausbau: Dieser besteht im We-
sentlichen aus der passiven Erschlies-sung der Räume mit Leerrohren, dievor allem für eine spätere Vernetzungdienen. Dazu zählt aber auch die Ins-tallation eines Kommunikationsnetz-werks, zum Beispiel Ethernet. Die zu-sätzlichen Investitionen werden auf
etwa 1 bis 1,5% der Gebäudebausum-me geschätzt.
• Einfacher Ausbaustandard: Dies ist dererste Ausbauschritt nach der passivenInfrastruktur. Vernetzt zu einemHaussteuersystem werden zum Bei-spiel Licht, Beschattung, allenfallsHeizung und Lüftung. Die zusätzli-chen Kosten zum Grundausbau betra-gen etwa 2% bis 4% der Gesamtbau-summe.
•Mittlerer Ausbaustandard: Dieser bein-haltet zusätzlich zum Beispiel Sicher-heitsfunktionen, Videosysteme, Anwe-senheitssimulation,Szenenbeleuchtung usw. Die Zusatz-kosten betragen etwa 1% bis 2% derGesamtbausumme.
• Hoher Ausbaustandard: Darunter ver-steht man die vollständige Integration
der verschiedenen Elemente derHaussteuerung, der Sicherheitsanlage,der Unterhaltungselektronik/Kom-munikation zu einem umfassendenHaussteuersystem. Die zusätzlichenKosten für diese Ausbaustufe liegen inder Grössenordnung von 2% bis 10%der Gesamtbausumme.
SteuerungssystemeDer Bauherr bzw. der Planer/Installateurkann auf eine grosse Auswahl an Systemenzurückgreifen. Bild 3 zeigt eine Übersicht.Die meisten Systeme sind proprietär,das heisst, sie werden nur von einemHersteller produziert und vertriebenund können meist nur mit grossem Auf-wand mit andern Systemen verknüpftoder ergänzt werden. Eine Ausnahmeist der KNX-Standard (früher EIB), dervon über 100 Herstellern kompatiblerGeräte unterstützt wird. Diese KNX-Geräte sind übergreifend miteinanderkombinierbar. Der Kunde hat so denVorteil, dass er nicht auf eine bestimm-te Firma angewiesen ist und auch späterseine Gebäudeautomation erweiternkann.
In Neubauten kommen vorwiegend Bus-lösungen zum Einsatz, bei Renovationenoder Nachrüstungen werden auch Funk-oder Powerline-Systeme verwendet.
Im vorliegenden Bericht wird erwähnt,dass das Intelligente Wohnen in der Schweiznoch nicht gross verbreitet sei. Und dass dieVielfalt der angebotenen Systeme den Bau-herrn eher verunsichere. Fatalerweise wür-den einige Installateure sich davor scheuen,ihren Kunden solche Lösungen anzubieten.
Energetische AspekteJe höher der Ausbaustandard ist, umsogrösser ist auch der Eigenenergiever-brauch der Systeme. Gleichzeitig er-schliesst der hohe Ausbaustandard durchdie Vernetzung der verschiedenen Ge-werke im Gebäude das grösste Einspar-potenzial. Auch einfache Systeme mit ge-ringem Eigenverbrauch können schonviel zur Erhöhung der Energieeffizienzbeitragen, zum Beispiel durch eine geziel-te Temperaturregelung für jeden einzel-nen Raum im Gebäude.
Tabelle 1 gibt einen qualitativenÜberblick der Aspekte Komfort, Flexi-bilität, Möglichkeiten der Energieein-sparung und Eigenverbrauch der ver-schiedenen Ausbaustufen.
Am Beispiel des dreigeschossigen EFH«Savia» für drei Personen mit hohemAusbaustandard wie• KNX-Bussystem (früher EIB) mit
Steuerungsserver für komplexe Funk-tionen und 15"-Touchpanel
3
2
2 Ausbaustandards beim Intelligenten Wohnen (GNI, Fachgruppe IW).3 Marktübersicht der Steuerungssysteme für den privaten Wohnungsbereich in der Schweiz.

Elektrotechnik 2/09 | 25
Aut
omat
ion
& E
lekt
roni
k
• Windows Mediacenter zur Steuerungund Bedienung von Multimedia-Anwendungen
• Raumtemperaturregelung über KNX•Präsenzmelder im Flur zur bewegungs-
optimierten Steuerung der Beleuchtung• Anwesenheitssimulation• Busfähige Meteozentrale zur Erfas-
sung der Wetterdaten• Alarmanlage, direkt in KNX realisiert• Kommunikationsverkabelung mit
separater Ethernet- und Koaxialverka-belung
• Web-Kamera zur Sicherheit
• Musiksteuerung über KNX• Fernzugriff via Internet möglichwurde der Elektrizitätsbezug für Intelli-gentes Wohnen bestimmt. Bild 4 zeigtdie Ergebnisse für den jährlichenStrombezug. Die jährliche Energieauf-nahme pro Gerät wurde aus der Leis-tungsaufnahme und der jährlichen Be-triebszeit für die drei BetriebszuständeNormalbetrieb, Bereitschaftsbetriebund Schein-Aus berechnet bzw. gemes-sen oder die Betriebszeit zusammen mitden Bewohnern geschätzt. Bemerkens-wert ist, dass die Autoren eine Schein-Aus-Funktion bei keinem der Gerätefeststellen konnten. Aus der Summe al-ler Werte ergibt sich der Energiebezugfür das Intelligente Wohnen.
Der totale Strombezug für die Ver-netzung beträgt bei diesem EFH knapp1900 kWh pro Jahr. Für eine 3-köpfigeFamilie in einem Einfamilienhaus rech-net man üblicherweise mit einemStrombezug (ohne Warmwassererwär-mung und ohne Vernetzung) von5000 kWh. Im Vergleich mit diesemRichtwert erhöht die Vernetzung denStrombezug um knapp 40%.
Auffallend ist der Mediaserver, der fürden Bereitschaftsbetrieb ebenso viel Stromverbraucht wie für den Normalbetrieb.Die bezogenen 700 kWh entsprechen ei-ner mittleren Leistung von rund 80 W.
5
4
Ausbaustufe Komfort Flexibilität System kann zum Energiespa-ren beitragen
Energiever-brauch System
Grundausbau 0 0 0 0
Einfacher Ausbaustandard ☺☺☺ ☺ ☺☺☺ ☺
Mittlerer Ausbaustandard ☺☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺☺ ���
Hoher Ausbaustandard ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ �����
4 Elektrizitätsbezug für Intelligentes Wohnen,alle Geräte, Objekt Savia
5 Strombezug infolge Vernetzung für vieruntersuchte Objekte.
Tabelle 1 Energieaspekte der Ausbaustufen. (Quelle: Raum Consulting)
Der Alleskönner MG2 Thermotransfer-drucker für die Kennzeichnung von:
• Kabeln • Klemmen• Adern • Drucktastern• Leitungen • Schaltelementen
Plica Produkte –Mehr als nur einen Blick wert !
Zürcherstr. 350 • CH-8501 Frauenfeld
Tel. +41 52 723 67 20
Fax +41 52 723 67 18
w w w . p l i c a . c h
2_Plica_MG2_bearb.indd 1 30.1.2009 9:03:26 Uhr

26 | Elektrotechnik 2/09
A
utom
atio
n &
Ele
ktro
nik
Damit dürfte er in diesem Objektdasjenige Haushaltgerät mit dem abso-lut höchsten Verbrauch sein, vor denHaushaltgrossgeräten wie Waschma-schine, Tumbler, Kochherd und Back-ofen. Der Mediaserver verursacht damitStromkosten von CHF 140.– pro Jahr,was in 5 Jahren ca. die Hälfte des An-schaffungspreises ausmacht.
Auch die Geräte der Kommunika-tion, speziell der Kabel-TV-Verstärker,und das DSL-Modem, sind nicht zuvernachlässigen. Mit Leistungen von 9und 11 Watt und einem Betrieb rundum die Uhr verbrauchen diese zwei Ge-räte zusammen mehr Energie als einmoderner Kühlschrank.
Zusammenfassend kann für das ObjektSavia festgehalten werden, dass nur 52%der elektrischen Energie für IntelligentesWohnen für den Normalbtrieb bezogenwerden, 48% für den Bereitschaftsbetrieb.
Dass die Vernetzung mit hohem Aus-baustandard zu einem massiv höherenStromverbrauch führt, stellen die Auto-ren auch bei anderen Objekten fest. InBild 5 fällt vor allem das Forschungs-haus «FutureLife» auf, wo die Vernet-zung mehr Energie benötigt als die üb-rigen Verbraucher! Die übrigen dreiObjekte zeigen sich zwar etwas günsti-ger, aber eine sinkende Tendenz stellendie Autoren des Berichtes nicht fest.
Umso deutlicher fällt der Unterschiedzwischen den komfortablen Anlagen undden einfachen Haussteuerungen auf, wieTabelle 2 zeigt. Offensichtlich sind heutesehr schlanke Systeme erhältlich, dieschon mit wenig Aufwand einen einfa-chen Ausbaustandard erlauben. Bei denkomplexen Systemen wird dagegennoch nicht in genügendem Mass auf dieEnergieeffizienz geachtet. Gerade beider Visualisierung werden unausgereifteLösungen eingesetzt, Server mit hoherLeistungsaufnahme laufen rund um dieUhr. Diese Problematik besteht seitdem FutureLife-Haus und ist nochnicht befriedigend gelöst.
Wie weiter?Die Autoren stellen nicht nur fest – siegeben auch Empfehlungen:• An das Bundesamt für Energie: Es ge-
nüge nicht, nur den Energieverbraucheinzelner Geräte zu begrenzen, son-dern der Blick sei auf den Gesamtkon-text der vernetzten Systeme zu fokus-sieren. Dies sei vorwiegend einInformations- und Kommunikations-problem in Zusammenarbeit mit derBranche. Als Ergänzung dazu sei dieErarbeitung von Leistungsgarantienoder Ausschreibungsunterlagen für
das Zusammenspiel von Servern undBedienstationen, speziell für ein funk-tionierendes Energiemanagement inBetracht zu ziehen.
• An die Branche: Hier sind nach Mei-nung der Autoren die Anlageplaner ge-fordert. So sei ein besonderes Augen-merk auf den Energieverbrauch vonServern und Bedienstationen zu werfen.Auch die Produkte- und Systemwahlhat Einfluss auf den Energieverbrauch.Nachfolgend sind einige Funktionen alsBeispiele zusammengestellt, die zurGrundausstattung eines Objektes miteiner Heimautomation des gehobenemAusbaustandards gehören sollten:– Heizung: Einzelraum- oder zumin-dest Zonenregulierung mit der ent-sprechenden Anzahl Temperatursen-soren. Wärmeabgabe drosseln beioffenem Fenster– Heizung und Brauchwarmwasser:Möglichkeit des Fernzugriffes, Absen-ken bei längerer Abwesenheit, Anhe-ben mit Zeitreserve vor der Rückkehr.– Standby-Verbrauch: Zentrale Aus-Funktion für alle Verbraucher überNacht oder bei längerer Abwesenheit(ausgenommen Anwesenheitssimula-tion und Sicherheitsfunktionen).– Beleuchtungssteuerung: automatisierteBeleuchtungssteuerung mit Hellig-keitssensoren und Präsenzmeldern.
• Gerätehersteller: Auch für die Geräte-hersteller haben die Autoren zweiEmpfehlungen bereit: Die Untersu-chung legt nahe, dass am Markt Be-darf für energetisch günstige Home-servers besteht. Auch für Systeme, wiezum Beispiel beim KNX sollten einfa-che, robuste Steuerungsserver mit tie-fem Eigenverbrauch angeboten wer-
den, die rund um die Uhr laufen kön-nen. Handelsübliche PC und Serversind für diesen Zweck nicht geeignet.Auch in Bezug auf die Visualisierungbesteht Handlungsbedarf. Es solltenstandardisierte Lösungen angebotenwerden, bei denen das Energiema-nagement im Zusammenspiel mit denBedienstationen einwandfrei und oh-ne grösseren Konfigurationsaufwanddurch den Benutzer funktioniert.
Sowohl Planer wie auch Bauherren undGerätehersteller beeinflussen mit derWahl der Systeme und Komponenten denEigenverbrauch für die Vernetzung stark.Speziell das Zusammenspiel von Steue-rungsservern und Bedienstationen bedarfeiner sorgfältigen Planung. Energiesparen-de Steuerungsfunktionen entfalten bishererst eine geringe Wirkung. Und es kann janicht sein, dass die Heimautomation prak-tisch zum grössten Energieverbraucher inder Wohnung mutiert. Auch beim einfa-chen Ausbaustandard des IntelligentenWohnens (Tabelle 2, Musterwohnung)entsprechen 137 kWh pro Jahr demStromverbrauch eines energiesparenden243-Liter-Kühlschranks der Klasse A+.Kurz zusammengefasst: Die gegenwärti-gen IW-Lösungen beinhalten noch ein be-trächtliches Entwicklungspotenzial! ■
Quelle:Schlussbericht: «Neuste Entwicklungenim Bereich Intelligentes Wohnen und desdamit verbundenen Stromverbrauchs».Ausgearbeitet durch Thomas Grieder/René Senn/Markus Gehrig im Auftrag desBundesamt für Energie BFE, 15. 09. 2008.Bezug der gesamten Publikation:www.intelligenteswohnen.com/iw_de/news.
Jährlicher Strombezug kWh
Objekt ohneVernetzung
zusätzlichVernetzung
Mehrverbrauchdurch Vernetzung
Jahr Bemerkungen
FutureLife-Haus 6140 6830 111% 2002 Hoher Ausbau-standard: mit IT und Multi-media-Vernetzung
Smarthome 6370 2381 37% 2005
EFH Meier 6500 3516 54% 2007
EFH Savia 5000 1864 37% 2007
Musterwohnung mit Feller Zeptrion
4500 83 2% 2007 Einfacher Ausbau-standard: keine komplexen Steuerungsfunktio-nen, keine Touch-panels
Musterwohnung mit Legrand Powerline
4500 137 3% 2007
Musterwohnung mit KNX
4500 63 1,5% 2007
Musterwohnung mit Theben Luxor
4500 137 3% 2007
Tabelle 2Tabelle 2 Zusätzlicher Strombezug für Intelligentes Wohnen, untersuchte Wohnobjekte und Labormes-sungen.

Elektrotechnik 2/09 | 27
Aut
omat
ion
& E
lekt
roni
k
BACnet-Serie - Folge 7
Die BACnet-Interope-rabilitätsregeln (Teil 2)
Nachdem in Teil 1 des Beitrags «BAC-net-Interoperabilitäts-Regeln» dieGrundlagen der Systemplanung, derBACnet-Adressierung und der Interope-rabilitätsbausteine (BIBBs = engl.«BACnet Interoperability BuildingBlocks») dargelegt wurden, werden inTeil 2 nun die Details der BIBBs erklärt.
BACnet-Interoperabilitätsbereich ( IOB)Die Festlegung von Interoperabilitätsbe-reichen (engl.: interoperability area
Die Folgen 6 und 7 erläutern die Interoperabilitäts-Regeln für BACnet.Denn BACnet erstellt man herstellerübergreifend nicht mit Plug and Play,sondern durch detailliertes Festlegen der geforderten Kommunikations-beziehungen.
Richard Staub «IA») stellt die Grundlage für eine Prüf-und Zertifizierbarkeit von GA-Produktendar. Erst damit ist eine Zuordnung vonbestimmten Produkten zu den Anforde-rungen eines Projekts möglich. Aus Sichteines Planers und Anwenders wird einBACnet-System mit einer Auswahl derbenötigten GA-Funktionen beschrie-ben, dazu kommt eine Vorgabe für dieAnforderungen an die Hardware. Dabeiist es vorerst noch nicht notwendig, dieBACnet-Eigenschaften der Produkte zukennen. Die fünf BACnet-Interoperabi-litätsbereiche sind:1. Gemeinsame Datennutzung, DS
(engl.: data sharing)2. Alarm- und Ereignisverarbeitung, AE
(engl.: alarm and event management3. Zeitplan, SCHED (engl.: scheduling)4. Trendaufzeichnung, T (engl.: trending)5. Device- und Netzwerkmanagement,
DM (engl.: device and networkmanagement).
Zweck des IOB «Gemeinsame Daten-nutzung» z. B. ist das systemübergrei-fende, gemeinsame Verwerten vonDatenpunkten, z. B. von Sensorinfor-mationen oder von abgeleiteten (berech-neten) Werten, das Verändern von Soll-werten und anderen Parametern, dasDarstellen von Werten in Grafiken undBerichten und die Datenhistorisierung.Die Kommunikation kann je nach Da-tenbehandlung in eine Richtung oder inbeide erfolgen. Die Interoperabilität ent-steht durch die Interpretation dieser Da-ten nach den Festlegungen im Protokoll.
Jeder IOB umfasst eine Anzahl anMerkmalen. Diese bestehen bei BACnetaus Interoperabilitäts-Bausteinen, so ge-nannten BIBBs, vergleichbar mit einemSpielzeugbaukasten. In der BACnet-Norm sind 72 BIBBs, sortiert nach denIOB, festgelegt. Jedes dieser BIBB-Merkmale erfordert wiederum, dass be-stimmte Elemente des BACnet-Proto-kolls in der betrachteten Einrichtung(implementiert) sind. Die BIBBs werdengrundsätzlich als «Akronym» mit denAnfangsbuchstaben des zugehörigenIOB, ihrer Dienstfunktionen und nachClient oder Server, also der Art der Da-tenbehandlung bezeichnet. Die Kenn-zeichnung der Datenbehandlung ist:• A für Daten-Anforderer (Client) und• B für Daten-Bereithalter (Server)Zum Beispiel:«DS-RP-A = Data Sharing-ReadProperty(Lese Information)-Anforderer«AE-N-B» = Alarm und Ereignismanage-ment-Notification (Meldung)-Bereithalter
Das interoperable Verhalten wird beiAnwendung der BIBBs und IOB mitden Device-Profilen bei einem Mini-mum an Aufwand vorhersagbar. MitHilfe der IOB wird die Aufgabe desPlaners von der Aufgabe des GA-Her-stellers entkoppelt. Als Ergebnis ent-steht eine Liste an BIBBs für die vorge-sehenen IOB, zugeordnet zu den im
2
1
1 Beispiel eines typischen Aufbaus einer BAC-net-Anlage mit unterschiedlichen Device-Typen.
2 Beispiel Interoperabilität B-OWS und B-BC,IOB SCHED (Zeitplan ) : Es sind mindestens8 Schaltzeiten (Ein/Aus ) pro Tag möglich, dieüber die OWS einstellbar sind.
Axim
a

28 | Elektrotechnik 2/09
A
utom
atio
n &
Ele
ktro
nik
Projekt erforderlichen Produkten (De-vice-Typen). Nach dieser kann der an-bietende Hersteller seine Produkte aus-wählen und die entsprechende Softwareimplementieren. Der Planer eines in-teroperablen heterogenen Systems kannanhand der Herstellerangaben in derProtokoll-Umsetzungsbestätigung undden Ausführungen weiter unten vorherprüfen, ob die gewünschte Interopera-bilität erreichbar sein wird. Ein PICSist Teil der Unterlagen eines Herstel-lers oder Auftragnehmers für jede imBACnet-System eingesetzte Einrich-tung. In den BACnet-Device-Profilensind die für den jeweiligen IOB vorge-sehenen BIBBs als Funktionselementeaufgeführt. Es folgt eine Beschreibungder einzelnen IOB.
BACnet-Device-TypIm BACnet-Standard sind sechs standar-disierte Device-Typen («Device-types»)beschrieben. Für reale Projekte, in denennicht nur «native» BACnet-Einrichtun-gen vorkommen, hat die BIG-EU einDevice-Profil für ein BACnet-Gatewayentwickelt. Mit «native BACnet» wer-den Einrichtungen bezeichnet, die sichohne internes oder externes Gateway mitanderen Einrichtungen interoperabelverhalten können – sie sprechen als«Muttersprache» BACnet.
Jede Einrichtung (Device), die allegeforderten BACnet-Elemente für ei-nen bestimmten IOB eingebaut (imple-mentiert) hat, ist ein Device-Typ nacheinem festgelegten Device-Profil. Diese
Device-Typen können auch zusätzlicheFähigkeiten enthalten, die dann inder Protokoll-Umsetzungsbestätigung(Protocol Implementation Conforman-ce Statement, PICS) angegeben seinmüssen (siehe weiter unten).Die momentan definierten Device-Typen sind:1. Bedien- und/oder Managementein-
richtung – BACnet Operator Work-station (B-OWS)
2. Automationsstation BC, universelleprogrammierbare Automationsein-richtung – BACnet Building Cont-roller (B-BC)
3. Controller AA, konfigurierbare Auto-mationseinrichtung – BACnet Advan-ced Application Controller (B-AAC)
4. Controller AS, parametrierbare Au-tomationseinrichtung (anwendungs-spezifische Steuer- und Regeleinheit) –BACnet Application Specific Controller(B-ASC)
5. netzwerkfähiges Schalt- und Stellgerät- BACnet Smart Actuator (B-SA)
6. netzwerkfähiger Fühler – BACnetSmart Sensor (B-SS)
7. BACnet-Gateway (B-GW) (nichtnormativ).
Zusätzlich wurde von der BIG-EU eineweitere Automationseinrichtung mit ei-nem speziellen Profil vorgeschlagen:Automationsstation BAS, programmier-bare Automationseinrichtung – BACnetBuilding Automation Station (B-BAS)(in Vorbereitung). Im Rahmen derWeiterentwicklung von BACnet werdenweitere Device-Typen (wie B-BAS und
B-GW) und deren Profile hinzukom-men. So ist abzusehen, dass die derzeiti-ge B-OWS das Spektrum an Bedien-und Managementeinrichtungen nurschwerlich zufrieden stellt.
Interoperabilitätsbewertung mit BIBBDie von einem Hersteller in den PICSangegebenen BACnet-Interoperabili-tätsbausteine (BIBBs) geben dem Pla-ner die Möglichkeit, Gebäudeautomati-onsprodukte verschiedener Herstelleruntereinander auf Interoperabilität zubewerten. Im einfachsten Beispiel hatein Device einen Temperaturfühler,dessen Messwert in einem Property ei-nes BACnet-Objekts steht. Die Soft-ware in einem anderen Device benötigtdiesen Temperaturmesswert. Die Ein-richtung mit dem Fühler nennen wir«Server». Um interoperabel zu sein,muss der Server eine Leseanforderungausführen und das Ergebnis als Antwortabsenden. Der Interoperabilitätsbausteinhierfür heisst «DS-RP-B» – das bedeu-tet Interoperabilitätsbereich «DS»Datenaustausch (Data Sharing) – «RP»lese Property (ReadProperty) – «B»Bereithalten (Server-Device). Die Ein-richtung mit der Software, die die Tem-peratur wissen will, nennen wir «Cli-ent». Der Client muss in der Lage sein,eine Leseanforderung zu senden unddie Antwort zu verarbeiten. Das BIBBfür diese Funktionalität nennt man«DS-RP-A» – «DS» Datenaustausch– «RP» lese Property – «A» Anfrage(Client-Device). Damit sind bereitszwei Interoperabilitätsbausteine(BIBBs) beschrieben, einer für die An-frage, einer für die Beantwortung. Nunkann es sein, dass ein Client auch einenSchreibauftrag erteilen möchte.
Die Automationseinrichtung (Server)mit dem Fühler hat auch einen Schaltaus-gang für die Beleuchtung. Der Client vonvorhin mit der Software, die die Tempera-
3
Der Promotor-Verlag bietet momen-tan folgende BACnet-Fachbücher an:BACnet Gebäudeautomation 1.4,Hans R. Kranz, 2. überarbeitete Aufl.Okt. 2006, das Standardwerk für denBauherrn, Planer und Betreiber,448 Seiten mit zahlreichen Abb.«BACnet und BACnet/IP/wie funkti-oniert das?», Prof. Friedbert Tierschund Christian Kuhles, 14 Kapitel, inkl.Beispiel für eine Projektierung und denBetrieb eines BACnet-Gebäudeauto-mations-Systems.Bezugsquelle: www.cci-promotor.de
BACnet-Fachbücher
Stau
bKr
anz
4
3 Beispiele von BIBBs im IOB DatavSharing DS.
4 BACnet-Gemeinschaft an derLight + Building 2008 war grösserdenn je: Integration von 30 Her-stellern auf einer gemeinsamenOperator Workstation.

Elektrotechnik 2/09 | 29
Aut
omat
ion
& E
lekt
roni
k
tur wissen wollte, will nun das Licht ein-schalten. Der Client sendet also einenSchreibauftrag an den Server um im ent-sprechenden Property den Aktualwert fürden Betriebszustand der Beleuchtung zuändern. Der Client will als Antwort erfah-ren, ob der Server den Schaltauftrag er-folgreich als Befehl ausgeben konnte. DieInteroperabilitätsbausteine heissen in die-sem Falle «DS-WP-A» und «DS-WP-B». «WP» steht für schreibe Property(WriteProperty). Grundsätzlich hat jedeInteraktion ein BIBB-Paar, welche sowohlden Client als auch den Server beschrei-ben. Solche BIBBs wurden für einegrosse Anzahl an interoperablen Funk-tionen geschaffen, die wir einzeln imFolgenden kennenlernen.
Die BACnet-BIBBsDie BIBBs sind eine Sammlung voneinem oder mehreren BACnet-Diens-ten. Diese Dienste und Funktionen sindbeschrieben in Form von A- und B-De-vices. Als Teilnehmer in einem BAC-net-Netzwerk agieren ein
• A-Device als Client (Nutzer oder An-forderer) und ein
• B-Device als Server (Datenquelleoder Bereithalter).
Für manche BIBBs gibt es allerdingsneben den normativen auch optionale
Objekte und Properties, oder es kannspezifische Einschränkungen bezüglichder Werte oder Dienstparameter geben.Solche projektspezifischen Besonderhei-ten sind ggf. preisrelevant und müssen beider Ausschreibung festgelegt werden.
Hier als Beispiel die BIBBs für DataSharing DS Quelle: BACnet-Standard,Anhang K (BIBBs) (Normativ), Ad-dendum b, 135 – 2004).
Profile der Standard-BACnet-DeviceIn Tabellen der Device-Profile wirdübersichtlich beschrieben, welcheBIBBs von jedem BACnet-Device-Typim jeweiligen IOB unterstützt werdenmüssen. Hier als Beispiel IOB DataSharing:
Es ist Aufgabe der Planung, den für einProjekt insgesamt erforderlichen Inte-roperabilitätsbereich und daraus abge-leitet die BACnet-Interoperabililitätsbau-steine (BIBBs) für die unterschiedlichenEinrichtungen (Devices) festzulegen. Ausden in diesem Kapitel beschriebenen Inter-operabilitätsregeln ersieht man unschwer,dass der entsprechende Planer eine entspre-chend intensive Schulung und Erfahrungmitbringen muss, um diese Aufgaben er-folgreich zu bewältigen. Für eine bessereMarktdurchdringung von BACnet und einerationellere Bearbeitung werden in Zukunftsicher noch weitere Tools und Hilfsmittelhinzukommen müssen.
Hinweis: Diese Folge basiert auf einerReihe von Fachartikeln von Dipl.-Ing.Hans R. Kranz, Berater bei HAK Un-ternehmensberatung und Leiter ver-schiedener GA-Normierungsgremien. ■
5
Lfd.Nr.
BIBB-Bezeichnung BIBB-Kürzel, A=Anfordernd;B=Bereitstellend
BAC-net-Nr.
DS Gemeinsame Datennutzung (Data Sharing BIBBs)
DS- 1
1. BIBB – Data Sharing-ReadProperty-A/BA liest Property von B.
DS-RP-A/B 1.1
2. BIBB – Data Sharing-ReadPropertyMultiple-A/BA liest mehrere Werte gleichzeitig von B.
DS-RPM-A/B 1.3
3. BIBB – Data Sharing-ReadPropertyConditional-A/B A liest gemäss Bedingung Property von B.
DS-RPC-A/B 1.5
4. BIBB – Data Sharing-WriteProperty-A/BA schreibt auf Property in B.
DS-WP-A/B 1.7
5. BIBB – Data Sharing-WritePropertyMultiple-A/B A schreibt mehrere Werte gleichzeitig in B.
DS-WPM-A/B 1.9
6. BIBB – Data Sharing-COV-A/B A abonniert Wertänderungen von B.
DS-COV-A/B 1.11
7. BIBB – Data Sharing-COVP-A/B A abonniert Wertänderungen eines speziellen Property von B.
DS-COVP-A/B 1.13
8. BIBB – Data Sharing-COV-Unsolicited-A/B A verarbeitet unaufgefordert gesandte COV-Werte von B.
DS-COVU-A/B 1.15
5 BACnet dringt immer mehr auch in die Raumautomation ein: Hier von TACkombiniert mit Funkkommunikation.
Stau
b
Device-Type
B-OWS B-BC B-AAC B-ASC B-SA B-SS B-GW
DS-RP-A, B DS-RP-A, B DS-RP-B DS-RP-B DS-RP-B DS-RP-B DS-RP-B
DS-RPM-A DS-RPM-A, B DS-RPM-B DS-WP-B DS-WP-B DS-RPM-B
DS-WP-A DS-WP-A, B DS-WP-B DS-WP-B
DS-WPM-A DS-WPM-B DS-WPM-B DS-WPM-B
DS-COVU-A, B

30 | Elektrotechnik 2/09
#
Trennen Sie noch?Platzieren Sie Ihre Dosen schnell, sicher und fehlerlos, wann
und wo Sie wollen. Und versetzen Sie sie einfach bei einer
Nutzungsänderung. Denn Sie müssen bei der Installation
keine Kabel mehr durchtrennen.
Und mit der neuen Raptor-Linie mit Piercing-Technologie
erleben Sie, wie Starkstrom und Bus mit einem Klick
angeschlossen werden.
Frischer Wind für die Welt der Gebäudeautomation.
RAPTOR
ecobus combi
ecobus data
Mehr Informationen unter:www.woertz.ch oder
Tel. +41 (0)61 466 33 44

Elektrotechnik 2/09 | 31
Lich
t & L
euch
ten
Höherer Komfort mit weniger Energie
Lichtsteuerungim Modul
Dimlite eignet sich besonders für dieAnwendung in Büros, Besprechungs-und Schulungsräumen, Fluren undanderen Bereichen, in denen dynami-sche Lichtlösungen mit geringeremInstallationsaufwand erreicht werdensollen. Zusätzlich bietet das Licht-steuerungssystem eine besonderskomfortable Möglichkeit zur Energie-einsparung.
Modularer SystemaufbauGemäss dem Motto «Stück fürStück» bzw. nach dem Prinzip einesPuzzles werden gemäss Bild 1 an einemBasismodul nur jene Komponenten instal-liert, die für das jeweilige Projekt benötigtwerden. Bereits das Basisgerät bietet vielepraktische Funktionen wie Dimmen, eineLichtstimmung sowie die zentrale EIN-/AUS-Funktion. Der modulare System-aufbau bietet viele Vorteile für den Ins-tallateur und für den Nutzer. Das zent-rale Modul ist die Basiseinheit und lässt
Das neue Lichtsteuerungssystem Dimlite von Zumtobel bietet einen einfa-chen Einstieg in die Welt der intelligenten Lichtsteuerung. Das System istmodular aufgebaut und lässt sich an die individuellen Bedürfnisse anpassen.
Hans R. Ris sich durch verschiedene Ergänzungs-module erweitern. So stehen ein Prä-senzmelder, Infrarot-Fernbedienung,Lichtsensor, Circle-Bedienstelle oder einSzenenmodul für das Abrufen vonLichtstimmung zur Auswahl.
Für DSI- und DALI-KomponentenEin besonderer Vorteil ist die Möglich-keit, sowohl DSI-Komponenten als auchDALI-Komponenten anschliessen zukönnen. Jeder Ausgangskanal ist daraufausgelegt, DSI- oder DALI-Moduleaufnehmen zu können. Ein besondererVorteil ist die sofortige Betriebsbereit-schaft der Anlage nach der Installation.Aufwändige Inbetriebnahmeprozessekönnen entfallen und vordefinierteLichtstimmungen stehen auf Abruf be-reit. Alle Leuchten können von zentra-ler Stelle ein- und ausgeschaltet wer-den. Dimlite erzeugt sowohl DSI- alsauch DALI-Lichtsteuersignale undkann über entsprechende Betriebsgerä-te alle Arten von Glüh- und Leucht-stofflampen sowie LEDs ansteuern.
Darüber hinaus werden alle Eingangs-module automatisch integriert. Soordnet Dimlite alle Sensoren und Be-diengeräte gleich richtig zu. Ein wei-teres Plus sind die polaritätsfreienSteuerleitungen, die mit handelsübli-chem NYM-Material verkabelt werdenkönnen.
Energieverbrauch senkenDimlite bietet viele Möglichkeiten, umden Energieverbrauch zu senken undgleichzeitig die Qualität und Flexibilitätder Beleuchtung, wie zum Beispiel inSchulräumen (Bild 2), zu erhöhen. Zu-sätzliches Einsparpotenzial bieten An-wesenheits- oder Multifunktionssenso-ren, die gleichzeitig den Bedienkomforterhöhen. Eine Dimlite-Lichtsteuerungarbeitet lastfrei, sodass ausgeschalteteLeuchten vom Stromnetz getrennt sindund daher null Energie für den Stand-by-Betrieb verbrauchen. Der Ausbau istdabei auch zeitlich versetzt möglich, so-dass sich die Anlage jederzeit an verän-derte Nutzungsanforderungen anpassenlässt. ■
Quelle: Nach Unterlagen von ZumtobelLighting GmbH, www.zumtobel.com
12
1 Plug & Play! Wie ein Puzzle lässt sich das mo-dulare Dimlite-System aufbauen und bei Be-darf zu jedem Zeitpunkt ergänzen. Alles wasder Installateur für den Einbau und die Inbe-triebnahme einer Dimlite-Lichtsteuerung benö-tigt, ist ein Schraubenzieher. Mit einem Druckauf die Testtaste am Dimlite-Basismodul erfolgtnach der Installation die Betriebsfreigabe.
2 Dimlite hält in Klassenzimmern die für denUnterricht typischen Lichtstimmungen – Ein-zel-, Gruppen- oder Frontalunterricht aufKnopfdruck bereit. Dazu wurden die Leuchtenin vier Gruppen geteilt, jede Einzelne davonist via DALI dimmbar. TageslichtabhängigeSteuerung und Präsenzmelder dimmen undschalten das Licht automatisch aus, sobald esnicht mehr benötigt wird.

32 | Elektrotechnik 2/09
Fo
rsch
ung
& U
mw
elt
Walter Bruch – zum Gedenken an seinen 100. Geburtstag
Vor gut 100 Jahren wurde am2. März 1908 in Neustadt (Haardt) derFernsehtechniker Walter Bruch geboren.Man nennt ihn auch «Papa PAL» oder denVater des PAL-Farbfernsehens.
Der Kaufmannssohn Walter erlerntenach seinem Schulbesuch zunächst denBeruf eines Maschinenschlossers. Dannschloss sich ein Ingenieurstudium an.Während der Studienzeit in Berlin er-warb er sich technisch-theoretische Vo-raussetzungen für seine seit 1930 be-triebene Hinwendung zur aufkommen-den Fernsehtechnik. Nach seinem Stu-dienabschluss arbeitete Bruch in Berlinim Laboratorium des Physikers Man-fred Baron von Ardenne. 1933 bis 1935war Bruch im Fernsehlabor des unga-risch-deutschen Technikers Denes vonMihály beschäftigt, der sich auf demGebiet des mechanischen Fernsehensmit der Nipkow-Scheibe einen Namengemacht hatte.
Doch schon bald erkannte Bruch diephysikalischen Grenzen der Lochschei-be, des Spiegelrades und des Linsen-kranzabtasters für die fernsehtechnischeWeiterentwicklung. Bruch wechselte imJahr 1935 zur Berliner Firma Telefun-ken über. In deren Fernsehabteilung ar-beitete er gemeinsam mit Fritz Schröteran der Entwicklung des ersten deut-schen industriell gefertigten Fernseh-empfängers und an einer elektronischenFernsehaufnahmekamera, dem Ikonos-kop. Professor Fritz Schröter erhielt
Papa PALHeinz Bergmann von der RCA bei einem Besuch in den
USA ein Muster der Ikonoskop-Röhre,die eine elektronische Bildaufnahme er-möglichte. Im Tausch dafür bekam dieRCA Leuchtstoffe von Telefunken, diebesser als die der Amerikaner waren.Schröter führte zur Flimmerreduzie-rung das Zeilensprungverfahren ein. Indieser frühen Fernsehzeit war an derEntwicklung der Ikonoskop-Kameraauch Walter Bruch beteiligt, der sichdem elektronischen Teil widmete.
Ein erster Höhepunkt für WalterBruch war sein Einsatz als Fernsehka-meramann an der Berliner Olympiade1936. Auf der Weltausstellung in Parisim Jahre 1937 führte Bruch das von ihmentwickelte 375-Zeilen-Fernsehen vor,und ein Jahr später folgte ein vollelekt-ronisches Fernsehstudio bei der Reichs-post, das mit 441 Zeilen arbeitete.Während des Zweiten Weltkriegs ar-beitete Bruch an einer der ersten Ka-meras für ein industrielles Kabelfernse-hen.
Nach Kriegsende betrieb Bruch inBerlin von 1946 bis 1950 ein eigenesEntwicklungslabor für Elektrophysik.Danach setzte er seine Tätigkeit bei Te-lefunken fort und wandte sich verstärktden Fragen des Farbfernsehens zu. ImJahre 1951 beriet die CCIR in Genfüber eine Fernsehnorm. Der SchweizerPostingenieur Walter Gerber schlugdabei eine Zeilenzahl von 625 mit 25Bildwechsel/s und einer Videoband-breite von 5 MHz vor. Im Jahre 1952schlossen sich neun europäische Länderdieser nach dem Schweizer genanntenGerber-Norm an. Diese Entscheidungwar auch bedeutend für die weitere Ar-beit von Bruch. Im Jahr 1959 wurdeihm die Leitung des Fernsehlabors beiTelefunken übertragen.
Die Mängel des 1953 in den USAeingeführten NTSC-Verfahrens (Na-tional Television System Committee)hatte Bruch erkannt. Auch das vondem französischen FernsehtechnikerHenri de France im Jahre 1956 entwi-ckelte Secam-Verfahren (Système encouleur avec mémoire) bildete seinerMeinung nach nicht die günstigsteLösung. Nach mehrjähriger For-schungsarbeit konnte Bruch sein
Farbfernsehsystem am 3. Januar 1963in Hannover im Fernsehlaboratoriumvon Telefunken einer Gruppe euro-päischer Fernsehfachleuten vorführenund die Vorteile des «PAL-Verfah-rens» (Phase Alternation Line) im Ver-gleich mit dem NTSC- und demSecam-Verfahren demonstrieren. DasPAL-Verfahren kompensiert die Pha-senfehler der Farbdifferenzsignale, diezu Farbverfälschungen führen können.Es folgten zahlreiche Vorführungen,die Walter Bruch in verschiedene Län-der Europas führten und das PAL-Ver-fahren bekannt machten. Die Fernseh-techniker konnte er meist überzeugen,die Entscheidungsträger waren oft anpolitische Vorgaben gebunden. Bruchkommt der Verdienst zu, schon frühzei-tig geeignete Transcoder für die Nor-menwandlung entwickelt und eingesetztzu haben. Nach Überwindung einerReihe kommerzieller und politischerVorbehalte hatten sich bis Dezember1982 bereits 61 Länder für die Einfüh-rung des PAL-Farbfernsehverfahrensentschieden.
Der Start des Farbfernsehens nachdem PAL-Verfahren in Deutschlandfiel auf den 25. August 1967. In derBerliner Funkausstellung erwarteten1200 Ehrengäste den Start des Farb-fernsehens. Das Bild erschien zunächstnoch in Schwarz-Weiss. Dann drückteWilly Brandt nach seiner Festrede aufden grossen roten Knopf und gab sosymbolisch die Farbkameras frei. Einoffenbar aufgeregter Fernsehtechnikerim Ü-Wagen schaltete aber wenige Se-kunden vor dem Knopfdruck bereits dieFarbe zu, eine Panne oder Kuriosum,das in die Geschichte einging. Abendslief das erste bunte Unterhaltungspro-gramm mit Vico Torriani im ZDF.
Am 15. August 1967 wählte der Bun-desrat für das Farbfernsehen in derSchweiz das PAL-System. Die Einwei-hung des Farbfernsehens in derSchweiz erfolgte am 1. Oktober 1968im Fernsehstudio «Bellerive» in Zü-rich. Vorerst wurde etwa sechs Stun-den pro Woche in Farbe ausgestrahlt.
Walter Bruch lehrte von 1968 biszu seiner Emeritierung 1973 als Pro-fessor an der Technischen UniversitätHannover. In Würdigung seiner Leis-tungen erhielt er den Werner-von-Siemens-Ring, 1980 den Wladimir-Kosma-Zworykin-Preis und die Eh-rendoktorwürde der TH Hannoververliehen. Er war auch in zahlreichenGremien als Leitungsmitglied oderBerater tätig. Walter Bruch starb am5. Mai 1990 in Hannover. ■

Elektrotechnik 2/09 | 33
#
100
jahr
e an
s an
ni
Feller AG I www.feller.ch
WELTNEUHEIT PIRIOS DALIpirios DALI ist der weltweit erste Bewegungsmelder mit aktiver DALI-Schnittstelle. Für bis zu 25
DALI-Geräte kann so direkt die Busspannung zur Verfügung gestellt werden. Ein sehr einfacher
Anschluss sowie eine kostensparende Konfiguration sind das überzeugende Resultat. Alle Steuer-
geräte für die im Broadcast-System betriebenen Leuchten kommen ohne Programmierung aus und
schalten, bzw. dimmen gemeinsam. Natürlich verfügen auch die neuen pirios DALI-Geräte über die
vorteilhaften pirios-Funktionen wie Ausschaltvorwarnung und Grundbeleuchtung.
SORTIMENTSERGÄNZUNG ZEPTRION DALIGleichzeitig lanciert Feller im zeptrion-System die DALI-Hauptstelle, welche ebenfalls bis maximum
25 DALI-Vorschaltgeräte oder -Trafos direkt ansteuert. Die bewährten zeptrion-Anwendungen wie
Infrarot-Fernbedienung, Zentral-, Gruppen- und Szenenfunktion oder Zeitschaltuhr-Steuerung sind
somit jetzt auch für DALI-Leuchten jederzeit möglich.
Feller sprichtDALI

34 | Elektrotechnik 2/09
El
ektro
plan
ung
& B
erat
ung
Arbeitsteilung statt Abschiebung oder Entzug der Verantwortung
Fachbauleitung heute
Werfen wir doch einen Blick auf eine klas-sische Baustelle in der heutigen Zeit, wiesie sicher jeder Leser schon erlebt hat.
Situation auf BaustellenMeist vor Beginn der Arbeiten oder amAnfang eines Projektes ist der Planermit der folgenden Frage konfrontiert:
«Haben Sie die Installationsanzeige(IA) schon gemacht oder muss ich dasnoch erledigen?»
Die Erstellung der Installationsanzei-ge gehört ohne jeden Zweifel zur Auf-gabe des Elektrounternehmers, welcherauch über die dafür nötige Installations-bewilligung verfügt. Noch hat langenicht jedes Ingenieurbüro eine Installa-tionsbewilligung. Zumal die Nieder-spannungsinstallationsverordnung (NIV)im Art. 23 zur Meldepflicht eine klareAussage macht.
Wer kennt die Baustellen nicht, andenen der Grossist als Materiallieferantdes Unternehmers zwei- bis dreimal imTag vorfährt und eine kleine Lieferungabgibt. Liegt man nicht im Einzugsge-biet, welches mehrmals beliefert wird,so holt sich der bauleitende Monteurdie nötigen Sachen gleich selbst im«Fabrikladen» des Grossisten. So hörtman doch von «bösen Zungen» immerwieder den Satz: «Suchst Du einenElektriker? An der Theke des Grossis-ten findest Du sie und hast erst nochdie grösste Auswahl!»
Die Personalplanung für die Abde-ckung der Baustellenbedürfnisse wirdzum Teil kaum gemacht. So werdendann am Vormittag per Handy nochschnell 2–3 Personen (Lehrlinge, Elek-
Bedingt durch die heutige Preissituation auf Baustellen können wir immermehr feststellen, dass Unternehmer sich der Führung der Baustelleentziehen oder diese Aufgaben nur bedingt wahrnehmen. Es wird versucht,einzelne Aufgaben der Fachbauleitung oder dem in solchen Sachen wenig erfahrenen Monteur auf der Baustelle abzuschieben. Diese Situa-tion führt immer wieder zu Problemen im Arbeitsablauf und als Folgedavon zu Überzeitaktionen oder gar Wochenend- und Nachtarbeit.
Marcel Schöb tromonteure etc.) aufgeboten oder um-disponiert. Diese Aktionen könntendurch eine gute Arbeitsvorbereitung(AVOR) vermieden werden.
Nicht wenig wird der Planer ange-fragt, ob die Zuleitungslänge gemässAusschreibung so bestellt werden kann.Zum Teil erfolgt diese Bestellung auchohne Rückfrage. Dies führt dann zu ei-nem Kabel, das vielleicht um 2 m zukurz ist oder, der vielleicht etwas weni-ger schlimmere Fall, zu lang ist.
Auftretende Probleme müssen sofortper Handy oder dgl. mit den zuständigenStellen gelöst werden. So kann es rascheinmal sein, dass der verantwortliche Pro-jektleiter im Ingenieurbüro 4–5-mal amTag angerufen und mit Problemen kon-frontiert wird, welche auch schon am vor-herigen Tag beim ordentlichen Baube-such behandelt werden könnten.
An Baustellenkoordinationssitzungen,Bausitzungen oder wie die Besprechun-gen auch immer benannt werden, fehltmeist der Projektleiter des Elektro-Ins-tallationsunternehmens als Einziger. Al-le anderen Unternehmer sind mit denentsprechenden Personen vertreten.Zum Teil lässt sich der Projektleiterdann durch den bauleitenden Monteurvertreten, der verständlicherweise zubetriebswirtschaftlichen Fragen (Mehr-kosten, Regie etc.) meist keine Stellungnehmen kann. Oft fehlen ihm auch dieentsprechenden Kompetenzen. Somitmüssen diese Fragen an den Projektlei-ter weitergeleitet werden und diesernimmt dann anschliessend telefonischoder schriftlich Stellung.
Das fortlaufende Erfassen bzw. Auf-nehmen des Nachmasses fällt dochmeistens unter den Tisch. Aussagen wie
«Das machen wir dann am Schluss,jetzt haben wir keine Zeit» gehören zurTagesordnung. Dieser Umstand verzö-gert meist auch die Lieferung derSchlussrechnung entsprechend. Wasbei der nachträglichen Erfassung desAusmasses vergessen geht, sei einmaldahingestellt, der Bauherr bedankt sich.
In vielen Betrieben fehlt heute die Zeitfür die Ausbildung des Montageperso-nals. So wird es mindestens kommuni-ziert. Somit fällt diese Aufgabe «automa-tisch» dem Elektroplaner zu, welcherversucht die wichtigsten Punkte einerneuen Technik/Technologie währenddes Baubesuchs an das Montagepersonalweiterzugeben bzw. zu vermitteln. ZumTeil sind die Planer auch gezwungen«Installationsrichtlinien» etc. zu erstel-len, welche dem Montagepersonal abge-geben werden können. Wie weit dies mitElektroplanung zu tun hat, lass ich andieser Stelle im Raum stehen.
Sobald die Baustelle abgeschlossen ist,ist der bauleitende Elektromonteur aufder nächsten Baustelle. Im Elektroingeni-eurbüro «wartet» man(n) auf die Liefe-rung der Unterlagen, damit die Revisi-onsakte (Pläne des ausgeführten Werkes)erstellt werden können. Die von Handnachgeführten Pläne und Schemas wer-den erst nach mehrmaliger Ermahnungund Zurückhalten der Schlusszahlungnachgereicht. Sie mussten meist erst nocherstellt werden, auf Plänen, die der Elekt-roingenieur nochmals an den Unterneh-mer geliefert hat. Wie genau diese Anga-ben nach 3– 4 Jahren Bauzeit noch stim-men lassen wir einmal dahingestellt.
Auf vielen Baustellen gehören die obi-gen Punkte zur Tagesordnung. Anschei-nend können sich diese Unternehmensolche Zustände leisten. Dabei ist dochdie Aufgabenteilung zwischen Planer undUnternehmer in der Führung einer Bau-stelle in den einschlägigen Dokumentenund Normen wie der SIA eindeutig ge-regelt. Diese Aufgabenteilung liegtauch den Kalkulationsunterlagen desVSEI zugrunde. In diesen Unterlagen,wird von der «Technischen Bearbei-tung (TB)» gesprochen. Diese ist indrei Teile TB-A, TB-B und TB-C auf-geteilt.

Elektrotechnik 2/09 | 35
Elek
tropl
anun
g &
Ber
atun
g
Technische Bearbeitung A, B und CIm Elektrogewerbe gibt es keine Arbeitenohne Technische Bearbeitung (TB). Je-dem Auftrag bzw. Arbeit geht die Pla-nung, Anmeldung etc. voran. Nach Ab-schluss der Arbeit folgt die Schlusskont-rolle nach NIV mit dem Sicherheits-nachweis etc. All diese Arbeiten habeneinen Zusammenhang mit der eigentli-chen Installationsarbeit, werden aberselten auch vom Installationspersonalerledigt. Sie werden meistens vom fach-kundigen Leiter des Unternehmens,dem verantwortlichen Projektleiter etc.,erledigt.
Die gesamte Technische Bearbeitungwird gemäss SIA 108 (Ausgabe 2003Art. 3.2) in die einzelnen Phasen undTeilphasen gegliedert.
Die Arbeiten der TB-A und TB-Bkönnen als separater Auftrag an Elekt-roingenieurbüros oder Elektrounter-nehmer vergeben werden. Sie umfassenden klassischen «Planungsauftrag». ImGegensatz dazu umfasst die TB-C sämt-liche nötigen Nebenarbeiten. Diesemüssen zwangsläufig durch den Elekt-rounternehmer selbst erbracht werden.
Für den Elektrounternehmer ist es un-erlässlich, bei der Offertstellung klar undeindeutig zu deklarieren, welche Anteileder Technischen Bearbeitung in seinemAngebot eingerechnet sind. In Ausschrei-bungen wird dies meist in Form einer Ta-belle durch die ausschreibende Instanzangegeben. In bestimmten Fällen mussder genaue Umfang der zu erbringendenTechnischen Bearbeitung mit einem Te-lefongespräch rückgefragt werden. Nunliegt es am Elektrounternehmer, die rich-
tigen Schlüsse aus diesen Informationenzu ziehen, denn nicht wenig «fehlt» einTeil der Technischen Bearbeitung. Sowird das ausschreibende Elektropla-nungsbüro zum Beispiel nur bis und mitPhase 4 beauftragt. Die Phase 5 «fehlt».Dies zeigt sich spätestens, wenn die ers-ten Arbeiten (z. B. Einlage Potenzialaus-gleich) anstehen und keine am Bau betei-ligte Unternehmung einen Plan erstellthat. Durch die vorgängige Abklärung dergenauen Verhältnisse, welche auch imWerkvertrag festgehalten werden sollten,kann sich der Elektrounternehmer garChancen für einen Zusatzauftrag in Formeines Planungs(teil)auftrages ausrechnen.Auf keinen Fall dürfen diese Phasen bzw.Teilphasen im Rahmen einer Abgebots-runde gratis übernommen werden. Diefachgerechte Erledigung einer oder meh-rerer Phasen/Teilphasen ist zeitaufwen-dig und darf nicht kostenlos erledigt wer-den. Hier wird durch den Unternehmereine Leistung erbracht, die bezahlt wer-den muss. Steckdosen werden auch nichtverschenkt!
Fachbauleitung gemäss SIA 108 Art. 4In der SIA 108 unter Art. 4 finden wirin der Teilphase 52 «Ausführung» dieBauleitung genau umschrieben.
Ebenfalls können aus der Tabelle 2die Zusatzleistungen entnommen wer-den, welche dem Auftragnehmer sepa-rat honoriert werden müssen.
Klare AufgabenteilungIm aktuellen Lehrbuch des VSEI zurKalkulation im Elektro- und Installati-onsgewerbe können im Gegenzug eine
Auflistung bzw. Umschreibung der inder TB-C enthaltenen Arbeiten ent-nommen werden. Die Auflistung basiertdabei auf der SIA 108 Art. 3 und 4.
AVOR• Der Elektrounternehmer klärt die
Bedingungen für die Ausführung derInstallationen ab.
• Er berechnet die Kosten für die Er-stellung der Installationen mit allfälli-gen eigenen Vorschlägen für die Ver-besserungen (Unternehmervariante).
• Er nimmt allfällige Weisungen der Bau-herrschaft entgegen, spricht Termine abund legt die Lieferung von Materi-al/Geräten mit dem Lieferanten fest.
• Der Elektrounternehmer erstellt dieInstallationsanzeige zuhanden derNetzbetreiberin.
• Er kontrolliert die zur Verfügung ge-stellten technischen Unterlagen undPläne und bereitet die Ausführung vor.
Bauphase• Der Elektrounternehmer plant den
Mitarbeitereinsatz, hat die Montage-leitung der Installationen inne undüberwacht die fach- und normenge-rechte Ausführung.
• Er prüft Arbeitsrapporte und Belege• Installationsänderungen werden im
Entwurf laufend in den Plänen einge-tragen.
• Der Elektrounternehmer erstelltNachtragsofferten für nicht offerierteZusatzarbeiten.
• Materialbestellungen müssen erledigtwerden, der Einsatz von Spezialwerk-zeug und Gerüsten will geplant sein etc.
Phasen Teilphasen TB nach VSEI
1 Strategische Planung 11 Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien –
2 Vorstudien 21 Projektdefi nition, Machbarkeitsstudien –
22 Auswahlverfahren –
3 Projektierung 31 Vorprojekt TB – A
32 Bauprojekt TB – A
33 Bewilligungsverfahren, Aufl ageprojekt TB – A
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertenvergleich, Vergabeantrag TB – B
5 Realisierung 51 Ausührungsprojekt TB – B
52 Ausführung TB – B
53 Inbetriebnahme, Abschluss TB – B
6 Bewirtschaftung 61 Betrieb –
62 Erhaltung –
Auftragsnebenarbeiten gemäss SIA 118/380 Arbeitsaufwand des Elektrounternehmers für die Arbeitsvorbereitung, die Montage-anweisungen, Überwachung und Abschluss mit Verrechnung. Schlusskontrolle inkl. SiNa und dgl. Instruktion und Inbetriebnahme
TB – C
Tabelle 1

36 | Elektrotechnik 2/09
El
ektro
plan
ung
& B
erat
ung
Abschlussphase• Ausmass der erstellten Installationen,
Bereitstellung zur Verrechnung• Verrechnung von Zusatzinstallationen
und Regiearbeiten• Durchführung der Schlusskontrolle
nach NIV, mit Prüfung, Durchfüh-rung aller notwenigen Messungen undErstellung des Sicherheitsnachweises(SiNa)
• Messungen und Protokollierungen imSchwachstrombereich, wie z. B. UKV(RIT)
• Instruktion der Bauherrschaft undFunktionskontrolle der erstelltenInstallationen
• Erstellen der Bauunterlagen mit
Sicherheitsnachweis (SiNa), Installati-onspläne (von Hand nachgeführt), Be-triebsanleitungen etc. Zuhanden derBauherrschaft bzw. deren Vertreter
Miteinander statt gegeneinanderDie Arbeiten und Zuständigkeiten sindalso eindeutig verteilt und zugeordnet.Diese eindeutige Zuordnung soll uns abernicht an einer regelmässigen Kommuni-kation unter allen Beteiligten hindern.Die besten Erfahrungen wurden dabeimir einem regelmässigen Austausch aufder Baustelle gemacht. Wie gross die Ab-stände/Perioden dabei gewählt werden,muss anhand der Baustellengrösse unddes aktuellen Arbeitsanfalls für den Un-
ternehmer entschieden werden. Meist lie-gen diese zwischen einmal pro Woche biseinmal pro Monat.
An solchen Baustellenbesprechungenwerden die nächsten Arbeiten und diedaraus folgenden, wichtigen Terminebesprochen. Der Unternehmer hat dieMöglichkeit, beim Elektroingenieurfehlende Unterlagen, Schemasund/oder Pläne anzufordern. Anlässlicheiner solchen Besprechung können dieAusführungsunterlagen direkt abgege-ben und besprochen werden. Der Post-versand mit der daraus folgenden Ver-zögerung und das anschliessende Rück-fragen per Mail oder Telefon entfallenebenfalls. Unter dem Strich resultiertfür beide ein Zeitgewinn (= Geld).
Durch den laufenden Kontakt zwi-schen dem Projektleiter des Elektroinge-nieurbüros und dem Elektroinstallateurist durch diesen auch eine rechtzeitigePersonaldisposition und Materialbereit-stellung möglich. Gleichzeitig könnenallfällig auftretende Regiearbeiten freige-geben und nach der Ausführung der ent-sprechende Rapport unterzeichnet wer-den. Das Hin- und Herschicken derRapporte per Post inkl. allfälliger Rück-fragen und Unklarheiten entfällt.
Durch die regelmässigen Treffen undBesprechungen kann weiter ein Vertrau-ensverhältnis entstehen, dass es auch er-laubt sich in Teilbereichen während z. B.Ferienabwesenheiten zu vertreten. Aufjeden Fall wird der Stellvertreter des je-weiligen Projektleiters beim Ingenieur-büro und Unternehmer während dessenAbwesenheit weit weniger benötigt undmit Arbeiten belastet.
Das Nachmass (Ausmass) muss unbe-dingt laufend zur Bauausführung erstelltwerden. Muss kein Nachmass erstelltwerden, wie z. B. bei einem Pauschalauf-trag, sind mindestens die allfällig auftre-tenden Zusatzarbeiten bzw. Mehrleis-tungen zu deklarieren bzw. anzumelden.Diese werden bei einer laufenden Auf-nahme und Erfassung des Nachmassesebenfalls rechtzeitig erkannt und könnenbei der Bauleitung/Bauherrschaft ange-meldet werden. Mit dem zunehmendenHerauszögern der Aufnahme des Nach-masses geht auch immer mehr Wis-sen/Information verloren. Die aktuellenMarktpreise lassen Geschenke in diesemBereich meist nicht zu. Je früher dasNachmass erfasst wird, desto kleiner istder dafür nötige Zeitaufwand.
Bei grösseren Projekten macht esdurchaus Sinn, die durch den Unter-nehmer nachgeführten Ausführungs-unterlagen laufend dem Ingenieurbüroabzugeben. So können die Revisions-
Beschrieb und Visualisierung Grundleistung Zusatzleistung (separat zu honorieren)
Bauleitung Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvorganges für die vom In-genieur bearbeiteten Anlageteile
Bauleitung für Anlageteile, welche von Dritten projektiert wurden
Kontrolle der Arbeiten auf der Baustelle sowie der Materialien und Lieferungen
Vom Auftraggeber oder von der Gesamtleitung gewünschte ständige Bauaufsicht bzw. re-gelmässige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen
Teilnahme an Bau- und Koordi-nationssitzungen nach Bedarf
Mehrleistungen infolge der Auswechslung von Unterneh-mern oder Lieferanten (z.B. bei Konkursen)
Werkstattkontrollen und Werk-stattabnahmen von wesentlichen Lieferteilen
Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten und der entspre-chenden Rapporte
Organisation und Kontrolle der Ausmassarbeiten
Prüfen von Nachträgen
Planen, Durchführen und Proto-kollieren von Teilabnahmen
Veranlassen offi zieller Kontrollen durch zuständige Instanzen
Projektänderung Überwachen der Aufnahme von eingetretenen Änderungen und von nachträglich nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten in die Ausführungsunterlagen
Kosten Führen der Kostenkontrolle
Erstellen periodischer Kosten-berichte
Auftragsnebenarbeiten gemäss SIA 118/380
Kontrolle von Leistungsaufstel-lungen und Rechnungen
Termine Nachführen des Ausführungster-minplans
Dokumentation Protokollieren der fachspezi-fi schen Bauplatzsitzungen mit Unternehmern und Lieferanten
Führen des BaujournalsTabelle 2

Elektrotechnik 2/09 | 37
Elek
tropl
anun
g &
Ber
atun
g
unterlagen erstellt werden, sobald einTeilprojekt (z. B. ein Gebäude einergrösseren Überbauung) fertiggestelltist. Hier gilt das Gleiche wie beimNachmass: Je früherer, desto kleinerist der nötige Zeitaufwand.
Nicht alles ist schlechtAn dieser Stelle soll aber auch erwähntwerden, dass viele Unternehmer dieHausaufgaben gemacht haben. Soklappt die Zusammenarbeit zwischenIngenieur und Unternehmer bestens.Die beiden Parteien sind in ständigemKontakt und Informationsautausch.Nur so kann nach Abschluss des Pro-jekts von einem erfolgreichem Ab-schluss und einer zufriedenen Bauherr-schaft ausgegangen werden. Den Elekt-roingenieur und Unternehmer sind ge-meinsam für den erfolgreichen Ab-schluss verantwortlich. Nur wenn beideam gleichen Strick ziehen, anstatt sichzu bekämpfen, kann von einer «gutenArbeit» gesprochen werden. Im ande-ren Fall machen die Verantwortlichenbei der Bauherrschaft keinen Unter-schied, wo versagt wurde, auf Planer-oder Unternehmerseite. Kurz wirddann einfach von Problemen im Be-reich Elektro gesprochen. Packen wir es
an und bringen wir unser Gewerbe wie-der dort hin wo wir einmal waren – andie Spitze mit einer Spitzenleistung. Es
versteht sich von selbst, dass mit einerguten Arbeit bzw. Zusammenarbeitauch (mehr) Geld verdient wird. ■
3
43 Technische Bearbeitung ist ein Teil der Arbeitskosten.4 Planungs- und Bauprozess.
VSEI
CRB
Energiesparen mit Präsenzmelder 3 Baureihen für mehr Komfort! PräsenzLight Baureihe
PräsenzLight 360:� eignet sich besonders fürkleinere Räume und Nasszonen.
PräsenzLight 180:� ist ideal für Korridore, Durchgangszonen, Nassräume und Garagen.
compact Baureihecompact office:� wird in Einzelbüros, Neben-/
Sanitärräumen bevorzugt eingesetzt.compact passage:� mit seiner grossen und recht-
eckigen Erfassung eignet sich der einzigartigePräsenzmelder für lange Korridore und Verkehrs-flächen. Mit einer Reichweite von bis zu 30m sorgt
er für eine zuverlässige Erfassung gehender Personen.
ECO-IR BaureiheECO-IR 360:� ist ideal für Grossraumbüros, Sitzungs-/Schulzimmer, Labors und Sporthallen.ECO-IR 180:� ist gut für Verkehrsflächen, Treppen-häuser und Sanitärräume einsetzbar.
Mehr Informationen auf www.theben-hts.ch
Theben HTS AGIm Langhag 11; CH-8307 Effretikon Tel : +41 (0) 52 355 17 00Fax: +41 (0) 52 355 17 [email protected], www.theben-hts.ch
PräsenzLight 360/180
Für kostengünstige Anwendungen in kleinen Räumen wie Keller, Korridoren, Nasszellen und Toiletten.
- „basic“- Präsenzmelder- zuverlässige Erfassung - mittlere Reichweite - Schutzklasse IP54- vollautomatische Lichtsteuerung
compact office/passage
Für komfortable Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern,Aufenthaltsräumen und Korridoren.
- „mid range“- Präsenzmelder - zuverlässige Erfassung- mittlere Reichweite- flexible Lichtsteuerung mit Zusatzfunktionen wie:
Halbautomatik für noch mehr Energiesparung.
ECO-IR 360/180
Für grossflächige Anwendungen in Schulzimmern, Büros und Verkehrsflächen.
- „high end“- Präsenzmelder - höchste Erfassungs- empfindlichkeit- grosse Reichweite - grossflächiger Einsatz - komfortable Lichtsteuerung mit Zusatzfunktionen
2_Theben_PraesenzMelder_bearb.in1 1 21.1.2009 13:39:14 Uhr

Wir testenZukunftsschritt-macher.In der Nachwuchsförderungs-Bewegung darwin21 könnendie Techniker von morgenschon heute zeigen, was Siedrauf haben.
www.darwin21.org
Teams:
Babel
Hochschule Luzern –Technik & Architektur
Phoenix Contact AG
Bacchus
Ecole d’ingénieurs etd’architectes de FribourgHochschule für Technik und Architektur Freiburg
Saia-Burgess Controls AG
Bajazzo
Berner Fachhochschule Technik und Informatik
Beckhoff Automation AG
Balbo
HFTbiel – Höhere Fachschule für Technik Biel
Siemens Schweiz AG
Balu
Berufsakademie Karlsruhe
Endress+Hauser Flowtec AG
Ben Hur
Gewerblich-industrielle BERUFSFACHSCHULE LIESTAL
Endress+Hauser Flowtec AG
Berni
MSW Winterthur
SMC Pneumatik AG
Big Boss
SUPSI
KUKA Roboter Schweiz AG
STEMMER IMAGING AG
Billy Boy
AVIL, BBZ, Wibilea
Weidmüller Schweiz AG
Borex
HSR – Hochschule für TechnikRapperswil, IMA
Bosch Rexroth Schweiz AG
Bruce
FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz, Institutfür Automation
Sick AG
Buster
FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz, Institutfür Automation
ifm electronic ag
B ...
Höhere Fachschule für Technik des Kantons Solothurn HFT-SO
Distrelec – Bereich der Dätwiler Schweiz AG
Eine Produkton der eins1 ag
Presenting Partner:
Hosting Partner:
swiss technology network
Patronat:
Supporter:
Supplying Partner:

Elektrotechnik 2/09 | 39
WLAN | Telefonie | VoIP | Triple play | Netzwerktechnik | Sicherheit
USV Eaton 9130von Powerware• Rackmontage oder Tower• Online mit Doppelwandlertechnik• Eingangs-Leistungsfaktor 0,99• Bis zu 95% Wirkgungsgrad• hohe Lebenserwartung der Batterie durch ABM (Advanced Batterie Management)
Rotronic AG8303 BassersdorfTel. 044 838 11 66www.rotronic.ch
40 IT: Schutz vor Angriffen46 Glasfaser bis in die Stube
48 Glasfaser – Werkzeuge
www.bks.ch
www.kochag.ch
www.stfw.ch
www.rdm.com
www.suprag.ch
www.satelco.ch

40 | Elektrotechnik 2/09
M
onat
sthe
ma
IT-Sicherheit: Viren, Würmer, Trojaner & Co.
Schutz vor Angriffenauf Homepage und PC
Am 11. November startet in Deutsch-land nicht nur die Karnevalssaison(oder Fasnacht). Der Tag davor hatnämlich einen Hintergrund, der we-niger zum Lachen ist: Die Geburts-stunde des ersten Virus, der auf den10. November 1983 – also vor mehrals 25 Jahren – datiert. Dabei ging esin der Aufgabe der Universität von Ka-lifornien lediglich darum, ein Pro-gramm zu entwickeln, das sich selbstvermehrt. Fred Cohen, der 1986 sei-nen Doktortitel der Elektro- undComputertechnik erwarb und 2002
Die Angriffe auf kommerzielle Rechnersysteme laufen immer komplexer undversteckter ab. Sie haben fatale Auswirkungen auf die Produktivität einerFirma. Dank passender Verfahren können solche Angriffe aber früh erkanntund abgewehrt werden. Und auch der PC beim Endbenutzer hat nochSchutzpotenzial.
Rüdiger Sellin zum Professor ernannt wurde, schriebdieses Programm. Er lieferte bereits1984 in seiner Doktorarbeit eine guteVirendefinition: «Ein Computervirusist ein Programm, das andere Pro-gramme infizieren kann, indem eseine möglicherweise veränderte Ver-sion von sich selbst zu dem Pro-gramm hinzufügt.» Etwa zur gleichenZeit wieCohen schrieb ein 15-jährigerSchüler namens Richard Skrenta einStörprogramm zur eigenen Belusti-gung. Er sicherte den sogenannten«Elk Cloner» auf Disketten und liessihn erstmals auf fremde PCs los.Zum Schreck des Benutzers führte
jeder fünfzigste Datenzugriff zu ei-nem schwarzen Bildschirm, was frei-lich keinen weiteren Schaden an-richtete. Zur Beruhigung wurde demBenutzer jeweils ein Gedicht Skren-tas angezeigt.
Vernetzung begünstigt AngriffeVon solchen Harmlosigkeiten entfern-ten sich die späteren Nachfolgegenera-tionen schnell. So löschte bereits 1991der Virus «Michelangelo» sämtlicheDaten auf infizierten privaten Rech-nern. Er geriet über das schlichte Öff-nen einer E-Mail mit dem Betreff«Iloveyou» auf die PCs der ahnungs-losen Benutzer. Zehn Jahre späterwurden längst Windows-Sicherheitslü-cken ausgenutzt, so beim Virus «CodeRed», der im Weissen Haus einenSchaden von rund zwei MilliardenDollar angerichtet haben soll. ImGrunde genommen sind Viren zwarunangenehm, aber sie zerstören in derRegel lediglich Dateien oder verän-dern sie. Wirklich gefährlich hingegensind Programme, die mit kriminellenAbsichten geschrieben wurden. Dabeigeht es um das sogenannte «Phishen»(Abholen) von Passwörtern, Kredit-kartennummem, Kontoinformationenund Login-Daten. Besonders beim po-pulären E-Banking ist besondere Vor-sicht angebracht, denn hier geht esdem Angreifer um pure finanzielle In-teressen mit hohem Schadenpotenzialfür den Geschädigten. Die Finanzins-titute sind daher ständig damit be-schäftigt, den Datenfluss unter allendenkbaren Umständen abzusichern.Überhaupt erwecken die entsprechen-den Meldungen zum Thema den Ein-druck, als ob die Entwickler vonSchutzprogrammen den Virenprodu-zenten stets leicht hinterherhinken.Allerdings hat deren Reaktionstempodeutlich zugenommen, trotz der seitJahren zunehmenden Virenprodukti-on. Im Schnitt kommen stündlich bis
Ein Virus muss mittels einer Datei odereines anderen Programms auf dem Rech-ner des Opfers installiert werden. Diesgeschieht oft über E-Mail-Anhänge, etwaüber harmlos aussehende Word- oder so-gar PDF-Dateien, welche keinerlei Arg-wohn beim Empfänger erwecken. Erstbeim Öffnen des Anhangs wird der Virusaktiv – von selbst installieren kann ersich also nicht. Darin unterscheidet ersich von einem Wurm, der sich alsE-Mail-Anhang (auch ohne Öffnen)selbständig verbreitet – etwa über alle Ad-ressen eines E-Mail-Systems. Noch perfi-der gehen sogenannte Trojanische Pferdeoder Trojaner vor. Diese spezielle Viren-art versteckt sich in nützlichen Program-men oder Gratis-Software zum Zeitver-treib wie Spiele, die der User bereitwilligherunterlädt. Im Hintergrund installiertsich während des Downloads jedoch eineandere, gänzlich ungewünschte Soft-ware. Oftmals bemerkt der Benutzer das
im Hintergrund ablaufende Programmnicht oder zu spät. Aggressive Viren be-fallen oftmals Windows-Systemdateienund gehen damit sozusagen an den Le-bensnerv eines PC.Apple-Benutzer sind zwar wesentlichweniger häufig von Viren bedroht. Be-dingt durch die zunehmende Popularitätder «Apfelrechner» und deren unzurei-chenden Sicherheit (bisher gab es kaumAngriffe ) soll 2009 das Jahr der Apple-Viren werden. Für alle Benutzer geltendie gleichen Schutzmassnahmen, etwadie Installation einer Firewall sowie einerAntiviren-Software aus seriöser Quelle.E-Mails von unbekannten Absendernsollte man nie öffnen und Programmenur von vertrauenswürdigen Anbieternherunterladen. Das gilt pikanterweiseauch für Antiviren-Software, die oft dasGegenteil von dem tut, was man von ihrerwartet – also aufgepasst beim Gratis-Download.
Begriffe aus der «I-Tierwelt»

Elektrotechnik 2/09 | 41
Mon
atst
hem
a
zu 800 neue Viren hinzu, im Schnittsind es rund 5000 pro Tag. Gleichwohlscheint deren Verbreitung nicht mehrganz so epidemieartig zu verlaufen,wie es bis 2005 der Fall war. Es gibtaber immer neue Facetten der Bedro-hungen aus dem Internet, die sichdurch die hohe Verbreitung von Breit-band-InternetAnschlüssen verschärfthaben.
Dazu zählen die sogenannten «Deni-al-of-Service»-Angriffe (DoS). DerenZiel ist die massive Einschränkung derVerfügbarkeit bestimmter Online-Sys-teme oder -Dienste bis hin zur totalenUnerreichbarkeit einer Homepage. Da-bei wird durch Ausnutzen von Lückenin Betriebssystemen, Programmen,Diensten bzw. von grundsätzlichenSchwachstellen der verwendeten Netz-werkprotokolle versucht, die angegriffe-nen Systeme via Internet zum Absturzzu bringen. Online-Systeme von eS-hops, Content-Providern, Finanz-dienstleistern (z. B. E-Banking) oderVerwaltungen (z. B. E-Government)werden so weit überlastet, bis sie kaumoder gar nicht mehr funktionieren. ImUnterschied zu anderen Angriffendringt der Angreifer normalerweisenicht in deren Computer ein und benö-tigt deshalb keine Passwörter. Jedochkann ein DoS-Angriff Bestandteil einessolchen Angriffs sein, etwa um den ei-gentlichen Angriff auf ein weiteres Sys-tem desselben Opfers zu vertuschen.Das mit der Administration betrauteIT-Personal wird durch den erhöhtenDatenverkehr abgelenkt, in dem dereigentliche Angriffsversuch unbemerktuntergeht.
Verteilte Angriffe sind populärDabei gehen die Angreifer immer ge-schickter vor und spannen dazu ein ver-teiltes Verbundnetz privater Rechner ein.Dank dieser sogenannten Bot-Netzwerkewerden verteilte Angriffe (DistributedDenial of Service, kurz DDoS) erst mög-lich. Bot-Netzwerke bestehen aus einigenhundert bis zigtausend infizierten PCs,die zeitgesteuert durch den Bot-Netz-werk-Administrator/-Controller für An-griffe missbraucht werden können. DieLeistung der in einen Angriff eingebun-denen PCs sowie die Anschlussbandbreitewerden in der Regel für den Benutzerim nicht wahrnehmbaren Bereich fürDDoS-Attacken beansprucht. Durch dieNutzung vieler PCs können auch Sitesmit sehr leistungsstarken Online-Syste-men und breitbandigen Netzverbindun-gen erfolgreich gestört werden. Gemässeiner seit 2005 jährlich durchgeführten
Untersuchung der Firma Arbor Net-works stellten auch in den letzten zwölfMonaten über DDoS geführte Angriffesowie Bot-Netzwerke über ein Drittel al-ler Bedrohungen (Bild 1). Der Ursprungund die Motive solcher Angriffe sindsehr vielschichtig und reichen von Ra-che- oder Protestaktionen gegen einebestimmte Firma oder Organisation bishin zu professionell tätigen Hacker-Organisationen mit mafiaähnlichenSchutzgelderpressungen. Professionellaufgesetzte Angriffe richten sich gegendie Verfügbarkeit kommerziell genutz-ter Systeme. Neben dem Imageschadendurch schlechte Performance könnenim schlimmeren Fall auch mehrtägigeAusfälle die Folge sein. Die kommerziel-len Einbussen sind dann gross und lassensich nur schwer beziffern.
Beim Angriff sind mehrere Rechn-ersysteme im Angreifernetzverbundan einer DDoS-Attacke beteiligt. Ei-gentümer infizierter PCs ist sind sich
meistens nicht bewusst, dass sie Teileines Bot-Netzwerks sind, denn ent-sprechende Programme werden fürden Benutzer unbemerkt während derOnline-Zeit installiert. Bedingt durchdie hohen Übertragungsgeschwindig-keiten moderner Breitbandanschlüsseund der Leistungsfähigkeit neuererPCs fallen dessen Performanceeinbus-sen während eines laufenden Angriffspraktisch nicht auf. Der Angriff inner-halb eines Bot-Netzwerks ist auf meh-rere Instanzen verteilt (Bild 2). EinClient (der eigentliche Angreifer) be-auftragt einen oder mehrere Master(als Server dienende Computer). Diesesteuern mehrere Daemons (im Hinter-grund ablaufende Prozesse), welcheschliesslich das Opfer attackieren. DerClient kommuniziert über eine Inter-net-Verbindung (oft von einer illegalverwendeten IP-Adresse aus) mit denverteilten Mastern. Deren IP-Adressebzw. die offenen TCP- oder UDP-
2
1
1 Häufigste Bedrohungen im Internet.2 Errichten von Bot-Netzwerken für DDoS-Angriffe.
Arbo
r Net
wor
ks, I
nc. 2
008
Selli
n

42 | Elektrotechnik 2/09
M
onat
sthe
ma
Ports wiederum hat er etwa mit Hilfevon Scanning-Tools besorgt. Poten-zielle Angriffsziele und deren Schwach-stellen werden via Internet-Security-Scanner ausfindig gemacht. Über den-selben Weg gelangt der Angreiferzudem an die Root-Rechte der Server-Systeme und prüft dabei auch gleich,welche Dienste und Ports dort aktiv(also offen) sind. Bei Vorliegen vonSicherheitslücken generiert der An-greifer ein Script (ein automatischablaufendes Programm) und legt esauf den gestohlenen Accounts ab. Mitdiesen Scripts nutzt er zu einemspäteren Zeitpunkt die entdecktenSicherheitslücken.
Auf den Master-Systemen werdenweitere Speicher benutzt, um dort dielauffähigen Daemons (als precompiledbinaries) zu lagern. Danach erstellt derAngreifer wiederum ein Script, welchesdie Liste der «in Besitz genommenen»Rechner benutzt und ein weiteresScript erzeugt. Letzteres führt den Ins-tallationsprozess automatisiert im Hin-tergrund durch. Diese Automati-sierung erlaubt den Aufbau einesweitverbreitenden Bot-Netzes ohneWissen der Besitzer der Systeme. DieMaster-Programme nehmen eineSchlüsselrolle im Netzwerk des Angrei-fers ein und werden bevorzugt aufsogenannten «Primary-Name-Server-Hosts» installiert. Diese sind für einenextrem grossen Netzwerkverkehr aus-gelegt, sodass auf solchen Server-Syste-men eine grosse Anzahl von Netzver-bindungen läuft. Für den Angreifer hatdies zwei wesentliche Vorteile. Zum
Swis
scom
3
4
3 Statusansicht auf dem TMS-Kundenportal des DDoS Protection Service.4 DNS Cache Poisoning als neue Bedrohung (vereinfachte Darstellung).
Schliesslich schreckte Ende Sommer 2008 eineweitere Meldung die Sicherheitsexperten auf,welche eine Sicherheitslücke in der DNS-Spe-zifikation betraf. Das DNS-Protokoll (DomainName System) dient der Umwandlung vonDomain-Namen (www.xyz.com) in die ent-sprechende IP-Adresse und umgekehrt. Dabeigibt es rekursive und nicht rekursive DNS-An-fragen. Ein Client stellt im Normalfall einerekursive Anfrage an den DNS-Server, d. h. ermöchte eine endgültige Antwort erhalten.DNS-Server untereinander verwenden nichtrekursive Anfragen, wobei jeder Server nur dieIP-Adressen nennt, die er selbst verwaltet.Kennt er die IP-Adresse eines Domain-Na-mens nicht, nennt er einen DNS-Server, derdie Antwort kennen könnte. Der Anfragendewird so zum einem DNS-Server vermittelt,der die gewünschte IP-Adresse herausgibt.Wird ein Domain-Name (z. B. www.ebank-ing.ch) aufgerufen, wird vom Client eineentsprechende rekursive DNS-Anfrage an den
«Domain»-Port des lokal zuständigen DNS-Ser-vers gesendet. Kennt dieser die zugehörige IP-Adresse nicht, sendet er nicht rekursive DNS-An-fragen an andere DNS-Server, um die zugehö-rige IP-Adresse zu ermitteln. Nach deren Ant-wort speichert er die genannte IP-Adresse zurBeantwortung künftiger Anfragen für eine ge-wisse Zeit in seinem Cache (temporärer Spei-cher). Kann ein Angreifer gefälschte Informatio-nen in diesen Cache einzuschleusen, so sprichtman von «Cache Poisoning» (wörtlich «Cache-Vergiftung»). Verfälschte DNS-Einträge werdendurch Sicherheitslücken möglich, daher auch derBegriff «ungepatchter DNS-Server» («Patch»bedeutet «Flicken» und steht für ein Software-Update zur Behebung von Mängeln). Somit kannder Angreifer Anfragen an ein bestimmten Serverzu einem vom ihm kontrollierten Server umleiten(Bild 4), was z. B. Phishing-Angriffe oder das Ein-schleusen schädlicher Software ermöglicht. Erstüber diese Umleitung gelangt das Opfer schliess-lich auf den gewünschten Ziel-Server.
DNS als Lebensnerv des Internets und als Angriffsziel
Selli
n

Mon
atst
hem
a
einen verdeckt die Grundlast (Prozes-soren und Netz) den zusätzlichen Netz-werkverkehr der Master sehr gut. Zumanderen werden solche Server-Systemeselbst bei einem DDoS-Verdacht nichtvorschnell aus dem Netz genommen, daihre Bedeutung für das eigene Netz zugross ist.
Der Angreifer sendet später dasAngriffskommando inklusive der Da-ten des Opfers (IP-Adresse, Port-nummer, Angriffsart) an die Master.Während des Angriffs ist dies dereinzige von ihm ausgehende Verkehr.Nach dem Startschuss liegt die wei-tere Steuerung und Koordination desAngriffs bei den Mastern, welche je-weils eine bestimmte Anzahl Dae-mons steuern. Damit beim Aufde-cken eines Masters durch einenNetzwerk-Sniffer nicht sofort alleDaemons unbrauchbar werden, tei-len die Angreifer die Master inzweckmässige Teilgebiete auf. Auchdie Daemons laufen auf weit im Netzverteilten Computern und führen aufAnweisung des Masters den eigentli-chen Angriff aus.
Sicherheit am Beispiel:DDoS Protection ServiceEinige Service-Provider bieten einenwirksamen Schutz gegen die gängigstenAngriffsszenarien als Dienstleistung an.Swisscoms DDoS-Protection-Serviceüberwacht dazu permanent die Ver-kehrsflüsse im Backbone und bietet fol-gende Eigenschaften:• Keine Hardware-Installationen beim
Kunden erforderlich• Wirksamen Schutz der Internet-
Infrastruktur vor DDoS-Attacken
(aktuell bis 10 Gbit/s filterbar)• Pro-aktive Alarmierung bei DDoS-
Attacken per E-Mail, SMS, SNMPTraps und Syslog
• Erlaubten Zugriff für «FriendlyUser» auf die Management-Plattforminklusive Monitoring und Reportingauch während DDoS-Attacken
• Direkte Abwehr von DDoS-Attackenvia Management-Plattform durch denSecurity- bzw. Netzwerk-Administrator
• Dynamische Identifizierung undBlockierung von DDoS-Attacken
• 7 x 24-h-Helpdesk/Support durch dasDDoS-Expertenteam
Bei Abweichungen von der Baseline (derwährend 24 Stunden laufend registrierteBandbreitenverlauf ) werden die System-verantwortlichen per E-Mail, SMS,SNMP Traps oder Syslog direkt infor-miert. Abhängig von der Anomalie wirdder Alarm als tief, mittel oder hoch einge-stuft. Diese sogenannte Traffic AnomalyDetection erfasst die Baseline-Daten lau-fend und registriert dabei Wochentag,Uhrzeit, die zu diesem Zeitpunkt gemesse-ne Bandbreite und die Protokollkonformi-tät. Bild 3 zeigt eine Statusansicht auf demKundenportal des DDoS Protection Ser-vice. Mit Hilfe dieser Angaben wird derVerkehr bezogen auf die eigene Infrastruk-tur permanent überwacht und analysiert.Zur Abwehr von DDoS-Attacken verwen-det Swisscom ein Threat ManagementSystem (TMS). Im Falle eines Angriffskann der Verkehr bzw. der Datenstrom inRichtung des attackierten Systems viaTMS umgeleitet werden. Das TMSanalysiert diesen Verkehr und kann gut-artigen von bösartigem Verkehr effizi-ent unterscheiden und filtern. Der
gefilterte Verkehr wird dann zurursprünglichen Destination weitergelei-tet. Die Filterfunktion im TMS wirdin jedem Fall durch den Kundenaktiviert, und zwar entweder über einegeschützte Internet-Seite oder – falls jeg-licher Internet-Verkehr unmöglich seinsollte – über eine Mobile-Unlimited-Verbindung, einen dedizierten xDSL-Anschluss oder telefonisch.
FazitInsgesamt gewährleistet die Kombi-nation aller Massnahmen – lokal am PCsowie beim Provider im Netz – einensehr guten Schutz vor Angriffen. Diesist gerade trotz aller potentiellenBedrohungen ein beruhigender Ge-danke. Grösste Schwachstelle bei allembleibt aber der Mensch, denn je nachVerhalten des Benutzers am PC undEinsatz der Schutzmechanismen ver-grössern oder verkleinern sich dieChancen von Angreifern erheblich.
■
Weitere Infos unter:•Fred Cohen, Computer Viruses – Theo-
ry and Experiments, University of Cali-fornia, ©1984, www.eecs.umich.edu/%7Eaprakash/eecs588/handouts/co-hen-viruses.html
• Arbor Security Reportwww.arbornetworks.net/report
• Sicherheit am Beispiel:www.swisscom.ch/ddos
Wir bringen Ihr Projekt auf den Punkt.BEAMER
LAUTSPRECHER
LEINWAND
MULTIRAUMSYSTEM
Hintermättlistrasse 1CH-5506 Mägenwil
T +41 62 887 27 37F +41 62 887 27 39

44 | Elektrotechnik 2/09
H
ighl
ight
Um den Einstieg in die elektronischeSicherheitstechnik zu erleichtern, bietetTrigress Security seinen Fachhändlern ei-ne breite Fülle an fachlicher Unterstüt-zung. In der eigens gegründeten Schu-lungsakademie werden Einsteiger,Fortgeschrittene und Sicherheitsprofis ge-schult und weitergebildet. Dabei geniesstvor allem die praktische Anwendung derProdukte einen hohen Stellenwert. Fach-handelspartner lernen dabei alles, was siefür den Erfolg im Security-Business brau-chen.
Teilnehmer bestätigen ErfolgDas Feedback der Teilnehmer bestätigtden Nutzen der Lehrgänge. Der persönli-che Kontakt zu den Fachhandelspartnernhilft gezielt auf ihre Bedürfnisse einzuge-hen. Für 2009 wurde das Schulungspro-gramm deutlich erweitert. So finden neben
Seit 2008 bietet Trigress Security Schulungen zum Thema Alarm- undVideotechnik an. Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung istso aufgebaut, dass auch kleine Elektrounternehmungen diese problemlosbewältigen. Die neuen Lehrgänge starten ab März und sind aufwww.trigress-security.ch veröffentlicht.
Schulungen für dieelektronische Sicherheit
Neues lukratives Geschäftsfeld für clevere Elektroinstallateure
den Grundlagenschulungen nun auch di-verse spezifische Schulungstage mit Spezi-althemen statt. Hier erfährt man alles überdie neue Secvest 2WAY einschliesslichder elektronischen Funkfenstersiche-rung FTS 96 E, die neue Funkalarman-lage Privest oder Eytron-Videoüberwa-chungssysteme.
Einfacher als man denktEinsteigern in die Security-Branchewird für den Start die Grundlagenschu-lung der Alarm- oder Videotechnikempfohlen. Für Profis stehen gezielteProduktschulungen auf dem Programm(aufbauend auf den Grundlagenschulun-gen). Das Trainerteam aus erfahrenen Si-cherheitsexperten vermittelt die Inhalte le-bendig und praxisnah. Die Projektierung,Installationstechnik und Inbetriebnahmeder Sicherheitssysteme werden eingehend
geübt. Natürlich fehlen dabei auch Tippsund Tricks für das Verkaufsgespräch nicht.Jeweils nach den theoretischen Grundla-gen kommt der Praxisteil. Auf diesen Teilwird speziell geachtet und dabei viel Zeitinvestiert. Die direkte Auseinandersetzungmit den Geräten hilft den Kursteilneh-mern bei der Installation vor Ort. Um aufmöglichst viele Fragen eingehen zu kön-nen, ist die Teilnehmerzahl der Kurse aufmaximal 12 Personen beschränkt. DieSchulungen finden im Showroom am Fir-mensitz in Baar statt. Die Schulungsräumesind mit dem nötigen Material ausgestat-tet. So macht die Vermittlung technischerZusammenhänge richtig Spass! Es ist aucheine gute Gelegenheit, mit Gleich-gesinnten und Mitarbeitern von TrigressSecurity ins Gespräch zu kommen. Umaufwendige Anreisen zu ersparen, sind dieKurse auf einen Tag beschränkt – jeweilsvon 9 Uhr bis 16.30 Uhr. Zur Bescheini-gung der erworbenen Fachkompetenzenerhalten alle Teilnehmer nach dem Besuchder Trigress Academy ein entsprechendesZertifikat.
FazitIn wirtschaftlich schwierigeren Zeitensind Alarm- und Videotechnik die Ge-legenheit, das Geschäftsfeld um einenlukrativen, zukunftsträchtigen Bereichzu erweitern. Denn leider gewinnt die-ses Thema auch in der Schweiz immermehr an Brisanz. Die Weiterbildungs-möglichkeiten der Trigress Security AGsind die ideale Möglichkeit, sich kom-petent auf dem Fachgebiet der elektro-nischen Sicherheit weiterzubilden. AlleInformationen rund um die TrigressAcademy sowie das aktuelle Schulungs-angebot mit allen Terminen sind unterwww.trigress-security.ch zu finden. ■
TRIGRESS Security AG6341 BaarTel. 041 560 86 66www.trigress-security.ch
Schulungen der Trigress Security AG.

Hig
hlig
ht
Elektrotechnik 2/09 | 45
Die Swisscom-Tochter Swisscom Broad-cast hat alle 10 Stadien der SchweizerFussballclubs, die in der Axpo SuperLeague spielen, sowie 12 Eishockey-Stadien der National League A an ihren«Broadcast Highway Video» ange-schlossen. Das Netz ist für Übertra-gungen in HD-(High Definition-)Qua-lität ausgebaut. Swisscom Broadcastleitet die Audio- und Video-Signaleals Business-to-Business-Anbieterin inkomprimierter Form nach Volketswilzu Teleclub. Über Bluewin TV oderKabel kommen dann die Sendungen zuden Zuschauern. Das Übertragungs-netz basiert auf Carrier Ethernet undwurde von Swisscom in enger Zusam-menarbeit mit Ringier und Teleclubrealisiert. Rotronic entwickelte in Re-kordzeit 19-Zoll-Outdoor-Schränke, diegenau auf die Anforderungen von Broad-cast Highway Video zugeschnitten sind.Sie dienen als Schnittstelle zwischen Über-
Bilder von bis zu 12 Kameras werden vor Ort zusammengeschnitten. Über denIP-basierten Broadcast Highway Video überträgt Swisscom Broadcast die digitalenVideo-Signale in die Studios von TV-Veranstaltern, von wo aus sie in die Fernseh-Haushalte verschickt werden. Die erforderlichen Outdoor-Schränke in den verschie-denen Stadien wurden von Rotronic nach Mass gefertigt. Selbstverständlich sorgtin diesen Schränken auch eine eingebaute USV für Spannungsausfallsicherheit.
Sportsendungen –Rotronic mischt mit
19-Zoll-Outdoor-Schränke speziell für Anforderungen von Broadcast Highway Video für Swisscom
tragungswagen und Datenautobahn. Umvor Ausfällen geschützt zu sein, sorgenUSV-Systeme für unterbrechungsfreieStromversorgung.
USV Eaton 9130Fussball- und Eishockey-Fans goutierenes gar nicht, wenn wegen eines Strom-ausfalls die Sportsendung ausfällt; dahört bei Fans der Spass auf. Nebst derHerausforderung, hier verschiedene Ge-räte zu verknüpfen und in einem Aussen-schrank aufzubauen, musste eine zuver-lässige USV integriert werden. Rotronichat diese in der von ihr vertretenen Pow-erware-Reihe gefunden. Diese sind imLeistungsbereich von 700 ... 3000 VA alsfrei stehende Geräte oder 19"-Einschü-be verfügbar. Selbst bei schwerwiegen-den Versorgungsproblemen weicht dieAusgangsspannung höchstens 3% vomNennwert ab. Wegen des weiten Ein-gangsspannungsbereichs ist die Eaton9130 zur Ausbügelung von Netz-schwankungen nicht auf Batterien an-gewiesen; letztere werden somit nur fürwirkliche Stromausfälle benötigt. DankDoppelwandler-Technik entsteht beieinem Stromausfall nicht die geringsteLücke bei der Ausgangsspannung. DieNetzspannung wird dauernd gleichge-richtet, auf Kondensatoren gepuffertund dann gleich wieder über denWechselrichter in eine stabile Sinus-wechselspannung von 50 Hz verwan-delt. Trotz aufwendiger Technik ver-fügt die USV über einen sehr hohenWirkungsgrad von bis zu 95 %. Dankdes hohen Leistungsfaktors von 0,9
steht die gesamte Kapazität der Eaton9130 für verschiedenste Anwendungenzur Verfügung; auch kapazitive und in-duktive Lasten sind problemlos. Durchden Eingangsleistungsfaktor von 0,99werden typische Netzrückwirkungenvon Konkurrenzprodukten vermieden.
FazitDank sehr breitem Produktprogramm,von Servern bis zu verschiedenenUSV-Systemen von 300 VA bis550 kVA, ist Rotronic in der Lage,komplexe Aufgabenstellungen aus demIT- und Kommunikationsbereich zu lö-sen. Mit dieser im Eiltempo erstelltenTechnik für Swisscom hat Rotronic be-wiesen, dass sie auch aussergewöhnlicheHerausforderungen in kürzester Zeitlöst. (rk) ■
Rotronic AG8303 BassersdorfTel. 044 838 11 66www.rotronic.ch
Aus den Schweizer Fussball- und Hockey-Stadienkann auch in HD-Qualität gesendet werden.
USV Eaton 9130 als 19"-Rack-Version oder freistehend.

46 | Elektrotechnik 2/09
Te
lem
atik
& M
ultim
edia
Bereits Ende 2009 werden 100 000Wohnungen mit Glasfaser erschlossensein. Gemäss Planung wird im Laufedes kommenden Jahres der Ausbauauf die Städte St. Gallen, Bern, Fri-bourg sowie Lausanne ausgeweitet.Die ersten Angebote für Privatkundenund KMU werden im ersten Halbjahr2009 lanciert. Swisscom plant in denkommenden sechs Jahren insgesamt 8Milliarden Franken in die SchweizerTelekom- und IT-Infrastruktur zu in-vestieren, davon entfallen rund 35%auf den Glasfaserausbau. Das sind gu-
Bereits heute hat Swisscom Glasfaser-Breitbandnetze bis in alle Quartiere.Von da führen bis jetzt Kupferkabel in die Häuser. Doch das soll sich jetztschnell ändern. Neu werden Glasfaserkabel bis zu Privatkunden und KMUgezogen. Der Start erfolgt in Zürich, Basel und Genf.
Glasfaserbis in die Stube
Swisscom ruft das Glasfaser-Zeitalter «fibre suisse» aus
te Nachrichten von Swisscom. Es fälltallerdings auf, dass Swisscom erstdurch das forsche Vorgehen des EWZund anderer EWs aus der Reserve ge-lockt wurde, denn dieser Schritt ist seitJahren überfällig. Im nahen Auslandwie Frankreich und Italien werden inStädten seit einigen Jahren Glasfasernbis in die Wohnungen gezogen undKunden erhalten damit Bandbreiten zuPreisen, von denen Schweizer Privat-kunden nur träumen können.
Swisscom darf man allerdings zugu-te halten, dass das Land flächende-
ckend mit ADSL ausgerüstet ist und zurund 75% mit VDSL. Mit VDSL wer-den im Idealfall Bandbreiten von 20 MBerreicht, und damit reicht dies für TriplePlay, wo Internet, Fernsehen und Tele-fon über die gleiche Leitung im IP-For-mat ins Haus führen. Wenn man dieBreitbandabdeckung bis zu einigen MB/sbetrachtet, spielt die Schweiz in der Spit-zenliga mit, wie dies die Grafik zeigt.Dies gilt aber nicht bezüglich Glasfaser-anschlüssen bis zum Endkunden. Wennimmer mehr Videos über das Internet an-geschaut werden, VoIP und HDTV imAnmarsch sind, fordern EndkundenBandbreiten von 100 MB. Und vor al-lem möchte der Kunde auch mit ak-zeptabler Geschwindigkeit seine Fotosund selbst gedrehten Filme verschi-cken können. Da hapert es bei denKupferleitungen besonders, denn ein
K anada
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
B reitband-Abonnenten (% der Haus halte)
FT
Tx
(% d
er
Ha
us
ha
lte
)
F T T Home
F T T B uilding
F T T N V DS L
5 Mio B reitband-Abonnenten
C hina
DeutschlandUS A T aiwan
S chweden
Dänemark
Niederlande
Australien
UK
S panienF rankreich
Italien
J apan
B elgien
S c hweiz
S üdkorea
Land
T ürkeiP olenArgentinienMexikoB ras ilienR uss landIndien
In der Bereitstellung hoher Bandbreiten in alle Haushalte nimmt die Schweiz eine Spitzenstellung ein.
Alca
tel-L
ucen
t Ana
lyse

Elektrotechnik 2/09 | 47
Tele
mat
ik &
Mul
timed
ia
Upload von mehr als 1 MB ist kaummachbar.
Wo liegt eigentlich das Problem?Ein Glasfaseranschluss bis zum End-kunden kostet pro Anschluss im städti-schen Bereich rund 1200 Franken, inländlichen Gebieten aber rund 4000Franken. Swisscom vernetzt seit mehrals zehn Jahren Grossunternehmenmit Glasfaser. Bei 4000 Franken An-schlusskosten muss für einen Privatan-schluss mit einer Amortisation von 15Jahren gerechnet werden – und das istsehr lange. Bei den Glasfaseranschlüs-sen ist Swisscom nicht mehr in der La-ge, die Schweiz innert weniger Jahreflächendeckend zu verkabeln, so wiedies bei ADSL der Fall war. Das istnicht finanzierbar. Rund ein Drittel derGeschäftskunden bezieht bereits überdas schnelle Netz ihre Breitbanddiens-te, insgesamt sind in der Schweiz 12 500Geschäftshäuser direkt mit Glasfasernvon Swisscom erschlossen. Und das In-teresse an Glasfasernetzen wächst stark:Innert eines Jahres ist die Zahl derGlasfaserkunden bei Swisscom um40% gewachsen.
Kunden profitieren vom Wettbewerbzwischen den NetzenBereits Ende Juli hat Swisscom potenzi-elle Kooperationspartner aus der Tele-kom-, Kabel- und Elektrizitätsbrancheeingeladen, das Glasfasernetz gemein-sam zu bauen. Ziel dieser Kooperationenist, das Glasfasernetz mit mehreren Part-nern schneller und auch kostengünstigerzu errichten. Zudem lässt sich durch dieZusammenarbeit ein Wettbewerb derverschiedenen Netze erwirken, der In-vestitionen und Innovationen fördertund den Kunden und Hauseigentümerndie grössten Vorteile bietet. Damit mög-liche Kooperationspartner auch nachBaubeginn ihre eigene Glasfaserinfra-struktur erweitern können, verlegtSwisscom in allen Gebieten mehrere Fa-sern pro Wohnung, eine davon wirdSwisscom nutzen. Die weiteren Fasernstehen Kooperationspartnern zur Verfü-gung. Nach Ansicht von Swisscom lässtsich mit dem Mehr-Fasern-Modell ver-hindern, dass in der Schweiz ein neuesNetzmonopol geschaffen wird. Es be-rücksichtigt zudem die Forderungen derMitbewerber, dass sie vollständigen Zu-gang zum Netz haben.
Technik beim Glasfasernetz ist Basisfür WettbewerbBereits heute bestehen in derSchweiz verschiedene Netze, über
die Telekommunikations-Dienstleis-tungen angeboten werden. Anbietersind neben Swisscom die Kabelnetz-betreiber, die Elektrizitätswerke unddie Bahnen. Die Netzbetreiber kön-nen bei einer eigenen Infrastrukturverschiedene Technologien einsetzenund darauf ihre Dienste aufbauenund anbieten. Welche Services undwelche Netzqualität später angebo-ten werden, hängt stark von derWahl der eingesetzten Technologienab. Nur wenn die Betreiber das ge-samte Netzwerk von den Zentralenbis zum Endkundengerät überwachenund steuern, können sie sich auf demMarkt bei Service, Qualität und tech-nologischer Innovation differenzie-ren. Mit der Verlegung mehrererGlasfasern pro Wohnung steigen dieInvestitionen marginal, dafür wirdauf der Technologie- und Service-Ebene Wettbewerb gewährleistet.
Kooperationsmodelle für alle AnsprücheBis vor kurzer Zeit hat SwisscomPartnern die Partizipation an ihremNetz erschwert, wenn nicht gar ver-unmöglicht. Sie konnte die Mono-polstellung voll ausnützen. Durch dieLiberalisierung des Telekommarktsist Swisscom gezwungen, ihre Netzezu akzeptablen Preisen Partnern zurVerfügung zu stellen. Bei Swisscomstellt man sich vier unterschiedlicheModelle der Zusammenarbeit vor.Man erhofft sich dabei auch, die Ein-führung der Breitbandnetze in derSchweiz durch Glasfasernetze be-schleunigen zu können.1. Baupartnerschaft: Dieses Koope-
rationsmodell wendet sich insbe-sondere an Partner mit eigenenLeitungsnetzen wie Elektrizitäts-werke oder Kabelnetzbetreiber.Der Bau des Glasfasernetzes in ei-nem bestimmten Gebiet – bei-spielsweise eines Quartiers odereiner ganzen Stadt – wird durcheinen der Partner übernommen.Es werden mehrere Glasfasernverlegt, sodass bei Fertigstellungden anderen Kooperationspart-nern eine Faser übergeben wird.Erschliessen alle Partner gleichgrosse Gebiete, die untereinandergetauscht werden, entfällt eineAusgleichszahlung.
2. Investitionspartnerschaft: Diese Zu-sammenarbeit ist interessant fürPartner ohne eigene Kabeltrassees.Die Partner finanzieren gemein-sam den Ausbau. Ein Partner bautdas gesamte Netz und räumt dem
Investor ein Nutzungsrecht an denverlegten Fasern ein.
3. Miete einzelner Glasfasern: DieMiete einzelner Glasfasern durchPartner, die zwar keine Investitio-nen in den Netzausbau leistenwollen, jedoch die Technikebenefür die Steuerung des Glasfaser-netzes selber bestimmen wollen.
4. Miete von Übertragungsdienstleis-tungen: Wie bereits bei der beste-henden DSL-Breitbandtechnologieseit Jahren im Markt etabliert, bietetSwisscom auch Wiederverkaufsange-bote für Internet-Service-Anbieter,die nicht in eine eigene Infrastrukturinvestieren wollen. Diese Anbieterkönnen sowohl die Glasfaser als auchdie übergeordnete Netztechnologievon Swisscom nutzen.
Das EWZ ist bisher auf kein Angebotder Swisscom eingegangen, obwohlSwisscom 120 Millionen Franken fürden Ausbau des Glasfasernetzes in Zü-rich angeboten hat. Das EWZ will dieVerkabelung und die aufgesetzte Elekt-ronik selbst stellen und nur die Ser-vice-Ebene verschiedenen Providernzur Verfügung stellen. Langjährige Er-fahrungen der Swisscom zeigen aller-dings, dass dies wenig kundenfreundlichist. Denn bei einem Fehler ruft einKunde zuerst den Serviceprovider an,dieser wird auf die fehlerhafte Verkabe-lungs- und Elektronikseite hinweisen.Dieses Schwarzpeterspiel schätzenKunden sicher nicht, sie möchten einenAnsprechpartner für alles und vor allemeinen Provider, der für sie das Problemlöst.
Fazit: Es tut sich wasSwisscom stellte Anfang Novemberallen Internet-Service-Anbietern ihrWiederverkaufsangebot vor. Das An-gebot umfasst in der ersten PhaseBandbreiten bis 50 MB/s für denDownload und bis zu 10 MB/s imUpload. In der Pilotphase, die An-fang März startet und im Herbst2009 in ein kommerzielles Angebotübergeht, konzentriert sich das An-gebot auf die bereits mit Glasfasererschlossenen Gebiete in Zürich, Ba-sel und Genf. Mit Hilfe der verein-barten Zusammenarbeit überprüfendie Partner die technische Umset-zung und die Marktakzeptanz dereinzelnen Angebote. Die Internet-Service-Anbieter, darunter VTX,green, Netstream und init7, sind frei inder Gestaltung ihrer Endkunden- undWiederverkaufsangebote. (rk) ■

48 | Elektrotechnik 2/09
Te
lem
atik
& M
ultim
edia
Geräte und Werkzeuge für die Glasfaserverarbeitung haben einen hohen Standard erreicht
Werkzeuge für dieGlasfaserbearbeitung
Werkzeuge und Geräte rund um die Glas-faserverarbeitung haben einen hohenStandard erreicht, die Bedienung wurde inden letzten Jahren einfacher. Das erlaubteinem grösseren Kreis von Anwendern,sich mit der Glasfasertechnik auseinander-zusetzen.
Glasfaserkabel verlegen und vorbereitenVor dem Öffnen des Kabels muss der Vor-bereitung und den Umgebungsbedingun-
Für grosse Datenvolumen und lange Übertragungsstrecken ist die Glasfa-ser heute das geeignete Übertragungsmedium. Die Glasfaser-Spleisstech-nik ist darum ein Bestandteil moderner Kommunikationsinstallationen.
Rico De Boni gen Rechnung getragen werden. Alle Ar-beiten müssen an einem sauberen, trocke-nen Ort erfolgen. Bereits beim Kabelzugsind wichtige Punkte zu berücksichtigen,die sonst in der Praxis zu Fehlerquellenführen:• Das Kabelende muss genügend lang
sein. 4 m für das freie Ende werden alsMinimum benötigt, um die Spleissungoder Aufschaltung ordungsgemässausführen zu können.
Zu enge Biegeradien, Quetschungenund andere äussere Krafteinwirkungen
führen zu Kabelfehlern.Je nach Art des Kabels sind die Fasernunterschiedlich «verpackt» (Bilder 1 und 2).Die verlegten Kabel können über Muf-fen verlängert oder abgezweigt werden.Sie enden auf den Steckkontakten imKabelendverteiler (Bild 3) oder aufSteckdosen. Nun müssen vor der Faser-aufschaltung oder der Spleissung dieverschiedenen Isolationen mit den ge-eigneten Werkzeugen entfernt werden.Bei Leitungen mit Bündeladern wird alsErstes der Kabelmantel auf die gefor-derte Absetzlänge von 2 – 3 m entfernt.Dann muss der Kabelanfang aufca. 20 cm abisoliert werden. Wie bei ei-nem Telefonkabel werden nämlich vonverschiedenen Herstellern Aufreissfä-den unter dem Mantel eingearbeitet.
2
1
1 Innenkabel2 Bündeladerkabel für Aussenanwendung.3 Kabelendverteiler4 Kabelöffner5 Kevlarschere
Hube
r + S
uhne
rBu
gnar
d SA
Bugn
ard
SA
54
3

Knip
ex
Elektrotechnik 2/09 | 49
Tele
mat
ik &
Mul
timed
ia
Sie liegen dort, wo beim Aussenkabeldie orange Markierung aufgedruckt ist.Sind keine Aufreissfäden vorhanden,wird der äussere Mantel mit demKabelöffner (Bild 4) geschlitzt. Die Ein-schnitttiefe muss über die Stellschraubejustiert werden, es darf keine Verlet-zung der inneren Schichten erfolgen.Der Kabelmantel wird der Länge nachoder in Spiralform eingeschnitten. Diedarunterliegenden Armid-, Kevlar- undGlasgarnfäden können nun mit derSpezialschere (Bild 5) entfernt werden.Die Schneide mit einem Präzisions-schliff und kleinen Zähnen sorgt füreinen sauberen Schnitt. Eine solcheSchere hält wesentlich länger als eineSchere in einfacher Ausführung. DieAdern mit den Glasfasern liegen nunfrei und können mit der Reihenfolgebeschriftet werden.
Faser zur Spleissung vorbereitenZuerst wird die Bündelader entfernt. Nachleichtem Einritzen der Aderhülle mit demBündeladerwerkzeug (Bild 6) wird diesesKunststoffröhrchen dann sorgfältig ge-brochen. Keinesfalls darf ganz durchge-schnitten werden. Verletzte Fasernkönnen das Auswechseln einer ganzenKabellänge zur Folge haben. Festum-mantelte Fasern werden mit dem aufdie Faserisolation passenden und einge-stellten Absetzwerkzeug (Bild 7) abisoliert.
Die Glasfaser ist nun noch mit dem Pri-mär-Coating, der ersten Isolation, ge-schützt. Erst wenn die Faser für die Verar-
beitung an der Reihe ist, wird diese Be-schichtung mit der Millerzange (Bild 8)durch leichtes Ziehen mechanisch ent-fernt. Diese Standardzange ist exakt auf250 μm Coating und 125 μm Faserdurch-messer konstruiert. Kratzer und Einker-bungen auf dem Glas werden so vermie-den. Für andere, weniger gebräuchlicheDimensionen sind ebenfalls fest eingestell-te Zangen erhältlich. Die abisolierte Faserist nun ungeschützt und bruchempfindlich.Sie wird sorgfältig mit Isopropanol, einemhochreinen Alkohol, gereinigt. Ein einfa-cher Alkoholspender, er wird in der Medi-zin häufig gebraucht, ist dazu hilfreich. Erstellt durch den Pumpvorgang eine kleineMenge Flüssigkeit für das fuselfreie Reini-gungstuch bereit. Damit wird verhindert,dass Verunreinigungen in die Flüssigkeitgelangen und diese dann unbrauchbarwird.
Eine saubere und staubfreie Arbeits-umgebung ist immer wichtig. Staubigeund nasse Umgebungen sind zu meiden.
Fasern trennen und spleissen mit demLichtbogen-SpleissgerätAm Spleissplatz (Bild 9) sind neben demSpleissautomaten auch ein Faserbrech-werkzeug und die Presse für den Spleiss-schutz aufgestellt. Vor dem Spleissen wirddie Faser mit dem Faserbrechwerkzeug sau-ber geschnitten. Der Schnittwinkel musshochpräzise 90° zur Faserachse sein. BeiSinglemode-Fasern ist nur eine Abwei-chung von weniger als 1° zulässig. DieSchneidegeräte arbeiten nach dem Biege-
Ritz-Prinzip. Dabei wird die Glasfaserüber den Amboss des Gerätes gelegt. In ei-nem Arbeitsgang wird die Faser durch einDiamanten- oder Hartmetallrad leicht ein-geritzt und gebrochen (Bild 10). Der Fa-serabfall wird in einem kleinen Behälterentsorgt. Diese Faserreste müssen sofortsorgfältig gesammelt werden. Werden sievon Hand zusammengewischt, kann dieszu Stichverletzungen führen. Faserbrech-werkzeuge werden nicht nur zur Vorberei-tung bei Spleissungen sondern auch für dieVerarbeitung von mechanischen Verbin-dungen benötigt.
Das schnelle Spleissen mit Verbindun-gen von hoher Qualität ist eine deroraussetzungen für die Installation vonGlasfasernetzen. Durch einen Lichtbogenwerden die genau ausgerichteten Fasernmiteinander verschmolzen. Nicht nur beiNetzverbindungen, sondern auch im An-schlussbereich wird diese Fusionsspleis-sung angewendet. Da die Vor-Ort-Kon-fektion von Steckern meist zuzeitaufwändig und die Qualität nicht mitwerksgefertigten Steckern gleichgesetzt
6
9
1 2 3 4 5 6 3 8
7
10
Bugn
ard
SA
7 Bugn
ard
SA
6 Bündeladerwerkzeug7 Absetzwerkzeug8 Millerzange9 Spleissplatz 1 Faserbrechwerkzeug 2 Spleissautomat 3 Bildschirm 4 Spleissschutzpresse 5 Behälter für Faserabfall10 Faserbrechwerkzeug, Prinzip 1 Führungsnuten 2 Faser mit Primärbeschichtung 3 Klemmbacken 4 Absetzkante Primärbeschichtung 5 Amboss 6 Faser ohne Primärbeschichtung 7 Schneidrad 8 Faserabfall
8

50 | Elektrotechnik 2/09
Te
lem
atik
& M
ultim
edia
werden kann, kommen «pigtails» (mit ei-nem Stück Faser im Werk konfektionierte
Stecker) zum Einsatz. Sie werden an dasKabel gespleisst und bilden den Leitungs-
abschluss.Der Spleissvorgang im Fusionsspleiss-
gerät läuft automatisch ab (Bild 11). Die-se Programme werden auf dieunterschiedlichen Faserarten angepasst.Die Fasern werden in Präzisionsnuteneingelegt und automatisch justiert. DieQualität der Faserenden wird danngeprüft und schlecht geschnitteneFasern werden zurückgewiesen.
Bezüglich der Ausrichtung sind zweiSysteme vorhanden:• Die Mantelzentrierung. Hier ist die x-
und y-Richtung durch die Faserhalte-rung in den Nuten gegeben.
• Die Kernzentrierung. Durch einge-koppeltes Licht sucht das Gerät miteiner hochauflösenden Bildverarbei-tung die optimale Ausrichtung deslichtführenden Kerns in allen 3 Ach-sen (Bild 12).
• Eine Abschätzung für den Spleiss-verlust und der mechanische Zugtestbeenden das Programm. Nach demSchmelzen sind die erhitzten Teile derFasern empfindlich, sie werden nun miteinem Spleissschutz versehen. Die Heiz-kammer für den Schrumpfspleissschutzist im Spleissgerät integriert, eine zu-sätzliche Arbeitsplatte kann die Pressefür einen Sandwich-Spleissschutz undauch für die Spleisskassette enthalten.
HilfsgeräteEinige Hilfsmittel erleichtern dieArbeiten mit der Glasfaser und gehörendaher zur Ausrüstung.
Mit dem Fiberchecker, einem Rot-lichtlaser, wird sichtbares Licht in dieFaser eingekoppelt. Damit lassen sichDurchgangsprüfungen, Steckeridentifi-kationen, aber auch Unterbrüche oderSteckerunterbrechungen anzeigen. Dasrote Laserlicht tritt an Enden und Feh-lerstellen aus und zeigt so den Weg derLichtsignale (Bild 13). Der Fibercheckerkann auch dort zum Einsatz kommen,wo Beschriftungen und Dokumentatio-nen ungenügend sind.
Die Mehrzahl der Übertragungspro-bleme wird durch verunreinigte Ste-cker verursacht. Die Steckerreinigungund die anschliessende Kontrolle mitdem Prüfmikroskop helfen hier(Bild 14). Die 200 – 400-fache Vergrös-serung zeigt Kratzer und Schmutzteileauf. Mit auf die Stecker passenden Ad-aptern lassen sich die optischen Verbin-dungen sehr gut begutachten. Die Rei-nigung der optischen Ausgänge anApparaten oder der Stecker kann miteinfachen Reinigungsstäbchen ausSchaumstoff, trocken oder mit Alkoholerfolgen. Auch mit dem automatischen
Durchgangsprüfung
Unterbruch suchen
Zu enge Biegungen finden
13
Abkürzung Bedeutung
LWL Lichtwellenleiter = Glasfaser
LWL-Spleissung Verbindung zweier LWL durch kontrolliertes Verschmel-zen der Enden, auch Schmelz-, Thermo- oder Fusions-spleiss, im Idealfall keine Dämpfung an der Verbindungs-stelle.
Festader Glasfaser und einer sie fest umgebenden Hülle.
Hohlader Glasfaser mit einer losen Schutzhülle.
Bündelader Mehrere Fasern mit einer gemeinsamen Schutzhülle. Der Zwischenraum kann mit einem Wasser abweisenden Gel gefüllt sein. In der Regel werden bis zwölf Fasern kräftefrei gebündelt. Die Faser sind zur Unterscheidung unterschiedlich eingefärbt.
Faserkern Der Kern ist der zentrale Bereich eines LWL, in ihm fi ndet die Lichtübertragung statt.
Coating Coating ist eine Beschichtung. Sie schützt die Glasfa-ser. Die Beschichtung besteht aus zwei Schichten: dem Primär- und dem Sekundär-Coating (Primary Coating und Secundary Coating). Das Primär-Coating ist eine Art Vorbeschichtung und umgibt unmittelbar das Mantelglas. Diese Primärbeschichtung reicht für einen vollständigen Schutz der Glasfaser nicht aus, deswegen wird um die Primärbeschichtung eine zweite Schutzhülle angebracht, die Sekundärbeschichtung. Das Sekundär-Coating ist abhängig vom Faseraufbau, es besteht aus Kunststoff-kombinationen.
Singlemode-Faser (auch Monomode-Faser)
Sie haben einen kleinen Kerndurchmesser in der Grösse von 9 – 10 µm. Sie sind zur Übertragung bei grossen Distanzen geeignet.
Multimode-Fasern Multimode-Fasern haben einen deutlich grösseren Kern (50 µm oder grösser). Sie werden für kürzere Übertra-gungsstrecken verwendet.
12
Elektroden
1. 2. 3. 4.
Ausrichten Zusammenstossen Vorschmelz Hauptschmelz Reinigungs- Lichtbogen
z z
y x
11
11 Spleissablauf12 Spleissanzeige13 Prinzip Fiber-Checker

Elektrotechnik 2/09 | 51
Tele
mat
ik &
Mul
timed
ia
Ferrule-Cleaner kann die Reinigung aufeinfache Art erfolgen (Bild 15 ). ImHalter sind Reinigungsstreifen einge-baut, die durch Drehen die Flächenreinigen.
Die auf einer Glasfaser übertragenenLichtsignale stammen mehrheitlich ausLasern. Die Wellenlänge des Lichtes istaber nicht im sichtbaren Bereich. Darumsind beim Reparaturarbeiten an Glasfa-seranlagen die notwendigen Sicherheits-massnahmen zu treffen. Bei nicht sicherausgeschalteten Anlagen ist der Einsatzvon Laserschutzbrillen zwingend. SolcheLaserschutzbrillen müssen auf die Wellen-
längen der Laser bei Telekommunikati-onsanlagen abgestimmt sein. ■
14 15
14 Stecker-Mikroskop15 Ferrule-Cleaner
Diam
ond
SA
«Der Lastoptimierer»peak-control 8-8
0 8 9 107654321 1211 16 17 18 19 20 21 22 231513 14 24
Leis
tungsm
axim
a (
Pm
ax.)
h
reduziertes Leistungsmaxima (Pmax.) = reduzierte Stromkosten
Digitale Eingänge für kWh/Imp., Pmax. Rücksetzen8 Relaisausgänge (250V / 8 A)
Lastprofil- und Schalthandlungsspeicher für 36 Tage WinPeak passwortgeschützte Parametrier- und Auslesesoftware
Energiekosten einsparenEchte Trendberechnung
Messgeräte • Systeme • Anlagen Zur Kontrolle und Optimierung des Verbrauches elektrischer Energie
Brüelstrasse 47 CH-4312 Magden Telefon 061-845 91 45 Telefax 061-845 91 40 E-Mail: [email protected] Internet: www.elko.ch
Meimo AG – 8954 Geroldswil – T 043 455 30 40 – www.meimo.ch
AstroTec–Clevere Zeitschaltuhr steuert Rollläden nach Astro-Zeiten Automatisierte Rollläden und Lamellenstoren sparen im Winterdurch pünktliches Schliessen Energie und erhöhen durch dieSimulation von Anwesenheit die Sicherheit in den eigenen vierWänden. Dazu bedarf es neben der Motorisierung auch einerintelligenten Steuerung, die Rollläden und Lamellenstoren entspre-chend der Sonnenauf- und untergangszeiten öffnet und schliesst.Die cleveren Astro-Steuerungen bieten in 15 wählbaren Sprachenmaximalen Bedienkomfort.
Weitere Informationen zur sicheren Funktechnologie auf 868 MHz und zur verdrahteten Steuerung ProLine....
Meimo AGA n t r i e b e S t e u e r u n g e n
einfach clever
steuern
2_09-02_AstroTec-1_bearb.indd 1 2.2.2009 16:26:06 Uhr
weitere Informationen und Anmeldung:www.wissen-am-morgen.ch
Beschattung
Beleuchtung
Raumklima
Verkabelung
Steuerung
> Ort
3.3.09 St. Gallen 25.3.09 Lausanne4.3.09 Luzern 26.3.09 Bern 5.3.09 Lugano 27.3.09 Zürich
jeweils von 715 bis 930 Uhr
Inklusive Frühstück, Getränke und Infos zur Gebäudeautomation.
> Up to date?
„Reduktion von Energieverlusten und Steigerung des Raumkomforts“
Die Veranstaltung für Fachplaner gibt Ihnen Informationen, Checklisten sowie Anregungen und orientiert sich am SIA Planungsablauf. Von Spezialisten aus der Praxis für die Praxis.
2_Adiutec_WAM-RG_bearb.indd 1 23.1.2009 11:44:39 Uhr

52 | Elektrotechnik 2/09
Te
lem
atik
-New
s
Sogenannte Captchas werden heute ge-braucht, um einen Code sicher zu ver-schicken; doch die Sicherheit täuscht!Forscher an der School of ComputingScience der Newcastle Universitywww.cs.ncl.ac.uk haben gezeigt, dass siemit einer einfachen, kostengünstigen Me-thode die einzelnen Zeichen bei Capt-cha-Tests von Microsoft sehr erfolgreichtrennen und ordnen können. Da die Be-ständigkeit gegen diese Separierung dereinzelnen Zeichen ein wichtiger Faktorfür die Sicherheit des Captcha-Tests ge-gen automatisierte Angriffe ist, bedeutetdas einen schweren Schlag für den Si-cherheitsmechanismus. Gepaart mit einergeeigneten Zeichenerkennung könne derMicrosoft-Captcha mit einer Erfolgsratevon über 60% geknackt werden, so dieEinschätzung der Forscher.
Eine unregelmässige Anordnung undstörende, zusätzliche Linienbögen bei
Zeichen in Microsoft-Captchas automatisch trennbarCaptcha-Rätseln sind zwei der Ansätze,mit denen Programmen eine Separierungder Zeichen – also ein korrektes Trennenund Ordnen – möglichst schwer gemachtwerden soll. Die Forscher in Newcastlehaben ein Set von 100 Bildern des Micro-soft-Captchas analysiert und anhand derErgebnisse ein Verfahren entwickelt, daseine Segmentierung der Zeichen einesCaptcha-Tests mit mehreren einfachenAnsätzen und dementsprechend kosten-günstig versucht. Bei einem Test mit 500weiteren Captcha-Bildern konnte ihrWerkzeug bei 92% die Zeichenfolgenkorrekt auflösen. Dabei werden auchüberflüssige Linienbögen entfernt, wasnach Ansicht der Forscher auch die not-wendige Zeichenerkennung erleichtert.
Für Microsofts Acht-Zeichen-Captchas,die beispielsweise beim Webmail-Dienst-Hotmail zur Anwendung kommen, bedeu-tet das ein hohes Risiko. Ihr gutes Ergebnis
bei der Separierung, gepaart mit der Tatsa-che, dass einzelne Zeichen auch bei relativstarker Verfremdung mit gut 90% Wahr-scheinlichkeit erkannt werden können, lies-sen laut Forschern insgesamt Erfolgsratenvon über 60% bei automatischen Angriffenmöglich erscheinen. Eigentlich sollte maxi-mal eine von 10 000 Attacken Erfolg ha-ben. Microsoft hat sein Captcha bereits ge-ändert, um auf diese Angriffe gewappnet zusein. Ob damit wirklich eine Abhärtung ge-gen den Separierungsangriff gelungen ist,muss sich noch zeigen.
Der Anbietervon Netzwerk-technik SMCwww.smc.de hateine neue IP-Überwachungs-kamera vorge-stellt, die sowohltagsüber als auchmit Hilfe von
Infrarot in der Nacht Bilder vomSchutzobjekt liefern kann. Die Kameramit dem Namen «EZ Control VisionWireless Day/Night IP Camera» kannentweder per Ethernet-Kabel, aberauch per Funk mit dem Netzwerk ver-bunden werden. Die WLAN-Funktion
Webcam mit Infrarot-Sensor für Überwachungsaufgabenerspart dem Nutzer eine aufwändigeVerkabelung, das Produkt ist nach derInstallation im Funknetzwerk soforteinsatzfähig. Die Kamera richtet sichvor allem an eine semiprofessionelleZielgruppe und findet somit hauptsäch-lich im privaten Bereich Verwendung.Allerdings kann das Gerät sehr wohlauch im Business-Umfeld eingesetztwerden, zumal mehrere Geräte in ei-nem Netzwerk zusammengefasst wer-den können. Somit ist auch die Über-wachung von grösseren Anlagen möglich.
Die Kamera zeichnet mit VGA-Auf-lösung (640 x 480 Pixel) bis zu 30 Bilderpro Sekunde auf. Für lichtschwacheUmgebungen bzw. Aufnahmen in der
Nacht werden die sechs integrierten In-frarot-LED eingesetzt. Dies ist vor al-lem bei der Aufklärung oder Verhinde-rung von nächtlichen Einbrüchenhilfreich. So lässt sich beispielsweise einAlarm bewegungsgesteuert per E-Mail-Benachrichtigung auslösen. Eben-falls integriert ist ein Mikrofon, wo-durch auch die zum Bild gehörendenTöne aufgenommen werden können.Vor allem im semiprofessionellen Be-reich setzen sich IP-basierte-Videosys-teme gegenüber herkömmlichen Kame-rasystemen unaufhaltsam durch. DieInternet-Kameras punkten neben ihrerFlexibilität auch mit niedrigeren Kos-ten.
Das US-amerikanische Start-up Bos-ton-Power www.boston-power.comhat mit «Sonata» einen neuartigenLithium-Ionen-Akku für Notebooksentwickelt, der eine deutlich höhereLebensdauer als bisherige Modelleverspricht. HP wird Akkus auf Basisder Sonata-Technologie in Note-book-Geräten anbieten. Bereits indiesem Jahr 2009 sollen die laut Bos-ton-Power langlebigsten, amschnellsten ladenden Lithium-Io-nen-Batterien zum Einsatz kommen.Es handelt sich ausserdem um einemehrfach ausgezeichnete umwelt-freundliche Technologie. HP wirdim Enviro-Series-Programm drei
«Grüne» langlebige Akkus.Jahre Garantie auf die angebotenenBatterien geben. Das liegt daran,dass der Kapazitätsverlust durch wie-derholtes Auf- und Entladen bei derSonata-Technologie deutlich gerin-ger ausfallen soll als bei bisherigenNotebook-Akkus. HP geht davonaus, dass derzeitige Lithium-Ionen-Akkus bei mässiger Belastung nach300 Zyklen nur etwa 80% ihrerNennkapazität liefern, weshalb derGewährleistungszeitraum ein Jahrbeträgt. Der Akku «Sonata 4400»aber bietet laut Datasheet dieselben80% Kapazität auch nach 800 undmehr Ladezyklen. Ausserdem sinddie Energiespeicher um 50% schnel-
ler aufladbar als bisherige Produkte.Im Akku kommen keine Schwerme-talle wie Blei, Arsen, Cadmium undQuecksilber und auch kein PVC vor.
Sonata-Akkus: Statt als Prototypen baldin HP-Notebooks.

Elektrotechnik 2/09 | 53
Tele
mat
ik-N
ews
Vor 30 Jahren fanden 400 Benutzer deswissenschaftlichen Internet-VorläufersArpanet in ihrem elektronischen Post-fach ein Werbe-Mail. Der im damalsnoch sehr exklusiven Netz leicht zuermittelnde Absender, Gary Thurek,bekam entsprechenden Ärger mit demUS-Verteidigungsministerium, das dasArpanet betrieb. Thurek wollte auf dieseWeise Computer und Zubehör seinesArbeitgebers Dec an den Mann bringenund hatte auch Erfolg. Die BezeichnungSpam, die ursprünglich für Dosenfleischstand, gilt heute als Synonym für eineunnötig häufige Verwendung und Wie-derholung, hervorgegangen aus einemSketch der britischen Comedy-Serie«Monty Python’s Flying Circus». In Zu-sammenhang mit E-Mails tauchte dieBezeichnung erst 1993 auf. Heutzutageist von weltweit etwa 100 MilliardenSpam- oder Junk-E-Mails pro Jahr aus-
30 Jahre Spam und kein Endezugehen. Das sind rund 80% des gesam-ten E-Mail-Verkehrs.
Neben der immensen quantitativenZunahme hat sich Spam auch in quali-tativer Hinsicht gewandelt – von einembanalen Ärgernis zu einer äusserst luk-rativen Sparte der Online-Kriminalität.Die Verbindung zwischen Spam undOnline-Kriminalität war es auch, dieMcAfee dazu veranlasste, in einem Ex-periment herauszufinden, wie weit dieSpam-Flut um sich greift. Dazu hat derAnti-Malware-Anbieter weltweit 50Testpersonen eigens mit neuen E-Mail-Adressen und Notebooks ohneSpam-Filter ausgestattet. Hausfrauen,Beamte, Studierende und Rentner sind30 Tage lang hemmungslos gesurft, ha-ben im Internet eingekauft und sich zuallen möglichen Werbeaktionen ange-meldet.
Die Ergebnisse des Experiments spie-
geln den Wandel wider: Der Spam-Ver-sand wird heute in organisierter Formmassenweise betrieben, um E-Mail-Be-nutzer zu vermeintlichen Schnäppchen,Gewinnen aus Online-Verlosungen oderunseriösen Finanzdienstleistungen zu lo-cken. Die Konvergenz von Spam, Phish-ing und Spyware verdeutlicht einmalmehr die betrügerische Komponente unddas unlautere Ziel, den Internet-Benut-
Profi-Headsets für Fixnet, VoIP, Callcenter, Versicherungen, Banken, Helpdesk, Mobile ...
���� ���� �� �������
GN-Netcom World Leader in Headsets
Suprag AG • Friedackerstrasse 14 • CH-8050 ZürichTel. +41 (0) 44 317 20 60 • Fax +41 (0) 44 310 20 60 • [email protected] • www.suprag.ch • www.direct.suprag.ch
Telecommunication • Audioconferencing • Voice-Recording
OfficeCordlessGN 9300
VoIP
» Cordless DECT-Headset» USB, DSP Technologie für optimales VoIP» HiFi-Stereo Headset für Profi-Multimedia» Aktiver Lärmschutz
2_headset_bearb.indd 1 15.2.2008 13:33:40 Uhr
Das US-Unternehmen MTI MicroFuel Cells www.mtimicrofuelcells.comhat eine tragbare Brennstoffzelle vorge-stellt, die als Universalladegerät für eineReihe von Kleingeräten dienen soll.Mobion, so der Name des Produkts,lädt Mobiltelefone ebenso auf wieMP3-Player oder Digitalkameras. Dasmobile Ladegerät hat in etwa die Grös-se einer 3,5-Zoll-Festplatte. Als Ener-giequelle wird Methanol eingesetzt, dasin Form von einer austauschbaren Kar-tusche zugeführt wird. Als Ausgangsste-cker ist ein USB-Port verbaut, über denKleingeräte mit Energie betankt wer-
Mobile Brennstoffzelle als Universal-Ladegerätden können. Eine Tankfüllung Metha-nol reicht, um ein Handy zehnmal auf-zuladen, mit einem portablen Gerät10 000 Songs anzuhören oder 100 Stun-den Video zu sehen. Eine professionelleDigitalkamera schiesst mit der zur Ver-fügung stehenden Energie 6000 Fotos.Die Betriebstemperatur gibt das Unter-nehmen mit 0 bis 40 °C an. Im Laborerreichte das Gerät eine Ausbeute von62 Milliwatt pro Kubikzentimeter, be-ziehungsweise 1800 Wattstunden proKilogramm Methanol. Mobion ist der-zeit noch ein Prototyp, das Gerät sollteaber dieses Jahr noch auf den Markt
kommen. Genutzt werden soll Mobionvor allem in Verbindung mit Geräten,die besonders viel Strom brauchen, undnatürlich überall dort, wo keine Infra-struktur für das Laden von Akkus be-steht.
Mobion liefert Energie auf Basisvon Methanol.

54 | Elektrotechnik 2/09
Po
rtrai
t
KNX Swiss
KNX zum Standardverholfen
KNX Swiss ist vor drei Jahren aus derVorgängerorganisation EIBA Swisshervorgegangen. Zu ihren Hauptaufga-ben gehört es, die internationalen Akti-vitäten von KNX national zu verbreitenund zu unterstützen. Das ist offensicht-lich nicht allzu schwierig, denn derLeistungsausweis ist eindrücklich, wiePeter Vogel, Präsident von KNX Swiss,erklärt. «KNX ist heute ein Weltstan-dard, auf den man vertrauen kann. VieleSchweizer Elektroinstallationsfirmenunterstützen dies und setzen dieKNX-Technik in ihrem Leistungsange-bot ein.» Der Vereinspräsident muss eswissen, denn er verfolgt die Einführungvon EIB und KNX in der Schweiz seitder Gründung der EIBA Swiss im Jahre1993.
Gemäss Peter Vogel bündelt der Ver-ein die Interessen seiner Mitglieder und
KNX Swiss ist die Schweizer Länderorganisation der KNX Association mitSitz in Brüssel. Die Fachorganisation ist für die KNX-Aktivitäten in derSchweiz verantwortlich. Gemäss Präsident Peter Vogel hat KNX den Stan-dard für die Gebäudesystemtechnik gesetzt.
Erich Schwaningerkommuniziert dann gemeinsam amMarkt. «Wir haben die ‹busNEWS›,welche jährlich zweimal deutsch undeinmal französisch erscheint und überAnwendungen und Neuheiten berich-tet, und dies schon seit 15 Jahren!» Zuden Leistungen gehören auch die Aus-bildung von KNX-Anwendern, eineumfassende Internet-Plattform mit al-len Adressen und Partnern sowie ver-schiedene Broschüren zur Marketin-gUnterstützung. Bei Anfragen vermit-telt die Fachorganisation auch Projekteund Partner.
Eigenfinanzierung und internationaleZusammenarbeitWer kann Mitglied von KNX Swisswerden? Peter Vogel: «Im Wesentli-chen sind das Hersteller, die KNX-Produkte verkaufen, oder jemand, derauf KNX setzt und in seinem Unter-
nehmen gezielt fördert.» Auch Planergehören dazu. Aktuell sind es 104 Mit-glieder aus allen Bereichen. KNX Swissist auf starke und zahlreiche Mitgliederangewiesen, denn diese sind für die Fi-nanzierung des Vereins alleine zustän-dig. Dabei ist der Beitrag abhängig vonder Art und Grösse der Firma.
Neben der europäischen KNX-Or-ganisation, der KNX Association mitSitz in Brüssel, pflegt KNX Swiss einenintensiven Dialog mit den Länderge-sellschaften in Deutschland, Frankreichund Italien. In der Schweiz steht dieZusammenarbeit mit der EEV und demVSEI im Vordergrund.
Auf die Frage nach dem typischenEinsatzgebiet für KNX-Produkte hatPeter Vogel eine klare Antwort. «KNXist Gebäudesystemtechnik und für alleBereiche des Wohn- und Zweckbausgeeignet. Energieeffizienz, Licht undJalousiesteuerungen, Anbindung anMultimedia und Sicherheit gehören da-zu.» Die Angebotspalette reiche voneinfachen bis sehr umfassenden Lösun-gen. Auch für Bussysteme in kleinenAnlagen sei KNX der richtige Partner.Und es gebe KNX-Technologien, dieauch ohne Software und PC in Betriebgenommen werden können. «Nur wis-sen das leider noch nicht alle!» DieseSysteme sind laut Vogel so konzipiert,dass ein späterer Ausbau je nach Bedarfproblemlos möglich ist. «ProprietäreSysteme können das nicht von sich be-haupten.»
Die Nachbarländer holen aufWie beurteilt Peter Vogel die Verbrei-tung der Gebäudeautomation in derSchweiz, auch im Vergleich mit demAusland? «Wir sind gut unterwegs, sinduns aber bewusst, dass immer nochmehr möglich ist.» Laut KNX Swisserzielten die Hersteller von KNX-Bus-komponenten im vergangenen Jahr ei-nen Umsatz von über 30 Mio. Franken.Ein Drittel davon könne durchaus für
Das moderne Heim wird mit einem Touchscreen gesteuert.

Dienstleistungen aus der Elektrobranche dazu gerechnet wer-den, ergänzt der Präsident. Doch restlos zufrieden ist Peter Vo-gel nicht. «Die Schweiz hatte lange Jahre die Nase vorn. Jetztholen die Märkte in Deutschland mächtig auf, aber auch Italienund Frankreich werden sehr aktiv», weiss der Geschäftsführervon Hager Tehalit AG. Generell werde der steigende Bedarf anWohnkomfort den weiteren Fortschritt noch beschleunigen.
Gemäss Peter Vogel wird KNX Swiss den Fokus weiterhinauf die Ausbildung legen. «Dazu haben wir Schulungsunterla-gen erstellt, welche wir dem VSEI und insbesondere den Be-rufsschulen zur Verfügung stellen können. ‹KNX 4 schools›war 2007 der Startschuss für all diese Tätigkeiten.» Zudem willder Verein den Bestand der Mitglieder aus dem Bereich derSystemintegratoren weiter ausbauen. «Wir wollen die richtigenLeute vernetzen und ihnen effiziente Hilfsmittel zur Verfügungstellen.»
Mit der Entwicklung von KNX dürfen Peter Vogel und seineLeute zufrieden sein. «Der Installationsbus ist heute Wirklich-keit und nicht mehr wegzudenken. In Zukunft werden nochmehr Informationen aus den bestehenden Gewerken verwendetwerden, was nur mit intelligenten Systemen möglich ist.» KNXhabe, so der Vereinspräsident, den Standard für die Gebäude-systemtechnik gesetzt.
Die Aktivitäten von KNX Swiss werden aus der Geschäftstel-le in Dübendorf gesteuert. «Mit René Senn haben wir einenversierten Geschäftsstellenleiter, der auch das Marketing ver-steht», lobt Peter Vogel. Es sollte also nicht mehr allzu langedauern, bis allenthalben bekannt ist, dass einige KNX-Techno-logien auch ohne PC in Betrieb genommen werden können.Den Präsidenten wirds freuen. ■
Weitere Informationen:www.knx-swiss.ch
KNX-Präsident Peter Vogel.
Generalvertretung für die Schweiz:
Demelectric AG, Steinhaldenstrasse 26, 8954 GeroldswilTelefon 043 455 44 00, Fax 043 455 44 11
e-Mail: [email protected]
e-Katalog: www.demelectric.chBezug über den Grossisten. Verlangen Sie unseren Katalog.
Energie-management:rationell undeffizient
D05
E-No 985 656 100
E-No 985 157 658
E-No 985 154 045
E-No 985 602 205
2_Demelectric_Energie_bearb.indd1 1 8.1.2009 11:48:11 Uhr

56 | Elektrotechnik 2/09
M
anag
emen
t
Eine Herausforderung für den Chef und den Mitarbeiter
Kritikgesprächeohne Klimastörungen
Jeder Mitarbeiter hat eine persönliche«Reizschwelle» gegenüber Kritik: Der ei-ne spricht bereits auf Ihr Stirnrunzeln odereinen prüfenden Blick an, während der an-dere ein wahrlich dickes Fell hat. Erschwe-rend kommt hinzu, dass gleiche Mitarbei-ter zu verschiedenen Zeiten und in ver-schiedenen Situationen auf Kritik unter-schiedlich reagieren. Sie sollten also nichtnur Charakter und Temperament, sondernauch die augenblickliche Verfassung desMitarbeiters berücksichtigen.
Leistungsdefizite ansprechenKritisieren Sie nie am Freitagnachmit-tag, sondern warten Sie bis Montag. Sieverderben ihm sonst nicht nur das Wo-chenende, sondern riskieren auch, dassFrust entsteht und er am Montagschlecht gelaunt erscheint oder sichkrankschreiben lässt. Achten Sie auf Ihreeigene innere Einstellung. Sind Sie selbstverärgert über einen Fehler? Fühlen Siesich aufgebracht und erregt? Dann be-steht die Gefahr, dass Ihr Kritikgesprächnicht ruhig und besonnen verläuft.
Mit Kritik richtig umgehenTipp 1: Geben Sie dem Mitarbeiter Gele-genheit, zu reagierenWenn er Gelegenheit zu einer Stellung-nahme hat, ist er aktiv am Gespräch be-teiligt. Rechnen Sie aber auch mit Ausre-den oder damit, dass die Schuld anderenPersonen oder Umständen zugeschobenwird. Das darf Sie nicht aus der Ruhe
Gründe für Kritikgespräche gibts genug: ein Mitarbeiter kommt morgens zu spät,er ist langsam oder unfreundlich oder er arbeitet nicht gründlich. Sie müssen ihnalso ins Gebet nehmen, ein Kritikgespräch führen. Schlechte Leistungen zu kriti-sieren gehört zum Alltag. Aber: Einfach ins Blaue hinein schimpfen lohnt sichnicht. Vielmehr können Sie durch gezielte und überlegte Kritik die Leistung desMitarbeiters steigern.
Rolf Leicher bringen. Überhören Sie Ausreden. Übri-gens: Für das Kritikgespräch ist ein kla-rer Tatbestand nötig. Kritisieren Sie erst,wenn Sie Beweise haben, nicht schon aufVerdacht.
Tipp 2: Nie persönlich werdenKritisieren dürfen Sie nur die Sache unddie Leistung des Mitarbeiters, nicht sei-ne Person. Das hört sich einfacher an alses ist. Im Gespräch sind es die einzelnenWorte, die eine Kritik sachlich oder per-sönlich machen.
Die Formulierung «von Ihnen bin ichenttäuscht» kann sachlich gemeint sein,sie hört sich jedoch für den Betroffenensehr persönlich an. Bei persönlicher Kri-tik verliert der Mitarbeiter ein StückSelbstwertgefühl. Vorgesetzte werdenoft unbewusst persönlich in ihren For-mulierungen. Das passiert schnell wegen
der angespannten Atmosphäre und weilman sich über die schlechte Leistung är-gert. Im Ärger sagt man schnell etwasUnkontrolliertes. Eine falsche Formulie-rung ist z. B. «Sie sind aber langsam heu-te». Richtig ist dagegen: «Diese Arbeithat aber verhältnismässig viel Zeit ge-braucht.» Das ist sachbezogene Beurtei-lung.Tipp 3: Zur Wahrheit ermutigenMachen Sie es jedem leicht, Fehlerund Versäumnisse einzugestehen.Die Akzeptanz ist grösser, wenn erkeine «Folgen» befürchten muss. Vor al-lem ängstliche Mitarbeiter werden durchärgerliches Verhalten des Vorgesetzten ab-gehalten, die Wahrheit zu sagen. Sie wer-den immer nach Ausreden suchen und nurin äussersten Fällen etwas zugeben.
Tipp 4: Kritisieren Sie nur untervier AugenJemanden vor anderen zu kritisieren, zeigtschlechten Führungsstil und ist für das Ar-beitsklima sehr schädlich. Kritik an einerPerson vor Kollegen kann dazu führen, dassdie Gruppe spontan für den KritisiertenPartei ergreift. Sorgen Sie auch dafür, dassnach der Kritik nicht unnötigerweise ande-re davon erfahren. Kritisieren Sie vor allenDingen einen Mitarbeiter nicht vor Kun-den.
... sich der gleiche Fehler beim Betreffenden wiederholt, also keine Besserung eintritt.... sich die Leistung nur kurzfristig bessert und dann wieder nachlässt.... der Mitarbeiter guten Willens ist, aber wegen Unvermögen die erwartete Leistung nicht erbringt.... der Mitarbeiter sich frustriert zurückzieht und sich das Be triebsklima verschlechtert.... es zu einer Diskussion über den Tatbestand kommt.... Sie selbst nachtragend oder auch misstrauisch sind.... Sie Diskretion verletzen und andere, vor allem Unbeteiligte, von diesem Gespräch erfahren.... Sie mit Ihrer Kritik allzulange warten, Tatbestände also schon länger zurückliegen.... Sie einen Sachverhalt kritisieren, für den der Mitarbeitende nicht verantwortlich ist.... Sie persönlich werden, weil Sie selbst erregt sind über den Vorfall.
Ein Kritikgespräch ist nicht gelungen, wenn ...

Elektrotechnik 2/09 | 57
Man
agem
ent
Tipp 5: Reden Sie nicht von früherenFehlernManche Vorgesetzte wärmen alte Ge-schichten auf. «Sie haben diesen Fehlerschon mal früher gemacht». Diese Be-hauptung des Vorgesetzten ist ein Stich, isteine alte verheilte Wunde. VergangeneFehler dürfen nicht «aufgewärmt» wer-den. Vielen ist es sehr peinlich, wenn sieetwas falsch gemacht haben und der Firmadadurch einen Schaden verursachen. Esgibt auch Mitarbeiter, die einen Fehler of-fen zugeben und ihn bedauern. Es ist im-mer besser, wenn der Mitarbeiter das tutund nicht wartet bis der Chef die Pannefeststellt und ihn dann kritisiert.
Kritikgespräche konstruktiv führenBeenden Sie die Kritik, indem SieMassnahmen vereinbaren. Die Kritikwird konstruktiv, wenn diese vomMitarbeiter akzeptiert wird. Die Äus-serung «Das darf nicht mehr passieren –sehen Sie mal zu, wie Sie klarkommen»,genügt nicht. Die Frage muss lauten:«Was ist zu tun, damit der Fehlernicht wieder vorkommt?» Nach einemgelungenen Kritikgespräch wird sich derMitarbeiter besonders anstrengen. Beob-achten Sie sein Arbeitsergebnis und erken-nen Sie die Verbesserung ausdrücklich an.Wer seine Leistung nach einem Kritikge-spräch bessert, braucht eine Rückmeldung.
Das spornt an und motiviert, die guteLeistung zu halten.
Ein Wort an den MitarbeiterKritik ist auch zu Ihrem Vorteil. Unddeshalb sollten Sie darauf reagieren, ohnedie Ruhe zu verlieren und sich nicht ver-letzt fühlen. Nicht über alles lässt sich ur-teilen. Ein versäumter Termin kann An-lass zu berechtigter Kritik sein, aber nichtsein Outfit, denn das ist eine persönlicheAngelegenheit.
Akzeptieren Sie die Kritiknicht nur zum ScheinIhr Vorgesetzter sucht eine Änderung inIhrem Verhalten. Stimmen Sie zu, aberändert es sich nicht, dann muss er glauben,Sie hätten ihn getäuscht: Versprechen SieBesserung und bemühen Sie sich darum.Hören Sie zu. Bleiben Sie ruhig, und ach-ten Sie darauf, was Ihr Kritiker tatsächlichsagt. Bitten Sie, falls nötig, um mehr De-tails der Kritik: «Könnten Sie mir das ge-nauer erklären?», ist eine gute Frage. Bit-ten Sie um Vorschläge oder Hilfe bei derSuche nach einer Lösung: «Was erwartenSie von mir genau?» Auf eine Kritik, dieSie für berechtigt halten, stimmen Sie of-fen zu: «Sie haben Recht – ich sehe es ein.Ich werde es ändern.» Diskutieren Siedann mit ihm gemeinsam die nötigen Vor-aussetzungen unter denen Ihre Änderungmöglich ist.
Fallen Sie dem Kritiker nicht ins Wort,wenn er kritisiertAuch wenn Ihre Reaktion Ihnen aufder Zunge liegt, lassen Sie ihn zuerstausreden. Auch auf Ihre innere Ein-stellung kommt es an. Die Haltung«Das müssen Sie gerade sagen» pro-grammiert Sie negativ. Sehen Sie ineiner Kritik nicht automatisch einenAngriff auf Ihre Person. Denken Sieauch mal daran, dass es für Vorge-setzte nicht immer leicht ist, ein gu-tes Kritikgespräch zu führen.
Dramatisieren Sie die Kritik nichtMachen Sie aufs einer Mücke keinen Ele-fanten. Fangen Sie nicht an zu jammern –«Bei mir geht alles daneben» – wollen SieMitleid erregen? Tragen Sie Ihrem Chefkeinesfalls die Worte der Kritik nach. Siemachen es ihm schwer, wohlwollend zukritisieren. Denken Sie stets daran: Vielenfällt das Kritikgespräch auch nicht geradeleicht. Also keinen Rückzug ins Schne-ckenhaus. Die ersten Stunden nach derKritik entscheiden. Reagieren Sie nichtüberempfindlich! Sie verlieren mehr, alsSie gewinnen. Verschaffen Sie sich Res-pekt, indem Sie Kritik ertragen.
T Tatsache darstellen: Zeitnah und präzise. Vorwurfsfrei und ohne ÜbertreibungU Ursache erfragen: Wie kam es dazu? Warum ist es passiert? Seit wann kommt es vor?L Lösungen besprechen: Wie vermeiden Sie den Fehler? Welchen Vorschlag haben Sie?P Positive Auswirkungen nennen: Welche Auswirkungen hat Vermeidung von Fehlern? Welche Vorteile entstehen?E Ergebniskontrolle festlegen: Wie ist festzustellen, ob Besserung erfolgt?
Kritikgespräche mit «TULPE» führen
1. Hat sich der gleiche Fehler beim Betreffenden wiederholt? ❑ ❏
2. Konnte der Mitarbeiter die Kritik mit Erfolg zurückweisen? ❑ ❑
3. Ist der Mitarbeiter zwar guten Willens, kann aber die Leistung, ❑ ❏ die von ihm erwartet wird, nicht erbringen?
4. Wird nach der Kritik kontrolliert, ❑ ❏ ob die Leistung sich tatsächlich verbessert?
5. Hat sich der Mitarbeiter frustriert zurückgezogen nach dem ❑ ❏ Gespräch?
6. Ist es zu einer Diskussion über den Tatbestand gekommen? ❑ ❏
7. Sind Sie nachtragend oder auch misstrauisch nach dem ❑ ❏ Kritikgespräch?
8. Ist die Diskretion verletzt worden, haben andere, vor allem ❑ ❏ Unbeteiligte, von diesem Gespräch erfahren?
9. Übersehen Sie als Vorgesetzter Fehler des einen ❑ ❏ Mitarbeiters, den Sie bei einem anderen kritisieren?
10. Wird mit der Kritik gewartet, so dass Tatbestände schon ❑ ❏ länger zurückliegen?
11. Ist ein Sachverhalt kritisiert worden, für den der Mitarbeiter ❑ ❏ nicht verantwortlich ist?
12. Kommt es zu persönlichen Äusserungen, die verletzend sind? ❑ ❏
Auswertung:Je mehr Sie ja angekreuzt haben, desto schlechter für Sie.Nein-Antworten zeigen, dass Ihre Kritik ankommt.
Checkliste Kritikgespräche führen Ja Nein

58 | Elektrotechnik 2/09
M
anag
emen
t
Verteilen Sie keine Schuld an andereNiemand anderer als Sie selbst sind für Ihr Verhalten verantwort-lich. Geben Sie jemand anderem die Schuld, zeigen Sie höchstensIhre Abwehr. Auch wenn andere Schuld an einem Fehler haben, soist es besser, wenn der Chef dies selbst erkennt. Führen Sie ihn ambesten mit Fragen dazu.
Entschuldigungen sind keine EinsichtWenn Sie immer wiederholen, wie leid Ihnen dieser Fehlertut, so ist dies zwar eine geschickte Taktik, um den Kritisie-renden zu beruhigen. Sie bremsen ihn wahrscheinlich auchetwas, jedoch kann es sein, dass er daraufhin etwas nicht er-wähnt, was für Ihre Leistungsverbesserung nötig gewesenwäre. Einsicht ist besser als Entschuldigung. Geben Sie demKritiker die Möglichkeit, alles zu sagen, was ihn stört. Bren-nen Sie darauf, die gesamte Kritik zu erfahren.
Nehmen Sie Vorschläge anSätze wie: «Sind Sie aber empfindlich» oder «Ihnen kann mannichts recht machen» sind eine Gegenreaktion, die nicht richtigsein kann. Gehen Sie auch nicht zu Ihren Kollegen/-innen nach derKritik mit der Absicht, den Kritiker jetzt schlecht zu machen. Ver-zichten Sie darauf, sich abzureagieren. Als Leistungsträger im Be-trieb müssen Sie die Verantwortung für sich selbst übernehmen.Stellen Sie im Vorfeld der Kritik Ihren Fehler offen dar, dann istdas Gespräch einfacher zu ertragen. Demnach warten Sie nicht, bisSie gerufen werden, sondern kommen dem Chef zuvor. MachenSie dem Kritiker keine Hoffnung, dass sich Ihre Leistung sofortverbessert, wenn Sie wissen, dass das nicht geht. Nennen Sie dieVoraussetzungen, unter denen Sie sich ändern. Das kostet zwarÜberwindung, macht aber Eindruck. ■
Schweizerische Elektro-Einkaufs-Vereinigung eev
[email protected] • www.eev.chTel. 031 380 10 10
Werden Sie Mitglied!Über 1850 Firmen profi tieren bereits.
Weitere Infos: www.eev.ch
Gemeinsam
die Zukunft gestalten
Ou
tilla
ge,
mac
hin
es, a
pp
arei
ls d
e m
esu
reW
erkz
eug
e, M
asch
inen
, Mes
sger
äte Soyez e-fficaces
Préparez vos commandes grâce à notre catalogue complet en ligne sur internet. La dernière édition du catalogue est également disponible sur demande par téléphone au 021 624 00 54 ou par e-mail à[email protected]
Für Ihre e-ffizienzStellen Sie Ihre Bestellungen mit Hilfe unseres vollständigen Online-Katalogs im Internet zusammen. Die letzte Katalogausgabe kann auf Wunsch auch telefonisch unter der Nummer044 432 31 70 oder per E-mail an [email protected] angefordert werden.
www.e-bugnard.ch
BUGNARD SA LausanneHEGA-BUGNARD AG Zürich
2_Bug-ann_bearbeitet.indd 1 5.9.2008 11:20:04 Uhr

Elektrotechnik 2/09 | 59
Bran
chen
-New
s
Nachlauf-Zeitschalter
in modernster IC-Technik. Für Trep-penhausbeleuch-tungen,Bad- /WC-Ventilatoren etc.AP- und UP. Von:
StufenloseDrehzahlreglerfür Ventilatoren,Gebläse, Absaug-geräte, 230 und400 V. AP und UP.Fragen Sie uns an:
ANSONVentilator-
Steuerungenz. B. Ein- / Aus-Schalter, Stufen-schalter, Thermo-stat-, Differenz-druck- und Zeit-schalter. Anrufen:
SS
ANSON8055 Zürich Friesenbergstr. 108 Fax 044/461 31 11
ANSON liefert gut und preisgünstig:
1-8_neu_bearbeitet_2009.indd 7 5.12.2008 15:05:29 Uhr
044/4611111
Hervorragende Leistungen an der 6. Schweizer-Meisterschaft für Elektroinstallateure
20 Elektroinstallateure an der6. SM in Horw
Im Elektroausbildungszentrum inHorw hatten die 20 Kandidaten einemit Schema, Disposition, Material- undWerkzeugliste sowie Funktionsbe-schrieben vorgegebene Installationsauf-gabe in 24 Arbeitsstunden zu erstellen,auszuprüfen, zu programmieren und inBetrieb zu setzen
Mit grosser Motivation und viel Elansetzten sich die Kandidaten mit der
Ein attraktiver Wettkampf sorgte vom 7. bis zum 10. Januar 2009 für Span-nung an der sechsten Schweizer-Meisterschaft für Elektroinstallateure.
Adrian Sommer, Berufsbildung VSEI gestellten Wettbewerbsaufgabe auseinan-der. Manch einer zweifelte an sich selberund wusste am ersten Tag nicht, wie erdiese anspruchsvolle Aufgabe in der vorge-gebenen Zeit lösen sollte.
Doch jeder der jungen Elektrofachleuteder Schweiz fand ein Rezept, mit demZeitdruck fertig zu werden. Alle Teilneh-mer arbeiteten auf schon fast weltmeister-lichem Niveau und mit hoher Konzentra-tion bis zum letzten Tag. Mit dieserhervorragenden Leistung sind sie die Vor-bilder für die angehenden Elektroinstalla-teure.
Spannender Höhepunkt des WettbewerbsDer letzte Tag der Schweizer-Meister-schaft bildete den Höhepunkt desWettbewerbs. Zusammen mit über 200
Gästen fieberten die Kandidaten denResultaten entgegen. Nach einemRundgang durch die Werkstatt und derBesichtigung der Prüfungsaufgabenfolgte die ersehnte Rangverkündigung:Dominik Süess aus Andwil SG siegtevor Martin Buob aus Neuenkirch LUund Arno Conradin aus Valchava GR.Die drei Erstplatzierten erhielten einenGranitpokal mit Gravur zur Erinnerungan ihre aussergewöhnliche Leistung.Zusätzlich werden Dominik Süess undMartin Buob am InternationalenWorldSkills» im September 2009 im kanadi-schen Calgary, die Schweiz vertreten.Der drittplatzierte Arno Conradin wirdam Europäischen Wettbewerb jungerElektriker im Frühjahr 2010 im spani-schen Madrid teilnehmen
Installationsaufgabe SM 2009Es handelte sich um eine Elektroinstalla-tion für die Tiefgarage eines Mehrfamili-enhauses. Eine Schaltgerätekombinationmusste komplett aufgebaut und verdrah-tet werden für die verschiedenenBeleuchtungen, eine 2-stufige Abwasser-pumpe sowie die speicherprogrammier-bare Steuerung (SPS) für das Garagentorund die Garagenlüftung mit CO-2 Mes-sung. Insgesamt war es eine enorm an-spruchsvolle Aufgabe mit grossem In-stallations- und Verdrahtungsaufwand,die in den vorgegebenen 24 Arbeits-stunden gelöst werden musste. ■
1 Die drei Erstplatzierten :2. Martin Buob,1. Dominik Süess,3. Arno Conradin.
2 Fertig installierte Elek-troinstallation für dieTiefgarage eines Mehr-familienhauses.1
2

Br
anch
en-N
ews
Kaum einer, der eine Berufslehre absol-viert hat, wird dies heute bereuen. SeineBerufschancen wurden gegenüber andernBildungswegen nie geschmälert. Mancherkann heute stolz auf Karriere und Erfolgezurückblicken. All jene, die noch daran ar-beiten, werden mit der Verleihung des In-novations- und Anerkennungspreises derVereinigung ehemaliger Lehrlinge VeL(BBC/ABB, Alstom, Bombardier moti-viert, an ihren Zielen weiterzuarbeiten.
Dieses Jahr feiert die VeL ihr 75-jähri-ges Bestehen. Am Jubiläumstag, am Sams-tag, 6. Juni 2009, wird der Verein seinenersten Innovations- undAnerkennungspreis verleihen. Erfolgdurch ausserordentliche Leistungen isthöchst selten wie ein Lottotreffer. Esbraucht neben Vorstellungskraft auch Aus-dauer und Durchhaltewillen, um weit ge-steckte Ziele im Auge zu behalten. DasErreichen solcher Ziele will die VeL ho-
Innovations- und AnerkennungspreisVeL 2009 mit Preissumme Fr. 18 000.–
Ausschreibung des Anerkennungspreise der Vereinigung ehemaliger Lehrlinge (VeL)
norieren. Sie möchte damit auch zeigen,dass eine Berufslehre ein solides Funda-ment ist, um darauf Grosses aufzubauen.
Was für Leistungen sollen denn eineChance zur Auszeichnung mit dem erstenInnovations- und Anerkennungspreiseshaben? Die nachfolgenden Beispiele sindMöglichkeiten, sie dürfen jedoch nicht alsEingrenzung verstanden werden: Pionier-arbeiten, Erfindungen und Patente, aus-serordentliche Weiterbildung mit Spitzen-resultaten, besondere Leistungen untererschwerten Bedingungen, Unterneh-mensgründung, Schaffung von Arbeits-plätzen, Eingliederung von Menschen mitLeistungseinschränkungen, Entwicklungs-hilfe und so weiter. Nicht der persönlichefinanzielle Erfolg ist der Massstab, auchwenn er oft eine augenfällige Grösse ist,besondere Leistungen zu messen. Waszählt, sind viel mehr die Bedeutung für einUnternehmen, Weiterkommen durch In-
novation, soziale Verträglichkeit und unserVerantwortungsbewusstsein gegenüberder Gesellschaft.
Die Preissumme beträgt 18 000 Fran-ken. Sie wird durch eine dafür qualifizierteJury auf ein bis drei Preisbewerber aufge-teilt. Kandidaturen können selbst einge-reicht oder durch Dritte vorgeschlagenwerden. Die Kandidatur ist bis zum30. März 2009 an folgende Adresse zurichten: Vereinigung ehemaliger Lehrlin-ge VeL, Jury Preisverleihung, Postfach1435, 5401 Baden. Das Reglement zurPreisverleihung kann von derselben Ad-resse bezogen oder auf der VeL-Homepa-ge eingesehen werden. ■
VeLVereinigung ehemaliger Lehrlinge5401 Badenwww.vel-info.ch
������� ����
��������� �� ���� �� ���������������� ß �� ���� ���������� ��� �� �� �� �� ß ���� ��� �� �� �� ������!"� �#���$"�#����� ß �#%&'!"� �#���$"�#�����
2_netzqualitaet_bearb.indd 1 23.12.2008 10:30:02 Uhr

Elektrotechnik 2/09 | 61
NIN
-Kno
w-h
ow
Fragen und Antworten zur NIN 2005
NIN-Know-how 42
Mängelbehebung:Isolationswiderstand
Kürzlich erhielten wir von einem Kundenden Auftrag, die Mängelbehebung seinerelektrischen Installation des Einfamilien-hauses vorzunehmen. Der Elektro-Sicher-heitsberater führte in seiner Mängelliste ei-nen schlechten Isolationswiderstand auf.Dieser muss nach seinen Angaben behobenwerden. Wir sind jedoch der Meinung, dassbei periodischen Kontrollen auf die Isolati-onsmessung verzichtet werden darf und wirdeshalb diesen beanstandeten Mangel nichtbeheben werden müssen. Was denken Siedazu? ( S. R. per E-Mail )
Sie stützen sich wohl auf die Verord-nung des UVEK über elektrischeNiederspannungsinstallationen (auchNIVV genannt), welche in Artikel10 Abs. 3 den Isolationswert bei peri-odischen Kontrollen von Anlagen mit20-jähriger Kontrollperiode nichtzwingend fordert. Gemäss diesemArtikel ist es also dem Elektro-Si-cherheitsberater überlassen, ob er beieiner periodischen Kontrolle einesEinfamilienhauses eine Isolations-messung macht oder eben nicht. Ge-rade in älteren Installationen kommtnoch oft die Nullung nach Schema 3vor. In diesen Anlagen ist eine Isolati-onsmessung kaum durchführbar undder Elektro-Sicherheitsberater kanngemäss NIVV auch darauf verzich-ten. In Anlagen, welche nach SystemTN-S errichtet sind, ist eine Isolati-onsmessung aber auf jeden Fall mög-lich. Mit der Isolationsmessung beieiner periodischen Kontrolle werdennicht nur die klassischen Isolations-defekte sichtbar gemacht, sondern eslassen sich auch Mängel aufspüren,
1
Oft wird der Aufwand, einer Norm zu entsprechen, sehr gross, nämlich dann, wenn die In-stallation bereits errichtet ist und man bei der Schluss- oder Abnahmekontrolle Mängelentdeckt. Es entstehen so oft auch unangenehme Situationen gegenüber dem Kunden. Inder Frage 7 ist dies der Fall, am Schluss wurde bemerkt, dass die Anordnung des Zug-schalters im Bereich 1 der Dusche wohl eher nicht ganz sorgfältig ausgewählt wurde.Man tut sich gut daran, wenn man vor allem gerade in speziellen Räumen die NIN bis indie Detailplanung berücksichtigt. Die NIN gilt bekanntlich nicht nur für das Errichten einerelektrischen Anlage, sondern auch für dessen Planung. Lesen Sie nebst dieser auch dieweiteren interessanten Fragen aus dem Leserkreis.
Pius Nauer und David Keller welche durch Laieninstallationenentstehen können. Der versierteElektro-Sicherheitsberater wird alsogerade auch deshalb bei periodischenKontrollen nicht auf die so wichtigeMessung verzichten. Eine Ausnahmeist, wenn die Installation oder einigeStromkreise durch Fehlerstrom-schutzeinrichtungen geschützt sind.Hier kann auf die Messung verzichtetwerden, weil die Fehlerstromschutz-einrichtung den Isolationswiderstanddauernd überwacht. Die NIN defi-niert im Kapitel 6 nicht nur Isolati-onswiderstände für Neuanlagen, son-dern auch für bestehende Anlagen.Aus diesen Gründen muss ein bean-standeter Isolationsdefekt anlässlicheiner periodischen Kontrolle aufjeden Fall instand gesetzt werden.
(pn)
Einsparungen bei KupferleitungenBei einem Neubau eines Bürogebäu-
des hat mein Chef gemeint, man solltedie Zuleitungen auf die Etagenverteilerkleiner dimensionieren als im Devis vor-gegeben. Seine Berechnungen nach NINhaben ergeben, dass das durchaus drin-liegt. Ich bin da aber nicht so sicher, kannman das einfach so? (S. D. per E-Mail)
Da gibt es verschiedene Aspekte,nach welchen die Leitungen nun aus-gewählt werden können. Die NINdefiniert die nötigen Querschnitteaus sicherheitstechnischen Überle-gungen. Mit dem Einhalten dieserNorm wird kein Brand entstehen unddie Leitung wird im normalen Be-trieb und im voraussehbaren Stö-rungsfall keinen Schaden nehmen.Zudem beeinflusst der Leiterquer-schnitt die automatische Abschaltungim Fehlerfall. Nun gibt es aber
2
durchaus noch weitere Gesichtspunk-te. Zum einen gilt es, die an der Lei-tung in Wärme umgewandelten Ver-luste in Franken und Rappen umzu-rechnen. Auch bei den momentansehr hohen Kupferpreisen kann maneine Amortisationsrechnung anstellenund so feststellen, wie lange es dau-ert, bis die für einen allenfalls höherals durch die NIN berechneter Lei-terquerschnitt entstehenden Mehr-kosten durch die Strompreise wiederaufgefressen sind. Da würde manchernoch staunen! (Die CD zur NIN2005 beinhaltet übrigens ein solchesBerechnungsprogramm, sie kann beider electrosuisse in Fehraltorf käuf-lich erworben werden.) Das ist abernoch nicht das letzte Argument. Diemodernen Probleme betreffen nichtselten die Netzqualität. Dabei hängtdie Spannungsverzerrung sehr starkvom Leiterwiderstand ab. Die dannnötig werdende Fehlersuche und-behebung für solcherlei Störungenkostet innert Kürze ein Vielfaches derMehrkosten eines dickeren Kabels.Nicht zuletzt sollte das Augenmerkdem Spannungs-(-ab)fall gelten. DieNIN empfehlen den Wert von 4 %vom Anschlussüberstromunterbre-cher bis zum Energieverbrauchernicht zu überschreiten.
Bevor Sie also den kleineren Quer-schnitt installieren, besprechen Siediese Punkte nochmals mit IhremChef. Möglicherweise sind solcheÜberlegungen in die Devisierung miteingeflossen. (dk)
Widerstandswert der Schutzleiterin Mess- und Prüfprotokoll
Beim Ausfüllen des Mess- und Prüf-protokolls ist mir aufgefallen, dass inder neusten Ausgabe die Leitfähigkeitdes Schutzleiters in Ohm aufgeführtist. Dies hat mich verunsichert undich bin mir nun nicht sicher, ob ichsämtliche Schutzleiterwiderständemessen und dann auch in das Proto-koll eintragen muss ? Sind im Mess-und Prüfprotokoll sämtliche Felderauszufüllen ? (W. v. L. per E-Mail )Grundsätzlich ist das Mess- und Prüf-
3

62 | Elektrotechnik 2/09
N
IN-K
now
-how
protokoll ein gutes Hilfsmittel für Sie,um die Mängelfreiheit Ihrer Installati-on darzustellen. Dementsprechend ge-nügt es, dass man jene Felder ausfüllt,welche auch mit der Sicherheit des ent-sprechenden Stromkreises in Verbin-dung stehen. Wie die einzelnen Mes-sungen und Prüfungen durchgeführtwerden müssen, wird in der NIN imKapitel 6 beschrieben. Ich möchtediese Frage an einem Beispiel, wel-ches Sie in der Abbildung 3 ersehenkönnen, erklären. Hier handelt essich um eine Steckdoseninstallation,welche durch einen LSFI geschütztist. Nebst der Beschreibung desStromkreises muss der maximaleKurzschlussstrom ermittelt und ein-getragen werden. Die Messung wirdam Anfang des Stromkreises ausge-führt und dient der Kontrolle desSchaltvermögens der Kurzschluss-schutzeinrichtungen. Bei grösserenAnlagen genügt es, wenn die Mes-sung an der Hauptverteilung einmalgemacht wird. Der minimale Kurz-schlussstrom wird am Ende der Lei-tung ge-messen. In unserem Beispielist dieser jedoch nicht mehr Relevantfür die automatische Abschaltung imFehlerfall (Fehlerstromschutzeinrich-tung) und es kann darauf verzichtetwerden. Natürlich ist es nicht verbo-ten, den Kurzschlussstrom zwischenPol- und Neutralleiter zu messen undauch in das Mess- und Prüfprotokolleinzutragen. Es können so auf einfacheArt die Verbindungen der Pol- und
Neutralleiter überprüft werden. Mitder Messung der Fehlerstromschutz-einrichtung und dem Eintragen derentsprechenden Auslösezeit ist die au-tomatische Abschaltung im Fehlerfallüberprüft und gewährleistet. DerSchutzleiter kann nun gemäss NINmit einer Niederohmmessung ge-prüft werden. Gemäss NIN 6.1.3.2kann diese Prüfung mit einem Gerätdurchgeführt werden, welches mit ei-ner Spannung von 4 – 24V AC oderDC und einem Strom von mindes-tens 0,2 A arbeitet. Dies kann alsoauch die gute alte Taschenlampe sein.Wähle ich diese Art von Schutzleiter-prüfung, so vermerke ich dies imMess- und Prüfprotokoll in dem ent-sprechenden Feld mit «OK». Mit ei-nem Installationstester lässt sich auchder genaue Widerstandswert ermitteln,dieser kann direkt in das Protokoll auf-genommen werden. (pn)
Fremde SicherungssystemeNeulich musste ich bei einem Pi-
ketteinsatz eine durchgebrannteNHS-Sicherung ersetzen. Dabei passtemeine NH-00-Sicherung nicht richtig indas Element, sie stand leicht vor. Sind dieToleranzen tatsächlich so gross, oder ha-ben die Maschinenerbauer (die Maschi-ne stammt aus Deutschland) irgend-welche exotischen Elemente eingebaut?
(HP. K. per E-Mail)
Die Toleranzen sind nicht derartgross ! Weltweit gibt es sehr viele ver-
4
schiedene Sicherungssysteme. FürHausinstallationen legt die NIN inArtikel 4.3.2.1 (und die folgenden)fest, welche Systeme angewendet wer-den dürfen. Für Hochleistungssiche-rungen sind für Neuanlagen solchenach DIN-Norm in den Grössen 00 bis4a zu benützen. Für Geräte, Maschi-nen, einfach generell für Verbrauchergelten aber die NIN so nicht. Das In-verkehrbringen von Erzeugnissen inder Schweiz wird in der Niederspan-nungs- Erzeugnisverordnung (NEV)geregelt. Diese verlangt, ähnlich wie dieNiederspannungs-Installationsverord-nung (NIV), dass die vereinbartentechnischen Normen oder die aner-kannten Regeln der Technik eingehal-ten werden müssen. Dazu gibt es natür-lich ein Universum von IEC und EN-Normen. In dem von Ihnen beschriebe-nen Fall könnte es also so sein, dass derHersteller der Maschine zum Schutzeder eingebauten Teile Schmelzsiche-rungen eingebaut hat, welche fürSchweizer Hausinstallationen nicht zu-lässig wären. Zum Beispiel gibt es ne-ben den bei uns verbreiteten Grössen00 bis 4a auch solche mit Zwischen-grössen. Grössen wie «000» oder«C00» unterscheiden sich nur margi-nal von der uns bekannten Grösse DIN00. So sind NH-Sicherungen derGrösse C00 nur etwa anderthalb Milli-meter weniger tief und etwa neuen Mil-limeter schmaler als die der Grösse 00.Wenn Sie also vor Ort genau hinschau-en, erkennen Sie wahrscheinlich die Be-zeichnung C00 auf dem Sicherungsele-ment, was erklären würde, weshalb SieIhre NH00-Patrone nicht richtig ein-setzen konnten. Diese Situation trifftman immer öfter, das ist auch zulässig.Vielleicht bestellen Sie für Ihren Kun-den einen Reservesatz von diesen Si-cherungen, damit im Notfall nicht nochmit langen Ausfallzeiten gerechnet wer-den muss. Zu diesem Thema sei auchnoch erwähnt, dass es nicht nur beiNHS andere Grössen gibt. Auch Nor-malleistungssicherungen findet man inallen Grössen und Formen. Sicher sinddie Neozed bei uns auch bekannt, auchwenn diese in den NIN nicht erwähntsind. (dk)
Installationsanzeige beim Austau-schen eines Verbrauchers
Bei einem Kunden dürfen wir ein älte-res Ceran-Kochfeld austauschen. Anstel-le des alten Gerätes werden wir einenInduktionsherd einbauen. Nun sind wiruns nicht sicher, ob wir für diese Arbei-ten eine Installationsanzeige an die zu-
5
FION
Test
13AC I n 0.03A
-25
1 Wohnzimmer TT 3x1,5 LSFI C 13 450 ------- 45 OK 13 30 27
450ARs
28msRCD
3

NIN
-Kno
w-h
ow
ständige Netzbetreiberin senden müssen.In der Niederspannungs-Installations-verordung NIV wird eine Installa-tionsanzeige ab 3,6 kVA Anschlusswertgefordert. Gilt dies auch dann, wennnur ein Verbraucher ausgetauschtwird? (K. S. per E-Mail)
Es ist richtig, dass die Niederspan-nungs-InstallationsverordnungNIV ab 3,6 kVA Anschlusswert ei-ne Installationsanzeige fordert.Wesentlich genauere Angaben zudiesem Thema erhält man jedochin den entsprechenden Werkvor-schriften der Netzbetreiberinnen.In den Werkvorschriften derOstschweizer Netzbetreiberinnenist zum Beispiel eine Installations-anzeige gefordert, wenn bei Er-weiterungen oder Änderungen einMehranschluss von 3,6 kVA ent-steht. Das heisst, dass bei einem Aus-tausch eines Kochherdes mit an-nähernd gleicher Leistung keine zu-sätzliche Installationsanzeige ge-macht werden muss. Aber aufgepasst,eine entsprechende Anzeige mussauch bei Anschlüssen unter 3,6 kVAgetätigt werden, wenn es sich um ei-nen Apparat handelt, für welchen einseparates Anschlussgesuch gemachtwerden muss. Ein Induktionskoch-herd kann Oberschwingungen verur-sachen und muss deshalb auf jedenFall mit einem separaten Anschluss-gesuch und der entsprechenden Ins-tallationsanzeige der Netzbetreiberinangemeldet werden. In solchen Fäl-len lohnt es sich also, wenn man dieWerkvorschriften zur Hand nimmt.
(pn)
Elektrotechnik 2/09 | 63
L1
L2
L3
N
XLR
L2
L1
Z P
olleiter (ZL)
2KI
2KI
NU
Z Polleiter (ZL)
RX
L
ZL2U
I N2K •
=
6b
L1
L2
L3
N
Z Polleiter (ZL)
Z P
olleiter (ZL)
Z Polleiter (ZL)
XL XLR R
L2 L3
L1
NU XL
R
3KI
3KI 3KI
ZL3UI N
3K •=
6c
6d
Bestimmen des maximalen Kurzschlussstromes mit einfachem Installationstester6a Einpoliger Kurzschluss Pol,- Neutralleiter (IK 1)6b Zweipoliger Kurzschluss zwischen zwei Polleitern (IK 2)6c Dreipoliger Kurzschluss zwischen allen Polleitern (IK 3)
L1
L2
L3
N
XL R
Z Polleiter (ZL)
XL R
Z Neutralleiter (ZN)
XL R
Z Neutralleiter (ZN)
L1
N
3U N
1KI
ZL23U
)ZNZL(3UI
N
N1K
••≈
+•=
Z P
olleiter (ZL)
6a
TechnikTechnik
WirtschaftWirtschaft
Informatik
Informatik
Die zti bildet Sie weiter.Höhere BerufsbildungProzessfachmannIndustriemeisterElektro-SicherheitsberaterElektro-ProjektleiterElektro-InstallateurTelematikerFachkurse Haustechnik undGebäudemanagementInstandhaltungsfachmann
InformatikCisco Certified NetworkingAssociate
Höhere Fachschule (eidg. anerkannt)
Dipl. Techniker/in HFMaschinenbauBetriebstechnikElektrotechnik(Techn. Informatik, Elektronik, Energie)
Informatik (Software Entwicklung,Systemmanagement, Wirtschaftsinformatik)
HaustechnikHochbau und Tiefbau
NachdiplomstudienHF NDS Betriebswirtschaftslehre fürFührungskräfte: (Managementkompetenz)
HF NDS Informatik-/Software-EngineeringNDK Projektleiter Gebäudeautomation
ISO
9001
:200
0•
Edu
Qu
a
Zuger Techniker- und InformatikschuleHöhere Fachschule für Technik, Landis+Gyr-Strasse 1, 6304 Zug
Telefon 041 724 40 24, Fax 041 724 52 62E-Mail [email protected], www.zti.ch
Ein Unternehmen der -Gruppe
Kursbeginn: April/OktoberInfoabende: siehe www.zti.ch

64 | Elektrotechnik 2/09
N
IN-K
now
-how
Maximaler Kurzschlussstrom IK maxAuf dem Mess- und Prüfprotokoll
können verschiedene Werte eingetra-gen werden. Unter der Spalte IK findetman aber verschiedene Angaben. ZumBeispiel liest man da IK min. In denNIN habe ich gelesen, dass man, umden IK min berechnen zu können, dendreipoligen Kurzschlussstrom durch 4dividieren soll. Heisst das umgekehrt,dass ich, wenn ich den einpoligenKurzschlussstrom messe, diesen mitdem Faktor 4 multiplizieren muss,um den «IK max» bestimmen zu kön-nen? (R. S. per E-Mail )
Die Bezeichnungen «min» und «max»führen immer wieder zu Verwirrungen.Die in den NIN 4.3.4.3.2. B + E be-schriebenen Berechnungen helfen, ausdem mutmasslichen, maximalen Kurz-schlussstrom (in der Installation ent-spricht das dem prospektiver Kurz-schlussstrom zwischen allen drei Pollei-tern) direkt den minimal fliessendenKurzschlussstrom zu bestimmen. Dabeisind auch Ungenauigkeitsfaktoren, allenvoran die Widerstandserhöhung derLeiter infolge Erwärmung, mit einge-rechnet. Um den Leitungsschutz, aberauch den Personenschutz sicherstellenzu können, muss man mit diesen Unge-nauigkeiten rechnen. Umgekehrt könn-te das aber auf den Holzweg führen.Den maximalen Kurzschlussstrom mussman kennen, um den Schutz der Schalt-geräte zu überprüfen. Wenn also einLeitungsschutzschalter über ein Nenn-schaltvermögen von 6000 Ampere ver-fügt, so darf an der Einbaustelle keingrösserer Strom als diese 6000 Am-pere fliessen, da sonst der LSzerstört wird. Da die Installa-tionstester keine dreipoligen Kurz-schlussströme bestimmen können,muss man nun eine Art «rick» an-wenden. Um den maximalen Kurz-schlussstrom zu bestimmen, misst mandie Schleifenimpedanz zwischen Pol-und Neutralleiter, oder wenn das Mes-segerät mitmacht denjenigen zwischenzwei Polleitern. Der Installationstes-ter rechnet nun den mutmasslichenKurzschlussstrom und zeigt diesenim Display. Dieser Wert entspricht
6
aber nicht dem minimalen Kurz-schlussstrom (IK min), denn die Fol-gen aus der möglichen Leitererwär-mung, den Übergangswiderständenund der Messgeräteungenauigkeitsind ja noch nicht eingerechnet. Umden ungünstigsten Fall hier anzu-nehmen, wäre aber gerade der Ein-bezug der Leitererwärmung falscham Platz. Die echte Mess-geräteungenauigkeit des Installati-onstesters kann man aus den techni-schen Unterlagen herauslesen. Nunberechnet man den dreipoligenKurzschlussstrom (IK max) indemman den angezeigten Wert mit demrichtigen Faktor multipliziert. Wiegross dieser Faktor ist und wie er zu-stande kommt, ersehen Sie aus denAbbildung 6. (dk)
Platzierung des Schalters nebenDuschhahn
In einem Altersheim wurde im Badzimmereine Personenrufanlage installiert. DerZugschalter ist ca. 50 cm neben dem Misch-hahn der Dusche auf einer Höhe von 1,2 mplatziert (Dusche ohne Wanne). Ist diesePlatzierung so zulässig, wenn es sichbeim Zugschalter um eine Trocken-ausführung handelt und der Strom-kreis mit SELV betrieben wird?
(A. S. per E-Mail)
7
Bei Duschen ohne Wanne erstreckt sichder Bereich 1 1,2 m ab fester Wasser-austrittsstelle. In diesem Fall, weil keinefest installierte Brause montiert ist, wirdvom Wasserhahn gemessen. Siehe dazuauch Abbildung 7. Der Zugschalter fürden Personennotruf liegt nun also imBereich 1. Gemäss NIN dürfen hiernur bedingt elektrische Betriebsmit-tel angeordnet sein. In NIN7.01.5.1.2.2.1 wird die Schutzart fürsämtliche Installationsgeräte undEnergieverbraucher definiert, welchein den verschiedenen Bereichen zu-gelassen sind. Für den Bereich 1 gibtdie NIN die Schutzart IPX4 vor. InNIN 7.01.5.3 lässt die Norm für denBereich 1 folgende Installationsgerätezu: Verbindungs- und Anschlussdosenfür die zugelassenen Energieverbrau-cher (Handtuchradiatoren, Ventilato-ren, Wassererwärmer) und Betriebsmit-tel in SELV- oder PELV-Stromkrei-sen mit einer Nennspannung bis25 VAC oder bis 60 VDC. WollenSie den Zugschalter nun neben demWasserhahn belassen, so kann er mitSELV bis 25 VAC betrieben werdenund muss der Schutzart IPX4 ent-sprechen. Eine weitere Möglichkeitist die Anordnung ausserhalb des Be-reichs 1, so kann ein «ormaler» Zug-schalter installiert werden. (pn)
7
6312 Steinhausen-ZugTelefon 041 740 58 [email protected]
Maschinen: EN60204Schaltgeräte: EN60439Werkzeuge: VDE701/702
Sicherheits-Tester!Klein, portabel und preisgünstig, Software inklusiv.
Schutzleiter: 10AIsolation: 500V DCHV: 1kV, 2.5kV ACAbleitstrom: mAM
I217
0

Elektrotechnik 2/09 | 65
Vera
nsta
ltung
en
Die weltweite Verunsicherung ist gross,was zu tun ist, um genügend Energie be-reitzustellen und gleichzeitig denCO2-Ausstoss zu reduzieren. Das 16. in-ternationale Europa Forum Luzern er-möglicht einen Überblick über die globa-le Energiesituation, in welche RichtungEuropa sich orientiert und welche Per-spektiven sich der Schweiz bieten.
Denn im Land stehen in den nächs-ten fünf Jahren wichtige Entscheide zurSicherung der Energieversorgung an.An der öffentlichen Abendveranstaltungvom 27. April 2009 referieren Bundes-rat Moritz Leuenberger, EU-Kommis-sionsmitglied Andris Piebalgs und derehemalige IEA-Direktor Claude Man-dil zusammen mit Stromwirtschaftsver-treter Heinz Karrer, CEO Axpo, über
Lift fahren und Kaffee kochen, die Heizung aufdrehen und mit MaschinenProdukte herstellen – alles selbstverständlich. Aber wie lange noch? DieÖl-, Erdgas- und Kohlevorkommen stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung.Die Schweizer Kernkraftwerk-Bewilligungen laufen aus. Sind erneuerbareEnergien wie Wasser-, Wind- und Sonnenkraftwerke oder Biogasanlagenvalable Alternativen?
Geht uns die Energie aus?Europa Forum Luzern: «Konfliktfeld Energie – Entwicklungen und Horizonte»
das Konfliktfeld Energie. An der Ta-gung vom 28. April 2009 referieren unddiskutieren Experten wie Fatih Birolvon der Internationalen Energieagentur(IEA) aus Paris, Walter Steinmann, Di-rektor des Bundesamts für Energie, Jas-min Staiblin, CEO der ABB Schweiz,und viele weitere über Energie-Szena-rios, Energieeffizienz und erneuerbareEnergien.
Europa Forum Luzern im KKL Lu-zern: Montag, 27. April 2009, 17.30 bis20.00 Uhr öffentlicher Abend (Eintrittfrei). Dienstag, 28. April 2009, Tagungvon 9.00 bis 18.00 Uhr.
Weitere Informationen und Anmeldung:www.europa-forum-luzern.choder Tel. 041 318 37 87.
Gebäudeautomatiker/in STFWDiese Ausbildung richtet sich an Fachleute mit abgeschlossener Berufslehre in der Elektro- oder Haustechnik. Sie haben Interesse an einer modernen und komplexen Gebäudetechnik und deren Verknüpfungen und sind bereit, eineanforderungsreiche Weiterbildung zu bestehen.
Berufsbegleitender Lehrgang, Freitag und Samstagvormittag. Die Ausbildung MSRL-Spezialist/in beinhaltet neben Haus-technik (Heizung, Klima, Kälte, Sanitär) auch Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik in Anlagen der Gebäudetechnik.
Kursdaten 15. Mai 2009 bis 15. Mai 2010
Infoveranstaltung Dienstag, 17. März 2009, 18.30 - ca. 20.00 Uhr
2_200902_STFW_bearb.indd 1 30.1.2009 15:38:12 Uhr

66 | Elektrotechnik 2/09
Ve
rans
taltu
ngen
Wissen für Gebäudetechnik-Fachplaner
WAM – die Wissens-plattform am Morgen
Wissen ist das zentrale Gut einerDienstleistungsgesellschaft, so auch inder Planung von Gebäudetechnikanla-gen. Als neue Plattform für die Wis-sensvermittlung an Fachplaner aus denBereichen Elektro, HLK, Gebäudeau-tomation sowie Fassade steht WAM –Wissen am Morgen zur Verfügung.Unter der Abkürzung WAM zeigenHersteller konkrete Anwendungen undKonzepte, wie die beiden zentralen An-forderungen Reduktion des Energie-verbrauchs sowie Steigerung desKomforts effizient umzusetzen sind.
Mit minimalem Aufwand soll das Ma-ximum erzielt werden. Dieses Credo giltnicht nur für den Energieverbrauch ei-nes zeitgemässen Gebäudes, es gilt auchfür WAM: die Teilnehmer erhalten dieInformationen von führenden Herstel-lern der Gebäudeautomation geballt amMorgen früh. Denn so bleibt der Abendfür Hobby und Familie erhalten und derTag ist für das Geschäft nutzbar.
Anhand des SIA-Planungsablaufs er-fahren die Teilnehmenden zu den zen-tralen Gewerken der Raumautomation(Beleuchtung, Beschattung, Raumkli-ma, Verkabelung, Steuerung) alle wich-tigen Aspekte, um Projekte mit Erfolgabzuwickeln. Die grosse Menge an In-formationen ist kompakt auf Checklis-ten zusammengefasst und hilft so auch
Führende Hersteller offerieren den Gebäudetechnik-Fachplanern im Märzdie Gelegenheit, Fachwissen aus zentralen Gebieten der Gebäudeautoma-tion aus erster Hand zu erhalten – im Rahmen eines gediegenen Morgen-essens in verschiedenen Regionen der Schweiz. Als roter Faden dient derSIA-Planungsablauf.
Rony Müller, Michael Birchler
nach dem Wissenstransfer, das Gelern-te in der Praxis umzusetzen – auch nachWochen oder Monaten.
Themenübersicht:• Beschattungsanlagen sind ein wichti-
ges und oft unterschätztes Stellgliedfür das Raumklima. Griesser AG zeigtdie wichtigsten Punkte zur Planungeiner Beschattungsanlage auf, damitder Komfort einer Storensteuerungsteigt und eine gute Abstimmung zuHLK erfolgt.
• Beleuchtungsanlagen sind heute be-deutend mehr als nur Licht schaltenund dimmen. Aspekte wie Präsenz,Grundbeleuchtung, Stimmung, Tages-lichtabhängigkeit und subjektive Emp-findungen sind zu berücksichtigen. SELightmanagement AG setzt Massstäbein der Beleuchtungstechnik.
• HLK-Anlagen müssen transparentsein, denn nur so kann sich der Betrei-ber an konkreten Grössen orientierenund Optimierungen vornehmen. Mo-derne Anlagen wissen, wo die Stellglie-
der stehen und liefern exakte Informa-tionen. Belimo Automation AG ist be-kannt für innovative Technik und gibtDetails aus erster Hand preis.
• Verkabelung muss nicht statisch sein.Clevere Automationslösungen bauenauf eine flexible und nachhaltige Instal-lation. Intelligente Gebäude brauchenauch in der Verkabelung neue Ansätzewie die von der Firma Woertz.
• Steuerung ist das Herz einer Anlageund muss durch eine offene Architek-tur zukunftstauglich sein. GünstigeBedienmöglichkeiten und hoherKomfort sind heutige Anforderungen,für welche die Saia-Burgess AGLösungsmöglichkeiten aufzeigt.
Um den interessierten Fachplanern die Entscheidung noch einfacher zu machen,kommt WAM in verschiedene Schweizer Städte:
– St. Gallen Dienstag, 3. März 2009– Luzern Mittwoch, 4. März 2009– Lugano Donnerstag, 5. März 2009– Lausanne Mittwoch, 25. März 2009– Bern Donnerstag, 26. März 2009– Zürich Freitag, 27. März 2009
Die Teilnehmer investieren ihre Zeit (7.15 bis 9.30 Uhr) und schenken ihre Aufmerk-samkeit, dafür offeriert WAM ihnen eine Plattform zur Wissensvermittlung, garniertmit einem reichhaltigen Frühstück. Ist das ein Deal? Die Veranstalter freuen sich aufviele Anmeldungen!Weitere Infos und Anmeldung: www.wissen-am-morgen.ch
SIA-Planungsablauf

Elektrotechnik 2/09 | 67
Vera
nsta
ltung
en
VeranstaltungenMessen und Tagungen
ineltec 2009Technologiemesse für Gebäude und Infrastruktur.Neuheiten, Produkte und Dienstleistungen aus Bereichen der modernen Gebäudetechnolgie:Energie, Elektro, Licht, Kommunikation-Netzwerktechnik, In-formationssysteme, Sicherheit, Automation, Architekturrelevante Systeme, Messen und Prüfen, Service.Ort: Messezentrum Basel, Halle 1Dienstag bis Freitag, 1. bis 4. September 2009Infos: www.ineltec.ch
go 2009Technologiemesse für Automatisierung und Elektronik.Neuheiten, Produkte, Systeme und Dienstleistungen aus folgenden Bereichen: Steuerungssysteme, Antriebstechnik, Sensorik, Robotik- und Handling-Systeme, Engineering in der Automation, Elektro-nik, Mess- und Prüftechnik u. a.Ort: Messezentrum Basel, Halle 2Dienstag bis Freitag, 1. bis 4. September 2009Infos: www.go-automation.ch
4. Elektro-Forum 2009 der em electrocontrol AGForum für Elektrofachleute wie Betriebselektriker, Projektleiter, Elektro-Installateure, Technische Leiter, Liegenschaftsverwalter, Elektro-Sicherheitsberater etc.BEA bern expo, Donnerstag, 26. Februar 2009, 8 bis 17 Uhr.Infos und Anmeldungen: www.electrocontrol.chSchulungen oder Tel. 031 980 10 50
Kurse der em electrocontrol AG• NIN-Update 26. März, 23. April, 30. April 2009• Leckstrommessung, Isolationsüberwachung 26. März, 23. April, 30. April 2009Kursort: Inforama, 3052 Zollikofen BEInfos und Anmeldungen: www.electrocontrol.ch, Tel. 031 980 10 50
Tagungen electrosuisse (SEV):• Informationstagung für Betriebselektriker
Zürich, 11. März, 12. März, 22. April, 23. April 2009Bern, 17. März 2009, Basel, 23. März 2009
• Journée d’information pour électriciens d’exploitationFribourg, 5. März 2009 Lausanne, 25. März 2009
• Informationstagung NIN 2010Zürich, 18. 8./24. 8. 2009 Bern, 20. 8. 2009Lugano, 26. 8. 2009 Landquart, 8. 9. 2009Basel, 10. 9. 2009 Fribourg, 15. 9. 2009
Weitere Infos und Anmeldungen: www.electrosuisse.ch, Tel. 044 956 11 75
• Fachtagung der ITG: Organische Elektronik Ort: ZHAW Winterthur Donnerstag, 2. Juli 2009, 8.30 bis 17 Uhr Infos und Anmeldung: www.electrosuisse.ch/itg
Swiss-Engineering / Feierabend-Event• Konvergenz in Triple-Play Applikationen: Internet, TV und Telefonie. Ort: Translumina Networks AG, Flurstrasse 50, Zürich Mittwoch, 18. März 2009, 17.30 bis 19.30 Uhr Infos und Online-Anmeldung: www.fael.ch > Anlässe > Focus 543
Europa Forum Luzern16. Internationale Tagung im KKL Luzern zum Thema «Konfl iktfeld Energie: Entwicklung und Horizonte». Globale Energieverknappung, europäische Herausforderungen, schweizerische Perspektiven. Montag, 27. April 2009, 17.30 bis 20.00 Uhr öffentlicher AbendDienstag, 28. April 2009 TagungProgramm, weitere Infos und Anmeldung:www.europa-forum-luzern.ch, Tel. 041 318 37 87.
easyFairs®-FachmessenIndustriebau: 16. – 17.September 2009, Messe Bern, Halle 210.Weitere Informationen: www.easyfairs.com/Schweiz
Weiterbildung und Seminare
Elektro-Bildungs-Zentrum EBZ • Elektro-Bauleiter KZEI 2009
31. Januar 2009 bis 6. Juni 2009 (11 Tage, 8.00 bis 16.30 Uhr)Intensivtage für Elektro-SicherheitsberaterGenaue Kursdaten, Anmeldung und weitere Informationenersehen Sie in unserer speziellen Broschüre.Weitere Infos, Daten und Anmeldung: www.ebz.ch, Tel. 052 354 64 64
Schweizer Arbeitsgemeinschaft Biologische Elektrotechnik SABE Grundschulseminar, Kursdauer 2 Tage.Mittwoch/Donnerstag, 27./28. Mai 2009 Weitere Infos und Anmeldung: www.sabe-schweiz.ch, [email protected], Tel. 061 723 06 12
VSEI-Kurse• Blitzschutzseminar von VSEI und electrosuisse
Vermittlung von Know-how über Blitz- und Überspannungsschutz1. bis 3. April, 16. und 17. April 20094 Tage bei TBZ und 1 Tag bei electrosuisse30. 9. bis 2. 10. sowie 22. und 23. 10. 20094 Tage bei TBZ und 1 Tag bei electrosuisse
11. 5. 2009, Prüfung Blitzschutzseminar von VSEI und electrosuisse16. 11. 2009, Prüfung Blitzschutzseminar von VSEI und electrosuisse
• Neues und Trends in der TelematikInstallationstechnik, IP-Telefonie, Unifi ed Communications (UC), Sicherheit, Satellitennavigation GPS und weitere Themen. Kursdauer 1 Tag.
Olten 21. , 22. oder 23. 4. 2009 Winterthur 28. , 29.oder 30. 4. 2009Anmeldeschluss: 20. 3. 2009
• PhotovoltaikDie direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie ist eine faszinierende Technologie Ort: Schweizerische technische Fachschule STFW in WinterthurKursdauer 1 Tag, 26. 3. / 21. 4. / 6. 5. / 7. 5. 2009
Weitere Infos und Anmeldung: wwww.vsei.ch, Tel. 044 444 17 25

68 | Elektrotechnik 2/09
St
elle
nanz
eige
r
Der innovative und moderne Zoo Zürich ist ein viel besuchter, attraktiver Erlebnis- und Erholungsraum. Er leistet einen wichtigen Beitrag für die Tierwelt, zur Forschung und zum Schutz von Arten und Lebensräumen. Für die Verstärkung unserer Werkstatt suchen wir per 1. Juli 2009 oder früher:
Leiter InstandhaltungIhre Aufgaben: Sie sind zusammen mit einem kleinen, erfahrenen Team verantwortlich für die Wert- und Instandhaltung sämtlicher technischer Anlagen im Zoo. Als Leiter Instandhaltung sind Sie schwergewichtig für die Arbeitsvorbereitung, die interne und externe Ressourcenplanung sowie die kontinuierliche Professionalisierung der Dienstleistungen unserer Werkstatt/Schreinerei zuständig. Sie unterstützen nach Bedarf die Werkstattmitarbeiter an der Front, insbesondere unseren Betriebs-elektriker und sind fähig das Gebäudeleitsystems (Heizung, Lüftung, Klima und Elektroanlagen) selbständig zu bedienen. Zum Aufgabenbereich gehört auch das Leisten von Wochenend- und 24h-Pikettdienst.
Was Sie mitbringen: Sie sind eine zuverlässige, innovative und teamfähige Persönlichkeit im Alter von 30 bis 40 Jahren. Auch in hektischen Situationen behalten Sie den Überblick, setzen Priori-täten und entscheiden. Als zukünftiges Kadermitglied bringen Sie Führungserfahrung, Organisations- und Kommunikationskompetenz mit. Eine Grundausbildung als Elektroinstallateur mit Weiterbildung zum Elektro - Projektleiter, handwerkliche Fähigkeiten sowie das Anwenden von Standardsoftware vervollständigen Ihr Dossier. Falls Sie eine Zusatzausbildung als Instandhaltungsleiter absolviert haben, verfügen Sie über das ideale Anforderungsprofi l.
Wir bieten Ihnen: Ein abwechslungsreiches, spannendes Engagement in einem kompetenten Umfeld. Einen fruchtbaren Boden, den Sie mit Eigeninitiative und Einfallsreichtum beackern können. Ein entsprechendes Salär und gut ausgebaute Sozialleistungen runden dieses attraktive Angebot optimal ab.
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto an die Zoo Zürich AG, Personalabteilung, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich.
2_Zoo_ZH_Zooh_bearb.indd 1 28.1.2009 8:16:25 Uhr
Lehrkräfte für technischen Fachunterricht (Berufsfachschule / BMS)
Das Bildungszentrum für Technik Frauenfeld ist
eine innovative Berufsfach- und Berufsmaturitätsschule
mit vorwiegend technischen Berufen.
Im Hinblick auf den Schulstart im August 2009 suchen wir
Es sind sowohl Teil- als auch Vollpensen möglich.
Bereiche:
- Elektronik / Elektrotechnik / Telekommunikation
- Informatik
- Maschinenbau
- Anlagen- und Apparatebau / Metallbau
- Haustechnik (Sanitär, Heizung, Spengler)
- Mathematik BMS
Anforderungen:
- abgeschlossenes Fachstudium oder höhere Fach-
ausbildung in einem der aufgeführten Bereiche
- vorzugsweise bereits Erfahrung im Unterrichten
- bei angestrebtem Vollpensum:
abgeschlossene pädagogische Berufsschullehrer-
Ausbildung oder die Bereitschaft, eine Ausbildung
an der EHB (Eidg. Hochschule für Berufspädagogik)
zu absolvieren
Anstellungsbedingungen nach kantonaler Verordnung
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Robert Schmid, Rektor
T 052 724 12 12 oder [email protected]
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis am
10. April 2009 an:
Bildungszentrum für Technik
Rektorat, Kurzenerchingerstr. 8, 8500 Frauenfeld
2_KtThurg_Lehrkraefte_bearb.indd1 1 22.1.2009 15:41:45 Uhr
Wago-Ausbildungskurse• KNX-Ausbildungsseminar• CoDeSys V2.3-GrundkursWeitere Infos, Daten und Anmeldung: www.wago.ch, Tel. 026 676 75 00
WAM – Wissensplattform am MorgenFachwissen für Gebäudetechnik-Fachplaner zum Thema: Reduktiondes Energieverbrauchs und Steigerung des Raumkomforts.Dauer 21/2 Stunden, Durchführung in sechs verschiedenen Regionen:– St. Gallen, Dienstag, 3. 3. 2009 Luzern, Mittwoch, 4. 3. 2009– Lugano, Donnerstag, 5. 3. 2009 Zürich, Freitag, 27. 3. 2009– Lausanne, Mittwoch, 25. 3. 2009 Bern, Donnerstag, 26. 3. 2009 Jeweils von 7.15 bis 09.30 Uhr, mit Frühstück.Weitere Infos und Anmeldung: www.wissen-am-morgen.ch
STFW Winterthur• Elektro-Projektleiter – berufsbegleitend – Start: 30. 1. 2009• Elektro-Sicherheitsberater – berufsbegleitend – Start: 30. 1. 2009• Prüfungsvorbereitung für Anschlussbewilligung (gemäss Art. 15
NIV Elektro-Anschlussbewilligung), 4 Tage – Start: 4. 2. 2009• Messkurs Schutzmassnahmen – 1 Tag – 25. Februar, 11. März,
25. März, 8. April, 6. Mai, 24. Juni, 2. Juli 2009• TV-Kabelnetzanlagen – 1 Tag – 4. März, 1. Juli 2009• Telekommunikation für kleine Firmen/Privatkunden – 1 Tag –
11. März 2009• Telematik-Spezialist VSEI/SFT – 3 x 1 Woche – Start: 23.3.2009• Europäischer Wirtschaftsführerschein – 4 x 6 Lektionen – Start: 7. Mai 2009Weitere Infos, Daten und Anmeldung: www.stfw.ch, Tel. 052 260 28 00
Berner Fachhochschule, Technik und InformatikSeminar: TelekommunikationKursort: BurgdorfDauer: 3 TageSeminar 2009/1 3. / 11. / 12. 3. 2009 2009/3 1. / 10. / 11. 9. 2009 2009/4 30. 11. / 1. und 2. 12. 2009Weitere Infos: www.ti.bfh.ch

Elektrotechnik 2/09 | 69
Stel
lena
nzei
ger
Für den Aussendienst geboren…
…als Elektromonteur ausgebildet…Ihr Interesse ist verständlich. Ein als sehr innovativ bekanntes Schweizer Elektro-Handelsunternehmen mit Sitz in der Region Zürich hat sich auf dem Gebiet Baustromverteiler und Elektrotechnische Apparate einen ausgezeichneten Ruf geschaffen. Im Zuge derExpansion möchte man Sie als
Verkaufsrepräsentant (im Aussendienst)
engagieren und Ihnen die Betreuung und Beratung der Stammkundschaft (Elektroinstallateure, Elektroplaner und Architekten) in der Region Ostschweiz, Zentralschweiz oder Mittelland überlassen. Sie informieren über Produkte und Dienstleistungen, erarbeiten und präsentieren Lösungen, führen Produkte Schulungen durch und arbeiten gezielt mit dem Grosshandel zusammen. Ausserdemist Ihre Initiative bei Messen, Ausstellungen und Fachtagungen sowie im Zusammenhang mit Marketing Angelegenheiten gefragt.
Wenn Sie über einen Abschluss als Elektromonteur verfügen, bereits einen klaren Bezug zum Frontverkauf haben, dann erwarten Sie eine abwechslungsreiche Aussendienstaufgabe mit echten Laufbahnchancen sowie attraktive Anstellungsbedingungen (gutes Fixum, Leistungsbonus, Firmenwagen usw.)
Fühlen Sie sich angesprochen? Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns Ihre Kurzofferte. In einem Gespräch unter vier Augen orientiert Sie J.-P. Meili gerne über Details. Tel. dir. 043 499 24 23. E-Mail: [email protected]
SCHRÄMLI + PARTNER AG � TELEFON 043 499 24 24 � e-mail: [email protected]
ÜBERLANDSTRASSE 101 � CH-8600 DÜBENDORF � TELEFAX 043 499 24 25 � http://www.schraemli.ch
!
2_Schraemli_VerkRep_bearb.indd 1 4.2.2009 8:51:37 Uhr
Im Auftrag des Bundes führt Electrosuisse in Fehraltorf (ZH) als besondere Dienststelle dasEidgenössische Starkstrominspektorat ESTI. Wir suchen
Elektrotechniker TS und Eidg. dipl. Elektroinstallateure
Aufgaben– Marktüberwachung elektrischer Erzeugnisse in Bezug auf deren Konformität– Beurteilung von Niederspannungserzeugnissen und Erteilung von Bewilligungen– Sicherheitstechnische Beurteilungen und Beratung in der Unfallverhütung– Technische Abklärungen und Expertisen im Zusammenhang mit Unfällen undBrandereignissen
– Kundenberatung und Referate im Rahmen des Fachgebietes
Ausbildung/ErfahrungSie blicken möglicherweise auf einige Jahre Berufserfahrung im Niederspannungsapparate-und Gerätebau zurück. Ferner haben Sie Interesse und Freude an der Beratungs- undVerhandlungstätigkeit mit Kunden sowie an administrativer Tätigkeit. Französischkenntnissein Wort und Schrift sowie allenfalls weitere Fremdsprachen sind erwünscht.
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde selbstständige Tätigkeit in einem eingespieltenTeam, eine umfassende Einarbeitung in das künftige Aufgabengebiet sowie entsprechendeWeiterbildungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen zum ESTI finden Sie unter www.esti.admin.ch.
Stellenantritt: nach Vereinbarung.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigeBewerbung an:Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTIFrau Ursula BachmannLuppmenstrasse 18320 Fehraltorf
Auskunft: Herr Paul Schoch,Leiter Marktüberwachung/BewilligungSicherheitszeichen, Tel. dir. 044 956 12 13.
Weitere interessante Stellenangebote derBundesverwaltung finden Sie unterwww.stelle.admin.ch
Eidgenössisches Starkstrom-inspektorat ESTI
2_BundesVerw_ElTech_bearb.indd 1 21.1.2009 11:37:05 Uhr

70 | Elektrotechnik 2/09
St
elle
nanz
eige
r
Unsere Mandantin ist ein renommiertes und bestens etabliertes Elektro-Ingenieurunternehmen mit Sitz am rechten Zürichseeufer. DasEngagement deckt das ganze Spektrum der Elektrotechnik am Bau ab,vom Energie- und kostenoptimierten Konzept über die Planung bis hinzur ökologischen Betriebsführung. Zur Verstärkung des Kaders suchenwir einen kompetenten
GesamprojektleiterElektroplanung
Ihre Aufgabe umfasst die Gesamtverantwortung für dieKonzeption, Planung und Abwicklung anspruchsvoller Projekte.Die Führung der Mitarbeiter des Projektteams sowie die kun-denorientierte Lösungsfindung sind weitere Schwerpunktedieser anspruchsvollen Kaderstelle.
Was Sie mitbringen sind• Fach- und Sozialkompetenz mit entsprechender beruflicher
Weiterbildung (höhere Fachprüfung oder höhere Fachschule)• Selbstständigkeit und Belastbarkeit
Erwarten dürfen Sie• eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe in einem
erfolgreichen Unternehmen• attraktive Anstellungsbedingungen, ein gutes Arbeitsklima
und Entwicklungsmöglichkeiten
Nutzen Sie die Chance! Herr Michel Grosjean, Tel. 044 73990 81, [email protected], freut sich auf Ihren Anrufoder Ihre Bewerbungsunterlagen.
GROPAG PERSONALMANAGEMENT AG www.gropag.chZürcherstr. 116, 8903 Birmensdorf, Tel. 044 737 00 00, Fax. 044 739 90 90
wei
tere
Job
sau
fw
ww
.gro
pag
.ch
2_Gropag_ProjektLeiter_bearb.ind1 1 22.12.2008 17:16:17 Uhr
Chance für einen ambitionierten Elektrofachmann
Wir sind eine selbständige öffentlich rechtlich organisierte Unternehmung und versorgen die Gemeinde mit Strom, Wasser und Kabelfernsehen. In-folge bevorstehender Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers suchen wir für die Führung und Neuausrichtung des Bereiches Betrieb und Unter-halt in der Elektrizitätsversorgung einen:
Projektleiter/ChefmonteurIhre Aufgaben:Sie gestalten, organisieren und legen selber Hand an beim Bau, Betrieb und Unterhalt des Strom- und Antennenverteilnetzes.
Ihr Profi l:Sie haben eine Grundausbildung als Elektromonteur und eine Weiterbildung als Sicherheitsberater / Projektleiter, oder Sie haben einige Jahre praktische Erfahrung im Elektroinstallationsgewerbe. Sie arbeiten gerne in einem klei-nen Team in dem Ihre Vielseitigkeit besonders zum Tragen kommt.
Unser Angebot:Eine abwechslungsreiche Aufgabe mit Aufstiegsmöglichkeiten. Ein moder-ner Arbeitsplatz mit guter Infrastruktur, zeitgemässen Anstellungsbedin-gungen und guten Sozialleistungen. Sie treffen auf fl ache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen. Die Einführung in Ihre neue Aufgabe ist durch unsere langjährigen Mitarbeiter sichergestellt.
Interessiert?Mehr über diese interessante Stelle erfahren Sie vom BetriebsleiterWalter Schönbächler, 044 835 22 44 / [email protected]
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Foto senden Sie an:
Gemeindewerke, Herrn Walter SchönbächlerZürichstrasse 22, 8306 Brüttisellen
2_Bruettisellen_Stelle_bearb.ind1 1 4.2.2009 9:29:32 Uhr
Schweiz. höhere Berufsbildung BMP eduQua 2007 zertifiziert
Aktuelle Kursdaten Frühling-Herbst 2009 � Neu: „New learning mit deduktiven Lernmethoden“
Eidg. Berufsprüfungen: Kurs Sicherheitsberater BS � ab 5. Mai 2009 Kurs Sicherheitsberater BS � ab 6. Oktober 2009
Elektro-Projektleiter BE � ab 6. Mai 2009 Elektro-Projektleiter BE � ab 1. Oktober 2009
Telematik-Bauleiter BL � ab 1. Oktober 2009Einsteigerkurs für Elektromonteur… (Modul 1 – 3)
Telematik-Projektleiter BT � ab 6. Mai 2009Vollkurs für „echte Telematiker EFZ“… (Modul 4 - 6)
Eidg. Höhere Fachprüfungen: Meisterkurs dipl. Elektro-Inst. HE � ab 3. Juli 2009 Meisterkurs dipl. Elektro-Inst. HE � ab 3. Oktober 2009
Meisterkurs dipl. Telematiker HT � ab 5. Mai 2009 Praxisprüfung FK / gemäss NIV (Praxisbezug notwendig)
Oder auf Anfrage, flexibler Einstieg in BS oder HE Klassen
� Lern- und Testinseln mit Wissenstransfer im Team� New learning mit grossem Free-Techno-Park � Volontärtage bei fehlender Praxis (Zusatzmodule)
� Bestes Kosten–Nutzen–Verhältnis � Rechnen Sie ! Tag der offenen Türe (17.00 bis 19.00 Uhr)
02. März 2009 06. April 2009 04. Mai 2009
Faxen an: 055 260 36 28 Joweid Zentrum 4 * 8630 Rüti ZH * 055 260 36 25
[email protected] www.elektro-profi.ch
Eidg. Praxisprüfung PX � ab 5. Mai 09 und 3. Juli 09
2_ElektroProfi_WintFrueh_bearb.i1 1 23.1.2009 16:08:46 Uhr
Mitg
lied
der
Fach
hoch
schu
le O
stsc
hwei
z FH
O
Lernkultur und Lebensqualität am See.
Neu ab Herbst 2009
Teilzeitstudium an der HSRBachelor-Studium
ElektrotechnikInformatik
Infoabend:Di 31. März 2009, 18.15 Uhr
www.hsr.ch
2_E_I90x130_bearb.indd 1 2.2.2009 16:30:57 Uhr

Impr
essu
m u
nd F
irmen
verz
eich
nis
Arbor Networks 43Axima 27Belimo AG 66Bugnard AG 49Ceconet AG 8Diamond SA 51Distrelec 6Electrosuisse 16Elvatec AG 9, 10Fluke 4Griesser AG 66Hager Tehalit AG 9, 10Hirschmann Automation GmbH 8IHS Infrarot-Heizsysteme AG 14Knipex 49Legrand Schweiz AG 6MTI Micro Fuel Cells 53Omni Ray AG 8
Redwell / VPL AG 14, 15Rotronic AG 8, 45Saia-Burgess Controls AG 66se Lightmanagement AG 66ServiceNet AG 9Siemens Schweiz AG 10SMC 52Solis AG 14Swisscom 43, 46TAC AG 29Trigress Elektro AG 6, 11Trigress Security AG 44VSE 16VSEI 37Wago Contact SA 9Woertz AG 66Wüest Infrarotheizung 14Zumtobel Licht AG 31
Im Text erwähnte Firmen
Die Elektrotechnik ist die auflagenstärksteabonnierte Fachzeitschrift auf dem Gebiet derelektrischen Energie- und Installationstechnik.60. Jahrgang 2009.Erscheint 11-mal pro Jahr. ISSN 1015-3926Total verkaufte Auflage: 5142 Ex.Total gratis Auflage: 177 Ex.
ChefredaktionFranz Lenz (fl), Chefredaktor ad interim Elektrotechnik ETAZ Fachverlage AG, Neumattstr. 1, CH-5001 AarauTel. 058 200 56 11, Fax 058 200 56 [email protected].
RedaktionPeter Warthmann (pw), Redaktor, Tel. 058 200 56 [email protected] Kleger (rk), Redaktor, dipl. El.-Ing. FHSchützenweg 9, CH-8505 Pfyn, Tel. 052 765 22 53Fax 052 765 22 51, [email protected]
Redaktionelle MitarbeiterErnst Feldmann (ef), eidg. dipl. El.-Inst., [email protected] Keller (dk), Fachlehrer STFW, [email protected] Nauer (pn), Fachlehrer STFW, [email protected] Rudolf Ris (hr), dipl. El.-Ing. FH, [email protected] Schöb (ms), eidg. dipl. El.-Inst., [email protected] Schwaninger (es), eidg. dipl. El.-Inst., [email protected]üdiger Sellin (rus), dipl. Ing. (FH), [email protected] Staub (rs), El.-Ing. ETH, [email protected]
Verlag© by AZ Fachverlage AG, Neumattstrasse 15001 Aarau, Tel. 058 200 56 50, Fax 058 200 56 61Verlagsleitung: Karen HeidlMarketingleiter: Jürg RykartLesermarketing: Fabienne Thomann
AnzeigenleitungVerkauf: Thomas Stark, Tel. 058 200 56 27,[email protected]: Ursula Aebi, Tel. 058 200 56 12Fax 058 200 56 61, [email protected]
AbonnementBestellungen: Abo Contact Center, Corinne DätwylerTel. 058 200 55 68, [email protected] Fr. 119.–, 2-Jahresabo Fr. 208.– (inkl. 2,4% MwSt.)
Produktion/LayoutPia FleischmannGülsah Yüksel
DruckVogt-Schild Druck AG, Gutenbergstrasse 1,4552 Derendingen, www.vsdruck.ch
VerlagsrechteMit der Annahme von Manuskripten durch die Redaktion und derAutor-Honorierung durch den Verlag erwirbt der Verlag das Copyrightund insbesondere alle Rechte zur Übersetzung und Veröffentlichungder entsprechenden Beiträge in anderen verlagseigenen Zeitschriften so-wie zur Herausgabe von Sonderdrucken. PR-Beiträge unter «Aktuell»werden als Anzeigen behandelt und sind kostenpflichtig. Details sieheMediadaten. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet!www.elektrotechnik.ch
Impressum Elektrotechnik
ET 3 Anzeigenschluss Redaktionsschluss23. März 2009 27. Februar 2009 11. Februar 2009
ET 4 Anzeigenschluss Redaktionsschluss20. April 2009 25. März 2009 9. März 2009
ALTRONA mesatec AG, Zug 64AMAG Automobil- und Motoren AG, Schinznach 10Anson AG Zürich, Zürich 10, 59Apteryx SA, Döttingen 22Arocom AG, Reinach BL 3BKW FMB Energie AG, Bern 5Bugnard SA, Lausanne 58CeCoNet AG, Mägenwil 43Darwin21 38Demelectric AG, Geroldswil 21, 55EEV Schweizerische Elektro-, Bern 14 58Elektro-Material AG, Zürich 3. USElektro-Profi GmbH, Rüti ZH 70Elko-Systeme AG, Samstagern 51Feller AG Marketing-Services, Horgen 33Fischer Otto AG, Zürich 2GMC-Instruments Schweiz AG, Zürich 60HSR Hochschule für Technik, Rapperswil SG 70IBZ-Schulen, Brugg 72Kertész Kabel AG, Rümlang 4. USM. Züblin AG, Wallisellen 7Meimo AG, Geroldswil 51Plica AG, Frauenfeld 25STF Schweizerische Techn. Fachschule Winterthur, 65Suprag AG, Zürich 53Systec Therm AG, St. Gallen 13Theben HTS AG, Effretikon 37WAM Wissen-am-morgen 51WAGO CONTACT SA, Domdidier 2. USWoertz AG, Muttenz 30ZTI, Zug 63Stellenmarkt 68 – 70 Titelseite Legrand (Schweiz ) AG, Birr Beilage Sfb Bildungszentrum, Dietikon
Unsere Inserenten
Elektrotechnik 2/09 | 71

Vo
rsch
au
Fehlerstromschutzhalter: RCD-Technik, Probleme, SpezialitätenSchon in der Lehre müssen Elektroinstallateure die Funktionsweisedes FI-Schalters (RCD) erklären können. Die Praxis zeigt allerdings,dass die Handhabung von RCD keineswegs trivial ist, sobaldspezielle Lasten mit Elektronik im Einsatz sind. Der Beitragbehandelt auch Spezialitäten. (Bild 1)
NPK-Know-how Teil 1Bei der täglichen Anwendung des Normpositionenkatalogs NPKtreten in der Praxis immer wieder Fragen der Auslegung auf. ImRahmen einer losen Serie werden Fragen beantwortet und Angabenkonkretisiert. Dies, um den Umgang mit dem Ausschreibungs- undKalkulationswerk noch leichter zu gestalten und die Diskussionenzwischen Elektroingenieur und Elektrounternehmer zu reduzieren.
Telekom-Konvergenz wird langsam RealitätDie Konvergenz in der Telekommunikation wird ab 2009 Schritt fürSchritt mit Inhalten gefüllt. Für den Endkunden bringt das spürbareVerbesserungen mit sich. Bisher musste er sich mit einem halbenDutzend Endgeräten herumschlagen, künftig werden es vielleichtnur noch zwei bis drei sein. (Bild 2)
Dank Multimedia-Netzwerk in Schritten zum Intelligenten WohnenBeim Bau oder bei einer umfangreichen Erneuerung eines Hauseswird mit einer konsequenten Vernetzung der Grundstein gelegt fürIntelligentes Wohnen und Multimedia im ganzen Haus. Die Ausrüs-tung mit den entsprechenden Geräten kann auch erst Jahre spätererfolgen. Die Komponenten dafür sind längst Massenproduktegeworden. Der Beitrag beschreibt ein Einfamilienhaus, das vor eini-gen Jahren erstellt wurde und erst später mit modernster Technikergänzt wurde. In jedem Raum gibt es mindestens zwei Ethernet-Anschlüsse. (Bild 3 )
Vorschau Elektrotechnik 3-09
... und viele weitere aktuelle Artikel zu Themen rund umdie Elektrotechnik, Gebäudetechnik, Automation und Telematik
1
2
3
72 | Elektrotechnik 2/09
TechnikTechnik
WirtschaftWirtschaft
Informatik
Informatik
Die IBZ Schulen bilden Sie weiter.Höhere BerufsbildungVorbereitungsschulen auf eidg.Berufs- und Höhere FachprüfungenElektro-Installateur/inTelematiker/inElektro-Projektleiter/inElektro-Sicherheitsberater/inPraxisprüfung gemäss NIV2002Instandhaltungsfachmann
Höhere Fachschule (eidg. anerkannt)
Dipl. Techniker/in HFElektrotechnik(Techn. Informatik, Elektronik, Energie)Haustechnik
NachdiplomstudienHF NDS Betriebswirtschaftslehre fürFührungskräfte: (Managementkompetenz)
NDK Projektleiter Gebäudeautomation
Kursbeginn: April/OktoberKursorte: Zürich Bern Basel Brugg Aarau Sargans Sursee Freienbach/SZ Zug
ISO
9001
:200
0•
Edu
Qu
a
IBZ Schulen für Technik Informatik WirtschaftZentralsekretariat Wildischachen, 5201 BruggTelefon 056 460 88 88, Telefax 056 460 88 87
E-Mail [email protected], www.ibz.ch

www.elektro-material.chElektro-Material AG:
Zürich 044 278 12 12 Basel 061 286 13 13 Bern 031 985 85 85 Genf 022 309 13 13 Lausanne 021 637 11 00 Lugano 091 612 20 20 Luzern 041 368 08 88 Sitten 027 324 40 50
Damit Ihre Rechnung auch bei LAN-Projekten aufgeht.
EM_RZdf-Vorlage_1seitig.indd 1 18.7.2006 16:38:44 Uhr

Der leistungsfähigste Schweizer Lieferant für Kabel, Rohre und Elektroteileeröffnet seinen neuen Verkaufstandort Bern/Westschweiz. Und Ihnen damit ganzneue Möglichkeiten: 031 930 80 00 oder 044 818 83 83, www.kerteszkabel.ch VORSICHT HOCHLEISTUNG.
Jetzt starten wir in der Westschweiz durch.
BMB