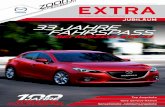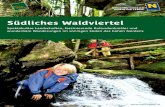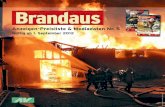2/2012 Brandaus - die Zeitschrift der niederösterreichischen Feuerwehren
Mineralogisches aus dem niederösterreichischen Waldviertel
-
Upload
alexander-koehler -
Category
Documents
-
view
219 -
download
6
Transcript of Mineralogisches aus dem niederösterreichischen Waldviertel

Tschermaks Mineralogische u. Petrographische Mitteilungen. Bd. 36, H. 3, 4, 1924.
Xli. Mineralogisches aus dem niedertister- reichischen. Waldviertel,
Voa Alexander K6hler.
Im verflossenen Sommer konnte ich im s[idiichen Waldviertel im Gebiete der Donau e~wa yon Melk stromaufwiirts his Sarmingstein bei meinen feldgeologischen Arbeitea einige Mineralstufen sammeln, die ich als Erg~inzung zu A. S igmund : ,,Die Minerale NiederSster- roichs" bier anf[ihren mSchte. Das Vorkommen yon Wollastonit ist ffir NiederSsterreich neu, ebenso ist das Vorkommen yon Mondstein im Granuli~ noch nicht beschriebeu women.
Am geologischen Aufbau des besagten Gebie~es beteiligt sich im ~uBersten Stiden ein noch nicht n~iher bekanntes, muldenf6rmig gelagerLes Granulitmassiv, dessen Hauptverbreitung siidlick der Donau gelegen ist und grS0tenteils yon jiingeren Bildungen bedeckt wird. In seinem Liegenden, im Norden der Donau, trifft man eine Reihe yon Ortho- und Paragesteinen an; zu ersteren gehSren augenscheinlich die zahlreichen AmphiboHte, zu letzteren die mannigfachen Schiefer- gneise, Sillimanitgneise, Marmor- und Graphitlins~n. An diese eLwa 1 km bre[te Zone schlielJen sich im Wesentlichen Cordieri~gneise an, die bis zum nahen siidbShmischen Granitbatholithen anhalten.
Mondstein. Bei Klein-PSchlarn ,~n der Donau ist der Granulit reich an
Biotit, arm an Granat und Disthen und gewinnt durch seine gute Schieferung das Aussehea eines Granitgnelses, iihnlich dem bek~nntea GfShlergneis im Osten. Auf dem Ful]wege yon Klein-PSchlarn nach Unter-Bierbaum land ich in einem grol]en Block dieses Ges~eins zahl- reiche gro~]e K6rner eines farblosen oder schwach gelblich g~fiirbten Mondsteins, Die einzelnen kantendurchscheinenden lndividuen kgnnen eiae GrSt]e yon 5--6 cm erreichen; kristallographische Umrisse feh- lea, nur die M i s t meis~ angedeu~et. Neben der vorz[iglichen Spalt-

158 Alexander K0hler.
barkeit naeh P und Mund einer weniger guten naeh 110 tritt noeh eine weitere Spaltfl~iche auf, die in der Medianzone liegt und mit der P einen Winkel yon zirka 720 einsehliel]t; es handelt sich also um die Murchisonitspaltung. Im Orthoskop zeigt sieh an Spaltbl~ttchea die gerade AuslSschusg auf P und eine AuslSsehung yon 90 auf M. Auf dieser Fl'~che sieht man auSerdem zahlreiehe Perthitspindeln. Die Spaltfliiehe naeh P und mehr noch die MurchisonRspaltfl~che zeigt sehr deutlieh das Phiinomeu des Glaukisierens uud diese Eigen- schaft sowie die beobachtete hohe Ausl6sehungssehiefe auf M weisen auf eine betriichtliehe Beimisehung des Albitmolekiils hin und reeht- fertigen die Bezeichnung Mondstein. Das spezifische Gewicht wurde mit 2"58 bestimmt.
Es w~ire interessant, fiber die Entstehung dieser Gebilde etwas sagen zu kSnnen; bei dem geringf[igigen Vorkommen sind allerdings nut Vermutungen m~glich. Bei einem so ~lkalireichen und kalk- armen Magma, wie es das granulitische ist, wird nicht das ganze Na~O an CaO im Plag~oklas gebunden, ein Tell tritt isomorph in den Kalifeldspat ein. Das liefert dash beim spRteren Zerfall jene aus deu Granuliteu bekannten ,,faserigen" Orthoklase, die in der zweiten H~ilfte des vorigen Jahrhu~aderts zu m~nnigfachen Deutungen AnlaB gegeben haben, und yon denen zuerst F. B e cke 1) naehgewiesen hat, da] es sich um ,,Mikroperthite" handelt. Wir wissen heute, dab diese Perthitlamellen, submikroskopiseh fein, das Glaukisieren ver- ursachenS). Zu solchen Mischuugen kann es in einem granulitisehen Magma leicht kommen. Man .d~irfte daher unter den Gemengteilen des Granulits wRren sie aur entspreehend gro], glaukisierende Feld- spate ~fter antreffen,
Im Gegensatz zu den alpineu Adular-Vorkommen, wo wir es mit hydrothermalen Kluftbildungen zu tun haben, handelt es sich in unserem FaUe um Bildungen aus liquid-magmatiseher Phase. Von einer Kluft ist hier keine Spur, wir haben es mit grobeu Gemeng- teilen im Gestein selbst zu tun, um die sich die iibrigen Gemengteile lidartig herumlegen. Es ist nun eine Beobachtung wiehtig und kanu zur ErklRrung herangezogen werden; alle Mondsteinind[viduen liegen
i) F. Becke: Die Gneisformation des nieder~sterreichischen Waldviertels. Tschermaks min.-petr. Mitt., IV. Bd., p. 189.
2) S. Kozu u. Y. Eudo: X-ray analysis of Adularia and 3Ioonstone and the influence of temperature on the atomic arrangement of these minerals. Science reports of the Tohoku Imperial University, series Ill, Vol. I, Sendal, Japan.

Mineralogisches aus dem niederSsterreichischen Waldviertel. 169
n~imlich in einer Ebene, die der Sehieferungsebene entspriehL. Aul~erhalb derselben finden sie sich im Gestein nicht. Es ist also augenscheinlich noch w~ihrend der Pr~gung des Gesteins zum kristallinen Schiefer Kalinatronsubstanz entlang dieser SchieferuDgsebene eingedrungen und hat zur Bildung der Mondsteine Anlal] gegeben.
Wir haben bier ein Analogon zum Ceyloner Vorkommen. Auch hier ist der Mondstein an pegmatitische Gesteine gebunden in der Nachbar- schaft des Granulits und mit diesem in genetisehem Zusammenhang~).
Die Marmorz~ige im Liegenden des Granulits werden oft yon m~ichtigen lamprophyrischen GSngen durehbrochen, und das hat Anlal] gegeben zur Bildung yon Kontaktmineralen. Es folge nun die Be- sprechung derselben.
Wollastonit. Dieses Mineral ist bis jetzt aus dem niederGsLerreichisehen Wald-
viertel nich~ bekannt geworden. Es wurde weiter im Osten niemals beobaehtet. In der Loya, einem kleinen Tal 5stlich yon Persenbeug, ist in einem grol]en Steinbruch ein Marmorzug angeschnR~en, in dem man schSne Stufen dieses Minerals auffinden kana. Es bildet 1 cm lange weil]e, seidengl~inzende Faseraggregate, oft radial ange- ordnet~ in einem kleinkGrnigen Gemenge yon Caleit, Augit und Granat in der Hauptsache. Zahlreich sind ferner 1 m m groi]e Graphitbliittehen. SpaltblEttehen lassen im Konoskop leicht die Lage der A. E. quer zar L~ngsersLreckung erkennen; dadurch ist die Unterscheidung yon dem gleich aussehendeu Tremolit und PektolRh gegebea. Im Diinn- schliff zeigen sich die zahlreichen vollkommenen Spaltrisse, die alie der Querachse parallel laufen. Jeder solehe Schnitt 1.~l]t im Konoskop die Lage der A. E. quer dazu erkennen. Der Charakter der Zone ist abwechselnd positiv vnd negativ. Lieht- und Doppelbrechung ist geringer wie die der Augite, er tritt im Relief nichL so deutlich heraus. Der Aehsenwinkel is~ ziemlich klein, die Dispersion p >'J auch im Sehliff zu erkennen.
6rossular ist in diesen Wollastonits~ufen al~ Begleiter oft anzutreffen. Kris~all- begrenzung fehlt ibm, er bildet runde K6rner his 1 c m GrSl]e. Farbe ist dunkelhoniggelb. Im Schliff ist er oft doppelbrechend.
~) E. Weinschenk: Zur Kenntnis der Graphitlagerst/itten 4. Die Graphit. lagerst~tten der Insel Ceylon. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1900, p. 174.

160 Alexander K6hler.
Zoisit (Thulit) wurde in einem neu angeleg~en Steinbruch bei der Fliiusergruppe Reith, etwa 1 k m nSrdlich yon Persenbeug, angetroffen. Derselbe Mar- morzug wie in der oben erw~ihnten Loya ist bier anstehend und durch einen m~ichtigea Porphyritgang kontaktmetamorph ver~ndert worden. Unter den so entstandenen Kalksilikaten tritt der Zoisit dutch seine RosM~irbung hervor. Deutliche Kristalle findea sich nicht; wohl finder mart ab und za ia Calcit eingewachsen prismatisch be- grenzte S~ulchen, meist jedoeh bildet er nur ein fiir das unbewaff- nete Auge dic/htes kristallinisches Aggregat. Die H~irte liegt zwisehen 7 und 8. Spaltbarkeit l~il]t sich nicht gut wahrnetlmen, .4_bsoaderung (luer zur Liingserstreckung ist deutlich. Im Di!nnschliff ist er darch folgende Eigenschaf'ten charakterisiert: Optisch zweiaehsig positiv, p>,x Die A. E. ]iegt bald parallel 001, bald parallel der 010. Je naeh der Lage wechselt in bestimmten Schaittert die Interferenzfarbe. Sie is~ normal grau, wenn A. E. ii 001, anomal indigoblau, w e n n A. E. ! 010. Es liegt also Zoisit ~. und ~ vor (Termier). Ein und dasselbe ladivi- duum kann aus ~ und ~ Zoisit bestehen. Die Verteitung der Farben ist dann unregelmiil3ig oder es wechseln Lamellen nach 010 ab. Pleochroismus ist nur an dickeren Sttulchen zu bemerken. Senk- reeht zur Lttngserstreckung ist dann eine deutliche Rosaft~rbung zu e r k e n n e n .
Salit. Er ist im Gestein leicht makroskopisch zu erkennen an seiner vor-
z~igliehen Gleitfl~che ii 001 nebst seiner guten prismatischen Spaltbar- keit. Farbe well] oder grauweil]. Die einzelnen Individuen erreichen eine GrSl3e yon mehreren Zentimetern. Eia weiteres Vorkommen stammt aus dem Thiemlingtal, 1 km 5stlich des Loyatales. Etwa 100m n6rd- lich tier Bahn am rechten Thalhang ist derselbe Marmorzug ein wenig anstehend und birgt bier grol3e Salite. Dieses Mineral ist aus dem Osten des Waldviertels vielfach bekannt geworden; die Fundstellen sind in A. S i g m u n d ,Die Minerale NiederSsterreichs" angegeben. Ein weiterer Gemengteil des Kalksilikatfelses yon Reith ist der
Pargasit. Makroskopiseh ist dieses Mineral dureh seine Spaltbarkeit naeh
dem Prisma yon 120 0 sogleich zur Hornblende zu stellen. Farbe ist graugrtin. Die GrSl]e der Individuen kann mehrere Zentimeter be-

Mineralogisches aus dem nieder6sterreichischen Waldviertel. 15'1
tragen. Kristallographische Ausbildung fehlt. Im Schliff zeigt sich der optisch positive Charakter, was die Bestimmung als Pargasit recht- fertigt. Das Mineral flirt entweder mit den/ibrigen Gemengteilen zu- gleich auf oder bildet bis faustgrol]e Aggregate fftr sich, die im Kalk- silikatfels lage,artig verteilt sind. Derzeit ist die pargasitfiihrende Stelle abgebaut.
Phlogopit is~ in den besprochenen Kalksilikatfelsen ein h~ufiger Gemengteil. Die silberweil]en bis bronzebraunen, mehrere Millimeter grol]en Schup- pen bilden gerne eine Schale um die Pargasitaggregate. Die am st~rksten gei~irbten Schuppen zeigen im Mikroskop deutlichen Pleo- chroismus mit den Farben hellbraun naeh 7, farblos nach a. im Sehnitt ]1 der A. E. Das Achsenlrreuz 6finer sich nicht. Erw~hnt soll hier noch das Vorkommen i n der Loya werden, wo e r schSne sechseckige bronzebraune BIRttchen im Marmor bildet.
Graphit isL in allen Kalksilikatfelsen und Marmoren sehr verbreitet. Sie bilden an vielen S[ellen m~ichtige Linsen, die seit langer Zeit abgebaut werden. Ein geringes neues ¥orkommen m~ge bier noch welter aus dem Westen nahe dem Granit angefiihrt werden. Bei H i r s c h e n a u (Bahntrasse) shld in einer etwa 1 m m~chtigen zersetzten Sehiefergneis- pattie kleine Linsen des Minerals anzutreffen. Hier, wie iiberall, woes an Paragesteine gebunden ist, kann die Herleitung yon organischer Substanz wohl nicht bezweifelt werden. Etwas heikler wird die Frage nach der Entstehung bei dem Vorkommen im Granuli~. A. S i g m u n d 1) hat zuerst das Vorkommen kSrperlicher Graphitdendriten im Oranulit bei P5chlarn beschrieben. Auch hier kann es sich nJcht um pneu- matolytische Bildungen nach W e i n s c h e n k analog dem Ceyloner Vorkommen handeln, denn die einzelnen Graphitpartikeln stehen nicht miteinander in Verbindung. Der Graphit bfldet, also einen gleichberechtigten Gemengteil des Gesteins. In letzter Zeit hal H. L i m b r o c k :') auf die grol]e Verbreitung des Graphits in dem besagten Granulitmassiv hingewiesen, lch selbst konnte ihn gleichfalls an vet-
z) A. Sigmund: Graphit im Granulit bei P6chlarn, Tscherm. min.-petr. Mitt. Bd. 23, p. 406.
'~) H. Limbrock: Der Granulit yon Marbach-Granz a. d. Donau. Jahrb. d. Geol. Bundesanstalt, Wien. 74. Bd. 1923, p. 139.
Mineralogisch-petrographische Mitteilungen. °,,6. 192t. 11

1~2 Alexander K6hler.
schiedenen Stellen als akzessorisehen Gemeng~eil aatreffen. Nun hal gerade H. L imbrock nachzuweisen versueht, dab der Granulit ,,hy- brid" sei. Diese Auffassung geht sicher zu weir, aber ich bin tiber- zeug~, da~ dies zumindest ftir manehe randliche Teile des Granulits gewil] ist. Von diesem Standpunkte aus erscheinL nun das ganze Vorkommen nicht mehr so sonderbar. Wohl war der Graphit vor der geologisehen Gestattung des Granulitmagmas in demselben ent- halten, aber sehon als Fremdling, yon den bitumenreiehen Schiefern herstammend. Ieh glaube, man wird nicht fehlgehen, wenn man jede Pattie innerhalb der Granulitmasse als hybrid ansieht, wo Graphit- gehalt naehgewiesen werden kann. In der Tat zeig~ er such an diesen Stellen, soweit es mir bisher bekannt ist, ein abweiehendes Verhalten im Mineralbestand. Es is~ selbs~verst~indlich, dal] noch viele pe~ro- graphische und chemische Untersuchungen notwendig sein werden, um die angeschnit~ene Frage genau beantworten zu k~nnen.
Sillimanit ist als Gemengteil des Grsnulits reeht verbreiLet und verr~t sich oft sehon an dem Seidenglanz auf den Schieferungsfl~iehen. In einem aufgelassenen Steinbruch bei Kemmelbach bildet er sporadiseh meh- rere Zentimeter lange, sehmale Nadeln mit deuflicher Absonderung nach 001. Die schSnsten Stufen fand ich im Steinbrueh in der Loya, wo er einen Hauptbestand~eil des Sillimanitgneises bildet und auf Klfiften oft in mehrere Zentimeter dicken Lagen zu finden is~. Die Einzelindividuen werden his 1 dm lang und i crn breit, zeigen Glas- glanz his Seidenglanz und deutliche kbsonderung nach der Basis. Im Schliff zeigen die Querschnitte die vorziigliche Spaltung nach der 100 und den kleinen positiven Achsenwinkel. Die Prismen schlie[~en einen Winkel yon zirka 880 ein, daher (230).
Almandin is~ in dem eben erw~hnten SillimaniLgneis sehr zahh'eich vertreten. Die bis zu 1 cm groi] werdenden Individuen haben keine erkenn- bare kristallographisehe Begrenzuug. Ebenfalls zum Almandin werden die Grana~e zu stellen sein, die in den Cordieritgneisen gegen den Granit zu in sehr variablen MengenverhRltnissen aufzufinden sind. Farbe ist blal]rot auch im Sehliff noeh bJal]rosa und stets isotrop.

Mineralogisches aus dem nieder@sterreichischen Waldviertel. 16'3
Pyrop w~re yon einem neuen Pyropserpentinvorkommen bei Klein-PSchlarn zu erwiihnen. Er bilde~ in diesem frischen~ sch6nen Gestein bis 1 ~n grol3e K~rner yon rotbrauner Farbe mit schSnen Kelyphitrinden.
Cordierit, der bisher nur yon sp~rlichen P u n ~ e n des Watdviertels bekannt war, konn~e in grol~er Verbreitung nachgewiesen werden. Es ist ein wesen~licher Gemengteil in den Cordieritgneisen, die eine breite Zone um den Granitba~holithen bilden. Man un~erscheidet ihn im Hand- sttick yon Quarz dureh seine Spal~barkeit und den charakteris~ischen fet~artigen Glasglanz. Seine Gr66e und Verbreitung in diesen Ge- steinen ist sehr variabel, desgleiehen schwankt die F~irbung je nach dem Grade der Zersetzung. Frische, unzersetzte KSrner sind viol- blau wie die Iglauer Vorkommen, meis~ abet sind sie griinlichgelb. Im Diinnsehliff zeigen die K6rner deut]iche kurze, aber nicht gerad- linige ~paltrisse nach (010). Ein Schnitt _L c-Achse = I. Mi~tellinie a zeig~ aul3er diesen 8paltrissen noch geradlinige Risse normal 001, die mit der Trace yon 010 einen ~C[ yon 33--34 o einschlieBen. Yon diesen aus dringen kleine 8erieitschiippchen in den Cordierit ein, was bis zur vSlligen Pinitbildung ffihren kann. Eine weitere Umwandlungs- erscheinung besteh~ in der Bildung einer isotropen, farblos oder gelb- lieh gef'~rbten, schw~cher lichtbrechenden Masse, die sich randlich oder an krummen Linien im Kristall anordnet. An anderen Pseudomor- phosen beteiligt sich ein chloritisches Mineral.
W i e n , November 1923.
Mineralog.-petrograph. Institut der Universit~it.
11"