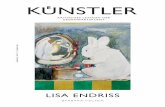Zehn mal BDA-Preis Bremen – Über die Nachhaltigkeit eines ... · Für Charles Jencks war diese...
Transcript of Zehn mal BDA-Preis Bremen – Über die Nachhaltigkeit eines ... · Für Charles Jencks war diese...
1
Zehn mal BDA-Preis Bremen – Über die Nachhaltigkeit eines Qualitätssiegels (Vortrag von Eberhard Syring zur Finissage der Ausstellung BDA-Preis 2010 am 3.2.2011 in der
Unteren Rathaushalle, Bremen)
Sehr geehrte Damen und Herren.
Wolfgang Hübschen hat mich gefragt, ob ich aus Anlass des zehnten Bremer
BDA-Preises ein paar Gedanken vortragen könne über die baukulturelle
Bedeutung dieses Preises. Diesen Wunsch erfülle ich gern – nicht zuletzt weil
die Erscheinungsformen und Wandlungen in der jüngeren lokalen
Baugeschichte ohnehin einen Schwerpunkt meines wissenschaftlichen
Interesses als Architekturhistoriker darstellen. Bereits vor vier Jahren durfte ich
anlässlich des neunten Bremer BDA-Preises ein Resümee über die Geschichte
des Preises vortragen. Auch damals war Wolfgang Hübschen schon
Landesvorsitzender.
Einige Beobachtungen von damals ließen sich glatt reaktivieren. Der
geschichtliche Fortschritt innerhalb von vier Jahren reichte zum Glück nicht aus,
um mein Urteil gänzlich zu revidieren. Man könnte also bestimmte
Beobachtungen über zurückliegende bauhistorische Resultate auch gut
wiederholen, um deren konstante Relevanz zu unterstreichen. Ich will das hier
auch im zweiten Teil meiner Ausführungen so handhaben. Zunächst werde ich
aber einen anderen Gesichtspunkt in den Mittelpunkt stellen.
Dass der BDA-Preis eines der wichtigsten baukulturellen Ereignisse im
Zweistädtestaat ist, darüber besteht überhaupt kein Zweifel. Auch nicht
darüber, dass seine Einführung 1974 zu einem Zeitpunkt, der wesentlich vom
so genannten „Bauwirtschaftsfunktionalismus“, von Großwohnanlagen,
Flächensanierungen und einer Industrialisierung des Bauens bestimmt war, ein
wichtiger Impuls war, um Architektur als kulturellen Faktor wieder ins
öffentliche Bewusstsein zu rücken.
In einem Betrag zu dem Buch „Geschichte der Freien Hansestadt Bremen 1945
bis 2005“ haben Detlef Kniemeyer und ich diese baugeschichtliche Situation
wie folgt beschrieben: „Ein Kritikpunkt an den Großprojekten der frühen
1970er Jahre – seien es Wohnanlagen, Handelszentren, Hochschulbauten oder
Schulzentren – war ihre architektonische Anonymität. Das schöpferische
Subjekt des Architekten schien hinter den stark von systemischen
Anforderungen bestimmten Projekten kaum mehr erkennbar zu sein. Und
wenn das, wie bei den Bauten der Bremer Universität, doch der Fall sein sollte,
so erschien die Nennung des Autors eher wie eine Fußnote. Die Opferung
ästhetischen Eigensinns unter den strikten Vorgaben von Bauämtern, Instituten
2
und Wohnungsbaugesellschaften war offensichtlich. Die
Entarchitekturalisierung des Bauens geschah nicht selten unter einem
Wissenschaftlichkeitsanspruch, wie ihn beispielsweise das Städtebauinstitut
Nürnberg (SIN) oder das Berliner Schulbauinstitut der Länder repräsentierten,
die vorübergehend einen großen Einfluss auf das Bremer Baugeschehen
hatten. Zur Ausweitung ihres Tätigkeitsfeldes in Erwartung einer sinkenden
Wohnungsproduktion hatte sich eine große Wohnungsbaugesellschaft wie die
Neue Heimat zudem eine Städtebau-Filiale geleistet, um bei kommunalen
Bauaufgaben ein weiteres Standbein zu haben.
Gegen diese Entwicklungen legte vor allem die wohl prominenteste
Standesorganisation der Architekten, der Bund Deutscher Architekten (BDA),
mit seiner Bremer Sektion häufig Protest ein. Die Forderung nach mehr
Architektur- und städtebaulichen Wettbewerben seitens dieser Institution war
obligatorisch. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Baukultur stellte der
1974 ins Leben gerufene Bremer BDA-Preis dar, der seitdem, im vierjährigen
Turnus ausgeschrieben, eine Art architektonisches Qualitätssiegel produziert
und einen wichtigen Beitrag für das öffentliche Bewusstsein in
Architekturfragen liefert.“
Die generelle Bedeutung des Preises ist somit sicherlich zutreffend
beschrieben. Der Kern meiner heutigen Überlegungen soll aber in einer
anderen Frage liegen, nämlich: Wie nachhaltig ist eigentlich ein solches
„architektonisches Qualitätssiegel“ BDA-Preis? Ausgangspunkt meiner
Gedanken ist eine Passage aus Wolfgang Hübschens Vorwort im Katalog zum
aktuellen BDA-Preis:
„In der Rückschau halten einige wenige damals prämierte Projekte den
heutigen Kriterien nicht mehr stand, in seltenen Fällen sind sie Neubauten oder
Überformungen zum Opfer gefallen (Stadthalle, Kunsthalle…), aber immer
waren die preisgekrönten Arbeiten herausragende Beispiele ihrer Zeit, und die
besonders gelungenen sind es noch heute.“
Dieser Satz deutet an, dass sich immer wieder bestimmte Architekturmoden in
den Jury-Urteilen manifestiert haben. Prämierungen, die man wenige Jahre
später offenbar nicht mehr ganz nachvollziehen mochte. Es geht also um eine
Katagorie des „Nur-Modische“, d.h. um das Präsentieren von zu einem
bestimmten historischen Zeitpunkt als „frisch“ und „neu“ geltenden
Formmerkmalen ohne tiefer gehende räumliche und funktionale Qualität. Ich
weiß nicht genau, ob es Höflichkeit ist oder der knappe Raum eines Vorworts,
dass uns Wolfgang Hübschen nicht sagt, an welche Beispiele er dabei denkt.
Egal wie – ich glaube, dass es gar nicht einfach ist, das „Nur-Modische“ von den
3
„normalen“ Zeitgeisteinflüssen zu unterscheiden, denen die jüngere
Baugeschichte stetig ausgesetzt war.
Architektonische Formkonzepte der jüngeren Vergangenheit am Beispiel Bremer Bauten
Dass Architekten nämlich eine konsistente Architektursprache, einen
dauerhaften Individualstil herausbilden, stellt bekanntlich eher die Ausnahme
dar. Der Wechsel von dominierenden Formkonzepten ist dagegen eine
Tatsache, die in der jüngeren Baugeschichte gewissermaßen rein
phänomenologisch mit dem ästhetischen Erscheinungsbild von Gebäuden
belegt wird. Bei Führungen zur jüngeren bremischen Baugeschichte erkläre ich
den Wandel vorherrschender Formkonzepte immer an dem hier zu sehenden
groben Schema: der Traditionalismus und der Modernismus des so genannten
Fünfzigerjahre-Stils – dominierende Formkonzepte des Wiederaufbaus –
werden durch spätmoderner Erscheinungsformen und insbesondere durch den
so genannten Brutalismus abgelöst, diese wiederum in dem 1980er Jahren
durch postmodernistische Tendenzen, und seit mittlerweile über zehn Jahren
wird die vorherrschende bauliche Erscheinungsform nach dem Kunsthistoriker
Heinrich Klotz in der Regel mit „Zweiter Moderne“ umschrieben. Als
Grobschema funktioniert das, natürlich muss man in der Nahsicht etwas feiner
differenzieren.
4
Wie schon gesagt, machen solche zeitgebundenen Wechsel formaler Vorlieben
nicht vor Werkverläufen von Architekten Halt. Man muss sich nur
vergegenwärtigen, wie unterschiedlich die baulichen Produkte eines
Architekten wie beispielsweise Gerhard Müller-Menckens im Laufe seiner
Werkentwicklung ausfielen. Obwohl sich dieser Architekt explizit auf die
Kontinuität des Bauens berufen hat, könnte man in Bezug auf das formale
Erscheinungsbild mit dem romantischen Dichter Shelley bemerken: „nichts als
nur der Wechsel hat Bestand“.
Bauten von Gerhard Müller-Menckens aus den Jahren 1951, 1955,1969 und 1994
Ein weiteres Beispiel: Auch in Gert Schulzes Werk lassen sich die Kennzeichen
von Spätmoderne, Postmodernismus und Zweiter Moderne gut herauslesen.
Bauten von Gert Schulze aus den Jahren 1978, 1986 und 2003
Und selbst bei einem Architekten wie Ungers – betrachtet man bloß seine
Werkphase ab Mitte der siebziger Jahre, die man gut unter dem Etikett des
Neorationalismus zusammenfassen kann – lässt sich deutlich ein Wandel
erkennen. So spiegelt die formale Entwicklung etwa zwischen dem Alfred-
Wegener-Institut und dem Contrescarpe-Center Zeitgeisteinflüsse der
Postmoderne und der Zweiten Moderne wider.
Bauten von Oswalt Mathias Ungers 1984 und 2005
So gesehen könnte man sagen: Die prämierten Arbeiten der bisherigen zehn
BDA-Preise sind ein relativ sicherer Indikator für einen jeweils vorherrschenden
5
architektonischen Zeitgeist. Insofern müsste man Wolfgang Hübschens
Feststellung, einige prämierte Bauten von damals hielten „heutigen Kriterien
nicht mehr stand“ darauf hin befragen, was mit „heutigen Kriterien“ denn
gemeint ist. Handelt es sich dabei um veränderte funktionale Ansprüche, um
veränderte bautechnische Standards oder um veränderte ästhetische
Vorlieben. Mit dem ersten Argument ließe sich natürlich auch der Stadthallen-
und der Kunsthallenumbau gut begründen – Abriss- und Umbaumaßnahmen,
die ja von Hübschen bedauert wurden. Mit bautechnischen und vor allem
energetischen Standards ließen sich heute viele der prämierten Gebäude von
damals abqualifizieren. Wie schwierig eine Balance zwischen der Erhaltung des
originalen Erscheinungsbildes und energetisch-technischen Anforderungen von
heute ist, mag die Restaurierung des ehemaligen amerikanischen
Generalkonsulats belegen.
Was nun die veränderten ästhetischen Vorlieben anbelangt, so betreten wir ein
besonders heikles Feld. Der architektonische Zeitgeist besitzt nämlich immer
auch ein verhängnisvolles ikonoklastisches Moment, also einen Drang,
ungeliebte ästhetische Gegenbilder auszulöschen. Ich will das an dem
Gründungsmythos der postmodernen Architektur veranschaulichen, wie ihn
uns Charles Jencks in seinem Buch „Die Sprache der postmodernen
Architektur“ bildhaft vor Augen geführt hat. Die gesprengten Wohnzeilen von
dem Architekten Minoru Yamasaki, der später das World-Trade-Center
entwarf, war in den fünfziger Jahren mit renommierten Preisen ausgezeichnet
worden. Für Charles Jencks war diese Siedlung allerdings ein Beleg dafür, dass
sie weder funktionalen noch ästhetischen Kriterien standhielt.
„Die moderne Architektur starb in St. Louis/Missouri
am 15. Juli 1972 um 15.32 Uhr, als die berüchtigte
Siedlung Pruitt-Igoe oder vielmehr einige ihrer
Hochhäuser den endgültigen Gnadenstoß durch
Dynamit erhielten.“ Charles Jencks in der Einleitung seines Buchs „Die Sprache der postmodernen
Architektur
Da die von Jencks propagierte Postmoderne inzwischen aber selbst wieder
historisch geworden ist, sollte man annehmen, dass man heute – auch im
Zeichen der so genannten Zweiten Moderne – wieder sensibler mit dem Erbe
moderner Bauten umgeht. Das scheint aber nur bedingt der Fall zu sein. Der
hier gezeigte Artikel aus der taz mag belegen, dass insbesondere im Umgang
6
mit dem Erbe der Spätmoderne und des Brutalismus große Probleme zu
bestehen scheinen.
Ausriss aus der taz-Nord vom 29.1.2011
Ich will das an zwei Beispielen von Bauten zeigen, die beim zweiten Bremer
BDA-Preis 1978 jeweils ausgezeichnet wurden, und die offensichtlich
gegenwärtig beide kurz vor dem Abriss stehen. Das erste ist das ehemalige
Verwaltungsgebäude der Klöckner-Stahlwerke, entworfen von dem bekannten
Düsseldorfer Architekturbüro Hentrich, Petschnigg und Partner. Das steht seit
2007 leer. In einem Weser-Kurier-Artikel vom Oktober letzten Jahres, in dem
dieser Bau beschrieben wird, heißt es:
Klöckner Verwaltungsgebäude 1977 und 2011
„Auf dem ehemaligen Parkplatz sprießt das Unkraut zwischen den
Pflastersteinen hervor, ein dichter grüner Wall umsäumt das Haus. Am
Eingangsbereich türmt sich Glasbruch,
seitlich davor steht eine rostige Skulp-
tur aus Stahl wie ein Mahnmal an
vergangene Zeiten. … Mit verführe-
rischem Glanz spiegelt sich das
Sonnenlicht in der Glasfassade des
Gebäudes. Ein fast idyllischer Ort mit
kleinen Wiesen voller Gräser, Büsche
und Bäume und einem Miniatursee
7
dahinter. Aber auch ein Ort, der durchsetzt ist vom Charme der Verlassenheit
und des Verfalls wie in einer postapokalyptischen Filmkulisse. Aber aus
derartiger Romantik wird wohl nichts. Ein Sprecher der Stahlwerke spekuliert,
dass das Gebäude wohl abgerissen wird. Eine Sanierung sei zu teuer. Eigentlich
wäre es schade drum.“
Altenzentrum St. Michael 1977 und 2011
Bei dem anderen Beispiel handelt es sich um das Altenheim St. Michael in der
Kornstraße von Veit Heckrott. Hier wird der unmittelbar bevorstehende Abriss
besonders deutlich an den Bergen rausgeschmissenen Mobiliars, die vor dem
Bau ausgebreitet liegen. Die mit Kurt Ackermann, Heinz Mohl und Manfred
Sack besetzte Jury hob 1978 besonders die „sehr menschliche Gliederung des
Gebäudes, im Inneren wie auch im Äußeren“ hervor, die Architektur sei
„lebendig, gleichzeitig ruhig“ und lebe „von einer zurückhaltenden Plastizität“.
St. Michael Innenaufnahmen 1977 und 2011
Ich habe einige namhafte Akteure des Baugeschehens zu diesen beiden Fällen
befragt. Die Urteile waren, wie so häufig, recht unterschiedlich. Der eine fand
das eine, der andere das andere Gebäude als eher erhaltungswürdig. Wobei
das jeweils „weniger erhaltungswürdige“ ähnlich wie von Wolfgang Hübschen
8
damit begründet wurde, es halte heutigen Kriterien nicht mehr stand. Von
anderer Seite war zu vernehmen, dass das Altenheim vor allem schwer
wiegende bautechnische Mängel aufweise und schon deshalb nicht mehr zu
retten sei.
Ich vermag das im Detail nicht zu beurteilen. Bemerkenswert ist allerdings, dass
sich solche geplanten oder ausgeführten Abrisse oder Umbauten scheinbar in
einer gewissen baukulturellen Grauzone vollziehen – dass sie in der Regel
offensichtlich vom BDA nicht bemerkt und/oder nicht thematisiert werden.
Sollte diese Beobachtung zutreffen, dann steckt darin eine bedenkliche
Tendenz, die dem architektonischen Qualitätssiegel BDA-Preis Schaden zufügen
könnte. Es könnte der Verdacht aufsteigen, neue Nutzungsinteressen stünden
allzu leicht über architektonischer Qualität.
Deshalb wäre es wichtig, dass sich der BDA mit seinen Gremien etwas präziser
darauf festlegte oder den Diskurs darüber eröffnete, welche der einst
prämierten Bauten denn welchen der angedeuteten heutigen Kriterien nicht
mehr standhalten und ob damit auch schon jeder Abriss oder jeder die bauliche
Substanz stark verändernde Umbau zu rechtfertigen sei. Sich hier allein auf die
Denkmalpflege zu verlassen, erscheint mir unangemessen. Gerade weil
architektonische Qualität, auf die sich BDA-Architekten ja stets gern berufen,
nicht nach letztlich objektiven Kriterien festzulegen ist, wäre der ständige
Diskurs über solche Qualitätsfragen so enorm wichtig. Und an welchen
Objekten ließe sich dieser Diskurs besser führen als BDA-Preisträgerbauwerken.