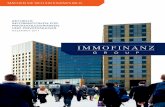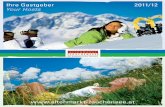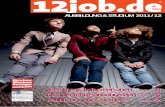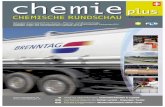grün:fläche WSe 2011/12
-
Upload
campusgruen-koeln -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of grün:fläche WSe 2011/12

Open Access wirdder freie (d.h. kosten- undbarriere-
freie) Zugang zu wissenschaftlicher Literatur genan-
nt. Dieser bietet eine Chance zur Demokratisierung
sowie einen weltweiten gleichberechtigten Zugang
zurWissenschaft.
Wissenschaft muss frei verbreitet werden, um Al-
len zu dienen
Seit jeher bemühen sich Wissenschaftler_innen, die
Ergebnisse ihrer Forschung dauerhaft zu doku-
mentieren und zu veröffentl ichen. Die Veröffent-
l ichung der Forschung sol lte also möglichst breit
sein, um dauerhaft zu bleiben. Dies steht dem Urhe-
berrecht, das in Deutschland gilt, diametral entge-
gen. Dieses sol l die Urheber_in von geistigem
Schaffen schützen und somit eine unkontrol l ierte
Verbreitung dieses Schaffens verhindern.
Bei wissenschaftl ichen Publikationen werden die
Erkenntnisse in neue Forschungen aufgenommen.
Die Forschungsergebnisse sol len sich gegenseitig in-
spirieren.
Wissenschaftl iche Publikationen sol len zur
Mehrung gesel lschaftl ichen Wissens beitragen und
werden zudem oftmals staatl ich finanziert. Ist in an-
deren Bereichen staatl icher Finanzierung die Ver-
fügbarkeit der Erzeugnisse selbstverständl ich (z.B.
bei der Bundeszentrale für pol itische Bildung), so
wird diese durch das Verlagswesen in der
Forschung im großen Umfang eingeschränkt. Wis-
senschaftsinstitute, Bibl iotheksverbände und die
Hochschulrektorenkonferenz setzten sich in der
Berl iner Erklärung von 2003 das Ziel , einen welt-
weiten kostenfreien Zugang zu Wissen zu er-
reichen, also "Open Access" umzusetzen.
(aufSeite 2 gehts weiter)
Über die Umstellung des Lehramts aufBachelor, die
damit verbundenen Probleme und das Auslaufen
des Lehramts aufStaatsexamen
Die Bachelor-Welle hat nun das große Feld der
Lehramtsstudiengänge ergriffen. Zu diesem
Semester wurden al le Lehramtsstudiengänge in
NRW auf Bachelor umgestel lt. Damit ist der Bo-
logna-Prozess auch bei den angehenden Lehrer-
innen und Lehrern angekommen und hat immer
einiges im Rucksack gehabt: Von International isier-
ung und Vergleichbarkeit bis hin zu Stärkung der
„Employabil ity“. Die grundsätzl iche Debatte über
das Bachelor-/ Mastersystem sol l hier außen vor
gelassen werden, da schl ießl ich die NRW-Landesreg-
ierung mit einer Reform der Reform ins Feld ziehen
möchte, um Probleme bei der Bologna-Umsetzung,
(wie bspw. der hohe Workload, das verschulte Sys-
tem, das kaum freie Gestaltungsmöglichkeit bietet)
zu beheben. Doch einige große Fragezeichen
müssen im Bezug auf die Lehramtsumstel lung an
dieser Stel le angeführt werden:
Die Einführung zum Wintersemester?!
Wenn man als Landesregierung ohnehin das
BA/MA-System reformieren möchte, wieso führt
man dann eine Studienreform durch, die die alten,
bekannten Probleme beinhaltet? Wieso wartet man
nicht „die Reform der Reform“ ab? Zugegeben: Das
Lehrerausbildungsgesetz (LABG 2009) sieht die Ums-
tel lung auf BA/MA mit dem Einführungsdatum WS
1 1 /1 2 vor. Im Grunde haben uns das unser alter Fre-
und Innovationsminister a.D. Pinkwart und seine
schwarz-gelben Kol leg_innen eingebrockt. Dass
nun dieses Tigerentengesetz greift, ist Fakt und Än-
derungen darin sind schwer zu erreichen. Die Unis
sind an die gesetzl iche Vorgabe gebunden. Dass
hier die Umstel lung nicht reibungslos funktioniert,
war zu erwarten. Auch wenn gerade die Uni Köln
und besonders das Zentrum für LehrerInnenbildung
(ZfL) in den letzten Monaten ein wahnsinniges
Tempo vorgelegt hat, um einen möglichst unprob-
lematischen Semesterbeginn zu erreichen, müssen
die Neueinsteiger sich mit Umstel lungsschwi-
erigkeiten auseinandersetzen: Unfertige Prüfung-
sordnungen und nicht verbreitete Modul-
handbücher, unklare Verbuchung von Leistungen
und eine (bisher) unzureichende Informationspol itik
der Univerwaltung.
Eine (un)nötige Umstellung?!
Über die Ausrichtung der neuen BA-Lehramtsstudi-
engänge kann man geteilter Meinung sein.
Praxissemester, deutl ichere Verzahnung von Theor-
ie und Praxis und individuel le Begleitung sind Än-
derungen, die beim Lehramt Sinn machen. Doch
braucht man hierfür die Umstel lung auf das BA-Sys-
tem? Hätte das nicht auch eine Reform der Staat-
sexamen-Studiengänge erreichen können? Klar,
wenn man ein Fan des BA-Systems ist, dann ist
sicherl ich auch ein BA-Lehramt eine tol le Sache.
Aber zwei Gegenfragen sind hier entlarvend: Wieso
gibt es dann keinen BA Jura und BA Medizin? Und:
Wie möchte man international bspw. BA Lehramt
Gymnasium vergleichen? Diese Studiengänge
können außerhalb von Deutschland nicht studiert
werden, da sich unser Bildungssystem grundlegend
von den anderen unterscheidet. Eine Internatinal is-
ierung, angeblich einer der großen Vorteile des
BA/MA-Systems, ist also nicht möglich.
Halbe Lehrer_innen?!
Die Umstel lung der Lehramtsstudiengänge beinhal-
tet eine deutl iche Umstrukturierung: Statt einem
Grund- und einem angeschlossenem Hauptstudium
mit dem Ziel Staatsexamen, wird ein BA-Studium
mit Abschluss und ein MA-Studium mit Abschluss
gefordert, um in den Referendariatsdienst gehen zu
können. Eine Garantie, nach der bestandenen BA-
Prüfung in das MA-Studium gehen zu können,
geschweige denn sofort und an der selben Uni, gibt
es jedoch nicht. Bei Nicht-Lehramtsstudiengängen
kann dies noch Sinn ergeben, aber da es überhaupt
nicht vorgesehen ist, dass Studierende mit BA
Lehramt Gymnasium mit Deutsch und Geografie für
den Master in Mathe und Physik wechseln könnten,
ist diese Zweiteilung nur sehr schwer zu vermitteln.
Um nicht befürchten zu müssen, nach dem
abgeschlossenen BA mit einem nicht-qual ifizier-
enden Berufsabschluss auf der Straße zu stehen,
wird das Gerangel um die MA-Plätze dements-
prechend groß sein. Alternativen, wie eine Exit-
Strategie hin zum fachbezogenen BA mit einem an-
schl ießenden Education Master gibt es bisher nicht.
Und was ist mit den „alten“ Lehrämtlern?!
Die tausenden Studierenden des Lehramts auf
Staatsexamen sind seit diesem Wintersemester ein
Auslaufmodel l . Was sich nach alter Waschmaschine
anhört, ist typisches Unijargon: Auslaufordnungen
wurden beschlossen. Durch erfolgreiche Interven-
tion des AStA wurde die absolvierte Zwischenprü-
fung bis 201 3 als erstes Selektions- und
Exmatrikulationsmittel gestrichen. Dennoch steht
nun fest, dass je nach Studiengang al le bis zum
Sommersemester 201 6 bzw. 201 7 ihr Staatsexamen
abgelegt haben müssen. Wer Lehramt studiert,
weiß wie unreal istisch die sogenannte „Regelstudi-
enzeit“ ist, an der man sich hier orientiert hat.
Welches Interesse zukünftige Schüler_innen haben,
von Lehrer_innen unterrichtet zu werden, die ihr
Studium im Galopp durchpeitschen mussten, ohne
die Möglichkeit zu haben, nach rechts und l inks zu
schauen, wird immer ein Geheimnis dieser Umstel-
lung bleiben.
(von MaxChristian Derichsweiler)
Liebe Student_innen,
wir begrüßen euch zur neuesten Ausgabe der
grün:fläche.
Das Jahr geht wieder langsam zu Ende, die Wahlen zum
Studierendenparlament und zu anderen Gremien
stehen vor der Tür und es wird Zeit ein Fazit zu ziehen.
1 0 Monate befindet sich campus :grün nun
zusammen mit Jusos und DieLinke.SDS im AStA. Für uns
war es ein spannendes, schönes aber auch sehr an-
strengendes Jahr mit Höhen und Tiefen. Wir hatten uns
vieles vorgenommen, wir haben vieles erreicht und
trotzdem ist nicht al les Gold was glänzt.
Auf diese Höhen und Tiefen der AStA-Arbeit wollen
wir in dieser Ausgabe eingehen. Wir wollen auf Prob-
leme hinweisen und (Selbst-)kritik üben.
Natürl ich wird in dieser Ausgabe nicht nur der AStA
Thema sein, sondern gibt es noch eine Vielzahl ander-
er Artikel zu den unterschiedlichsten Themen in-
und außerhalb der Uni , die uns als campus :grün
beschäftigen.
Wenn ihr euch auch hochschul- und gesel lschaftspol it-
isch engagieren wollt, könnt ihr gerne auf unsere Tref-
fen kommen.
In der Regel finden die Treffen in lockerer Runde
jeden Dienstag um 1 9:30 Uhr im Raum C über dem
AStA Café (Universitätsstraße 1 6) – Eingang Studi-
obühne (eine Wegbeschreibung gibts auf unserer
Homepage), statt. Wir tauschen uns dort über pol itische
Themen aus, diskutieren und planen Veranstaltungen.
Jede_r ist bei uns wil lkommen. Wir definieren uns als
parteienunabhängige, geschlechtergerechte und
basisdemokratische Hochschulgruppe.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und freuen
uns über Kritik und Anregungen.
Mehr Infos über uns und weitere Termine:
www.campusgruen.uni-koeln.de
Lehramt – Alt und Neu gesellt sich ungern
Ausgabe 4 - Wintersemester 201 1 /201 2
Open Access
Donnerstag, 01 .1 2.201 1
Perspectives from within - the Spanish Economy in the
Eurocrisis
Referent : Miguel Otero-Iglesias, Assistant Professor in
International Relations, Centre for European Integra-
tion, ESSCA – School of Management, Angers
Beginn: 1 9.30 Uhr - Ort: Hörsaal VI (Hauptgebäude)
Montag, 06.1 2.201 1
campus :grün köln Treffen
Beginn: 1 9.30 Uhr - Ort: Raum C (Über dem AStA Cafe)
Montag-Freitag, 1 2. - 1 6.1 2.201 1
Wahlen an der Uni Köln
Weitere Infomationen : www.wahlen.uni-koeln.de
Termine

An einem sonnigen Samstagmorgen sammeln sich et-
wa 1 500 junge, alte Menschen – al lein, in Gruppen,
mit Kinderwagen, mit selbst gebasteltem wütendem
(Wisch-)Mob oder in Guy-Fawkes-Masken auf dem
Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt. Sie sind
aufgeweckt, rufen und singen eigens gedichtete,
kölsche Protestl ieder. Der Umzug spaziert von Bank
zu Bank und zeigt Wut!
In der nächsten Woche versammeln sich genau so
viele Leute am Dom, um das wachsende Unbehagen
zu zeigen. Am 1 5. Oktober 201 1 sind es deutschland-
weit 40.000 Menschen, die die scheinbare Ohnmacht
der 99% der Weltbevölkerung nicht mehr hinnehmen
wollen. An den nächsten Terminen flacht es etwas ab.
Am 1 1 .1 1 .1 1 um 1 1 .1 1 Uhr trifft sich Occupy weltweit
– ein Datum, welches in Köln ohnehin Massen nach
draußen lockt. Der „Karneval der Empörten“ sol l die
ursprüngl ichen politischen Beweggründe wieder mit
dem Fest verbinden. Nach dem Motto „Jeder ist
König!“ kann sich jeder auf dem selbstgebasteltem
Thron krönen lassen. Weltweit kommen wieder
Tausende zusammen. „We are the 99 %!“, brül len
auch die Besetzer auf dem neu getauften Liberty
Plaza in New York seit dem 1 7. September. Arab
spring meet American fal l - von dem Tahrir Platz in
Kairo zieht eine Welle der Empörung in die USA und
in die ganze Welt.
Einzelne stel len konkrete Forderungen, wie Nobelpre-
isträger und Wirtschaftswissenschaftler Joseph Stigitz.
Als häufiger Besucher des Protest Camps am Liberty
Plaza in Manhattan schlägt er vor, höhere Steuern für
Wohlhabende und eine Finanztransaktionssteuer ein-
zuführen. Diese ist schon länger in der Diskussion und
sol l das Börsenglücksspiel , bei dem auf kurzfristige
Schwankungen von Kursen gesetzt wird, eindämmen.
Hier würden die Spekulanten spüren, dass ihre Trans-
fers nicht gratis von der Bühne
gehen. Seit Sommer 201 1 wird
die „Robin-Hood Steuer“ von
der CDU/CSU befürwortet. Bei
Youtube kann man Jan Josef
Liefers und Heike Makatsch
dabei zusehen, wie sie sich über die Vor- und
Nachteile der Transaktionssteuer austauschen.
Ganze Forderungsl isten sind auf occupywal lst.org zu
lesen. Die Lage ist komplex und die Lösungsansätze
sind unterschiedl ich. Occupy betont die eigene Unab-
hängigkeit und sieht sich als Kol lektiv. Einzelne Grup-
pen hissen ihre Fahnen und verteilen in Papierform
eigene Lösungsansätze. Was eigentl ich einen wil lkom-
menen Gedankenaustausch bringen kann, birgt auch
eine Gefahr der Unterwanderung. So warnte die taz
vor der US-Vereinigung Zeitgeist, welche eine „ob-
skure Mischung von Rel igionskritik, Esoterik und Ver-
schwörungstheorien“ propagiere. Occupy ist nicht
das eine passende Medikament gegen die Erkrankung
im System, sondern die Bewegung bewegt sich und
schafft Raum für Ideen. Gleichgesinnte wissen vonein-
ander und vernetzen sich. So kann man bei Facebook
lesen, dass jemand woanders auf der Welt die gleiche
Wut oder eine ähnl iche Idee teilt. Letztendl ich geht es
darum, selbst mitzugestalten. Occupy wil l dazu
aufrufen, über Missstände im System aufzuklären,
mögliche Lösungsansätze zu suchen, zu finden und
zu diskutieren. Der offene Dialog ist nicht klar und
eindeutig, ebenso l iegt der Fokus auf der Welt der In-
dustrienationen und beachtet die Situation der En-
twicklungsländer wenig. Dennoch sind Offenheit und
das kritische Hinterfragen - in Köln und darüberhinaus
- wichtige Eigenschaften, die unserem oft maßlosen
(Wirtschafts-)system und der globalen Verteilung
fehlen.
„Die Bürger bilden das Getriebe dieser Maschinerie,
welche nur dazu entwickelt wurde, um einer Minder-
heit zu Reichtum zu verhelfen, die sich nicht um un-
sere Bedürfnisse kümmert. Wir sind anonym, doch
ohne uns würde dergleichen nicht existieren können,
denn am Ende bewegen wir die Welt.“ (aus dem
„Manifest der Empörung“)
Und so werden auch die Straßen von Köln weiterhin
okkupiert, das Protestcamp auf dem Chlodwigplatz
begrüßt langsam den Winter, Foren wachsen, altern-
ative Ideen bepflastern das Internet – man kann
dabei sein! Occupy ist eine Plattform, die Gefühle
zeigt – Wut, Freude am Miteinander, am Teilen und
am Austausch. Wieder mehr Wärme in ein kaltes Sys-
tem zu bringen, würde al len mehr Zufriedenheit
bringen.
(von Corinna Fischer)
Einschränkung des Zugangs zu Wissen für Wis-
senschaftler_innen
Hauptbezugsquel le für wissenschaftl iche Literatur in
Studium und Forschung ist die Bibl iothek. Diese bi-
etet für Forscher_innen und Student_innen zumeist
die Grundlage für ihre Recherchen. Hauptbestandteil
von Bibl iotheken sind einerseits Fachbücher, auch
Monographien genannt, andererseits wissenschaft-
l iche Fachzeitschriften, auch Journals. Fachbücher
werden über die Verlage bestel lt und sind dann Teil
des Bestands der Bibl iothek. Zeitschriften hingegen
werden von Bibl iotheken in Abonnements von Verla-
gen bestel lt und dann den Wissenschaftler_innen zur
Verfügung gestel lt. Der Preis für die Bibl iothek richtet
sich hierbei nach der Anzahl der Nutzer_innen und
dem Renommee der Zeitschrift.
Zusätzl ich zu den Büchern und Zeitschriften haben
sich E-Books und E-Journals etabl iert und bieten oft-
mals unkomplizierten Zugang zu Literatur von
Zuhause oder aus dem Universitätsnetz. Was für viele
EDV-versierte Forscher_innen eine starke Verein-
fachung des Zugangs zu Wissen darstel lt, hat sich für
die Bibl iotheken zu einem großen Problem entwick-
elt.
Die Verlage befürchteten durch die Digital isierung
und damit größere Verbreitungsmöglichkeit einen
Wegfal l ihrer Finanzierung. Der Nationale Forschungs-
rat in den USA nannte die daraus resultierenden Prob-
leme das digitale Dilemma. Gemeint ist der Konfl ikt
zwischen den möglichen Potenzialen, die sich durch
den Einsatz neuer Technologien für das wissenschaft-
l iche Publizieren eröffnen und den gleichzeitigen Eins-
chränkungen, die in den privaten Verwertungs-
interessen der Rechteinhaber (Verlage) begründet l ie-
gen.
In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich zudem
auf dem Publikationsmarkt für universitäre Forschung
eine immer höhere Konzentration von Anbi-
eter_innen herausgebildet. Einerseits zeigt sich eine
Dominanz einiger weniger Verlage. Andererseits hat
sich in vielen Forschungsdiszipl inen eine einzige Zeits-
chrift als marktdominant erwiesen und hat somit eine
bessere Verhandlungsbasis gegenüber den Bibl io-
theken.
Die Digital isierung und die Konzentration von Zeits-
chriften und Verlagen führte zur sogenannten Zeits-
chriftenkrise der 1 990er Jahre. Besonders im
naturwissenschaftl ichen Bereich nutzten die Verlage
ihre guten Verhandlungsbedingungen aus, um einen
starken Anstieg in den Abonnementpreisen für Zeits-
chriften durchzusetzen. Infolge dessen konnten sich
einige Hochschulbibl iotheken die Versorgung mit ak-
tuel ler Literatur nicht mehr leisten. Für Forscher-
_innen bedeutete das natürl ich eine starke
Einschränkung ihrer Forschungsmöglichkeiten.
Die Hochschule zahlt doppelt
Die Abhängigkeit von der Veröffentl ichung in renom-
mierten Zeitschriften führt dazu, dass viele Wis-
senschaftler_innen die Nutzungsrechte für ihre
Publikationen entgeltfrei und exklusiv an die Verlage
abgeben. Die Wissenschaftler_innen haben also kein
Recht mehr auf Zweitpubl ikation in hochschuleigen-
en oder privaten Medien (Webseite o.ä.) . Um die
Ergebnisse der Forschung also innerhalb der eigenen
Hochschule nutzbar zu machen, muss die Hochschul-
bibl iothek die Zeitschrift, in der die Artikel einer_s Wis-
senschaftler_in erscheint, abonnieren.
Der Staat beziehungsweise die Hochschule bezahlt
also mehrfach für die Forschung. Einmal indem das
Gehalt und die Ausstattung der Wissenschaftler-
_innen finanziert wird und dann noch einmal um die
Ergebnisse der Forschung auch lesen zu können. Zu-
dem wird das Qual itätsmerkmal Peer-Review, dass die
Begutachtung der wissenschaftl ichen Qual ität durch
Kol leg_innen bezeichnet, auch zumeist durch Wis-
senschaftler_innen an Hochschulen durchgeführt und
somit indirekt auch durch den Staat finanziert.
Gerade in einer Phase der permanenten Unterfinan-
zierung der Hochschulen stel lt sich die Frage, ob eine
solche finanziel le Belastung vertretbar ist.
Open Access als Weg aus der Krise
Ihre Vorläufer hat Open Access in den Dissertations-
und Preprintservices der 90er Jahre. Schon ab 2000 fin-
gen viele Wissenschaftler_innen an das Publika-
tionssystem zu hinterfragen. Im Februar 2002 wurde
die Budapest Open Access Initiative gegründet. Diese
gilt als die Geburtsstunde der Open Access-Bewe-
gung. Im Anschluss daran haben sich die führenden
deutschen Wissenschaftsorganisationen und
Forschungsinstitute zusammengefunden, um in der
Berl iner Erklärung eine Bekräftigung des Open Ac-
cess-Gedankens zu geben. Ziel ist laut Berl iner
Erklärung: „das Internet als Instrument für eine welt-
weite Basis wissenschaftl icher Kenntnisse und
menschl icher Reflexion zu fördern und die erforder-
l ichen Maßnahmen zu formulieren, die von
Entscheidungsträgern, Forschungsorganisationen,
Förderinstitutionen, Bibl iotheken, Archiven und
Museen zu bedenken sind.“(Berl iner Erklärung)
Hiermit wurde der Grundstein zur Verbreitung von
Open Access in der deutschen Forschungslandschaft
gelegt. Open Access Veröffentl ichungen gewähren al-
len Nutzer_innen unwiderrufl ich das freie, weltweite
Zugangsrecht zu diesen Veröffentl ichungen und er-
lauben ihnen diese – in jedem beliebigen digitalen
Medium und für jeden verantwortbaren Zweck – zu
kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und
öffentl ich wiederzugeben sowie Bearbeitungen dav-
on zu erstel len und zu verbreiten, sofern die Urheber-
schaft korrekt angegeben wird. Zudem wird eine
vol lständige Fassung der Veröffentl ichung sowie al ler
ergänzenden Material ien in einem geeigneten
elektronischen Standardformat in mindestens einem
Online-Archiv veröffentl icht, um den offenen Zugang
und die uneingeschränkte Verbreitung zu ermög-
l ichen. (Im Anschluss an die Berl iner Erklärung haben
sich einige Hochschulen und Forschungsinstitute
zusammengeschlossen, um Open Access in der BRD
weiter zu fördern. So haben etwa die FU Berl in und
die Universitäten Bielefeld, Göttingen und Konstanz
gemeinsam ein Informationsportal zu Open Access
entworfen (http://open-access.net).)
Auch an der Universität zu Köln gibt es erste Be-
strebungen Open Access zu fördern.
Unter http://kups.ub.uni-koeln.de/ findet ihr ein On-
l ine-Archiv für die Uni Köln, in dem vor al lem Doktor-
arbeiten zu finden. Trotzdem bleibt die meiste
Forschung an der Uni Köln unter Verschluss oder in
hochpreisigen kommerziel len Zeitschriften.
Zugang ist nicht gleich Freiheit
Die Verteidigung des freien Zugangs zu Forschung-
sergebnissen ist richtig und wichtig. Dieser wird aber
konterkariert, wenn die Freiheit der Wissenschaft
eingeschränkt wird. In der ganzen BRD und auch in
Köln gibt es eine stark wachsende Zahl von Stiftungs-
professuren und Geheimverträgen. Solange der Inhalt
der Vereinbarung zwischen der Kölner Unikl inik und
Bayer ebenso unbekannt ist, wie der zwischen
Deutschen Bank und FU Berl in, ist diese Freiheit stark
zu bezweifeln.
So ist von dem Energiewirtschaftl ichen Institut (EWI),
dass zur Hälfte von RWE und e.on finanziert wird
keine unabhängige, und damit auch keine gesel l-
schaftl ich relevante, Forschung zu erwarten.
(von Fabian Kaske)
Köln ist okkupiert!

Eine interessante Frage, die natürl ich einer ausführ-
l ichen Antwort bedarf. Da der AStA nicht gerade die
Füße stil l gehalten hat und die Seele baumeln l ieß,
sondern sich tatkräftig um eure Anliegen und Pro-
jekte zur Verbesserung des Studiums gekümmert hat,
gibt es da einiges zu berichten. Wir versuchen uns
mal auf ein Paar Punkte zu konzentrieren.
Im neuen Ökologiereferat wurden mehrere Projekte
umgesetzt: Das wichtigste für uns ist die al lseits be-
l iebte Fahrradwerkstatt, die sich seit dem Win-
tersemester 201 1 /201 2 im Hinterhof der Mensa
befindet. Die Dienste der fleißigen Helfer_innen wer-
den von vielen Fahrradbesitzer_innen in Anspruch
genommen. Ein weiterer Erfolg ist die Gemüsekiste,
eine Zusammenstel lung von saisonalem und re-
gionalem Obst und Gemüse, das von einem Bio-
Bauernhof in der Nähe von Köln, nach Hause oder an
die Uni gel iefert wird.
Gut besucht war auch die Vortrags-, und Filmreihe
zum Thema „Kl imawandel vor der Haustür“, sowie die
Diskussion zu regionalem und fairem Handel . Vom
Ökologiereferat ging zudem auch die Forderung aus,
dass al le AStA-Publ ikationen auf Recycl ingpapier
gedruckt wurden. Hier fand durchaus ein kleiner Men-
tal itätswechsel statt.
Eine Auseinandersetzung mit dem Thema Rassisimus
und Alltagsdiskriminierung wurde durch das vom
Referat "Kritische Wissenschaft und Antidiskrimin-
ierung" organisierte `festival contre le racisme`
angeregt. Dies erfolgte durch unterschiedl iche Form-
ate, wie Ausstel lungen, Theateraufführungen,
Vorträge und Konzerte.
Mit Vorträgen und Aktionen zu Burschenschaften, wie
zum Beispiel der Störung des geplanten Couleur-Früh-
stücks der Burschenschaft Germania an Hitlers Ge-
burtstag, setzte der AStA einen klares Zeichen gegen
Rassismus und Faschismus. Im Wintersemester war
die Veranstaltung "Rechte Burschen" der Auftakt zu
einer kritischen, inhaltl ichen Auseinandersetzung. Wir
hoffen, dass es da im kommenden Semester weiterge-
ht und haben einiges vor. Mit den "Aktionstagen ge-
gen Sexismus und Homophobie" konnte an der Uni
Köln den Focus besonders auf Antidiskriminierung-
sarbeit gesetzt werden. Die Ringvorlesung „Alternat-
iven Denken“ bot einen Raum, die übl ich gelehrten
Denkweisen in verschiedenen Forschungsbereichen
kritisch zu hinterfragen. Das Engagement im
Bildungsstreik, die Forderung nach mehr Partizipation
und der Einsatz gegen kommerziel le Werbung an der
Universität sind weitere wichtige Anl iegen des Refer-
ats für "Kritische Wissenschaft und Antidiskriminier-
ung".
Das Herzstück des Öffentlichkeitsreferates ist die in
neuem Format erscheinende AStA Zeitung
„Nachdruck“, in der hochschulpol itische Angelegen-
heiten, kritische Themen oder, so traditionsbewusst
sind wir, auch der Speiseplan der Uni- Mensa ihren
Platz finden. Das Referat informierte die Studier-
endenschaft über Uni-aktuel le Themen wie die
Zwangsexmatrikulation vieler Kommil iton_innen, die
schlechte Wohnungssituation in Köln und natürl ich
auch den Bildungsstreik. Die Präsenz des AStA's auf
dem Campus wird zusätzl ich durch den neuen Info-
Point im Seminargebäude verstärkt, wo AStA Aktive
für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen.
Einige Studierende haben so endl ich erfahren, dass es
sowas wie den AStA gibt.
Vernetzung
Unser Engagement im freien Zusammenschluss von
StudentInnenschaften (fzs) und bei Landesasten-
treffen (LAT) verstärkte die Zusammenarbeit mit an-
deren Hochschulen aus verschiedensten Städten.
Dadurch konnte landes- und bundesweit auf wichtige
Themen von Studierenden eingegangen werden.
Um auch Fachschaften unserer Universität wieder
näher zusammen zu bringen, hat das Fachschafts-
referat Vernetzungstreffen organisiert. Dort konnten
sich Fachschaftler_innen über uniweite Belange aus-
tauschen und informieren. Der Grundstein für eine
uniweite Fachschaftenkonferenz(FSK) wurde damit
gelegt und sol l in den kommenden Monaten aktiv
weitergeführt werden, al lerdings ohne die Fach-
schaften einzuschränken oder etwas vorzugeben.
Im Senat stel lte der AStA kritische Anträge und Fra-
gen zum Beispiel zu Burschenschaften, zur Aus-
laufordnung der Lehramtsstudiengänge und zu
Werbung an der Uni. Außerdem brachte sich der AStA
ein, als es um die Einführung der Qual itätsverbesser-
ungskommission, zur Verteilung der Studienge-
bühren-Kompenationszahlungen, ging. Das Rektorat
versuchte diese lange herauszuzögern.
Im AStA setzten wir uns auch für die Verbesserung
der Studienbedingungen ein. Gerade die neue
Lehramtsausbildung wurde kritisch begleitet, um den
neuen Bachelor- und Masterstudierenden ein studi-
erbareres Studium zu ermöglichen.
Neben der inhaltl ichen Arbeit wurde seit langem
auch wieder auf die Finanzen geachtet. Ohne einen
sol iden Haushalt ist inhaltl iche Arbeit schl ießl ich
nicht möglich. So konnten durch neue Verträge mit
der Studiobühne oder kritischer Reflektion, welche
Veranstaltungen wirkl ich notwendig sind, einige
tausend Euro eingespart werden.
Wichtig für uns ist, darauf hin zu weisen, dass nicht
nur wir im AStA tätig waren, sondern das mit der Juso
Hochschulgruppe und DieLinke.SDS zwei weitere
Gruppen beteil igt waren, bei denen wir uns an dieser
Stel le bedanken wollen.
Al les zusammen betrachtet, war dieses AStA-Jahr
endl ich mal wieder ein Jahr in dem "Bewegung im
AStA" war. Wir haben euch bei den letzten Wahlen
also nicht zu viel versprochen.
(Einige AStA-Beteiligte von campus:grün)
Ein Jahr im AStA – eine kritische Selbstreflexion
Seit dem ersten Februar 201 1 ist campus :grün
im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) vertre-
ten. Für die Gruppe hat das große Veränderungen
bedeutet, sind wir doch zum ersten Mal im AStA tätig.
Dieser Artikel sol l eine kritische Reflexion des letzten
Jahres sein. Er sol l aber nicht inhaltl ich Bilanz ziehen,
sondern vor al lem von unseren Erfahrungen in den
Strukturen dieses Gremiums berichten.
Die Wahlen und die Party - Startschuss im Freuden-
taumel
Alles begann auf der Wahlparty im Dezember 201 0. Es
zeigte sich, dass zum ersten Mal seit vielen Jahren
wieder eine real istische Möglichkeit bestand, die un-
pol itischen Unabs (Die Unabhängigen) aus ihrem
gemachten Nest zu holen und sie bei ihrer AStA-
Arbeit abzulösen. campus :grün hatte sich bei
den letzten Wahlen von 1 0 auf 1 5 Plätzen verbessert.
Dies war einerseits durch unsere Arbeit in der Opposi-
tion begründet, andererseits auch dadurch, dass die
feministische Liste gueril la grrls und die Alternative
Liste nicht mehr zu den Wahlen angetreten waren
und wir die Wählerinnen und Wähler dieser Gruppen
am besten von unseren Ideen überzeugen konnten.
Trotzdem hatte keine_r wirkl ich mit diesem Ergebnis
gerechnet. Und so konnte man in den freudestrah-
lenden Gesichtern nach Bekanntmachung der Ergebn-
isse auch ein wenig Ernst erkennen, denn eins war
klar: AStA-Arbeit bedeutet eine Menge Verantwor-
tung.
Nach der Party folgt der Kater - die Koalitionsver-
handlungen
Nach den Wahlen begann dann die Diskussion, mit
wem es in den AStA gehen sol l . Relativ schnel l haben
wir uns gegen eine Zusammenarbeit mit den Unabs
entschieden. Uns war wichtig, einen echten Neuan-
fang gegenüber den letzten elf Jahren Hoch-
schulpol itik an unserer Uni zu machen und alte
Strukturen aufzubrechen. Dabei waren wir der Mein-
ung, dass es bei den Unabs noch einige Personen gab
und gibt, denen es nach unserem Empfinden nicht
daran gelegen ist, die Studienbedingungen im Sinne
al ler Studierenden zu verbessern. Dies gab den Aus-
schlag, sich auf Gespräche mit der Juso-Hochschul-
gruppe und DieLinke.SDS zu konzentrieren. Inhaltl ich
wurde man sich recht schnel l einig. Offen bl ieben
nach den ersten Sitzungen noch einige personel le
und strukturel le Änderungen.
Aus heutiger Sicht würden wir die Koal itionsverhand-
lungen wohl ein wenig anders angehen. Uns ist klar,
dass ein Koal itionsvertrag immer auch ein Kom-
promiss ist. Al lerdings haben wir es – viel leicht auf-
grund von mangelnder Erfahrung – versäumt, einige
für uns sehr wichtige Themen in den Koal itionsvertrag
aufzunehmen, die aus diesem Grund dann später viel
zu wenig thematisiert wurden. So kam es während un-
serer Amtszeit weder zu einer Positionierungen zur
Atomkraft, noch zur Zerstörung der Sürther Aue
durch den Ausbau des Godorfer Hafens. Zu beiden
Themen hatte der AStA offiziel l keine Meinung und
Stel lungnahmen, beide Themen scheiterten an der
Juso-Hochschulgruppe.
Los geht's – Der Sprung ins kalte Wasser
Trotz al ledem stand am Ende ein Koal itionsvertrag,
mit dem wir sinnvol le Arbeit leisten konnten. Es ging
auch ziemlich schnel l los, da das Semester geplant
werden musste. Vol ler Energie, teilweise aber ziemlich
unbedarft stürzten wir uns ins Abenteuer. An
manchen Punkten war es dabei sinnvol l , auf die Er-
fahrung der Juso-Hochschulgruppe zurück zu greifen,
die zu Teilen bereits seit 2 Jahren mit den Unabs im
AStA war. Auch ganz besonders haben uns die Ge-
spräche mit den Angestel lten des AStA geholfen, die
teilweise seit über 20 Jahren für die Studier-
endenschaft tätig sind und Höhen und Tiefen im AStA
erlebt haben.
Wichtiges Ziel unserer Arbeit war es, neben der Umset-
zung und Bearbeitung vieler inhaltl icher Punkte, die
Strukturen so zu verändern, dass es für al le einfacher
wird sich zu beteil igen. Aus einem traditionel len Funk-
tionärsverständnis des "Wir FÜR euch" sol lte ein "Wir
MIT euch" werden. In vielen Bereichen, vor al lem im
Ökologiereferat, aber auch im Referat für kritische Wis-
senschaften und Antidiskriminierung und im Sozi-
alreferat, ist dies gut gelungen. Hier wurden
Menschen, die nicht aus den AStA-tragenden Hoch-
schulgruppen kommen, in die inhaltl iche Arbeit ein-
bezogen. So wird die AStA-Fahrradwerkstatt bereits
jetzt zu einem großen Teil von außenstehenden Studi-
erenden gestaltet. Außerdem wurde stark der Ein-
bezug verschiedener, nicht im Studierenden-
parlament vertretener Hochschulgruppen gesucht
und auch die Zusammenarbeit mit den autonomen
Referaten klappte größtenteils gut.
Zwar war es so möglich, viele verschiedene Menschen
an die Verfasste Studierendenschaft bzw. den AStA
heranzuführen, die eigentl iche Interessenvertretung
blieb al lerdings auf wenige Personen, meist aus den
drei AStA-tragenden Hochschulgruppen, beschränkt.
Dies sol lte aus unserer Sicht in Zukunft anders wer-
den.
Ganz klar wurde, dass AStA-Arbeit in der derzeitigen
Form eine Tätigkeit ist, die nicht al len möglich ist.
Gerade Studierende, die es sich nicht leisten können,
so viel Zeit in diese Arbeit zu stecken, bleiben aus-
geschlossen. Denn wer engagiert im AStA arbeitet,
hat daneben unmöglich Zeit, noch einen Nebenjob
auszuüben geschweige denn die nötige Zeit in sein
oder ihr Studium zu stecken. Die Aufwandsentschädi-
gung, die man für sein Engagement bekommt, reicht
aber nicht aus, um einen Nebenjob finanziel l zu kom-
pensieren. Zudem trifft diese strukturel le Diskriminier-
ung Studierende mit Kindern und Studierende, die
Angehörige pflegen oder aus anderen Gründen nicht
an zahlreichen, häufig abends gelegenen Terminen
teilnehmen können oder wollen. Um bei diesen Punk-
ten eine Barrierefreiheit herzustel len, ist noch ein weit-
er Weg zu gehen.
Es war uns von Anfang an ein wichtiges Anl iegen, die
Verbindung zwischen dem AStA und den Studier-
enden zu verbessern. Hier ist es uns gelungen, durch
regelmäßige Sprechstunden im neuen Seminarge-
bäude, die neue AStA-Zeitung, zahlreiche Veranstal-
tungen und Projekte und die selbstverwaltete
Fahrradwerkstatt mehr Kontaktmöglichkeiten für
Studierende zu schaffen.
Ein Punkt, in dem wir unseren eigenen Ansprüchen
leider nicht gerecht werden konnten, ist die
geschlechtergerechte Arbeit und damit verbunden
die Repräsentation von Frauen im AStA. Für einen
AStA, der mit einem feministischen Anspruch angetre-
ten ist, haben zu wenige Frauen in ihm mitgearbeitet.
Dies l iegt aber unserer Meinung auch daran, dass die
Strukturen weiterhin sehr männerdominiert sind, was
geschlechtergerechte Arbeit schwer macht. In Zu-
kunft werden al le Gruppen zusammen daran arbeiten
müssen, um wirkl ich eine Lösung zu finden.
AStA-Arbeit bedeutet eine Menge Verantwortung –
obwohl es uns auf der Wahlparty vor fast einem Jahr
schon klar war, war uns das Ausmaß wohl
rückbl ickend nicht vol lends bewusst. Zu sehen, wie
unter unserer eigenen Verantwortung neue Dinge
entstanden sind, hat uns viel Freude bereitet und Mo-
tivation für unsere Arbeit gegeben. Al lerdings hatten
viele von uns unterschätzt, wie stark die persönl iche
Verantwortung und der damit einhergehende Druck
sich auch auf das Privatleben und das Studium aus-
wirken kann. Ein Problem war sicher auch, dass sich
nicht al le Menschen gleichermaßen für das „Projekt
AStA“ verantwortl ich gefühlt haben und so häufig
Aufgaben ungleich verteilt waren. Eins ist uns vor al-
lem klar geworden: Ein AStA wie wir ihn uns vorstel-
len, kann nur funktionieren, wenn genug Menschen
ihr Herzblut hineinstecken!
Ein Jahr ist nicht genug – ein neuer Aufbruch
Wir haben inhaltl ich viele Projekte, die wir uns vor-
genommen hatten, erfolgreich umgesetzt. Al lerdings
reicht ein Jahr einfach nicht aus, um Strukturen, die
sich in mehr als einem Jahrzehnt zuvor festgefahren
haben, aufzubrechen und tiefgreifend umzugestal-
ten. Die Arbeit im AStA hat uns stel lenweise sehr
ernüchtert, daher werden viele von uns im kom-
menden Jahr an anderen Stel len pol itisch aktiv sein,
sich wieder stärker in der Gruppe engagieren oder
sich andere Betätigungsfelder suchen, in denen sie
aktiv werden wollen. Trotzdem haben wir uns bei
einem Gruppentreffen Anfang November dazu
entschieden, wieder zu den Wahlen anzutreten; mit
dem Ziel , erneut in den AStA zu gehen.
Wir wünschen uns, dass der AStA weiterhin pol itisch
Stel lung bezieht, die Uni sozialer und ökologischer
wird und dass Themen, die ohne uns unter den Tisch
fal len würden, auch im kommenden Jahr behandelt
werden. Dabei wird es uns noch wichtiger sein, mög-
l ichst viele Menschen in die AStA-Tätigkeit einzubez-
iehen.
(Einige AStA-Beteiligte von campus:grün)
Und was hat der AStA so gemacht im letzten Jahr?

Seit dem Unglück in Fukushima im März 201 1 wurde
auch in Deutschland wieder die Atomdiskussion
angeregt. Bürger, Pol itiker und Medien fragen: „Wie
sicher sind eigentl ich unsere Atomkraftwerke?“ Zwar
l iegen die 1 7 deutschen AKW nicht in so stark gefähr-
deten Erdbebenregionen wie in Japan, aber Stromaus-
fäl le durch Bl itzeinschlag, Verstopfung von
Kühlanlagen oder unglückl iche Verkettung von
menschl ichem Versagen sind nicht aufRegionen bezo-
gen, sondern können jedes Kraftwerk treffen. Die Un-
glücke in Harrisburg (1 979) und Tschnobly (1 986)
schienen nicht nachhaltig genug zu sein, um die
Menschheit zum Umdenken zu bewegen. Deshalb ver-
öffentl ichte die Autorin Gudrun Pausewang 1 987
ihren Roman „Die Wolke“, in dem sie eine atomare
Katastrophe inmitten der dicht besiedelten Bundes-
republik inszenierte. Bis 201 0 wurden 1 ,5 Mil l ionen Ex-
emplare verkauft, durch den GAU in Japan erreichte
das Buch erneut die Bestel lerl isten und das Interesse
einer neuen Generation. Das Werk wurde mit dem
Deutschen Literaturpreis ausgezeichnet.
Die Handlung von „Die Wolke“ beginnt im Osten von
Hessen, wo die 1 5-jährige Janna-Berta und ihre
Mitschüler während des Unterrichts von einem Kata-
strophenalarm überrascht werden. Panik bricht aus,
als bekannt wird, dass es im Atomkraftwerk Grafen-
reinfeld zu einem kerntechnischen Unfal l gekommen
ist. Janna-Berta macht sich sofort auf den Weg nach
Hause, wo ihr kleiner Bruder Ul i sie schon aufgeregt er-
wartet. Die Eltern sind an diesem Tag mit dem Baby-
bruder Kai in Schweinfurt und
zunächst sind sich die
Geschwister unsicher, wie sie
sich verhalten sol len. Während die Pol izei in Durch-
sagen dazu auffordert Türen und Fenster geschlossen
zu halten und ruhig zu bleiben, flüchten die Nachbarn
in vol lbeladenen Autos Richtung Autobahn. Nach
einem Anruf der Mutter machen sich Janna-Berta und
Uli mit Fahrädern auf den Weg nach Bad Hersfeld, von
wo sie mit dem Zug weiter nach Süden fahren wollen.
Auf der Fahrt kommt Uli bei einem Unfal l ums Leben
und Janna-Berta wird, völ l ig traumatisiert, von einer
Famil ie zum Bahnhof mitgenommen. Unfähig eine
Entscheidung zu treffen, irrt sie dort umher, gerät in
einen radioaktiven Regenschauer und landet schl ieß-
l ich stark geschwächt in einer Notunterkunft in Herle-
shausen. Lange weiß sie nicht, was mit ihren Eltern
passiert ist und erst nach und nach stel lt sich heraus,
dass es sich bei dem Unfal l in Grafenreinfeld um einen
viel größeres Unglück handelt, als damals in
Tschernobyl .
Sie fuhren mit geschlossenen Fenstern, obwohl es
sehr warm war. „Sicher ist sicher“, meinte Helga. Sie
l ieß Janna-Berta auch nicht aus einer eingefasste
Quel le trinken. „Man kann nie wissen“, sagte sie. Erst
bei Göttingen wagte sie sich auf die Autobahn Kassel-
Hamburg. Sie aßen zusammen in einer Raststätte.
Janna-Berta traute ihren Augen nicht, als sie die Preise
sah.
„Das Fleisch ist aus Übersee und das Gemüse auch“,
erklärte Helga. „Nur die Kartoffeln sind deutsch. Noch
aus der alten Ernte. Im nächsten Jahr werden auch die
Kartoffeln von anderswo kommen müssen - für die,
die’s bezahlen können.“
„Und was essen die, die’s nicht bezahlen können?“,
fragte Janna-Berta.
„Das Bil l igere“, antworte Helga.
Janna-Berta nickte: Das also würde der neue Unter-
schied zwischen Arm und Reich sein.
(Seite 1 27)
Sehr beeindruckend erzählt Gudrun Pausewang die
Geschichte der 1 5-Jährigen, die von heute auf mor-
gen in einem zerstörten Land leben muss, in der kein-
er mehr das Deutschland sehen kann, das vor dem
Unglück existierte. Ein Mädchen, die nicht weiß, was
mit ihrer Famil ie ist und deren Zukunft sich einfach in
Luft aufgelöst hat. Ein Roman, der bewegt, mitfühlen
lässt und wütend macht. Eine Geschichte, die Fiktion
bleiben sol l .
DieWolke - Gudrun Pausewang
erschienen im Ravensburger Verlag, Taschenbuch
5,95€
(Buchempfehlung von Anna-Teresa Geisbauer)
Dogcare-Clinic Sri Lanka - Eine Rettung für viele StraßenhundeSandstrand, Palmen und blaues Meer - Eine
malerische Kul isse eröffnet sich den Touristen, die
ihren Urlaub auf der Insel „Sri Lanka“ ehemals
„Ceylon" im indischen Ozean verbringen. Von den
Spuren des Tsunamis, der 2004 das Land verwüstet
und zahlreiche Todesopfer gefordert hat, ist heute
nicht mehr viel zu sehen. Besonders die Westküste hat
sich aus ihrem Schock gelöst und sich wieder ganz
dem Tourismus verschrieben. Nicht nur wunder-
schöne Strände, Ayuverda- Kuren und gutes Essen
locken zahlreiche Urlauber_Innen jedes Jahr auf die In-
sel unterhalb Indiens, auch kulturel le und rel igiöse
Stätten heizen den Massentourismus zusätzl ich an.
Doch hinter diesem, von westl ichen Sonnenan-
beter_innen konstruierten Urlaubsparadies verbergen
sich Probleme, die der typische „Massentourist“ nicht
mal im Geringsten für möglich hält beziehungsweise
die Hintergründe erfassen kann. Nicht nur der
Tsunami 2004 forderte tausende von Menschenleben,
auch der Bürgerkrieg, der erst vor ca. zwei Jahren sein
Ende fand wurde von vielen zivilen Opfern begleitet.
Die Forderung nach einem unabhängigen Tamilen-
staat der „Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)“ und
die Ablehnung der sri lankanischen Regierung gingen
dem Konfl ikt voraus. Es folgten Jahre der Gebietser-
oberungen auf beiden Seiten, ehe 1 995 die Situation
zu einem Bürgerkrieg eskal ierte. Friedensverhandlun-
gen scheiterten und so endeten die Kämpfe erst im
Mai 2009 als die sri lankanischen Truppen die Re-
bel l_innen auf eine „ungefährl iche“ Zahl reduziert
und ihren Anführer erschossen hatten. Nicht zuletzt
wegen den beschriebenen Zuständen leidet Sri Lanka
unter wirtschaftl ichen Problemen und Armut. Doch
auch ein anderes soziales Thema beschäftigt die rund
20,6 Mil l ionen Einwohner_innen der Insel im indis-
chen Ozean.
So genannte Streetdogs, Straßenhunde sind eines der
großen Probleme der Gesel lschaft. Hunde, die sich frei
bewegen, tägl ich um ihr Futter kämpfen müssen und
somit auch um ihr Überleben. Hunde, die niemand
vermisst, um die sich niemand kümmert, für die
niemand verantwortl ich ist und für die erst recht
niemand ein Herz zeigt. Streetdogs sind meistens
nicht kastriert, krank und vol lkommen unterernährt.
Von Flöhen, Läusen und anderem Ungeziefer ganz zu
schweigen, sind die Hunde oft von Kratzern und Ver-
letzungen aus Revierkämpfen, bedeckt. Auf den
Straßen zählt das Gesetz des Stärkeren, genau das
spüren diese Hunde Tag für Tag.
Der Umgang vieler Einheimischer mit ihren eigenen
Hunden sowie den Streetdogs lässt stark zu wün-
schen übrig und kann nur verbessert werden. Das Ver-
ständnis für nötige Kastrationen, Behandlungen und
Vorsorgeimpfungen ist bei einigen Bewohner_innen
der Insel noch nicht ausgeprägt genug beziehungs-
weise gar nicht vorhanden. Der Stel lenwert eines
jeden Hundes ist durch die große Gesamtanzahl in
den Augen der Sri Lankaner_innen unglaubl ich ge-
sunken. Hunde als Werkzeug, als lebende Alarman-
lage, als Wegwerfprodukt gesehen. Oft wird keinerlei
emotionale Bindung zum eigenen Tier und erst recht
nicht zu den herumlungernden Straßenhunden aufge-
baut, die mit Tritten und Schlägen weggejagt oder
hemmungslos überfahren werden. Hinzu kommt die
Angst der Inselbewohner_innen vor der bei uns fast
nicht mehr vorkommenden „Tol lwut“, einer Krankheit
die für den Menschen fast immer zum Tode führt und
sie deshalb auch so gefährl ich macht. Eine Schutzimp-
fung ist sehr kostspiel ig, weshalb sie für viele Sri
Lankaner_innen nicht in Frage kommt. Es bleibt also
nur die Möglichkeit sowohl Straßen-, als auch Hunde
von Besitzern, mit dem Impfstoff zu versorgen, um sie
so als Träger der Krankheit, als „potentiel le Gefahren-
quel le“ ausschl ießen zu können.
Eine weitere Erklärung für den doch sehr fragl ichen
Umgang mit den Hunden lässt sich in der Rel igion der
Einheimischen finden. Zu 70% leben Buddhisten auf
der Insel , die restl ichen 30% teilen sich der Hinduis-
mus, der Islam und das Christentum. Eine wichtige
Rol le im Buddhismus spielt die Wiedergeburt, die sich
als eine Art Leitfaden durch das Leben der Gläubigen
zieht. Wer sich durch gute Taten und positives Han-
deln in seinem ersten Leben hervorgetan hat, kann
auf eine Inkarnation als menschl iches Wesen hoffen.
Schlechte Personen werden dagegen oft als Tier
wiedergeboren, speziel l der Hund ist ein Symbol für
ein schlechtes vorrangegangenes Leben. Viel leicht
aus diesen Gründen, viel leicht aus anderen ist die Situ-
ation der Hunde so katastrophal und kann auf lange
Sicht nur durch eine Reduzierung der Masse (Kastra-
tionsprogramme) und durch Aufklärung der Bevölker-
ung verändert werden.
Genau an diesem Punkt knüpft Marina Möbius mit ihr-
er Dogcare-cl inic, im schönen Badeort Unawatuna
(Südküste), an. Sie kam selbst als Touristin auf die In-
sel und konnte sich vor dem Elend der Straßenhunde
nicht verschl ießen. Aus anfängl ich zwei oder drei Hun-
den, die sich ihre Portion Futter bei ihr abholten,
wurde bald eine kleine Bande und so nahm die
Entstehung der Dogcare-cl inic ihren Lauf. Marina
Möbius schaffte es mit Hilfe von Freunden und Ein-
heimischen die Kl inik zu bauen und nach nahezu west-
l ichem Standard einzurichten. Im Jul i 2007 öffnete sie
zum ersten Mal ihre Pforten. Wöchentl ich finden nun
Kastrationstouren, in Zusammenarbeit mit lokalen
Tierärzt_innen, in verschiedenen Städten in der
Umgebung und auch teilweise in großer Entfernung
statt. Die Kl inik bietet tierärztl iche Versorgung, Imp-
fungen und Kastrationen und sorgt so für die al lzu
wichtige Aufklärung der Bevölkerung. Viele Sri Lankan-
er_innen sind nicht in der Lage für Leistungen wie
diese finanziel l aufzukommen. Die Versorgung der
Hunde ist daher nicht nur kostenfrei für sie, sondern
wird auch mit einer kleinen Geldspende für die Fam-
il ie „belohnt“. So wird die Versorgung beziehungs-
weise Kastration der Hunde gewährleistet und ein
Bewusstsein für die Verantwortung gegenüber ihren
Tieren entsteht. Eine Finanzierung des Projektes ist
nur durch Spenden und Patenschaften, sowie durch
Marinas persönl iches Engagement möglich.
Um den Überlebenskampf der Straßenhunde etwas
zu erleichtern, bricht das Team der Kl inik jeden Tag zu
sogenannten Fütterungstouren auf. Hierbei wird Fut-
ter an bestimmte Plätze in der Umgebung gebracht,
an denen die Straßenhunde schon sehnsüchtig da-
rauf warten. Das große Areal der Dogcare-cl inic bietet
nicht nur Zuflucht für Streetdogs, für die ein Über-
leben auf der Straße unmöglich geworden ist, son-
dern auch für Hunde aus Famil ien, die nicht mehr an
ihre „Herrchen“ zurück gegeben werden können oder
solche, die einfach nicht mehr zu ihren früheren
Besitzern zurück gehen möchten. Neben diesen
Dauerbewohnern, treffen nahezu tägl ich
Kleinstwelpen, die ohne Hilfe keine Überlebenschan-
cen hätten, in der Kl inik ein. Sie werden auf den täg-
l ichen Fütterungstouren, in Pappschachteln am
Wegesrand, vor Klöstern oder von hilfsbereiten Tour-
isten gefunden. Durch den frühen Entzug der Mutter
und damit verbunden der ersten wichtigen Mutter-
milch haben die Jungtiere ein sehr schwaches Im-
munsystem und sind den „Krankheiten der Straße“
hilflos ausgel iefert.
In der Dogcare-cl inic wird um jedes Leben gekämpft,
doch manchmal kommen die helfenden Maßnahmen
zu spät und viele der Findelkinder müssen schon
während der ersten Tage ihres Aufenthaltes von ihr-
em Leiden erlöst werden. Die Welpen werden wieder
aufgepäppelt, mit den notwendigen Impfungen ver-
sorgt und nach einiger Zeit auch kastriert. Sind die
Hunde in einem guten gesundheitl ichen Zustand be-
ginnt die Suche nach neuen Besitzer_innen. Es ist
Marina Möbius ein besonderes Anl iegen die Hunde
nicht nach Deutschland zu vermitteln, sondern sie auf
Sri Lanka an geeignete Einheimische abzugeben.
Zum einen können und werden die Hunde immer
wieder besucht und stehen so unter Beobachtung,
zum anderen würde sich das Problem nur verlagern
und nicht gelöst werden, so Möbius. Hier vor Ort sol l
der Umgang mit den Tieren verändert werden. Das
Ziel ist ein Wandel im Denken der Einheimischen, der
Hund sol l an Stel lenwert gewinnen und als fühlendes
Wesen wahrgenommen werden.
Die Situation der Streetdogs hat sich dank des Ein-
satzes von Marina Möbius und ihrem Team im Umkre-
is von Unawatuna erstaunl ich gebessert und das
Leben der Hunde erleichtert. Doch das Örtchen an
der Südküste ist nur ein kleiner Part der Insel und es
Bedarf noch viel Hilfe, Zeit und Aufklärung, um die
Lage der Straßenhunde auf ganz Sri Lanka dauerhaft
zu verändern und lebensfreundl ich zu gestalten.
Weitere Informationen unterwww.dogcare-clinic.de
(von Julia Haas)
Buchempfehlung : Die Wolke
Auflage : 3000
Layout : Pascal Klons, Thomas Heise
Redaktion : Franziska Reich, Hanna Palm
ViSdP: Pascal Klons, Am Weidenbach 35, 50676
Köln
Grafiken : campus:grün köln
Druckerei : Caro-Druck, Frankfurt
Im Web : www.campusgruen.uni-koeln.de