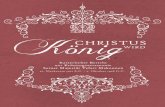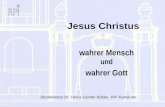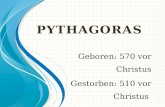Hausarbeit Christus Johannes Gruppen2
Transcript of Hausarbeit Christus Johannes Gruppen2

Humboldt-Universität zu Berlin
Kunstgeschichtliches Seminar
Wintersemester 2008/09
PS Einführung in die Mediengeschichte der deutschen Skulptur und
Plastik
Stefan Trinks M.A.
Die Christus-Johannes-Gruppen des 14.
Jahrhunderts
Denis Pieper
Bild- und Kunstgeschichte, 3. Semester
Matrikelnummer 520049
Novalisstraße 13
10115 Berlin
Tel.: 0176/21989485

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung S.2
2. Hauptteil S.2
2.1 Die plastischen Christus-Johannes-Gruppen S.2
2.2 Ikonographische Vorstufen S.7
2.2.1 Die literarische Quellen: Das Letzte Abendmahl S.7
2.2.2 Autorenbilder S.8
2.2.3 Hohenliedillustrationen S.9
2.3 Das Andachtsbild und die deutsche Mystik S.10
3. Schluss S.11
4. Literatur- und Bildverzeichnis S.13
5. Abbildungen S.15
1

1. EINLEITUNG
Die Christus-Johannes-Gruppen sind in der Gotik entstandene Andachtsbilder,
die eine charakteristische Bildprägung der spätmittelalterlichen Mystik
darstellen. Die ikonographischen Wurzeln reichen jedoch bis ins frühe
Mittelalter zurück und der letztendlichen plastischen Ausformung gehen
literarische, theologische und buchmalerische Entwicklungen zuvor. Neben der
Darlegung der Entwicklungslinie der plastischen Gruppen im theologischen und
sozialen Kontext ihrer Entstehungszeit wird im Folgenden deshalb auch der
Versuch unternommen werden, knapp die weiter zurückliegende
ikonographische Entwicklung darzustellen. Hierbei werden vor allem die
Schriften von Hans Wentzel und Rainer Hausherr genutzt.
2. HAUPTTEIL
2.1 Die plastischen Christus-Johannes-Gruppen
Als Christus-Johannes-Gruppen werden Zweifigurengruppen bezeichnet, die
den Jünger Johannes an der Brust Christi bzw. in dessen Armen ruhend
darstellen. Es sind insgesamt 25 plastische Gruppen bekannt, von denen
jedoch 14 Werke im 14. Jahrhundert entstanden. Sie sind fast ausschließlich in
Holz gefertigt und ihr Format variiert stark.1 Auffallend ist, dass sie alle aus dem
schwäbisch-alemannischen Raum, also aus Schwaben, der deutschen Schweiz
und dem Oberrheingebiet stammen und meist in Frauenklöstern verehrt
wurden.
Zudem weisen alle erhaltenen Gruppen, die bis zur Hälfte des ersten 14.
Jahrhunderts entstanden, untereinander eine auffallende Ähnlichkeit auf.
Aufgrund der motivischen, zeitlichen und lokalen Begrenzung der Gruppen
wurde in der Forschung oft von einem Urbild oder Gnadenbild ausgegangen,
dass aufgrund seiner wunderwirkenden Fähigkeit kopiert wurde. Bereits Hans
Wentzel diskutiert diese Möglichkeit.2 Er verweist zum Vergleich auf das
Beispiel des wundertätigen Gnadenbilds in Alt-Ötingen, eine kleine Marien-
1 Reiner Haussherr: Über die Christus-Johannes-Gruppen: Zum Problem „Andachtsbild“ und deutsche Mystik, in: Beiträge zur Kunst des Mittelalters : Festschrift für Hans Wentzel zum 60. Geburtstag, Berlin 1975, S, 82.2 Hans Wentzel: Die Christus-Johannes-Gruppen des vierzehnten Jahrhunderts, Berlin 1947, S. 7-8.
2

Holzfigur aus dem mittleren 14. Jahrhundert, die zahlreiche kopiert wurde. Das
Fehlen eines solchen Urbildes könnte laut Wentzel durch die Bilderstürme im
vornehmlich protestantischen Bodenseegebiet erklärt werden. Gegen die
Existenz eines Gnadenbildes spricht jedoch das Fehlen von textlichen Quellen
und Überlieferungen über ein solch wunderwirkendes Kultbild.
Trotz der Ungewissheit über die Existenz eines solchen Bildes ist in der
Forschung mittlerweile allgemein anerkannt, dass zwei Urgruppen überliefert
wurden, die im Verlaufe der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts nachgebildet
wurden.
An dieser Stelle muss auf die spezifische Kopiergewohnheit des Mittelalters
verwiesen werden: Die für den inhaltlichen Gehalt wichtigen Charakteristika
wurden übernommen, ohne jedoch zu versuchen eine exakte Kopie auf
formaler und stilistischer Ebene zu erreichen.
Die stilistisch älter wirkende dieser beiden Urgruppen ist die 92 cm große
Christus-Johannes-Gruppe aus Eichenholz (Abb.1). Sie wird auf das Jahr 1280
datiert, stammt aus dem Benediktinerstift in Zwiefalten und befindet sich heute
im Cleveland Museum of Art in den USA.3
Ein leicht bärtiger Mann mit langem, in der Mitte gescheiteltem, welligem Haar
sitzt aufrecht auf einer Bank. Sein Blick ist streng nach vorne gerichtet. Sein
Mund bildet ein leichtes Lächeln. An seiner linken Seite sitzt ein bartloser
Jüngling, der Evangelist Johannes, der ebenfalls gewelltes, langes Haar besitzt.
Mit geschlossenen Augen tief in sich versunken, neigt er sich Christi zu. Sein
Kopf ruht auf dessen linken Schulte. Die rechten Hände beider Figuren
berühren sich über dem Schoß Christi auf dessen Nabelhöhe, was als
sogenannte dextrarum iunctio bezeichnet werden kann. Zudem ist dessen linke
Hand auf Johannes linke Schulter aufgelegt.
Trotz dieser Gesten der Nähe und Zuneigung bleiben beide Figuren formal
voneinander abgegrenzt. Die aus einem Block geschnitzte Gruppe wurde in
der Mitte durch einen Zwischenraum geteilt. Wie bereits erwähnt, neigt sich
Christi Johannes weder zu, noch sieht er ihn an. Sein figürlicher Aufbau betont
3 Justin Lang: Herzesanliegen: Die Mystik mittelalterlicher Christus-Johannes-Gruppen, Ostfildern 1994. Alle Größenangaben und Datierungen der beschriebenen Gruppen richten sich nach ebd.
3

die Vertikale. Auch die grob und wuchtig geschnitzten Falten seines Gewandes
laufen gerade nach unten im Gegensatz zu den Gewandfalten Johannes, die
der Körperneigung folgend, leicht zu Christus hin verlaufen. Der rechte Arm
Johannes folgt in seiner Neigung dem Schwung der Gewandfalten.
An dieser Gruppe lassen sich bereits alle Grundmotive der bis zur ersten Hälfte
des 14. Jahrhunderts entstandenen Gruppen feststellen: Johannes sitzt zur
Linken Jesu und lehnt sein Haupt an dessen Schulter oder Brust. Der ebenfalls
sitzende Jesus legt dabei seine linke Hand auf die linke Schulter Johannes,
während Johannes seine Rechte in die rechte Christi legt bzw. diese berührt,
die sogenannte dextrarum iunctio. Erst ab 1350 löst sich die strenge Zuordnung
der Motive auf: Charakteristische Motive werden nicht dargestellt bzw. werden
sie mit anderen kombiniert4.
Eine vermutlich aus Mariaberg stammende, um 1320 entstandene und aus
Nussbaum gefertigte Skulptur, die heute im Württembergischen
Landesmuseum zu finden ist, ähnelt der Zwiefalter Gruppe stark (Abb.2). Sie
misst 128 cm und auch hier wurden alle ikonographischen Merkmale
übernommen. Zwar sind die beiden rechten Arme nicht mehr erhalten, so dass
das wichtige Motiv der dextrarum iunctio nicht mehr näher untersucht werden
kann, jedoch ist anhand der Armposition zumindest davon ausgehen, dass sie
sich ursprünglich, eine Vertikale bildend, berührten. Die farbliche Fassung ist
nur noch in Resten erhalten. Die Figur ist zeitlich später als die Zwiefalter
Gruppe zu datieren, denn das leichte Lächeln Jesu ist gewichen und die
Gewandfalten verloren an Rundung und wurden spitzer dargestellt. Justin Lang
geht davon aus, dass das gerundete Faltenprofil noch der Formenwelt des 13.
Jahrunderts angehöre, welche dem Stil des 14. Jahrhunderts weichen musste5.
Auch eine Gruppe aus Riederau am Ammersee, heute im Bayerischen
Nationalmuseum in München befindlich und aus Eiche bestehend, übernimmt
die ikonographischen Merkmale der Zwiefalter Gruppe (Abb.3). Auch hier neigt
sich Christi nicht seinem Jünger zu und die beiden Figuren sind durch eine tiefe
Furche in der Mitte zweigeteilt. Allerdings sind die Gewandfalten hier noch
4 Hausherr 1975, S.855 Lang 1994
4

spitzer zulaufend als bei der Gruppe aus Mariaberg dargestellt. Auffällig sind
auch die schräg nach oben gezogenen Augen und Brauen.
Dies verweist bereits auf das zweite Urbild. Es handelt sich hierbei um die mit
131 cm Höhe nahezu lebensgroße Skulptur, dessen Herkunft von Ilse Futterer
auf das Dominikanerkloster Katharinental bei Dießenhofen im Thurgau
lokalisiert wurde (Abb.4): Die um die Mitte des 14. Jahrhunderts entstandenen
Nonnenviten des Kloster, erwähnen an zwei Stellen eine Christus-Johannes-
Gruppe, die zum einen den Standort der Gruppe im Chor erwähnt, die Gruppe
zum anderen ausdrücklich als groß beschreibt. Als weiteren Beleg für die
Herkunft aus dem Katharinentaler Kloster führt Futterer eine Stelle aus einer
Handschrift des 18. Jahrhunderts an, welche die Gründungsgeschichte des
Klosters beschreibt. Sie besagt:
St. Joannesbild wardt von meister Hainnrich dem bildhauwer zu Co(n)stantz uß einem nußbom so schön gemacht, d(a)s jed(er)man sich verwunderte, der meister selbst.6
Da unter allen erhaltenen Gruppen die Antwerpener Gruppe die einzige ist, die
sowohl groß ist, als auch aus Nussbaum besteht, macht die Zuordnung zum
Katharinentaler Kloster wahrscheinlich. Des Weiteren wies Futterer auf die
stilistische Nähe der Gruppe zu einer sich noch heute in Katharinental
befindenden Madonna hin7. Auch wenn die Gruppe auf inhaltlicher Ebene mit
der Zwiefalter Gruppe übereinstimmt, so zeigen sich bei näherer Betrachtung
doch einige Unterschiede in der formalen Gestaltung: Die Figur des Christus
löst sich aus der strengen Vertikale durch eine leichte Neigung hin zu
Johannes. Dieser ruht näher an der Brust Christi, so dass sein rechter
Körperumriss in den Körper Christi eingebettet scheint. Dieses Verschmelzen
der Umrisslinien wird vor allem auch durch den fehlenden Zwischenraum
herbeigeführt. Die beiden rechten Hände treffen sich auch hier über dem Schoß
Christi, jedoch bilden sie einen Bogen und liegen fest ineinander. Auch die
Gewandfalten beider Figuren korrespondieren miteinander: Die über dem
Schoß liegenden Mäntel wirken wie ein einheitliches Gewand. Sie nehmen das
Motiv der zueinander geneigten Körper auf und schwingen zueinander hin,
beispielsweise zwischen den Beinen. Die Augen beider Köpfe sind leicht schräg 6 zit. nach Hausherr 1975, S.827 Ilse Futterer: Gotische Bildwerke der deutschen Schweiz 1240-1440, Augsburg 1930
5

nach oben gestellt, wie bei der bereits erwähnten Riedenauer Gruppe.
Zudem zu beachten ist, dass der linke Fuß des Johannes im Gegensatz zur
Zwiefalter Gruppe nicht zu sehen ist. Dieses Verschmelzen vom 4-Fuß Typus
zum 3-Fuß-Typus kann analog zum Wechsel vom 4-Nageltypus zum 3-
Nageltypus in Kreuzdarstellungen Christi gesehen werden und verweist somit
auf eine Entstehung der Gruppen im 14. Jahrhundert.
Bei der nur 34,5 cm messenden Eichengruppe aus dem Kloster Adelshausen in
Freiburg im Breisgau, die sich seit 1950 im Liebieghaus in Frankfurt befindet, ist
der 3-Fußtypus noch deutlicher zu erkennen (Abb.5). Auch die markant
überproportional gestalteten Köpfe, verweisen auf eine Entstehung um die Mitte
des 14. Jahrhunderts.
Eine zeitlich der Katharinentaler Gruppe wahrscheinlich relativ nahe Kopie ist
die Gruppe aus dem Zisterzienserkloster in Heiligkreuztal (Abb.6). Sie diente
wohl als Retabelstatue, also als Altarschmuck. Auch hier sind alle wichtigen
Motive übernommen worden ohne jedoch auf eine persönliche stilistische
Umprägung zu verzichten. Die Gruppe wirkt weniger fein ausgearbeitet. Die
Hände liegen nur noch in der Schrägen ineinander. Dafür lehnt sich Jesus
jedoch stärker in Richtung Johannes. Auch seine Mimik wirkt weniger kühl und
emotionaler.
Auffällig ist vor allem aber auch die Fassung der Gruppe, die mit ihren kräftigen
Farben für manche heutigen Betrachter wohl kaum mit der unaufdringlichen
Ruhe und der zurückhaltenden Innigkeit der Gruppe in Zusammenhang zu
bringen ist. Die Farbwahl für das Kleid des Johannes entspricht jedoch den
üblichen Darstellung von Apostelgewändern in Rot und Grün. Das Blau des
Gewandes Christi kann als Verweis auf das Himmlische, die Transzendenz
Christi interpretiert werden. Zwar ist die Farbe Gold eindeutig Jesu zugewiesen,
doch kommt sie in geringem Ausmaß auch an den Rändern des Gewandes
Johannes vor, was als Hinweis auf die Innigkeit und Einswerdung der beiden
Figuren gelesen werden könnte. Eine Einswerdung die sich zwar noch nicht
komplett vollzogen hat, jedoch schon angelegt und begonnen ist.
Eine weitere Wiederholung als Altargruppe ist die etwas kleinere, 89 cm hohe,
in Eiche geschnitzte Sigmaringer Skulptur, die sich mittlerweile in der
6

Sammlung des Bode-Museum befindet (Abb.7). Die Gruppe ist weniger
plastisch und unter einer Konzentration auf die Fläche gestaltet. Der Kopf des
Johannes ruht nicht mehr an der Brust Jesu sondern auf dessen Schulter. Zwar
vollzieht sich dies zu Lasten der Plastizität, jedoch werden dadurch die
Umrisslinien wieder stärker betont, was der Skulptur eine gewisse
Körperlosigkeit verleiht.
Auch die Gesichter, vor allem das Gesicht Jesu, wirken mit ihren schräg nach
oben gezogenen Augen abstrahiert. Man könnte in der Gruppe den Versuch
einer symbolhafteren Darstellung erkennen, die das Christus-Johannes-Motiv
unter Wahrung der wichtigen Charakteristika entpersonifiziert und somit
generalisiert.
2.2 Ikonographische Vorstufen
2.2.1 Die literarische Quellen: Das Letzte Abendmahl
Auf der Suche nach den Ursprüngen der Christus-Johannes-Gruppe liegt die
Rückführung auf den Abendmahlsbericht des Johannes-Evangelium nahe,
denn nur in diesem Bericht wird das Ruhen Johannes an der Brust Jesu
erwähnt:
Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische saß an der Brust Jesu, welchen Jesus liebhatte (Joh 13, 23).
Am Ende des Evangeliums wird dieses Motiv des Ruhens an der Brust Jesu
erneut erwähnt, was dessen Wichtigkeit deutlich macht:
Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, welchen Jesus liebhatte, der auch an seiner Brust beim Abendessen gelegen war und gesagt hatte: HERR, wer ist's, der dich verrät?
Dennoch wäre es zu kurz gegriffen, die Entstehung des neuen Bildtypus nur als
Verdichtung und Konzentration aus der Abendmahlsszene aufzufassen. Die
ikonographischen Wurzeln des Motivs sind komplex und reichen weiter ins
Mittelalter zurück:
2.2.2 Autorenbilder
7

Bereits Hans Wentzel weist explizit auf Christus-Johannes Darstellungen in der
Buchmalerei hin8. Es sind 18 bis 20 Darstellungen von Johannes an der Seite
Christi erhalten, die vom Beginn des 13. Jahrhunderts bis hin zum 15.
Jahrhundert zu datieren sind.9 Die ersten Christus-Johannes Darstellung trat in
der Buchmalerei folglich bereits ca. 100 Jahre vor der ersten plastischen
Ausformung dieses Motivs auf. Fast alle der Darstellungen sind den
Anfangsinitialien des Johannesevangeliums, der Apokalypse oder anderen
Büchern des neuen Testaments eingefügt und stellen folglich Autorenbilder des
Johannes dar. Sie greifen die besonders bevorzugte Stellung Johannes unter
den Jüngern, die der Evangelist, wie bereits erwähnt wurde, auch selber zu
seiner Charakterisierung anbrachte auf: Den Jünger, “den Jesus lieb hatte“. In
den von den Kirchenvätern verfassten Vorwörtern zu den Evangelien wird
hervorgehoben, dass die besonders innige Beziehung Johannes zum
Schreiben des Evangeliums befähigte. Jesus wird hier also attributiv dem
Johannes beigefügt. Allgemein werden auch diese Darstellungen auf die
Abendmahlsszene zurückgeführt. Jedoch fällt die große Freiheit auf, mit der die
Gruppierung beider Figuren zueinander dargestellt wird. Wentzel erklärt sich
dies durch ihre Funktion als Autorenbilder, die eine gewisse gestalterische
Freiheit von der ursprünglichen Abendmahlsszene erhalten konnten, da das
Hauptaugenmerk auf Johannes und dem attributiv verwendeten Christus lag
und nicht auf dem Letztem Abendmahl lag. Doch bereits für Hanns Swarzenski
war diese gängige These nicht ausreichend. Zwar lässt er den Bezug auf die
Abendmahlsszene für englische Bibelillustrationen aus dem 13. Jahrhundert zu
(Abb.8-10), grenzt diese jedoch in ihrer ikonographischen Entwicklung von den
deutschen Illustrationen (Abb.11), zu denen auch die älteste Illustration aus
einer Missale in Zürich gehört (Abb.12), ab10. Auch Eleanor S. Greenhill greift
dies in einer ausführlichen Arbeit zu den Christus-Johannes-Gruppen als
Autorenbilder auf und vertritt die These, dass sich der Großteil der
Darstellungen auf die Berufung des Johannes bezieht11.
8 Wentzel 19479 Eleanor S. Greenhill: The Group of Christ and St. John as Author Portrait: Literary Sources, Pictorial Parallels, Festschrift Bernhard Bischoff, Stuttgart 1971, S. 407.
10 Hanns Swarzenski: Quellen zum deutschen Andachtsbild, Zeitschrift für Kunstgeschichte 4, 1935, S.20.11 Greenhill 1971, S.408
8

2.2.3 Hohenliedillustrationen
Diese Überlegungen zeigen, dass bei der isolierten Darstellung von Christus
und Johannes nicht lediglich von einer Reduktion einer Einzelszene aus der
Abendmahlsszene auszugehen ist.
Weitere Untersuchungen führen in die Bereich des Hohenliedes Salomonis.
Hausherr macht deutlich, dass bereits Origenes das Ruhen an der Brust Christi
„mit der Vorstellung von der Brust des Herren als Quelle des Lebens und der
Offenbarung des Evangeliums in Zusammenhang bringt“12 und diese Gedanken
wiederum auf seine Interpretation des Hohenliedes anwendet, indem er die
Brust (ubera) der Braut (Cant 1,1) mit der Brust des Herren (pectus Domini)
gleichsetzt. Der vermeintlich profane Hymnus zweier Liebenden wird allegorisch
mit der Vereinigung zwischen Jesus und der Kirche, der sogenannten ecclesia,
gedeutet. Diese Vereinigung, wurde üblicherweise durch die Umarmung von
Bräutigam und Braut, sponsus und sponsa, dargestellt, die meist auf gleicher
Ebene nebeneinander sitzen und sich gegenseitig ansehen13. Das Motiv der
Umarmung kommt in der mittelalterlichen Buchmalerei darüber hinaus so selten
vor, dass sie neben Darstellungen der Seele in Abrahams Schoß ausschließlich
Jesus vorbehalten ist.14
Eine weitere Darstellungsweise der sponsus-sponsa-Metaphorik ist das
gegenseitige Reichen der Hände. Dieses Motiv der verbundenen Hände, die
sogenannte dextrarum iunctio tauchte bereits in der Antike auf und wurde im
Mittelalter charakteristisch für Hochzeitsdarstellungen, von wo sie dann
schlussendlich in den Bereich der Hohenliedillustrationen übertragen wurde.
Beeinflusst von den Illustrationen des Hohenliedes ist auch die älteste
überlieferte Darstellung von Johannes an der Brust Christi aus einer Handschrift
des mittleren 12. Jahrhundert aus dem Kloster Admont (Abb.13). Es handelt
sich hierbei um eine Illustration eines Gebets von Anselm von Canterbury zu
Johannes. Laut Otto Pächts Deutung zeigt die Szene, wie Johannes seine
12 Hausherr 1975, S.88-8913 zit. nach ebd, S. 92)14 Vgl. Wentzel 1974, S.14
9

Braut verlässt um sich Jesus anzutrauen15, was ja bereits der Text im
Spruchband
„Tu leve coniugis pectus – respuisti supra pectus domini Jesus recubens“
Damit ist der Ursprung aller charakteristischen Motive in den plastischen
Christus-Johannes-Gruppen beschrieben.16 Die vereinzelten und nicht in eine
einheitliche Entwicklungslinie zu bringenden früheren Darstellungen werden in
den plastischen Christus-Johannes-Gruppen der ersten Hälfte des 14.
Jahrhunderts schematisch zusammengefasst. Hausherr spricht von einer
„latenten Bildvorstellung“17. Es stellt sich jedoch die Frage warum das bereits
existierende Gedankengut gerade im 14. Jahrhundert zu einem feststehenden
Bildschemata zusammengefügt wird:
2.3 Das Andachtsbild und die deutsche Mystik
Die Christus-Johannesgruppen werden der Gruppe der sogenannten
Andachtsbilder zugeordnet. Das Andachtsbild ist ein im 13. Jahrhundert in
Deutschland aufgekommener Bildtypus, der der persönlichen Andacht des
Einzelnen dient und nicht in der liturgischen Praxis verwendet wurde. Dieser
Bildtypus erreicht im 14./15. Jahrhundert seine erste Blütezeit. Zu den
wichtigsten Vertretern dieser Gruppe zählen neben der Christus-Johannes-
Gruppe, das Vesperbild und der Schmerzensmann. Die Ikonographie der
Andachstsbilder ist nicht in der heiligen Schrift vorgebildet. Stattdessen wurzeln
sie meist in Szenen aus der Dichtung18.
Die Entstehung der Andachtsbilder geht zurück auf die Ausbreitung der Mystik
und Volksfrömmigkeit in Deutschland. Die deutsche Mystik steht im weiten
Kontext einer Subjektivierung der Religiosität im 13. Jahrhundert.
Im Gegensatz zur bis ins 13. Jahrhundert hinein eher überpersönlich-
normativen geprägten Religiosität, setzt im selben Jahrhundert eine Erneuerung
des religiösen Lebens ein, die in erster Line auf Vertiefung und Verinnerlichung
15 Otto Pächt: The Illustrations of the St. Anselm’s Prayers and Meditations, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 19, 1959, S.78f.16 Für eine weitere, detailliertere Analyse einiger Sondermotive s. Hausherr 1975, S.92ff17 Hausherr 1975, S. 9618 Vgl. Reallexikon für Kunstgeschichte, Hrsg. Otto Schmitt, Stuttgart 1937ff, Bd. 1 (1937), S.682-683
10

des religiösen Empfinden abzielt und in Deutschland in der Mystik ihre
Ausprägung findet. Diese Verinnerlichung in der deutschen Mystik erweckt den
Bedarf nach neuen Formen der Andacht, da der traditionelle liturgische Apparat
nicht ausreicht und stellt somit ein wichtiges Moment der Entstehung der
Andachtsbilder dar19.
Wie anfänglich bereits erwähnt wurden die Christus-Johannes-Gruppen vor
allem in alemannischen Frauenklöstern verehrt. Diese stellte um 1300 ein
Zentrum der spätmittelalterlichen Mystik dar. Johannes bot sich für die Nonnen
aufgrund seiner besonderen Gottesnähe und seine in der Bibel bezeugte
Jungfräulichkeit (virgo in aevum) als Identifikationsfigur an. Abgesehen davon
diente Johannes schon früher als Vor- und Leitbild der vita contemplativa. Der
Verzicht auf und das Zurücklassen von irdischen und sinnlichen Gütern, um
sich einem Leben an der Brust Gottes zu verschreiben, wird durch die
Nachahmung des Johannes, der seine ihm angetraute Ehefrau verließ, um sich
Gott hinzugeben, legitimisiert und findet hier einen ihrer theologischen
Ursprünge.
3. Schluss
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Christus-Johannes-Gruppen in
einem reich verzweigten Netz von theologischen und ikonographischen
Bezügen verankert sind und dennoch neuen gesellschaftlichen und religiösen
Entwicklungen Rechnung tragen. Die Gruppen beruhen vornehmlich auf einer
Mischung der Motivik von Abendmahls-, Hohenlied- und
Umarmungsdarstellungen. Diese verschiedenen und teilweise losen Motive
werden aufgrund des Bedarf an neuen, intimeren Andachtsformen durch das
Erstarken der deutschen Mystik zu Beginn des 14. Jahrhunderts zu einem
festgelegten Bildschemata zusammengefügt, welches sich auf die Vereinigung
Johannes mit Christi konzentriert und somit vor allem den Zentren der
mystischen Bewegung, den Frauenklöstern, als Identifikationsschablone dient
und deren Bedürfnis Rechnung trägt.
19 Julius Baum: Gotische Bildwerke Schwabens, Berlin 1921
11

Literaturverzeichnis:
Julius Baum: Gotische Bildwerke Schwabens, Berlin 1921
Ilse Futterer: Gotische Bildwerke der deutschen Schweiz 1240-1440, Augsburg 1930
Eleanor S. Greenhill: The Group of Christ and St. John as Author Portrait: LiterarySources, Pictorial Parallels, Festschrift Bernhard Bischoff, Stuttgart 1971
Reiner Haussherr: Über die Christus-Johannes-Gruppen: Zum Problem „Andachtsbild“ und deutsche Mystik, in: Beiträge zur Kunst des Mittelalters : Festschrift für Hans Wentzel zum 60. Geburtstag, Hrsg. Rüdiger Becksmann, Berlin 1975
12

Veronika Kaiser: „Bild, da Sant Johans ruwet uff unser Herren Herczen“: Zur Funktion der Christus-Johannes-Gruppe, in: Sinnbild und Abbild, Hrsg. Paul Naredi-Rainer, Innsbruck 1994
Otto Pächt: The Illustrations of the St. Anselm’s Prayers and Meditations, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 19, 1959
Reallexikon für Kunstgeschichte, Hrsg. Otto Schmitt, Stuttgart 1937ff, Bd. 1 (1937), S.682-683
Hanns Swarzenski: Quellen zum deutschen Andachtsbild, Zeitschrift für Kunstgeschichte 4, 1935, S. 141-144
Hans Wentzel: Die Christus-Johannes-Gruppen des vierzehnten Jahrhunderts, Berlin 1947
Bildverzeichnis
Abb. 1, 2, 6, 7, 13
Justin Lang: Herzesanliegen: Die Mystik mittelalterlicher Christus-Johannes-Gruppen, Ostfildern 1994
Abb. 3
Hans Wentzel: Die Christus-Johannes-Gruppen des vierzehntenJahrhunderts, Berlin 1947
Abb. 4
http://museum.antwerpen.be/mayervandenbergh/index_eng.html, Stand: 15.03.2009
Abb. 5
Ansichts Sache. Das Bodemuseum Berlin im Liebieghaus Frankfurt, Hrg. Herbert Beck, Frankfurt am Main 2002
Abb. 8, 9, 10, 11, 12
Hanns Swarzenski: Quellen zum deutschen Andachtsbild, Zeitschrift für Kunstgeschichte 4, 1935, S. 141-144
13